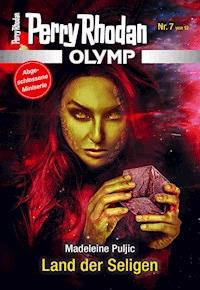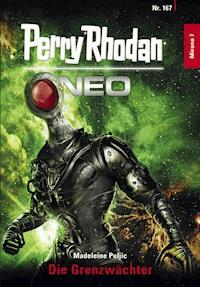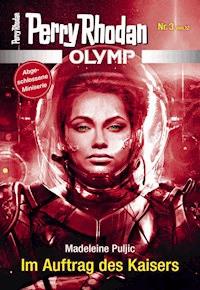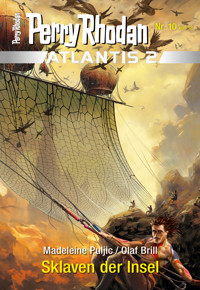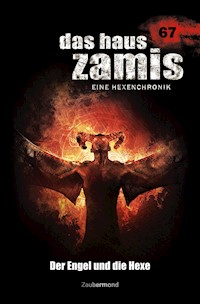
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zaubermond Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
Guardian und Coco befinden sich auf der Flucht vor dem Hohen Gremium. Auch Coco erfährt nun die Wahrheit, warum man ihr nachstellt – und weshalb Guardian sie begehrt. Aber ist sie wirklich eine Wiedergeburt Auroras – jener Geliebten, die Guardian in all den Jahrhunderten immer wieder aufs Neue schmerzlich verlor?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Engel und die Hexe
Band 67
Der Engel und die Hexe
von Madeleine Puljic und Logan Dee
nach einem Exposé von Uwe Voehl
© Zaubermond Verlag 2023
© »Das Haus Zamis – Dämonenkiller«
by Pabel-Moewig Verlag GmbH, Rastatt
Titelbild: Mark Freier
www.Zaubermond.de
Alle Rechte vorbehalten
Was bisher geschah:
Die junge Hexe Coco Zamis ist das weiße Schaf ihrer Familie. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht sie den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Auf einem Schwarzen Sabbat soll Coco endlich zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an. Doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut – umso mehr, da Cocos Vater Michael Zamis ohnehin mehr oder minder unverhohlen Ansprüche auf den Thron der Schwarzen Familie erhebt.
Nach jahrelangen Scharmützeln scheint endlich wieder Ruhe einzukehren: Michael Zamis und seine Familie festigen ihre Stellung als stärkste Familie in Wien, und auch Asmodi findet sich mit den Gegebenheiten ab. Coco Zamis indes hat sich von ihrer Familie offiziell emanzipiert.
Die intriganten Spiele, auch innerhalb der Zamis-Sippe, gehen unvermindert weiter.
In ihrer Halbschwester Juna findet Coco eine Gleichgesinnte: Auch Juna stößt das Treiben der Dämonen eher ab.
Unterdessen schart ein mächtiger Dämon weltweit Jünger um sich: Abraxas. Niemand weiß, was genau er bezweckt, doch selbst Asmodi, der amtierende Fürst der Finsternis, sieht in ihn einen gefährlichen Gegenspieler. Abraxas bedient sich in Wien eines treuen Vasallen: Monsignore Tatkammer.
Coco verlässt Wien. In Hamburg lernt sie Merle kennen, die sich als eine weitere ihrer Halbschwestern entpuppt. Da erreicht Coco der Todesimpuls ihrer Geschwister – Adalmar und auch Lydia werden Opfer von Tatkammers Intrigen.
Nun ist Coco gefragt, ihren Eltern beizustehen und den Tod der Geschwister zu rächen.
Sie tötet Monsignore Tatkammer, doch Abraxas erweckt ihn wieder zum Leben – wovon die Zamis aber zunächst nichts ahnen …
In Wien kommt es zum Showdown. Mit Abraxas‘ Macht im Rücken gelingt es Tatkammer, Coco wie eine Marionette zu benutzen und sie zu zwingen, ihr Elternhaus, die Villa Zamis, in Brand zu setzen. Ihre Eltern Thekla und Michael Zamis kommen in den magischen Flammen um. Auch ihr Bruder Georg und Juna befinden sich zu dem Zeitpunkt in der Villa. Ob sich die beiden haben retten können, ist nicht bekannt, jedenfalls sind sie spurlos verschwunden. Genauso wie Dorian Hunter, der Dämonenkiller und Cocos ehemaliger Liebhaber, der sich ebenfalls in dem Haus aufgehalten hatte.
Schwer verletzt erwacht Coco in einem Krankenhaus. Sie wird von dämonischen Schwestern und Ärzten gesund gepflegt und wohnt schließlich der Beerdigung ihrer Eltern bei, deren Seelen in einem Scheingrab auf einem Friedhof, der sich in einer anderen Dimension befindet, beigesetzt werden.
Wien ist nun in Abraxas‘ Hand. Wie überall immer mehr Mitglieder der Schwarzen Familie zu Abraxas überlaufen.
Coco hat von allem genug. Sie will nur noch ihren Frieden.
Sie setzt sich in einen Zug und fährt einem unbekannten Ziel entgegen …
Als der Zug auf offener Strecke hält und sie verwirrt aussteigt, trifft sie auf sechs weitere Reisende, die fortan ihr Schicksal bestimmen. Denn niemand ist der, der er zu sein vorgibt.
Es entbrennt ein tödlicher Kampf. Coco stirbt – und erwacht wieder zum Leben. Ein geheimnisvoller Fremder, der sich Guardian nennt, erklärt ihr, dass es sich um eine Prüfung handelte. Da sie sie nicht bestanden habe, müsse sie weitere zu meistern versuchen. Dahinter steckt das geheimnisvolle Hohe Gremium, für das nach eigenen Angaben weder Gut noch Böse existiert und das allein dafür sorgt, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt.
Coco besteht auch die nachfolgenden Prüfungen nicht. Sie wird auf den Dämonenfriedhof verbannt. Dort, so teilt ihr Guardian mit, wird sie so lange bleiben müssen, bis das Hohe Gremium endgültig über ihr Schicksal entschieden hat.
Zunächst jedoch kann Coco entkommen, doch wieder gerät sie in die Fänge des Gremiums.
Georg und Juna konnten dem von Coco gelegten Feuer entkommen. Georg ist voller Rachedurst. Auch ist er überzeugt, dass Coco die Schuldige ist. Da erscheint ihm Guardian, der ihm das Gegenteil beweisen will. Er weiß zudem, wo sich Coco aufhält: im Haus der schwarzen Tränen. Guardian glaubt in Coco die Reinkarnation seiner geliebten Aurora gefunden zu haben …
Mit Guardians Hilfe gelingt es Georg, Coco zu befreien. Ausgerechnet Asmodi kommt ihnen am Schluss zur Hilfe. Was treibt den Fürsten der Finsternis dazu? Will er womöglich etwas vertuschen?
Erstes Buch
Grausame Erinnerung
von Madeleine Puljic
nach einem Exposé von Uwe Voehl
Kapitel 1
Sentas Leichenstaub war mit ihrem Blut zu einer dicken Pampe verronnen, die unter meinen Absätzen schmatzte. Voller Zorn stiefelte ich über die Überreste meiner einstigen Freundin hinweg.
Ich hatte sie verschont. Das war es, was mich so wütend machte.
In einem Anflug von blödsinniger Sentimentalität hatte ich darauf verzichtet, meine Leidensgeschichte aus ihr herauszupressen. Dabei hätte sie mir endlich Einblicke geben können in die Zeit, die ich als Kind im Haus der schwarzen Tränen festgesessen hatte. In das, was man mir in diesem Gemäuer angetan und an das ich keine Erinnerung hatte. Aber nein, ich hatte sie laufen lassen, weil ich in ihr immer noch meine Jugendfreundin Senta Altmann gesehen hatte – und nicht Schwester Maria, die grausame Foltermeisterin, die alle zu braven Dämonen fürchteten.
Und was hatte ich jetzt davon? Sie war bloß noch Dreck! Und ich würde kein Sterbenswörtchen mehr aus ihr herausbekommen.
Am liebsten hätte ich auf Sentas Leichenbrei gespuckt, aber das hätte die Sauerei nur schlimmer gemacht, der mir ohnedies bereits an den kitschigen strassbesetzten High Heels klebte. Ich wischte mir die Sohle an der nächsten Treppenstufe ab, direkt neben einem abgerissenen Unterkiefer, der dort kopflos auf dem Stein lag und vor sich hinsaftelte. Es war zu deformiert, um zu erkennen, ob er einem der Dämonen gehört hatte, die mich hier gequält hatten. Aber im Zweifelsfall hatten sie das ohnehin alle getan. Mein Mitleid hielt sich also in Grenzen.
Es war an der Zeit, all das hier zurückzulassen. Das nuttige Outfit, das mir die jüngst verblichene Senta Altmann höchstpersönlich zusammengestellt hatte. Vor allem aber diese sogenannte Heilanstalt für unwillige Dämonen, in der ich einen ganzen verdammten Monat lang schikaniert worden war.
Und wenn es nach mir ging, hätte ich mich auch von meinen beiden Rettern verabschiedet, die hinter mir die Treppe aus dem Kellergewölbe emporkamen.
Mein Bruder Georg erreichte mich als Erster. »So.« Mit gekonntem Tritt beförderte er eine Ratte beiseite, die sich an dem Unterkiefer gütlich tun wollte. »Nachdem das erledigt ist, können wir ja nun endlich nach Wien aufbrechen.«
Nach Wien? Nichts lag mir ferner. Alles, was ich wollte, war meine Ruhe!
»Tut mir leid, Georg, aber diese Reise wirst du ohne mich antreten müssen.«
»Es reicht!« Grob packte mein Bruder mich am Arm und riss mich herum. »Du und Guardian, ihr glaubt wohl, mich endlos an der Nase herumführen zu können! Aber meine Geduld hat ein Ende, Coco, und zwar jetzt. Ich habe mich lange genug hinhalten lassen. Du kommst mit mir, und wenn ich deinen wertlosen Hintern mit Gewalt nach Wien schleifen muss!«
Ich riss mich los und warf ihm eine Flammenlanze entgegen. Er verschwand vor meinen Augen und tauchte im nächsten Augenblick auf den Stufen über mir wieder auf. Wut verzerrte seine Miene. Hätte er nicht in den schnelleren Zeitablauf gewechselt, hätte ich ihn erwischt. Dabei war das gar nicht meine Absicht gewesen. Er sollte bloß verschwinden.
»Du schleifst mich nirgendwohin, verstanden?« Ich hatte genug Demütigungen erlitten für die nächste Zeit. Von Georg würde ich sie nicht dulden. In Kindertagen hatten meine Geschwister mich oft genug drangsaliert. Weil ich nicht bösartig und kaltblütig genug war, weil ich im Gegensatz zu ihnen keinen Spaß daran hatte, Tiere oder meine Mitmenschen zu quälen. In den Augen meiner Familie war ich eine Schande.
Tja, was sollte ich dazu sagen? – Die meisten meiner Geschwister und auch meine Eltern waren inzwischen tot. Bei einigen war ich an ihrem Ableben – unfreiwillig zwar – zumindest beteiligt gewesen. Das sollte Georg lieber nicht vergessen.
»Wenn du meine Unterstützung willst«, erklärte ich, »mit Drohungen bekommst du sie nicht.«
»Na schön.« Er warf einen Blick die Treppe hinab. Lautlos wie ein Geist war die weiße Gestalt Guardians uns gefolgt. Die Schraubköpfe, die aus seinen verbundenen Augen ragten, richteten sich unverwandt auf meinen Bruder. Georg deutete auf seinen stillen Begleiter. »Was er mir vorgehalten hat, gilt ebenso für dich, Schwester. Ein jedes Sippenmitglied steht dem anderen im Falle einer Gefahr jederzeit zur Seite. So lauten die Regeln der Schwarzen Familie.«
»Richtig.« Ich schenkte ihm ein gehässiges Lächeln. »Aber es besteht nun mal keine akute Gefahr für unsere Sippe, oder, Bruder? Es existiert außer uns beiden niemand mehr aus dem engeren Familienkreis.« Ich verschwieg ihm, dass zumindest die Lebensfunken unserer Eltern noch aktiv waren. Und zwar in mir. »Es ist Rache, die dich nach Wien treibt. Die kannst du suchen, wenn du es nicht lassen kannst. Aber allein.«
Diesmal war es der tropfende Unterkiefer selbst, den er durch die Gegend schoss. Der morsche Knochen prallte gegen die Steinmauer und zersplitterte, sodass sich die schiefen Zähne in alle Richtungen verteilten.
»Und dein kleines Intermezzo mit Senta, das du unbedingt erledigen musstest?«, fauchte Georg. »Wozu haben wir uns durch dieses ganze Haus geprügelt? War das etwa keine Rache?«
Von seinem aggressiven Getue ließ ich mich nicht beeindrucken.
»Das war Informationsbeschaffung«, erwiderte ich kühl. »Und hätte ich gewusst, dass auch du über meinen damaligen Aufenthalt hier Bescheid weißt, hätten wir uns das sparen können!«
Das entsprach nur zum Teil der Wahrheit. Auch ohne meine Wissenslücken hätte ich Senta stellen wollen – ob nun aus Rache oder aus einem anderen Grund, darüber wollte ich im Augenblick nicht nachdenken.
Da Georg allerdings erst zum Ende des Gemetzels damit herausgerückt war, dass er zumindest einen Teil der Antworten auf meine Fragen kannte, hatte er es sich vollkommen selbst zuzuschreiben, wenn die Angelegenheit länger gedauert hatte, als er veranschlagt hatte.
»Darüber werden wir uns unterhalten müssen«, erklärte ich bestimmt. »Erst einmal will ich aus diesen Sachen raus.« Ich zupfte an meiner halb durchsichtigen Bluse, die mittlerweile auch noch mit Blut und anderen, geruchsintensiveren Körperflüssigkeiten bespritzt war. »So setze ich mich in keinen Zug.«
Vom Mondsee nach Wien waren es gute zweihundertfünfzig Kilometer, die wollte ich nicht als stinkende Prolonutte zurücklegen. Ich hatte nichts gegen aufreizende Kleidung, solange sie meinem Geschmack entsprach. Über Geschmack ließ sich jedoch bekanntermaßen streiten. Es hatte jedenfalls seine Gründe, weshalb Senta dieses Outfit zu meiner Bestrafung eingesetzt hatte.
Georg lachte knapp. »Welcher Zug denn? Du verbringst zu viel Zeit unter Menschen, werte Schwester. Davon abgesehen …« Er deutete auf seinen Begleiter, der immer noch kein Wort gesprochen hatte, seit wir meine ehemaligen Kerkermeister samt einem Gutteil meiner Mitgefangenen ausradiert hatten. »Mit Guardians Hilfe sind wir in wenigen Augenblicken in Hietzing. Du brauchst dich also überhaupt nicht aufzutakeln. Oder wen willst du beeindrucken? Ihn etwa?«
Die süffisante Art, mit der er dabei auf Guardian deutete, gefiel mir nicht.
»Danke, ich verzichte. Da fahre ich lieber mit dem Zug.« Ich wandte mich direkt an meinen zweiten Retter. »Von dir lasse ich mich jedenfalls nirgendwohin schleppen«, sagte ich Guardian in das bandagierte Gesicht. »Ich traue dir nicht. Diesmal hast du mir geholfen, schön und gut. Aber davor hast du mich diesem ominösen Hohen Gremium ausgeliefert, und die haben mich lebendig begraben lassen.« Neben mir zuckte Georg zusammen. »Und davor«, betonte ich, »hast du mich eigenhändig erstochen.«
»All das war notwendig«, beharrte Guardian.
»Das macht es nicht besser. Davon abgesehen hast du gerade vorhin erst vor meinen Augen jemanden getötet, der mir im vergangenen Monat beigestanden hat. War das etwa auch notwendig?«
Ich hatte wenig Mitleid mit Charles, immerhin hatte er mir kurz vor seinem Tod noch gestanden, dass er selbst zum Morden bereit war, wenn es ihm nur endlich die Freiheit bescherte. Das Haus der schwarzen Tränen hatte sein Werk an ihm vollbracht.
Aber mir ging es ums Prinzip. Ich akzeptierte keine Verbündeten, deren Beweggründe ich nicht kannte. Und das Verhalten meines Gegenübers war dermaßen undurchschaubar, dass ich bei ihm lieber doppelt und dreifach auf Nummer sicher ging.
Wieder einmal zeigte Guardian keine Emotion. »Dass der Vampir dir beigestanden hat, lag allein an meiner Suggestion«, behauptete er. »Ich war es, der ihm eingebläut hat, auf dich zu achten. Und dich mit auf seinen Freigang zu nehmen, damit wir, Georg und ich, dich retten konnten.«
»Ach ja?« Ich stemmte die Fäuste in die Seiten. Es war mir egal, dass ich dadurch vermutlich aussah wie die billige Dorfmatratze, die ihren zahlungsunwilligen Stecher zur Rede stellte. »Umso weniger Grund sehe ich, ihn zu töten.« Charles war einer von den netten Vampiren gewesen.
Zu Guardians fragwürdiger Moral passte das dafür umso besser. Hatte er nicht auch mir vorgegaukelt, dass er mir helfen wollte, nur um mich dann eigenhändig zu erdolchen? Charles war für ihn nur ein Werkzeug gewesen, das seinen Zweck erfüllt hatte. Also hatte er ihn entsorgt.
»Ich bleibe dabei. Ich traue dir kein Stück.« Und bei meinem eigenen Bruder lag die Sache auch nicht viel besser.
Guardian schüttelte den Kopf. »Du hast dich wirklich sehr verändert. Manchmal frage ich mich, ob … Aber nein. Ich irre mich nicht. Ich kann mich nicht irren!«
»Wovon sprichst du?«
Georg schnaubte ungeduldig. »Das spielt jetzt keine Rolle. Aussprechen könnt ihr euch später. Du willst Antworten von mir, Coco? Dann komm endlich mit nach Wien.«
»Ich sagte doch, dass ich Zeit brauche! Und eine Dusche. Und …«
Weiter kam ich nicht. Ein kräftiger Arm packte mich von der Seite. Im nächsten Augenblick wurde Georg an mich gequetscht, ebenso in Guardians Umklammerung gefangen wie ich.
Ich hörte ein Rauschen, wie von mächtigen Schwingen – und das Kellergewölbe um uns herum verschwand.
Nach einer heißen Dusche fühlte ich mich tatsächlich besser. Guardian hatte mir Kleidung in meiner Größe besorgt – ich fragte nicht, weshalb er die kannte oder woher die Sachen stammten. In meiner Situation musste man dankbar sein für Kleinigkeiten. Und die dunkle Hose und die dazu passende Bluse entsprachen immerhin mehr meinem Geschmack, auch wenn mir die Glitzer-High Heels vorerst erhalten blieben.
Ich setzte mich quer über den breiten Polstersessel, einen Arm um die Lehne gelegt, und schlug die Beine übereinander.
»Hier hast du also auf der Lauer gelegen?«, fragte ich meinen Bruder. Wir waren allein, von Guardian war nichts zu sehen.
Georg saß zurückgelehnt auf dem Sofa auf der anderen Seite des Glastischs, die Arme vor der Brust verschränkt, und beobachtete mich missmutig.
Mein Blick glitt über die Überreste diverser Liefermahlzeiten, die der Hotelzimmerservice noch nicht beseitigt hatte. »Charmant.«
»Treib es nicht zu weit, Coco. Denk nicht, dass ich dich von aller Schuld freispreche, nur weil du unter Tatkammers Einfluss gestanden hast, als du unsere Villa angezündet hast. Wärst du eine stärkere Hexe …«
Ich hörte ein gehässiges Lachen, irgendwo in meinem Hinterkopf, von dem ich nicht gänzlich sicher war, ob es bloß meiner Einbildung entsprang.
»Wenn ich so eine schwache Hexe bin, wozu brauchst du mich dann?« Ich beugte mich vor. »Wir sind uns fremd geworden, Georg. Warum fragst du nicht Juna?«
Zu meiner Überraschung zog Georg eine angewiderte Grimasse. Als er nichts erwiderte, fühlte ich zum ersten Mal Besorgnis. Ich setzte mich auf. »Wenn wir schon dabei sind – wo ist Juna?«, fragte ich. »Sie ist nicht tot, oder?« Ich hätte ihren Sterbeimpuls gespürt. Immerhin war sie meine Halbschwester.
»Sie lebt«, antwortete er so knapp, dass klar war, dass er nicht darüber reden wollte. Ich fügte diese Frage im Geiste zu der Liste der Dinge hinzu, über die wir definitiv reden mussten. Ohne Antworten würde ich meinen Bruder nicht freigeben.
Da ich jedoch ahnte, dass es an der Stelle kein Weiterkommen gab, jedenfalls nicht heute, schlug ich einen anderen Pfad ein. »Wie lange war ich damals fort? Im Haus der Tränen?«
Wieder verzog er den Mund. »Warum willst du diese alten Geschichten aufwärmen?«
»Ich bin nicht diejenige, die damit angefangen hat!«
Für irgendjemanden war meine Vergangenheit keineswegs vergangen. Und einer dieser Jemande hatte sich sogar die Mühe gemacht, eigenhändig eine Zeugin zu beseitigen.
Asmodi. Voller Verachtung dachte ich an die schwarze Schattengestalt mit den rot glühenden Augen. Immer wieder war es Asmodi, der in mein Leben reinpfuschte, und das stets zum Schlechteren. Das Haus der schwarzen Tränen war ihm gewidmet. Um widerspenstige Dämonen nach seinem Willen zu formen und ihnen eine schwarze Träne zu entlocken, mit der er sie kontrollieren konnte. In meinem Fall war das nicht gelungen, so viel hatte Georg verraten. Immerhin eine Sorge weniger. Das Letzte, was ich gebrauchen konnte, war ein derart mächtiges Manipulationsmittel in den Händen meines Widersachers.
Es erklärte jedoch nicht, weshalb Asmodi persönlich aufgetaucht war, um Senta zu töten. Ausgerechnet jetzt. Das war es, was mir an ihrem Tod am meisten zusetzte. Was hatte sie gewusst, das Asmodi unbedingt verheimlichen wollte? Was hätte sie mir verraten können?
Es mochte egozentrisch klingen, aber warum sonst sollte der Fürst der Finsternis ein Interesse daran haben, Senta zu vernichten, wenn nicht meinetwegen?
»Man hat mich zwei Mal ins Haus der schwarzen Tränen verfrachtet, und ich will wissen, warum.«
»Es dreht sich nicht alles um dich, Coco!«, brauste Georg auf. Er schlug so heftig auf den kniehohen Glastisch, dass er zerbarst. Georgs Hand blutete, aber er machte sich nicht die Mühe, einen Heilzauber zu wirken. Schwarze Tropfen fielen auf die Scherben und schenkten dem beigen Niederflorteppich darunter ein unregelmäßiges Muster, das mit jeder von Georgs wütenden Gesten einen weiteren Ausläufer gewann. »Abraxas hat unsere Familie nahezu ausgelöscht, und zwar mit deiner Hilfe! Ein wenig Schuldbewusstsein deinerseits wäre durchaus angebracht. Stattdessen tust du so, als würde dich das nichts angehen!«
Weil es so war, jedenfalls nach meinem Empfinden.
Natürlich war ich nicht stolz darauf, den Sitz meiner Familie abgefackelt zu haben, mit meinen Eltern, Geschwistern und sogar Dorian Hunter darin. Dass Abraxas mich dazu manipuliert hatte, machte ihn mir selbstverständlich nicht sympathisch, ich ließ mich nicht gern benutzen.
Und was interessierte es mich, welcher größenwahnsinnige Dämon sich gerade zum Oberhaupt der Schwarzen Familie aufschwang? Ich wollte mit der ganzen Bagage nichts zu tun haben! Asmodi war mir zuwider. Und meine Eltern hatten ja wohl eine ganz neue Art gefunden, mich zu quälen.
Hör gefälligst auf deinen Bruder, Coco!, vernahm ich die Stimme meines Vaters. Du bist immer noch eine Zamis. Nach allem, was wir deinetwegen erlitten haben, bist du es unserer Familie schuldig!
Du bist also auch noch da, entgegnete ich im Stillen. Die ganze Zeit über, während ich im Haus der schwarzen Tränen gefangen gehalten worden war, hatten die Lebensgeister meiner Eltern geschwiegen. Kaum war das Schlimmste vorüber, tauchte mein Vater wieder auf.
Warum habt ihr mir nicht geholfen, zu entkommen?
Für die Anwesenheit meines Bruders brauchte ich ihnen offensichtlich nicht zu danken.
Wer hätte ahnen können, dass du nicht imstande bist, dich aus einer solch banalen Situation selbst zu befreien?, grollte mein Vater.
Außerdem erschien es uns angebracht, einen … zweiten Versuch zuzulassen, fügte meine Mutter mit gewohnter Kälte hinzu. Es hätte doch sein können, dass es diesmal gelingt, eine richtige Hexe aus dir zu machen.
Das reicht!, rief ich sie zur Ordnung. Ich lasse mich nicht von euch beleidigen! Immerhin war das mein Körper, in den die beiden sich mit ihren Lebensgeistern eingenistet hatten wie zwei dicke kleine Bandwürmer.
An Georg gerichtet sagte ich: »Ich frage dich noch einmal: Wo ist Juna?«
Er war unserer Halbschwester bis in die Vergangenheit gefolgt, die beiden waren unzertrennlich. Und jetzt hatte er nichts als Grimassen für sie übrig?
»Sie liegt in deinem Grab, Coco.«
Erschrocken wirbelte ich herum. Wieder einmal war es Guardian gelungen, sich ohne jede Vorwarnung in meine unmittelbare Nähe zu begeben. Er stand aufrecht hinter meinem Polstersessel, so nah, dass ich den Rost an seinen blutigen Augenschrauben sehen konnte.
»Für euch beide hat Juna ihre Gabe eingesetzt«, verkündete Guardian ungerührt. »Es war jedoch nicht an ihr, deine Strafe zu beenden. Lebendig begraben auf ewig, so lautete das Urteil des Hohen Gremiums über dich, Coco. Juna wollte das umgehen. Nun nimmt sie deinen Platz ein.«
Ich war schockiert. Da hatte ich mich durch Ghoulsekret und Knochenberge gewühlt, um meinem Sarg zu entkommen – und nun lag Juna darin? Wie lange schon?
Ich sah zu meinem Bruder. Auch er schien von der Auskunft überrascht, doch seine Reaktion fiel gänzlich anders aus, als ich erwartet hatte.
»Na wenn schon«, murrte Georg. Er lehnte sich zurück, heilte nun endlich seine verletzte Hand und leckte sich das Blut vom Arm. »Dann hast du ja nun deine Antwort, Coco. Zufrieden?«
»Nein, selbstverständlich nicht!« Ich konnte nicht glauben, was ich da aus seinem Mund hörte. »Wie kann dich das so kalt lassen? Juna ist unsere Schwester!«
»Halbschwester«, korrigierte er mich.
»Und wenn schon. Sie ist eine Zamis, und sie ist in Gefahr. Die Regeln …«
»Hältst du mich für dumm, Schwesterherz?« Langsam erhob er sich und stieg über die Scherben des Tisches hinweg auf mich zu. Drohend blickte er auf mich herab. »Weshalb meinst du eigentlich, dich immer nur dann auf irgendwelche Regeln berufen zu können, wenn es zu deinem Vorteil gereicht?« Kurz zuckte sein Blick zu Guardian, nur um mich sogleich wieder zu fixieren. »Juna ist mir zuwider, und du auch. Ich habe dein Getue satt. Einen Monat lang habe ich mir den Hintern hier für dich plattgesessen, und du? Du undankbares Luder ziehst es doch nicht einmal in Erwägung, mir im Gegenzug ebenfalls Unterstützung zuzugestehen! Glaub nicht, dass ich es dir vergesse, wenn du mich nun im Stich lässt.«
Ich hob die Augenbrauen. »So wie du Juna?«
Ein leichtes Zucken seiner Mundwinkel verriet mir, dass ich ins Schwarze getroffen hatte.
»Auch sie wollte mich überreden, dir zu helfen.« Georg schnaubte. »Geh und erlöse sie, wenn du unbedingt willst. Tausch erneut den Platz mit deiner ach so teuren Juna. Mir ist es gleich, welche von euch auf dem Friedhof vermodert. Ich verschwende keine weitere Zeit mit euch.«
Er warf Guardian einen zornigen Blick zu. »Dich brauche ich ja wohl nicht zu fragen, ob du mitkommst.«
»Du kennst die Antwort, Georg Zamis.«
Georg spuckte ihm vor die Füße. »Dann bleib bei deiner Aurora. Versuch dein Glück. Du siehst ja jetzt, womit du es bei meiner Schwester zu tun hast. Ich bedaure nur, dass ich nicht zusehen kann, wenn dich das Hohe Gremium ein weiteres Mal bestraft.«
Kapitel 2
In einem Vorort von Lissabon, 1847
»Arosa?«
Das heisere Wispern in der Dunkelheit jagte ihr einen Schauer durch den Körper, der sich in ihrer Körpermitte zu einem erwartungsvollen Brennen zusammenballte. Rasch entzündete Arosa die Kerze, die ihr als Nachtlicht diente, und zog ihre Decke zurecht.
»Komm herein«, flüsterte sie.
Mit einem leisen Knarzen öffnete sich die Tür des Schlafgemachs, und Arosa seufzte.
Es war nicht ihr Gatte, der sie aufsuchte. Der war auf dem Nachbarhof, da Bartolomea Ribeiro in den Wehen lag und ihr Balg wohl heute endlich gebären würde – und er würde sich gewiss reichlich am Wein des stolzen Vaters gütlich tun. Er war also beschäftigt.
Sollte Francisco sich wider Erwarten diese Nacht doch noch auf den Rückweg in sein eigenes Heim machen, würde er vermutlich wieder einmal irgendwo betrunken im Graben landen und dort seinen Rausch ausschlafen, wie so oft. Arosa kannte das Prozedere.
Aber auch unter anderen Umständen hätte Francisco ihr keinen nächtlichen Besuch abgestattet. Die fromme Enthaltsamkeit, die ihm beim Saufen abging, kehrte er im Ehebett umso mehr heraus. Sein Glaube lehrte, dass der Beischlaf nur vollzogen werden durfte, um Kinder zu zeugen – und von Kindern hielt der trinksüchtige Arzt nichts.
Arosa war das nur recht. Sie würde ihm ohnehin keine schenken. Weder ihm noch einem anderen Mann.
»Gegrüßet seist du, Maria«, hauchte sie, während sie eine Hand bereits unter ihr Nachthemd gleiten ließ. Ihre eigene Berührung entlockte ihr das erste Stöhnen.
Marias Lippen, die sich auf ihre legten, rangen ihr das nächste ab.
Natürlich hieß das Mädchen nicht wirklich Maria. Den Namen hatte Francisco ihr gegeben, als er das Mädchen in der Gosse aufgegabelt und angeblich aus Mildtätigkeit aufgenommen hatte – genau wie einst sie, die er sogar geehelicht hatte. Er hatte Marias Fleiß und ihre Geschicklichkeit gelobt. Arosa dagegen bewunderte die seidige Haut, die dichten Wimpern um die dunklen, schwarzen Augen, die vollen Lippen und die zarten jungen Brüste mit den braunen Brustwarzen, die sie nun zwischen ihren Fingern rieb, bis sie hart und aufrecht standen.
Maria stöhnte nicht. Das tat sie nie, wenn sie beide zusammenlagen. Sie war allgemein sehr schweigsam. Dafür umso gewandter, was andere Fertigkeiten ihrer Zunge anging.
Gierig drückte Arosa den Kopf des Mädchens zwischen ihre eigenen Beine. Marias Hände umklammerten ihre Beine, wanderten weiter zu Arosas Pobacken und widmeten sich dem verbotenen Bereich dazwischen.
Arosa schob sich ihr entgegen. Sie kannte im Bett keine Zurückhaltung. Die Frömmigkeit überließ sie Francisco.
Genüsslich wand sie sich unter den Stößen, dem Kratzen und Saugen – bis sie aus dem Augenwinkel eine dunkle Gestalt zu sehen glaubte.
Mit einem Aufschrei stieß sie das Mädchen von sich, riss sich in derselben Bewegung die Decke an die Brust und sah sich hektisch um. Nichts. Nur das Flackern ihres Nachtlichts, das unstete Schattengespinste an die Wand warf. War der Schatten nur eine Einbildung gewesen, ihrem erhitzten Gemüt entsprungen?
»So schüchtern, Arosa? Du erstaunst mich.«
Die Stimme kam von direkt hinter ihr. Sie fuhr herum, und da stand er. Ein Mann, so schön, dass selbst Marias volle Lippen vergessen waren. Schlank, mit dunklen Locken, die ihm in die ebenmäßige Stirn fielen. Nur der leblose Ausdruck seiner Augen ließ sie schaudern.
»Wer bist du?« Sie bemühte sich, ihrer Stimme einen festen Klang zu verleihen. »Wie kommst du in mein Haus?« Und in mein Schlafgemach?
»Erkennst du mich denn nicht? Hast du mich so leicht vergessen?«
»Vergessen?« Sie blinzelte. Einen Moment lang schien es ihr, als würde seine Gestalt flimmern und den Blick freigeben auf einen schrecklich entstellten Mann, über und über mit Brandnarben bedeckt, die Augen gelbe unförmige Klumpen, Haare und Ohren von Flammen verschlungen. Das Bild verschwand so rasch, wie es gekommen war.
»Nein, ich …« Sie wollte ihm versichern, dass sie ihn nicht kannte, ganz gewiss noch nie gesehen hatte … Doch stimmte das? Sein Gesicht schien ihr mit einem Mal so vertraut wie das eigene. So kalt und bleich … wie der Tod.
»Anael«, wisperte sie.
Er nickte. »Ich starb für dich, Arosa.«
»Und ich für dich.« Das Wissen war da, schwappte über ihr zusammen wie dunkle Meeresfluten. Sie war immer noch Arosa de Noronha, Frau von Francisco, dem Arzt ihrer kleinen Gemeinde. Aber sie war auch Aurora, Dämonin und Engelsgeliebte. Sie war tot – und war es nicht.
Mit einem lauten Schluchzen sprang sie aus dem Bett. Nackt wie sie war, fiel sie ihm um den Hals, bedeckte sein Gesicht mit Küssen.
Irgendwo hinter ihr wimmerte Maria. Sie hatte sich beim Sturz aus dem Bett den Kopf gestoßen, saß nun benommen auf dem Boden und hielt sich die blutende Wunde. Aurora blickte auf das Mädchen hinab und fühlte Verachtung. Aber da war auch noch etwas anderes. Die Erinnerung an die Zuneigung, die Arosa für das Mädchen empfunden hatte. Und die Erregung, die immer noch durch das Blut in ihrem Körper wallte.
»Hör auf, zu flennen«, befahl sie ihr. »Siehst du nicht, wer das ist? Es ist der Engel der Liebe, der uns mit seiner Anwesenheit ehrt.«
»Ein … Engel, Arosa?«
»Herrin, für dich!«, schnauzte Arosa sie an. Ein kaltes Lächeln schlich sich auf ihr Gesicht. »Ja, ein Engel. Und er kann unbeschreibliche Lust schenken.« Sie ließ ihre Hände über ihren Körper wandern, drückte ihre Brüste hoch und leckte sich die Lippen. »Wollen wir sehen, ob er sich mit deinem Können messen kann? Ich bin mir sicher, bei ihm wirst du nicht schweigen.«
Damit stolzierte Aurora zurück zu Arosas Bett, legte sich rücklings darauf und spreizte auffordernd ihre Beine. »Komm zu mir, Maria. Du hast deine Aufgabe noch nicht zu Ende gebracht.«
Während sich Maria zitternd erhob, sich das Blut aus der Stirn wischte und folgsam vor ihr auf die Knie ging, verharrten Auroras Augen auf Anael. Auf seinem ausdruckslosen Gesicht, das kein Gefühl, keine Seele zeigte. Selbst als er sich entkleidete und auf das Hinterteil des Mädchens zuschritt, sein Schwanz mehr als bereit, ihr seine verfluchte Göttlichkeit unter Beweis zu stellen, offenbarte er keine Emotion. Nur die Grimasse der Anstrengung, die Männern beim körperlichen Akt eigen war, verriet seine Erregung, während er sich an Maria abarbeitete, sich immer fester in sie rammte.
Und Maria stöhnte nicht nur. Sie schrie, kreischte ihre Lust in Auroras Schoß, ohne dabei jedoch ihre Aufgabe zu vergessen.
Ihre Zungenfertigkeit war wirklich bemerkenswert.
Gegenwart
Keuchend riss ich die Augen auf. Ich war schweißgebadet, obwohl die Klimaanlage des Luxushotels mir eiskalte Luft entgegenspuckte. Die Hitze kam aus meinem Inneren. Genauer gesagt entsprang sie zwischen meinen Schenkeln, wo meine Finger im Schlaf hingewandert und emsig tätig geworden waren …
Wütend riss ich die Hand aus meinem Slip und wischte sie am Laken ab. Ich wollte aufspringen, um Guardian zur Rede zu stellen – denn nur er konnte es gewesen sein, der mir die Vision aufgezwungen hatte –, doch meine Beine gehorchten nicht. Selbst im Wachzustand hielt die Vision an. Weitere Bilder drängten sich mir auf, ebenso real wie das Bett, auf dem ich lag. Ich sah, wie das Hohe Gremium die traute Dreisamkeit rund um Aurora und Guardian störte. Hörte Anaels Schreie, als sie ihm den Schwanz abrissen, fühlte den Druck im Hals, als sie das schrumpfende Glied in Auroras Mund stopften und es tiefer und tiefer hineinpressten, bis sie an dem offenbar sterblichen Organ elendiglich erstickte.
Ich würgte und hustete, versuchte mich von den Eindrücken zu befreien. Doch die Vision endete erst, als Aurora ihren letzten Atemzug getan hatte.
Dann endlich gab sie mich frei. Bebend kauerte ich auf der durchfeuchteten Matratze, und mit jedem meiner gequälten Atemzüge schwoll meine Wut auf Guardian weiter an.
Ich brüllte seinen Namen.
Wie konnte er es wagen? Glaubte er etwa, mich mit solch billigen Tricks für sich gewinnen zu können?