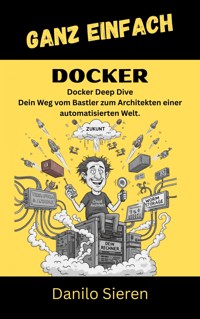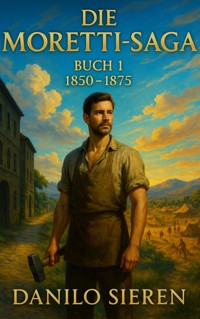7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Budapest, 2003. Als die Journalistin Elena Kovács in einem verstaubten Archiv auf den Restaurator Aron Németh trifft, ahnt sie nicht, dass diese Begegnung ihr Leben für immer verändern wird. Aron sucht verzweifelt nach einem gestohlenen Gemälde – dem letzten Werk seines Großvaters István, gemalt 1944 im Schatten von Auschwitz. Was als journalistische Recherche beginnt, wird zu einer gefährlichen Jagd durch halb Europa. Von Wien über Monaco bis nach Dubai folgen Elena und Aron der Spur des verschollenen Meisterwerks. Doch sie finden mehr als nur ein Gemälde. Sie entdecken eine Liebesgeschichte, die den Holocaust überdauerte, eine Familie, die sich weigerte zu vergessen, und ein Vermächtnis, das sechs Generationen überspannt. Eine epische Familiensaga über Kunst, Erinnerung und die Macht der Liebe – erzählt über 136 Jahre, von 1944 bis 2080.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
❦
✦❧✦❧✦
Das Herz der Erinnerung
✦❧✦❧✦
❦
Ein Liebesroman
Danilo Sieren
❧
Weitere Bücher vom Autor
✦❧✦
❧
Die Stille Zeugin (Thriller)
Ein atemberaubender Tech-Thriller über die dunkle Seite künstlicher Intelligenz, über
Macht, Täuschung und die Frage: Wem können wir trauen, wenn selbst Maschinen
lügen können?
Budapest Protokoll (Thriller)
Die Reihe ist multiperspektivisch erzählt, visuell komponiert und dramaturgisch klar
gegliedert. Sie richtet sich an Leser und Leserin, die politische Spannung mit
literarischer Tiefe suchen, und verbindet retro-investigative Ästhetik mit
psychologischer Resonanz.
Band 1 Schwarze Donau
Band 2 Rote Brücke
Band 3 Das Archiv
Das Archiv des Verbrechens (Krimi)
Zehn Fälle. Zehn Einblicke in eine Welt, die sich selbst schützt.
Mord, Manipulation, Machtmissbrauch – nichts ist, wie es scheint.
Dies ist kein Krimi für nebenbei.
Dies ist ein Archiv.
Und es beginnt jetzt.
Band 1: Die ersten zehn Fälle
Band 2: Die nächsten zehn Fälle
Band 3: Tiefer als zuvor
Band 4: Kein Zurück
Band 5: Letzte Wahrheit
❧
Impressum
✦
Danilo Sieren
Württembergerstr.44
44339 Dortmund
Kapitel 1
Der Auftrag
Kapitel 2
Die Villa am Fluss
Kapitel 3
Die Briefe
Kapitel 4
Wiedersehen
Kapitel 5
Die Enthüllung
Kapitel 6
Nacht in Wien
Kapitel 7
Schatten der Vergangenheit
Kapitel 8
Die Restaurierung beginnt
Kapitel 9
Die Entdeckung
Kapitel 10
Stimmen aus der Vergangenheit
Kapitel 11
Der Riss
Kapitel 12
Das Archiv
Kapitel 13
Die Wahl
Kapitel 14
Die Heimkehr
Kapitel 15
Der Schatten
Kapitel 16
Die Konfrontation
Kapitel 17
Die Jagd
Kapitel 18
Der Sammler
Kapitel 19
"Wie?"
Kapitel 20
Die Rückkehr
Kapitel 21
Neue Kapitel
Kapitel 22
Verborgene Wahrheiten
Kapitel 23
Die Prüfung
Kapitel 24
Das Leben
Kapitel 25
"Kann ich auch malen?"
Kapitel 26
Die nächste Generation
Kapitel 27
"An was besonders?"
Kapitel 28
Der Kreis schließt sich
Kapitel 29
"Die besten! Ich bin schwanger!"
Kapitel 30
Epilog: Das ewige Vermächtnis
Kapitel 31
Impressum
❦
✦❧✦❧✦
Kapitel 1
Der Auftrag
✦❧✦
❧
Budapest empfing mich mit grauem Nieselregen und dem bittersüßen Duft von gerösteten Kastanien. Ich stand am Ufer der Donau, den Kragen meines Mantels hochgeschlagen, und betrachtete das Parlamentsgebäude auf der gegenüberliegenden Seite. Die gotischen Türme verschwammen im Nebel, als wollten sie mir ein Geheimnis erzählen, das ich noch nicht zu hören bereit war.
Es war Oktober, und die Stadt zeigte sich in ihrem melancholischsten Gewand. Die Blätter an den Bäumen hatten ihre Farbe gewechselt, von sattem Grün zu brennendem Orange und tiefem Rot. Sie fielen langsam zur Erde, wie kleine Abschiede, die niemand bemerkte. Ich liebte Budapest in dieser Jahreszeit. Es war die Zeit, in der die Stadt ihre Maske ablegte und ihr wahres Gesicht zeigte – alt, weise, von Geschichte durchdrungen.
Ich war vor drei Jahren nach Berlin gezogen. Die deutsche Hauptstadt hatte mir alles gegeben, was ich brauchte: einen guten Job als Kulturjournalistin, eine kleine Wohnung in Kreuzberg, Anonymität. Aber Budapest blieb meine Heimat. Die Stadt, in der ich geboren wurde, in der mein Vater sein Geschäft hatte, in der jede Straßenecke eine Erinnerung beherbergte.
Mein Vater. András Kovács. Kunsthändler, Liebhaber alter Meister, Geschichtenerzähler. Er war vor fünf Jahren gestorben, plötzlich und unerwartet, an einem Herzinfarkt. Ich hatte ihn gefunden, in seinem Laden, zwischen den Gemälden, die er so liebte. Es war, als wäre ein Teil von mir mit ihm gegangen.
"Elena Kovács?"
Die Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Ich drehte mich um und sah einen Mann, der sich näherte. Er war Mitte vierzig, schätzte ich, mit grauen Schläfen und einem eleganten dunklen Anzug, der perfekt saß. Seine Schuhe waren poliert, seine Krawatte dezent. Alles an ihm sprach von Erfolg und Kontrolle.
"Viktor Lenz", stellte er sich vor und streckte mir die Hand entgegen. Sein Händedruck war fest, aber nicht aufdringlich. Seine Augen waren grau und musterten mich aufmerksam. "Danke, dass Sie so kurzfristig gekommen sind."
Ich nickte knapp. "Ihr Anruf hat mich neugierig gemacht."
Viktor Lenz war Galerist in Wien, spezialisiert auf osteuropäische Kunst des 20. Jahrhunderts. Sein Anruf vor drei Tagen hatte mich überrascht. Er suchte jemanden für eine Recherche über ein verschollenes Gemälde, und mein Name war ihm von einem Kollegen empfohlen worden. Er hatte keine Details am Telefon preisgegeben, nur gesagt, dass es sich um ein bedeutendes Werk handle und dass er jemanden brauche, der sich in Budapest auskenne.
"Das Café ist gleich um die Ecke", sagte er und deutete auf eine schmale Gasse, die vom Donauufer wegführte. "Dort können wir in Ruhe sprechen. Und ich möchte Ihnen etwas zeigen."
Wir gingen schweigend durch die Straßen. Der Regen hatte aufgehört, aber die Luft war noch feucht und kühl. Budapest roch nach nassem Asphalt und Herbst, nach Zigaretten und frisch gebackenem Brot aus den kleinen Bäckereien, die es an jeder Ecke gab.
Das Café war ein verstecktes Juwel, wie man es nur in Budapest fand. Von außen unscheinbar, innen aber voller Charme. Die Wände waren mit alten Fotografien tapeziert – Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Budapest vor dem Krieg, von Menschen in altmodischer Kleidung, von Straßenbahnen und Pferdefuhrwerken. Die Möbel waren abgenutzt, aber gemütlich, und über allem lag der Duft von starkem Kaffee und süßem Gebäck.
Wir setzten uns an einen Tisch in der Ecke, wo wir ungestört sprechen konnten. Viktor bestellte zwei Kaffee und ein Stück Dobos-Torte, die berühmte ungarische Schokoladentorte. Dann lehnte er sich zurück und sah mich an.
"Haben Sie schon einmal von 'Frau mit rotem Schleier' gehört?"
Ich schüttelte den Kopf. Der Name sagte mir nichts, aber etwas in meinem Inneren regte sich, ein leises Gefühl der Vorahnung.
Viktor zog einen Laptop aus seiner Tasche und öffnete ihn. "Es ist ein Gemälde, geschaffen 1943 von einem ungarischen Künstler namens István Németh. Das Bild zeigt eine Frau in einem roten Schleier, gemalt in einem sehr emotionalen, fast expressionistischen Stil. Die Farben sind intensiv, die Pinselführung kraftvoll. Es ist ein Meisterwerk – oder wäre es, wenn man es finden könnte. Denn es ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschollen."
Er drehte den Laptop zu mir, und ich sah eine digitalisierte Schwarz-Weiß-Fotografie. Trotz der mangelnden Farbe konnte ich die Kraft des Gemäldes erkennen. Eine Frau, deren Gesicht zur Hälfte von einem Schleier verdeckt wurde. Ihre Augen waren groß und dunkel, voller Traurigkeit und doch voller Würde. Es war, als würde sie direkt in meine Seele blicken.
"Beeindruckend", murmelte ich.
"Nicht wahr? István Németh war ein außergewöhnlicher Künstler. Er studierte in Paris, war von den Expressionisten beeinflusst, entwickelte aber einen ganz eigenen Stil. Seine Werke sind heute selten und wertvoll. Aber 'Frau mit rotem Schleier' ist sein bedeutendstes Werk. Es wurde nie öffentlich ausgestellt, nie verkauft. Es verschwand einfach."
Die Bedienung brachte unseren Kaffee. Ich nahm einen Schluck und genoss die Bitterkeit, die meine Sinne schärfte.
"Und Sie möchten, dass ich es finde?", fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte. "Nach über siebzig Jahren?"
Viktor lächelte. Es war ein kalkuliertes Lächeln, das seine Zähne zeigte, aber nicht seine Augen erreichte. "Nicht unbedingt das Gemälde selbst, obwohl das natürlich ideal wäre. Aber ich hätte gerne mehr Informationen darüber. Wo es sich befunden hat, wem es gehörte, ob es noch existiert oder zerstört wurde. Ich habe einen Käufer, der sehr interessiert ist. Ein Sammler, der bereit wäre, einen beträchtlichen Betrag zu zahlen – vorausgesetzt, wir können das Werk lokalisieren."
"Wie beträchtlich?"
"Mehrere hunderttausend Euro. Vielleicht mehr, je nach Zustand und Provenienz."
Ich pfiff leise durch die Zähne. Das war tatsächlich eine beträchtliche Summe.
"Warum gerade ich?", fragte ich. "Es gibt sicher erfahrenere Kunstdetektive."
Viktor lehnte sich vor. "Weil Sie aus Budapest stammen. Weil Ihr Vater András Kovács war, ein angesehener Kunsthändler, der die Szene hier kannte. Weil Sie Ungarisch sprechen, die Kultur verstehen, Zugang zu Archiven haben. Und weil Sie eine hervorragende Journalistin sind mit einem Gespür für Geschichten." Er zog einen Umschlag aus seiner Tasche und schob ihn über den Tisch. "Das ist alles, was ich bisher habe. Schwarz-Weiß-Fotografien, ein paar Notizen, Kopien von alten Dokumenten. Nicht viel, aber ein Anfang."
Ich zögerte. Etwas in mir warnte mich davor, den Umschlag zu öffnen. Aber die Neugier war stärker. Ich nahm ihn in die Hand – er war schwer, gefüllt mit Papieren – und öffnete ihn langsam.
Drei Fotografien glitten heraus und landeten auf dem Tisch. Die erste zeigte das Gemälde, das ich bereits auf dem Laptop gesehen hatte. Die zweite eine Villa am Flussufer, ein elegantes zweistöckiges Gebäude im Jugendstil mit verschnörkelten Balkonen und hohen Fenstern. Es hatte etwas Majestätisches, aber auch etwas Verlorenes, als wäre es aus der Zeit gefallen.
Und dann die dritte Fotografie.
Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Eine junge Frau stand vor der Villa, lächelnd, die Hand in die Hüfte gestemmt. Sie trug ein sommerliches Kleid und hatte dunkles, gewelltes Haar. Ihr Gesicht war mir vertraut – zu vertraut. Sie sah aus wie ich. Oder besser gesagt, wie eine jüngere Version meiner Mutter. Die gleichen hohen Wangenknochen, die gleichen dunklen Augen, der gleiche schmale Mund.
"Was ist?" Viktors Stimme klang besorgt. "Sie sind ganz blass geworden."
Ich zwang mich zu einem Lächeln und legte die Fotografie zurück auf den Tisch. Meine Hand zitterte leicht. "Nichts. Nur... die Villa kommt mir bekannt vor."
Das war gelogen. Die Villa kam mir nicht nur bekannt vor – ich war dort gewesen. Als Kind, mit meinem Vater. Es war einer jener Sommertage gewesen, an denen die Hitze über Budapest lag wie eine Decke. Mein Vater hatte einen Termin gehabt, und ich hatte ihn begleitet. Ich erinnerte mich an den verwilderten Garten, an die Statuen zwischen den Bäumen, an das Gefühl, an einem magischen Ort zu sein.
Aber was hatte mein Vater dort gemacht? Und wer war die Frau auf dem Foto?
„Gut“ sagte Viktor und lehnte sich zufrieden zurück. "Dann nehmen Sie den Auftrag an?"
Ich starrte auf das Foto in meiner Hand. Die Frau lächelte mich an, als würde sie mich herausfordern, ihr Geheimnis zu lüften. Etwas in mir wusste, dass dies kein gewöhnlicher Auftrag war. Dies war eine Tür, die sich öffnete – zu einer Vergangenheit, die ich nie vollständig verstanden hatte. Zu Fragen, die ich nie gestellt hatte.
"Was ist mit dem Honorar?", fragte ich, um Zeit zu gewinnen.
"Fünftausend Euro für die Recherche, unabhängig vom Ergebnis. Wenn Sie das Gemälde finden oder substanzielle neue Informationen liefern, kommt ein Bonus von weiteren fünfzehntausend dazu."
Das war mehr als großzügig. Es würde meine finanzielle Situation für Monate stabilisieren. Aber das Geld war nicht der Grund, warum ich zusagen wollte. Es war die Fotografie. Es war das Gefühl, dass diese Geschichte mich etwas anging.
"Ja", hörte ich mich sagen. "Ich nehme an."
Viktor lächelte breit. "Ausgezeichnet. Ich habe einen Vertrag vorbereitet." Er zog weitere Papiere aus seiner Tasche. "Lesen Sie ihn durch, und wenn alles in Ordnung ist, können Sie hier unterschreiben."
Ich überflog den Vertrag. Er war standardmäßig – Geheimhaltung, Zahlungsmodalitäten, Zeitrahmen. Nichts Ungewöhnliches. Ich unterschrieb mit zitternder Hand.
"Wunderbar." Viktor steckte seine Kopie des Vertrags ein und stand auf. "Ich bin die nächsten Tage in Wien erreichbar. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie weitere Ressourcen benötigen."
Wir verabschiedeten uns, und ich blieb allein im Café zurück. Die Fotografien lagen vor mir auf dem Tisch. Ich bestellte noch einen Kaffee und begann, die anderen Dokumente im Umschlag durchzusehen.
Es waren Kopien aus alten Archiven. Eine Liste von Gemälden, die István Németh geschaffen hatte. Zeitungsartikel aus den 1930er und frühen 1940er Jahren, die seine Ausstellungen besprachen. Ein Brief, datiert auf März 1944, in dem jemand namens Klára Németh an einen Freund schrieb und um Hilfe bat.
Ich las den Brief mehrmals. Die Handschrift war elegant, aber hastig, als wäre er unter Druck geschrieben worden. Klára schrieb von Angst, von der Notwendigkeit zu fliehen, davon, dass sie etwas Wertvolles in Sicherheit bringen musste. Sie erwähnte das Gemälde nicht direkt, aber zwischen den Zeilen konnte ich ihre Verzweiflung spüren.
Wer war Klára Németh? Die Frau des Künstlers? Seine Schwester? Und war sie die Frau auf dem Gemälde?
Ich packte alles wieder in den Umschlag und verließ das Café. Draußen hatte es wieder zu regnen begonnen, ein feiner Sprühregen, der sich wie Nebel über die Stadt legte. Ich schlug den Kragen meines Mantels hoch und machte mich auf den Weg zu meinem Hotel.
Aber meine Gedanken waren nicht beim Weg. Sie kreisten um die Villa, um die Frau auf dem Foto, um die Frage, warum mein Vater nie von diesem Ort erzählt hatte. Hatte er etwas gewusst? Hatte er nach dem Gemälde gesucht?
Ich beschloss, am nächsten Morgen zur Villa zu fahren. Vielleicht würde ich dort Antworten finden. Oder vielleicht nur mehr Fragen.
In dieser Nacht träumte ich von der Frau mit dem roten Schleier. Sie stand in einem dunklen Raum, beleuchtet von Kerzenlicht, und sah mich mit ihren großen, traurigen Augen an. Sie öffnete den Mund, als wolle sie etwas sagen, aber ich konnte sie nicht hören. Und dann begann sie zu weinen, und ihre Tränen waren rot wie Blut.
Ich wachte schweißgebadet auf, mein Herz hämmerte in meiner Brust. Das Hotelzimmer war dunkel und still. Draußen regnete es noch immer. Ich stand auf, ging zum Fenster und blickte hinaus auf die nächtliche Stadt.
Budapest schlief, aber ich konnte die Geschichte spüren, die unter der Oberfläche pulsierte. Die Geschichten der Menschen, die hier gelebt hatten, geliebt hatten, gelitten hatten. Die Geschichte meiner eigenen Familie, die ich nie wirklich gekannt hatte.
Und irgendwo in dieser Stadt, verborgen und vergessen, wartete ein Gemälde darauf, gefunden zu werden. Ein Gemälde, das Geheimnisse bewahrte, die jemand nicht preisgeben wollte.
Ich kehrte ins Bett zurück, aber ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich lag wach bis zum Morgengrauen, und als die ersten Strahlen der Sonne durch die Vorhänge fielen, stand ich auf und bereitete mich auf den Tag vor.
Es war Zeit, zur Villa zu fahren.
Zeit, Antworten zu finden.
❦
✦❧✦❧✦
Kapitel 2
Die Villa am Fluss
✦❧✦
❧
Die Adresse führte mich in einen ruhigen Vorort Budapests, wo sich die Straßen zwischen verwilderten Gärten und bröckelnden Villen hin durchwanden. Óbuda, hieß dieser Stadtteil – das alte Buda. Es war eine Gegend, die einst wohlhabend gewesen sein musste, in der die Elite der Stadt ihre Sommerresidenzen hatte. Jetzt war sie ein Schatten ihrer selbst – die Mauern waren rissig, die Gärten überwuchert, und über allem lag eine Atmosphäre des Verfalls und der Melancholie.
Ich fuhr langsam durch die engen Straßen, vorbei an Häusern, die aussahen, als hätten sie seit Jahrzehnten niemanden mehr gesehen. Ein alter Mann saß auf einer Bank vor einem der Häuser, eine Zeitung auf dem Schoß. Er blickte nicht auf, als ich vorbeifuhr. Eine Katze – getigert, mit einem zerrissenen Ohr – huschte über die Straße und verschwand im Unterholz. Manche Häuser hatten verschlossene Fensterläden, andere standen komplett leer, ihre Fassaden von Efeu überzogen wie von grünen Spinnennetzen. Die Luft roch nach feuchtem Laub und vergangenem Glanz, nach einer Zeit, die unwiederbringlich verloren war.
Die Villa stand in der Ráth György utca, Nummer 17. Ein Straßenschild, halb verrostet, lehnte schief an einem Laternenpfahl. Ich parkte meinen Mietwagen – einen kleinen blauen Škoda – am Straßenrand und stieg aus.
Das Grundstück war von einer hohen Steinmauer umgeben, mindestens drei Meter hoch, über die sich Efeuranken ergossen wie grüne Wasserfälle. Das schmiedeeiserne Tor war kunstvoll gearbeitet, mit Ranken und Blüten verziert, aber der Rost hatte seine Spuren hinterlassen. Braune Flecken überzogen das Metall wie Krankheit. Ich legte meine Hand auf das kalte Eisen und drückte. Das Tor gab mit einem leisen, klagenden Quietschen nach, als hätte es seit Jahren auf jemanden gewartet, der es öffnete.
Der Garten war ein Dschungel. Was einst sorgfältig angelegte Beete gewesen sein mochten, war nun eine wilde Mischung aus Rosenbüschen, die sich zu undurchdringlichen Hecken ausgebreitet hatten, und Bäumen, deren Äste sich zu einem dichten Blätterdach verwoben. Ein alter Kastanienbaum dominierte die Mitte des Gartens, sein Stamm dick wie ein Auto, seine Wurzeln brachen durch den Boden wie die Knochen der Erde. Zwischen den Pflanzen lagen umgestürzte Statuen – eine kopflose Venus aus weißem Marmor, ihr Körper von Moos bedeckt, ein geflügelter Amor, dessen Flügel abgebrochen waren und nun im Gras lagen. Ein steinerner Satyr grinste mich an, halb verborgen hinter einem Rosenstrauch. Sie lagen da wie gefallene Götter, vergessen von der Zeit.
Ich bahnte mir einen Weg durch das Dickicht. Spinnenweben streiften mein Gesicht – feucht, klebrig, unangenehm. Ich wischte sie weg und schauderte. Dornen verfingen sich in meinem schwarzen Mantel und hinterließen kleine Risse. Der Boden war weich und feucht, bedeckt mit einer dicken Schicht aus verrottenden Blättern, die bei jedem Schritt leise knirschten. Es roch nach Erde und Pilzen, nach Verfall und doch auch nach Leben – nach dem unaufhaltsamen Kreislauf der Natur, die sich zurückholte, was der Mensch aufgegeben hatte.
Und dann sah ich die Villa.
Sie stand da wie aus einem Traum – oder einem Albtraum. Ein zweistöckiges Gebäude im Jugendstil, mit verschnörkelten Balkonen, deren Geländer mit floralen Motiven verziert waren, und hohen Fenstern mit bunten Glasscheiben, die wie blinde Augen in die Welt starrten. Die Fassade war einst weiß gewesen, cremeweiß mit goldenen Akzenten, aber jetzt war sie grau und fleckig, von Feuchtigkeit und Efeu gezeichnet. An manchen Stellen blätterte der Putz ab und gab das nackte Mauerwerk frei, rötliche Ziegel, die aussahen wie Wunden.
Die meisten Fensterläden waren geschlossen, ihre grüne Farbe verblichen zu einem moosigen Grau. Aber eines – ein Fenster im ersten Stock, links – stand offen und schlug leise im Wind. Ein rhythmisches Klopfen, langsam und regelmäßig, wie ein Herzschlag. Wie ein Ruf.
Ich stand einen Moment lang einfach nur da und starrte. Die Erinnerung an meinen Besuch als Kind kam zurück – vage, verschwommen, wie ein Traum, den man beim Aufwachen vergisst, aber der trotzdem eine Spur hinterlässt. Ich war sieben oder acht gewesen, im Hochsommer, an einem Tag, an dem die Hitze über Budapest lag wie eine schwere Decke. Mein Vater hatte mich an der Hand genommen – ich spürte noch immer seine große, warme Hand um meine kleine – und hatte mich durch genau diesen Garten geführt. Damals war er noch gepflegt gewesen, mit ordentlichen Kieswegen, die unter unseren Füßen knirschten, und blühenden Blumen – Rosen, Hortensien, Lilien. Der Satyr hatte noch an seinem Platz gestanden, und ich hatte mich vor ihm gefürchtet.
Wir waren ins Haus gegangen, und ich erinnerte mich an dunkle Räume, an den Geruch von altem Holz und Lavendel, an Stimmen, die flüsterten. Mein Vater hatte mit jemandem gesprochen – einem Mann? Einer Frau? Das Bild war verschwommen. Aber ich erinnerte mich an das Gefühl: Ehrfurcht. Als wären wir in einer Kirche. Als wären wir an einem Ort, der heilig war.
Aber warum waren wir hier gewesen? Und mit wem hatte mein Vater gesprochen?
"Kann ich Ihnen helfen?"
Die Stimme ließ mich zusammenzucken. Mein Herz machte einen Sprung, und ich fuhr herum, die Hand instinktiv zur Brust geführt.
Ein Mann stand am Rand des Gartens, etwa zehn Meter entfernt. Er hatte die Hände in den Taschen einer abgewetzten braunen Lederjacke vergraben und beobachtete mich mit einem Ausdruck, der irgendwo zwischen Misstrauen und Neugier lag.
Er war groß, vielleicht einen Meter fünfundachtzig, schlank, aber nicht dünn – eher athletisch, mit breiten Schultern unter der Jacke. Sein Haar war dunkel, fast schwarz, mit einem Hauch von Braun in der Sonne, und fiel ihm unordentlich in die Stirn. Er trug es etwas zu lang, als hätte er vergessen, zum Friseur zu gehen, oder als wäre es ihm egal. Seine Augen waren das Erste, was mir wirklich auffiel – graugrün, wie Seewasser an einem bewölkten Tag, oder wie Moos auf Stein. Sie musterten mich aufmerksam, abschätzend, aber nicht unfreundlich. Sein Gesicht war markant, mit hohen Wangenknochen, die Schatten warfen, einem starken Kinn mit einem Hauch von Bartstoppeln, und einer Nase, die einmal gebrochen gewesen sein musste, denn sie war leicht schief. Er sah aus wie Mitte, vielleicht Ende dreißig.
Er trug Jeans, abgenutzt und an den Knien ausgeblichen, und braune Lederstiefel, die aussahen, als hätten sie viele Wege zurückgelegt. Um seinen Hals hing eine dünne silberne Kette – ich konnte nicht erkennen, ob etwas daran hing. Seine Hände, die er jetzt aus den Taschen zog, waren groß, mit langen Fingern. Arbeitshände. Unter seinen Fingernägeln sah ich Spuren von etwas Dunklem – Farbe? Erde?
"Ich... suche nach Informationen über dieses Haus", sagte ich und versuchte, meine Fassung wiederzuerlangen. Mein Herz klopfte noch immer schneller als normal. "Entschuldigung, ich wollte nicht eindringen."
Er trat näher, langsam, bedächtig, als wolle er mich nicht erschrecken. Oder als wäre er sich nicht sicher, ob ich eine Bedrohung darstellte. Seine Schritte waren leise, trotz der Stiefel. "Journalistin?", fragte er. Seine Stimme war tief, ein bisschen rau, als würde er nicht oft sprechen.
Ich war überrascht. "Wie haben Sie...?"
Ein schwaches Lächeln huschte über sein Gesicht, erreichte aber nicht seine Augen. Sie blieben wachsam, ein wenig traurig. "Sie haben diese typische Art, sich umzusehen. Als würden Sie alles aufnehmen, katalogisieren, für später speichern. Als würden Sie eine Geschichte suchen." Er deutete auf das kleine Notizbuch, das aus meiner Manteltasche ragte – ein schwarzes Moleskine, abgegriffen von Gebrauch. "Und Sie tragen eine Kamera um den Hals."
Ich blickte hinunter. Meine Canon hing tatsächlich an ihrem Riemen, gegen meine Brust. Ich hatte sie gar nicht bewusst wahrgenommen.
Ich musste unwillkürlich lächeln. "Erwischt. Elena Kovács." Ich streckte ihm die Hand entgegen.
Er zögerte einen Moment – ich sah, wie seine Augen auf meine Hand wanderten, dann zu meinem Gesicht –, dann ergriff er sie. Sein Händedruck war fest, seine Hand warm und ein wenig rau. "Aron Németh."
Németh. Wie der Künstler. Mein Herzschlag beschleunigte sich erneut.
"Sie... Sie sind verwandt mit István Németh?", fragte ich vorsichtig. Ich ließ seine Hand nicht sofort los, und er zog sie auch nicht zurück. Für einen Moment standen wir so da, verbunden durch diese einfache Geste.
Seine Miene verfinsterte sich unmerklich. Die Schatten unter seinen Wangenknochen vertieften sich. Er ließ meine Hand los und trat einen Schritt zurück. "Mein Großvater. Woher wissen Sie von ihm?"
Ich wählte meine Worte sorgfältig. "Ich recherchiere über eines seiner Gemälde. 'Frau mit rotem Schleier'. Haben Sie davon gehört?"
Für einen Moment – nur einen winzigen Moment – sah es aus, als würde er sich einfach umdrehen und gehen. Seine Kiefermuskeln spannten sich an, und in seinen Augen flackerte etwas – Wut? Schmerz? Angst? Ich konnte es nicht deuten. Er ballte die Hände zu Fäusten, dann öffnete er sie wieder und atmete tief ein und aus, als müsste er sich zwingen, ruhig zu bleiben.
"Ja", sagte er schließlich, seine Stimme rauer als zuvor. "Ich habe davon gehört."
"Wissen Sie, wo es ist?"
"Nein." Die Antwort kam zu schnell, zu abrupt. Seine Augen wanderten weg von mir, fixierten einen Punkt irgendwo über meiner Schulter – die Villa, realisierte ich. Er starrte auf die Villa. "Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen."
"Warum nicht?" Ich trat näher, versuchte, seinen Blick einzufangen, aber er sah mich nicht an.
"Weil manche Dinge der Vergangenheit angehören sollten", sagte er leise, fast für sich selbst. "Weil dieses Gemälde... es hat nur Schmerz gebracht. Meiner Familie. Allen, die damit zu tun hatten."
"Schmerz? Was meinen Sie damit?"
Er schüttelte den Kopf, eine schnelle, abwehrende Bewegung. "Das ist eine lange Geschichte. Und eine, die ich nicht mit Ihnen teilen möchte. Tut mir leid." Er wandte sich ab, bereit zu gehen. "Sie sollten gehen. Das Haus ist nicht sicher. Es könnte einstürzen."
"Warten Sie!" Ich griff nach seinem Arm – instinktiv, ohne nachzudenken. Meine Finger schlossen sich um den rauen Stoff seiner Jacke. Aber er zuckte zurück, als hätte ich ihn verbrannt, als wäre die Berührung schmerzhaft.
"Bitte", sagte ich, und ich hörte die Verzweiflung in meiner eigenen Stimme. "Ich verstehe, dass das schmerzhaft für Sie ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Über das Gemälde. Über Ihre Familie. Über diesen Ort."
"Warum?" Jetzt sah er mich wieder an, und in seinen Augen lag eine Intensität, die mich zurückweichen ließ. Sie bohrten sich in meine, suchten etwas. "Was geht Sie das an? Wollen Sie darüber schreiben? Eine nette Geschichte über ein verschollenes Gemälde und eine tragische Familie? Damit Sie Ihr Magazin verkaufen können? Damit irgendwelche Leute beim Frühstück darüber lesen und dann vergessen?"
Seine Worte trafen mich wie Schläge. Aber er hatte nicht ganz unrecht. War es nicht genau das, was ich vorhatte?
"Nein", sagte ich, und zu meiner Überraschung klang meine Stimme fest, überzeugter als ich mich fühlte. "Es geht nicht nur um einen Artikel. Es geht um... ich weiß selbst nicht genau, warum. Aber als ich die Fotografie der Villa sah, als ich von Ihrer Familie hörte, da fühlte es sich wichtig an. Als ob ich es wissen müsste. Als ob..." Ich brach ab.
"Als ob?", drängte er.
"Als ob es mich etwas angeht", gestand ich. "Ich war hier. Als Kind, mit meinem Vater. Ich erinnere mich nicht an alles, aber ich erinnere mich an diesen Garten. An dieses Haus. Und mein Vater... er hat mir nie erklärt, warum wir hier waren."
Etwas in Arons Gesicht veränderte sich. Die Härte wich ein wenig, wurde weicher. "Ihr Vater... András Kovács?"
Ich nickte, überrascht. "Sie kannten ihn?"
"Nein. Aber mein Vater hat von ihm gesprochen. Er war Kunsthändler, nicht wahr?"
"Ja."
Aron musterte mich lange, sein Blick wanderte über mein Gesicht, als würde er nach etwas suchen. Nach einem Zeichen, ob er mir vertrauen konnte. Nach Ehrlichkeit. Nach... ich wusste nicht, was. Schließlich seufzte er tief.
„Gut“ sagte er. "Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen etwas."
Er führte mich zur Villa. Wir gingen schweigend, nur das Knirschen unserer Schritte auf den Blättern und das leise Klopfen des offenen Fensterladens begleiteten uns. Die Eingangstür war aus dunklem Holz, massiv, mit kunstvollen Schnitzereien – Weinranken und Trauben, ein Füllhorn. Die Farbe war abgeblättert, das Holz an manchen Stellen verfault. Ein altes Messingschild neben der Tür war grün angelaufen, aber ich konnte noch die Gravur erkennen: "Familie Németh".
Das Schloss war verrostet, der Schlüssel längst verloren. Aron drückte gegen die Tür, und sie schwang quietschend auf. Niemand hatte sie seit Jahren verschlossen.
Das Innere der Villa war eine Zeitkapsel. Der Flur war breit, mit einem Schachbrettmuster aus schwarzen und weißen Fliesen auf dem Boden. Viele waren gesprungen, manche fehlten ganz. Die Wände waren einst mit Tapeten bedeckt gewesen – ich sah noch Reste davon, dunkelrot mit goldenen Ornamenten –, aber jetzt hingen sie in Fetzen herab wie die Haut eines Reptils bei der Häutung. An manchen Stellen sah man das nackte Mauerwerk, feucht und von Schimmel befallen. Es roch nach Moder und Zeit, nach Jahren der Vernachlässigung, nach Tod und Vergessenheit.
Staubpartikel tanzten im Licht, das durch die Ritzen der Fensterläden fiel, schmale goldene Strahlen in der Dunkelheit. Unsere Schritte hallten in der Leere wider. Der Boden war mit einer dicken Staubschicht bedeckt, und unsere Fußspuren hinterließen deutliche Abdrücke, wie Spuren im Schnee.
An den Wänden hingen noch Bilderrahmen – leer, die Glasscheiben zerbrochen oder fehlend. Wo einst Gemälde gewesen sein mussten, starrten jetzt nur leere Rechtecke. Geister von Kunst.
Aron zog eine kleine Taschenlampe aus seiner Jackentasche – eine robuste, metallene – und schaltete sie ein. Der Strahl schnitt durch die Dunkelheit wie ein Messer. "Vorsicht", sagte er. "Der Boden ist nicht überall stabil."
Wir gingen durch den Flur in einen großen Raum zur Linken – einst wohl ein Salon. Der Raum war riesig, mit einer hohen Decke, von der ein gewaltiger Kronleuchter hing. Viele seiner Kristalle waren heruntergefallen und lagen zerbrochen auf dem Boden, sie knirschten unter unseren Füßen wie Schnee oder Eis. Die Möbel waren noch da, mit Tüchern bedeckt – weißen Laken, die jetzt grau und schmutzig waren. Sie wirkten wie Geister, wie verhüllte Gestalten, die in der Dunkelheit lauerten.
Aron zog eines der Tücher beiseite. Darunter kam ein Sofa zum Vorschein, einst rot, mit goldenen Verzierungen, im Empire-Stil. Der Stoff war von Motten zerfressen, die Federn quollen heraus.
„Hier“ sagte er und deutete auf die Wand gegenüber. "Sehen Sie das?"
Ich trat näher. An der Wand, zwischen den Fetzen der Tapete, waren schwache Umrisse zu erkennen. Rechtecke in verschiedenen Größen, die sich vom Rest der Wand abhoben. Heller, sauberer. Wo Gemälde gehangen hatten. Dutzende von ihnen.
"Dies war die Galerie meines Großvaters", erklärte Aron. Seine Stimme hatte einen träumerischen Klang, als würde er in eine andere Zeit gleiten, als könne er sehen, was einst hier war. "Hier hing seine Sammlung. Werke von ihm selbst, aber auch von Freunden, von anderen Künstlern. Picasso, Braque, Kandinsky – mein Großvater hatte gute Kontakte. Es war ein magischer Ort, so hat mein Vater, András, es mir erzählt. Menschen kamen von überall her, um die Gemälde zu sehen. Künstler, Sammler, Intellektuelle. Dies war ein Salon im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wurde diskutiert, getrunken, gelebt."
Er schwieg einen Moment, der Strahl der Taschenlampe wanderte über die leeren Wände.
"Und dann?"
"Dann kam der Krieg." Er drehte sich zu mir um. Im schwachen Licht der Taschenlampe sah sein Gesicht aus wie eine Skulptur, alle Schatten und Konturen, die Augen zwei dunkle Höhlen. "István wurde 1944 deportiert. 19. März – genau an dem Tag, als die Deutschen Ungarn besetzten. Er hatte sich bis dahin versteckt gehalten, aber jemand muss ihn verraten haben. Er kam nie zurück. Auschwitz. Gaskammer. Einer von Sechshunderttausend."
Die Zahl hing zwischen uns in der Luft, schwer und erdrückend.
"Meine Großmutter Klára und mein Vater versteckten sich in einem Kloster", fuhr Aron fort. "Abt Pál Miklós – ein guter Mann, er lebt noch immer – nahm sie auf, versteckte sie im Keller. Sie überlebten. Aber als sie nach dem Krieg zurückkamen, im Sommer 1945, war das Haus geplündert worden. Die Gemälde waren weg, die Möbel, der Schmuck, alles. Nur die leeren Wände blieben. Und Klára blieb nur die Erinnerung an ihren Mann."
Ich spürte, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildete. "Das tut mir so leid."
"Mir auch." Er starrte auf die Wand, als könne er die Gemälde sehen, die einst dort hingen. "Klára versuchte, hier zu leben. Sie und mein Vater, András. Aber es war zu schwer. Zu viele Geister. Zu viele Erinnerungen. Nach einem Jahr zogen sie aus. Sie nahmen fast nichts mit. Ließen alles hier. Als wollten sie die Vergangenheit begraben."
"Und 'Frau mit rotem Schleier'?"
"War nie hier." Er ging zu einem der verhüllten Möbelstücke – ein Sideboard aus dunklem Holz – und zog das Tuch beiseite. Staub wirbelte auf, ließ mich husten. "Mein Großvater malte es im Versteck, im Keller des Klosters, kurz vor seiner Verhaftung. Pater Benedikt – ein junger Mönch damals, jetzt lange tot – hatte ihm Farben und Leinwand besorgt. Es war sein letztes Werk. Sein Vermächtnis. Ein Porträt meiner Großmutter Klára."
"Sie war die Frau auf dem Gemälde?"
"Ja." Er öffnete eine Schublade des Sideboards. Sie war überraschend sauber, als hätte jemand sie vor Kurzem gereinigt. Innen lagen Dokumente, in Plastikfolien geschützt vor der Feuchtigkeit. Er zog eine heraus – ein altes, vergilbtes Foto.
"Das ist sie."
Er reichte mir das Foto. Ich hielt es in den Strahl der Taschenlampe. Eine junge Frau, vielleicht Mitte zwanzig, stand vor einer Wand. Sie trug ein einfaches dunkles Kleid, ihr Haar war zu einem Knoten hochgesteckt. Aber es waren ihre Augen, die mich fesselten. Groß, dunkel, intelligent. Sie lächelte, aber das Lächeln erreichte ihre Augen nicht ganz. In ihnen lag etwas Trauriges, etwas Wissendendes. Als ahne sie bereits, was kommen würde.
Dieselbe Frau, die ich auf Viktors Foto gesehen hatte. Die Frau vor der Villa.
"Sie ist wunderschön", flüsterte ich, und meine Stimme klang rau.
"Sie war es." Arons Stimme wurde leiser, brüchig. "Sie starb, als ich zehn war. Krebs. Sie hatte jahrelang geraucht, Zigarette um Zigarette, als wolle sie die Erinnerungen verbrennen. Aber ich erinnere mich an sie. An ihre Stimme – sie sang manchmal, alte ungarische Lieder, Volkslieder. An ihre Hände – immer kalt, auch im Sommer. An die Art, wie sie meinen Vater ansah. Mit so viel Liebe, aber auch mit so viel Traurigkeit. Als würde sie jemanden vermissen, der nie zurückkommen würde."
"István", sagte ich.
"Ja. Sie sprach nie viel über ihn. Es war zu schmerzhaft. Aber manchmal, wenn sie dachte, niemand würde sie sehen, weinte sie. Ich fand sie einmal, spät nachts, in der Küche unserer Wohnung. Sie saß am Tisch, vor sich ein Glas Wein – Tokaji, süß und golden –, und in ihrer Hand hielt sie ein Foto von István. Sie weinte ganz leise, ohne Schluchzen, nur Tränen, die über ihre Wangen liefen wie Regen. Als sie mich sah, wischte sie sich schnell die Augen und lächelte. Aber ich hatte es gesehen. Ich hatte den Schmerz gesehen, der nie verblasste."
Ich spürte, wie Tränen in meinen eigenen Augen brannten. Die Geschichte war so traurig, so voller verlorener Liebe und nicht geheilter Wunden.
"Das tut mir so leid", wiederholte ich, und die Worte fühlten sich unzureichend an. Was konnte man sagen angesichts solchen Leids?
"Mir auch." Er nahm mir das Foto aus der Hand und legte es zurück in die Schublade, sanft, als wäre es zerbrechlich. "Deshalb will ich nicht, dass das Gemälde gefunden wird. Es würde nur alte Wunden aufreißen. Es würde die Geschichte meiner Großmutter, ihre Trauer, ihren Schmerz zu einem Spektakel machen. Zu einer Schlagzeile. Zu etwas, das man kaufen und verkaufen kann."
"Aber vielleicht", sagte ich vorsichtig, und wählte meine Worte mit Bedacht, "vielleicht würde es auch ihre Liebe ehren. Die Liebe zwischen ihr und István. Vielleicht würde es bedeuten, dass ihr Leiden nicht umsonst war. Dass ihre Geschichte erzählt wird. Dass sie nicht vergessen werden."
Er sah mich an, lange und durchdringend. Seine Augen suchten in meinen nach etwas – Aufrichtigkeit? Verständnis? Ich hielt seinem Blick stand, ließ ihn suchen.
"Sie verstehen es nicht", sagte er schließlich, aber seine Stimme klang weniger hart als zuvor. Müde. "Dieses Gemälde hat meine Familie zerstört. Nicht nur Klára. Auch meinen Vater. Er wurde... besessen davon."
Er schwieg einen Moment, dann sprach er weiter, die Worte sprudelten heraus, als hätte er lange darauf gewartet, sie jemandem zu erzählen.
"András – mein Vater – wuchs ohne Vater auf. István starb, als er erst fünf Jahre alt war. Er hatte kaum Erinnerungen an ihn. Nur Geschichten, die Klára ihm erzählte. Geschichten über einen großartigen Mann, einen brillanten Künstler, einen liebenden Ehemann. András wollte ihm nahekommen, wollte verstehen, wer sein Vater gewesen war. Und er dachte, wenn er das Gemälde finden würde – das letzte Werk, das Vermächtnis –, dann würde er ihm näherkommen. Dann würde er die Leere in sich füllen können."
Aron lachte bitter, ein Lachen ohne Freude. "Also suchte er. Jahre, Jahrzehnte. Er ging zu Auktionshäusern, zu Galerien, zu Privatsammlern. Er durchforstete Archive. Er reiste durch ganz Europa – Wien, Paris, Berlin, Prag. Er gab ein Vermögen aus. Er vernachlässigte seine Arbeit – er war Lehrer, Kunstgeschichte an einem Gymnasium, Jókai Mór Gymnasium y hier in Budapest. Gute Schule. Aber die Arbeit wurde ihm gleichgültig. Er nahm sich unbezahlten Urlaub, vernachlässigte seine Schüler. Er vernachlässigte seine Ehe – meine Mutter, Eszter, sie war geduldig, liebevoll, aber irgendwann konnte auch sie nicht mehr. Sie verließ ihn, als ich sechzehn war. Ging zurück nach Debrecen, zu ihrer Familie."
Seine Stimme brach, und er musste einen Moment innehalten, tief durchatmen.
"Und er vernachlässigte mich. Seinen Sohn. Ich versuchte, ihn zu verstehen. Ich versuchte, ihm zu helfen. Aber er ließ mich nicht an sich heran. Alles drehte sich nur noch um dieses eine verdammte Gemälde. Es wurde zu seiner Obsession, zu seinem Fluch. Er starb, als ich fünfundzwanzig war. Herzinfarkt. Er war erst sechsundfünfzig. Zu jung. Aber sein Herz war gebrochen, ausgelaugt von jahrelanger Verzweiflung."
Ohne nachzudenken, legte ich meine Hand auf seinen Arm. Diesmal zuckte er nicht zurück. Er sah auf meine Hand, dann auf mein Gesicht, und in seinen Augen lag eine Verletzlichkeit, die mir das Herz brach.
"Das tut mir so unendlich leid", sagte ich leise, und ich meinte es. "Wirklich."
"Danke." Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Wir standen so da, in der Dunkelheit der verfallenen Villa, umgeben von Geistern und Erinnerungen, und für einen Moment fühlte es sich an, als würde die Zeit stillstehen.
Dann räusperte er sich und trat einen Schritt zurück. Meine Hand fiel von seinem Arm.
"Kommen Sie", sagte er, seine Stimme wieder fester. "Ich zeige Ihnen noch etwas."
Wir verließen den Salon und gingen eine knarrende Treppe hinauf in den ersten Stock. Die Stufen waren aus dunklem Holz, an manchen Stellen durchgebogen, an anderen gesprungen. Das Geländer war kunstvoll geschnitzt, mit Ranken und Blättern verziert, aber an vielen Stellen fehlten Teile, als hätte jemand sie herausgebrochen. Vielleicht zum Heizen, in den kalten Nachkriegsjahren, als Holz kostbarer war als Gold.
Hier war der Verfall noch deutlicher. Das Dach musste undicht sein, denn an vielen Stellen hatten sich Wasserschäden gebildet. Die Decke war braun verfärbt, an manchen Stellen hingen Fetzen herab wie totes Fleisch. Die Tapeten – einst wohl grün mit silbernen Mustern – hingen in langen Bahnen herab, feucht und von Schimmel befallen. Der Geruch war überwältigend, ein Geruch nach Fäulnis und Tod.
Aron öffnete eine Tür am Ende des Flurs. Die Klinke war aus Porzellan, weiß mit blauen Blumen bemalt, erstaunlich intakt. Dahinter lag ein kleiner Raum, einst wohl ein Schlafzimmer. Es war leer bis auf einen alten Schrank – massiv, aus dunklem Eichenholz, mit geschnitzten Türen – und ein rostiges Bettgestell ohne Matratze.
"Das war Kláras Zimmer", sagte Aron leise, fast ehrfürchtig. "Nach dem Krieg. Sie lebte hier allein mit meinem Vater, bis sie es nicht mehr ertragen konnte. 1946 bis 1953. Sieben Jahre zwischen diesen Wänden. Sieben Jahre mit den Geistern."
Er ging zum Schrank. Die Türen quietschten, als er sie öffnete, ein klagendes Geräusch, das durch den leeren Raum hallte. Innen war der Schrank erstaunlich gut erhalten, als hätte die Zeit hier innegehalten. Ich sah alte Kleidung auf Bügeln – Kleider aus den Vierzigern, in gedeckten Farben, Braun und Grau und Dunkelblau. Schachteln, ordentlich gestapelt. Ein paar Bücher – ich erkannte die Rücken: "Der Zauberberg" von Thomas Mann, "Anna Karenina" von Tolstoi, "Die Elenden" von Victor Hugo. Klára hatte gut gelesen.
"Sie ließ alles hier", erklärte Aron, während er eine der Schachteln herauszog. "Als sie 1953 auszog – mein Vater war achtzehn, begann sein Studium an der Universität ELTE, Kunstgeschichte – nahm sie fast nichts mit. Nur ein paar Fotos, einige persönliche Dokumente. Den Rest ließ sie hier. Als würde sie versuchen, die Vergangenheit zurückzulassen. Als könnte sie einfach weggehen und eine neue Person werden."
Er öffnete die Schachtel. Sie war aus Pappe, einst weiß, jetzt vergilbt. Auf dem Deckel stand in verblasster Schrift: "István – Briefe". Innen lagen Dutzende von Briefen, mit Bändern gebündelt – dünne Seidenbänder in verblasstem Rot.
"Briefe von István", sagte Aron. Seine Stimme zitterte leicht. "Geschrieben aus dem Versteck, zwischen 1943 und 1944. Der letzte datiert auf den 18. März 1944. Einen Tag, bevor sie ihn holten."
Er nahm eines der Bündel und löste vorsichtig das Band. Die Briefe waren auf dünnem Papier geschrieben, vergilbt und brüchig. Die Tinte war verblichen, aber noch lesbar. Die Handschrift war elegant, fließend, mit großen Schleifen und ausladenden Buchstaben – die Handschrift eines Künstlers.
"Darf ich...?", fragte ich vorsichtig.
Er zögerte, dann nickte er. "Ja. Aber behandeln Sie sie vorsichtig. Sie sind alles, was von ihm übrig ist. Sein Vermächtnis."
Ich nahm einen der Briefe und entfaltete ihn so behutsam, wie ich konnte. Das Papier knisterte leise unter meinen Fingern, fühlte sich zerbrechlich an, als könnte es jeden Moment zerfallen. Ich hielt ihn ins Licht der Taschenlampe und begann zu lesen.
Budapest, 15. November 1943
Meine allerliebste, meine einzige Klára,
Heute ist es wieder kälter geworden. Der erste Frost kam letzte Nacht, und die Fenster im Keller sind mit Eis bedeckt. Pater Benedikt brachte mir eine Decke – grob, aus Wolle, sie kratzt, aber sie wärmt. Der Winter naht, mein Schatz, und ich frage mich, ob ich ihn noch erleben werde. Ob ich den Frühling noch sehen werde, wenn die Kastanien auf unserem Hügel wieder blühen.
Aber ich darf nicht so denken. Das weißt Du. Ich muss Hoffnung haben, für Dich, für unseren kleinen András. Er muss drei Jahre alt sein jetzt. Wie sehr ich ihn vermisse! Wie sehr ich Dich vermisse! Manchmal, wenn ich die Augen schließe, kann ich Dein Gesicht sehen, so klar, als stündest Du vor mir. Deine Augen – diese wundervollen dunklen Augen, in denen ich mich verlieren kann wie in einem tiefen See. Dein Lächeln – dieses scheue, geheime Lächeln, das Du nur für mich hast. Die Art, wie Du Dein Haar zurückstreichst, wenn Du nachdenkst.
Ich male wieder. Es ist das Einzige, das mich bei Verstand hält, das einzige, das die Angst fernhält. Ich male Dein Gesicht, immer und immer wieder. Dutzende von Skizzen liegen jetzt hier, auf dem Boden des Kellers verstreut. Pater Benedikt schaut sie sich manchmal an, wenn er mir Essen bringt – Brot, meist trocken, manchmal ein Stück Käse, selten Fleisch. Er sagt, ich solle weitermalen. Er sagt, das ist meine Art zu beten.
Und er hat recht. Jeder Pinselstrich ist ein Gebet. Jede Farbe ist ein Wort zu Gott. Ich male Dich mit dem roten Schleier, den Du bei unserer Hochzeit getragen hast. Erinnerst Du Dich, meine Liebste? Es war September 1937, ein goldener Herbsttag, die Blätter fielen wie Konfetti. Wir standen vor dem Altar der Matthiaskirche – so schön, mit ihren bunten Dachziegeln, die in der Sonne glänzten. Pfarrer Kovács – ein guter Mann, hoffentlich lebt er noch – traute uns. Du warst so schön an diesem Tag! Das Schönste, was ich je gesehen hatte. Dein Kleid war schlicht, cremeweiß, aber der Schleier – rot wie Mohn, rot wie Blut, rot wie Liebe. Deine Mutter hatte ihn für Dich genäht, aus Seide, die sie von ihrer eigenen Hochzeit aufbewahrt hatte.
Ich male Dich so, wie ich Dich in Erinnerung habe. Dein Gesicht halb verborgen, halb enthüllt. Deine Augen, die mich ansehen mit dieser Mischung aus Traurigkeit und Hoffnung. Ich male die Liebe, die wir teilen. Ich male die Angst, die uns umgibt. Ich male die Zukunft, die wir vielleicht nie haben werden.
Dieses Gemälde wird mein Vermächtnis sein, mein Schatz. Wenn sie mich holen – und ich weiß, dass sie kommen werden, ich spüre es in meinen Knochen, ich sehe es in meinen Träumen –, dann wird dieses Bild von unserer Liebe erzählen. Von der Schönheit, die selbst in den dunkelsten Zeiten fortbesteht. Von der Hoffnung, die selbst der Tod nicht auslöschen kann.
Bewahre es gut auf, meine geliebte Klára. Verstecke es. Gib es niemals her. Und wenn András alt genug ist, erzähl ihm von seinem Vater. Erzähl ihm, dass ich ihn geliebt habe, auch wenn ich nicht da sein konnte, um ihn aufwachsen zu sehen. Erzähl ihm, dass er aus Liebe geboren wurde, aus der größten Liebe, die zwei Menschen teilen können.
Ich denke jeden Tag an Dich. Jede Stunde. Jede Minute. Du bist mein erster Gedanke am Morgen und mein letzter vor dem Schlaf. Du bist die Luft, die ich atme, das Blut in meinen Adern, der Grund, warum mein Herz schlägt.
In ewiger, unendlicher Liebe, Dein István
P.S.: Pater Benedikt sagt, er wird versuchen, diesen Brief zu Dir zu bringen. Ich hoffe, er erreicht Dich. Ich hoffe, Du weißt, dass ich noch lebe, dass ich noch kämpfe, dass ich noch hoffe. Küsse András von mir. Sag ihm, Papa kommt bald nach Hause. Auch wenn wir beide wissen, dass das vielleicht eine Lüge ist.
Die Worte verschwammen vor meinen Augen. Tränen – ich hatte nicht gemerkt, dass ich weinte – liefen über meine Wangen. Ich musste schlucken, wieder und wieder, um den Kloß in meinem Hals loszuwerden. Die Liebe in diesen Worten war so rein, so verzweifelt, so voller Hoffnung trotz der Hoffnungslosigkeit.
"Das ist..." Ich konnte nicht weitersprechen. Die Worte reichten nicht aus.
"Ja", sagte Aron leise. Er sah mich nicht an, sondern starrte auf die Briefe in seinen Händen. "Es gibt noch mehr. Dutzende. Alle ähnlich. Alle voller Liebe, voller Angst, voller Hoffnung, die langsam stirbt."
"Darf ich einen weiteren lesen?"
Er nickte und reichte mir einen anderen Brief.
Budapest, 3. Januar 1944
Meine Klára,
Das neue Jahr ist da. 1944. Ein neues Jahr, aber keine neue Hoffnung. Die Nachrichten, die Pater Benedikt mir bringt, sind schlecht. Die Rote Armee rückt vor, ja, aber langsam, so langsam. Und hier, in Ungarn, wird die Lage täglich schlimmer. Mehr Deportationen. Mehr Gesetze. Mehr Angst.
Gestern hörte ich Schreie auf der Straße. Ich wagte es, durch das kleine Kellerfenster zu schauen – nur einen kurzen Blick. Ich sah Soldaten, SS-Männer, wie sie eine Familie aus einem Haus holten. Der Vater versuchte zu protestieren, wurde niedergeschlagen. Die Mutter weinte. Die Kinder – zwei kleine Mädchen, vielleicht fünf und sieben Jahre alt – klammerten sich an ihre Röcke. Ich musste wegsehen. Ich konnte es nicht ertragen.
Und ich denke: Wann bin ich an der Reihe? Wann kommen sie für mich?
Aber dann denke ich an Dich, an András, und ich weiß: Ich muss durchhalten. Ich muss überleben. Für Euch.
Das Gemälde macht Fortschritte. Es ist fast fertig jetzt. Dein Gesicht schaut mich an von der Leinwand, so lebendig, als könntest Du jeden Moment zu sprechen beginnen. Manchmal, wenn ich spät nachts male, bei Kerzenlicht – nur eine einzige Kerze, mehr kann ich nicht riskieren, das Licht könnte jemanden aufmerksam machen –, dann habe ich das Gefühl, Du bist bei mir. Du sitzt neben mir, Deine Hand auf meiner Schulter, und schaust zu, wie ich male. Und ich bin nicht mehr allein.
Ist das Wahnsinn, mein Schatz? Verliere ich den Verstand? Oder ist das Liebe – die Art, wie Liebe die Grenzen von Raum und Zeit überwindet?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich Dich liebe. Mehr als mein Leben. Mehr als alles.
Für immer Dein, István
Ich legte den Brief vorsichtig zurück in die Schachtel. Meine Hände zitterten.
"Jetzt verstehen Sie vielleicht", sagte Aron, und seine Stimme klang rau, "warum ich nicht will, dass dieses Gemälde gefunden wird. Es ist zu persönlich, zu schmerzhaft. Es gehört nicht in eine Galerie, nicht in die Hände von Sammlern, die nur seinen Wert in Geld sehen. Es ist ein Liebesbrief in Farben, ein letzter Schrei eines sterbenden Mannes. Es gehört... ich weiß nicht, wohin es gehört. Aber nicht in die Öffentlichkeit."
Ich sah ihn an. Im schwachen Licht der Taschenlampe konnte ich Tränen auf seinen Wangen glänzen sehen. Er weinte leise, ohne Schluchzen, wie seine Großmutter einst geweint hatte.
"Ich verstehe", sagte ich leise. Und ich verstand. Wirklich. "Aber..." Ich zögerte. "Was, wenn es noch existiert? Was, wenn jemand es findet und verkauft, ohne die Geschichte zu kennen? Ohne zu wissen, was es bedeutet? Wäre es dann nicht besser, wenn Sie es zuerst finden? Wenn Sie entscheiden könnten, was damit passiert? Sie könnten es einem Museum geben, mit der Bedingung, dass die Geschichte erzählt wird. Die wahre Geschichte. Die Geschichte von István und Klára, von ihrer Liebe, von dem, was sie durchgemacht haben."
Er schüttelte den Kopf, aber die Bewegung war weniger entschieden als zuvor. "Ich habe Jahre damit verbracht zu suchen. Zusammen mit meinem Vater, und dann allein, nachdem er gestorben war. Nach seinem Tod – das war 2013, vor zwölf Jahren – fand ich in seinen Unterlagen all seine Notizen. Seiten über Seiten, Ordner voll. Er hatte alles dokumentiert: Jede Galerie, die er besucht hatte. Jeder Sammler, mit dem er gesprochen hatte. Jede Spur, die sich als Sackgasse herausstellte. Ich folgte seinen Spuren. Ich fuhr nach Wien, nach Berlin, nach Paris. Ich sprach mit Kunsthistorikern, mit Archivaren. Nichts. Das Gemälde ist verschwunden. Zerstört, vielleicht, in den Wirren des Krieges. Oder so gut versteckt, dass es niemand je finden wird."
"Aber was, wenn nicht?", beharrte ich. Die Worte sprudelten aus mir heraus, getrieben von einem Gefühl, das ich nicht ganz verstand. "Was, wenn es irgendwo da draußen ist, wartet darauf, gefunden zu werden? Was, wenn Klára es versteckt hat, so gut, dass selbst András es nicht finden konnte, aber mit Hinweisen, die sie hinterlassen hat? Hinweise, die wir zusammen finden könnten?"
Er sah mich lange an. In seinen Augen kämpften Hoffnung und Resignation miteinander, wie Licht und Schatten. Schließlich seufzte er tief.
"Selbst wenn... ich habe keine Hinweise mehr. Keine Spuren. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich habe alles durchsucht. Dieses Haus. Die Wohnung, in der Klára später lebte – Gellérthegy, eine kleine Einzimmerwohnung mit Blick auf die Donau, sie starb dort 1987. Das Kloster. Überall."
"Vielleicht könnten wir zusammenarbeiten", schlug ich vor. Die Worte kamen spontan, aus einem Impuls heraus, aber sobald ich sie ausgesprochen hatte, wusste ich, dass sie richtig waren. "Ich habe Zugang zu Archiven, Kontakte in der Kunstwelt. Mein Auftraggeber, Viktor Lenz, hat Verbindungen zu Galerien und Sammlern in ganz Europa. Und Sie kennen die Geschichte Ihrer Familie, die Details, die nur Sie wissen können. Gemeinsam könnten wir vielleicht etwas finden, das Ihrem Vater entgangen ist."
Er schüttelte den Kopf. "Ich weiß nicht..."
"Denken Sie darüber nach", sagte ich. Ich zog eine Visitenkarte aus meiner Tasche und reichte sie ihm. Sie war schlicht, weiß mit schwarzer Schrift: "Elena Kovács – Kulturjournalistin", meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse. "Das ist meine Nummer. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, rufen Sie mich an. Jederzeit."
Er nahm die Karte und betrachtete sie lange, als könne er in ihr etwas lesen, das nicht darauf stand. Dann steckte er sie in seine Jackentasche.
"Ich werde darüber nachdenken", sagte er schließlich.
Wir verließen das Zimmer schweigend. Die Treppe hinunter, durch den Salon, durch den Flur. Bei der Eingangstür blieb er stehen.
"Warten Sie noch einen Moment", sagte er. "Es gibt noch etwas, das ich Ihnen zeigen möchte."
Er führte mich durch den Garten zu einem kleinen Schuppen, halb versteckt hinter einer Hecke aus wilden Rosen. Die Tür war verschlossen mit einem alten Vorhängeschloss, verrostet, aber noch funktionsfähig. Aron zog einen Schlüssel aus seiner Tasche – ein kleiner, alter Schlüssel aus Messing – und schloss auf.
Innen war der Schuppen überraschend trocken und ordentlich. Es roch nach Holz und Terpentin. An den Wänden hingen Werkzeuge – Hammer, Sägen, Zangen, alle alt, aber gepflegt. In der Ecke stand eine Staffelei, und auf einem Regal lagen Pinsel, Farben, Leinwände.
"Meine Werkstatt", erklärte Aron. "Ich bin Restaurator. Ich arbeite mit alten Gemälden, versuche, sie zu retten, zu bewahren. Manchmal komme ich hierher, wenn ich allein sein will. Wenn ich nachdenken will."
"Sie restaurieren Gemälde?" Ich war überrascht. "Wie Ihr Großvater sie erschaffen hat."
"Ja. Ich habe nie sein Talent geerbt. Ich kann nicht malen – nicht so, wie er konnte. Aber ich kann reparieren. Ich kann etwas Zerbrochenes wieder zusammensetzen, etwas Verlorenes zurückbringen." Er lächelte schwach. "Es ist eine Art, mit der Vergangenheit umzugehen. Mit dem Verlust."
Er ging zu dem Regal und nahm ein altes Foto in einem Rahmen. "Das hier... das ist das einzige Foto, das wir vom Gemälde haben. Eine Schwarzweißkopie, nicht besonders gut. Aber es zeigt, wie es aussah."
Er reichte mir das Foto. Ich hielt es ins Tageslicht, das durch die offene Tür fiel.
Und da war es. "Frau mit rotem Schleier".
Selbst in Schwarzweiß war die Kraft des Bildes spürbar. Die Frau – Klára – saß vor einem dunklen Hintergrund, vielleicht ein Vorhang. Der rote Schleier – in der Schwarzweißfotografie ein mittleres Grau – bedeckte ihr Haar und fiel über ihre Schultern. Ihr Gesicht war zur Seite gewandt, aber ihre Augen schauten direkt in die Kamera – oder vielmehr, in die Augen des Betrachters. Sie waren groß, dunkel, unendlich traurig und doch voller Würde. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, als wollte sie etwas sagen. Ihre Hände lagen im Schoß, gefaltet, ruhig.
Die Pinselführung war expressiv, fast wild an manchen Stellen – man konnte die einzelnen Striche erkennen, die Textur der Farbe. Es war nicht realistisch im klassischen Sinne. Es war emotional, roh, ehrlich.
Es war wunderschön. Und herzzerreißend.
"Es ist..." Ich konnte keine Worte finden.
"Ja", sagte Aron leise. "Es ist sein Meisterwerk. Das Werk eines Mannes, der wusste, dass er sterben würde. Der sein ganzes Herz, seine ganze Seele in dieses eine Bild gelegte."
Wir standen schweigend da, beide in die Betrachtung des Fotos versunken.
Schließlich gab ich ihm das Foto zurück. "Danke", sagte ich. "Dass Sie mir das alles gezeigt haben. Ich weiß, es war nicht einfach für Sie."
Er nickte nur. Dann, als ich mich zum Gehen wandte, sagte er: "Warten Sie."
Ich drehte mich um.
"Es gibt einen Ort", sagte er langsam, gegen seinen eigenen Willen ankämpfend. Die Worte schienen ihm schwerzufallen. "Ein Kloster, etwa zwei Stunden von hier, nordwestlich, in der Nähe von Esztergom. Pannonhalma – ein Benediktinerkloster, eines der ältesten in Europa. Dort haben meine Großmutter und mein Vater während des Krieges Zuflucht gefunden. Der Abt, der ihnen damals half – Pál Miklós – lebt noch immer. Er ist sehr alt jetzt, über neunzig, aber sein Verstand ist klar. Vielleicht... vielleicht weiß er etwas."
Mein Herz machte einen Sprung. "Würden Sie... würden Sie mich dorthin begleiten?"
Er zögerte lange. Ich sah, wie er mit sich kämpfte, wie verschiedene Gedanken und Gefühle über sein Gesicht huschten. Schließlich nickte er.
"Ja. Ich komme mit. Aber nicht für das Gemälde." Er sah mir direkt in die Augen. "Ich komme mit, weil ich Pfarrer Miklós schon lange besuchen wollte. Weil ich ihm danken möchte für das, was er für meine Familie getan hat. Und weil..." Er brach ab.
"Weil?", ermunterte ich ihn sanft.
"Weil etwas mir sagt, dass Sie es ernst meinen. Dass es Ihnen nicht nur um einen Artikel geht. Dass Sie die Geschichte verstehen wollen. Die echte Geschichte, nicht nur die Schlagzeile."
Ich lächelte. "Das stimmt. Es ist mehr als das. Viel mehr. Ich weiß nur noch nicht genau, was. Aber ich werde es herausfinden."
"Morgen?", fragte er. "Ich habe morgen frei. Ich arbeite in einer Restaurierungswerkstatt in der Stadt, im Burgviertel, aber mein Chef – Tamás Horváth, guter Mann – lässt mich manchmal einen Tag freimachen, wenn ich ihn brauche."
„Morgen“ bestätigte ich. "Um wie viel Uhr?"
"Acht Uhr? Wir treffen uns hier. Die Fahrt dauert etwa zwei Stunden, vielleicht etwas länger mit dem Verkehr."
"Perfekt. Ich werde hier sein."
Wir tauschten Telefonnummern aus – er tippte meine in sein altes Smartphone ein, ein Samsung mit Rissen im Display, ich seine in mein iPhone. Dann verabschiedeten wir uns.
Als ich zum Tor ging, spürte ich seinen Blick in meinem Rücken. Ich drehte mich um und sah ihn noch immer vor dem Schuppen stehen, die Hände in den Taschen, eine einsame Gestalt vor der verfallenen Villa. Das Sonnenlicht – es war später Nachmittag geworden – fiel durch die Bäume und warf Schatten auf sein Gesicht.
Und in diesem Moment wusste ich, dass sich etwas verändert hatte. Dass dies nicht nur eine Recherche war, nicht nur ein Auftrag. Dies war der Beginn von etwas Größerem, etwas, das ich noch nicht benennen konnte, aber das ich spüren konnte – eine Verbindung, zart wie ein Spinnenfaden, aber da. Eine Verbindung zu diesem Mann, zu seiner Geschichte, zu seiner Trauer.
Ich hob die Hand zum Abschied. Er hob seine ebenfalls, ein kleines, zaghaftes Winken.
Dann ging ich durch das Tor, zu meinem Auto, und fuhr zurück in die Stadt.
Aber meine Gedanken blieben bei der Villa, bei den Briefen, bei Aron Németh und seinen traurigen graugrünen Augen. Und bei der Frage, was uns morgen im Kloster erwarten würde.
Bei der Frage, ob wir das Gemälde wirklich finden würden.
Und bei der Frage – leise, kaum bewusst, aber da –, ob ich Aron jemals wiedersehen würde, nachdem diese Suche vorbei war.
Ob ich ihn wiedersehen wollte.
Die Antwort, wusste ich, war ja.
❦
✦❧✦❧✦
Kapitel 3
Die Briefe
✦❧✦
❧
An diesem Abend konnte ich nicht schlafen. Ich lag in meinem Hotelzimmer – Hotel Palazzo Zichy, ein kleines Boutique-Hotel im jüdischen Viertel, mit hohen Decken und Kronleuchtern, die an eine vergangene Ära erinnerten – und starrte an die mit Stuck verzierte Decke. Engel und Weinranken tanzten dort oben in der Dunkelheit, nur schwach beleuchtet vom Licht der Straßenlaternen, das durch die schweren Samtvorhänge drang.
Draußen hörte ich die Stadt leben. Budapest schlief nie wirklich. Autos fuhren vorbei, ihre Reifen zischten auf dem noch feuchten Asphalt. Irgendwo spielte jemand Violine – traurig, melancholisch, eine Melodie, die ich nicht kannte, aber die mir trotzdem vertraut vorkam. Stimmen von Betrunkenen, die aus einer Bar kamen, Lachen, das zu laut war, zu verzweifelt. Eine Straßenbahn ratterte vorbei, die Nummer 6, die letzte für diese Nacht.
Aber diese Geräusche erreichten mich kaum. Meine Gedanken kreisten um Aron Németh. Um seine Worte. Um den Schmerz in seinen Augen. Um die Art, wie seine Stimme gebrochen war, als er von seinem Vater erzählte.
"Dieses Gemälde hat meine Familie zerstört."
Die Worte hallten in meinem Kopf wider, immer und immer wieder, wie ein Echo in einer leeren Kirche.
Und dann die Briefe. István Briefe an Klára. Diese verzweifelten, liebevollen, hoffnungslosen Worte eines Mannes, der wusste, dass er sterben würde, aber trotzdem an die Liebe glaubte. Der malte, während die Welt um ihn herum zusammenbrach.
Ich dachte an meinen eigenen Vater. András Kovács. War er deshalb in der Villa gewesen, damals, als ich ein Kind war? Hatte er nach dem Gemälde gesucht? Hatte er etwas gewusst?
Fragen über Fragen, und keine Antworten.
Ich stand auf – die Uhr auf dem Nachttisch zeigte 2:17 Uhr – und ging zum Fenster. Ich schob die Vorhänge beiseite und blickte hinaus. Die Straße war fast leer. Eine einsame Gestalt ging vorbei, ein alter Mann mit einem Hund – ein kleiner Terrier, der an der Leine zerrte. Der Mann trug einen langen Mantel und einen Hut, sah aus wie aus einer anderen Zeit. Er verschwand um die Ecke, und die Straße war wieder leer.
Ich lehnte meine Stirn gegen das kalte Glas. Mein Atem beschlug die Scheibe.
Morgen würden wir zum Kloster fahren. Aron und ich. Zusammen. Der Gedanke ließ mein Herz schneller schlagen, und ich wusste nicht genau, warum. War es Aufregung wegen der Recherche? Oder war es etwas anderes?
Ich schüttelte den Kopf. Das war lächerlich. Ich kannte den Mann kaum. Ein paar Stunden in einer verfallenen Villa, das war alles.
Aber diese paar Stunden hatten etwas in mir berührt. Etwas, das ich lange verschlossen gehalten hatte.
Ich ging zurück ins Bett, aber schlief noch immer nicht. Stattdessen nahm ich mein Handy vom Nachttisch und öffnete die Notizen-App. Ich begann zu schreiben, zu dokumentieren, was ich heute erlebt hatte. Die Villa. Die Briefe. Aron. Jedes Detail, das ich mich erinnern konnte.
Als ich fertig war, war es fast vier Uhr morgens. Ich legte das Handy weg und schloss die Augen. Diesmal kam der Schlaf, aber er brachte Träume mit sich.
Ich träumte von einer Frau in einem roten Schleier. Sie stand in einem dunklen Raum – ein Keller, erkannte ich, mit feuchten Steinwänden und einem kleinen Fenster hoch oben, durch das kaum Licht fiel. Sie war allein. Auf einer Staffelei vor ihr stand eine Leinwand, halb fertig bemalt. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, nur ihre Silhouette, aber ich wusste, dass sie weinte. Ihre Schultern bebten.
Und dann veränderte sich die Szene. Ich war in einem anderen Raum, hell und freundlich, mit hohen Fenstern, durch die Sonnenlicht strömte. An den Wänden hingen Gemälde – Dutzende, Hunderte. Menschen bewegten sich durch den Raum, elegant gekleidet, mit Gläsern in der Hand. Champagner, vermutlich. Sie sprachen, lachten. Eine Vernissage.
Und dort, in der Mitte des Raums, hing das Gemälde. "Frau mit rotem Schleier". In Farbe, lebendig. Der Schleier war wirklich rot – ein tiefes, leuchtendes Rot, wie Rosenblüten, wie Sonnenuntergänge, wie Blut. Die Frau – Klára – schaute mich an, und ihre Augen waren so traurig, dass es wehtat, sie anzusehen.
Ich trat näher. Meine Hand streckte sich aus, wollte die Leinwand berühren, wollte fühlen, ob sie real war.
Aber bevor ich sie erreichen konnte, verschwand alles. Der Raum, die Menschen, das Gemälde. Alles löste sich auf in Dunkelheit.
Ich wachte keuchend auf. Mein Herz raste. Das Hotelzimmer war grau vom ersten Morgenlicht. Die Uhr zeigte 6:03 Uhr.
Ich stand auf, duschte, zog mich an. Jeans, ein schwarzer Pullover, bequeme Stiefel. Praktisch für eine Fahrt aufs Land. Ich packte meine Tasche – Notizbuch, Kamera, Aufnahmegerät, ein paar Stifte. Die Journalistin in mir, immer vorbereitet.
Dann ging ich hinunter zum Frühstück. Das Restaurant des Hotels war ein kleiner, gemütlicher Raum mit Holztischen und frischen Blumen. Nur wenige Gäste waren da – ein älteres Ehepaar, Touristen vermutlich, Amerikaner nach ihrem Akzent zu urteilen, und ein Geschäftsmann in Anzug, der konzentriert auf sein Tablet starrte.
Die Kellnerin – ein junges Mädchen, vielleicht zwanzig, mit einem freundlichen Lächeln und einem Namensschild "Petra" – brachte mir Kaffee. Stark und schwarz, genau wie ich ihn brauchte. Ich bestellte ein einfaches Frühstück: Brot, Käse, ein gekochtes Ei. Ich hatte keinen großen Appetit, aber ich musste etwas essen.
Während ich aß, dachte ich über meine nächsten Schritte nach. Nach dem Klosterbesuch mit Aron musste ich ins Nationalarchiv. Éva Tóth, die Archivarin, die Viktor erwähnt hatte. Sie konnte vielleicht mehr Informationen über István Németh haben, über seine Werke, über die Kriegszeit.
Und ich musste Viktor anrufen. Ihm berichten, was ich bisher herausgefunden hatte. Nicht alles, entschied ich. Nicht die Briefe, nicht Arons Geschichte. Das war zu persönlich. Aber die Spur zum Kloster – das konnte ich erwähnen.