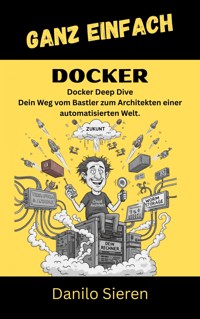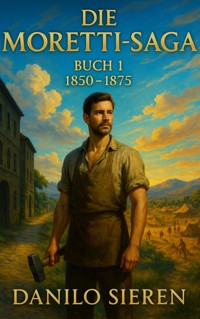
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Ursprung (Neapel, 1850) Die Saga beginnt in der düsteren Via dei Fabbri in Neapel. Der 14-jährige Giuseppe Moretti steht am Amboss seines Vaters Lorenzo, einem Mann, der als "Der Schweigende" bekannt ist. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als ein mysteriöser Fremder im schwarzen Mantel die Schmiede betritt. Er verlangt das Unmögliche: Zwanzig identische, tödliche Messer in nur sieben Tagen. Die Bezahlung ist ein Vermögen in Gold, die Alternative der Tod der gesamten Familie. Vater und Sohn erfüllen den Auftrag in einer Woche voller Qualen, doch der Preis ist höher als Gold: Sie verlieren ihre Unschuld und laden eine moralische Schuld auf sich, die sie zur Flucht zwingt. Die Flucht und der Neuanfang (Australien) Die Flucht führt sie auf das Schiff Vittoria nach Australien. Doch das gelobte Land fordert sofort seinen Tribut: Giuseppes Eltern überleben die Reise bzw. die Ankunft nicht. Giuseppe steht mit 14 Jahren allein in Ballarat, dem Epizentrum des viktorianischen Goldrauschs – einem Ort, den er schnell als "Hölle auf Erden" kennenlernt. Statt im Goldrausch unterzugehen, besinnt sich Giuseppe auf das Einzige, was ihm geblieben ist: sein Handwerk. Er versteht, dass wahre Macht nicht im flüchtigen Gold liegt, sondern im Eisen, das die Welt formt. Aufstieg und Familie Inmitten von Schlamm, Gewalt und Gier baut Giuseppe seine eigene Schmiede auf. Er findet unverhoffte Verbündete wie den rauen Iren Patrick Kearney, der zum loyalen Freund fürs Leben wird. Und er findet Liebe: Lucia D'Angelo, eine stolze Italienerin, die ihre eigenen Narben trägt und Giuseppe lehrt, dass man nicht nur überleben, sondern auch leben muss. Zusammen trotzen sie Stürmen, Schutzgelderpressern wie dem gefährlichen Samuel Price und den politischen Unruhen (Eureka Stockade), die das Lager erschüttern. Eine neue Generation wächst heran: Das Buch endet im Jahr 1875. : Eine Familie, die nicht mehr nur überlebt, sondern gedeiht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
DIE MORETTI-SAGA
Buch 1
GOLD
1850 - 1875
Ein Mann. Ein Hammer. Ein Schweigen.
Danilo Sieren
2
3
Inhaltsverzeichnis
PROLOG: DIE FLAMME
KAPITEL 1
DER URSPRUNG DES SCHWEIGENS ......................................................................9
KAPITEL 2
DER SCHMIED .........................................................................................................16
KAPITEL 3
DAS CAMP ................................................................................................................29
KAPITEL 4
LUCIAS SCHWEIGEN ..............................................................................................43
KAPITEL 5
DIE GLUT IM REGEN ..............................................................................................56
KAPITEL 6
DAS GESETZ DER HÄNDE ......................................................................................69
KAPITEL 7
PATRICK KEARNEY ..................................................................................................81
KAPITEL 8
DER PREIS DES METALLS ......................................................................................93
KAPITEL 9
DIE NARBEN ...........................................................................................................105
KAPITEL 10
MARIA ......................................................................................................................117
KAPITEL 11
DIE JAHRE DER STILLE ........................................................................................128
KAPITEL 12
4
DER ERSTE LEHRLING .........................................................................................140
KAPITEL 13
DER SCHATTEN KEHRT ZURÜCK .......................................................................150
KAPITEL 14
MARCOS WEG ........................................................................................................159
KAPITEL 15
DIE LETZTEN JAHRE — 1868 BIS 1870 ...............................................................169
KAPITEL 16
MARCOS SCHMIEDE — 1871 BIS 1872 ...............................................................183
KAPITEL 17
MARIAS RÜCKKEHR — SOMMER 1872 ..............................................................197
KAPITEL 18
DIE BRÜCKE ÜBER DEN LODDON — HERBST 1873 ........................................207
KAPITEL 19
DER TAG DER WAHRHEIT — APRIL 1874 ...........................................................217
KAPITEL 20
DAS VERMÄCHTNIS — WINTER 1875 .................................................................227
IMPRESSUM
5
6
Prolog: Die Flamme
Es gibt Geschichten, die mit Feuer beginnen, und es gibt Geschichten, die mit Feuer enden. Die Geschichte der Morettis ist beides. In den Annalen der Geschichte gibt es Namen, die in Stein gemeißelt sind - die Cäsaren, die Medici, die Rothschilds. Familien, deren Macht so groß war, dass sie den Lauf der Welt veränderten. Aber es gibt auch Namen, die niemals aufgeschrieben wurden. Namen, die nur im Flüstern weitergegeben wurden, von Mann zu Mann, von Generation zu Generation.
Moretti ist so ein Name.
Niemand weiß mit Sicherheit, wann die Morettis zum ersten Mal auftauchten. Manche sagen, es war in Neapel, in den schmutzigen Gassen des Hafenviertels, wo das Leben billig war und der Tod noch billiger. Andere behaupten, die Familie existierte schon viel früher, vielleicht sogar in den Tagen des Römischen Reiches, als Schmiede Schwerter für Legionäre schmiedeten und Könige zu ihren Schutzherren zählten.
Aber die wahre Geschichte beginnt nicht in der Vergangenheit. Sie beginnt an einem Dienstag im Februar 1850, in einer Schmiede, die nach Schwefel und Blut roch. Das ist die Geschichte von Giuseppe Moretti - einem Mann, der niemals König war, aber der ein Reich aufbaute. Einem Mann, der niemals sprach, aber dessen Schweigen lauter war als tausend Worte. Einem Mann, der verstand, dass Feuer nicht nur zerstört.
Es formt auch.
Und was Giuseppe Moretti aus den Flammen formte, würde die Welt für immer verändern. Dies ist keine Geschichte von Helden. Es ist eine Geschichte von Überlebenden. Von Männern und Frauen, die verstanden, dass Moral ein Luxus ist, den sich nur die Reichen leisten können. Von Menschen, die lernten, dass Schweigen manchmal die lauteste Waffe ist.
Es ist eine Geschichte von Blut und Gold, von Feuer und Eisen, von Ehre und Verrat.
7
Es ist die Geschichte der Morettis.
8
KAPITEL 1
Der Ursprung des Schweigens
»Manche Männer werden aus Feuer geboren. Andere verbrennen
darin.«
Giuseppe Moretti erinnerte sich nicht an den Tag seiner Geburt, aber er erinnerte sich an den Tag, an dem er zum ersten Mal starb.
Es war ein Dienstag im Februar 1850, drei Tage bevor das Schiff 'Vittoria' den Hafen von Neapel verließ. Die Sonne hing schwer über dem Golf, eine bleierne Kugel in einem Himmel, der nach Schwefel und verbranntem Holz roch. Giuseppe stand in der Schmiede seines Vaters, die Esse glühte wie das Herz eines sterbenden Gottes, und in seinen Händen hielt er einen Hammer, der schwerer war als sein eigenes Leben.
»Schlage«, sagte sein Vater.
Giuseppe schlug.
Das Eisen sang. Es war kein Lied der Freude, sondern ein Schrei - metallisch, gellend, wie der letzte Atemzug eines Mannes, der weiß, dass er verloren ist. Funken spritzten in die Dunkelheit der Werkstatt, kleine Sterne, die für einen Augenblick lebten und dann erloschen. Der Junge war vierzehn Jahre alt, und seine Hände waren bereits vernarbtes Leder.
»Noch einmal«, befahl der Vater.
Giuseppe schlug noch einmal. Und noch einmal. Jeder Schlag ein Versprechen. Jeder Funke ein Gebet.
Die Schmiede war kein Ort der Gnade. Sie war ein Ort der Transformation, wo Rohes zu Nützlichem wurde, wo Chaos zu Ordnung gezwungen wurde durch die rohe Gewalt menschlicher Hände und das brennende Herz der Esse. Hier, zwischen den rußgeschwärzten
9
Wänden und dem Geruch von geschmolzenem Metall, lernte Giuseppe die erste große Lektion seines Lebens: Alles in dieser Welt muss sich beugen. Entweder du beugst das Eisen, oder das Leben beugt dich.
Er hatte nie verstanden, warum sein Vater ihn hasste. Vielleicht, weil er der Jüngste von sieben Kindern war und der Einzige, der lebte. Die anderen - drei Brüder, drei Schwestern - waren alle vor ihrem fünften Lebensjahr gestorben. Cholera. Hunger. Das Leben in den engen Gassen von Neapel verschlang Kinder wie ein hungriger Wolf. Giuseppe überlebte nicht, weil er stärker war. Er überlebte, weil er lernte, unsichtbar zu sein.
Sein Vater, Lorenzo Moretti, war ein Mann aus Stein. Groß, breit, mit Händen, die Hufeisen verbiegen konnten, und einem Gesicht, das keine Regung zeigte. Die Leute im Viertel nannten ihn 'Il Taciturno' - den Schweigenden. Nicht, weil er nicht sprechen konnte, sondern weil er es nicht wollte. Lorenzo Moretti glaubte, dass Worte Schwäche zeigten. Ein richtiger Mann sprach mit seinen Händen, mit dem Hammer, mit dem Stahl.
Und Giuseppe lernte, zu schweigen.
Die Schmiede lag in der Via dei Fabbri, der Straße der Schmiede, im Herzen des alten Neapels. Es war eine Gegend, in der das Hämmern von Metall nie aufhörte, wo der Rauch so dick war, dass man die Sonne nur als blassen Fleck am Himmel sah. Hier lebten Männer, deren Lungen schwarz waren vom eingeatmeten Ruß, deren Hände vernarbten Fleisches waren, deren Gesichter die Linien des Feuers trugen.
Giuseppe kannte jeden von ihnen. Da war Alfonso, der alte Hufschmied, dessen Rücken so gekrümmt war, dass er aussah wie ein lebender Fragezeichen. Marcello, der junge Waffenschmied, der prahl erzählte, wie seine Klingen im letzten Krieg verwendet worden waren. Antonio, der schweigsame Kesselschmied, der seine Frau bei der Geburt ihres dritten Kindes verloren hatte und seitdem nur noch arbeitete, Tag und Nacht, als könnte er den Schmerz wegschmieden.
Sie alle kannten Lorenzo Moretti. Respektierten ihn. Fürchteten ihn ein wenig. Lorenzo war nicht der beste Schmied in der Straße - das war wahrscheinlich Marcello, dessen Klingen scharf genug waren, um Haare in der Luft zu durchtrennen. Aber Lorenzo war der härteste.
10
Der unbeugsame. Der Mann, der niemals aufgab, niemals nachgab, niemals zeigte, dass etwas ihn berührte.
Außer an jenem Dienstag.
* * *
An jenem Dienstag, drei Tage vor der Abreise, betrat ein Mann die Schmiede.
Er war groß und dünn, trug einen schwarzen Mantel trotz der Hitze und roch nach Lavendel und Verwesung. Seine Augen waren farblos wie Glas, und als er sprach, klang seine Stimme wie das Kratzen einer Klinge über Stein.
»Ich suche einen Schmied«, sagte der Mann.
Giuseppe, der gerade einen Spaten schärfte, hielt inne. Es war etwas in der Stimme des Mannes, das ihn erschaudern ließ. Etwas Kaltes, Unmenschliches. Er sah auf und beobachtete, wie der Fremde die Schmiede musterte - nicht wie ein Kunde, der ein Werkzeug braucht, sondern wie ein Raubtier, das sein Territorium vermisst.
Lorenzo Moretti trat aus dem Schatten der Esse, wo die Hitze die Luft vibrieren ließ. Schweiß lief ihm über den nackten Oberkörper, der mit Narben übersät war - Erinnerungen an vierzig Jahre Arbeit mit glühendem Metall. Er war ein massiger Mann, mit Armen wie Baumstämme und einem Gesicht, das aussah, als wäre es selbst geschmiedet worden - hart, kantig, ohne Gnade. Sein Blick traf den des Fremden, und für einen langen Moment sagten beide nichts.
Die Stille in der Schmiede war so dicht, dass Giuseppe seinen eigenen Herzschlag hören konnte. Das Feuer in der Esse knisterte. Irgendwo in der Ferne schrie ein Kind. Das Leben der Stadt ging weiter, aber hier, in diesem Moment, schien die Zeit stillzustehen.
»Ich bin ein Schmied«, sagte Lorenzo schließlich, seine Stimme tief wie ferner Donner.
Der Fremde lächelte, aber es war kein Lächeln der Freundlichkeit. Es war das Lächeln eines Mannes, der weiß, dass er die Kontrolle hat, dass er bereits gewonnen hat, bevor das Spiel
11
begonnen hat. »Nicht irgendein Schmied«, sagte er und trat näher. »Ich suche einen Mann, der schweigen kann.«
»Schweigen ist eine Tugend«, antwortete Lorenzo, aber Giuseppe hörte die Spannung in der Stimme seines Vaters. Er kannte diesen Ton. Es war die Stimme eines Mannes, der Gefahr wittert.
»Eine teure Tugend.« Der Fremde trat noch näher. Das Licht der Esse tanzte über sein Gesicht und verwandelte es in eine Maske aus Licht und Schatten, schön und schrecklich zugleich. »Was ich von dir brauche, darf niemals das Tageslicht sehen. Niemals in einem Gerichtssaal erwähnt werden. Niemals auf einer Polizeiakte erscheinen.«
Lorenzos Kiefer spannte sich an. »Was brauchst du?«
Der Fremde zog etwas aus seinem Mantel - ein Messer. Aber es war kein gewöhnliches Messer. Die Klinge war dünn wie eine Nadel, gekrümmt wie die Sichel des Todes, mit einer Schneide, die im Licht der Esse glänzte wie flüssiges Silber. Der Griff war aus schwarzem Holz, poliert auf Hochglanz, und passte perfekt in die Hand. Es war ein Kunstwerk. Ein tödliches Kunstwerk.
Und an der Spitze der Klinge klebte etwas Dunkles.
Giuseppe trat näher, von einer Mischung aus Faszination und Abscheu getrieben. Als er das Messer genauer betrachtete, erkannte er, was das Dunkle war.
Es war Blut.
Nicht frisches Blut. Getrocknetes, verkrustetes Blut, das sich in die winzigen Rillen der Klinge gegraben hatte. Blut, das erzählte, dass dieses Messer bereits getötet hatte, vielleicht mehr als einmal.
»Ich brauche zwanzig davon«, sagte der Mann und legte das Messer auf den Amboss mit einer Vorsicht, die Respekt oder vielleicht Angst verriet. »In einer Woche. Die Klinge muss scharf genug sein, um Sehnen zu durchtrennen, aber dünn genug, um zwischen Rippen zu gleiten. Der Griff muss Balance haben, perfekte Balance, damit kein Fehlstoß möglich ist.
12
Jedes Messer muss identisch sein - gleiche Länge, gleiche Krümmung, gleiche Gewichtsverteilung. Können Sie das?«
»Das ist unmöglich«, sagte Lorenzo sofort. »Eine Woche ist nicht genug Zeit für solche Präzisionsarbeit. Jedes Messer würde mindestens zwei, drei Tage brauchen. Allein das Schmieden der Klinge, dann das Härten, das Schärfen, der Griff...«
»Nichts ist unmöglich für den richtigen Preis.« Der Fremde zog eine Ledertasche aus seinem Mantel, eine Tasche, die unter ihrem Gewicht schwer hing. Er legte sie auf den Amboss neben dem Messer. Das Geräusch, das sie machte, als sie aufschlug, war das unverkennbare Singen von Metall auf Metall - das süße Lied von Gold.
Giuseppe hatte in seinem kurzen Leben viel Gold gesehen. Neapel war eine Hafenstadt, und mit den Schiffen kam auch der Reichtum. Händler, Seemänner, manchmal sogar Adelige passierten durch die Via dei Fabbri auf ihrem Weg zu den Vergnügungen der Stadt. Aber er hatte noch nie so viel Gold auf einmal gesehen.
Die Tasche war prall gefüllt mit Münzen - nicht die kleinen Kupfermünzen der Armen oder die Silberlire der Mittelklasse, sondern echte Goldducati, jeder so schwer wie ein Hühnerei. Giuseppe konnte sie durch das Leder sehen, konnte ihr Gewicht förmlich spüren. Es war mehr Geld, als sein Vater in zehn Jahren verdienen würde. Vielleicht in zwanzig.
Lorenzo starrte auf die Tasche, dann auf das Messer, dann auf den Mann. Sein Gesicht blieb ausdruckslos, aber Giuseppe kannte seinen Vater gut genug, um die innere Spannung zu erkennen. Er sah, wie sich Lorenzos Hände öffneten und schlossen, wie ein Muskel in seinem Kiefer zuckte. Lorenzo Moretti war ein Mann von Prinzipien, aber er war auch ein Mann mit Schulden. Viele Schulden.
Das Leben in Neapel war teuer. Die Miete für die Schmiede. Das Essen. Die Kleidung. Die Medikamente für Maria, Giuseppes Mutter, die seit Jahren an einer schleichenden Lungenkrankheit litt. Und dann waren da noch die Schulden bei Don Salvatore, dem lokalen Geldverleiher, einem Mann, dessen Geduld dünn war und dessen Methoden brutal.
13
Giuseppe wusste, dass sein Vater nachts nicht schlafen konnte. Er hatte ihn gehört, wie er in der Küche saß und Zahlen murmelte, wie er mit sich selbst stritt. Die Familie stand am Rand des Ruins, und alle wussten es.
»Und wenn ich nein sage?«, fragte Lorenzo leise.
Der Fremde lächelte wieder, und diesmal war das Lächeln noch kälter. »Dann wirst du sterben. Und dein Sohn auch. Und alle, die du liebst. Ich werde sie einen nach dem anderen finden, und ich werde sie langsam sterben lassen, damit du weißt, was deine Weigerung gekostet hat. Zuerst deine Frau. Dann den Jungen. Vielleicht lasse ich dich zusehen, bevor du selbst stirbst.«
Die Worte wurden ohne Emotion gesprochen, fast beiläufig, als würde der Mann über das Wetter reden. Aber ihre Wirkung war verheerend. Giuseppe spürte, wie sein Herz schneller schlug, wie sich seine Handflächen mit Schweiß füllten. Er wollte etwas sagen, irgendetwas, aber die Worte blieben ihm in der Kehle stecken.
Lorenzo schwieg lange. Die Entscheidung war bereits getroffen worden in dem Moment, als der Fremde die Tasche mit Gold gezeigt hatte. Aber Lorenzo war ein stolzer Mann, und Stolz verlangt Zeit, auch wenn die Entscheidung bereits gefallen ist.
Schließlich nickte er. »Eine Woche«, sagte er. »Zwanzig Messer.«
»Ausgezeichnet.« Der Fremde nahm das Messer vom Amboss und steckte es zurück in seinen Mantel, bewegte sich dabei mit einer Flüssigkeit, die eher an eine Schlange als an einen Menschen erinnerte. »Ich komme in sieben Tagen zurück, bei Sonnenuntergang. Wenn die Arbeit gut ist, wirst du reich sein, reicher als du je zu träumen gewagt hast. Wenn nicht...« Er ließ den Satz unvollendet, aber die Drohung war klarer als jede ausgesprochene Warnung.
Er ging zur Tür, sein Mantel raschelte wie Flügel. Dort drehte er sich noch einmal um, und im Gegenlicht der untergehenden Sonne sah er aus wie eine Erscheinung aus einem Albtraum. »Falls Ihr jemals darüber nachdenken solltet, mit jemandem zu sprechen - mit der Polizei, einem Priester, wem auch immer - erinnert Euch daran, dass ich alles weiß. Wo Ihr lebt. Wo Eure Frau einkauft. Wo Euer Sohn spielt. Ich habe Augen überall. Schweigen ist nicht nur eine Tugend, meine Freunde. Es ist Überleben.«
14
Und damit verschwand er in der Abenddämmerung, sein schwarzer Mantel verschmolz mit den Schatten der Gasse. Das Klappern seiner Schritte hallte noch lange nach, ein unheimlicher Rhythmus, der sich in Giuseppes Gedächtnis einbrannte.
* * *
15
KAPITEL 2
Der Schmied
»Aus Hoffnung wird Überleben. Aus Überleben wird Macht.«
Die sieben Tage waren eine Reise durch die Hölle.
Giuseppe hatte gedacht, er kenne harte Arbeit. Er hatte sein ganzes Leben in der Schmiede verbracht, hatte jeden Tag zwölf, vierzehn, manchmal sechzehn Stunden mit Hammer und Esse verbracht. Seine Hände waren Landkarten aus Narben, sein Rücken gekrümmt von der ewigen Beugung über den Amboss, seine Lungen geschwärzt vom eingeatmeten Rauch. Er hatte gedacht, er wisse, was es bedeutete, zu leiden.
Er hatte sich geirrt.
In jener ersten Nacht, nachdem der Fremde im schwarzen Mantel verschwunden war, nachdem die Ledertasche voller Gold auf dem Amboss lag, wie eine Schlange, die auf ihre Beute wartet, in jener Nacht begann die wahre Arbeit. Lorenzo öffnete die Tasche nicht. Er sah sie nicht einmal an. Stattdessen nahm er das Messer - das blutverschmierte Meisterwerk der Mörderkunst - und studierte es mit der Konzentration eines Mannes, der weiß, dass sein Leben davon abhängt.
»Wir brauchen den besten Stahl«, sagte er schließlich, mehr zu sich selbst als zu Giuseppe. »Nicht den italienischen Müll, den wir normalerweise verwenden. Wir brauchen Toledo-Stahl, vielleicht sogar Damastener, wenn wir welchen finden können. Die Klinge muss flexibel sein, aber nicht zu flexibel. Scharf, aber nicht spröde. Es ist ein Tanz auf dem Messer Schneide.« Er lachte bitter über sein eigenes Wortspiel. »Passend, nicht wahr?«
Giuseppe sagte nichts. Er wusste, dass sein Vater keine Antwort erwartete. Lorenzo sprach mit sich selbst, arbeitete das Problem durch, Schicht für Schicht, wie er ein Stück Metall bearbeiten würde.
16
»Das Härten wird kritisch sein«, fuhr Lorenzo fort. »Zu heiß, und der Stahl wird spröde wie Glas. Zu kühl, und er wird weich bleiben wie Butter. Wir brauchen die exakte Temperatur, und wir brauchen sie zwanzig Mal zu reproduzieren. Zwanzig identische Klingen. Unmöglich.« Er drehte das Messer in seinen massigen Händen, ließ das Licht der Esse über die Klinge tanzen. »Aber wir haben keine Wahl.«
Er sah Giuseppe an, und zum ersten Mal in seinem Leben sah der Junge etwas in den Augen seines Vaters, das er nie erwartet hätte zu sehen. Nicht Liebe - Lorenzo Moretti war nicht fähig zu Liebe, oder wenn er es war, hatte er diese Fähigkeit vor langer Zeit begraben. Aber da war etwas anderes. Respekt vielleicht. Oder Anerkennung, dass sie in diesem zusammen waren, dass sie beide die Last tragen mussten.
»Wir schlafen nicht diese Woche«, sagte Lorenzo. »Wir essen nur, wenn wir müssen. Wir arbeiten, bis wir umfallen, und dann arbeiten wir weiter. Verstehst du?«
Giuseppe nickte.
»Gut. Dann lass uns beginnen.«
* * *
Die erste Aufgabe war, den richtigen Stahl zu finden. Lorenzo schickte Giuseppe durch ganz Neapel, von Schmied zu Schmied, auf der Suche nach dem besten Material, das verfügbar war. Es war noch vor Sonnenaufgang, als Giuseppe die Schmiede verließ, und die Stadt war ein Geist ihrer selbst - leer, still, nur die Ratten und die gelegentlichen Betrunkenen bevölkerten die Gassen.
Er ging zuerst zu Marcello, dem Waffenschmied, weil Marcello Zugang zu den besten Stahllieferungen hatte. Aber Marcellos Werkstatt war verschlossen, und kein noch so lautes Klopfen brachte eine Antwort. Giuseppe wartete eine Stunde, während die Sonne langsam über die Dächer kroch, und klopfte jede zehn Minuten erneut. Nichts.
Dann zu Alfonso, dem alten Hufschmied. Alfonso war immer früh wach - seine schmerzenden Gelenke ließen ihn nicht länger schlafen. Giuseppe fand ihn in seiner
17
Werkstatt, bereits bei der Arbeit an einem Pferdeschuh, sein gekrümmter Rücken über den Amboss gebeugt.
»Junge«, knurrte Alfonso, ohne aufzusehen. »Was willst du um diese gottlose Stunde?«
»Stahl«, sagte Giuseppe. »Den besten, den Ihr habt. Mein Vater schickt mich. Er zahlt gut.«
Alfonso legte den Hammer nieder und richtete sich auf, so weit sein verkrümmter Rücken es zuließ. Er musterte Giuseppe mit seinen scharfen, alten Augen. »Lorenzo Moretti zahlt gut? Das ist neu. Was schmiedet ihr denn, dass er plötzlich Geld auszugeben bereit ist?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Kannst nicht oder willst nicht?«
»Beides.«
Alfonso grinste, enthüllte eine Reihe verfaulter Zähne. »Geheimnisse, hmm? Nun, Geheimnisse haben ihren Preis, genauso wie guter Stahl. Wie viel brauchst du?«
»Genug für zwanzig Klingen. Klein, dünn, aber stark.«
»Messer?«
Giuseppe zögerte, dann nickte.
»Waffen also.« Alfonso spuckte auf den Boden. »Ich mag keine Waffenschmiede. Sie bringen nur Tod. Aber...« Er sah Giuseppe an, und etwas in seinem Blick wurde weicher. »Du bist ein guter Junge, Giuseppe. Dein Vater ist ein harter Mann, aber du... du hast noch eine Seele. Ich habe Toledo-Stahl, importiert aus Spanien, die beste Qualität. Normalerweise würde ich ihn für Marcellos Schwerter aufheben, aber für dich...« Er ging zu einer Truhe in der Ecke seiner Werkstatt und öffnete sie. Drinnen lagen Barren aus dunklem Stahl, jeder etwa so lang wie Giuseppes Unterarm. »Nimm, was du brauchst. Aber Giuseppe...« Seine Stimme wurde ernst. »Was auch immer dein Vater macht, sei vorsichtig. Ich kenne diesen Blick in den Augen eines Mannes. Den Blick von jemandem, der etwas tut, das er nicht tun sollte. Sei vorsichtig.«
18
Giuseppe nahm den Stahl - fünf Barren, jeder schwer wie Sünde - und machte sich auf den Weg zurück zur Schmiede. Die Sonne stand jetzt hoch am Himmel, und die Straßen von Neapel erwachten zum Leben. Händler riefen ihre Waren aus, Kinder spielten in den Gassen, Frauen wuschen Wäsche in den öffentlichen Brunnen. Das normale Leben ging weiter, gleichgültig gegenüber dem dunklen Drama, das sich in der Schmiede der Morettis abspielte.
* * *
Als Giuseppe zurückkehrte, hatte Lorenzo die Esse bereits auf Höchsttemperatur gebracht. Die Hitze, die aus dem glühenden Schlund strömte, war so intensiv, dass Giuseppe sie auf seiner Haut spüren konnte, noch bevor er die Werkstatt betrat. Es war, als würde man in einen Ofen gehen, als würde man der Sonne zu nahe kommen.
»Gut«, sagte Lorenzo, als er den Stahl sah. »Toledo. Alfonso?«
Giuseppe nickte.
»Der alte Narr hat ein weiches Herz. Das wird ihn eines Tages umbringen.« Lorenzo nahm einen der Barren und wog ihn in seiner Hand. »Aber sein Stahl ist gut. Das wird funktionieren. Jetzt, Giuseppe, hör mir sehr genau zu. Was wir in den nächsten sieben Tagen tun, ist das Schwierigste, was du je getan haben wirst. Schwieriger als alles, was du dir vorstellen kannst. Wir müssen zwanzig identische Messer schaffen, jedes perfekt, jedes tödlich. Ein Fehler, und wir sterben. Verstehst du? Nicht vielleicht. Nicht möglicherweise. Wir sterben. Der Mann, der diese Messer bestellt hat, macht keine leeren Drohungen.«
»Ich verstehe«, sagte Giuseppe, obwohl er nicht sicher war, ob er wirklich verstand. Wie konnte man verstehen, was es bedeutete zu sterben, wenn man noch nie wirklich gelebt hatte?
»Dann lass uns beginnen.«
Lorenzo legte den ersten Stahlbarren in die Esse. Das Metall begann sofort zu glühen, erst dunkelrot, dann heller, heller, bis es fast weiß war, leuchtend wie ein gefallener Stern. Die Hitze war so intensiv, dass die Luft darum herum vibrierte, sich wand wie ein lebendiges Wesen.
19
»Beobachte die Farbe«, sagte Lorenzo. »Nicht die Esse. Das Metall. Siehst du, wie es von rot zu orange wechselt? Das ist gut. Wir wollen orange, fast gelb. Das ist die perfekte Temperatur zum Schmieden. Zu heiß, und der Stahl verbrennt. Zu kalt, und er bricht unter dem Hammer.«
Giuseppe beobachtete, fasziniert trotz seiner Angst. Er hatte tausendmal zugesehen, wie sein Vater Metall schmiedete, aber dies war anders. Dies war keine Routine. Dies war Präzision, gefordert unter Todesdrohung.
Als das Metall die richtige Farbe erreicht hatte - ein leuchtendes Orange, das schmerzte, es anzusehen - nahm Lorenzo es mit der langen Zange aus der Esse und legte es auf den Amboss. Dann begann er zu hämmern.
Der Rhythmus war hypnotisierend. Schlag. Pause. Schlag. Pause. Jeder Schlag präzise platziert, jeder mit exakt der richtigen Kraft. Das Metall begann sich zu strecken, zu dünn, formte sich unter Lorenzos Willen. Funken flogen bei jedem Aufprall, kleine Explosionen von Licht und Hitze.
»Halte es«, befahl Lorenzo.
Giuseppe griff nach einer zweiten Zange und hielt das glühende Metall fest, während sein Vater weiterhämmerte. Die Hitze war unerträglich, selbst durch das dicke Leder der Handschuhe. Sein Gesicht fühlte sich an, als würde es schmelzen. Schweiß lief ihm in die Augen, brannte, verschwamm seine Sicht.
Aber er hielt. Er musste.
Stunde um Stunde arbeiteten sie. Das Metall wurde immer wieder in die Esse zurückgelegt, erhitzt, gehämmert. Langsam nahm es Form an - die lange, dünne Form einer Klinge. Lorenzo arbeitete mit einer Präzision, die Giuseppe noch nie gesehen hatte. Jeder Hammerschlag war gemessen, kontrolliert. Keine verschwendete Bewegung. Keine Fehler.
Als die Sonne unterging, war die erste Klinge geformt. Sie lag auf dem Amboss, noch nicht geschliffen oder poliert, aber bereits erkennbar, als das, was sie werden würde - eine Waffe. Ein Werkzeug des Todes.
20
Lorenzo betrachtete sie lange, dann schüttelte er den Kopf. »Nicht gut genug. Die Krümmung ist falsch. Siehst du?« Er zeigte auf einen Punkt nahe der Spitze. »Hier ist sie zu flach. Sie muss perfekt sein. Alles oder nichts.«
Er nahm die Klinge und warf sie in eine Ecke, wo sie klappernd auf einem Haufen Schrott landete.
»Wir beginnen von vorn«, sagte er.
* * *
Die Nächte verschwammen zu einem einzigen, endlosen Albtraum aus Feuer und Schmerz.
Giuseppe verlor das Gefühl für Zeit. War es der zweite Tag? Der dritte? Er wusste es nicht mehr. Alles, was existierte, war die Esse, der Amboss, das glühende Metall, der unbarmherzige Rhythmus des Hammers. Seine Hände waren eine einzige Masse aus Blasen und aufgeplatzter Haut. Seine Lungen brannten vom eingeatmeten Rauch. Seine Augen waren rot und geschwollen, tränten ständig von der Hitze und dem Ruß.
Aber er arbeitete weiter.
Lorenzo war noch schlimmer dran. Der ältere Mann hustete jetzt fast ständig, ein tiefer, nasser Husten, der Blut hervorbrachte. Seine Bewegungen wurden langsamer, unsicherer. Mehrmals musste er sich am Amboss abstützen, um nicht umzufallen. Aber er weigerte sich zu ruhen.
»Wir haben keine Zeit«, sagte er, wann immer Giuseppe vorschlug, eine Pause zu machen. »Keine Zeit.«
Am dritten Tag - oder war es der vierte? - kam Giuseppes Mutter in die Schmiede.
Maria Moretti war einmal eine schöne Frau gewesen. Giuseppe hatte Bilder von ihr gesehen, Daguerreotypie aus ihrer Jugend, wo sie lächelte, ihre Augen strahlend, ihr Gesicht unbeschwert. Aber das war vor den sechs toten Kindern gewesen. Vor den Jahren der Armut und Krankheit. Vor der langsamen, unaufhaltsamen Lungenkrankheit, die sie von innen heraus auffraß.
21
Jetzt war sie ein Schatten, dünn wie Pergament, ihre Haut grau, ihre Augen eingefallen. Sie bewegte sich wie ein Geist durch das Haus, kaum bemerkt, kaum da. Lorenzo sprach nicht mehr mit ihr - hatte seit Jahren nicht mehr wirklich mit ihr gesprochen. Sie waren Fremde, die unter einem Dach lebten, verbunden nur durch die Erinnerung an das, was sie einmal gewesen waren.
»Was tut ihr?«, fragte sie jetzt, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern, aber es lag eine Verzweiflung darin, die lauter war als jeder Schrei.
Lorenzo sah sie nicht an. Er hämmerte weiter, der Rhythmus unterbrochen, seine Konzentration gestört durch ihre Anwesenheit. »Wir arbeiten.«
»An was? Was kann so wichtig sein, dass ihr euch umbringt? Giuseppe ist noch ein Kind. Sieh ihn dir an, Lorenzo. Sieh, was du ihm antust.«
»Er ist kein Kind mehr. Er ist ein Mann. Und Männer tun, was getan werden muss.«
»Männer? Er ist vierzehn Jahre alt!«
»Ich war zwölf, als ich anfing zu arbeiten. Zwölf, Maria. Er hat Glück.«
»Glück?« Marias Stimme brach. Tränen liefen über ihre hohlen Wangen. »Das ist kein Glück, Lorenzo. Das ist Wahnsinn. Was auch immer du tust, es ist nicht richtig. Ich kann es fühlen. Es ist... es ist böse.«
Lorenzo legte endlich den Hammer ab. Er wandte sich seiner Frau zu, und Giuseppe sah etwas Schreckliches in seinem Gesicht - nicht Wut, nicht Hass, sondern eine Art tödliche Resignation. »Geh zurück ins Haus, Maria. Dies geht dich nichts an.«
»Es geht mich alles an! Ihr seid meine Familie. Alles, was ich noch habe.«
»Nein.« Lorenzos Stimme war jetzt kalt, endgültig. »Ich habe schon sechs Kinder begraben, Maria. Ich werde nicht noch einen begraben. Nicht Giuseppe. Was ich tue, tue ich für ihn. Für uns. Um zu überleben.«
»Was ist Überleben wert, wenn wir unsere Seelen verlieren?«
22
Die Frage hing in der Luft zwischen ihnen, schwer wie Blei. Lorenzo hatte keine Antwort darauf, oder wenn er eine hatte, wollte er sie nicht teilen. Er nahm nur den Hammer wieder auf und begann erneut zu schlagen, härter jetzt, wütender, als könnte er die Wahrheit von Marias Worten wegschmieden.
Maria stand noch lange da, die Tränen trockneten auf ihren Wangen, hinterließen Salzspuren wie die Pfade verlorener Hoffnung. Sie sah Giuseppe an, und in ihren Augen lag so viel Schmerz, dass er wegschauen musste. Dann drehte sie sich um und ging, ihre Schritte langsam, die eines alten Menschen, obwohl sie erst fünfunddreißig war.
Giuseppe würde sie nie wiedersehen.
* * *
Am sechsten Tag hatten sie fünfzehn Klingen fertig.
Sie lagen aufgereiht auf einer langen Werkbank, jede identisch, jede tödlich schön. Das Metall war jetzt gehärtet und geschliffen, die Klingen schimmerten wie flüssiges Silber im Licht der Esse. Giuseppe hatte sie geschärft, Stunde um Stunde an der Schleifscheibe, bis seine Arme vor Erschöpfung zitterten und er das Geräusch des Steins auf Stahl in seinen Träumen hörte.
Lorenzo hatte die Griffe gemacht - Ebenholz, importiert aus Afrika, so schwarz wie die Nacht, so hart wie Stein. Er hatte sie geschnitzt mit einer Sorgfalt, die Giuseppe überraschte. Trotz seiner Erschöpfung, trotz des Hustens, der jetzt fast konstant war, trotz des Blutes, das er jedes Mal ausspuckte, arbeitete Lorenzo mit der Präzision eines Uhrmachers. Jeder Griff war identisch, bis auf den Bruchteil eines Millimeters.
»Fünf noch«, sagte Lorenzo, seine Stimme rau, kaum mehr als ein Krächzen. »Fünf, und wir sind fertig.«
Aber Giuseppe sah, dass sein Vater am Ende seiner Kräfte war. Lorenzo schwankte, als er stand, musste sich am Amboss festhalten. Sein Gesicht war grau, seine Lippen blau. Jeder Atemzug schien eine Anstrengung zu sein, ein Kampf gegen die eigenen Lungen.
»Vater«, sagte Giuseppe leise. »Du musst dich ausruhen.«
23
»Keine Zeit.«
»Nur eine Stunde. Bitte.«
Lorenzo sah seinen Sohn an, und für einen Moment - nur einen kurzen, kostbaren Moment - sah Giuseppe etwas in den Augen seines Vaters, das Liebe sein könnte. Oder vielleicht war es nur Erschöpfung. Es war schwer zu sagen.
»Eine Stunde«, sagte Lorenzo schließlich. »Nicht mehr.«
Er taumelte zu einer Ecke der Werkstatt, wo ein Haufen alter Säcke lag, und ließ sich darauf fallen. Innerhalb von Sekunden war er eingeschlafen, sein Atem röchelnd, unregelmäßig.
Giuseppe beobachtete ihn eine Weile, dann kehrte er zur Arbeit zurück. Jemand musste die letzten fünf Messer fertigstellen, und wenn sein Vater es nicht tun konnte, dann musste er es tun.
Er arbeitete durch die Nacht, allein jetzt, nur das Feuer als Gesellschaft. Seine Hände bewegten sich fast automatisch, geleitet von den Lektionen tausender Stunden an der Esse. Erhitzen. Hämmern. Formen. Wieder und wieder, bis das Metall sich seinem Willen beugte.
Als die Sonne aufging, war die zwanzigste Klinge fertig.
* * *
Am siebten Tag, bei Sonnenuntergang, kehrte der Fremde zurück.
Die zwanzig Messer lagen auf dem Amboss, perfekt arrangiert wie die Zähne eines Raubtiers. Jedes war identisch - gleiche Länge, gleiche Krümmung, gleiche tödliche Eleganz. Das Licht der untergehenden Sonne, das durch das schmale Fenster der Schmiede fiel, tanzte über die Klingen und ließ sie aussehen wie flüssiges Feuer.
Der Mann trat ein, sein schwarzer Mantel raschelte wie die Flügel eines Raben. Er bewegte sich langsam, genussvoll, ein Raubtier, das seine Beute einkreist. Er ging um den Amboss herum, betrachtete jedes Messer einzeln, hob einige auf, testete ihre Balance, prüfte die Schärfe mit seinem Daumen. Blut perlte auf der Haut, aber er schien es nicht zu bemerken oder sich nicht daran zu stören.
24
Giuseppe und Lorenzo standen schweigend da und beobachteten. Giuseppe fühlte sein Herz in seiner Brust hämmern. Sieben Tage Arbeit. Sieben Tage Hölle. Alles hing jetzt von dem Urteil dieses Fremden ab.
»Perfekt« sagte der Mann schließlich, und es klang fast wie ein Seufzer der Erleichterung, oder vielleicht der Bewunderung. »Absolut perfekt. Ihr seid wahre Meister eures Handwerks. Ich hatte gehofft, dass ihr liefern würdet, aber dies...« Er hob eines der Messer ins Licht. »Dies übertrifft meine Erwartungen.«
Er zog einen schwarzen Samtsack aus seinem Mantel und begann, die Messer sorgfältig hineinzulegen. Jedes wurde in weichen Samt gewickelt, behandelt mit einer Sorgfalt, die beinahe respektvoll wirkte. Und in gewisser Weise waren sie das auch - Kunstwerke. Tödliche, schreckliche Kunstwerke, aber Kunstwerke dennoch, geschaffen von Meisterhänden in den Feuern der Hölle.
»Das Geld«, sagte Lorenzo. Seine Stimme war heiser, gebrochen vom Rauch und der Erschöpfung.
Der Fremde lächelte und legte eine zweite Ledertasche auf den Amboss, noch schwerer als die erste. »Wie versprochen. Plus ein Bonus für die außergewöhnliche Qualität. Ihr habt euch diesen Bonus verdient.«
Lorenzo nahm die Tasche nicht sofort. Er starrte sie nur an, als wäre sie eine Schlange, die jeden Moment zubeißen könnte. »Was werdet ihr damit tun?«, fragte er leise, eine Frage, die er sich geschworen hatte, nicht zu stellen.
Der Fremde hörte auf, die Messer einzupacken, und sah Lorenzo an. In seinen farblosen Augen lag etwas, das vielleicht Amüsement war, oder vielleicht Mitleid. »Das möchtet Ihr wirklich nicht wissen, Meister Moretti. Glaubt mir, Unwissenheit ist in diesem Fall wirklich ein Segen.«
»Ich will es trotzdem wissen.«
»Nein«, sagte der Fremde sanft. »Das wollt Ihr nicht. Aber ich werde Euch dies sagen: Diese Messer werden benutzt werden, um die Welt zu verändern. Ob zum Besseren oder zum
25
Schlechteren, das hängt von der Perspektive ab. Geschichte wird geschrieben werden mit diesen Klingen. Könige werden fallen. Throne werden wackeln. Und Euer Name, Lorenzo Moretti, wird niemals erwähnt werden, aber Euer Werk wird fortbestehen. Ist das nicht eine Art Unsterblichkeit?«
Er nahm den Sack mit den Messern und ging zur Tür. Dort drehte er sich noch einmal um, und sein Gesicht war jetzt ernst, alle Spuren von Amüsement verschwunden. »Falls Ihr jemals darüber nachdenken solltet, mit jemandem zu sprechen - mit der Polizei, einem Priester, einem Freund, wem auch immer - erinnert Euch daran, dass ich alles weiß. Wo Ihr lebt. Wo Eure Frau einkauft. Wo Euer Sohn sein Brot kauft. Ich habe Augen überall, Ohren an jeder Ecke. Schweigen ist nicht nur eine Tugend, meine Freunde. Es ist Überleben. Und wenn Ihr schweigt, wenn Ihr diese sieben Tage aus Eurem Gedächtnis löscht, als hätten sie nie existiert, dann werdet Ihr lange leben. Ihr werdet reich sein. Ihr werdet glücklich sein, so glücklich, wie Männer wie Ihr glücklich sein können.«
»Aber wenn Ihr sprecht...«
Er ließ den Satz unvollendet, aber die Drohung war klarer als jede ausgesprochene Warnung. Dann verschwand er in der Abenddämmerung, sein schwarzer Mantel verschmolz mit den Schatten der Gasse. Das Klappern seiner Schritte hallte noch lange nach, ein unheimlicher Rhythmus, der sich in Giuseppes Gedächtnis einbrannte, ein Rhythmus, den er nie vergessen würde.
* * *
Giuseppe stand lange in der Tür der Schmiede und starrte in die Dunkelheit, in die der Fremde verschwunden war.
»Was haben wir getan?«, flüsterte er schließlich. Zum ersten Mal seit Tagen brach seine Stimme, und Tränen liefen über sein rußgeschwärzten Gesicht, hinterließen saubere Linien durch den Schmutz.
Lorenzo antwortete nicht sofort. Er stand am Amboss, die zwei Ledertaschen vor sich, und starrte sie an, als würden sie alle Antworten des Universums enthalten. Schließlich nahm er
26
die erste Tasche und öffnete sie. Goldmünzen glitzerten im Licht der Esse, mehr Gold, als Giuseppe je in seinem Leben gesehen hatte.
»Wir haben überlebt«, sagte Lorenzo, aber seine Stimme klang hohl, leer, als würde er versuchen, sich selbst zu überzeugen. »Das ist alles, was zählt, Giuseppe. Überleben. Alles andere ist Luxus, den sich nur die Reichen leisten können.«
Aber Giuseppe wusste, dass es nicht alles war, was zählte. Es gab Dinge, die wichtiger waren als Überleben. Ehre. Moral. Die Fähigkeit, sich im Spiegel anzusehen, ohne sich selbst zu hassen. Die Fähigkeit, nachts zu schlafen, ohne von den Geistern derer verfolgt zu werden, die durch deine Hände sterben würden.
Sie hatten all das verloren. In nur sieben Tagen. Sieben Tage, die ihr Leben für immer verändert hatten.
»Wir müssen gehen«, sagte Lorenzo plötzlich.
»Was?«
»Weg von Neapel. Weg von Italien. Wir haben das Geld jetzt. Wir können irgendwohin gehen, wo niemand uns kennt, wo niemand Fragen stellt. Australien vielleicht. Ich habe gehört, dass sie dort Schmiede brauchen. Gold wurde gefunden. Männer strömen dorthin wie Ameisen zu einem Zuckerhaufen. Wir könnten dort neu anfangen.«
»Und Mutter?«
Lorenzo schwieg lange. Dann: »Sie kommt mit. Natürlich kommt sie mit.«
Aber Giuseppe hörte die Lüge in der Stimme seines Vaters. Sie beide wussten, dass Maria nicht stark genug war für eine solche Reise. Die monatelange Überfahrt würde sie töten. Vielleicht war das Lorenzos Plan. Vielleicht war das seine Art, sich von der lebenden Erinnerung an das, was er getan hatte, zu befreien.
»In drei Tagen«, sagte Lorenzo. »In drei Tagen verlässt ein Schiff nach Australien. Die 'Vittoria'. Ich habe davon gehört. Wir werden darauf sein.«
Und so begann die zweite Reise von Giuseppe Morettis Leben - nicht nur eine physische Reise über Ozeane und Kontinente, sondern eine innere Reise, von Unschuld zu Schuld, von
27
Naivität zu Verständnis. Er verließ Neapel als Junge und würde in Australien als Mann ankommen.