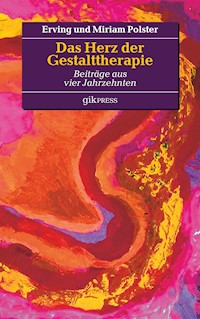
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erving Polster und seine 2001 verstorbene Frau Miriam zählen zu den international bekanntesten Gestalttherapeut*innen. In mehr als 40 Jahren haben sie Gestalttherapeut*innen auf der ganzen Welt ausgebildet und in besonderer Weise geprägt: Immer wieder machten sie deutlich, dass es Wohlwollen und Achtung durch die Therapeut*innen sind, die es den Klient*innen in der Gestalttherapie ermöglichen, sich zu öffnen und so neue, bereichernde Erfahrungen zu machen. Aus ihrer therapeutischen Arbeit und ihrer Lehrtätigkeit sind Publikationen hervorgegangen, welche zu den Klassikern der Gestalttherapie zählen. Ihre wichtigsten Beiträge sind in diesem Buch versammelt und werden allen ans Herz gelegt, die sich professionell und/oder persönlich weiterentwickeln möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: Thomas Bader, 1999
Erving Polster und seine 2001 verstorbene Frau Miriam zählen zu den international bekanntesten Gestalttherapeut*innen. In mehr als 40 Jahren haben sie Gestalttherapeut*innen auf der ganzen Welt aus gebildet und in besonderer Weise geprägt: Immer wieder machten sie deutlich, daß es Wohlwollen und Achtung durch die Therapeut*innen sind, die es den Klient*innen in der Gestalttherapie ermöglichen, sich zu öffnen und so neue, bereichernde Erfahrungen zu machen.
Aus ihrer therapeutischen Arbeit und ihrer Lehrtätigkeit sind eine Vielzahl von Publikationen hervorgegangen, die zum großen Teil schon zu Klassikern der Gestalttherapie geworden sind. Ihre wichtigsten Beiträge sind in diesem Buch versammelt und werden allen ans Herz gelegt, die sich professionell oder persönlich weiterentwickeln möchten.
therapeutenadressen service
Praxisadressen von Gestalttherapeutinnen und -therapeuten. Infos siehe letzte Buchseite
Inhalt
Anke und Erhard Doubrawa: Zur deutschen Ausgabe
Danksagung
Arthur Roberts: Der dialektisch-synthetische Modus in der Gestalttherapie: Eine Einführung in die Arbeiten von Erving und Miriam Polster
Prolog
Teil I: Die Bühne bereiten
Zeitgemäße Psychotherapie
Die Sprache der Erfahrung
Sinnliche Wahrnehmung in der Psychotherapie
Frauen in Therapie
Theorie und Praxis der Gestalttherapie
Teil II: Transformation der Prinzipien
Therapie ohne Widerstand – Gestalttherapie
Flucht aus der Gegenwart: Übergang und Erzählweise
Dichte therapeutische Sequenzen
Jedes Menschen Leben ist einen Roman wert
Die therapeutische Kraft der Aufmerksamkeit
Das Selbst in Aktion
Die Theorie in Praxis übersetzen: Martin Heidegger und die Gestalttherapie
Gemeinsamkeit und Vielfalt in der Gestalttherapie
In Erinnerung an Carl Rogers: Große Menschen werfen große Schatten
Teil III: Die Rolle der Gemeinschaft
Kommunale Encounterarbeit
Evas Töchter
Individualität und Gemeinschaft
Jenseits der Einzeltherapie
Das Jahr der Frau
Koda
Was gibt’s Neues?
Literaturverzeichnis
Index
Zur deutschen Ausgabe
Anke und Erhard Doubrawa
»Erving und Miriam Polster sind wie Bergführer, die ihre Klienten durch das Unterholz und die engen, verwachsenen Stellen ihres Lebens führen, durch rauhe Wetterlagen, in denen es nicht mehr weiter geht, durch steile Gegenden, wo man sehr langsam gehen muß, und währenddessen halten sie immer wieder nach neuen Wegen und Pfaden Ausschau, nach neuen und weiteren Räumen und Möglichkeiten.«
Stephen Schoen
Erv Polster und seine 2001 verstorbene Frau Miriam zählen zu den international bekanntesten Gestalttherapeut*innen. In mehr als 40 Jahren haben sie Gestalttherapeut*innen auf der ganzen Welt ausgebildet und in besonderer Weise geprägt: Immer wieder machten sie deutlich, daß es Wohlwollen und Achtung durch die Therapeut*innen sind, die es den Klient*innen ermöglichen, sich zu öffnen und so neue, bereichernde Erfahrungen zu machen.
Nach der Neuauflage ihres Lehrbuches Gestalttherapie – Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapie freuen wir uns, den deutschsprachigen Leser*innen das zweite Buch unserer Lehrer*innen vorlegen zu können. Ihre wichtigsten Vorträge und Essays sind hier versammelt.
Der amerikanische Kollege Arthur Robert hat ein ausgezeichnetes Vorwort zu dem Buch verfaßt, dem es inhaltlich nichts mehr hinzuzufügen gilt.
So möchten wir diese Stelle nutzen, um auf die Menschen, die beiden Therapeut*innen und Lehrer*innen hinter den Texten hinzuweisen: Auf ihre Großzügigkeit und ihre Offenheit gegenüber ihren Klient*innen und Trainees, mit denen sie sie einladen und willkommen heißen. Auf ihre unbedingte Zuwendung und ihr Interesse an den Menschen, denen sie gegenüber stehen. Auf die Leichtigkeit und Eleganz ihrer Arbeit. Auf ihre geistige Weite, ihre Freundlichkeit, ihre tiefe Menschlichkeit – und natürlich auf ihren Humor.
Als wir Erv und Miriam Polster zum ersten Mal gestalttherapeutisch arbeiten sahen, fiel uns nur eine Beschreibung dafür ein:
Ein sanfter, zärtlicher Tanz. Ihre therapeutische Arbeit bewegte sich leicht. Sie begann wie ein freundliches Gespräch. Manchmal wurde daraus ein Gespräch unter Freund*innen. Es wurde viel gelacht – und viel geweint. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der über Alltägliches gesprochen wurde, wurde Intimes geäußert. Die therapeutische Arbeit bewegte sich mühelos zwischen scheinbar Oberflächlichem und Tiefem. Sie (er-)öffnete den Klient*innen und Trainees ein Feld für deren eigene Suchbewegungen. Erv und Miriam Polster waren einfach da. Sie begleiteten ihre Klient*innen und Trainees mit großem Einfühlungsvermögen.
Klient*nnen – so sagen Erv und Miriam – seien in ihrem Leben schon genug verletzt worden. Das müßten wir Therapeut*innen nun in unserer Arbeit nicht noch extra – absichtlich, mutwillig – tun.
Als wir vor etwa sechs Jahren gemeinsam mit Erv und Miriam Polster die Veröffentlichung einer Sammlung ihrer Beiträge aus vier Jahrzehnten konkret planten, erwies es sich als nahezu unmöglich, von Deutschland aus die Rechte für so viele Beiträge bei amerikanischen Zeitschriften und Verlagen zu erwerben. Eine Weile später berichtete uns Erv davon, daß der amerikanische Gestalttherapeut und Ver leger Gordon Wheeler von The Gestalt Institute of Cleveland Press (GIC Press) Interesse an einem vergleichbaren Projekt hatte. Gerne haben wir das Projekt den Kolleg*innen in Cleveland überlassen – und uns zugleich die Rechte für die deutsche Ausgabe gesichert. Wir danken Gordon Wheeler, Arthur Roberts und GIC-Press herzlich für dieses wertvolle Buch.
Mit Freude stellen wir immer wieder fest, wie nachhaltig uns die von Miriam und Erv gelehrte und vorgelebte Haltung in der alltäglichen therapeutischen Praxis bestimmt, ebenso wie auch in der Ausbildungstätigkeit am Gestalt-Institut Köln.
Wir wünschen Ihnen, daß Sie dieses Buch mit der gleichen Freude und mit dem gleichen Gewinn lesen wie wir.
Köln, im Juli 2002
Anke und Erhard Doubrawa Gestalttherapeuten
Danksagung
Zahlreiche Faktoren haben zu der hier vorliegenden und im Laufe von 33 Jahren entstandenen Sammlung von Aufsätzen und Vorträgen beigetragen. Besonders danken wollen wir Gordon Wheeler, der es nicht nur für eine gute Idee hielt, die einzelnen Beiträge in einem Buch zusammenzufassen, sondern uns auch das nötige Know-how zur Verfügung gestellt hat, um diese Idee zu verwirklichen. Seinem Kollegen Arch Roberts danken wir für seinen Scharfsinn, seine Energie, seine Weisheit und sein Wohlwollen mit dem er unsere Überlegungen begleitet und realisierbar gemacht hat.
Unser Dank gilt auch den Mitarbeitern des Gestalt Institute of Cleveland, an dem wir viele Jahre gelehrt und gearbeitet haben. Die Kollegen von damals haben viel dazu beigetragen, daß unsere frühen Arbeiten mit besonderer Freude entstanden sind. Die enge Verbundenheit mit diesen Kollegen, die Humor, Intelligenz, Freundschaft und Offenheit miteinander zu verbinden wußten, war eine aufregende und wunderschöne Erfahrung.
Auch unseren heutigen Mitarbeitern, die uns als Freunde und Kollegen ans Herz gewachsen sind, möchten wir danken: Sharon Grodner, Rich Hycner, John Reis, Roy Resnikoff und Anna Walden. Mit ihnen und uns verbunden ist George Sargent, der – viel zu jung – erst kürzlich verstarb.
Kathryn Conklin hat viele Jahre als Sekretärin für uns gearbeitet und ist jetzt dabei, ihre eigene Karriere als Psychologin voranzutreiben. Mit ihrer sonnigen und herzlichen Art ist sie eine Bereicherung für unser Leben – und sie hält unser Büro am laufen.
Einleitung
Der dialektisch-synthetische Modus in der Gestalttherapie:Eine Einführung in die Arbeiten von Erving und Miriam PolsterArthur Roberts
Erv und Miriam Polster sind zwei der weltweit bekanntesten und beliebtesten Psychotherapeuten. Mit ihrer klinischen Arbeit und ihrer Lehrtätigkeit haben sie auf der ganzen Welt Tausende von Menschen erreicht.
Dennoch bedarf die hier vorliegende Sammlung ihres geschriebenen Werkes einer kurzen Einführung. Die schriftlichen Arbeiten der Polsters umspannen vier Jahrzehnte innerhalb der Geschichte der Gestalttherapie. Das thematische Spektrum, das diese Arbeiten umfaßt, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind so weitreichend, daß ein einzelnes Buch der Tragweite ihrer Arbeit unmöglich gerecht werden kann. Allerdings kann man feststellen, daß bestimmte, für die Gestalttherapie zentrale Themen im Laufe ihrer langen Karriere immer wiederkehren. Dieses Buch ist der Versuch, diese zentralen Themen aus der Gesamtheit ihrer Arbeiten herauszugreifen und in einem Band darzustellen.
Was das Denken von Erv und Miriam Polster in besonderer Weise kennzeichnet, ist ihre Absage an unzulässige Vereinfachungen. Ihr Denken ist klar und eindeutig und zeigt dadurch die vielen Facetten unserer Theorie auf, wobei jeder Gedankengang in seiner jeweiligen Komplexität entwickelt und dargelegt wird. Paradoxerweise führt dieser enge Fokus zu einer theoretischen Erweiterung, denn die Polsters ermutigen uns, die Details der gestalttherapeutischen Theorie unter die Lupe zu nehmen. Dabei entdecken wir – und zwar sehr konkret –, daß jeder Punkt einen gleichermaßen gültigen Kontrapunkt impliziert (Punkt-Kontrapunkt-Beziehung).
Und da sie die Wichtigkeit beider Seiten dieser Beziehung erläutern und verdeutlichen, stoßen sie auch bei den Skeptikern unter uns auf große Zustimmung.
Ihre Arbeit richtet sich an eine sehr gemischte Leserschaft. Die Intellektuellen können sich einer Vielzahl von Bezügen zu Denkern wie Tillich, Berlin, Graves oder Kozinski erfreuen, die Kunstinteressierten kommen in den Genuß von Hinweisen auf Proust und James, Dreiser und Eliot, historisch interessierte Leser kommen durch Exkursionen in die theoretischen Ursprünge der Gestalttherapie ebenso auf ihre Kosten wie durch Reminiszenzen an die erlebte Arbeit mit Perls, Goodman, From oder Weisz, und die Kliniker werden an der offenen Reflexion vieler Fallbeispiele Gefallen finden. Ausgestattet mit diesem Reichtum an Vielfalt und Erfahrung haben die Polsters ein Lebenswerk hervorgebracht, das sich nicht nur durch seine theoretische Kühnheit auszeichnet, sondern auch durch seinen Anspruch, eine Fülle sehr unterschiedlicher und widersprüchlicher Perspektiven innerhalb der Gestalttherapie anzuerkennen und miteinander zu verbinden. Daraus entsteht eine Kraft, die bei der Lektüre lebendig und spürbar wird.
Auch sei darauf hingewiesen, daß die Themen, mit denen die Polsters sich bereits vor vierzig Jahren vorausschauend auseinandergesetzt haben, heute im Zentrum der Diskussion um die Psychotherapietheorie stehen. Dabei handelt es sich um höchst aktuelle Konzepte wie Intersubjektivität, Pluralität, Kontinuität und Diskontinuität, Neopragmatismus, Erzählkunst, Paradox, erfahrbare Wirklichkeit, die implizite Abfolge resp. »Prägnanz« resp. »Fortgang« der Erfahrung usw. Diese Konzepte, die in der aktuellen Literatur und auf professionellen Konferenzen und Zusammenkünften heiß diskutiert werden, haben Erv und Miriam Polster seit Jahrzehnten erforscht und auf diese Weise die Konturen von Theorie und Praxis kontinuierlich mitgestaltet.
Eines der besonderen Merkmale der Polsterschen Arbeit besteht darin, daß sie konsequent einem dialektisch-synthetischen Modell folgt. Die Geschichte lehrt uns, daß eine Idee häufig als Korrektiv zu einer früheren Idee entsteht, so daß sich zwischen diesen beiden Ideen eine scheinbar unüberbrückbare theoretische Diskrepanz auftut.
Dies ist der Anfang des dialektischen Prozesses – in der kurzen Geschichte der Psychotherapie allerdings leider auch sein Ende. Doch anders als der Großteil psychologischer Ideen und Konzepte, die im Laufe des letzten Jahrhunderts entwickelt wurden, läuft das Denken der Polsters nicht auf definitive Erklärungen oder auf ein im vorhinein festgelegtes Resultat hinaus. Vielmehr sucht es die Weite, den Horizont, und damit ein Mehr an Möglichkeiten und Komplexität. Die Arbeit von Erv und Miriam Polster beendet den Dialog nicht, sondern sucht ihn und möchte ihn am Leben erhalten; stets zeigt sie den nächsten Schritt des dialektischen Prozesses auf, nämlich die Synthese. Einer der Gründe dafür, daß ihre Arbeit unser Feld nach wie vor bereichert und belebt, ist, daß sie die Synthese nicht nur nicht auslassen, sondern sie explizit anstreben.
Die Positionen von Erv und Miriam Polster zeigen im Leben und in der Arbeit direkte Wirkung. Dieses erfreuliche Ergebnis verdanken wir ihrer intuitiven Erkenntnis, daß Dialektik ohne Synthese kaum mehr ist als eine intellektuelle Übung. Aus ihrer Sicht bezieht die Gestalttherapie ihren Reichtum und ihre Tiefe aus der Tatsache, daß ihre Grundaussagen einen dialektischen Prozeß beschreiben, in dem wir das, was wir brauchen, auf organische Weise erlangen, indem wir uns Neues aneignen und uns für Kontakt öffnen. Die Conditio sine qua non der gestalttherapeutischen Theorie besteht für sie darin, daß sie einen natürlichen Prozeß beschreibt, in dem wir neu entstehende oder auftauchende Figuren assimilieren und durch die Synthese transformieren. Wenn wir den Kontakt nicht vorzeitig abbrechen, wird das, was zunächst als »Nicht-Ich« erscheint, absorbiert und assimiliert. Brechen wir den Kontakt jedoch ab, dann verhindern wir damit das Auftauchen möglicher neuer Figuren. Ein solches Versäumnis, den Prozeß zu Ende zu führen, liegt auf der Ebene der Synthese; es bedeutet das Ende des Dialogs und den Beginn des Dogmas. Diese These, die zu den wichtigsten Überzeugungen der Autoren gehört, markiert nicht nur einen Unterschied gegenüber anderen Theoretikern der Gestalttherapie, sondern hat sie auch zu einer fruchtbaren und gleichermaßen theoretisch stabilen wie praxisbezogenen Arbeit geführt.
Ihre Offenheit verdankt diese Arbeit der Bereitschaft beider, gerade dort nach neuen Ideen zu suchen, wo andere Theorien sich abwenden. Hier zeigt sich die unter der Oberfläche wirksame, integrative Kraft im Denken der Polsters: es bewegt sich immer auf diese Weise, fügt zusammen und drängt weiter vorwärts, um schließlich in der Synthese seinen Höhepunkt zu erreichen, von wo aus der Kreislauf dann von Neuem beginnt.
Dieser Gedankenverlauf zeigt sich in der hier vorliegenden Zusammenstellung immer und immer wieder, vor allem in ihrem umsichtigen Verständnis jener Eigenart des menschlichen Denkens, sich einem bestimmten Pol anzunähern, der eigentlich nur Teil einer Gesamtheit ist – etwa der »reinen Erfahrung« im Gegensatz zu ihrer »Bedeutung«, dem »Prozeß« im Gegensatz zum »Inhalt« oder der »Figur« in Abgrenzung zum »Hintergrund«.
Während manche Gestalttherapeuten ihren Fokus fast ausschließlich auf die Figurbildung legen, andere hingegen auf die Struktur des Hintergrundes, machen die Polsters deutlich, daß keine dieser Positionen aus sich allein heraus haltbar ist. Sie umgehen die Falle falscher Dichotomien, indem sie konsequent beide Seiten der Dialektik beleuchten, und zwar nicht um besser argumentieren zu können, sondern um uns zu ermutigen, es ihnen gleichzutun. Ihre Arbeit zeigt, daß der entscheidende Schritt der Synthese nur dann stattfinden kann, wenn es gelingt, die Spannung zwischen einander entgegengesetzten Polen zu halten. C.G. Jung nannte diesen letzten Schritt die »transzendentale Funktion« der Psyche und meinte damit jene Funktion, durch die Thesis und Antithesis verschmelzen und zu einer neuen Ganzheit umgewandelt werden. Die Polsters lassen keinen Zweifel daran, daß wir erst indem wir die Komplexität und die Vielfalt dissonanter Erfahrungen zulassen und jede innere und äußere Stimme hören, fähig werden, begrenzte Positionen, die lediglich eine einzelne, fixierte Perspektive auf eine größere Wirklichkeit zulassen, zu transzendieren.
Die Polsters streben jene Art von anhaltendem und differenziertem Kontakt an, der eine solche Synthese ermöglicht. Ihre Arbeit macht ihre Überzeugungen deutlich: nicht nur sprechen sie sich für die Einschließung aus, sondern auch gegen die Ausschließung. Immer wieder weisen sie auf die Gefahren hin, die mit exklusiven Standpunkten einhergehen, in denen eine festgesetzte Doktrin gegen eine andere verteidigt wird, und warnen davor, daß die Anerkennung grundsätzlich jedes Dogmas den Kliniker schwächen kann, weil sie zu Rigidität und damit zur Einschränkung oder dem Verlust der Fähigkeit führen kann, das eigene Handeln an die ästhetischen Anforderungen einer gegebenen Situation anzupassen. Demgegenüber ermuntern uns die Polsters zu dem komplexeren, aber auch anstrengenderen Ansatz, beide Seiten einer Punkt-Kontrapunkt-Beziehung zu erforschen. Zum Beispiel ermuntern sie uns zu lernen, sowohl mit dem Inhalt als auch mit dem Prozeß zu arbeiten, sowohl mit der Entstehung von Bedeutung als auch mit der »reinen Erfahrung«. Sie halten uns an, bei der Spannung scheinbar unvereinbarer Gegensätze zu verharren – wohl wissend, daß die Gegensätze nur theoretisch unvereinbar sind, nicht aber im wirklichen Leben. Einer Logik kann widersprochen werden, nicht aber der Erfahrung. Die Polsters halten unerschütterlich an dem Recht (und der Verantwortung) des Therapeuten fest, das jeweils angemessenste dynamische Gleichgewicht zwischen zwei Gegensätzen immer wieder neu zu entdecken.
Indem sie die Ausschließung ablehnen und die Einschließung befürworten, drängen die Polsters uns geradezu, uns sowohl einander als auch dem Feld, dessen Teil wir sind, zuzuwenden. Und dadurch, daß wir uns selbst für neue Ideen und Erfahrungen öffnen, verstärken wir die kreative Spannung zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten und schaffen innerhalb des Feldes die Bedingungen, die zur Integration beider Seiten notwendig sind. Mehr als diese Bedingungen schaffen, können wir nicht. Letztendlich brauchen wir aber auch nicht mehr zu tun, denn wenn die Bedingungen im Feld gegeben sind, stellt die Synthese sich von selbst ein, und wenn sie sich einstellt, erfahren wir die darin enthaltene Lösung. Geht dieser Prozeß ungestört vonstatten, dann »bringen« wir die Lösung nicht »hervor«, sondern sie »fällt uns zu« – und bringt uns hervor.
Doch der Wille und die eigene Anstrengung spielen hier eine entscheidende Rolle. Vor dieser Tatsache schrecken die Polsters keineswegs zurück, sondern erwarten, daß wir weisen Gebrauch davon machen. Der Wille kann eingesetzt werden, um ein Gefühl oder einen Gedanken zuzulassen, anstatt ihn abzuwehren, er kann herangezogen werden, um einen anderen zu hören, anstatt ihn auszuschließen. Diese Absicht, sich etwas anderem zu öffnen, eine andere Sichtweise in die eigene mit einzubeziehen, trägt dazu bei, eine Synthese zu ermöglichen. Da der Wille etwas ist, worüber wir per definitionem eine gewisse Kontrolle haben, intervenieren die Polsters an eben dieser Stelle und drängen uns zu einem freiwilligen Ethos der Integration.
Ihr Glaube an die transformative Kraft der Integration ist ansteckend, und die besondere Qualität ihrer schriftlichen Arbeit nährt sich zum Teil aus ihrer Hingabe an dieses Ideal. Sie »glauben« nicht nur an die theoretische Integration – das tun viele –, sondern widmen sich ihr. Wenn es in ihrer Arbeit eine implizite Überzeugung gibt, dann die, daß unser Leben (und unsere Theorien) sich weiterentwickeln, wenn wir unseren Erfahrungen und unseren Unterschieden aktiv Raum geben. Dabei müssen wir sogar jenem Teil von uns Raum geben, der sich dagegen wehrt, weiteren Raum freizugeben. Diese Überzeugung finden wir fast auf jeder Seite ihrer schriftlichen Arbeit: Es ist besser, weiterzugehen und zu antworten – den Dialog zu wagen und Veränderung zu riskieren – als sich einzuengen und mit einer dauerhaften Einschränkung abzufinden. Die überaus kreativen Leistungen, die Erv und Miriam Polster im Laufe ihrer Karriere erbracht haben, sind ein Zeugnis für die Kraft dieser Überzeugung.
Ein weiteres Ergebnis ihrer Hingabe an diesen Glauben ist die Flexibilität, die in ihrer Arbeit mit Patienten sichtbar wird. Die klinischen Interventionen, die in diesem Buch beschrieben werden, spiegeln die Spontaneität und Kunstfertigkeit von Therapeuten wider, die erfrischend frei und unbehindert von Doktrinen jeglicher Couleur arbeiten. Sie sind wirklich erstaunlich frei. Jeder von ihnen bringt es irgendwie fertig, die klinisch relevanten Vorstellungen, Blickwinkel, Intuitionen und Perspektiven mit einzubeziehen und daraus eine elegante Intervention zu entwickeln, die den Patienten darin unterstützt, über seine Fixierungen hinauszugehen und sich dem nächsten Schritt zuzuwenden.
Gleichzeitig aber stehen die Polsters innerhalb des Rahmens theoretischen Wissens und Disziplin auch für klinische Freiheit ein. Sie sind sich durchaus bewußt, wie sehr introjizierte Regeln den Therapeuten behindern, wie sie seine Möglichkeiten einschränken, das Gewahrsein beeinträchtigen und therapeutische Kreativität zunichte machen; daneben sehen sie aber auch die Notwendigkeit und den Wert von theoretischen Strukturen. In diesem Sinne waren sie immer damit beschäftigt, die Grenzen der gestalttherapeutischen Theorie zu erweitern, nicht aus ideologischer Leidenschaft, sondern aus der tief verwurzelten Überzeugung, daß die Individualität des Therapeuten mindestens ebenso wichtig ist wie die theoretischen Axiome, an denen er sich zu orientieren hat. Ihr intuitives Verständnis besagt, daß lebendigen Menschen nur eine lebendige Theorie dienlich sein kann, daß wir der zunehmenden Komplexität derer, die eine solche Theorie anwenden, nur dadurch Raum geben können, daß wir auch ihre Grenzen kontinuierlich ausweiten. Die Unbeständigkeit und den Wandel der Erfahrung werden unsere Theorien niemals umfassen, und der beste Weg, uns der Komplexität unseres Lebens anzunähern, ist, unsere Vorstellungen immer wieder zu erweitern und zu erneuern.
Erv und Miriam Polster leben dieses Credo. In diesem Buch kann der Leser erkennen, wie ihre Arbeit sich kontinuierlich weiterentwickelt hat – und sie werden nicht müde weiter zu forschen. Ihre Schriften sind gekennzeichnet durch eine freudige Lebendigkeit und stetigen Fortschritt, durch einen Fluß, der Denker und Gedanken durch jahrzehntelanges Studieren, Praktizieren, Lehren und Leben trägt. Und das ist noch nicht alles, denn sie schreiben weiter und stellen ihre Energie auch weiterhin der Gemeinschaft zur Verfügung. Es gibt vieles, wofür wir dankbar sein können, und noch mehr, worauf wir uns freuen dürfen.
Arthur Roberts Providence, Rhode Island Sommer 1999
Originalbeitrag für dieses Buch, 1999. Aus dem Amerikanischen von Ludger Firneburg.
Prolog
Als wir diese Artikelsammlung – nicht ohne ein gewisses Gefühl von Nostalgie – noch einmal durchsahen, fragten wir uns, ob es einen thematischen Zusammenhang zwischen den frühen und den späteren Arbeiten geben, und worin dieser bestehen könnte. Beim Lesen des ersten Artikels, Zeitgemäße Psychotherapie, den Erv vor 32 Jahren geschrieben hat, stellten wir mit Erstaunen fest, daß die zentralen Themen bis heute die gleichen geblieben sind. Es kam uns vor, als hätte Erv damals unwissentlich die Einführung in eine theoretische Fragestellung geschrieben, die erst sehr viel später aktuell wurde. Die in der Folge entstandenen schriftlichen Arbeiten wiesen in ganz unterschiedliche Richtungen, alle wurzeln jedoch in denselben ursprünglichen theoretischen Prämissen. Vielleicht gestalten die Menschen ihr Leben nach einem ähnlichen Muster, indem sie von frühen Empfindungen ausgehen und diese im Laufe ihres Lebens dann immer wieder neu verarbeiten, manchmal kaum nachvollziehbar, und auch ohne sich dabei zu wiederholen, aber immer in einer kaleidoskopischen Neuanordnung dessen, was ihnen bereits von Anfang an wichtig war.
Das soll nicht heißen, daß die Vergangenheit die Gegenwart verursacht, sondern vielmehr, daß beide miteinander verbunden sind – als ganzheitliches Thema, das sich selbst in diesen Schriften zu erkennen gibt. Wir schauen uns um, ausgestattet mit einem Gehirn, zwei Augen und unzähligen Neuronen und halten die unglaubliche Leistung, eine endlose Zahl von Ereignissen in einer einheitlichen Erfahrung vereinigt zu finden, für selbstverständlich. Das geschieht auf natürliche Weise in jedem von uns, dank eines Gestaltungsreflexes, der all diese Erfahrungen miteinander verbindet. Aber das Gelingen dieses Reflexes ist nie gewährleistet, denn wir werden immer wieder aus dem Gleichgewicht geworfen und durch unzählige, unzusammenhängende Verhaltens- und Gefühlsmöglichkeiten jedesmal aufs Neue herausgefordert.
Aus einer solchen Herausforderung entstand auch die Gestalttherapie. Sie verband die scheinbar kaum miteinander zu vereinbarenden Arbeiten unterschiedlicher Denker, darunter eine ganze Reihe psychoanalytischer Dissidenten, Gestalt-Lerntheoretiker und Existentialphilosophen, die innerhalb der Freudschen Psychoanalyse sämtlich als nicht assimilierbar galten. Diese Integration erzeugte einen Zusammenhalt, der gerade aus der Verschiedenartigkeit der Positionen genährt wurde, und war darüber hinaus auch für die Theorie der Gestalttherapie tonangebend, die eine grundlegende Gastfreundschaft gegenüber dissonanten oder gegensätzlichen Kräften entfaltete. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, daß die gestalttherapeutische Theorie auf das Konzept der Spaltung zurückgreift, um die neurotischen Wirkungen der Zerrissenheit zu erkennen und die Identifikation und Synthese der entfremdeten Aspekte der Persönlichkeit wiederherzustellen (Perls, Hefferline und Goodman 1951b, S. 23ff).
Die Radikale Mitte
Das Konzept der Radikalen Mitte ist ein Ansatzpunkt für die Koordination von Einheit und Vielfalt. Der Begriff der Radikalen Mitte ist nicht so widersprüchlich wie es zunächst scheinen mag. Im Gegenteil, einige Wörterbücher erklären nicht nur, daß das Wort »radikal« auf die Wurzel oder die Basis von etwas hinweist, sondern auch die Bedeutung von In-der-Mitte-Sein annehmen kann (Webster’s Dictionary, zweite Auflage). In der allgemeinen Auffassung hingegen hat »radikal« die Bedeutung von »extrem« und steht im Gegensatz zu einer moderaten, gemäßigten Mitte. Der sich daraus ergebende Widerspruch zwischen »radikal« und »Mitte« ist problematisch, weil ihm die falsche Annahme zugrundeliegt, daß Energie, Neuerung, Fortschritt und Kreativität, die immer wieder mit Radikalismus assoziiert werden, mit extremen Positionen verknüpft sein müßten. Fälschlicherweise wird die Mitte häufig als weniger bedeutsame Quelle von Lebenskraft angesehen, oft genug als bloßer Kompromiß, und manchmal sogar lediglich als Resignation vor dem Einfluß gegensätzlicher Extreme.
Als die Gestalttherapie der reinen Erfahrung das Gewahrsein gegenüberstellte, um dadurch die übermäßige Betonung der Bedeutung abzuschwächen, nahm sie gegenüber der Psychoanalyse eine extreme Position ein. Dabei sollte jedoch auch berücksichtigt werden, daß die Gestalttherapie sich – trotz ihres Widerspruchs zur Psychoanalyse – schon in ihren Anfängen an der radikalen Mitte orientierte, als Perls nämlich Friedländers Begriff der »Kreativen Indifferenz« als primäres Orientierungskriterium heranzog. Aus dieser Position heraus schrieb Perls:
»In seinem Buch ›Schöpferische Indifferenz‹ stellt Friedlaender die Theorie auf, jedes Ereignis stehe in bezug zu einem Nullpunkt, von dem aus eine Differenzierung in Gegensätze stattfinde. Diese Gegensätze zeigen in ihrem spezifischen Zusammenhang eine große Affinität zueinander. Indem wir wachsam im Zentrum bleiben, können wir eine schöpferische Fähigkeit erwerben, beide Seiten eines Vorkommnisses zu sehen und jede unvollständige Hälfte zu ergänzen« (Perls 1947, S. 16; zweite Hervorhebung durch die Autoren).
Extreme Positionen sind insofern von großem Nutzen, als sie zu dem System, dessen Teil sie sind, neue Perspektiven beisteuern. Dennoch sind sie immer auch Teil des Systems und von diesem nicht zu trennen, selbst wenn sie sich durch spezifische Merkmale abheben. Um Ganzheitlichkeit zu erreichen, muß man einen Weg finden, auftauchende Dissonanzen gezielt in das bestehende System einzubinden. Aus dieser Position heraus, aus der die Unteilbarkeit der Prinzipien deutlicher wird, läßt sich der Kampf widersprüchlicher konzeptueller Beziehungen leichter rekonstruieren. T. S. Eliot hat diese Unteilbarkeit auf den Punkt gebracht. Er spricht von dem Ruhepol der Weltbewegung, der ohne Ausgangspunkt und ohne Ziel ist und an dem Vergangenheit und Zukunft sich begegnen. An diesem Ruhepol, schreibt Eliot, findet der Tanz statt (Eliot 1943, S. 15). Eine ähnliche Bedeutung kommt dem »Tanz« als der zentralen Kraft der Mitte auch bei Martin Heidegger zu, dessen Denken sich z.T. in der Theorie der Gestalttherapie wiederfindet. Heidegger betrachtet die Mitte, so scheint uns, als Quelle sowohl des Seins als auch der Sorge, wenn er schreibt, daß sowohl die Enden als auch das, was zwischen ihnen ist, in der einzig möglichen Weise existieren, nämlich als Sorge (Heidegger 1927, S. 323ff). Nietzsche, der große Held des freien Geistes, sagt, Kunst sei »die freudige Hoffnung, daß der Bann der Individuation zu zerbrechen sei, als die Ahnung einer wiederhergestellten Einheit« (Nietzsche 1872, S. 73), und weiter:
»In welcher seltsamen Vereinfachung und Fälschung lebt der Mensch! […] Wie haben wir Alles um uns hell und frei und leicht und einfach gemacht […]. Mag nämlich auch die Sprache, hier wie anderwärts, nicht über ihre Plumpheit hinauskönnen und fortfahren, von Gegensätzen zu reden, wo es nur Grade und mancherlei Feinheit der Stufen giebt« (Nietzsche 1886, S. 41).
Eliots »Tanz«, Heideggers »Sorge« und Nietzsches »Freude« sind belebende Anmerkungen. Sie spiegeln die Kraft wider, die aus einer nach Einheit drängenden Mitte entspringt. Deshalb kann man Gestalttherapie niemals wirklich begreifen, wenn man nur ein Element der dialektischen Komplexität herausgreift. Gestalttherapie ist keine bloß prozeßorientierte Therapie, sondern eine, die Prozeß und Inhalt miteinander verbindet und sie als unteilbare Facetten menschlicher Erfahrung betrachtet.
Im Hinblick auf Prozeß und Inhalt scheint diese Verwobenheit recht offensichtlich zu sein. Aber die weithin zu beobachtende Vermeidung dieser offensichtlichen Unteilbarkeit verdeutlicht nur die Existenz eines Vereinfachungsreflexes. Dieser Reflex führt dazu, daß Menschen der Klarheit selbst dann noch den höheren Stellenwert beimessen, wenn dies zu Lasten von Weite und Verhältnismäßigkeit geht. Die daraus resultierende Spaltung zwischen dem grundlegenden Bedürfnis nach nachvollziehbaren theoretischen Aussagen und dem gleichermaßen zwingenden Bedürfnis nach Verbindung unterschiedlicher Standpunkte stellt eine Gefahr für all jene Theoretiker dar, die sich um eine, die ganze Bandbreite der Theorie umfassende, kohärente Kommunikation bemühen. Die Attraktivität von Einfachheit, Klarheit, Sicherheit und klaren Beziehungen zu Gleichgesinnten verführt dazu, das eine oder andere Prinzip zu bevorzugen. Diese Einschränkung steht im Widerspruch zu einer ungeheuren Fülle an Erfahrungen. Mit diesem Konflikt muß sich jede Theorie auseinandersetzen, weil ihre Vertreter dazu neigen, manche Aspekte stärker zu berücksichtigen als andere.
Ebenso wie Freud von diesem Prozeß profitierte, hatte er auch unter ihm zu leiden. Viele Psychologen betrachten Freud als den Apostel des Rationalismus, obwohl gerade sein Werk – wie wohl kein anderes in der Geschichte – den unterschwelligen Tendenzen der menschlichen Existenz besondere Beachtung schenkte. Dieses Paradox zeigt sich auch in der Arbeit von Carl Rogers, dessen Image lange Zeit auf seine therapeutischen Techniken des Spiegelns und der Klärung basierte, die häufig nur mechanisch angewandt wurden. Aber Rogers war auch derjenige Theoretiker, der sich am intensivsten für die Idee der Empathie einsetzte. Viele von uns verbinden den Namen Aaron Beck ausschließlich mit der Fokussierung gedanklicher Prozesse, aber Beck steht sowohl emotionalen Elementen als auch der Kraft der Erfahrung selbst durchaus aufgeschlossen gegenüber. Er sagt: »Der erfahrungsorientierte Ansatz setzt den Patienten Erfahrungen aus, die aus sich selbst heraus genügend Kraft besitzen, um falsche Vorstellungen zu verändern« (Beck 1979, S. 214, Hervorhebung durch die Autoren). Auch Beck war ein Vertreter eines »therapeutischen Eklektizismus« (Beck 1991).
Auch Perls’ Positionen wurden z.T. falsch verstanden. Aufgrund seiner aphoristischen Neigungen und der Vereinfachungsreflexe anderer wurde er mit dem Konzept des Hier-und-Jetzt in Verbindung gebracht, während seine eigentliche therapeutische Grundhaltung sich an der lebendigen Beziehung zwischen Figur und Grund, der Unteilbarkeit von Organismus und Umgebung und der Auflösung unerledigter Situationen orientierte. Die Klischees, die den Meistern der therapeutischen Kunst anhaften, werden nicht nur durch jene genährt, die sie nur oberflächlich kennen, sondern auch durch ihre ergebensten Anhänger.
Die aufgrund der zahlreichen Facetten jeder Theorie entstehende Entfremdung hat immer wieder zu Mißverständnissen, Revierkämpfen und einer Art Bekennertum geführt, so daß Inhalte, die nicht ohne weiteres zu vereinheitlichen waren, fallengelassen wurden. Doch Steigerung der Flexibilität und Erweiterung der Grundsätze sind riskante Unterfangen, weil sie eine Bedrohung sowohl des inneren Zusammenhalts einer Theorie als auch der Klarheit der Grundsätze und der wissenschaftlichen Disziplin darstellen. Die Fruchtbarkeit von Ideen kann in der Tat ein übersteigertes Wachstum nach sich ziehen. Eine kunstvolle Beschneidung und die kreative Entwicklung von Grundsätzen aufgrund der Auseinandersetzung mit Widersprüchen trägt jedoch dazu bei, daß Prinzipien, die sich nicht ohne weiteres in das theoretische Gesamtgebäude einfügen, nicht vorschnell fallengelassen werden. Als Freud eben solche Ausschlüsse vornahm und damit seine Sorge um die Integrität des psychoanalytischen Systems zum Ausdruck brachte, schuf er die Grundlage für eine Orthodoxie und einen Formalismus, den die Psychoanalyse erst in unseren Tagen im Begriff ist, zu überwinden. Dieser Prozeß kam in Gang, nachdem man sich wieder auf therapeutische Grundsätze besann, die dank der psychoanalytischen Dissidenten erhalten geblieben waren. In den letzten Jahren erleben wir das Aufblühen einer Neopsychoanalyse, die sich durch den Respekt vor der vordergründigen Erfahrung und dem interpersonellen Imperativ auszeichnet, der jede Therapie beeinflußt. Die Tatsache, daß auch die Gestalttherapie Positionen von Analytikern integriert hat, die sich entweder von Freud abgewandt hatten oder aber ausgeschlossen worden waren, ist bemerkenswert, wird aber weithin verkannt.
Die Suche nach theoretischer Einheit
Es gibt drei wesentliche Faktoren, die auf der einen Seite die theoretische Vielfalt der Gestalttherapie ausweiten und auf der anderen Seite ihre theoretische Einheit erhalten. Das sind 1. Punkt-Kontrapunkt-Beziehungen, 2. Dimensionalität und 3. persönlicher Stil und Repertoire.
Das Punkt-Kontrapunkt-Phänomen
bezieht sich auf das gleichzeitige Vorhandensein von
wechselnden theoretischen Optionen.
Diese Optionen werden meist paarweise wahrgenommen, wie z. B. in der Beziehung zwischen Selbstunterstützung und Fremdunterstützung. Immer aber sind diese wechselnden Optionen unteilbar, auch wenn sie – je nach Situation – unterschiedlich stark betont werden. Wenn der Fokus auf der Selbstunterstützung liegt, wandert die Fremdunterstützung in den Hintergrund; erfordert allerdings ein neues Interesse eine Verschiebung des Fokus, tritt sie wieder in den Vordergrund. Diese Flexibilität erhält die Vielseitigkeit der Theorie, weil sie eine kontinuierliche Schwingung variierender Fokusse ermöglicht. Deshalb hängt die Integrität jeder Theorie u.a. davon ab, wie erfolgreich der Impuls in Richtung auf die Punkt-Kontrapunkt-Einheit bewältigt wird. Die Aufgeschlossenheit, die solche Punkt-Kontrapunkt-Schwingungen erfordert, erleichtert es Praktikern und Theoretikern, Variationen früher theoretischer Themen und unvorhergesehene Brüche zu entdecken, die bei der Anwendung der aus der Theorie hervorgegangenen Techniken sichtbar werden.
Dimensionalität
bezieht sich auf den Standpunkt, den jeder Therapeut zwischen den Extremen eines beliebigen theoretischen Gegensatzpaares einnehmen kann. Der Therapeut hat nicht nur die Option, den Fokus
wechselweise
auf die Selbstunterstützung oder die Fremdunterstützung zu legen, sondern kann sich auch der einen oder anderen Position stärker zu wen den. Manche Therapeuten werden bei ihren Patienten stärker auf die Entwicklung der Selbstunterstützung achten, während andere es vorziehen, die Aussichten ihrer Patienten auf äußere Unterstützung zu verdeutlichen. Ob ein Therapeut im Sinne der gestalttherapeutischen Theorie arbeitet, hängt nicht davon ab, welchen Standpunkt er in der jeweiligen Dimension einnimmt, sondern davon, ob er von dieser und einer Reihe weiterer Dimensionen durchdrungen ist. Einige dieser Dimensionen halten wir im Hinblick auf die Theorie der Gestalttherapie für essentiell, was wir später noch weiter ausführen werden.
Repertoire und Stil
des Praktizierenden gehören zu den Schlüsselfaktoren der lebendigen Anwendung eines theoretischen Systems. Der Stil beschreibt die individuelle, charakteristische Vorgehensweise des Therapeuten, während das Repertoire das Spektrum der Methoden an sich umfaßt. Obwohl es zwischen Stil und Repertoire deutliche Unterschiede gibt, sind sie andererseits doch so eng miteinander verwoben, daß sie manchmal kaum voneinander zu unterscheiden sind.
Eindeutig stilistisch sind Eigenschaften wie sprachliches Ausdrucksvermögen, Festigkeit, Tempo, Emotionalität, Humor, Dominanz und Großzügigkeit. Manche Menschen sind schneller als andere, einige sind eher ironisch, andere inspirativ, wieder andere besser informiert oder eher freundlich, manche sind stärker mit großen Lebenszusammenhängen beschäftigt, andere hingegen mit kleinsten Details. Das therapeutische Repertoire zeigt sich im Spektrum der zur Verfügung stehenden Verfahren und Methoden, also z. B. an der Vielfalt der Experimente, auf die man zurückgreifen kann; hierher gehören aber auch die Technik der Verdichtung von Abläufen, der intrapersonelle Dialog, das alltägliche Gespräch, die Konzentration auf den Körper, der Einsatz von visuellen Phantasien oder von hypnotischen Techniken, das Anbieten von Rat, die therapeutische Selbstoffenbarung etc. Manche Gestalttherapeuten arbeiten sehr viel mit Träumen, andere hingegen so gut wie nie. Einige achten vor allem auf das Gewahrsein ihrer Patienten, andere beschäftigen sich vorwiegend mit der Qualität des Kontakts. Einige bieten in jeder Sitzung Experimente an, andere wiederum höchst selten.
Wenn wir sagen, daß methodische und theoretische Offenheit ein grundlegendes Attribut des gestalttherapeutischen Systems darstellt, ist es notwendig, die Grenze zum Eklektizismus deutlich zu machen. In der Tat gibt es theoretische Prinzipien, die allem, was ein Gestalttherapeut tut, zugrunde liegen, auch wenn die Theorie nicht eindeutig festschreibt, was, wann, mit wem und in welchem Verhältnis etwas zu tun ist. Doch diese theoretische Identität muß durch die Auseinandersetzung mit widerspenstigen Prinzipien erworben werden, und nicht einfach durch die Betonung derjenigen Prinzipien, die man sich gerade ausgesucht hat. Jede eingeschränkte Sichtweise, so leicht es auch sein mag, sich mit ihr zu identifizieren, führt zu einer Reduzierung der Möglichkeiten, die in den Prinzipien der Harmonisierung von Punkt und Kontrapunkt, Multidimensionalität und der Vielfalt von Repertoire und Stil begründet sind. Glücklicherweise sind diese Freiheiten Bestandteil des Gestaltsystems, in das viele verschiedene Positionen eingeflossen sind. Was wir hier aufzeigen wollen, ist, daß die Gestalttherapie die Vorteile einer integrativen Sichtweise sowie eine Fülle an stilistischen und methodischen Möglichkeiten bietet, die alle innerhalb des Rahmens ihrer Grundaussagen liegen. Diese Sichtweise deckt sich auch mit der des frühen Perls, wenn er schreibt:
»Heute gibt es viele ›Psychologien‹, und jede Schule hat recht, zumindest teilweise. Aber leider ist auch jede Schule selbstgerecht. Der tolerante Psychologieprofessor nimmt meistens die verschiedenen Schulen aus ihren Schubladen heraus, diskutiert sie, zeigt seine Vorliebe für die eine oder andere – aber wie wenig tut er für ihre Integration! Ich habe versucht zu zeigen, daß man etwas Derartiges tun kann, wenn man die trennenden Abgründe überbrückt …« (Perls 1947 , S. 7).
Die Entwicklung des Prinzips
In den Beiträgen, die für dieses Buch ausgewählt wurden, haben wir zehn Dimensionen der Gestalttherapie unterschieden, die jeweils zwei gegenteilige theoretische Sichtweisen umfassen. Einige dieser Perspektiven werden in mehreren Beiträgen erläutert, andere bilden das zentrale Thema eines einzigen Aufsatzes. Selbstverständlich decken diese Felder nicht das gesamte Spektrum möglicher Dimensionen ab, aber sie zeigen doch, in welcher Weise wir versucht haben, einige grundlegende gestalttherapeutische Positionen weiter zu entwickeln.
1. Hier-und-Jetzt vs. Konzentration – Die einengende Wirkung der gestalttherapeutischen Orientierung am Hier-und-Jetzt hat uns ein gewisses Unbehagen bereitet, deshalb haben wir versucht, einen umfassenderen Zugang zur gesamten Dimension von Raum und Zeit, in der wir leben, zu eröffnen, gleichzeitig jedoch den scharfen Fokus, den diese Orientierung ermöglicht, beizubehalten. Die Gegenwart ist nur ein Moment, so flüchtig, daß er schon wieder verflogen ist, bevor man mit dem Finger darauf zeigen kann. Doch trotz dieser Flüchtigkeit ist die Illusion der Gegenwart als dem Ort aller persönlichen Erfahrung bis heute ein mächtiges therapeutisches Medium – nicht aufgrund ihrer zeitlichen Ausdehnung, sondern weil darin die Anregung zu einer äußerst scharf fokussierten Aufmerksamkeit, der Konzentration, liegt, die Perls ursprünglich als eines der Grundprinzipen der Psychotherapie betrachtete. Wie Erv schreibt:
»Eines der wirksamsten Mittel dieses neuen Optimismus und gleichzeitig ein Beitrag zur Entwicklung der Psychotherapiegeschichte bestand in Fritz Perls’ Engagement für eine deutlichere therapeutische Bestimmtheit. Es ging ihm um eine verstärkte Konzentration auf die eigene Erfahrung und den Kontakt mit anderen. Die damit einhergehende Veränderung des Erfahrungsfokus stellte eine hypnoseartige Innovation für den Durchbruch der therapeutischen Einfachheit dar. Den Grundprinzipien der Gestalttherapie, die der Betrachtung des Kontextes und des Widerspruchs größere Wichtigkeit beimaßen, entsprach diese Akzentuierung zwar eigentlich nicht, dennoch verhalf sie aber der Erfahrung zu mehr Klarheit, indem sie sie von der oftmals paralysierenden Vielschichtigkeit der Existenz befreite. Die Verkleinerung des Spektrums persönlicher Belange, das Dort-und-Dann, öffnete vielen die Augen für die satorihafte psychologische Kraft der außerordentlich konzentrierten Einfachheit. Diese spezialisierte Aufmerksamkeit war mehr als die Vermeidung einer ausgedehnteren Realität; sie war der Eintritt in die begrenzten Bereiche des Geistes. Klarheit der Wahrnehmung, Verstärkung der Aktivität und Offenheit gegenüber blockierenden Ängsten gehörten zu den Verdiensten größerer Genauigkeit und der Begrenzung des Lebenszusammenhangs« (E. Polster 1990).
Diese Akzentuierung einer gelenkten Aufmerksamkeit sollte jedoch nicht zur Amputation vergangener und zukünftiger Ereignisse führen, aus denen sich unser Leben zusammensetzt. Trotz des Vorbehalts, daß gegenwärtige Erfahrung auch Erinnerung und Planung umfaßt, hat die falsch verstandene Interpretation des Hierund-Jetzt-Konzeptes viele Menschen von der Zukunft und der Vergangenheit weggeführt. Wir sind der Auffassung, daß die Zeit gekommen ist, die Platitüde des Hier-und-Jetzt als der Quelle der Erfahrung aufzugeben und durch eine sorgfältig gelenkte Aufmerksamkeit auf eine lange Kette von Ereignissen zu ersetzen. Ervs Beschreibung der Aufmerksamkeitstriade ist hier besonders treffend (vgl. E. Polster: A Population of Selves, 1995, S. 63-81).
2. Erzählfluß vs. »Darüberismus« – Wir sind dem Mißtrauen nachgegangen, mit dem der Lebensinhalt in der Gestalttherapie häufig betrachtet wird. Perls gebrauchte in diesem Zusammenhang das Wort »Darüberismus« [aboutism]. Wenn man sich die Ereignisfülle des Lebens vor Augen führt, kann das helfen, ein Gespür für Kontinuität zu entwickeln, die Verbindungen in der Kette von Ereignissen, die uns allen widerfahren, wiederherzustellen und ein Gefühl des persönlichen Zusammenhangs zu erzeugen. Eine gute Geschichte konkretisiert zudem die Abstraktionen, die das Leben eines Menschen ansonsten auf eingeschränkte Weise definieren (vgl. E. Polster 1987). Obwohl Abstraktionen als Einführungen oder Zusammenfassungen größerer Erfahrungszusammenhänge durchaus ihren Wert haben, lassen sie viel Bedeutsames aus. Sie sind eine Art Gedankengebäude für Geschichten. Wenn in diesen Abstraktionen jedoch keine Geschichten stecken, dann ist dieses Gebäude leer.
3. Konfigurativer Reflex vs. Gestaltbildung – Der konfigurative Reflex beschreibt unsere Sichtweise des Konzeptes der Gestaltbildung. Das gängige Modell der Gestaltbildung besagt, daß die Welt der Erfahrung uns in Ganzheiten gegeben ist. In der von uns vorgeschlagenen Betonung des konfigurativen Elements wird die Beziehung zwischen Ganzheiten und Teilen stärker berücksichtigt. Es bezeichnet einen kreativen Akt, in dem eine unendliche Menge an Bestandteilen reflexartig organisiert wird. Das Wohlbefinden jedes Menschen hängt weitgehend davon ab, wie erfolgreich er der Herausforderung begegnet, angesichts einer Masse unzusammenhängender Erfahrungen einen Sinn für Ganzheit zu entwickeln.
Diese Erkenntnis der Wechselbeziehung zwischen dem Ganzen und seinen Teilen erscheint der wahrnehmenden Person ziemlich offensichtlich. Bei den Psychologen jedoch hat die Frage nach dieser Wechselbeziehung historisch gesehen beträchtliche Spaltungen mit sich gebracht. Die Gestalt-Lerntheorie z. B., die stärkeres Gewicht auf die Ganzheit einer Erfahrung gelegt hat als auf ihre Teile, spaltete sich von der assoziativen Lerntheorie ab, die auf der Beziehung zwischen zwei experimentell beobachteten Ereignissen basierte. Als die Gestalttherapie aufkam, erklärten wir die Ganzheit als grundlegend nicht nur im Hinblick auf die Wahrnehmung, sondern auf jegliche persönliche Erfahrung. Wir taten dies in Abgrenzung zu einer anderen, eher psychoanalytischen Sichtweise, die zu analysieren versucht, welches Ereignis mit welchem anderen Ereignis zusammenhängt. Die Unerbittlichkeit, mit der diese Dichotomisierung stattfand, nagelte beide Seiten auf ihre Positionen fest und erzeugte eine schwere Last für den konfigurativen Prozeß, der in einer sich nicht gerade leicht erschließenden Welt nach Einheit sucht. Wie wir bereits sagten, begegnete Perls dieser Herausforderung, indem er zu differenziertem Denken aufrief (Perls 1947, S. 13ff). Das bedeutet, daß Menschen mit gegensätzlichen Phänomenen leben und daß diese Gegensätze Proportion und Bedeutung hervorbringen. Der Tag erlangt Bedeutung aus seiner Beziehung zur Nacht, die Enttäuschung aus ihrer Beziehung zur Befriedigung, das Ganze aus seiner Beziehung zu den Teilen.
4. Selbst als Klassifizierung vs. Selbst als fließende Erfahrung – Wir haben das Konzept des Selbst so überarbeitet, daß es auch solche Klassifizierungen des Selbst umfassen kann, die aus einem ursprünglich konfigurativen Prozeß erwachsen. Die Gestalttherapie reagierte auf die Klassifizierung von Ereignissen mit einer phänomenologischen Betrachtungsweise und der Betonung des Erfahrungsflusses. Anstatt sich durch die sozialen Auswirkungen der Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen wie Geschlecht, Rasse, Persönlichkeitstyp etc. eingeschränkt zu fühlen, fingen die Menschen an, die Begrenzung der Möglichkeiten zu öffnen und entwickelten mehr Zuversicht, die Gestaltung ihres Lebens selbst in die Hand zu nehmen.
In gutem Glauben ging die Gestalttherapie zu weit. Unsere gegenwärtigen Vorstellungen über die Bildung des Selbst versuchen, den phänomenologischen Fluß zu bewahren, ohne dabei die persönlichen Vorteile der Klassifizierung aufzugeben. Natürlich kann man die Klassifizierung des Selbst als Manifestation einer Gestaltbildung bezeichnen und behaupten, daß sie infolgedessen ebenso zum Leben gehört wie das Fließen des Selbst. Menschen suchen beides. Klassifizierungen des Selbst – wie etwa die in ein altruistisches oder ein urteilendes Selbst – ergänzen das Fließen und sorgen häufig für eine verläßliche Identität. Die Menschen wollen wissen, wer und was sie sind, und sie versuchen, aus der unüberschaubaren Fülle erlebter Ereignisse die Quelle ihrer persönlichen Identität herauszufiltern. Unser Konzept des Selbst basiert deshalb auf dem konfigurativen Prozeß, durch den Gruppen charakteristischer Eigenschaften gebildet werden (vgl. E. Polster: A Population of Selves). Daher besteht eine der therapeutischen Aufgaben darin, diese Gruppen charakteristischer Eigenschaften, die im Leben jedes Menschen einen permanenten und erkennbaren Platz haben, zu identifizieren, zu benennen und zu rekonstruieren. Sind die angemessenen Gruppen re-integriert, kann der einzelne wieder ein Gespür für persönliche Identität entwickeln und sich als Ganzes fühlen.
5. Dichte therapeutische Sequenzen vs. Hier-und-Jetzt – Das Konzept der dichten therapeutischen Sequenzen repräsentiert eine Veränderung des Fokus vom Hier-und-Jetzt hin zu den Übergängen und der Bewegung. Wir leben nie wirklich im Hier-und-Jetzt, sondern streben weiter und verbinden uns mit dem, was als Nächstes kommt. Da dieser Prozeß aber für Unterbrechungen und Verzerrungen anfällig ist, geht es in der Therapie u. a. darum, die Verbindung zwischen verschiedenen Erfahrungsmomenten wiederherzustellen. Verdichtung von Sequenzen impliziert, daß die Erfahrung eines beliebigen Augenblicks unmittelbare Folgen hat. Wenn jemand in einem Augenblick traurig ist, trägt der nächste Augenblick diese Traurigkeit weiter, vielleicht dadurch, daß die Person über ihre Traurigkeit spricht, vielleicht durch Weinen, vielleicht durch den Schwur, sich nie wieder so sehr einzulassen, oder durch irgend etwas, das zu dieser speziellen Person mit ihrer Traurigkeit und den gegebenen Umständen paßt. Ein therapeutisch bedingtes Nebenprodukt der Verdichtung solcher Sequenzen ist, daß die Wiederherstellung der Kontinuität eine Haltung des »ja, natürlich« fördert, das es in zunehmendem Maße natürlich erscheinen läßt, den (vorher blockierten) nächsten Schritt zu tun. Die Verbundenheit, die durch diese Übergänge von Augenblick zu Augenblick entsteht, wird so zu einer Säule persönlicher Ganzheit – sie stellt den Fluß und das Vertrauen in zukünftige Erfahrungen wieder her.
Das Konzept der dichten therapeutischen Sequenzen entspringt unserem früheren Versuch, den Konflikt zwischen dem Konzept des Widerstandes und dem der reinen Erfahrung zu klären. Durch die Betonung der reinen Erfahrung haben wir die Idee des Widerstands völlig über Bord geworfen. Perls, Hefferline und Goodman stellten sich gegen die damals üblichen Angriffe auf das Konzept des Widerstands. Statt dessen führten sie die Idee des kreativen Widerstands ein, wonach Verhaltensweisen, in denen man bis dahin üblicherweise bloßen Widerstand sah, als aktiver Ausdruck von Lebendigkeit betrachtet wurden, die nicht abgestellt, sondern als das angenommen werden sollten, was sie waren. Das kreative am »Widerstand« bestand darin, daß das Kind schwierigen Umständen eigene Lösungen entgegensetzte, aus denen neue Möglichkeiten erwuchsen, den Schmerz auszugleichen. Wenn es z. B. im Weinen verhaftet blieb, konnte das Kind den Entschluß fassen, nie mehr verprügelt zu werden, oder es konnte ein Mitgefühl für eine Mutter entwickeln, die das Weinen nicht tolerieren konnte, oder es entdeckte, wieviel Traurigkeit sein Körper aushalten konnte, ohne sich Erleichterung verschaffen zu müssen etc. So betrachtet, verlor der Widerstand seine abwertende Qualität, und die Therapeuten entwickelten so etwas wie Wertschätzung für die Tapferkeit und die Kreativität, mit denen Menschen schwierige Situationen zu meistern versuchten.
Funktional bedeutete dies ein Mehr an Empathie für den Patienten, und der Therapeut stand nicht mehr so sehr in der Gefahr, Streitlust, Apathie, Verdrehung oder andere Hindernisse aufgrund seiner eigenen Sicht der notwendigen therapeutischen Vorgehensweise wegzuerklären. Statt dessen nahm er das Verhalten, so wie es sich darstellte und reagierte auf Streitlust, Apathie, Verdrehung etc. mit Neugier, Rechtfertigung, Erinnerung, Rat, Unterstützung, Stille oder anderen angemessenen Reaktionen, die seinen eigenen Möglichkeiten entsprachen. Trotz der bedeutsamen Korrektur jedoch, die das Konzept des kreativen Widerstands mit sich gebracht hat, glauben wir, daß die Idee des Widerstands, sei dieser nun kreativ oder nicht, durch die auf Seiten des Therapeuten historisch einseitige Bewertung dessen, was richtiges therapeutisches Verhalten sei, zu stark belastet ist.
Das Konzept des Widerstands diente lange Zeit als vornehmliche Quelle des Verständnisses der Gefahren versteckter Bedeutungen und uneindeutig gehemmter Erfahrung. Was wir statt dessen anbieten, sind Konzepte, die ebenfalls Bedeutung und Hemmung berücksichtigen, die aber weniger Gefahr laufen, die eigentliche Erfahrung in den Schatten zu stellen. Wir haben eine Unterscheidung zwischen vertikaler und horizontaler Bedeutung eingeführt. Vertikale Bedeutung entsteht, wenn man in die Oberfläche der Erfahrung eindringt und sieht, was unter dieser Erfahrung liegt. Das ist ein legitimer Weg zum Verständnis jeder Art von Erfahrung, der allerdings auch eine Versuchung für die intellektuelle Virtuosität darstellt und häufig übertrieben oder zur falschen Zeit beschritten wird. In diesen Fällen überschattet er die eigentliche Erfahrung und führt zu kaum mehr als einer hohlen Abstraktion.
Der andere Weg zur Bedeutung, der horizontale, zeigt sich in der Entwicklung von Bedeutung durch eine Sequenz von Erfahrungen. Bedeutung ist das Verstehen der Wechselbeziehung zwischen Ereignissen. Sie kann gewonnen werden durch die Wiederherstellung von Verbindungen zwischen Erfahrungen, so wie sie von Augenblick zu Augenblick entstehen. Solche Bedeutungen können in den Verdacht geraten, die »tiefere« Bedeutung, nach der häufig gesucht wird, nicht zu erreichen, wie etwa den Zusammenhang zwischen einer aktuellen Angst vor sozialen Beziehungen und einer traumatischen Isolation durch einen frühen Lehrer, aber diese Tiefe wird auch durch horizontale Entwicklung sichtbar. Das Konzept des »Widerstands« aufzugeben bedeutet für uns nicht, Bedeutung zu überspringen oder die Vielfalt gehemmter Verhaltensweisen, die der Kontinuität des Erlebens im Weg steht, außer acht zu lassen. Vielmehr betrachten wir Bedeutungsdiskrepanzen ebenso wie Störungen der Kontinuität als natürliche Aspekte komplexen Verhaltens. Indem wir diese Diskrepanzen durch die horizontale Wiederherstellung der gegenwärtigen Kontinuität ausfüllen, wird die Erneuerung solcher einfachen Verbindungen zum Vehikel für die Wiederherstellung von Bedeutung und Kontinuität im Denken und Erleben derjenigen, die Bedeutung vermissen oder verloren haben.
6. Kontakt vs. Empathie und Verschmelzung – Kontakt ist das, was an der Grenze zwischen Selbst und anderem geschieht. Was wir jedoch auch berücksichtigen müssen, ist die unteilbare Beziehung zwischen Kontakt und Empathie und Verschmelzung, die wir als »Kontakttriade« beschrieben haben. Zu der Zeit, als man die Individualität stärker betonte, wurde diese Einheit häufig übersehen. Empathie galt als suspekt, weil es sein konnte, daß jemand einseitig und fälschlich Gefühle unterstellte, die andere gar nicht hatten. Zum Beispiel könnte ich empathisch sein, weil ich annehme, daß der Verlust deiner Arbeit dich traurig macht, während du dich in Wirklichkeit erleichtert fühlst. Aus ähnlichen Gründen galt auch Verschmelzung als suspekt, aber nicht so sehr wegen der Gefahr falscher Annahmen, sondern weil die Vereinigung der Absichten zweier Menschen zur Verschleierung der eigenen Identität führen könnte. Wenn wir jedoch Kontakt, Empathie und Verschmelzung als Kontakttriade verstehen, entwickelt das Konzept ein tiefer und stärker empfundenes Gefühl für Beziehung.
Als die Gestalttherapie das Konzept des Kontakts einführte, berücksichtigte sie erstaunlicherweise die Beziehung ebensowenig wie das Verhältnis zwischen Kontakt, Empathie und Verschmelzung. Was nicht ausreichend bedacht wurde, ist die Tatsache, daß man sehr wohl einen hervorragenden Kontakt zu jemandem haben kann, ohne dabei aber wirklich in Beziehung zu treten. In unserem Buch Gestalttherapie – Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapie sprechen wir deshalb von Kontaktepisoden als einem Konzept, das den Kontakt über den Rahmen eines bestimmten Augenblicks hinaushebt, indem wir verschiedene Phasen beschreiben, durch die hindurch sich Kontakt entwickelt. Doch selbst dieses Konzept ist noch auf eine bestimmte Art von Kontakt begrenzt und vernachlässigt die persönliche Beziehung.
Will man sich den umfassenderen Aspekten von Beziehung widmen, geht die Verschmelzungstriade noch einen Schritt weiter als die Kontakttriade. Die Funktion der Verschmelzung enthält drei gestalttherapeutische Konzepte: Introjektion, Konfluenz und Synthese. Jedes dieser Konzepte leistet einen Beitrag zum Gefühl der persönlichen Untrennbarkeit von anderen Menschen. Introjektion z. B. wird weithin im Kontrast oder Gegensatz zu Kontakt verstanden. Wir hingegen betrachten Introjektion als etwas, das mit Kontakt koordiniert wird. Wie Erv schreibt:
»Der Mensch, der Kontakt aufnimmt, ist so eng verbunden, daß er zum ›Schmiermittel‹ für den introjektiven Prozeß wird, denn dieser Prozeß macht ihn eigentlich erst wirklich aufgeschlossen« (E. Polster 1995, S. 32-33).
Daher glauben wir, daß man Introjektion am besten als spontane und von bewußten Erwägungen und Überlegungen freie Aufgeschlossenheit versteht. Unseres Erachtens beinhaltet der introjektive Prozeß aber nicht nur qualitativ hochwertigen Kontakt, sondern auch eine erfolgreiche Konfiguration und reflektierte Gestaltung. Ebenso wie beim Herzschlag oder der Atmung handelt es sich bei der Introjektion um eine an sich gesunde Funktion, die allerdings – wie Puls oder Atmung – auch »verrückt spielen« kann. So wie die Atmung dem Körper frische Luft zuführt und der Herzschlag den Blutkreislauf reguliert, dient die Introjektion als ursprüngliche Lernquelle. Versteht und akzeptiert man Introjektion als einen Prozeß der Befruchtung, dann ergeben sich daraus weitreichende Konsequenzen für die Freiheit der Einflußnahme des Therapeuten auf seinen Patienten, weil man damit anerkennt, daß der Patient, der sich den Vorstellungen und Überzeugungen des Therapeuten anvertraut, nicht in jedem Falle einfach nur leichtgläubig handelt, sondern sich damit u.U. auch einen sinnvollen Einstieg in eine neue Art der Erfahrung eröffnen kann. Diese Offenheit für die Einigkeit mit dem Therapeuten oder mit anderen mag für die Selbstbehauptungskraft des einzelnen ein Risiko darstellen, gleichzeitig ist sie aber auch ein wichtiger Ansatzpunkt für die Entstehung und Entwicklung neuer Selbstbilder sowie für das Zulassen heilsamer gemeinsamer Erfahrungen.
Ohne an dieser Stelle ins Detail zu gehen, können wir beobachten, daß die anderen Elemente der Verschmelzungstriade, nämlich Konfluenz und Synthese, dieselbe Art der Gegenseitigkeit hervorbringen wie die Introjektion. Konfluenz schafft eine gemeinsame Basis für verschiedene Menschen und ermöglicht die Koordination persönlicher Interessen. Synthese trägt dazu bei, ein Gefühl von Ganzheit entstehen zu lassen, in dem sich sowohl die harmonischen als auch die dissonanten Lebenserfahrungen wiederfinden. Diese Erweiterung der theoretischen Erkenntnis der sehr weit gefaßten Parameter menschlicher Beziehungen führt auch zu einer stärkeren Betonung solcher Konzepte wie Zugehörigkeit, Identität und Gemeinschaft.
»In unserer hochgradig individualisierten Gesellschaft ist es leichter, das menschliche Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu vernachlässigen … Therapeuten gehen grundsätzlich davon aus, daß wenn die Individualität eines Patienten erst wiederhergestellt ist, er schon einen Weg finden wird, um wieder dazuzugehören. Für Punkt-Kontrapunkt-Beziehungen gilt jedoch: Wenn man sich einer Seite sehr sicher ist, nimmt die andere dementsprechend ab. Wenn wir die einander widerstrebenden Bedürfnisse nach Individualität und Zugehörigkeit in den Griff bekommen wollen, müssen wir beide berücksichtigen« (E. Polster 1995, S. 179).
7. Inhalt vs. Prozeß – Die Gestalttherapie hat die Wichtigkeit des »Wie« der Erfahrung erkannt und dadurch dem »Was« einen Teil der Aufmerksamkeit entzogen. Natürlich geht es nicht ohne das Was. Wird der Inhalt jedoch einfach als gegeben hingenommen, dann kann es sein, daß die Prozeßbeobachtungen in der Therapie überhand nehmen. Die Fokussierung der Sprache, der Muskulatur und des geistigen Rahmens werden dann vorrangig, während das eigentliche Erzählen der Ereignisse in den Hintergrund tritt. Fragen wie: Was tust, fühlst oder willst du? fördern zwar den Prozeß, gleichzeitig drücken sie aber auch den Wunsch aus, zu wissen, was der andere denn tut, fühlt oder will. Unserer Erfahrung nach führt die ausschließliche Konzentration auf den Prozeß eher zu einer mechanisch orientierten Therapie, als wenn der Inhalt in angemessenem Umfang mit betrachtet wird. Ist der Fokus auf den Inhalt wiederhergestellt, dann wird die Geschichte zu einer vortrefflichen Quelle des Gefühls von Ganzheit und Selbstbestätigung (vgl. den Artikel Jedes Menschen Leben ist einen Roman wert von Erv in diesem Buch auf Seite 187ff).
8. Gewahrsein vs. Handlung – Wir haben die »synaptische Erfahrung« als Steigerung der Erfahrung durch die Einheit von Gewahrsein und Handeln beschrieben. Diese Einheit entspricht der senso-motorischen Natur der Existenz. Wenn die Einheit von Gewahrsein und Handeln voll zum Zuge kommt, dann verbessern sich durch den damit verbundenen scharfen Fokus auch die Chancen, daß die Erfahrung bewußt wahrgenommen und erlebt wird. Dieses bewußte Erleben ist eine wirkungsvolle Kraft, die bei vielen Patienten häufig starke oder große Erfahrungen auslösen, wie etwa Weinen oder Wut, gesteigerte Erregung, das Annehmen der Liebe eines anderen Menschen, die Erkenntnis neuer Möglichkeiten oder auch ein Gefühl des Ganzbei-sich-Seins, das durch das erfolgreiche Zusammenspiel der verschiedenen Modi von Gewahrsein und Handeln entsteht. Darüber hinaus fließen die Wirkungen der Einheit von Gewahrsein und Handeln auch in den intensivierten Kontakt zwischen Therapeut und Patient ein und können dem Patienten Geschichten über seine Lebenserfahrungen zu Bewußtsein bringen. Das Zusammenspiel von Handeln, Gewahrsein und Kontakt ist ein Grundstein des therapeutischen Erfolgs – vor allem dann, wenn dieses Zusammenspiel die Beziehung fördert und gestaltet.
9. Menschlichkeit vs. Technik – Wir sind der Auffassung, daß die Technik ein elementarer Bestandteil der Therapie ist. Wir glauben aber auch, daß normale Sprache und Beziehung die Basis jeder technischen Arbeit sind. Wie Erv gesagt hat:
»Da der normale Kontakt, wie er im täglichen Leben jederzeit vorkommt oder vorkommen kann, eher als ‚natürlich‘ empfunden wird, ist es wichtig, daß in der Therapie auch einige solcher leicht erkennbaren Kontaktarten vorkommen. Dazu gehören Freundlichkeit, Neugier, eine klare und abwechslungsreiche Sprache, das Ausstrahlen von Aufmerksamkeit, ein wohlwollendes aber entschlossenes Denken und noch viele andere zwischenmenschliche Qualitäten, die das tägliche Leben der Menschen mitprägen« (E. Polster 1995, S. 142).
Ein Zusammenspiel von alltäglicher menschlicher Anteilnahme und psychotherapeutischen Techniken findet eigentlich immer statt, das Verhältnis der beiden zueinander hängt jedoch vom jeweiligen Therapeuten ab. Bei einigen Therapeuten wird sehr klar sein, daß jede ihrer Handlungen oder Interventionen technisch orientiert sind, während man bei anderen die therapeutische Sitzung manchmal kaum von einer alltäglichen Gesprächssituation zwischen zwei Menschen wird unterscheiden können.
Eine Folge der Schlüsselrolle, die dem qualitativ hochwertigen Kontakt für die menschliche Qualität der Psychotherapie zukommt, ist eine Aufmerksamkeits-Triade, in der Konzentration, Faszination und Neugier miteinander kombiniert werden. Diese Prozesse führen den Therapeuten dazu, aufgeschlossen und sorgsam zu sein. Dadurch, daß wir ein besonderes Augenmerk auf den Erzählfluß legen, schenken wir dem dramatischen Aspekt im Leben des Patienten und der persönlichen Intimität, die sich aus der therapeutischen Beziehung heraus entwickelt, zusätzliche Aufmerksamkeit.
10. Feldtheorie vs. Systemtheorie – Viele Gestalttherapeuten sind der festen Überzeugung, daß die Gestalttherapie eine Feldtheorie sei. Andere glauben, daß die holistische Perspektive der Gestalttherapie, die die Interdependenz von Ereignissen hervorhebt, sie auch als Systemtheorie qualifiziere. Beide Positionen sind durchaus komplex, und wir sind keiner von beiden ausschließlich verpflichtet – abgesehen von den Erkenntnissen, die sie in bezug auf Holismus und Interdependenz hervorbringt. Eine Frage, die im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen Feldtheorie und Systemtheorie immer wieder gestellt wurde, ist die, ob man von primären Ganzheiten ausgehen soll, die sich dann differenzieren, oder ob man von primären Teilen ausgehen soll, die dann integriert werden. In eine menschliche Begrifflichkeit übersetzt, lautet die Frage: Was kommt zuerst – das Wir, das sich in ein Ich und ein Du differenziert, oder das Ich und das Du, aus dem das Wir entsteht? Unseres Erachtens ist dies eine Frage nach Henne oder Ei – faszinierend, aber nicht maßgeblich für unser Verständnis von Gestalttherapie. Was die Theorie der Gestalttherapie uns zu verstehen hilft, ist die permanente Bewegung zwischen Ganzheiten und Teilen, unabhängig davon, was zuerst da war. Wir sehen das z. B. daran, daß eine Nase gleichzeitig eine Ganzheit, aber auch Teil der Ganzheit Gesicht ist, und diese ist wiederum Teil einer ganzen Person, die Teil einer ganzen Familie ist usw. ad infinitum.
Der zweite Faktor, der zur Unterscheidung zwischen Feld- und Systemtheorie herangezogen wird, ist der Unterschied zwischen linearer und nicht-linearer Sprache. Doch auch diese Unterscheidung erweist sich nicht als besonders brauchbar, denn beide Theorien müssen sich ja mit beiden Sprachformen auseinandersetzen. Intuition z. B., angeblich nicht-linear, kann sowohl in klar erkennbaren Sequenzen kommuniziert werden, oder aber sie wird erst im nachhinein verstanden, also durch später gemachte Erfahrungen und in überraschenden, vielleicht blitzartigen Erkenntnissen. Darüber hinaus gibt es Extreme von Linearität und Nicht-Linearität, was sich zum einen in der surrealistischen Literatur widerspiegelt, deren Sequenzen sich dem Leser nicht unbedingt leicht erschließen, zum anderen in wissenschaftlichen Beiträgen, für die eine strikte logische Gedankenfolge unabdingbar ist.
Dennoch kann es sein, daß der surrealistische Autor das, was er zu sagen hat, trotz vielleicht merkwürdiger sprachlicher Konstruktionen sehr deutlich herüberbringt, während ein wissenschaftlicher Autor trotz seiner syntaktischen Untadeligkeit durchaus verworren und unverständlich schreiben kann. Wir sehen keinen Grund, die eine oder andere Kategorie zu verherrlichen oder zu verurteilen. Worauf es nach unserer Überzeugung hingegen wirklich ankommt, ist, daß die Verfechter beider Positionen in der Lage sind, sich ihren Patienten verständlich zu machen und für die überraschenden Verbindungen zwischen ihren Erfahrungen offen zu sein.
Es gibt noch andere Unterscheidungen zu treffen – mehr als wir an dieser Stelle ansprechen können. Doch welche holistische Orientierung der einzelne Gestalttherapeut der Feld- oder der Systemtheorie auch immer abgewinnen mag, letztlich führen beide Theorien zu der Erkenntnis, daß die Gemeinschaft im Leben eines Menschen eine zentrale Rolle spielt, und dieser Aspekt wird in verschiedenen Beiträgen dieses Buches immer wieder aufgegriffen. Der offensichtliche Grund dafür, daß die Gemeinschaft für den therapeutischen Prozeß eine so wichtige Rolle spielt, besteht darin, daß die freudigen und schmerzlichen Erfahrungen der Menschen aus der Art und Weise resultieren, wie sie und ihre Gemeinschaften sich aufeinander beziehen. Die Therapie lohnt sich dann, wenn die Patienten in der Lage sind, das, was sie in der Therapie gelernt haben, auch in ihrem Leben in und mit der Gemeinschaft umzusetzen.
Es ist unübersehbar, daß Einzel- und Gruppentherapie dem heutigen gesellschaftlichen Bedürfnis bei weitem nicht gerecht werden. Die therapeutische Arbeit erwuchs ursprünglich aus der Erkenntnis unterdrückter individueller Bedürfnisse, die von der Religion und anderen gesellschaftlichen Institutionen zu lange ignoriert worden waren. Doch das Pendel schwingt, und inzwischen erkennen wir das Bedürfnis nach einer gegenseitigen Beziehung zwischen dem einzelnen und seiner Gemeinschaft, die beide aufeinander einwirken. Diese Gegenseitigkeit hat einen funktionalen Charakter, dem aus therapeutischer Sicht von zwei Seiten begegnet werden kann. Zum einen können wir den einzelnen unterstützen, in seinem täglichen Leben immer wacher und aufmerksamer zu werden, um diese Gegenseitigkeit dadurch herzustellen, daß er eine Gemeinschaft findet, die seine Individualität fördert. Zum anderen kann die Psychotherapie Gelegenheiten zur Gegenseitigkeit schaffen, indem sie große Gruppen als Instrument des therapeutischen Prozesses entdeckt und benutzt. Auf diese Weise kann in einem dauerhaften Prozeß und einer gemeinschaftlichen Atmosphäre ein lebensnaher Fokus entstehen, anstatt lediglich auf die Beseitigung bestimmter Störungen abzuzielen.
Schluß
Wir glauben, daß die Gestalttherapie ihre Identität vor allem aus der Integration solcher einander widersprechender Prinzipien herleitet, wie sie durch die zehn hier beschriebenen Dimensionen repräsentiert werden. Daneben existieren noch andere Dimensionen, und das Bemühen um deren Integration ist ein ebenso entscheidender Bestandteil ihrer Identität. Diese zehn sind jedoch diejenigen, die in der hier vorliegenden Auswahl unserer Schriften am stärksten berücksichtigt werden.
Die Fruchtbarkeit jeder Theorie entspringt ihren zentralen Prinzipien. Um ihre Ganzheitlichkeit zu bewahren, müssen Theorien aber konzeptionelle Bereiche, die ihre Prinzipien nicht abdecken, ebenso berücksichtigen wie die Widersprüche, die sich daraus ergeben. Neue Perspektiven und Anwendungsmöglichkeiten wurzeln in eben dieser Auseinandersetzung zwischen klarer theoretischer Identität und ungehemmtem Wachstum von Prinzipien. Stück für Stück kommen wir so zu Einsichten und Folgerungen, die ursprünglich nicht erkennbar waren. Dies geschieht z.T. deshalb, weil das Lernen komplexer Methoden mit so ungeheuren Anforderungen verbunden ist, daß kaum genug Raum bleibt, um sie in Frage zu stellen – vor allem dann nicht, wenn dieses In-Frage-Stellen von den Vordenkern und tonangebenden Theoretikern als Bedrohung des Systems empfunden wird. Nach einer Weile jedoch gewinnt man mehr Sicherheit im Umgang mit dem System – zumindest soviel, daß Zweifel an seiner Heiligkeit nicht mehr als unangemessene Bedrohung erscheinen.
Erving und Miriam Polster. Originalbeitrag für dieses Buch, 1999. Aus dem Amerikanischen von Ludger Firneburg.
Teil I:
Die Bühne bereiten
Zeitgemäße Psychotherapie
Einige der Überlegungen zum Begriff des Zeitgemäßen, die in diesem Aufsatz vorgestellt werden, haben mir die Gestalttherapie als Orientierungssystem für meine Arbeit nähergebracht.
Im normalen Sprachgebrauch findet man Worte wie »zeitgemäß« oder »modern« vor allem im Zusammenhang mit der Kunst, der Architektur, der Malerei oder der Musik, und weniger im wissenschaftlichen Umfeld. Dennoch muß auch die Wissenschaft – und zweifellos auch die Psychotherapie – über ihre Aktualität nachdenken, denn Wahrheiten wandeln und verändern sich von Generation zu Generation und setzen immer wieder neue Maßstäbe.





























