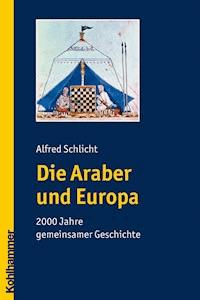Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
The states of Ethiopia, Djibouti, Eritrea and Somalia together form what is known as the Horn of Africa, on the eastern tip of the African continent. The region is characterized by cultural diversity, with Christian and Muslim influences encountering each other, and it has had close ties with Europe since ancient times. At the turn of the 21st century, the Horn of Africa became an international trouble spot & for example, due to the war between Eritrea and Ethiopia and the disintegration of Somalia, which was ravaged by Islamist terrorism. Alfred Schlicht traces the region=s history, from discoveries of early human remains to the period of great-power rivalry, colonialism, and hopes for reconciliation in recent years. The very latest events are thus placed in a broader context historically and geographically, in a well-grounded and readable way.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Dr. Alfred Schlicht, Orientalist und langjähriger Diplomat, hat viele Jahre im Nahen Osten gelebt, ist Experte für die Geschichte und Politik des gesamten Vorderen Orients und Nordafrikas und hat eine Reihe von Büchern über die Geschichte der Region und den heutigen Islam publiziert.
Alfred Schlicht
Das Horn von Afrika
Äthiopien, Dschibuti, Eritrea und Somalia: Geschichte und Politik
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Umschlagbild: Collage der Flaggen Äthiopiens (Bild: Miguel Á. Padriñán), Eritreas (Bild: Mykhailo Polenok), Dschibutis (Bild: slon.pics – freepik.com) und Somalias (Bild: pixabay.com).
Print:
ISBN 978-3-17-036965-8
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036966-5
epub: ISBN 978-3-17-036967-2
mobi: ISBN 978-3-17-036968-9
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Vorwort
1 Von den ersten Menschen bis zu den frühen Staaten am Horn von Afrika
Erste Menschen
Das Land Punt und frühe Staaten am Horn von Afrika
Christentum, Handel und Imperialismus zwischen Südarabien und Nil: Das Reich von Aksum
Der Islam kommt ans Horn von Afrika
Die Nadschahiden – eine abessinische Sklavendynastie in der jemenitischen Küstenebene
2 Lalibela – die Zagwe-Dynastie
3 Sieben Jahrhunderte salomonische Dynastie – zwischen christlichem Nationalmythos und imperialer Kontinuität
Ein Staat und seine Legende
Aufstieg und Ausbreitung eines Imperiums
Christliche ›Fundamentalisten‹
Zar’a Ya’kob – Religion, Kultur und Weltpolitik
Krisen und interkontinentale Beziehungen
Aufbruch der Oromo
Ein katholisches Reich am Horn von Afrika?
Das Reich von Gonder
Zemene Mesafent – Zerfall des Reiches
4 Vielfalt am Horn von Afrika – historische Aspekte und Facetten
Das Horn von Afrika und Europa im Mittelalter und an der Schwelle zur Neuzeit
Islamische Staaten am Horn von Afrika
Die Beta Israel – Juden am Horn von Afrika?
Regionale Identitäten am Horn von Afrika
Die Somalis vor der Kolonialzeit
Sklaverei
5 Drei Kaiser schaffen das moderne Äthiopien – das Horn von Afrika zwischen Restauration und Neubeginn
Tewodros II.
Yohannes IV.
Menilek II.
6 Der Imperialismus am Horn von Afrika im 19. und 20. Jahrhundert
Französisch-Dschibuti
Britisch-Somaliland
Italienisch Somalia
Die italienische Kolonie Eritrea
Deutschland am Horn von Afrika?
7 Äthiopien unter Hayle Selassie – das Ende des salomonischen Reiches
Kaiserinnen am Horn von Afrika?
Auf dem Weg zur Macht – Teferi Mekonnens Regentschaft
Der letzte Kaiser (I) – bis zur italienischen Okkupation
Ca Custa Lon Ca Custa – um jeden Preis: Africa Orientale Italiana
Der letzte Kaiser (II) – Vom Neubeginn bis zum Ende des salomonischen Reiches
8 Eritrea – der lange Weg von der italienischen Kolonie zur Unabhängigkeit
Eine eritreisch-äthiopische Föderation?
Vom Buschkrieg zur nationalen Unabhängigkeit – 30 Jahre eritreischer Befreiungskampf
9 Marxismus, Hunger, Bruderkrieg und Versöhnung
Das Scheitern eines Regimes, die Geburt einer Nation
Neuanfang mit Hindernissen
Grenzkonflikt oder mehr?
No War, No Peace
Äthiopien – ›Entwicklungsdiktatur‹ auf dem Weg zum ›China Afrikas‹?
Abiy Ahmad – Neubeginn am Horn von Afrika?
10 Somalia und Dschibuti – Wege in die Unabhängigkeit … oder ins Chaos?
Failed State Somalia?
Internationale Krisenbewältigungsversuche und islamistischer Terror
Dschibuti – Insel der Stabilität?
Karten
Anmerkungen
Bibliographie
Abbildungsnachweis
Vorwort
Wenn die griechische Hässlichkeit in Äthiopien Schönheit sei, so könnte wohl sein, dass beide Teile recht hätten?
Christoph Martin Wieland, ›Geschichte der Abderiten‹
Das ›Horn von Afrika‹ ist ein geographischer Begriff. Es bezeichnet den Raum um die Ostspitze Afrikas, die wie ein Horn in den Indischen Ozean ragt. Hier befindet sich der östlichste Punkt Afrikas, Ras Hafun (Ras Xaafuun), südlich von Kap Guardafui, dem ›aromaton acron‹ (Kap der Gewürze) der Antike. Kap Guardafui liegt an der Spitze des Horns von Afrika und wird deshalb manchmal irrtümlicherweise als östlichste Stelle des Kontinents betrachtet. Zu den heutigen Staaten am Horn von Afrika im weiteren Sinn gehören Äthiopien, Dschibuti (Djibouti), Eritrea und Somalia, welche den geographischen Rahmen abstecken, dessen historische Entwicklung Gegenstand vorliegenden Buches ist.
Dieser geographische Raum ist selbst dem gut informierten Europäer bestenfalls in großen Linien vertraut. Deshalb ist es unerlässlich für ein historisches Verständnis des Horns von Afrika, geographische und historische Karten zu verwenden. In Band V der ›Encyclopaedia Aethiopica‹ (EA) findet sich eine Zusammenstellung von über 30 Karten,1 viele historische Werke enthalten weiteres kartographisches Material, auch am Ende dieses Buches finden sich zwei Karten.
Es fällt schwer, gemeinsame Züge für die Länder dieses Raumes zu finden. Charakteristisch ist vielmehr eine schier unüberschaubare Vielfalt – etwa 80 Sprachen, die teilweise untereinander nicht einmal verwandt sind, werden hier gesprochen. Nie war im Laufe der Geschichte das ›Horn von Afrika‹ eine politische oder kulturelle Einheit oder wurde von einer einzigen Macht beherrscht. Auch religiös herrscht mehr Vielfalt als Einheit. Neben dem Christentum und dem Islam, die seit weit über 1000 Jahren vor allem prägend waren, existieren auch zahlreiche (Natur-)Religionen lokaler und regionaler Bedeutung.
Ein besonderes Charakteristikum des Horns von Afrika besteht darin, dass hier das Christentum eine über 1600 Jahre lange staatliche Kontinuität aufzuweisen hat, dass hier seit dem 4. Jahrhundert christliche Staaten bestehen. Das Horn von Afrika ist der einzige Bereich auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, in dem das Christentum seine Führungsrolle bis heute behaupten konnte. Die christlichen Reiche Nubiens wurden vom Islam erobert, die ägyptischen Kopten sind längst zur Minderheit im Land am Nil geworden. In den Ländern Nordafrikas westlich von Ägypten ist das Christentum völlig verschwunden.
Die Länder dieses Großraums haben untereinander immer sehr enge und wechselvolle Beziehungen unterhalten, intensive Wechselwirkungen und lebhaften Austausch erlebt. Deshalb ist es sinnvoll, sie als eine historische Einheit zu betrachten.
Dabei ist die Verwendung geographischer und kultureller Begriffe nicht unproblematisch. Sprechen wir etwa über das salomonische Reich oder seine christlichen und vorchristlichen Vorgänger, so verwenden wir in diesem Buch oft die Bezeichnung ›Abessinien‹ (vom semitischen ›Habasch‹,2 deshalb in älteren deutschen Texten auch Habessinien), ›Äthiopien‹ wird vorwiegend als Bezeichnung für den modernen Staat dieses Namens (seit dem 19. Jahrhundert) verwendet.
Andere Bezeichnungen, wie Somalia oder Eritrea, werden – wenn sie sich nicht eindeutig auf die modernen Staaten beziehen – angewandt, um die geographische Einordnung eines Ortes oder eines Ereignisses zu erleichtern. Sie sollen weder Grenzen präjudizieren noch eine Parteinahme in kontroversen Fragen darstellen.
Zahlreiche Eigennamen und Toponyme, die in diesem Buch verwendet werden, entstammen unterschiedlichen Sprachen und Kulturkreisen, für die kein einheitliches Transskriptionsystem existiert. Es wurde versucht, sie in einer benutzerfreundlichen, bewusst vereinfachenden Schreibweise wiederzugeben, die allerdings keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben will und kann. Inkonsequenzen sind dabei nicht auszuschließen.
Die Geschichte des Horns von Afrika ist in Europa außerhalb der Fachkreise noch weitgehend unbekannt – deshalb ist das Buch chronologisch aufgebaut. Dies stellt für den Leser den einfachsten Zugang zu einer sehr komplexen Materie dar. Eine Ausnahme bildet Kapitel 4, in dem thematische Einzelaspekte, welche eine vertiefte Behandlung sinnvoll erscheinen lassen, näher betrachtet werden.
Für dieses Buch habe ich über Jahre und Jahrzehnte hinweg zahlreiche Anregungen, Inspirationen und Impulse von verschiedensten Seiten erhalten, für die ich sehr dankbar bin. Besonders verpflichtet fühle ich mich:
Meinem Großvater Eugen Berger, der lebhaftes Interesse an außereuropäischen Räumen hatte, dieses an seine Kinder weitergab und stets von Reisen träumte, die ihm nie möglich waren.
Meiner Mutter Hildegund Berger, die mich schon als Kind auf Reisen nach Afrika mitnahm und mir aufgrund ihrer umfassenden literarischen, geographischen und historischen Kenntnisse die Augen für Vieles öffnete.
Meinem verehrten akademischen Lehrer Julius Assfalg,3 der mir half, Zugang zur vielfältigen Welt der Sprachen und Kulturen des christlichen Orients zu finden und sie mir wissenschaftlich zu erschließen.
Meinem akademischen Lehrer Hans-Joachim Kißling, der mein Interesse an interkontinentalen Beziehungen im Spannungsfeld der islamisch-christlichen Rivalität weckte.
Meinem Mentor Eberhard Schmitt,4 als dessen Mitarbeiter ich viel über Globalgeschichte gelernt habe und dem wir das 14-bändige Monumentalwerk ›Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion‹ verdanken, an dem ich zeitweise mitarbeiten durfte.
Meinem Schwiegervater Ghebre Selassie Dirar, der als Geistlicher die tiefe, traditionelle Frömmigkeit des christlichen Afrika bis an die Schwelle zum 21. Jahrhundert brachte und dessen Gebetbuch noch heute im Familienbesitz ist.
Meiner Frau Azeb, die die Familientradition bis heute lebendig hält und dafür sorgt, dass in unserer Familie noch drei Sprachen (Tigrinya, Amharisch und Arabisch) vom Horn von Afrika gepflegt werden. Sie half mir, Quellen zu erschliessen, die mir sonst unbekannt geblieben wären.
Meiner Tochter Julia, die in Washington DC geboren ist, in Amman, Jordanien, zur Schule kam, in Atlanta, GA, ihr Abitur machte, die in Deutschland studiert und in drei Kulturkreisen zuhause ist. Sie leistete mir konkrete Hilfe bei der Entstehung dieses Textes.
Ihnen widme ich dieses Buch.
Alfred SchlichtIm November 2020
1 Von den ersten Menschen bis zu den frühen Staaten am Horn von Afrika
Erste Menschen
Afrika ist eine der Wiegen der Menschheit. Einige der ältesten Spuren von Menschen wurden am Horn von Afrika entdeckt. Millionen Jahre alte Überreste von Hominini kommen vor allem am Afrikanischen Grabenbruch vor, der von der Küste des Roten Meeres durch die heutigen Staaten Dschibuti und Äthiopien und weiter in südlicher Richtung verläuft. Menschenfunde wurden im Süden des heutigen Äthiopien an der Grenze zu Kenia gemacht. Schwerpunkt solcher Funde ist jedoch die Afar-Senke (auch Danakil-Senke oder Afar-Dreieck),1 ein Tiefland im Nordosten Äthiopiens, das sich nach Eritrea, Dschibuti (Djibouti) und Somalia erstreckt. Am Awash-Fluss, der diese Region von Süd nach Nord durchfließt, wurde 1997 der Ardipithecus ramidus kadabba entdeckt, das erste Spezimen eines definitiv auf zwei Beinen gehenden Menschen. Er ist mit 5,2 bis 5,8 Millionen Jahren der älteste Fund in diesem Raum. Nur in Kenia und im Tchad fanden sich menschliche Reste, die möglicherweise noch etwas älter sind. Berühmtheit über die Fachkreise hinaus hat ›Lucy‹2 erlangt, die zwar ›nur‹ 3,2 Millionen Jahre alt ist, aber ein weitgehend vollständiges Skelett darstellt, das heute im Nationalmuseum von Addis Abeba aufbewahrt wird. Vielleicht wegen dieser Vollständigkeit wird ›Lucy‹ von den Äthiopiern ›Dinqenesch‹ (Du bist so wunderbar) genannt. Sie wurde 1974 ebenfalls am Awash-Fluss gefunden.
Die menschlichen Spuren im eritreischen Buya sind mit einer Mio. Jahre dagegen vergleichsweise ›jung‹. All diese Menschenfunde sind jedoch in jedem Fall sehr viel älter als der in Europa gefeierte ›Ötzi‹, der 1991 in Südtirol gefunden wurde, mit einem Alter von nur etwas über 5000 Jahren allerdings auch bereits ein homo sapiens sapiens ist.
Schon in der griechischen Antike muss das Horn von Afrika ein Ort gewesen sein, an dem die Menschheit ihren Ursprung suchte: ›Aithiops‹ war eine mythische Gestalt, die im Osten am Ozean lebte und sowohl die älteste als auch die vollkommenste Verkörperung des Menschen darstellte.3 Wie sich dieses Gesamtbild durch die Entdeckung des etwa 11,6 Mio. Jahre alten aufrecht gehenden ›Danuvius guggenmosi‹ im Allgäu im Jahre 2019 ändert, bleibt abzuwarten.
Historisch nicht mehr so weit entfernt von uns sind Werke, die Menschen geschaffen haben: Stelen etwa, deren älteste auf das Jahr 5000 v. Chr. zurückgehen, und Felsmalereien, die teilweise erst im 21. Jahrhundert am Horn von Afrika gefunden worden sind. Dabei handelt es sich nicht nur – wie andernorts vielfach –
Abb. 1: Lucy, Äthiopisches Nationalmuseum, Addis Abeba.
um Höhlenmalereien, sondern die Darstellungen finden sich teilweise auch unter freiem Himmel, unter Felsvorsprüngen, wo sie über die Jahrtausende geschützt waren und auch die damaligen Künstler und ihre Herden möglicherweise Schutz vor Sonne und Regen fanden. Diese frühen Kunstformen finden sich in allen Ländern am Horn von Afrika – in den heutigen Staaten Äthiopien (bis in den tiefen Süden), Eritrea, Dschibuti und Somalia, wo sich im Felsmassiv von Laas Geel bei Hargeysa die vielleicht besterhaltenen polychromen Felsmalereien Afrikas befinden. Teilweise sind sie fast 10 000 Jahre alt, damit aber deutlich jünger als die Malereien in den europäischen Höhlen wie z. B. in Lascaux und Altamira. Abgebildet werden vor allem Rinder und Schafe, aber auch Giraffen, Elefanten, Strausse und Kamele. Menschen werden ebenso dargestellt, bewaffnete Jäger und Krieger, auch eine Melk-Szene. Vergleichbare Höhlenmalereien befinden sich im somalischen Dhambalin und in Karin Heegan (70 km östlich von Boosaaso).
Abb. 2: Prähistorische Felsmalerei in Laas Geel, Somalia.
Das Land Punt und frühe Staaten am Horn von Afrika
Historisch signifikant sind die ägyptischen Beziehungen zur Region am Horn von Afrika, die seit dem ›alten Reich‹ (2700–2200 v. Chr.) bestehen. Das Land Punt4 am Horn von Afrika – auch hier sind die Anfänge in mythologischen Nebel gehüllt – wurde als Urheimat der altägyptischen Götter aufgefasst. Zwar gab es wahrscheinlich keinen Staat dieses Namens, kein regelrechtes ›Reich‹ Punt – aber ›Punt‹ war durchaus kein Phantasiegebilde. Lange war umstritten, wo dieses sagenhafte Land im Süden, mit dem Ägypten intensiven Handel getrieben hat, genau lag. Neuere Forschungen zeigen, dass es sich um die Küste des Roten Meeres zwischen dem Sudan und Somalia gehandelt haben muss, um Nordäthiopien und Eritrea und den Fluss Gasch; möglicherweise gehörte auch Südarabien, das ohnehin seit jeher eng mit der afrikanischen Seite des Roten Meeres verbunden war, zu Punt. Besonders ein Relief auf dem Totentempel von Königin Hatschepsut aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. gibt uns einen lebhaften Eindruck von Punt, seiner Flora und Fauna. Die Verbindung zwischen Ägypten und Punt verlief einerseits über den Landweg, durch das Land Kusch (Nubien) am Nil (heutiger Sudan), andererseits aber mehr und mehr über den Seeweg. Weihrauch und Gold waren wichtige Handelswaren auf diesem Weg, ebenso Elfenbein, Ebenholz, Straußenfedern und -eier sowie Leopardenfelle und Affen.
Punt ist auch heute noch ein in der Region sehr präsenter Begriff und in Somalia bis in die Gegenwart ein wichtiges Element des ideologischen Versuchs, eine lange Tradition und weit zurückreichende historische nationale Kontinuität zu konstruieren.
Auch Ophir gehört in diesen Kontext als Land, das bereits in der Bibel erwähnt wird, aber auch in weiteren schriftlichen Quellen aus dem alten Israel, das aus Ophir Gold bezog. Über die Lage von Ophir gibt es jedoch mehrere Thesen – von Sri Lanka über Indien und Simbabwe bis zur eritreischen Küste.
Die Küste des Roten Meeres und des Indischen Ozeans ermöglicht zahlreiche Kontakte und öffnet das Horn von Afrika äußeren Einflüssen. Spätestens seit dem frühen 1. Jahrtausend v. Chr. gibt es Verbindungen zum südlichen Arabien und seinen Kulturen. Auffallend sind die kulturellen Ähnlichkeiten zwischen der Tihama, der jemenitischen Küstenebene am Roten Meer, und der eritreischen Küste5 gegenüber, wie beispielsweise ein Vergleich der eritreischen Ona-Kultur6 (um Asmara) und der jemenitischen Sabr-Kultur verdeutlicht.
Südaraber sind schon früh am Horn präsent, der Einfluss ihrer Sprache und Schrift ist allgegenwärtig. Die ältesten Inschriften7 am Horn von Afrika sind sabäisch (also südarabisch). Auch ihre Religion – belegt durch Darstellungen der Sonnenscheibe und der Mondsichel (wenn deren Bedeutung auch inzwischen kontrovers diskutiert wird) – brachten Sabäer ans Westufer des Roten Meeres. Weit gespannte Handelsbeziehungen belegen auch Inschriften (z. B. indischen Ursprungs) bereits aus vorchristlicher Zeit auf der kleinen Insel Sokotra vor Kap Guardafui (heute zum Jemen gehörig, faktisch seit 2020 von südjemenitischen Rebellen kontrolliert) am Eingang zum Golf von Aden.
Wichtigster Hafen dieser Zeit am Horn von Afrika ist Adulis am Golf von Zula, etwa 40 km südlich vom heutigen Hafen Massawa in der Nähe des eritreischen Dorfes Foro. Adulis existierte bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. und wird aufgrund seiner Bedeutung für den internationalen Handel in zahlreichen antiken und mittelalterlichen Quellen genannt. Im 7. Jahrhundert v. Chr. wird es schon von Griechen und Phöniziern angelaufen und beginnt bereits, eine immer wichtiger werdende Rolle im interkontinentalen Handel zu spielen. Aber auch kleinere Häfen wie Opone, Mosylon oder Zayla (im heutigen Nordsomalia) gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Der erste regelrechte Staat am Horn von Afrika ist Da’amat,8 das im 8./7. Jahrhundert v. Chr. aufblüht. Es entfaltet sich in der Gegend der späteren Metropole Aksum in der nordäthiopischen Region Tigray, zwischen Mekele und Addigrat; also in dem Teil des Horns von Afrika, in dem Jahrhunderte später eine Großmacht, das Reich von Aksum, aufsteigen wird. Da’amat selbst ist jedoch von begrenzter Ausdehnung und existierte nur relativ kurze Zeit. Es war stark südarabisch geprägt. Die südarabischen Götter werden hier in Inschriften genannt und angebetet – noch immer eindrucksvoll ist der Tempel in Yeha, der Almaqah,9 dem höchsten Gott des sabäischen Pantheon, gewidmet ist. Wir haben nur wenige schriftliche Quellen (6 sabäische Inschriften mit einheimischen sprachlichen Einflüssen) aus diesem Staat. Die Hauptstadt Yeha bietet jedoch interessante handwerkliche Überreste und archäologische Zeugnisse.10 Spätestens um 400 v. Chr. bricht Da’amat vollständig zusammen, Ansätze zur Entstehung eines neuen Staates werden greifbar.
Christentum, Handel und Imperialismus zwischen Südarabien und Nil: Das Reich von Aksum
Mit dem Beginn unserer christlichen Zeitrechnung ist auch für das Horn von Afrika eine neue Epoche verbunden. Schriftliche Quellen werden häufiger, Münzen erscheinen und der Raum findet Anschluss an die internationalen Beziehungen dieser Zeit, nimmt Teil an globalen Entwicklungen. Der Aufstieg des Reiches von Aksum11 beginnt.
Der ›Periplus des eritreischen Meeres‹,12 ein Handbuch über das Rote Meer und den Indischen Ozean, dessen Verfasser unbekannt ist, das aber neben nautischen auch vielfältige ökonomische und historische Informationen enthält, entsteht in der Mitte des 1. Jahrhunderts AD und ist nur in einem Manuskript aus dem 10. Jahrhundert (Heidelberg) überliefert. In diesem Werk wird Aksum erstmals genannt. Auch in der Geographie des Ptolemäus (2. Jahrhundert) erscheint Aksum bereits. Aksum, südlich des Mereb-Flusses (heute Grenze zwischen Äthiopien und Eritrea) und südwestlich von Yeha, dem Zentrum von Da’amat gelegen, ist die Metropole, Ausgangs- und Mittelpunkt des Reiches, dem sie ihren Namen gab. Das erste Jahrtausend christlicher Zeitrechnung ist am Horn von Afrika eindeutig das aksumitische Jahrtausend. Aksum, seine Geschichte und sein kulturelles Profil haben dem Raum seine besondere Prägung und seine spezifische Orientierung auch für die darauffolgenden Jahrhunderte gegeben. Damals werden Weichen gestellt, nehmen Entwicklungen ihren Anfang, die für den gesamten ›orbis aethiopicus‹ nachhaltige Wirkungen entfalten. Noch heute sichtbare Symbole damaliger imperialer Größe sind Obelisken,13 darunter der größte der Welt mit 30 Metern Länge. Obelisken und Stelen gab es am Horn von Afrika schon lange vor Aksum, aber die aksumitischen Obelisken symbolisieren in besonderem Masse – etwa im heute noch eindrucksvollen Stelenpark von Aksum – den Großmachtanspruch. Es handelt sich dabei um Grabsteine, die uns in verschiedenen Grössen überall in der Region, z. B. in Matara in Eritrea, begegnen. Seit der Christianisierung jedoch spielen die Stelen keine Rolle mehr. Auch Paläste und Tempel weisen noch heute auf die einstige Bedeutung Aksums hin.
Einige steinerne Monumente helfen uns durch Inschriften, die Geschichte von Aksum nachzuvollziehen (Monumentum Adulitanum, Ezana-Steine – siehe unten). Wichtig sind auch die in Aksum geprägten Münzen,14 goldene, silberne und bronzene. Sie erlauben uns, eine Reihe von Königen vom 3. bis zum 7. Jahrhundert zu identifizieren. Nur zwei Könige und ihre Zeit sowie ihr historisches Umfeld kennen wir näher, da sie auch in anderen Quellen erwähnt werden: Ezana (4. Jahrhundert) und Kaleb (6. Jahrhundert). Bemerkenswert ist, dass die Münzen
Abb. 3: Stelen-Park von Aksum.
mehrsprachige Aufschriften trugen: Ge’ez, das Altäthiopische, und Griechisch; damit verdeutlichen sie den starken griechischen Kultureinfluss im Land.
In der aksumitischen Periode kommt erstmals die eigentliche Landessprache, Ge’ez,15 zum Tragen. Es handelt sich um eine eigenständige äthio-semitische Sprache,16 die zusammen mit Tigre und Tigrinya zur nordäthiopischen Gruppe gehört (im Gegensatz zur südäthiopischen, zu der u. a. – das später entstandene – Amharisch oder das im Osten des heutigen Staates Äthiopien verwendete Harari gehören). Der Aufstieg des Ge’ez ist mit dem Aufblühen des aksumitischen Reiches verbunden.
Jetzt erst erscheinen Ge’ez-Inschriften; alle früheren Inschriften,17 also auch die mit Bezug zu Da’amat, waren in sabäischer (altsüdarabischer) Sprache abgefasst. Die ältesten Ge’ez-Inschriften sind noch unvokalisiert, d. h., sie geben, wie es für semitische Sprachen18 und Schriften charakteristisch ist, nur die Konsonantenstruktur wieder.
Besonders charakteristisch für das Reich Aksum ist, dass es bald internationale Dimensionen gewinnt, eine aktive Außenpolitik führt und expandiert, aber auch Einflüsse von außen aufnimmt und assimiliert. Der Hafen von Adulis und das Rote Meer gewinnen an Bedeutung, Aksum wird Teil interkontinentaler Beziehungsgeflechte, findet Anschluss an die Weltgeschichte. Es ist die Rivalität um den Fernhandel, die dabei im Vordergrund steht. Das Römische Reich (später Byzanz) und Aksum sind daran interessiert, dass der Indien-Handel durch das Bab al-Mandeb, die Meerenge zwischen Rotem Meer und Indischem Ozean, und das Rote Meer verläuft und auf einer römisch-aksumitisch kontrollierten Route Ägypten und das Mittelmeer erreicht. Die Römer errichten deshalb, wohl im 2. Jahrhundert, einen militärischen Außenposten auf den Farasan-Inseln (nordöstlich von Massawa und den Dahlak-Inseln vor der Küste Arabiens bei Dschisan). Das Perserreich will diese Handelsströme ebenfalls kontrollieren und sie durch die Straße von Hormuz und den Persischen Golf leiten.
Aber auch die Waren Afrikas kommen über Aksum und Adulis auf die Weltmärkte, wie schon seit Jahrtausenden aus dem Land Punt.
Die Waren, die Aksum exportiert und die teilweise aus dem Inneren Afrikas kommen, sind Elfenbein, Sklaven und Gold, Nashörner, Nilpferdhäute, Schildkrötpanzer und Obsidian. Aber auch andere Häfen wie Malao (das heutige Berbera) und Opone (Ras Hafun), südlich von Kap Guardafui, an der Somaliküste sind als Sklavenhandelsplätze bekannt.
Eingeführt wurden Kleidung und gefertigte Güter wie Äxte, Speere und Schwerter, aber auch Schmuck, Trinkgefäße und Glaswaren aus Indien, Ägypten und dem Mittelmeerraum. Römische, ägyptische und später byzantinische Kaufleute kamen nach Adulis, um hier Waren aus Indien zu kaufen. Im Rhythmus der Monsunwinde, die deshalb bezeichnenderweise auch ›Handelswinde‹ genannt werden, segeln Schiffe von Adulis nach Indien19 und Ceylon und zurück. Indische Quellen erwähnen Perlen und Korallen aus dem Roten Meer. Zimt gelangt auf diesem Weg von Asien nach Ägypten und in den Mittelmeerraum. Die weitläufige Ausdehnung dieses Handels ist belegt durch Funde aksumitischer Münzen in Südarabien, Palästina und Indien, während indische Münzen am Horn von Afrika gefunden werden.20
Auf der vorgelagerten Insel Sokotra finden sich frühe Inschriften in verschiedenen Sprachen, u. a. auch von indischen Seefahrern. Adulis, das zur Zeit Christi Geburt noch weitgehend selbständig war, wird vollständig ins aksumitische System eingegliedert und eine der wichtigsten Städte des Reiches. Griechen und griechischsprachige Ägypter kommen zusehends ins Land, zunächst vor allem als Kaufleute. Sie bleiben nicht im Hafen Adulis oder in anderen Handelsstädten im Küstenbereich wie Qohaito, ein wichtiger Elfenbeinmarkt an der Straße zwischen Adulis und Aksum, oder Matara, eine blühende (eritreische) Stadt schon seit voraksumitischer Zeit, sondern gelangen bis Axum. Griechisch, lingua franca nun auch im Roten Meer, wird zur ›Bildungssprache‹ im Aksumitischen Reich. Griechische Inschriften charakterisieren die aksumitische Periode ebenso wie griechische Texte auf aksumitischen Münzen – z. B. ›Basileus Axomiton‹ (König von Aksum) – die sich hier neben Ge’ez-Texten finden. Zoskales wird im ›Periplus‹ als Herrscher von Aksum und der Küste im ersten christlichen Jahrhundert genannt, der über gute griechische Bildung verfügt habe.21
Es dürfte diesem lebhaften Handel zu verdanken sein, dass auch das Christentum schon früh in die Welt von Adulis und Aksum gelangte.
Eine entscheidende Epoche in der aksumitischen Geschichte war dabei die Regierungszeit von König Ezana22 in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts. In Ezanas Herrschaft fällt die Christianisierung von Aksum.23 Ein gewisser Frumentius24 († 383) aus Tyros, den wir vor allem aus der Kirchengeschichte des Rufus von Aquilea aus dem 5. Jahrhundert kennen, soll an der eritreischen Küste Schiffbruch erlitten haben und zusammen mit seinem Bruder nach Aksum an den königlichen Hof gebracht worden sein. König Ella Amida, Vater von Ezana, überträgt ihm Funktionen bei Hof und macht ihn schließlich zum Erzieher des Prinzen Ezana. Offenbar kann Frumentius beträchtlichen Einfluss nicht nur auf den Prinzen in seiner Jugend, sondern auch auf den späteren König Ezana gewinnen, denn dieser tritt zum Christentum über. Aksum25 wird zu einem der ersten christlichen Länder der Welt. In Aksum empfand man die Notwendigkeit, an die bereits christianisierte Welt angeschlossen zu werden und ein Kirchenoberhaupt zu erhalten, das von einer schon bestehenden kirchlichen Autorität bestellt und ermächtigt sein würde. Frumentius reiste nach Alexandria, an den Sitz des koptischen Patriarchen, informierte diesen, Athanasius I., über den Aufstieg des Christentums in Aksum und bat ihn um Entsendung eines Bischofs. Athanasius weiht Frumentius selbst zum Bischof und sendet ihn zurück nach Aksum, um dort im Namen der koptischen Kirche und mit kirchlichem Segen als Oberhaupt der neu enstehenden Kirche von Aksum zu fungieren. Damit war ein Präzedenzfall gesetzt, der eine 1600-jährige Praxis begründete. Von nun an wurde jedes neue Oberhaupt der aksumitischen, später äthiopischen, Kirche vom Patriarchen von Alexandria ernannt und aus Ägypten entsandt.26 Dennoch war die Kirche von Aksum und später die äthiopische Kirche nicht wirklich Teil der koptischen Kirche, sondern agierte weitgehend autonom. Das aus Ägypten entsandte Kirchenoberhaupt hatte weitgehend rituelle und zeremonielle Aufgaben und war kaum in die eigentliche ›Kirchenpolitik‹ involviert.
Abuna Selama Kesate Berhan, wie Frumentius in Aksum genannt wurde, wird als erster Bischof und Begründer der Kirche am Horn von Afrika bis heute als Heiliger verehrt (und gilt auch in der orthodoxen sowie in der katholischen Kirche als Heiliger).
Auffallend ist, wie sich der Übergang zum Christentum in Aksum in der Münzprägung ausdrückt. Die älteren Münzen aus der frühen Regierungszeit Ezanas sind noch in der traditionellen Weise (altsüdarabische Symbolik) gestaltet, während auf späteren Münzen das Kreuz erscheint – die Konversion zum Christentum erfolgte wohl um 340 AD. Christianisiert wurde Aksum ›von oben‹ – der König war der wichtigste Katalysator für die Verbreitung des Christentums. Ganz im Gegensatz zu Ägypten, wo sich das Christentum zunächst vor allem im einfachen Volk verbreitet hatte, weshalb es zu einer Blüte koptischer Sprache und Kultur gekommen war (die Konvertiten hatten keine ausreichenden Griechischkenntnisse, die vor allem in gehobenen Gesellschaftsschichten verbreitet waren).
Schon bald finden sich Spuren für eine weitere Verbreitung des Christentums am Horn von Afrika – Kreuze nicht nur auf Münzen, sondern auch auf Gebrauchsgegenständen und Gebäuden. In diese Jahre fällt auch eine weitere Neuerung in der Kultur von Aksum, die ebenfalls bis heute Auswirkungen hat: Die vom Südarabischen abgeleitete Schrift, in der Ge’ez, das klassische (Alt-)Äthiopische, geschrieben wurde, war zunächst eine reine Konsonantenschrift, weshalb wir nicht genau wissen, wie frühe Texte zu lesen sind. Denn wir haben nur ein unvokalisiertes Konsonantengerüst wie auch im heutigen Hebräischen oder Arabischen (wobei es für diese Sprachen aber Vokalzeichen gibt, durch die wir also über die Vokalisierung genau Bescheid wissen). Erst im 4. Jahrhundert, um die Zeit der Christianisierung (wohl kurz davor), erscheint Ge’ez in vokalisierter Form – vielleicht unter indischem Einfluss.27 Eine Art Silbenschrift entsteht, die später auch für andere semitische Sprachen am Horn von Afrika – z. B. Amharisch und Tigrinya – verwendet wird und bis heute die am weitesten verbreitete Schrift in diesem Raum ist. Die Nationalsprachen von Äthiopien und Eritrea werden heute noch immer in dieser Schrift geschrieben, der einzigen existierenden semitischen Silbenschrift.
Aksum ist im 4. Jahrhundert längst zur Großacht geworden. Mani, der Stifter der nach ihm benannten Religion des Manichäismus, führt Aksum bereits im 3. Jahrhundert als eine der führenden Mächte auf.28 Der Staat ist weit über seine Keimzelle, die Stadt Aksum in Tigray, hinausgewachsen, hat seinen Zugang zum Meer ausgebaut und expandiert sowohl über das Rote Meer nach Südarabien als auch ins Innere Afrikas. Er ist dabei, ein wichtiger Partner und Alliierter für Rom zunächst und dann für Byzanz zu werden, unterhält Handelsbeziehungen mit Indien und Ceylon. Inschriften auf Steinplatten weisen Ezana als König von Himyar und Saba, also als Oberherrn von südarabischen Staaten, aus.
Ende des 5./Anfang des 6. Jahrhunderts kommen, glaubt man der Überlieferung in der Hagiographie, ›Neun Heilige‹29 aus dem Nahen Osten ans Horn von Afrika. Es ist die legendenhafte Verkleidung des Vordringens christlich-orientalischen Mönchstums nach Aksum. Im Nahen Osten hatte sich vor allem im koptischen Ägypten, mit dem Aksum in Verbindung stand, ein sehr lebendiges Mönchstum entwickelt,30 dessen Ausbreitung nach Süden naheliegend ist. Auch im Christentum am Horn von Afrika verwurzelte sich das Mönchstum bald und wurde zu einem essenziellen, tragenden Element der Kirche. In den folgenden Jahrhunderten wurden zahllose Klöster gegründet, in denen sich ein reiches geistiges Leben entwickelte.
Schon früh unternimmt Aksum militärische Vorstöße über das Meer hinweg, die auf der Ost- und Westküste des Roten Meeres gleichermaßen dokumentiert sind. Lange vor Ezana haben sich Könige von Aksum in Südarabien engagiert, dort über wechselnde Allianzen mit verschiedenen – sabäischen und himyaritischen – Herrschern Einfluss ausgeübt und die Küstenebene am Roten Meer (Tihama) zumindest zeitweise kontrolliert.
Aksum ist für eine Zeit dominierende Macht in Südarabien und kann die Lokalmächte gegeneinander ausspielen. Im 3. Jahrhundert erschienen die Könige GDR (T) – vielleicht der erste aksumitische König, der in Südarabien interveniert, jedenfalls der erste, der in einer sabäischen Inschrift genannt wird – und GRMT als Protagonisten einer aktiven aksumitischen Arabien-Politik. Ob Aksum allerdings noch zu Ezanas Zeiten eine dominierende Rolle im Südwesten der Arabischen Halbinsel spielte, ist nicht eindeutig klar. Die Erwähnung südarabischer Staaten in Ezana-Inschriften mag üblicher Bestandteil der Standardtitulatur des Königs sein.
Dagegen war die Regierungszeit von König Ezana definitiv eine Epoche von Feldzügen zu Lande und territorialer Ausdehnung sowie der wirtschaftlichen Expansion. Bereits in den 60er-Jahren des 3. Jahrhunderts hat ein aksumitischer Feldzug gegen Meroe stattgefunden. Meroe,31 zwischen dem 5. und 6. Nilkatarakt etwa 180 km nördlich der heutigen sudanesischen Hauptstadt Khartum im historischen Nubien gelegen, ist seit 300 v. Chr. Hauptstadt des Reiches Kusch. Es ist Träger des Handels zwischen Innerafrika und Ägypten sowie der Mittelmeerwelt.32 Als Ezana Mitte des 4. Jahrhunderts dann seinen Feldzug gegen Meroe unternimmt, ist der Staat bereits im Niedergang begriffen, die Operation richtet sich wohl gegen die Ethnien der Kasu und Noba (Nubier), die die Stadt eingenommen haben. Aksum kann den innerafrikanischen Handel übernehmen und Meroe bzw. Kusch als wichtigen Handelspartner Roms im südlichen Niltal ablösen. Wichtigste Waren dieses Handels sind Ebenholz, Elfenbein, Weihrauch, Straußenfedern und -eier. Später übernahm dann auch hier das Christentum eine führende Rolle, seit 500 AD entstanden drei christliche nubische Reiche.
Wir dürfen aber nicht davon ausgehen, dass Aksum sich als ein ›Reich‹ bis an den Nil erstreckte und das Territorium von Kusch oder Nubien umfasste. Das ›Reichsgebiet‹ von Aksum müssen wir uns relativ beschränkt vorstellen. ›Aksum‹ ist immer zuallererst die Stadt Aksum, in der das Reich sein Zentrum hat und auf die alles fokussiert ist.
Aksum darf nicht gleichgesetzt werden mit dem Staatsgebiet des heutigen Staates ›Äthiopien‹ oder gar als ein Staat, der sowohl Äthiopien als auch Eritrea umfasste (oder gar Somalia, den Sudan etc.).
Die wirkliche Reichweite der ›Herrschaft‹ aksumitischer Herrscher – Institutionen und Verwaltung gab es nur ansatzweise und in eingeschränktem Sinn – war von sehr unterschiedlicher Dimension. Das ›Territorium‹ von Aksum war starken Schwankungen unterworfen, eine auch nur annähernd genaue Grenzziehung oder kartographische Erfassung ist so gut wie unmöglich.33 Auffallend ist: Der Reichsmittelpunkt liegt im Hochland (von Tigray), wie es schon bei Dama’at der Fall war – dennoch ist der Zugang zum Meer entscheidend, wenn auch Küstenregionen nur zeitweise zum Kernland gehören.
Ganz ähnlich wird die Entwicklung auch in den folgenden Jahrhunderten bis in die Gegenwart sein: Das größte Reich am Horn von Afrika, ob der Staat der Zagwe-Dynastie oder später das salomonische Reich (Kap. 2 und Kap. 3), ist zunehmend zum Landesinneren hin orientiert und verlegt seine Schwerpunkte mehr und mehr nach Süden, der Küstenstreifen erlangt immer wieder eine gewisse Autonomie oder Eigenexistenz, gefördert durch die verkehrsgünstige Lage am Roten Meer und geprägt von den äußeren (macht-)politischen Einflüssen, die hier zum Tragen kommen. Schon früh artikuliert sich eine Art ›eritreische‹ Individualexistenz.
Im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung gibt die Entwicklung in Südarabien neue Anstöße für eine aktive Politik im Roten Meer und starkes aksumitisches Engagement auf seiner Ostküste. In Südarabien hatte das Christentum Fuß fassen und zahlreiche Anhänger gewinnen können. Dies stärkte auch den aksumitischen und den byzantinischen Einfluss auf der arabischen Halbinsel und im Roten Meer. Dieser scheint jedoch im 6. Jahrhundert in Gefahr.
Um 520 kam es durch den zum Judentum konvertierten König Yusuf As’ar Yath’ar (arabische Quellen nennen ihn Dhu Nuwas) zu antichristlichen Maßnahmen (er brannte etwa die Kirche der himyaritischen Hauptstadt Zafar nieder) sowie zu relgelrechten Christenverfolgungen, die ihren Höhepunkt in Nadschran fanden, wo viele Christen starben,34 welche seither unter orientalischen Christen als Märtyrer verehrt werden. Eine wichtige syrisch-aramäische Quelle, das ›Buch der Himyariten‹, berichtet über diese Christenverfolgung, die von Inschriften und anderen Quellen bestätigt wird.35 Der aksumitische König Kaleb Ella Asbeha intervenierte auf Bitten des byzantinischen Kaisers Justin I. Dieser will sein Bündnissystem ausbauen,36 seine Position gegenüber Persien sichern und stellte seinem aksumitischen Verbündeten auch Schiffe für die Operation zur Verfügung.
Der König selbst steht an der Spitze des Feldzugs nach Arabien. Die Dominanz des Christentums sowie Aksums im Südwesten der arabischen Halbinsel wurde nach anfänglichen Schwierigkeiten wiederhergestellt. Dies bedeutet das Ende von Himyar – ein aksumitischer Regent wurde nun eingesetzt.37 Der letzte Versuch des himyaritischen Staates, seine Eigenständigkeit zurückzubekommen, ist definitiv gescheitert, die byzantinisch-aksumitische Kontrolle der Region scheint gesichert.
Abraha, ein Offizier aus Adulis, soll später die Macht übernommen haben, sich aber mit dem ›Mutterland‹ Aksum nach anfänglichen Auseinandersetzungen arrangiert und Tribut bezahlt haben. Es wird überliefert, er habe im ›Jahr des Elefanten‹ (benannt nach einem aksumitischen Kriegselefanten), in dem Muhammad, der Prophet des Islam geboren wurde, einen Feldzug gegen Mekka unternommen, das durch göttliche Intervention aber gerettet worden sei.
Dieser Feldzug hat wohl faktisch kurz vor oder kurz nach 550 stattgefunden, das Jahr der Prophetengeburt dürfte aber 570 (oder 573) gewesen sein. Entweder dieses Ereignis oder ein Hilferuf aus Himyar, jetzt aksumitische Provinz, führte dann zu einer militärischen Intervention des persischen Sassanidenreiches und damit endgültig zum Ende der aksumitischen Rolle in Südarabien. Persien griff die Gelegenheit für ein militärisches Einschreiten gern auf und konnte jetzt die Vorherrschaft im Indischen Ozean und im Roten Meer für einige Zeit übernehmen. Sogar in Berbera an der Somaliküste richteten die Perser eine Garnison ein, vielleicht ein erster Schritt zu energischeren Maßnahmen auch gegen Aksum?
Der Islam kommt ans Horn von Afrika
Eine neue, große Gefahr sowohl für Byzanz als auch für das Sassanidenreich, das bald sein Ende finden wird, kommt auf: Der Islam. Anfang des 7. Jahrhunderts AD trat in Mekka, einem Karawanenhandelsplatz auf der arabischen Halbinsel, ein Mann auf, der zur Rückkehr zur (Ur-)Religion des Abraham aufrief. Es ist die Geburtsstunde des Islam. Der ›Mahner‹ ist Muhammad,38 der Stifter der neuen Religion und das ›Siegel der Propheten‹, geboren um 570.
622 AD zog Muhammad nach anfänglichen Schwierigkeiten in seiner Vaterstadt mit seinen Anhängern in die Oase Yathrib, die damit zur ›Stadt (des Propheten)‹ wurde – Madina(t al-Nabi); dies ist der Beginn des islamischen Urstaates.39
In Mekka kannte man längst Menschen von der Westküste des Roten Meeres, viele waren durch den lebhaften Sklavenhandel ins Land gekommen: Muhammad, der Prophet, hatte schon früh Kontakt zu Afrikanern und ernennt einen ›Äthiopier‹, Bilal, zum ersten Muezzin des Islam.
Schon in den frühen Jahren des Islam, noch in der mekkanischen Zeit, kam es zu ersten Kontakten mit dem Horn von Afrika und den dortigen Christen. Als sich die frühislamische Gemeinde zunehmendem Druck seitens der ›Heiden‹ ausgesetzt sah, schickte Muhammad 615 AD in einer ›ersten Hidschra‹ eine Gruppe dieser frühen Muslime, zu denen auch der spätere Kalif Uthman sowie eine der Frauen des Propheten gehörten, ins aksumitische Reich, wo sie offenbar gut aufgenommen wurden. Möglicherweise aus Aksum kam eine Gruppe von Christen, die Muhammad um 620 in Mekka besuchte und von dem, was sie hörten, so beeindruckt gewesen sein soll, dass sie sich dem Propheten anschloss. Auch an den militärischen Auseinandersetzungen des frühislamischen Staates mit dem ›heidnischen‹ Mekka scheinen Menschen vom Horn von Afrika auf seiten des Propheten teilgenommen zu haben. So standen die ersten Kontakte des Islam mit den ›Habascha‹ unter einem günstigen Omen, das sich ausdrückt in dem Prophetenwort ›Lasst die Habascha in Ruhe, solange sie euch in Ruhe lassen‹.
Zu intensiven Auseinandersetzungen zwischen dem entstehenden islamischen Staat, der in den letzten Lebensjahren des Propheten praktisch schon die gesamte arabische Halbinsel umfasste, und dem christlichen Aksum kam es in der Tat nicht und die islamisch-arabische Expansion, die bald nach dem Tod des Propheten (632 AD) einsetzte, hatte eine andere Stossrichtung, konzentrierte sich auf das byzantinische und dass sassanidische Reich, richtete sich mehr nach Norden und nicht gegen das Horn von Afrika, das zunächst eher im Windschatten der islamischen Interessen lag. Dennoch war die Expansion des Islam und die Entstehung eines islamischen Imperiums auch mit mittelbaren und unmittelbaren Konsequenzen für das Horn von Afrika verbunden.
Durch den Siegeszug des Islam verändert sich die politische Landschaft im Nahen Osten und auch im Nordwesten des Indischen Ozeans grundlegend.40 Das sassanidische (Perser-)Reich ging 651 AD unter, das Byzantinische Reich verschwand völlig aus dem Roten Meer und verlor seine Positionen am Südufer des Mittelmeeres, wo sich überall die Herrschaft der Kalifen, später auch lokaler islamischer Machthaber und Dynastien, ausdehnte. Damit befand sich Aksum in einer völlig neuen Situation – die strategische und wirtschaftliche Allianz mit Byzanz, die den aksumitischen Handel im Indischen Ozean und im Roten Meer begünstigte, existiert nicht mehr. Byzanz war damals im Ostmittelmeer damit beschäftigt, sein Überleben zu sichern. Der Islam als die neue dynamische Macht, die bald zur Weltmacht wird, entwickelte sich zum beherrschenden Faktor und bildete eigene interkontinentale Handelsnetze. Das Christentum geriet in die Defensive, verlor im gesamten Mittelmeerraum an Terrain. Das Rote Meer wird zum ›islamischen See‹.
Nach einem Überfall auf Jiddah, der 70241 von der eritreischen Küste ausging (Piraten?), nahmen die Muslime die Dahlak-Inseln vor Massawa ein und hatten somit schon früh einen Vorposten am Horn von Afrika, der später ein unabhängiges Sultanat, zeitweise unter Einschluss von Massawa auf dem Festland, wurde. Unliebsame Personen und politische Gefangene sollen auf die Dahlak-Inseln verbracht worden sein, die aus Sicht der Kalifen in Damaskus oder (ab 750) Baghdad wohl weit genug entfernt von den Zentren der islamischen Welt und somit als Verbannungsort geeignet waren. Jedenfalls ist der Islam damit auch machtpolitisch am Horn von Afrika präsent, wenn auch eine regelrechte ›Eroberung‹ des christlichen Aksum nie versucht wurde. Der erste christlich Staat Afrikas wurde nicht, wie viele andere bereits christianisierte Länder des Nahen Ostens und der Mittelmeerwelt (bis hin zum Westgotenstaat auf der iberischen Halbinsel) von der arabisch-islamischen Eroberungswelle überrollt und hinweggefegt; sein Rückzug von der Küste mag ihn davor bewahrt haben oder auch die guten Beziehungen, die von Anfang an mit der islamischen Urgemeinde bestanden hatten.
Doch mit der islamischen Expansion des 7. und 8. Jahrhunderts begann auch der Abstieg von Aksum, das sich mehr und mehr ins Landesinnere zurückzog und den Fernhandel zunehmend den neuen Herren der Meere, den Muslimen, überlassen musste,42 die jetzt fast alle Küsten der Region kontrollierten. Handelsstraßen und -verbindungen sowie strategische Schnittstellen zwischen den Kontinenten (etwa die Übergänge zwischen Rotem Meer und Mittelmeer sowie dessen Südufer, das Zweistromland, der Persische Golf mit Hormuz und das Bab al-Mandeb43 am Südausgang des Roten Meeres) sind jetzt definitiv für Jahrhunderte in islamischer Hand.
Es gab jetzt untrügliche konkrete Anzeichen für den Niedergang von Aksum: Die Münzprägung wurde im 7. Jahrhundert eingestellt, ein sicheres Anzeichen dafür, dass Aksum nicht mehr so stark am Fernhandel beteiligt war aufgrund des Aufstiegs des Islam, denn Münzen wurden vorwiegend im Fernhandel verwendet. Auf lokaler und regionaler Ebene gab es Tauschhandel;44 verwendet wurden auch Ersatzwährungen wie Salz – die Salzbarren wurden ›Amole‹45 genannt – und Eisenstücke.
Aksum verlor seine Rolle als Reichshauptstadt – auch in den folgenden Jahrhunderten wird das christliche Reich, das dann entstand und das wir später ›Äthiopien‹ nennen, meist keine permanente ›Hauptstadt‹ mehr haben.
Im 7. oder 8. Jahrhundert ging auch die Bedeutung von Adulis zurück, der Aufstieg von Massawa, heute noch wichtigster Hafen an der eritreischen Küste, begann zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung des Islam. Ausdruck der Krise ist auch der starke Rückgang der Zahl von Inschriften in den letzten Jahrhunderten der aksumitischen Epoche.
Der endgültige Untergang Aksums liegt im Dunkel. Eine Herrscherin aus dem Süden namens Judith/Gudit oder Esato46 soll Aksum im 10. Jahrhundert angegriffen, zahlreiche Kirchen zerstört und den (letzten?) König von Aksum getötet haben. Immer wieder wurde behauptet, es habe sich um eine ›jüdische‹ Königin gehandelt – dies gehört jedoch ins Reich der Legende. Sicher ist, dass Aksum um das Jahr 1000 stark reduziert und geschwächt und nicht lange darauf völlig verschwunden war. Die spätaksumitische Phase ist gekennzeichnet von der Entstehung neuer Staaten im orbis aethiopicus. Das 10. Jahrhundert sieht den Aufstieg des Staates Damot suedlich des Abbay-Flusses und des Tana-Sees in Schewa, der Zentralregion des heutigen Staates Äthiopien, in der auch die aktuelle Hauptstadt Addis Abeba liegt. In welchem Zusammenhang die genannte Königin Judith und ihr Reich möglicherweise mit Damot standen, ist ungklärt; möglicherweise war sie eine Herrscherin des kuschitischen Damot-Staates, die der Hegemonie des semitischen Aksum ein Ende setzte. Damot blieb für längere Zeit der dominierende Staat auf der Hochebene von Schewa.
Nach und nach kamen zahlreiche Muslime ans Horn von Afrika, als Kaufleute oder als Religionsgelehrte, die den Islam verbreiteten und vorlebten. Die Anziehungskraft der neuen Religion ist vor allem da, wo das Christentum noch nicht verbreitet ist, groß. Nach und nach werden weite Regionen islamisiert, der Islam dringt bis in die Gebiete südlich des christlichen Reiches vor.47
Auch islamische48 Machtbereiche bildeten sich wahrscheinlich schon in der aksumitischen Endphase: Mogadischu (heute somalische Hauptstadt) wurde wohl seit dem 8. Jahrhundert von Muslimen besiedelt und war auch am Hof des Kalifen in Baghdad als Teil der islamischen Umma bekannt, wenn es seine Blüte auch erst im Hochmittelalter erleben wird.
Zayla wird ebenfalls in arabischen Quellen genannt, als Handelshafen hervorgehoben, aber als abhängig vom christlichen Äthiopien beschrieben; später allerdings wird es wesentliche Komponente einer islamischen Föderation. Möglicherweise schon Ende des 9. Jahrhunderts entstand ein islamischer Staat in Schewa (im Osten der heutigen gleichnamigen Region gelegen). Es ist ein Anzeichen für das dynamische Vordringen des Islam nach Süden, wenn auch die Quellenlage
Abb. 4: Mittelalterliche Moschee von Harar.
sehr dürftig und es ›verdächtig‹ ist, dass 896 sowohl als Gründungsjahr für das Sultanat Schewa als auch für das Emirat Harar genannt wird,49 das erst im Laufe späterer Jahrhunderte ins Licht der Geschichte treten wird. Im 11. Jahrhundert erst wird das Sultanat Schewa historisch deutlicher fassbar. Wohl ins 13. Jahrhundert fällt die Gründung der islamischen Stadt Harar, eines der ältesten und wichtigsten Zentren des Islam am Horn von Afrika, das später zum Mittelpunkt eines machtvollen Staates wurde, der große Teile auch der christlichen Regionen unterwerfen konnte, und dessen eindrucksvolle Architektur bis heute eine glanzvolle Geschichte dokumentiert.
Die Nadschahiden – eine abessinische Sklavendynastie in der jemenitischen Küstenebene
In der jemenitischen Küstenebene Tihama kam es im 11. Jahrhundert – also zur Zeit des Untergangs von Aksum oder kurz danach – zur Gründung eines Staates durch Sklaven vom Horn von Afrika. Sklaven wurden im Jemen wie in anderen islamischen (und nichtislamischen) Ländern nicht ausschließlich für ›niedere Dienste‹ eingesetzt, sondern oft auch als Soldaten oder in Regierungsämtern, wobei sie oft beachtliche Machtpositionen erlangen konnten – bekanntestes Beispiel hierfür ist wohl das Mamlukenreich, das 1250–1517 in Ägypten florierte.
Sklaven50 waren seit der Antike ein wichtiges ›Handelsgut‹ in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Horn von Afrika und seinen Handelspartnern. Besonders ›abessinische‹ Sklaven waren auf der arabischen Halbinsel seit langem präsent und beliebt. Die Hafentadt Zabid entwickelte sich in den ersten Jahrhunderten des Islam von einem Regionalzentrum der jemenitischen Küstenebene zu einer glänzenden Metropole, die eine führende Rolle hatte im Handelsnetz Mittelmeer/Nordostafrika/Indien/Südarabien. Es wurde zur wichtigen Zwischenstation für Mekka-Pilger, die aus Aden und vom Horn von Afrika zum geistlichen Zentrum des Islam, nach Mekka, unterwegs waren. Zabid war auch ein bedeutender Sammelplatz für Sklaven, die von Massawa51 über die Dahlak-Inseln von der afrikanischen Küste des Roten Meeres nach Arabien kamen. Einem von ihnen, einem freigelassenen Sklaven namens Nadschah, gelang es 1021, die Macht in Zabid zu ergreifen, dort einen regelrechten Staat52 und eine veritable Dynastie zu gründen, die weit über ein Jahrhundert Bestand hatte. Die ständigen internen Konflikte der im Jemen dominierenden Sulaihiden-Dynastie erlaubten es den (nach ihrem Stammvater benannten) Nadschahiden, ihre Selbständigkeit zu wahren und sich immer wieder zu behaupten. Wurde ihre Lage prekär, zogen sie sich kurzerhand vorübergehend auf die eritreischen Dahlak-Inseln zurück, die in sicherer Entfernung von der jemenitischen Küste lagen. Die christliche Herrschaft über zumindest einige der mehr als 120 Dahlak-Inseln war damals wohl längst vorüber, der islamische Einfluss hatte stark zugenommen und die Inseln spielten eine Rolle im Handel zwischen afrikanischer und arabischer Rotmeerküste, aber auch im Fernhandel; dabei gerieten sie wiederholt ins Visier jemenitischer Machthaber. Grabsteine auf den Dahlak-Inseln belegen, wie bunt gemischt die Bevölkerung dieser Inselgruppe im Mittelalter war.53 Die Nadschahiden vergaßen ihre Herkunft nicht – immer wieder rekrutierten sie am Horn von Afrika Söldner, die entscheidend waren bei der Aufrechterhaltung ihrer Kontrolle über das aufstrebende Wirtschafts- und Verkehrszentrum Zabid. Erst 1159 fand ihre Herrschaft dort ein Ende.
2 Lalibela – die Zagwe-Dynastie
Die wichtigste Entwicklung am Horn von Afrika jedoch nach dem Untergang des Reiches von Aksum stellte der Aufstieg der Agau, einer Ethnie aus der Region Lasta, am Tekkeze-Fluss1 südlich des aksumitischen Stammlandes dar, die bereits in aksumitischen Quellen genannt wurde. Die Agau werden als eine der ältesten Ethnien in dem Raum betrachtet, in dem dann semitische Einflüsse als katalysatorisch bei der Entstehung von Städten und Staaten wirkten. Die Agau selbst waren kulturell-sprachlich jedoch kuschitisch geprägt. Die Sprache der Agau bildet das Substrat der südsemitischen Sprachen Tigrinya und Amharisch. In spätaksumitischer Zeit wanderten Agau-Gruppen aus dem Süden ins Gebiet von Tigray und Eritrea. Bugna, eine Region in Lasta im Nordwesten von Wello, ihre Urheimat, bildete das Kernland des Widerstandes gegen das späte Aksum. Aus der Agau-Bevölkerung geht die Zagwe-Dynastie hervor, welche die staatlich-christliche Tradition von Aksum aufnimmt und über ein Jahrhundert lang fortführt.
Sie bildet die Brücke zwischen der aksumitischen ›antiken‹ Epoche und dem langen salomonischen Zeitalter, das vom Hochmittelalter (unserer europäischen Periodisierung) bis fast in die Gegenwart reicht.
Das Aufkommen der Zagwe-Dynastie um das Jahr 1140 beendet die ›dunkle‹ Periode seit der aksumitischen Endzeit, die vor dem Jahr 1000 einsetzte. Wir wissen wenig über diese ›Zwischenzeit‹; die Überlieferungen über einen aksumitischen General, der eine Königstochter heiratete, dann seinen Schwiegervater liquidierte und als Usurpator den Thron einnahm, gehören ins Reich der Legende und beabsichtigen wohl vor allem, eine nicht wirklich nachweisbare Kontinuität herzustellen. Erster Zagwe-Herrscher soll Tekle Haymanot gewesen sein – nicht zu verwechseln mit dem hochverehrten gleichnamigen Heiligen dieses Namens aus dem 13. Jahrhundert. Die Zagwe bilden weniger eine echte Dynastie mit strenger patrilinearer Erbfolge, sondern eher einen Familienclan, aus dem der Herrscher jeweils kam. Das Reich der Zagwe erstreckte sich von Akkele Guzay (heutiges Eritrea, an der Grenze zu Tigray) im Norden bis südlich des Beselo, eines Nebenflusses des ›blauen Nils‹ (Abbay) in Wello, im Süden. Relativ gering war im Vergleich die Ost-West-Ausdehnung des Reiches. Im Westen gehörten beispielsweise die Region Begemdir und der Tana-See schon nicht mehr zum Zagwe-Staat; der Tekkeze-Fluss bildete die Westgrenze. Im Osten reichte der Staat kaum bis an den Awash-Fluss; dort hatten sich islamische Staaten gebildet. So stellt sich das von den Zagwe beherrschte Reich als ein relativ schmales Nord-Süd-Band dar, das nur einen kleinen Teil der heutigen Staaten Äthiopien und Eritrea umfasste und dessen südlichster Punkt weit nördlich der heutigen äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba lag.