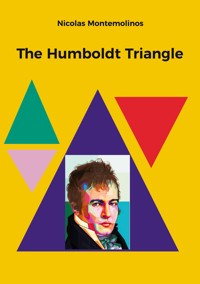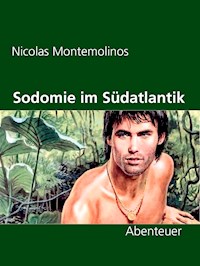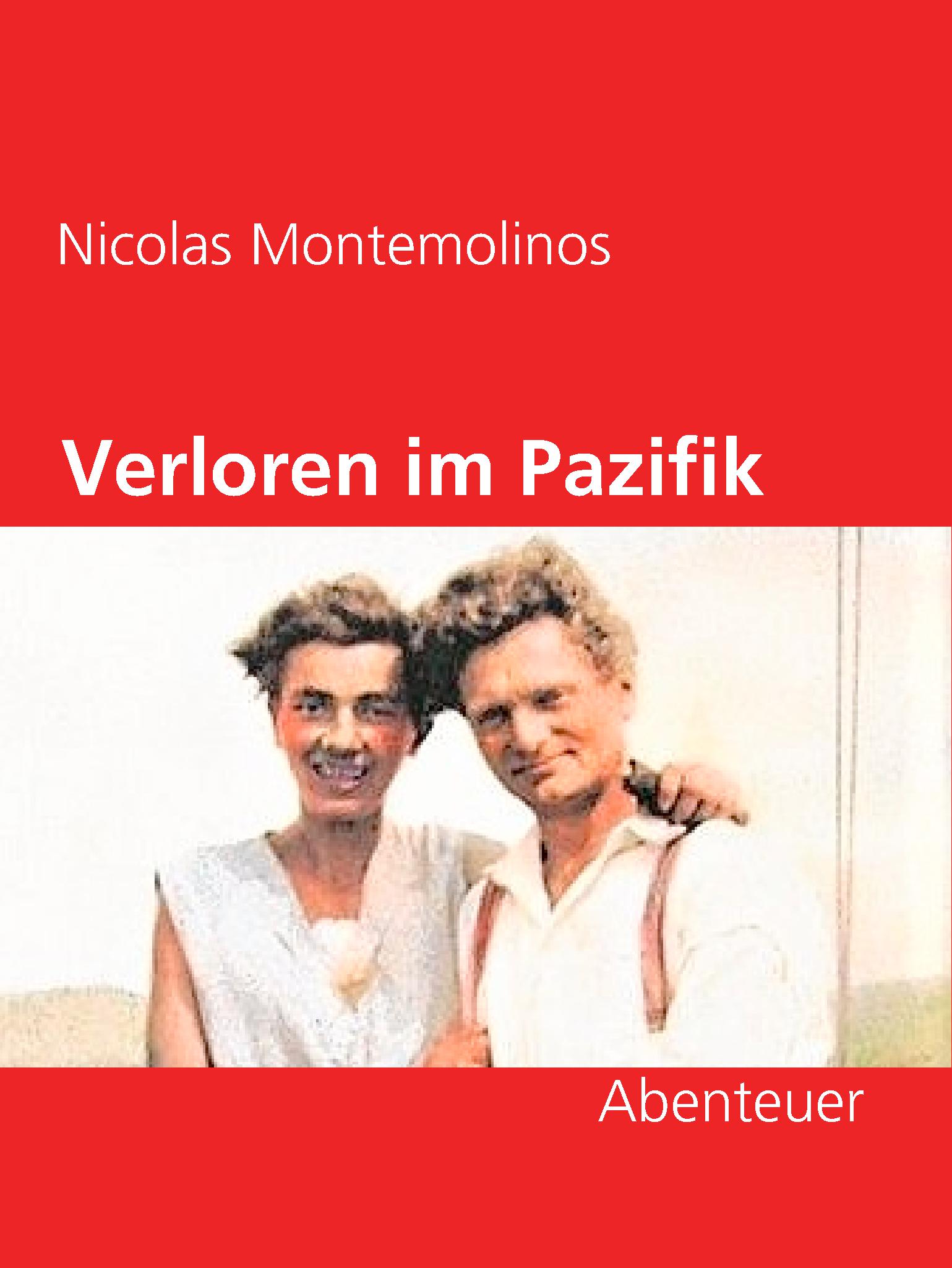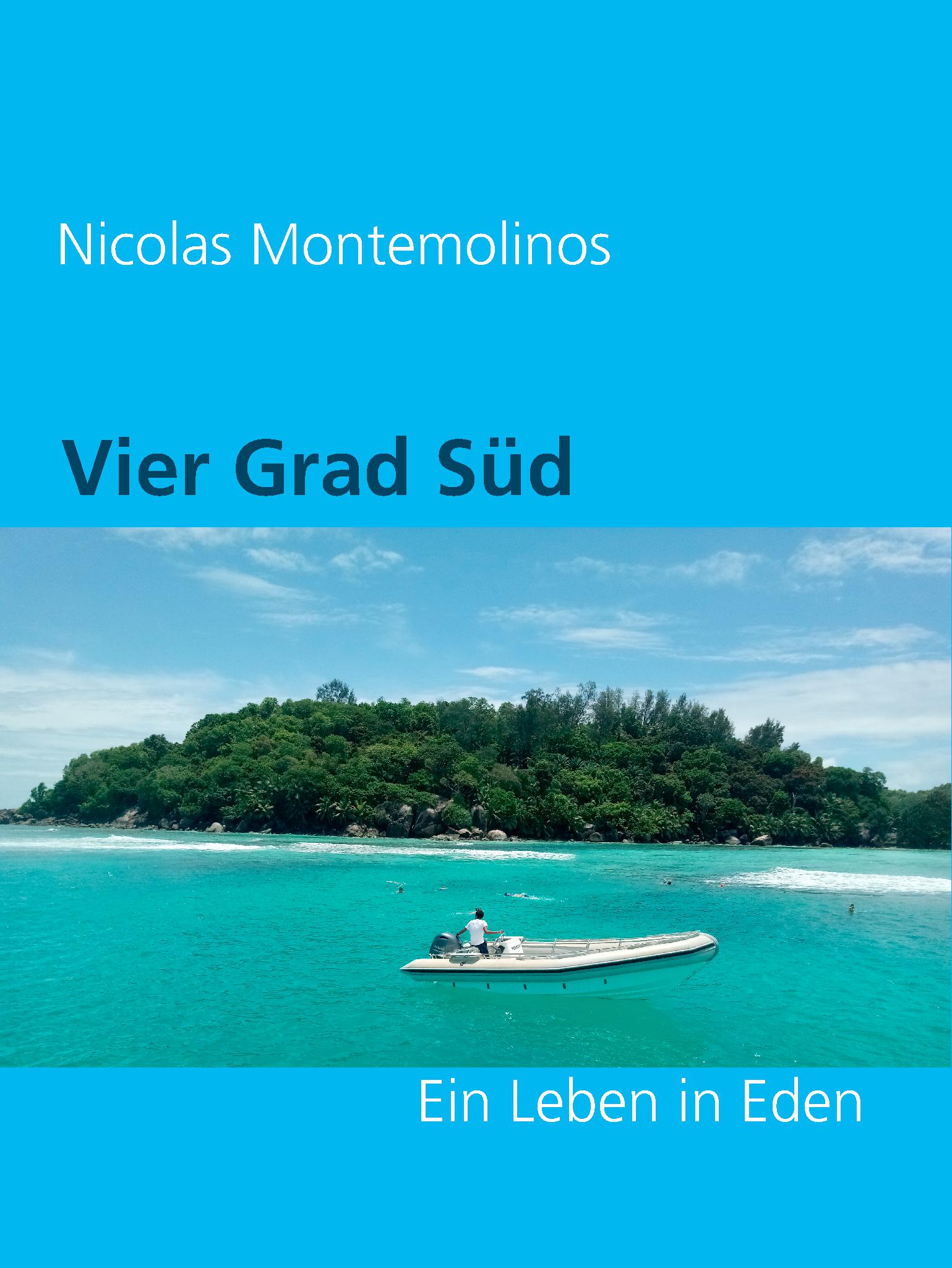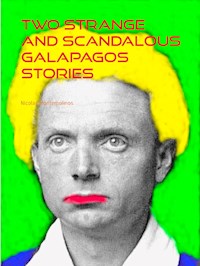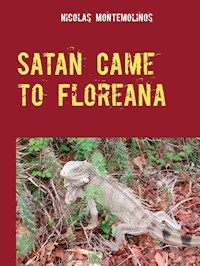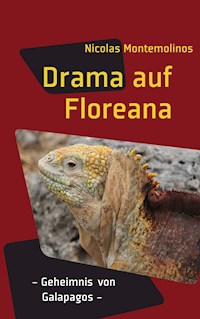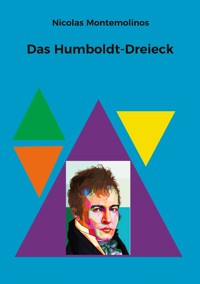
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2019 war Alexander von Humboldt in den Medien sehr präsent, denn es wurde sein 250. Geburtstag gefeiert. Fernsehsendungen, Zeitungen und neue Bücher berichteten euphorisch von einem Mann, der Übermenschliches geleistet hatte. Vom "Shakespeare der Wissenschaften", "deutschen Indiana Jones" oder gar einem "preußischen Kolumbus" war hier die Rede. Diese Glorifizierung und Heldenverehrung gerieten teilweise zu einem völlig überzogenen Heiligenkult. Aber Heilige, das wissen wir, sind nicht selten ausgedachte Fantasiewesen oder Scheinheilige. Bei aller Begeisterung über die Leistungen des großen Universalgelehrten sollte nicht vergessen werden, dass da über einen Menschen aus Fleisch und Blut geschrieben wird, einem Mann, der sicherlich vieles war, nur eben kein asexuelles, nur der Wissenschaft verschriebenes Neutrum. Es geht in diesem Buch unter anderem um die Fragen: Hatte er einen unehelichen Sohn? Führte er in Südamerika eine Dreiecksbeziehung? Oder war er in den fünf Jahren seiner Reise gar nicht sexuell aktiv? In der folgenden Erzählung wird nun erstmalig der Versuch unternommen, diese privaten Rätsel der Humboldt-Expedition zu entschlüsseln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwor
I Koka mit Kalkerde
II Carlos statt Rosa
IlII Im siebten Himmel
IV Chillen in Chillo
V Pyramidenreste
VI Toyboy
VII Thron des Mondes
VIII Humboldts Sohn
XI Doppelschlag
X Beim Schweinepriester
XI Berghochzeit
XII Chinarinde
XIII Gelüste
XIV Schlechtes Klima in Lima
XV Annus Horribilis
VORWORT
Im Jahr 2019 war Alexander von Humboldt in den Medien sehr präsent, denn es wurde sein 250. Geburtstag gefeiert. Fernsehsendungen, Zeitungen und neue Bücher berichteten euphorisch von einem Mann, der Übermenschliches geleistet hatte. Vom „Shakespeare der Wissenschaften“, „deutschen Indiana Jones“ oder gar einem „preußischen Kolumbus“ war hier die Rede. Diese Glorifizierung und Heldenverehrung gerieten teilweise zu einem völlig überzogenen Heiligenkult. Aber Heilige, das wissen wir, sind nicht selten ausgedachte Fantasiewesen oder Scheinheilige. Bei aller Begeisterung über die Leistungen des großen Universalgelehrten sollte nicht vergessen werden, dass da über einen Menschen aus Fleisch und Blut geschrieben wird, einem Mann, der sicherlich vieles war, nur eben kein asexuelles, nur der Wissenschaft verschriebenes Neutrum. Lieber Leser, fragen Sie sich bitte ehrlich selber: Sind Ihnen Neid, Eifersucht, Eitelkeit, Gier, sexuelles Verlangen, Verliebtheit oder Übermut völlig fremd? Nein? Warum sollten solche Gefühle dann für Humboldt nicht infrage kommen? Weil es die sogenannten „Quellen“ sachlich nicht hergeben, weil es „wissenschaftlich“ nicht bewiesen werden kann? Es hilft nicht weiter, aus Humboldt lediglich ein Sachthema zu machen, welches man anhand von Quellen, Tagebüchern und alten Manuskripten studiert. Denn steht dort alles drin oder fehlt da etwas? Etwas Entscheidendes? Manchmal hilft es, einfach nur den gesunden Menschenverstand zu bemühen und eins und eins zusammenzuzählen. Natürlich war niemand von uns bei seiner Reise dabei, aber mit etwas imaginärer Kraft, Intuition und Gespür lässt sich sein amerikanisches Abenteuer sehr viel persönlicher und realistischer nachzeichnen, als dies bisher geschehen ist. Selbstverständlich ohne Gewähr, aber wer hundertprozentige Sicherheit benötigt, sollte besser nicht vor die Türe gehen und sich erst recht nicht diese Lektüre zu Gemüte führen. Es geht in diesem Buch unter anderem um die Fragen: Hatte er einen unehelichen Sohn? Führte er in Südamerika eine Dreiecksbeziehung? Oder war er in den fünf Jahren seiner Reise gar nicht sexuell aktiv? In der folgenden Erzählung wird nun erstmalig der Versuch unternommen, diese privaten Rätsel der Humboldt-Expedition zu entschlüsseln.
I KOKA MIT KALKERDE
Wir beginnen unsere Erzählung am Neujahrstag im Jahr 1802, einem ganz besonderen Jahr für den damals in der Blüte seines Lebens stehenden 32-jährigen Alexander von Humboldt. Es sollte das Jahr werden, an dem ihn Amors Pfeil traf wie nie zuvor in seinem irdischen Dasein und er zum ersten Mal von einem Tsunami der Sinnlichkeit überrollt werden würde, wie er es selbst nicht für möglich gehalten hätte. Doch dazu später mehr. An diesem ersten Tag seines Schicksaljahres bewegte sich Humboldts Tross, bestehend aus ihm selber, seinem Reisebegleiter, dem vier Jahre jüngeren französischen Botaniker und Arzt Aimé Bonpland, sowie seinem Diener José Gonzales, den anderen einheimischen Helfern und diversen Maultieren, Pferden und Ochsen, langsam in Richtung der Stadt Ibarra. Schon seit fast zweieinhalb Jahren bereiste er nun schon das spanische Vizekönigreich Neu-Granada, welches der politische Vorgänger der heutigen Staaten Panama, Kolumbien, Venezuela und Ecuador war. Am ersten Januar überschritten sie die heutige Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador im Andenhochland und näherten sich somit unweigerlich dem Äquator, welcher sich dem Deutschen jedoch in dieser Höhenlage eher kühl präsentierte. Humboldt fröstelte zwar hier auf der alten Heerstraße, war aber trotzdem gut gelaunt. Nach einem über zwei Monate andauernden Aufenthalt in Bogotá, dem Verwaltungssitz von Neu-Granada, war er jetzt froh, Neues zu sehen und den gesellschaftlichen Verpflichtungen, die er so hasste, vorerst entkommen zu sein. Von der Stadt Bogotá war der deutsche Forschungsreisende wenig angetan: eine windige, heruntergekommene Kommune auf dem andinen Hochplateau in 2600 Metern Höhe mit verfallenden Bauten und einer korrupten Oberschicht. Jedoch wohnte hier der 70-jährige Priester und Gelehrte José Celestino Mutis, die allseits anerkannte naturwissenschaftliche Koryphäe Neu-Granadas, die Humboldt zwecks wissenschaftlichem Austausches unbedingt treffen wollte.
Humboldt hatte vor dem Zusammentreffen mit dem berühmten südamerikanischen Weisen etwas „Bammel“, denn dieser galt als extrem schwierig und verschlossen. Aber es erwies sich, dass solche Befürchtungen unbegründet waren. Mutis zeigte sich hocherfreut über den Besuch aus Europa, brachte ihm dieser doch hohes Ansehen bei der lokalen Prominenz, und im Sinne der Wissenschaft teilte er mit dem Deutschen und dem Franzosen all sein in fast vierzig Jahren erlangtes Wissen über die lokale Botanik und Geografie. Auch gewährte er ihnen uneingeschränkten Zugang zu seiner riesigen Bibliothek, was sich für Humboldt als ein wahrer Glücksfall herausstellte, konnte er doch so seine bisher in Südamerika gewonnenen Erkenntnisse verifizieren, abrunden und neue Erkenntnisse „aufsaugen“. Sein Spanisch war mittlerweile recht gut geworden, die teilweise abenteuerlichen Dialekte in der Neuen Welt bereiteten ihm, im Gegensatz zu Bonpland, immer weniger Schwierigkeiten. Der wissenschaftliche Austausch mit dem von Humboldt unbestritten als Autorität anerkannten Mutis brachte Humboldt extremen Nutzen, der von Mutis als unabdingbar angesehene gesellschaftliche Umgang mit der hiesigen Oberschicht nervte den Preußen allerdings sehr. Humboldt empfand die ganzen Feste, Partys und Salons als pure Zeitverschwendung. Immer musste er sich dann mit seiner mitgeschleppten preußischen Hofuniform verkleiden, um eine gute Figur zu machen. Aber er wusste, dass ihm die Wahrnehmung solcher Pflichten in dem Ausländern in der Regel verschlossenen und unzugänglichen Neu-Granada Türen öffnete, die ihm sonst verschlossen blieben. Also handelte er nach der Devise „Augen zu und durch“. Humboldt und Bonpland brauchten die Empfehlungsschreiben, die Geld- und Sachspenden sowie die Kontakte der oberen Zehntausend, um effizient und kostengünstig voranzukommen. Zwar hatte der preußische Adlige von seiner Mutter ca. 100 000 Thaler geerbt, was ungefähr nach heutigem Wert 5 Millionen Euro entsprach, aber selbst diese Summe war endlich. Deshalb betrachtete er die Empfänge immer auch unter dem Gesichtspunkt der eigenen Vermarktung und des Fundraisings für seine Forschungsreise. Sie waren ein unvermeidliches, notwendiges Übel. Sozusagen eine Prostitution für die Wissenschaft. Besonders unangenehm empfand es der Junggeselle Humboldt, wenn ihm die heiratsfähigen, unverheirateten Töchter der lokalen High Society vorgestellt wurden, mit denen er sodann galanten Smalltalk führen musste, um sich alsbald gekonnt zu verabschieden, ohne jemanden allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Im Gegensatz zu Bonpland, der sich im Verlaufe der bisherigen Reise keinesfalls als Kostverächter des weiblichen Geschlechts herausgestellt hatte, empfand Humboldt nichts dergleichen für diese in rosa, weißen und gelben Roben gehüllten, engelsgleichen Geschöpfe. Im Gegenteil, Schminke und Spitze trieben ihn regelmäßig in die Flucht.
Aber all das lag ja nun erst einmal hinter ihm. Er konnte aufatmen und die frische Luft genießen, die von den umliegenden Andengipfeln ins Tal wehte. Alexander von Humboldt fühlte sich gesund und klar im Kopf. Im Gegensatz zu Bonpland, der wieder einmal vor sich hin kränkelte und von irgendeinem Fieber geschwächt war, seit sie auf dem Río Magdalena gefahren waren. Der Preuße freute sich insgeheim über seine gute Gesundheit gegenüber dem jüngeren Bonpland, hatte aber einen Verdacht, den er für sich behielt. Humboldt mutmaßte, dass sich Bonpland bei seinen wiederholten Weibergeschichten mit indigenen Frauen oder Mestizinnen womöglich einen Wurm oder etwas in der Art eingefangen hatte. Bonpland war in Humboldts Augen ein guter Mensch und ein treuer Freund und Reisebegleiter. Aber mit Ende zwanzig auch oft Geisel seiner Triebe, d. h., er konnte und wollte nicht auf Sexualität verzichten. Dabei waren seine Ausrichtung und seine Vorlieben so flexibel wie Eisenbahnschienen. Der Franzose begehrte ausschließlich kleine exotische Frauen mit hängenden Brüsten und schwarzen Haaren. Humboldt gruselte sich bei dem Gedanken, wen seine „gute Pflanze“ (das bedeutete der Kunstname des Franzosen) seit ihrer Ankunft in Cumana schon überall bestäubt hatte, und war überzeugt, dass zahlreiche seiner Samen inzwischen bereits aufgegangen waren. Dabei wunderte sich der Deutsche, wie einfach es der Franzose bei seinen Kontaktaufnahmen mit den Weibsbildern hatte. In seinen Augen war Bonpland nicht wirklich hässlich, aber auch auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise attraktiv. Seine schwarzen Haare glänzten fettig, sein Gesicht wirkte knollig wie von einem Bauern und er war nur minimal größer als Humboldt selber. Aber damit wirkte sein Begleiter der einheimischen Bevölkerung ähnlicher als er selbst mit seinem Blondschopf, und verglichen mit den hiesigen Männern ragte selbst Bonpland fast immer um eine Kopfeslänge aus dem Durchschnitt heraus. Ein Mann also, der für die Indianerinnen und Mestizinnen ein attraktives Angebot darstellte, für Humboldt aber völlig uninteressant war und blieb. Geld war wohl keines im Spiel, denn der Franzose besaß keines und der Preuße verwaltete die Kasse. Jedenfalls war Bonpland befriedigt und krank und Humboldt unbefriedigt und gesund. Einen Zustand, den Humboldt in den letzten 2 Monaten bei Mutis durch fieberhaftes Arbeiten hatte verdrängen können, doch jetzt meldete sich sein kleiner Freund zwischen den Beinen wieder verstärkt. Am Morgen, tagsüber und auch nachts plagten den Forscher dauerhafte Erektionen, die selbst durch verstärktes Masturbieren nicht in den Griff zu bekommen waren. Das Schaukeln auf dem Pferderücken verstärkte das Phänomen nur noch, und Humboldt musste sich eingestehen, dass er ziemlich notgeil war, es ihm aber an Gelegenheiten zum Druckabbau mangelte. Bonpland war klar im Vorteil. Um sein körperliches Verlangen etwas zu stillen, kaute er bisweilen kleine Mengen an Koka-Blättern, die er mit Kalkerde vermischte. Das wurde im Mund zu einer Art von Kaugummi und stellte etwas ruhig. Gedanken an Sex verflüchtigten sich, die Konzentration kam wieder zurück.
Alexander von Humboldt freute sich auf das bevorstehende Treffen mit Francisco José de Caldas in Ibarra, einem ungefähr gleichaltrigen Autodidakten in Sachen Astronomie und Biogeografie, der aus Popayán stammte. Der ehrenwerte Mutis hatte den Kontakt vermittelt und bestand auf einem Treffen mit diesem einfachen Mann, ohne Titel und ohne Besitz. Und Humboldt konnte Mutis diese Bitte auch nicht abschlagen, hatte der doch die weitere Expedition mit Geld, Lasttieren und Vorräten versorgt sowie fast alle Fundstücke aus der bisherigen Reise via Bogotá nach Madrid verschiffen lassen. Auf verschiedenen Schiffen, in der Hoffnung, dass zumindest ein Teil der Sammlung die spanische Hauptstadt erreichen würde. Der Preuße hätte Caldas aber vermutlich auch ohne den Druck von Mutis aufgesucht, war Humboldt doch sehr daran interessiert, das Wissen von lokalen Forschern abzugreifen und in Europa zu vermarkten. Er hatte ja auf Reisen selber gar nicht die zeitliche Möglichkeit, längere und gründliche Forschungen bzw. Messungen an ein und demselben Ort durchzuführen, wie es die Einheimischen konnten.
In Popayán hatte die Reisegruppe das Wohnhaus von Caldas aufgesucht, ihn aber leider nicht angetroffen. Man sagte Humboldt dort, Caldas würde wegen der unabdingbaren Teilnahme an einem Gerichtsprozess in Quito weilen. Das schäbige kleine Haus von Caldas, wohl sein Geburtshaus, lag zwei Blöcke vom Marktplatz entfernt und lud die Reisegruppe nicht wirklich zum Verweilen ein. Über Brieftauben erreichten sie Caldas in Quito und machten aus, dass er ihnen die halbe Strecke zwischen Quito und Popayán entgegenritt und dass man sich in Ibarra treffen würde. Popayán selber war ein schläfriges, feuchtes Loch im Pubenza-Tal mit nur 7000 Einwohnern, umgeben von Goldminen. Es regnete andauernd und Humboldts Tross blieb mehrfach im Schlamm stecken. Wie froh waren die Forscher, am 02. Januar 1802 gegen Mittag in Ibarra anzukommen, welches einen wesentlich freundlicheren Eindruck machte und mit besserem Wetter aufwartete! Humboldt hatte bereits vor dem Treffen mit Francisco de Caldas eine hohe Meinung von ihm, war er doch von Mutis ordentlich gebrieft worden. In seinem Tagebuch schrieb er am 15. November 1801: „Geradezu ein Wunder in der Astronomie arbeitet er hier im Dunkeln einer abgelegenen Stadt seit Jahren. Bis vor kurzem hat er von dieser ultima Thule kaum weitere Reisen als nach Bogotá unternommen. Sich selber hat er die Instrumente für Messungen und Beobachtungen hergestellt. Jetzt zieht er Meridiane, jetzt misst er Breiten! Was würde solch ein Mann in einem Lande leisten, wo mehr Unterstützung ihm zuteil würde!“ Nach dem Besuch von Popayán, an diesem „Arsch der Welt“, wie man es heute postulieren würde, fand Humboldt die Leistungen von Caldas umso erstaunlicher.
Aber auch der junge Criollo Caldas fieberte der Zusammenkunft mit dem deutsch-französischen Forscherpaar voller Freude entgegen. Criollos, so nannte man in Neu-Granada etwas abschätzig alle außerhalb von Spanien geborenen Europäer. Mutis war dagegen in Cádiz, Spanien, geboren worden und somit kein Criollo. Caldas hatte begriffen, dass das Treffen mit dem deutschen Baron vermutlich die wohl einzige Möglichkeit in seinem Leben sein würde, sich mit einer berühmten Persönlichkeit zu verbinden, seinen eigenen Status dadurch zu erhöhen und durch ihn auch an viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden zu gelangen. Caldas, der in Bogotá eher widerwillig Jura studiert hatte und nur durch die Unterstützung reicher Mäzene aus Cartagena und Bogotá überhaupt forschen konnte, hatte für Humboldt und Bonpland eine Unterkunft beim hiesigen Verwaltungschef von Ibarra, dem Corregidor José Antonio Parco, organisiert. Humboldt war sehr angetan von dieser Bleibe und der Freundlichkeit seiner Gastgeber, und als ihm dann noch ein schmackhafter Eintopf aus Kartoffeln, Bohnen und Mais serviert wurde, schien es ihm, als wäre er für einen kurzen Augenblick wieder in seinem geliebten Paris, in der besten aller Welten. Um 15 Uhr traf endlich Caldas ein. Sie waren offensichtlich so ziemlich auf einer Wellenlänge, denn sofort entspann sich ein äußerst fruchtbarer Dialog über die Anden, ihre Geografie, die Pflanzen, die Vulkane und das Klima. Humboldt war ziemlich beeindruckt vom Wissen Caldas und sehr zufrieden, dass ihm Mutis diesen jungen Wissenschaftler empfohlen hatte. Das erste Zusammentreffen mit diesem völlig Fremden hätte nicht besser verlaufen können. Sofort bestand eine Verbindung, sofort empfand der Baron Wertschätzung für sein Gegenüber und augenblicklich auch eine gewisse Sympathie.