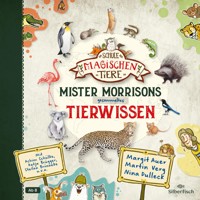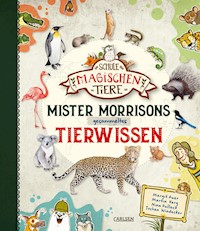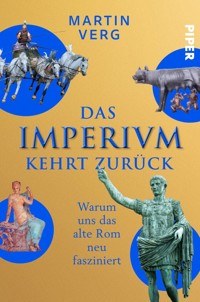
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer hat's erfunden? Auch nach seinem Untergang vor 1500 Jahren scheint das antike Rom hat nichts von seiner Faszination verloren zu haben. Ganz im Gegenteil: Es ist Zentrum eines neuen Hypes. In Serien und Kinofilmen ersteht es gerade wieder auf und der Instagram-Hashtag #RomanEmpire bringt es auf mehr als 1,3 Milliarden Beiträge. Woher aber kommt das ungebremste Interesse an dem versunkenen Imperium? Der Historiker Martin Verg geht dieser Frage nach und unterhält uns mit erstaunlichen Fakten, spannenden Geschichten und kuriosen historischen Randnotizen rund um das lebendige Erbe unserer römischen Vorfahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: akg-images, akg-images / Mondadori Portfolio / Sergio Anelli, ColsTravel / Alamy Stock Foto und AndreaAstes / iStock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
INTRODUCTIO
CAPUT I – I WANT YOU FOR ROMAN ARMY
CAPUT II – DIE MINUSKELN SPIELEN LASSEN
CAPUT III – ETWAS BROT UND GANZ VIEL SPIELE
CAPUT IV – KLASSISCHE BILDUNG(SUNGERECHTIGKEIT)
CAPUT V – DIE SCHLAGADERN DES IMPERIUMS
CAPUT VI – HOSENTRÄGER AUF DEM FORUM
CAPUT VII – EINE FÜR ALLE
CAPUT VIII – HALLO, HERR KAISER
CAPUT IX – HABE NUN, ACH …!
CAPUT X – DREI LEGIONEN FÜR EIN HALLELUJA
CAPUT XI – SCHALTEN UND WALTEN
CAPUT XII – SIND WIR NICHT ALLE EIN BISSCHEN SPARTACUS?
CAPUT XIII – ZWISCHEN FAST FOOD UND FESTGELAGEN
CAPUT XIV – VULKANASCHE SCHLÄGT STAHLARMIERUNG
CAPUT XV – BÖSE MÄDCHEN KOMMEN … BIS AUF DEN KAISERTHRON
CAPUT XVI – CHECKS AND BALANCES AUF DER EHRENRUNDE
CAPUT XVII – KÖRPER FRISCH, DER GEIST GEPFLEGT
CAPUT XVIII – ÜBERDEHNT TUT SELTEN GUT
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Motto
History doesn’t repeat itself, but it rhymes.
(Soll Mark Twain gesagt haben. Stimmt nicht. Ist trotzdem gut.)
INTRODUCTIO
Jerusalem, mutmaßlich einige Jahre n. Chr. Eine Gruppe von Widerständlern gegen die römische Fremdherrschaft muss sich mal wieder der Rechtmäßigkeit ihrer Taten selbstvergewissern: »Mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan?« Triumphierend blickt der Anführer des Haufens, gespielt von John Cleese, in die Runde. Es ist die vielleicht ikonischste Szene aus dem an ikonischen Szenen nicht eben armen Film »Das Leben des Brian« der britischen Komikertruppe Monty Python von 1979.
Ich habe »Das Leben des Brian« erst viele Jahre später als Teenager gesehen. Da war ich schon auf halbem Weg zum großen Latinum. Notenmäßig mittelerfolgreich, irgendwie gab es immer interessantere Dinge zu tun, als Deklinationen rauf und runter zu üben (und dann war ich am Ende auch noch der Einzige, der in der Abiturklausur nicht mitbekam, dass eine Vergil-Übersetzung auf der Schultoilette lag). Latein war nie mein Lieblingsfach, Julius Cäsar Satz für Satz holprig und unendlich langsam auf seinem Feldzug durch Gallien zu begleiten? Fand ich vor allem anstrengend.
Meiner Faszination für das antike Rom konnte das trotzdem keinen Abbruch tun. Als ein Trend auf TikTok vor einiger Zeit zutage brachte, dass Männer quasi täglich ans alte Rom denken würden, hat mich das nicht sonderlich überrascht. Auch wenn ich es bei mir selbst nie überprüft hatte: Es erschien mir komplett plausibel. Jedenfalls bis zu dem Punkt, wo ich dieser Behauptung in meinem eigenen Umfeld nachgehen wollte – und vor allem Erstaunen erntete: Das alte Rom? Ich? Sicher nicht!
Ich glaube aber: doch! Das alte Rom, das ist eben nicht nur Cäsar, das sind nicht nur Feldherren und -züge, nicht nur die offensichtlichen Überreste einer Jahrhunderte währenden Hochkultur: Aquädukte, Tempel, Amphitheater und so, das ist nicht nur eine vermeintlich tote Sprache, die nur noch ein paar Hartgesottene an humanistischen Gymnasien pauken. Rom hat uns – zumindest hier in Europa – viel tiefer durchdrungen, als es selbst John Cleese’ Untergrundkämpfer ahnt. Vom Kalender bis zur Kulinarik, von der Verführungskraft der Massenunterhaltung bis zu unserer Vorstellung von Recht und Gesetz, die maßgeblich in Rom formuliert wurde, von den fast zwanzig Prozent, die der deutsche Wortschatz aus Latein besteht, bis zu den Legionen, die als erste Berufsarmee der Erde nach Strategien operierten, die teils bis heute gelehrt und angewendet werden.
Apropos Legionen: In seiner Aggressivität, seinem unbändigen Expansionsdrang sollte uns Rom vielleicht nicht als Vorbild dienen (auch wenn es das bei manchen zu tun scheint). Aber wo es herrschte, brachte es eben oftmals auch bis dahin ungekannten Fortschritt. Und »den Frieden«, wie ein Mitstreiter in der Filmszene John Cleeses’ Aufzählung komplettiert – sehr zu dessen Unmut: »Ach, Frieden? Halt die Klappe!« Dabei stimmt es: Die pax romana bescherte dem Imperium fast zweihundert Jahre weitgehende Ruhe. Ob wir das in Europa noch einmal schaffen?
Die achtzehn Kapitel dieses Buches sind keine Geschichte Roms. Sie behandeln jeweils Aspekte daraus, die sich auf die eine oder andere Weise, mal ganz direkt, mal eher mittelbar auf uns und unsere heutige Welt auswirken. Dabei ist es nicht immer einfach, Fakt und Fiktion zu trennen. Was wir von Roms mehr als tausendjähriger Geschichte wissen (bis zum Fall Konstantinopels und damit dem Ende Ostroms, sind es sogar zweitausend Jahre), fußt vielfach auf einer eher dünnen Quellenlage. Es sind einzelne Autoren, die oft erst Jahrzehnte nach den Ereignissen darüber schreiben. Autoren, die selten frei sind von einer eigenen Agenda (wie neutral berichtet Tacitus wohl in seiner Agricola über den gleichnamigen Statthalter Britanniens, der zugleich sein Schwiegervater ist?). Und die auch, sagen wir mal, einen eher engen Fokus haben. Kaiserviten? Kein Problem, liegen sogar mehrfach vor. Was derweil die einfachen Leute trieben, was sie umtrieb? Das bekommen wir häufig bestenfalls am Rand mit. Es gibt kein lateinisches Wort für Alltagsgeschichte. Die kann man dann oft nur mit Hilfe der Archäologie rekonstruieren. So schrecklich der Vesuvausbruch im Jahr 79 n. Chr. für die Bewohnerinnen und Bewohner Pompejis und Herculaneums war – unter Metern von Vulkanasche, Staub und Gestein wurde ein Alltag konserviert, über den wir heute ansonsten kaum etwas wüssten. Von den verkohlten Brotlaiben, die noch beim Bäcker im Ofen liegen, über die kleine Thermenanlage einer gewissen Julia Felix (ein ebenso seltenes wie eindrückliches Beispiel für die Existenz erfolg- und einflussreicher Geschäftsfrauen, über die Tacitus und Co. sich natürlich ausschweigen) bis zu den zahllosen Graffiti mit Wahlwerbung (damals so beliebt wie heute) oder der unverhohlenen Meinungsäußerung über den doofen Lehrer.
Seit den Tagen Roms ist die Welt zugleich größer geworden und geschrumpft: Größer, weil sich die Geschichte nicht mehr ausschließlich rund um das Mittelmeer, das mare nostrum, abspielt. Klar, das tat sie auch damals nicht. Aber wer wusste schon, was in China oder den Amerikas los war? Heute wissen wir es, oder wir wissen zumindest deutlich mehr darüber. Und das macht die Welt eben kleiner. Oder lässt sie wenigstens kleiner erscheinen. Ob amerikanische Popkultur, die Produktflut aus Fernost, ob neue Ideen, Trends, Moden: Die Einflüsse, die uns prägen, haben einen viel größeren, einen globalen Radius erlangt. Aber sie sind vielleicht auch beliebiger, schnelllebiger geworden. Ob irgendetwas davon in zweitausend Jahren noch nachklingen wird, wie es bei Rom bis heute der Fall ist? Quod esset demonstrandum!
Alles im Kasten
Wie die Legionen von ihren auxiliares, den Hilfstruppen, oder wie eine zünftige cena durch Gesang und Tanz werden auch die achtzehn folgenden Kapitel flankiert und ergänzt – durch kleine Textkästen mit kuriosen, erstaunlichen, immer merkenswerten Infohappen. Mal sind sie einfach »gut zu wissen« (siehe oben: bonum scire). Mal liefern sie eine kluge oder alltagstaugliche Redewendung, das Bonmot für den Partytalk (semper recta verba – »immer das richtige Wort«). Mal gibt es ein paar Zahlen zum Staunen (numeri placent – »Zahlen, bitte«).
CAPUT I–I WANT YOU FOR ROMAN ARMY
Das Erfolgsgeheimnis der Legionen
Der 2. August 216 v. Chr. ist ein Tag zum Vergessen. Oder aber das genaue Gegenteil, eine Frage der Perspektive. Knapp zwei Jahre zuvor hat der karthagische Feldherr Hannibal seine Truppen samt den berüchtigten Kriegselefanten über die Alpen ins römische Herzland geführt. Seitdem ziehen die Karthager, inzwischen verstärkt von keltischen Stämmen, die sich Hannibals Heer anschließen, durch Italien. Die Bedrohung ist existenziell: Was, wenn die Nordafrikaner, Roms ärgster Konkurrent um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeerraum, auf die Tiberstadt selbst marschieren? Nicht auszudenken! Man muss sie aufhalten, mit aller Macht.
Der Senat wählt für diesen Auftrag die beiden Konsuln Lucius Aemilius Paullus und Gaius Terentius Varro, zieht sagenhafte 16 Legionen zusammen, insgesamt schätzungsweise 80 000 Fußsoldaten plus noch einmal 6000 Berittene. Es ist das größte Aufgebot in der bisherigen Geschichte Roms – und gut das Doppelte von dem, was Hannibal befehligt. Eine ausgemachte Sache also? Das Problem: Was Hannibal an manpower fehlt, macht er mit taktischem Geschick mehr als wett. Umgekehrt wird man später allerdings auch bilanzieren müssen: Paullus und Varro? Nicht gerade die Superstrategen.
Bei Cannae, einem Ort etwa auf halber Strecke zwischen dem heutigen Foggia und Bari im Südosten des italienischen Stiefels, stehen sich die beiden Heere einander schließlich gegenüber. Die Römer entscheiden sich dafür, ihre zahlenmäßige Überlegenheit in der Tiefe der Formation auszuspielen. Der Gedanke: die Legionen wie einen unaufhaltbaren Keil immer tiefer in die gegnerischen Reihen treiben. Klar, in der Rückschau hat man immer leicht reden. Aber hätten Paullus und Varro stattdessen ihre Überlegenheit in der Breite ausgespielt, wäre die Sache vermutlich anders ausgegangen.
Hannibal jedenfalls ahnt den Plan der Römer. Als die Legionen vorstoßen, lässt er seine Truppen absichtlich zurückweichen – um auf diese Weise eine Art Halbmond um den römischen Keil bilden zu können, der von der karthagischen Reiterei, die die römischen Linien umrundet und plötzlich in deren Rücken steht, zu einem Ring geschlossen wird.
Was folgt, ist eine Kesselschlacht wie aus dem Lehrbuch. Funfact: Das ist sie auch. Hannibals Umfassungsstrategie wird tatsächlich bis heute an den Militärakademien der Welt gelehrt. Noch im Zweiten Golfkrieg (1990 bis 1991) nannte Norman Schwarzkopf, der Oberbefehlshaber der US-Armee, die Schlacht bei Cannae als Vorbild für sein Vorgehen bei der Invasion des Iraks.
Der Tag endet für Rom in einer Katastrophe. Ein Großteil der Soldaten wird im Kessel von Cannae getötet, darunter auch Konsul Paullus. Nur wenigen Tausend gelingt die Flucht. Es ist die verheerendste Niederlage, die eine römische Armee jemals erlitten hat – und bleibt es für mehr als zweihundert Jahre. Erst das Fiasko der Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr. wird Rom ähnlich traumatisieren (siehe Caput X).
Cannae ist zwar die verheerendste, aber nicht die erste Niederlage, die die Römer einstecken mussten, seit Hannibal durch Italien marodiert. Bereits mehrfach hat der Karthager unter Beweis gestellt, dass er in der Feldschlacht kaum zu besiegen ist. Ironie der Geschichte: Das ist den Römern eigentlich klar. Bevor das Kommando an Varro und Paullus ging, hatte Rom in seiner Not Quintus Fabius Maximus Verrucosus (etwa 275 bis 203 v. Chr.), kurz Fabius, zum Diktator gemacht und ihn auf diese Weise mit noch weitreichenderen Befugnissen ausgestattet, als sie einem Konsul zustehen.
Fabius weiß um die Fähigkeiten und die Stärke der Karthager und vermeidet es bewusst, Hannibal in einer offenen Schlacht gegenüberzutreten. Stattdessen setzt er auf Zermürbung: Die Karthager stehen pausenlos unter Beobachtung. Leisten sie sich auch nur eine Blöße, etwa wenn kleinere Verbände ausgesandt werden, um Verpflegung für das Hauptheer zu besorgen, schlagen die Römer zu. Eine Strategie der Nadelstiche, der Abnutzung, die nicht nur erfolgreich ist, sondern als »fabianische Strategie« ebenfalls Einzug in die Lehrbücher finden wird. Ihr einziger Haken: der absolute Mangel an Prestige. Die stolzen Legionen als bloße Guerillakämpfer? Das passt nicht ins römische Selbstverständnis. Obwohl Fabius vormacht, wie Hannibal zu knacken sein könnte, wendet sich die Stimmung in Rom gegen den Diktator. Wie genau seine Amtszeit endet, ist nicht überliefert, fest steht nur: Ihm folgen Varro und Paullus. Der Rest: siehe oben.
Zum Glück der Römer bleibt das Desaster von Cannae eher eine Ausnahme. In der Regel geht das ausgeprägte Bedürfnis nach Ruhm, Ehre und Machtzuwachs mit einem ebenso großen strategischen Kalkül einher. Schon die römische Geschichtsschreibung bilanziert, dass, hätte etwa ein Gaius Julius Cäsar (100 bis 44 v. Chr.) die Legionen gegen Hannibal ins Feld geführt, die Sache definitiv anders geendet hätte.
Ein (gar nicht so) einfacher Cäsar
Wie man untereinander kommuniziert, ohne dass der Feind Wind von Strategie und Taktik bekommt, treibt jede Armee der Welt um. Vielleicht nicht schon immer – aber mindestens seit den Tagen von Gaius Julius Cäsar. Zumindest will Sueton es wissen. In seiner Biografie vom »göttlichen Julius« schreibt er, der Mann habe, wann immer es geheime Botschaften auszutauschen gab, seine Briefe codiert, indem er das Alphabet um jeweils vier Buchstaben verschob. Wo D steht, ist A gemeint und so weiter. Noch heute ist diese Urmutter aller Geheimschriften als CÄSARCHIFFRE bekannt, auch als »einfacher Cäsar« – weil es nun wirklich keine Quantencomputer braucht, um den Code zu knacken. Aber das ist leicht gesagt, zweitausend Jahre Kryptografiegeschichte später. Für Cäsars Zeitgenossen mag sich der Buchstabensalat ähnlich undurchdringlich dargestellt haben wie im Zweiten Weltkrieg die Codes der berüchtigten Chiffriermaschine »Enigma«, mit der die deutsche Wehrmacht kommunizierte, und die erst entschlüsselt werden konnten, als die Alliierten selbst in den Besitz eines solchen Apparates kamen, der gegenüber Cäsars Chiffrierung mit einem einzigen Code ganze 158 962 555 217 826 360 000 verschiedene produzieren konnte.
Taktisches Genie gepaart mit dem extrem hohen Ausbildungsgrad der Legionäre ist dabei nur ein Teil der Geschichte. Roms Militär zeichnet sich zudem dadurch aus, nicht halsstarrig auf gelernten Techniken zu beharren – es weist die Fähigkeit auf, sich adaptiv auf jeden Gegner einstellen zu können. Das wahrscheinlich berühmteste Beispiel hierfür stammt aus dem ersten Krieg, den Rom und Karthago rund vierzig Jahre früher führen. Zu Land sind Roms Legionen zwar überlegen, aber da der Konflikt im Wesentlichen Sizilien betrifft, wird den Strategen am Tiber bald klar: Ohne eine eigene Kriegsmarine, über die Rom bis dahin nicht verfügt, wird die Sache nicht zu entscheiden sein. Jedenfalls nicht zu den eigenen Gunsten.
Angeblich nehmen römische Ingenieure das Wrack eines karthagischen Schiffes als Blaupause und bauen nach diesem Vorbild in nicht einmal zwei Monaten ein Geschwader von 120 Schiffen, währenddessen sie Tausende von Ruderern auf improvisierten Bänken an Land trainieren lassen. In der Seeschlacht von Mylae, dem heutigen Milazzo, kann man dann die Ernte einfahren. Die karthagische Flotte wird vernichtend geschlagen. Okay, die heutige Forschung geht davon aus, dass es ganz so sagenhaft wahrscheinlich nicht zugegangen ist. Dass Rom durchaus schon vorher eigene Schiffe und auch Erfahrung in der Seekriegsführung besaß. Aber das nur am Rande.
Hannibal hat sein triumphaler Sieg bei Cannae übrigens nicht viel gebracht. Obwohl die Karthager noch mehr als zehn Jahre in Italien bleiben, können sie sich am Ende nicht halten. Zu weit von der nordafrikanischen Heimat entfernt, mangelt es auf Dauer an Nachschub, überdehnen die Karthager quasi ihre Möglichkeiten und sind der römischen Übermacht und Ausdauer schließlich nicht mehr gewachsen. Im Jahr 202 v. Chr. endet der Konflikt, der als Zweiter Punischer Krieg in die Geschichte eingeht, mit der einstweiligen Niederlage Karthagos (gut fünfzig Jahre später folgt noch ein dritter Krieg).
Auch wenn Dinge wie Seekrieg oder Kesselschlachten das Handbuch für römische Feldherren erst mit der Zeit ergänzen – Rom blickt an diesem Punkt schon auf mehr als fünfhundert Jahre Geschichte seit seiner legendären Gründung 753 v. Chr. zurück. Und das ist quasi gleichbedeutend mit fünfhundert Jahren Militärgeschichte. Ab Tag eins ist man schließlich auf Expansion gepolt. Anfangs geht es vor allem gegen benachbarte Städte und Völker. Doch mit zunehmendem Erfolg steigt der Appetit auf mehr – und es erwächst zugleich eine Art Missionsgedanke: Wir müssen unsere überlegene Zivilisation in die Welt tragen, das Mittelmeer zu unserem Meer machen, zum mare nostrum, den Völkern der Erde Frieden – zu unseren Bedingungen, versteht sich – bringen, die pax romana (siehe Caput VI). Und dafür brauchen wir die beste Armee von allen. Die fußt im Wesentlichen auf drei Säulen:
Erstens auf einer hervorragenden technischen und taktischen Ausbildung jedes einzelnen Soldaten, zweitens auf einer beinahe konkurrenzlosen Ausstattung, einschließlich der hervorragenden Infrastruktur, die Rom etwa in Form seines Straßen- und Kommunikationsnetzes erschafft (siehe Caput V), und drittens auf den human resources – also den Menschen, die die Reihen der Legionen immer wieder auffüllen.
Anfangs sind das auch in Rom wie überall sonst Bürger: Geht es in den Krieg, was fast immer der Fall ist, werden sie mobilisiert – allerdings nicht alle. Nur Landbesitzer qualifizieren sich für den Wehrdienst. Außerdem verstehen es die Römer, besiegte und unterworfene Städte, Stämme und Völker zu foederati zu machen, zu mehr oder weniger freiwilligen Bundesgenossen, die zur militärischen Unterstützung verpflichtet sind. Diese steuern in der Regel aber nur auxiliares bei, also Hilfstruppen. Weil sich im Laufe der Zeit der Landbesitz aber mehr und mehr in den Händen von immer weniger Großgrundbesitzern konzentriert, schrumpft das Angebot an verfügbaren Rekruten. Zugleich wird der Personalbedarf mit wachsender Einflusssphäre bei gleichzeitig ungestilltem Expansionsdrang immer größer. Ein Verlust von vielleicht 50 000 bis 60 000 Soldaten wie bei Cannae ist nur schwer zu kompensieren.
Von wegen Schwarz auf Weiß
Aquarium und Laudanum, Babaorum und Kleinbonum: Vermutlich gibt es mehr als die eine oder den anderen, denen beim Stichwort RÖMERLAGER als Erstes die Namen der vier Forts einfallen, die sich gleich einer Perlenkette um das Dorf der unbeugsamen Gallier aufreihen. Dazu die entsprechenden Bilder: Ein Karree aus Palisaden, darin ordentliche Reihen der Zelte, in denen die Legionäre untergebracht sind und zähneklappernd der nächsten Schlägerei mit Asterix und Obelix entgegensehen. Achtung, jetzt kommt’s: Fast nichts daran stimmt. Zelte und Palisaden? Vielleicht, wenn eine Legion auf dem Marsch war und ihren Lagerplatz provisorisch befestigte. Wo Rom seine Truppen dauerhaft postierte, entstanden meist auch dauerhafte Befestigungen, zum Teil mit Steinmauern, gewiss aber mit festen Baracken für die Soldaten – und nicht nur für die: Anders als in den Comics sind in den Lagern neben Legionären meist auch Hilfstruppen stationiert, die sogenannten auxiliares, dazu Zivilisten, die für die Versorgung der Truppe sorgten. Sogar Ehefrauen und Kinder konnten vor Ort sein, wie wir von den Vindolanda-Tafeln aus dem frühen 2. Jahrhundert n. Chr. wissen, die man im gleichnamigen Lager im Norden Englands fand: Manche davon enthalten die private Korrespondenz von Offiziersfrauen (siehe Caput II).
Auftritt: Gaius Marius (etwa 158 bis 86 v. Chr.) und seine berühmte Heeresreform. Auch wenn die neuere Forschung davon ausgeht, dass es mit ziemlicher Sicherheit mehr als eine war und auch nicht alles von Marius ausgeheckt wurde – das Ergebnis ist einschneidend und stellt entscheidende Weichen für den weiteren Aufstieg Roms zur Weltmacht. Marius öffnet das Militär auch Besitzlosen. Damit vervielfacht er auf einen Schlag den Pool, aus dem die Legionen nun Nachschub schöpfen dürfen. Weil aber Menschen, die nicht einfach von den Erträgen ihres Landbesitzes leben können, sondern Lohnarbeit für ihren Unterhalt leisten müssen, nicht pro bono jahrelang auf irgendwelchen Feldzügen am Ende der Welt unterwegs sein können, baut Marius die Legionen zu einer Berufsarmee aus. Es gibt einen ordentlichen Sold, nach dem mehrjährigen Dienst erhalten die Legionäre eine Pension oder auch Landbesitz, auf dem sie sich als Selbstversorger zur Ruhe setzen können. Dazu das standing: In einer durch und durch militaristischen Gesellschaft wie der römischen ist das soziale Ansehen eines Soldaten hoch. Jedenfalls höher als das der meisten anderen Berufe, die diesen Menschen zur Auswahl stehen. Ein klares Win-win: Massenweise wird der Militärdienst zur verlockenden Karriereoption, zugleich ist das Thema Personalnot Geschichte. In den kommenden Jahrzehnten wächst die Größe der Armee immer weiter, bis sie zu Zeiten Kaiser Trajans (53 bis 117 n. Chr.), als das Reich auch seine größte Ausdehnung erreicht (siehe Caput VIII und Caput XVIII), einschließlich aller Hilfstruppen rund eine halbe Million Mann umfasst haben dürfte.
Alte Kameraden
Die Legionen waren mehr als tausend Jahre lang das Rückgrat der römischen Militärmacht. Auch wenn ihre Truppenstärke und Organisation sich durch die Zeiten wandelte, existierte manche Einheit über Jahrhunderte, aber keine davon so lange wie die legio V Macedonica. Ihre Gründung geht wahrscheinlich auf Augustus zurück. In der Schlacht von Actium (31 v. Chr.) half sie dem Mann, der damals noch Octavian hieß, seinen großen Widersacher Marcus Antonius – und dessen Verbündete und Geliebte Kleopatra – zu besiegen und damit den Weg zur Alleinherrschaft freizuräumen. Danach wurde die Legio V ins heutige Mazedonien verlegt, daher der Zuname. Sie war rund 130 Jahre später im Feldzug gegen die Daker dabei (siehe Caput II), taucht immer wieder in verschiedenen Quellen an verschiedenen Orten auf. Die letzte Erwähnung bezieht sich auf einen Einsatz im heutigen Ägypten etwa um 635 n. Chr. – womit die sagenumwobene Truppe beinahe 700 JAHRE lang existiert hätte.
So ein Apparat kostet allerdings. Ob Marius sich viele Gedanken darüber gemacht hat? Man weiß es nicht. Sicher ist, schon gut hundert Jahre später muss Augustus (63 v. Chr. bis 14 n. Chr.) schätzungsweise rund vierzig Prozent des Staatshaushalts aufbringen, um seine Legionen zu finanzieren. In der Krise des 3. Jahrhunderts n. Chr., als ein sogenannter Soldatenkaiser nach dem anderen sich auf dem Thron ablösen beziehungsweise einander bekriegen, sollen es bis zu sechzig Prozent gewesen sein.
Dreieinhalb oder auch fünf, wie es in den NATO-Staaten angesichts der fragilen Weltlage gefordert wird? Darüber hätte schon Marius gelacht, von Augustus und seinen Nachfolgern ganz zu schweigen. Rom lebt quasi in permanenter Kriegswirtschaft – und zwar über Jahrhunderte. Sicherlich, eine Gesellschaft, die kaum Geld für Bildung (siehe Caput IV) oder Soziales ausgeben muss, ein System, das auf Sklavenarbeit fußt (siehe Caput XII) und entsprechend keine Mittel für Kranken- oder Renten-, geschweige denn Arbeitslosenversicherung vorhalten muss, kann deutlich mehr in Ausrüstung und Unterhalt seiner Legionen stecken. Trotzdem ist sich die Forschung heute einig: Am Niedergang des einst so mächtigen Rom ist nicht nur der wachsende Druck von außen schuld. Die innere Aushöhlung hat einen mindestens ebenso großen Anteil. Der Staat hat sich auf Dauer finanziell übernommen, Inflation ist die Folge und damit der wirtschaftliche Abstieg (siehe Caput XVIII).
Und so erben wir vielleicht zweierlei: Rom hat vorgemacht, wie man einen militärischen Apparat in beispielloser Weise professionalisiert. Seine Legionen bleiben über Jahrhunderte hinweg unangefochten die beste und schlagkräftigste Armee des Planeten, die dem Imperium seinen Status als Supermacht sichert. Aber auch das Ende sollte mahnendes Beispiel sein. Schlussendlich ist das System, das quasi komplett auf sein Militär ausgerichtet ist, nicht überlebensfähig.
CAPUT II–DIE MINUSKELN SPIELEN LASSEN
Warum wir (fast) wie Römer schreiben – aber nicht so rechnen
Eigentlich sind die Daker selbst schuld, oder? Jahrelang haben sie wie ein eingetretener Dorn den Römern Schmerzen zugefügt. Nie lebensbedrohlich, aber unangenehm. Erst wagen sie es, aus ihrem Siedlungsgebiet jenseits der Donau in Moesia einzufallen, der angrenzenden römischen Provinz. Als Kaiser Domitian (51 bis 96 n. Chr.) zur Vergeltung Strafexpeditionen schickt, werden die von den Dakern unter ihrem König Decebal immer wieder geschlagen. Nicht nur deswegen sind viele in Rom froh, als Domitian im Jahr 96 n. Chr. endlich einem Mordkomplott zum Opfer fällt und nach dem kurzen Auftritt Nervas, eines ältlichen Senators, den man als Interimsherrscher eingesetzt hatte, im Jahr 98 n. Chr. Nervas Adoptivsohn Trajan den Thron besteigt – und von Anfang an klarstellt: Dieser Dorn an der Donau? Gehört ein für alle Mal ausgerissen und unschädlich gemacht.