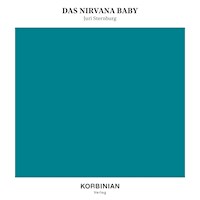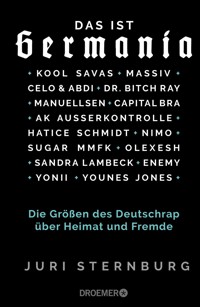
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Rap-Game verändert das Land. Capital Bra, Kool Savas, Dr. Bitch Ray, Massiv, Manuellsen u.v.m.: die Größen des Deutschrap darüber, was Heimat für sie bedeutet - Hip-Hop ist der einflussreichste kulturelle Trend in Deutschland - Die erfolgreichsten Rap-Artists und Influencer*innen Deutschlands erzählen - Ein neuer Blick auf die Gesellschaft aus postmigrantischer Perspektive Dass sich Prominente in der Integrationsdebatte zu Wort melden, ist keine Neuerung. Allerdings kamen solche Beiträge noch nie so frei und unbeschwert daher. – FAZ über Germania Capital Bra, Kool Savas, Massiv: Die Größen des Deutschrap prägen den Sound unserer Zeit. Aber sie stehen für viel mehr als das. Sie repräsentieren eine postmigrantische Gesellschaft, die im Hip-Hop ihre Stimme gefunden hat. Basierend auf persönlichen Interviews erzählt der renommierte Musikjournalist Juri Sternburg nun ihre Geschichten: übers Heimweh und Ankommen, über Beats und Hooks, über Zugehörigkeit und Rassismus. Und so stellt Das ist Germania den Begriff Heimat auf den Kopf, zerlegt ihn und setzt ihn wieder neu zusammen. Lauter, bunter und komplexer. Wer Deutschland heute verstehen will, muss dieses Buch lesen. Das ist Germania basiert auf dem einflussreichen gleichnamigen Youtube-Format: Die wichtigsten Protagonisten des Deutschrap und der Social-Media-Welt erzählen hier von ihrem Verhältnis zu Deutschland, berichten über Erfahrungen mit alltäglicher Ausgrenzung und Rassismus genauso wie über das Selbstbewusstsein der postmigrantischen Rap-Nation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Juri Sternburg
Das ist Germania
KOOL SAVAS + Celo & Abdi + Dr. Bitch Ray + Massiv + Capital Bra + AK Ausserkontrolle + Hatice Schmidt + NIMO + Sugar MMFK + Olexesh + Sandra Lambeck + Manuellsen + ENEMY + Yonii + Younes Jones
Die Größen des Deutschrap über Heimat und Fremde
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Rap-Game verändert das Land
Deutschrap prägt den Sound unserer Zeit und ist zugleich so viel mehr als Musik. Besonders in der Hip-Hop-Kultur hat die postmigrantische Gesellschaft eine Stimme gefunden. Basierend auf persönlichen Interviews mit den Protagonist*innen des deutschen Rap-Kosmos und der Social-Media-Welt erzählt Autor und Musikjournalist Juri Sternburg nun ihre Geschichten: über Heimweh und Ankommen, über Beats und Hooks, über ihre Eltern und deren Kämpfe, über Zugehörigkeit und Rassismus. Sie stellen den Begriff Heimat auf den Kopf, zerlegen ihn und setzen ihn wieder neu zusammen. Lauter, bunter und komplexer. Wer die Geschichten der Menschen in diesem Land hören und Deutschland 2020 verstehen will, muss dieses Buch lesen.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Einleitung
Motto
Celo & Abdi
AK Ausserkontrolle
Olexesh
Yonii
Manuellsen
Hatice Schmidt
Massiv
Nimo
Dr. Bitch Ray
Sugar MMFK
Enemy
Sandra Lambeck
Younes Jones
Kool Savas
Capital Bra
Dank
Bildnachweis und Playlist
Vorwort
Es ist Mitte Dezember 2016, wir sitzen in einem italienischen Restaurant in Berlin-Kreuzberg. Die ehemalige Fleischerei liegt direkt gegenüber von unserem Büro, und wir essen oft mittags hier. An diesem Abend findet die erste Weihnachtsfeier unserer Produktionsfirma statt. Wir sind ein kleines Team: sechs, sieben Redakteur*innen, Kameraleute, Cutter. Unsere Reihe Germania läuft seit ein paar Monaten auf YouTube, aber der Erfolg ist überschaubar. Ein paar Tausend Abrufe, zehntausend, wenn es gut läuft. Niemand scheint zu verstehen, was wir wollen, was diese Reihe eigentlich sein soll. Sie ist weder ein Musikformat, obwohl Musiker*innen vorkommen. Noch ein klassisches journalistisches Stück, obwohl wir über Identität in der deutschen Gesellschaft sprechen.
Am Nachmittag haben wir gerade eine Folge mit dem Darmstädter Rapper Olexesh veröffentlicht. Er gehört zu einer neuen Welle von jungen Musiker*innen aus der ehemaligen Sowjetunion, gilt als genauso wortgewandt wie lyrisch begabt und steht beim Frankfurter Label 385idéal unter Vertrag. Das Anfangsbild seiner Germania-Folge zeigt ihn in einer viel zu großen Versace-Daunenjacke auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Anschließend erzählt er, wie vermittelt durch Rap die deutsche Sprache für ihn zu einer Heimat geworden ist.
Es ist Vorweihnachtszeit, der italienische Kellner serviert große Platten Tagliatelle mit Trüffeln. Es gibt Weißwein und einen etwas unangenehmen Prosecco, der uns als Naturwein angepriesen wurde, wir trinken ihn trotzdem. Mitten im Essen reißt unsere Redakteurin Sara ihr Telefon in die Luft und schreit durch den ganzen Raum, so laut, dass die Bedienung uns fortan keinen Wein mehr bringen will: »60000 Klicks!« Keiner weiß, was sie meint. Bis wir verstehen, dass die Olexesh-Folge in ein paar Stunden mehr Zuschauer*innen erreicht hat als alle vorherigen Folgen zusammen. Den Rest des Abends schauen wir immer wieder auf die Telefone.
Ein halbes Jahr später drehen wir eine Folge mit Samy Deluxe an der Hamburger Außenalster. Der Rapper war einer der ersten, der in den 90er-Jahren deutsche Sprache und Rap virtuos und handwerklich perfekt zusammengebracht hat. Inzwischen erreichen alle Germania-Folgen sechsstellige Abrufzahlen. Plattenfirmen und Promoter haben das Format entdeckt, und auch bei den Fans wird es immer bekannter. Drei Jungs, vielleicht 12 oder 13 Jahre alt, erkennen Samy und fragen, was hier gedreht wird. Als sie hören, dass es eine Folge für Germania ist, stellen sie sich in einer Reihe auf und singen perfekt im Chor die Titelmelodie: den ersten Vers des alten Volkslieds »Am Brunnen vor dem Tore«.
April 2018 in der Ruhrgebietsstadt Marl. Es ist kühl und verregnet, wir fahren mit unserem Team in einem schwarzen Van zum Stadttheater, wo wir am Abend einen Grimme-Preis erhalten werden. Unsere Redakteurinnen Sara und Nadja sitzen im Auto, unsere Kamerafrau Susi und Benni, der Regisseur. Unser Cutter Suraj trägt zur Feier des Tages seinen Afro offen. Bei der Nominierung hat die Jury vor allem die »anspruchsvolle Ästhetik« von Bild und Ton, die Auswahl der Drehorte und Atmosphäre der Filme gewürdigt. Auf dem roten Teppich eine surreale Situation, Tom Tykwer, Kida Ramadan, Peter Kurth, Volker Bruch, Lied Lisa Fries, Oliver Masucci lassen sich vor uns fotografieren und geben Autogramme. Nach zwei Jahren haben wir es mit einer YouTube-Reihe geschafft, den wichtigsten Fernsehpreis in Deutschland zu gewinnen.
Germania ist der seltene Fall einer Serie, die bei der Kritik, aber auch bei den Zuschauern erfolgreich ist. Wir haben inzwischen über vierzig Millionen Videos ausgespielt, Hunderttausende Kommentare beantwortet und neben dem Grimme-Preis auch den Goldene Kamera Digital Award erhalten. Auf YouTube gibt es unzählige Kopien von Germania. Der FC Bayern hat seine Spieler nach unserer Vorlage porträtiert. Rapper*innen, die nicht eingeladen wurden haben, haben kurzerhand ihre eigenen Folgen gedreht.
Trotz des großen Erfolgs gab es auch immer wieder Kritik, sowohl an der Verwendung des historisch kontaminierten Begriffs »Germania« als auch an der offensiven Umdeutung tradierter Konzepte wie etwa »Heimat«. Doch diese Kritik geht oftmals am zentralen Anliegen der Serie vorbei – nämlich die Geschichte von Migrant*innen und ihren Kindern zu erzählen und sie anzuerkennen. Ihre Verschiedenartigkeit zu akzeptieren, sie nicht als eine gleichförmige Gruppe zu sehen, sondern mehr über ihre individuellen Erfahrungen zu lernen. Wir wollten eine Serie schaffen, die eine »typisch« deutsche Landschaft zeigt, in der sich »untypische« Deutsche bewegen – und andersherum. Ein modernes und zeitgemäßes Bild, jenseits von Klischees und Romantisierung.
Dieses Buch erzählt sechzehn der eindrücklichsten Geschichten, die wir in den letzten drei Jahren gehört haben. Ein guter Anlass, um allen Beteiligten zu danken. Unseren Auftraggeber*innen bei ZDF und Funk, die dieses Projekt ermöglicht haben. Dem ganzen Redaktionsteam, allen Manager*innen, Promoter*innen, Plattenfirmen und Medien, die uns unterstützt haben.
Vor allem aber möchte ich den Menschen danken, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Ohne sie wäre Germania nicht möglich. Sie haben zum ersten Mal vor einer Kamera über ihre eigene Biografie gesprochen. Über die Geschichte ihrer Familie. Über Themen wie Herkunft und Zerrissenheit, über Liebe und Heimat. Sie haben unseren Zuschauer*innen eine Seite gezeigt, die man gerade im Rap nur selten sieht. Reflektierte, differenzierte und kluge Ansichten jenseits ihres öffentlichen Images. Dieses Buch dient hoffentlich dazu, diese Geschichten weiterzuerzählen. Und eine offene Debatte darüber zu führen, wie wir in diesem Land zusammenleben wollen.
Bastian Asdonk, Hyperbole TV
Einleitung
Es waren die immer gleichen Fragen, die ich und andere mir gestellt haben, seit ich mich entschlossen habe, dieses Buch zu schreiben: Braucht die Welt ein weiteres Werk, in dem Migrant*innen erzählen, dass sie auch zu Deutschland gehören? Ist das keine Selbstverständlichkeit? Oder sollte man es nicht lieber mit Max Czolleks Desintegriert euch! halten? Wird der Alltagsrassismus, der in Deutschland abseits der großstädtischen Echokammern immer noch an der Tagesordnung ist, durch solche Formate verharmlost?
Ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist. Und es gab viele unterschiedliche Stimmen dazu, wenn ich nachgefragt habe. Und dennoch wollte ich mir die Naivität nicht nehmen lassen, wollte und will an das glauben, was ich in diesem Format und vor allem in dem nun veröffentlichten Buch von Tag eins an gesehen habe: die Möglichkeit, komplett unterschiedliche Schichten und Szenen anzusprechen. Menschen zusammenzuführen, die sich nur selten treffen, die, die alle fließend Deutsch und doch manchmal ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dabei rede ich nicht von Menschen, die durch absurde Konstrukte wie Ländergrenzen getrennt sind. Ich rede von Jugendkultur und Bildungsbürgertum, von Straßen-Rapperin und Soziologiestudent, von der Mutter, die wissen will, was ihr Sohn da hört, und der Tochter, die dem Vater vielleicht etwas verständlicher machen kann, warum sie diese Musik oder jene Influencerin so liebt.
Wenn Kool Savas davon erzählt, wie ihm erst die sogenannte Flüchtlingskrise im Jahr 2015 verdeutlichte, dass auch er ein Geflüchteter ist, wenn Hatice Schmidt über ihren Umzug aus dem beschaulichen Lankwitz ins beinharte Neukölln berichtet oder wenn andere ihre diffuse Angst vor dem Heimatland ihrer Eltern beschreiben, dann ist das für einen Großteil dieser weißen Mehrheitsgesellschaft eben immer noch »Neuland«. Dann hören sie im Idealfall Geschichten, die sie so nicht kannten. Und dann fühlen sich jene, die nicht Teil dieser Mehrheitsgesellschaft sind, eventuell inspiriert und abgebildet. Fühlen sich gesehen und erkennen, dass ihre Idole und Stars ähnliche Erfahrungen hatten. Die Geschichten der Protagonist*innen um Informationen und Hintergrundinfos zu bereichern, sie einzuordnen und mit eigenen Erfahrungen zu verbinden, das ist es, was ich hier versucht habe.
Denn außerhalb der ach so aufgeklärten Journalismus- und Debattenblase, in der ich und viele andere sich bewegen, gibt es Millionen von Kindern und Erwachsenen, die nach solchen Geschichten dürsten oder sie zumindest einmal hören sollten. Denn wenn sie niemand hören würde, wäre das ein Verlust für uns alle. Das ist es, woran ich fest glaube.
Juri Sternburg, Mai 2020
Ich übernehme einfach gerne Dinge aus anderen Kulturen.
Kool Savas
Celo & Abdi
In der Diaspora
Die Zeil in Frankfurt am Main. Lärm, Menschen, Autos. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gilt die Straße in Frankfurts Innenstadt als eine der bekanntesten und umsatzstärksten Einkaufsgegenden Deutschlands. Jetzt grade ist davon nicht viel zu sehen. Ein Betrunkener wankt den Bürgersteig entlang, brabbelt etwas, läuft weiter. Der knapp 500 Meter lange westliche Teil der Straße ist seit den 70er-Jahren eine Fußgängerzone. Hier treffen die Menschen einer Stadt aufeinander, die von ihren Extremen lebt. Millionäre und arme Schlucker, Durchschnittsbürger und schillernde Figuren, Bänker und Drogenkranke. Wobei Letzteres manchmal das Gleiche ist:
Frankfurt am Main Subkultur
Vorstrafenfrei sein, ist hier Luxus pur
Celo & Abdi, »Azzlackz«, 2012
Am östlichen Ende der Straße liegt die Konstablerwache, »Konsti« genannt. In den Texten der Frankfurter Rapper wie Haftbefehl und Hanybal spielt sie oft eine entscheidende Rolle. Hier hängt man rum, hier werden Geschäfte gemacht, hier wird man auch mal über den Tisch gezogen. Die beiden Männer, die jetzt auf die Straße einbiegen, wirken nur auf das unerfahrene Auge bedrohlich. Wer sich zwei Minuten mit ihnen unterhält, merkt: Celo & Abdi sind nicht nur ein Herz und eine Seele, sondern auch mit das Sympathischste und Amüsanteste, was Deutschrap an Persönlichkeiten aktuell zu bieten hat.
Höflich, wie sie sind, stellen sie sich erst mal vor. »Mein Name ist Erol Huseinćehaj, bekannt als Celo. Ich bin 38 Jahre alt, geboren am 15. Januar 1982 in Frankfurt am Main im Marienkrankenhaus. Ich bin OBB – Original Bornheimer Bub. Ich bin in Bornheim auf der Bergerstraße aufgewachsen.« Abdi beobachtet ihn, während er redet, dann ist er an der Reihe. »Mein Name ist Abderrahim el Ommali. Ich bin am 7. 8. 1987 in Frankfurt am Main Höchst geboren, gebürtiger Frankfurter Bub.« Die beiden wirken, als wären sie rundum zufrieden mit ihren Aussagen. Grinsend setzen sie sich auf zwei Stühle vor einem Imbiss und bestellen ein paar Softdrinks für alle Anwesenden.
Wenn man Celo fragt, wie seine Geschichte mit und in Deutschland aussieht, klingt das, als würde man ihn fragen, was er zu Mittag gegessen hat: »Mein Vater kam hierher, hat gearbeitet, hat meine Mutter kennengelernt, mein Bruder kam auf die Welt, ich kam auf die Welt. Dann hab ich Abdi kennengelernt, und jetzt sitzen wir hier. Das ist meine Story.« Etwas komplexer ist es natürlich schon. Aber noch bevor man einhaken kann, bedankt sich Abdi bei ihm für die Erwähnung seines Namens und die schöne Geschichte. Der Grat zwischen Humor und ernst gemeinter Zuneigung ist ebenso schmal wie wichtig bei den beiden. Um zu begreifen, was dieses außergewöhnliche Duo ausmacht, muss man sie erleben. Muss sehen, hören oder zumindest verstehen, wie sie miteinander umgehen.
Als Abdi einmal in einem Interview gefragt wurde, wer sein absolutes Traum-Feature für einen Song wäre, dachte er keine Sekunde nach und nannte automatisch seinen musikalischen Partner: Celo. Das hier ist keine Konkurrenz, keine Überheblichkeit. Weder Machogehabe noch falsche Gangster-Attitüde. Es ist wahre Bruderliebe von zwei jungen Männern, die sich im Callcenter über die damalige gemeinsame Vorliebe für Marihuana und Musik kennengelernt haben und begriffen, dass sie zusammen unschlagbar sind. Was Timon & Pumba im König der Löwen, sind sie als »Jugo und der Arab« auf den Straßen Frankfurts:
Hennessy und Jack, Haze-Fanatics
Der Jugo und Arab auf der Street wie Classics
Kripo Hessen und sechstes, Hijo de Puta
Wir machen Para mit Yayo und Nouggah
Celo & Abdi, »Intro«, 2010
Die Sonne ballert, die beiden haben gute Laune. Während sich die Massen an den beiden Frankfurter Rappern vorbeidrängen, der Geruch von Falafel, Currywurst und Döner Kebab in der Luft steht, machen sich die beiden so ihre Gedanken über ihre Stadt, die vielen zu hart ist, aber schon immer eine gewisse Faszination ausstrahlte. Das Drehkreuz Europas. Worin diese Faszination der beiden für ihre Stadt liegt, kann Abdi schnell und präzise erklären. »Das Zusammenleben in Frankfurt funktioniert sehr gut. Ein plumpes Beispiel: Kai Uwe, der Deutscher ist, und Ali, der Migrant ist, trinken zusammen ein bisschen zu viel, stechen sich aus Versehen gegenseitig ab und gehen danach zusammen in den Puff in der Breiten Gasse. Es wird viel gelacht und viel geweint zusammen. Ganz einfach.« Klingt herzerwärmend und brutal zugleich. Und genau das ist es auch.
»Frankfurt ist schon eine sehr, sehr multikulturelle Stadt«, erzählt Celo. »Das geht schon weit zurück. Zu den Gastarbeitern in den Sechzigern. Hier haben sich in den letzten Jahren viele Kulturen und Nationen angesammelt und leben miteinander.« Die beiden sind eines der besten Beispiele für dieses Miteinander. Celo ist der Sohn bosnischer Einwanderer, Abdis Familie kam aus Marokko nach Deutschland. Beide Väter waren Gastarbeiter, haben diese typischen Lebensgeschichten, die man immer wieder zu hören bekommt, wenn man denn überhaupt nachfragt.
Hinter diesen unzähligen, oft baugleichen Biografien steckt jedoch meist mehr individuelles Leid, als viele der Gastarbeiterkinder zugeben möchten. Die Probleme der Eltern, besonders der Väter, sind für viele der Kinder zwar allgegenwärtig, widersprechen jedoch oft ihrer absoluten Vergötterung von Mutter und Vater. Auch schweigen die Eltern oft, wenn es um die Schwierigkeiten in ihrem Leben geht, sich zu beklagen ist nicht Teil ihrer Lebenseinstellung.
Als Celos Vater geboren wird, heißt sein Land noch Jugoslawien. Früh geht er als Architekt nach Deutschland und bleibt so größtenteils von dem kommenden Horror verschont. Denn infolge des Zerfalls der Sowjetunion sowie der kriegerischen Konflikte in und mit Kroatien wachsen in den Jahren 1990/91 auch die Spannungen zwischen den verschiedenen Ethnien in Bosnien und Herzegowina. Während große Teile der Serben für einen Verbleib in der jugoslawischen Föderation plädieren, gibt es insbesondere bei den Bosniaken den Wunsch, einen eigenen unabhängigen Staat zu bilden. Durch unterschiedliche nationalistische Gruppen immer weiter angeheizt, entsteht der sogenannte Bosnienkrieg, der über 100000 Opfer fordert. Abertausende Familien fliehen aus dem Land, viele finden in Deutschland sowohl eine Zuflucht als auch eine neue Heimat. Auch Celos Familie trägt Narben aus dieser Zeit. Reden möchte er darüber wenn, dann nur in seinen Songs, wie etwa 2017 in »Diaspora«:
Kein Strom und kein Wasser, Grenzen geschlossen
Den Tod vor Augen, nur noch beten und hoffen
Dreihundert Jahre vergehen, Cousin hat posttraumatische Schäden
Was soll ich erzähl’n?
Über Bosnien, Brücke zwischen Orient und Okzident
Celo & Abdi, »Diaspora«, 2017
Als Celo aka Erol Huseinćehaj 1982 auf die Welt kommt, ist dieser Krieg noch nicht abzusehen. Doch auch in Deutschland wird es ihm nicht leicht gemacht, das beginnt bereits in der ersten Klasse. Schon damals merkt er, wie unterschiedlich seine Lehrer die »deutschen« und die »ausländischen« Schüler und Schülerinnen behandeln. »Ich habe das damals schon mitbekommen, weil ich auch so steinalte Lehrer aus dieser Vorkriegszeit hatte. Die waren noch zur NS-Zeit aktiv, mäßig. Und die haben uns dann unterrichtet. Für die war das natürlich ein Kulturschock, uns als Gleichberechtigte anzuerkennen.«
An ein Beispiel erinnert er sich ganz genau: »Damals gab es ja Religionsunterricht, das war noch, bevor Ethik eingeführt wurde. Danach hat man ja irgendwann erkannt: Okay, jetzt machen wir besser Ethikunterricht, weil es gibt ja auch Orthodoxe, Juden, Moslems et cetera. Aber damals war das noch gar nicht so vorgesehen.« Er trinkt einen großen Schluck von seinem Softdrink und blinzelt in die Sonne. »Mein Land war damals noch Jugoslawien, und es waren viele Kroaten in meiner Klasse, ich war der einzige Bosnier. Kroaten sind in der Regel katholisch. Und ohne mich zu fragen, haben sie mich dann auch in den katholischen Religionsunterricht eingetragen. Ich wusste nicht mal, was ich da mache. Ich hatte zwar schon davon gehört, Jesus und so, aha, interessant. Aber ich wusste, das ist nicht mein Ding, vor allem als Kind, wenn du sieben oder acht Jahre alt bist.« Seine Eltern denken, so wird das eben gemacht in Deutschland, das sind offenbar die Regeln. Und Regeln widersetzt man sich nicht.
Aber Celo rebelliert. »Ich bin dann ein paarmal nicht hingegangen, und am nächsten Tag in der Pause kam dieser Religionslehrer in der Schule zu mir: Tja Erol, ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen! Das ging dann so weit, dass der Direktor sich eingeschaltet hat, und der hat das überprüft und schließlich gesagt: Moment mal, der Junge ist doch gar nicht katholisch. Der muss überhaupt nicht dahin.« Er hat Glück, ist stark genug, um sich zu wehren. Aber die Fälle, in denen Lehrer ausländischen Kindern Steine in den Weg legen, ihnen beispielsweise trotz hervorragender Noten nur eine Hauptschulempfehlung aussprechen, gibt es zuhauf. Wer in migrantischen Familien nachfragt, deren Kinder heute trotz all der Hindernisse mit einem erstklassigen Abitur dastehen, bekommt schnell Dutzende solcher Vorfälle zusammen.
»Da hat sich allerdings einiges getan«, sagt Celo. »Das ist ein Beispiel von früher. Mittlerweile habe ich mitgekriegt, die Lehrer sind ein bisschen integrierter.« Er merkt gar nicht, wie schön dieser Satz ist, und redet einfach weiter. »Die kennen sich aus, aber ich bin halt in der Zeit aufgewachsen, wo dieser Umbruch gar nicht geplant war. Die dachten, wir sind Gastarbeiter, und ein Gastarbeiter geht eh zurück.« Doch aus den Gastarbeitern, die temporär kommen sollten und wollten, wurden Einwohner, Staatsangehörige und Bürger. Sie heirateten, bekamen Kinder, bauten Häuser, gründeten Firmen und wurden Teil eines neuen Deutschlands.
Und dennoch ist die alte Heimat immer Bestandteil des Lebens. Wenn am letzten Schultag vor den Sommerferien bereits die Sachen gepackt sind, weil es am nächsten Morgen ganz früh endlich nach Bosnien geht, dann ist das mehr als Urlaub. Das Auto bis unters Dach vollgestopft, an jeder erdenklichen Stelle noch Koffer und Mitbringsel festgeschnallt, und dann fährt man 18 Stunden über die Autobahn, die ab der deutschen Grenze nicht mehr ganz so bequem ist. Sechs Wochen in Bosnien. Hier wird nur noch bosnisch geredet, gegessen, gedacht und geträumt. Warum man diese Verbindung zu seinen Wurzeln aufgeben sollte, bleibt ein weiteres Mysterium deutscher Willkommenskultur.
Die oft gehörte Forderung, die alte Heimat zu vergessen, ist so realitätsfremd wie frech. Und für Celo kommt das auch überhaupt nicht infrage. »Nach sechs Wochen war das zwar alles wieder vorbei. Die Schule ging wieder los, die Eltern gingen zur Arbeit. Aber ich fühlte mich trotzdem bosnisch.« Das ist heute nicht anders. »Aber ich bin eben ein Hybrid. Wir nennen das Diaspora. Wir sind die Bosnier in der Diaspora, im Ausland. Wir sind eine Gemeinschaft, die im Ausland lebt. Hier gibt es auch bosnische Moscheen, bosnische Cafés. Treffpunkte, wo sich Bosnier versammeln und ihre Kultur leben. Das ist nicht in jedem Land einfach so gegeben, aber eben in Deutschland. Dadurch entwickelt sich etwas Neues. Vielleicht vergleichbar mit Italienern in New York. Meine Erziehung fand auf jeden Fall in einer Parallelwelt statt. Aber nicht im negativen Sinn. Das fängt beim Essen an, es gibt eben kein Schweinefleisch.« Für manche aber beginnt dort bereits der Untergang des Abendlandes, wenn sich jemand nicht regelmäßig in Schweinesülze baden will.
Es ist Teil der gefühlt seit Ewigkeiten laufenden deutschen Debatte über Integration und Leitkultur, dass sich Menschen mit schwarzen Haaren doppelt und dreifach beweisen müssen. Dass sie verantwortlich gemacht werden für Taten von ihnen vollkommen Fremden, die zufällig aus demselben Land stammen. Wegen ihrer Herkunft diskriminiert zu werden gehört so sehr zum Alltag, dass Abdi, darauf angesprochen, antwortet, als hätte man ihn gefragt, ob er schon mal telefoniert hat. »Ich wurde gestern erst diskriminiert. Das ist einfach so, weil ich Marokkaner bin. Es gibt eben diese Klischees. Hier zum Beispiel, wo wir uns gerade aufhalten, gibt es Marokkaner, die Drogen verkaufen. Es gibt halt den einen oder anderen marokkanischen Mitbürger, der auch mal wen übers Ohr haut, um sein Geld zu machen. Das gibt’s doch überall. In Deutschland bekommt man da schnell einen Stempel aufgedrückt: Ah du bist doch Marokk und so. Aber man muss halt wirklich unterscheiden können: Möchte mich da jetzt jemand wirklich beleidigen, oder macht jemand einen Spaß über die üblichen Klischees. Denn damit sollte man umgehen können, finde ich.«
Es gibt ja auch Klischees über Deutsche. Pünktlichkeit ist eine der obersten Tugenden, das können so gut wie alle Migranten und Migrantinnen bestätigen. Celo stöhnt auf. »Da bin ich gar nicht deutsch! Bei der Pünktlichkeit!« Abdi lacht sofort laut auf: »Das kann ich bestätigen!« Ein Schlagabtausch à la Celo & Abdi beginnt. »Der hat schon graue Haare bekommen wegen mir«, sagt Celo, und Abdi fasst sich direkt an den Schädel mit den auf null rasierten Seiten. »Hab ich wirklich graue Haare?« Angst macht sich in seinem Gesicht breit, aber Celo beruhigt ihn: »Nein Mann, ich mach Spaß.« Die Aufregung bei Abdi legt sich, während Celo aufs Thema zurückkommt. »Auf jeden Fall, Pünktlichkeit ist das A und O in Deutschland. Das hat mir auch schon viele Wege verbaut. Das hab ich mir nie angeeignet.«
Dass sich die beiden Rapper nicht auf den gleichen Pfad wie ihre Eltern begeben werden, war früh klar. Abdis Papa hoffte eine Zeit lang, dass der Sohn eine Profi-Karriere als Fußballer hinlegt, aber die Hoffnungen lösten sich schnell in Luft auf. Lieber freestylt der Junge auf der Straße mit seinen Freunden, legt als DJ auf oder tanzt Breakdance. Die älteren Jungs aus dem Block klingeln regelmäßig bei seinen Eltern und verlangen, dass »die Rotzgöre« nach unten kommen soll, tanzen. Der Weg zum Entertainer war früh geebnet. Eine komplett andere Welt als die des Vaters, eine Welt, die auf den ersten Blick wenig mit dem bürgerlichen Frankfurter Erfolgsmodell schlechthin – dem »Bänker« – zu tun hat:
Drogenhändler statt Bänker geworden
Wollte und konnte nicht den Eltern gehorchen
Erforschen, wo meine Grenzen sind
Jetzt kratze ich täglich Striche an die Wände hin
Celo & Abdi, »Besuchstag«, 2012
»Damals kamen die Firmen nach Marokko und haben geguckt, wen sie als Gastarbeiter einladen können. Mein Vater kam mit ungefähr achtzehn Jahren nach Deutschland, sein Cousin hatte ihn eingeladen, der war schon in Deutschland. Ja und dann hat er hier in Deutschland gelebt, mit Junggesellen sozusagen. Die waren zwar keine richtigen Junggesellen, die hatten schon alle Frauen. Aber die Frauen waren halt in der Heimat. Und dann haben die Männer immer zu viert oder fünft zusammen in einer Wohnung gelebt. Haben selber Essen gemacht, Wäsche gewaschen und so.« Abdi lächelt verschmitzt. »Was man als Mann aus Marokko jetzt nicht unbedingt gewohnt ist.« War sein Vater froh, in Deutschland zu sein? Abdis Antwort kommt überraschend: »Mein Vater hat den deutschen Adler tätowiert. Der Adler ist aber nur noch zur Hälfte da, der wurde irgendwann mal gelasert.« Warum denn ein Adler? »Weil Deutschland das beste Land der Welt ist vielleicht? Deutschland gute Land, maschallah, al-hamdu lillah.« Er macht sich kurz lustig über die eigene Welt und den Dialekt, den Deutsche von Schwarzköpfen wie ihm oft erwarten, wird aber sofort wieder ernst, wenn er sagt: »Wir leben gerne hier!«
Der Blick schweift ab, wenn er an seinen Vater denkt. Für den Musiker ist es bis heute schwer vorstellbar, dass sein Vater auch mal jung war und sich tätowieren hat lassen. Die Aura der Respektsperson wiegt schwerer als die Vorstellungskraft des jungen Mannes.
Bei Celo ist das nicht viel anders. Die Welt, in der er sich heute bewegt, hat nichts zu tun mit dem harten Arbeiterleben seiner Eltern. Die Traditionen hingegen versuchen sie beide wenigstens im Privaten aufrechtzuerhalten. »Ich hab in meinem Elternhaus nur Bosnisch gesprochen, meine Muttersprache oder Heimatsprache. Meine Eltern haben auch nie deutsch mit mir geredet. Deutsch hab ich dann immer nur in der Schule gesprochen oder draußen mit Freunden.«
Es gehört zu den deutschen Eigenarten, man kann es auch ganz einfach Rassismus nennen, dass es auf die Sprache ankommt, ob ein solches Verhalten entweder bewundert oder abgewertet wird. Wenn die Eltern mit dem Kind zu Hause nur französisch oder norwegisch reden, staunen die Deutschen. Wie kultiviert und weltmännisch. Bei Sprachen wie Türkisch oder etwa Persisch ändert sich der Blick ganz schnell. Da wird plötzlich von fehlender Integration gesprochen. Von Familien, die sich nicht anpassen. Von lernunwilligen Menschen. Von Leitkultur und Strafen. Celo hat die deutsche Sprache ganz traditionell gelernt: im Fernsehen. »Bevor ich zur Schule ging, hab ich Serien geguckt. So hab ich begonnen, die Sprache zu verstehen.«
Zu Hause herrschte vor allem die Tradition, die mancher Politiker als Wurzel allen Übels ausgemacht hat. »Aber es ist doch eine schöne Tradition. Zum Beispiel abends mit der Familie zusammenzusitzen, wenn alle zu Besuch sind. Viele von uns sind ja im ganzen Land verteilt. Nicht jeder wohnt in Frankfurt. Manche sind in München, manche sind in Stuttgart, und wenn man sich dann trifft, ist das schon ein schönes Gefühl, dieser Familienzusammenhalt.« Aber große Familien werden in Deutschland nun mal traditionell schief angeguckt.
Abdi mischt sich ein. »Also ich bin Deutscher durch und durch.« Trommelwirbel, man wartet auf die Pointe. Und sie kommt: »… und zwar im Feiern!« Er lacht laut auf. »Deutsche sind Partytiere, das muss man denen lassen. Das hab ich abbekommen von den Almanesen. Ich lebe getreu dem Motto: work hard, party harder. Wenn ihr manchmal so im Büro hockt oder fünf Tage die Woche aufm Bau steht – egal, wo ihr seid. Und euch sagt: Scheiße, das kotzt mich alles an. Dann denkt ihr euch einfach: Egal, dafür geh ich dann am Wochenende richtig die Sau rauslassen. Und dann lasst ihr Deutschen auch die Sau raus! Werft mal so ’n Aschenbecher in die Tanzfläche rein oder so, und dann könnt ihr ab Montag wieder schön arbeiten. Uff jeeehts! Das ist für mich deutsch! Feiern. Die Deutschen können feiern, definitiv!« Es ist vielleicht auch ihr Blick für die Doppelbödigkeit dieser Feierwut, die die beiden »Afrika« auf »Kaviar« reimen lässt:
Hör zu, was Abdi sagt, Hunger in Afrika
Parallel dazu, isst du Hummer und Kaviar
In Bavaria vorm Sony Bravia
Parallel dazu, jagen Tommys Al-Quaida
Celo & Abdi, »Parallelen«, 2012
Und bei den Marokkanern ist das anders? Abdi überlegt. Dieser sympathische Wahnsinn, der 24/7 in Abdis Augen blitzt, gibt seinen Aussagen die nötige Prise Witz. »Bei uns ist das anders geregelt. Ich kann dir sagen, es gibt natürlich Marokkaner, das sind die schlimmsten Finger. Aber wenn der Fastenmonat Ramadan kommt, das ist eine Sache, die in unserer Kultur einfach integriert ist, dann ist halt ein Monat Ruhe angesagt. Es gibt schon Tage, wo man einfach so denkt: Ey, vielleicht will ich jetzt einfach mal einen Tag aussetzen. Aber man ist in diese Tradition reingewachsen. Wenn Ramadan ist: ein Monat die Füße stillhalten, zusammenreißen. Es gibt doch noch elf andere Monate, da kannst du machen, was du willst!« Ist Ramadan eine Tradition, die ihm wichtig ist, gerade auch in Deutschland? »Natürlich. Ich liebe es. Die ersten Tage sind oberschwer, und dann fällt einem auf, dass auch das Portemonnaie fastet, nur dass es dabei immer dicker wird und dass der Lifestyle, dieser gesunde Lifestyle, voll guttut. Und manchmal wünscht man sich wirklich, dass Ramadan sogar drei Monate gehen könnte. Und deswegen finde ich es vorteilhaft, diese Tradition zu haben.«
Celo kommt auf das eigentliche Thema zurück: »Was für mich auch richtig deutsch ist und was ich mir auch angeeignet hab, ist Ordentlichkeit und Papierkram. Weißt du, Bürokratie und so, das ist ja in Deutschland sehr hoch angepriesen. Pünktlichkeit und Bürokratie, da gehört ja eins ins andere. Und zum Beispiel jetzt so Unterlagen, da kannste meinen Manager fragen, hab ich immer alles sortiert. Nach A, B, C, Quittungen und alles für den Steuerberater, und ich krieg auch immer gut zurück bei der Umsatzsteuer und so, weil ich mach das immer ordentlich.«
Also was sind sie jetzt? Deutschmarokkaner? Deutschbosnier? Ausländer? Migranten? Deutsche? Celo winkt ab. »Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Wir sind Kanaken in Deutschland!« Ein paar Wagen brausen laut hupend vorbei, Celo ist abgelenkt. »Das ist auch Deutschland. Kanaken in deutschen Autos, die laut sind und sich gerne präsentieren. Also, wo waren wir? Ah. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Natürlich ist man mit der Heimat verbunden, Bosnien, Sarajevo. Aber da könnte ich mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben zu verbringen. Ich bin einfach hier zu verankert. Vielleicht später, wenn ich mal älter bin. Mein Vater geht jetzt fünf Monate nach Bosnien. Wenn es kalt wird, kommt er nach Deutschland, dann wieder zurück nach Bosnien. So ist zurzeit sein Lifestyle. Ich könnte mir das so ähnlich auch vorstellen, aber mit mehr Zeit in Deutschland.«
Der Begriff »Kanake« oder »Kanack« ist längst zum Self-Empowerment geworden. Während ihre Eltern in den 90ern noch von deutschen Neonazis als Kanaken beschimpft wurden, holte sich die nächste Generation das Wort zurück. »Kanake ist man nicht, weil die Eltern nicht Deutsche sind«, führt Abdi aus, während die PS-starken Autos die Zeil rauf und runter donnern. »Ich zitiere jetzt einfach mal den Film Kanak Attack. Da sagt der eine: Meine Goldkette ist Kanake, mein Schweiß ist Kanake, unser ganzer eigener Style ist Kanake. Auch Kai-Uwe kann Kanake sein, manchmal sogar mehr als ein Ausländer. Deswegen ist Kanake nicht die Herkunft, sondern der Lifestyle, definitiv.«
Celo & Abdi haben diese Wortschöpfung allerdings nicht nur weitergedacht, sie haben sie gleich zu ihrem Markenzeichen gemacht: Azzlack-Rap. Das Label ihres Förderers und Freunds Haftbefehl nennt sich ebenfalls so. Eine ganze Generation bezeichnet sich mittlerweile als Azzlacks. »Azzlack bedeutet asozialer Kanake. Das ist, wie Abdi beschrieben hat, Kanaken, aber noch eine Spur asozialer. Wir rappen ja wirklich schlimme Sachen.« Abdi nickt, und widersprechen kann und möchte man ihnen da wirklich nicht. Auch wenn ihre Texte bei Weitem nicht vergleichbar sind mit den teils fragwürdigeren Lyrics einiger Kollegen. Der Unterschied zwischen Kunstfigur und realer Persönlichkeit ist im Deutschrap oft enorm. Celo & Abdi jedoch erzählen einfach von den Dingen, die sie erleben. Sie sind Spiegel der Gesellschaft und Block-Poeten in einem. Oder eben der »Ulrich Wickert der Straße«, wie Celo sich in einem der neuesten Song selbst beschreibt.
Hinter dem anfangs vielleicht abschreckenden Begriff Azzlack steckt übrigens viel mehr, als man auf den ersten Blick denkt. »Was viele wissen müssen, in Frankfurt ist es so, dass im Jargon viel Kauderwelsch benutzt wird«, erklärt Celo. »Sinti oder Jiddisch zum Beispiel. Azzlack ist ein altes Wort, welches die Sinti früher benutzt haben. Schmock ist ein jiddisches Wort. Tacheles ist ein jiddisches Wort. Frankfurt war ja immer Handels- und Bankenstadt, so hat sich die Sprache auch entwickelt.«
Die Texte von Haftbefehl oder Celo & Abdi sind voll von solchen Hybriden und Wortschöpfungen, sie sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Ob spanisch oder jiddisch, bosnisch, arabisch oder italienisch, alles wird verwertet, wird durch den Fleischwolf der Straße gedreht und kommt als neues, frisches Produkt wieder auf den Markt. Für ungeübte Hörer ist es ohne ein Wörterbuch und genug Kenntnis des Straßenjargons beinahe unmöglich, ihre Texte zu verstehen. Wo die Älteren oft fürchten, dass die schöne deutsche Sprache verwurstet wird, ist für die jüngeren Generationen vollkommen klar, dass sich Sprache hier in atemberaubendem Tempo weiterentwickelt – so wie es bereits seit Jahrhunderten geschieht:
Guck Blaulicht und Krips in der Siedlung
Frankfurt, Phantom, Last Action Hero
Packs oder Kilos, Haze-Ernte, Bio
Captain Planet, Temperament Al Pacino
Celo & Abdi, »Last Action Hero«, 2012
Celo hat einen ganz klaren Blick auf die Sprache seines Landes. »Für mich bedeutet die deutsche Sprache folgendes Zitat: Deutsche Sprache schwere Sprache. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Aber ich bin der deutschen Sprache komplett mächtig. Und wenn man Deutsch kann, fällt es einem ganz leicht, Englisch zu lernen. Die deutsche Sprache ist eine schöne Sprache. Ich mag sie sehr.« Und wie zum Beweis, dass er die Sprache nicht nur beherrscht, sondern auch wunderschöne Bilder mit ihr malen kann, steht er auf und sagt: »Deutschland ist für mich auf jeden Fall so ein richtig schönes, dunkles Roggenbrot.« Und dabei rollt er das R so sehr, dass es erst weiter hinter der Zeil in der Abendsonne Frankfurts irgendwo zum Stehen kommt.
AK Ausserkontrolle
Ein kultivierter Kanake
Typisch deutsche Eigenschaften?«, Davut Altundal überlegt ein paar Sekunden, er sucht offenbar in seinen Erinnerungen, dann fällt es ihm ein. »Die Deutschen lassen sich halt voll oft scheiden.« Aus seiner Stimme klingt leichte Belustigung, aber ob er sich wirklich amüsiert oder einfach nur trocken wiedergibt, was er in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat, bleibt unklar. Denn sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Lediglich die stechenden Augen sind zu sehen, der Rest wird von einem schwarzen Basecap und einem umgebundenen blauen Bandana verdeckt. Grauer Kapuzenpullover und schwarze Lederjacke runden das Bild ab. Ein klassisches Bankräuber-Outfit, könnte man meinen.
Dabei sind Masken keine Seltenheit im Rap-Game. Ob Sido, 18 Karat, Lance Butters, Genetikk oder Cro – es gibt die unterschiedlichsten Gründe, sein Gesicht zu verstecken: keine Lust, auf der Straße erkannt zu werden, nicht das passende Gesicht zum Image oder extraterrestrische Lebewesen als Alter Ego. Bei Davut Altundal jedoch, der sich als Rapper AK Ausserkontrolle nennt und in seinen Tracks und Texten den Berliner Arbeiterbezirk Wedding repräsentiert, war die Maske bereits Teil seiner Persönlichkeit, lange bevor er gerappt hat.
Wenn man provokant sein möchte, würde man die Maske als seine alte Arbeitskleidung betiteln. Denn AK Ausserkontrolle hat eine Laufbahn im kriminellen Milieu hinter sich, die man tatsächlich als »Karriere« bezeichnen kann. Doch während andere Rapper gerne damit prahlen, dass sie mit 16 Jahren auch mal ein paar Gramm Gras gedealt haben, ist es Davut eher leid, in Interviews über seine Zeit in den Boulevardmedien und auf Fahndungsplakaten zu reden. Sein altes Ich ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil er oft darauf reduziert wird, Segen, weil er eine Geschichte mitbringt, die man hören will. Aber der Reihe nach.
»Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, aus Mardin, das ist kurdisches Gebiet in Südostanatolien«, erzählt er. »Sie sind damals in den Libanon gezogen und vom Libanon nach Deutschland. Das hatte alles viel mit Kriegen und Unruhen zu tun, logisch. Die sind quasi immer weiter geflüchtet. Und am Ende haben meine Eltern dann hier in Deutschland ihre Ruhe gefunden.« Wann Davut genau geboren ist, bleibt bewusst im Dunkeln. Er findet, das geht niemanden etwas an.