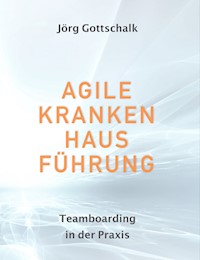Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
15 Jahre DRG-System bedeuten 15 Jahre Cost Cutting, Personalreduktion, Fallzahlsteigerungen, Zentralisierung, Outsourcing und Privatisierung. Vieles hat sich verändert in der Krankenhauswelt, nur die Art und Weise nicht, wie Behandlungsprozesse im Inneren gelebt werden. Krankenhausorganisation funktioniert immer noch nach den alten chaotischen Mustern: höchst individuell, maximal flexibel, weitgehend unstrukturiert und voller Verschwendung. Eine solche Organisation funktioniert zwar, sie schafft jedoch Unzufriedenheit und führt zu Verschwendung und unnötigen Risiken in Größenordnungen von mindestens 30 Prozent. Statt Chaos benötigen wir exakt das Gegenteil: Verlässlichkeit und Stabilität. Darum geht es im Lean Hospital. Es geht um Struktur und Planbarkeit, Transparenz, Verlässlichkeit und Stabilität – und um kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten in der gesamten Organisation durch diejenigen, die sich auskennen: die Mitarbeitenden. Es geht selbstverständlich auch und vor allem um Führung, die operative Verbesserung antreibt, vor Ort die Mitarbeitenden unterstützt und so vom Auftraggeber zum echten Mitakteur wird. Im Grunde stellen wir mit Lean die Führungs- und Organisationsphilosophie von Heute vom Kopf auf die Füße. Wir verändern die Logik dessen, wie Prozesse im Krankenhaus künftig funktionieren. Wir schaffen bessere Arbeitsbedingungen, minimieren Verschwendung und senken Risiken. Fundiert, wie immer leicht verständlich und unterhaltsam transferiert Jörg Gottschalk die Philosophie des Lean Management auf die besondere Welt der Krankenhäuser. Er nimmt den Leser mit auf seine persönliche Leanreise mit dem Ziel, Lean in seinen Tiefen, Zusammenhängen und Wirkungen zu verstehen. Mit vielen Beispielen aus der Praxis gibt er hilfreiche Anregungen und präsentiert mit Teamboarding ein unternehmensweites Verbesserungssystem, das kontinuierliches Verbessern zu einem festen Bestandteil von Arbeit aller Beteiligten macht – Führung eingeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Gottschalk
Das ist
Jörg Gottschalk
Das istLean Hospital
Schlanke Prozesse und agile Verbesserung im Krankenhaus
Die Texte in diesem Buch sind mit großer Sorgfalt erarbeitet worden. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Verlages oder des Autors, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Die in diesem Buch wiedergegebenen Bezeichnungen können Warenzeichen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Bearbeitungen sonstiger Art sowie für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Dies gilt auch für die Entnahme von einzelnen Abbildungen und bei auszugsweiser Verwendung von Texten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Gender-Hinweis
Eine konsequent gendergerechte Schreibweise stellt eine große Herausforderung dar. Ich möchte keinesfalls den eingetretenen Pfaden der ausschließlich männlich geprägten Begriffswelt folgen. Bei all meinen ernst gemeinten Versuchen der Vergangenheit musste ich jedoch leider erkennen, dass die Lesbarkeit der Texte leidet, bis hin zur völligen Unlesbarkeit. Aus diesem Grunde verzichte ich an einigen Stellen notgedrungen und mit schlechtem Gewissen auf eine gendergerechte Sprache. Das bedeutet jedoch ausdrücklich nicht den Ausschluss des jeweils anderen Geschlechts oder die Festschreibung auf nur ein oder zwei Geschlechter. Frauen, Männer und all jene, die sich „dazwischen“ oder anders identifizieren, mögen sich von den Inhalten dieses Buches gleichermaßen angesprochen fühlen.
Jörg Gottschalk
Impressum
Texte:
© 2022 Jörg Gottschalk
Umschlag:
© 2022 Jörg Gottschalk
Bild/Grafiken:
© 2022 Jörg Gottschalk undsiehe Bildnachweis
Lektorat:
Lisa Vogel, Bayreuth
Verantwortlich für den Inhalt:
Jörg Gottschalk, Berlin
Druck:
Epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Buchcover Coverdesign:
Ärztin © Tascha / Adobe Stock© sirisako /Adobe Stock
Inhaltsverzeichnis
1Warum Lean Hospital?
2Wenn Krankenhäuser Autos bauen
3Das Konzept Lean Hospital im Überblick
4Schwester Philin oder die ideale Organisation
Der Arbeitstag von Philin
Ideale Bedingungen schaffen
Exkurs: ein industrieller Ausflug
Die Station als Fließbandersatz
Falsch verstandene Individualität
Vier Feinde – vier Freunde
5In den Fluss bringen
Die Patientenbrille – der Dokumentarfilm
Ein linksschiefes Problem
6Wertschöpfung und Verschwendung
Verschwendung – eine Definition
Notwendige und pure Verschwendung
Das Ziel: Verschwendung reduzieren
Schuld und Sühne
7Sieben plus eine Verschwendungsart
Nr. 1: Überproduktion
Nr. 2: Warten und Suchen
Nr. 3: Transporte
Nr. 4: Überdimensionierter Prozess
Nr. 5: Bestände
Nr. 6: Wege
Nr. 7: Nacharbeiten
Nr. 8: Ungenutztes Mitarbeiterpotenzial
Augen auf – es geht um die Details
Das Nicht-weglassen-können-Syndrom
8Standardbasiertes Arbeiten
Die Bedeutung von Regeln und Standards
Regeln erfolgreich einführen – das 6R-Schema
Das Versprechen einer Führungskraft
9Orientierung geben − der Tagesplan
Pläne geben Struktur und Orientierung
Pläne fördern Genauigkeit
Pläne setzen Prioritäten
Pläne erziehen die Organisation
Pläne schaffen Probleme
10Störungen reduzieren
Störungen schaffen Arbeit und Instabilität
Die Springerin
Der Patient klingelt
Telefonate reduzieren
Störungspotpourri
11Überlastung vermeiden
Von Schwankung, Überlastung und Glättung
Ressourcen- versus Flusseffizienz
Engpässe und andere Nadelöhre
Puffer schaffen
12Schnittstellen minimieren
135S – von Struktur und Ordnung
14Die schlanke Patientenaufnahme
Heute
Schritt 1: In den Fluss bringen
Schritt 2: In den Takt bringen
Schritt 3: Das EKUV-Prinzip
Das Ergebnis
15Das Prinzip der kleinen Schritte
Dem Nordstern entgegen
Experimentieren
Exkurs: Lernen wie die Kinder
Komplexität und kleine Schritte
Ursache-Wirkungs-Diagramm
Vier Ansätze für Verbesserung
Organisationsanker werfen
16Lean Teamboarding
Das System im Überblick
Rollen und Gruppen im System
Das Teamboard
Regelkommunikation
Boarding als Teil der Regelkommunikation
Arbeiten mit Kennzahlen
Ein neues Thema einbringen
Der Kartenlauf am Board
Die 7V-Kata
17Die Hidden Agenda im Teamboarding
Transparenz schaffen
Fokussieren und Aufmerksamkeit schaffen
Prioritäten setzen
Handlungsdruck generieren
Unterschiedliche Sichtweisen integrieren
Routinen schaffen
Berufsgruppengrenzen auflösen
Hierarchiegrenzen durchlässiger machen
18Veränderung kommt von innen
19Literaturempfehlungen
20Bildnachweise
21Über den Autor
Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es
1 Warum Lean Hospital?
Nicht alles war früher besser. Fünfzehn Jahre DRG-System mit Cost-Cutting, Restrukturierung, Zentralisierung, Outsourcing, Konzernierung und Privatisierung haben die Krankenhauswelt in vielerlei Hinsicht produktiver werden lassen. Doch wir sehen und spüren heute auch die Schattenseiten dieser Entwicklung: stetige Personalknappheit, wachsende Unzufriedenheit des Personals sowie anhaltender Leistungs-, Ergebnis- und Kostendruck.
Der Ausweg aus diesem ewigen Dilemma liegt für viele auf der Hand, sie fordern mehr Geld und mehr Personal. Doch wird es mittelfristig weder das eine noch das andere geben. Und wenn doch, wird das die Probleme kaum lösen. Wir werden lernen müssen, besser mit dem auszukommen, was wir haben.
Lean Hospital beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Ist es möglich, mit den heute vorhandenen Ressourcen bessere Ergebnisse zu erzielen? Bessere Ergebnisse für unsere Patientinnen und Patienten? Bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende? Mehr Wirtschaftlichkeit?
Die Antwort auf all diese Fragen lautet eindeutig: Ja. Die heutige Krankenhausorganisation birgt erhebliche Zeitreserven in sich. Etwa 30 Prozent der Arbeitszeit fließt in Tätigkeiten, die keinen echten Nutzen für die Behandlung von Patientinnen und Patienten stiften. Es wird gelaufen, gesucht, gewartet oder dokumentiert. Beinahe jeder Vorgang wird durch Störungen unterbrochen. Ständig treten unklare Situationen auf, weshalb die Telefone ohne Unterlass läuten.
Das nachfolgende Bild zeigt die Situation recht eindrücklich.
Dieser Wertstrom zeigt den Krankenhausaufenthalt eines Patienten, der – im Bild von links nach rechts – seinen stationären Behandlungsprozess durchläuft. Die zahlreichen Zettel und Striche repräsentieren unterschiedlichste Aufgaben, Aktivitäten und vor allem Kommunikationstätigkeiten, die im Verlaufe eines Aufenthaltes notwendig werden. Der Patient selbst nimmt nur einen Bruchteil von ihnen bewusst wahr, nämlich die untere Zettelzeile. Dabei handelt es sich um Aktivitäten, die unmittelbar ihm gelten und in seinem Beisein ausgeführt werden: Untersuchungen, Gespräche, Therapien oder die Medikamenten- und Essensausgabe. Solche Aktivitäten tragen direkt zu seiner Behandlung bei bzw. sind dazu geeignet, seine Erwartungen an den Krankenhausaufenthalt sichtbar zu erfüllen.
Lassen Sie das Bild ein paar Sekunden auf sich wirken. Sie müssen nicht jeden Zettel entziffern. Es geht vielmehr um den Gesamteindruck. Was sind ihre spontanen Eindrücke?
Die meisten Betrachter empfinden das Bild als chaotisch, intransparent oder unstrukturiert. Manche lesen ein erhöhtes Risiko aus den vielen ungeordneten Strichen heraus. Einige spekulieren, dass das alles wohl sehr aufwendig sei.
Ihr Eindruck täuscht nicht. Wussten Sie beispielsweise, dass eine Pflegekraft pro Schicht mehr als zwei Stunden mit Gehen beschäftigt ist? Zwei von acht Stunden, die auf immer verloren gehen und keinen unmittelbaren Nutzen stiften. Und so ergeht es nicht nur Pflegekräften. Möchten Sie in einer Organisation arbeiten, in der sie keinen einzigen Vorgang ohne Störung und Unterbrechung erledigen können? Ich nicht, die meisten Mitarbeitenden auch nicht. Und trotzdem bedeutet das den Krankenhausarbeitsalltag.
Sehr viele Aktivitäten gelten in der Krankenhausorganisation als dringlich und sollen sofort und spontan erledigt werden. Selten kann ein Vorgang ohne Unterbrechung zu Ende gebracht werden. Kaum eine diagnostische Maßnahme oder eine Therapie wird mit einem genauen Termin belegt, und wenn doch, dann findet er selten pünktlich statt. Täglich werden OP-Pläne aufgestellt, die am nächsten Tag nicht einmal zu einem Drittel eingehalten werden. Das und viel mehr prägt die heutige Krankenhausorganisation. Spontan adäquates Handeln gilt den Beteiligten als wichtiger (und effizienter) als strukturierte, vorausschauend geplante Abläufe. Das Gegenteil würde man erwarten.
Vor allem wird viel kommuniziert. Die meisten Striche im Bild spiegeln Kommunikation wider. Dabei handelt es sich in erster Linie um Telefonate, E-Mails oder persönliche Nachfragen: „Wo ist der Patient? Wo ist der Arzt? Was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Patienten (sofort) zum Ultraschall! Wo ist die Akte?“ Hunderte solcher Fragen, Anordnungen oder Anweisungen tauchen täglich auf. Zugespitzt müsste man feststellen: eine Organisation voller Fragen, Unklarheiten, Unsicherheiten und spontaner Aktivitäten. Die Ineffizienz und das hohe Risikoniveau einer typischen Krankenhausorganisation springen uns förmlich entgegen.
Nehmen wir an, dass jedes Telefonat, jede Frage, jede Unklarheit oder Unsicherheit, jeder mündliche „Befehl“ Ausdruck eines tiefsitzenden Organisationsproblems wäre. Warum weiß die Beteiligte nicht, wo ihr Patient oder der Arzt ist? Warum sind die nicht dort, wo sie sein sollten? Warum liegt die Akte nicht an ihrem Platz und warum muss ein Patient immer spontan zu seiner Diagnostik gebracht werden? Warum weiß der Assistenzarzt nicht, was er in diesem Moment tun muss? Warum, warum, warum? Tausend Fragen – auf die die Organisation keine allgemeingültigen Antworten liefert. Deshalb muss man nachfragen. Eine solche Organisation schreit förmlich nach Verbesserung.
Der Wertstrom repräsentiert eindrucksvoll das gesamte organisatorische Wirrwarr eines durchschnittlichen Krankenhauses. In der Organisationslehre bezeichnen wir eine solche Organisation als chaotisch. Das Wort Chaos bedeutet eine zufällige Anordnung seiner Elemente. Zufälle und Unruhe prägen das heutige System mehr als Struktur und Ordnung. In jeder Sekunde müssen Mitarbeitende neue Entscheidungen treffen, weil neue Situationen entstehen. Es fehlt das Normale, die Routine.
Ich finde es bemerkenswert, dass ein solches Prozesschaos funktioniert. Trotz allem werden qualitativ gute Behandlungsergebnisse erzielt und die Patientinnen und Patienten in deutschen Krankenhäusern sind mit ihrer Versorgung zufrieden.
Das Kernproblem besteht allerdings darin, dass eine solche Organisation
extrem aufwendig ist,
viele kleine und große Risiken in sich trägt, die meist unsichtbar bleiben,
von Mitarbeitenden als belastend empfunden wird und
extrem intransparent und deshalb weder steuer- noch verbesserbar ist.
Das Ziel eines Krankenhauses besteht darin, Patienten perfekt zu versorgen, maximal wirtschaftlich zu handeln und attraktive Arbeitsbedingungen für hoch qualifizierte Mitarbeitende zu schaffen. Chaos ist exakt das Gegenteil dessen, was eine gute Organisation auszeichnen sollte.
Chaos funktioniert nämlich nur, wenn man genügend Zeit hat, es zu bewältigen.
Statt Chaos benötigen wir ein strukturiertes, fließendes und transparentes System. Es muss mit minimaler Verschwendung, möglichst störungsfrei und ohne gravierende Schwankungen sicherstellen, dass Patienten schnell, sicher und nach dem aktuellen Stand der Wissenschaften behandelt werden. All das soll nicht zufällig, sondern jeden Tag gezielt und berechenbar geschehen – für jeden einzelnen Mitarbeitenden.
Darüber hinaus benötigen wir ein stabiles, funktionierendes und unternehmensweit einheitliches Verbesserungssystem. Es soll jeden Organisationsbereich und seine Mitarbeitenden in die Lage versetzen, kontinuierlich die eigenen Prozesse zu verbessern: gemeinsam, berufsgruppen- und hierarchieübergreifend und mit voller Unterstützung der Führung vor Ort.
Darum geht es im Lean Hospital. Es geht um Struktur und Planbarkeit, Transparenz, Verlässlichkeit und Stabilität – und um kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten in der gesamten Organisation. Im Lean Hospital werden wir die heutige Krankenhauskultur und -organisation vom Kopf auf die Füße stellen.
Cost-Cutting ist Diät, Lean Management ist Ernährungsumstellung.
2 Wenn Krankenhäuser Autos bauen
Im Jahr 2020 habe ich die folgende Geschichte auf meinem Blog veröffentlicht: Wenn Krankenhäuser Autos bauen. Stellen Sie sich ein Krankenhaus auf der Suche nach neuen und zukunftssicheren Ertragsmöglichkeiten vor. Was würde wohl passieren, wenn es seine Erfahrungen in der Produktion komplexer Leistungen nutzen, bewährte Prozessmethoden übertragen und künftig innovative Autos bauen würde? Es würde mit Sicherheit die Welt verändern. Hier finden Sie den ersten Erfahrungsbericht.
Seitdem Autos mit den Methoden eines Krankenhauses hergestellt werden, gibt es im Werk keine Fließbänder mehr. Sie haben sich weder als zielführend noch als wirtschaftlich erwiesen. Einzel- und Gruppenarbeitsplätze erleben ein Comeback.
Die Geschwindigkeit und die Qualität der Produktion hängen vor allem davon ab, wie viele Mitarbeitende morgens zur Arbeit erscheinen. Der Personaleinsatz ist hochvariabel. Weil keine Personalpuffer existieren, beeinflusst die schwankende Personalmenge unmittelbar die Produktion. Die Geschwindigkeit und die Qualität der Produktion hängen außerdem maßgeblich von der Qualifikation und der Erfahrung dieser Mitarbeitenden ab.
Weil aus diesen Gründen kein Arbeitsschritt vollständig oder identisch erledigt werden kann, dokumentieren die Teams ihre Leistungen umfassend. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das jeweils nächste (zufällige) Team auf dem aktuellen Zustand des vorausgehenden Schrittes aufbauen kann. Derzeit arbeitet man mit Hochdruck daran, die Qualität und die Vollständigkeit dieser Dokumentation zu optimieren. Gerade wird ein neues Vorstandsreferat Dokumentationsmanagement aufgebaut.
Die Werkssprache wurde dazu auf Englisch umgestellt, denn die unterschiedlichen Herkunftssprachen der Mitarbeitenden haben in den letzten Monaten verstärkt zu Problemen in der Produktion und vor allem in der Dokumentation geführt. Jeder Mitarbeitende soll, so die Vorgabe, innerhalb von zwei Jahren das europäische Sprachlevel B1 Englisch erreichen. Bis dahin werden zusätzlich mehrsprachige Übersetzer und Übersetzerinnen eingestellt. Auch arbeitet man an der Standardisierung der Dokumentation, was allerdings derzeit auf starke Ablehnung in den Teams stößt. Die Gewohnheiten der Menschen sind doch zu unterschiedlich.
So entstehen Übergabeprotokolle mit einer variierenden Länge zwischen 2 und 6 Seiten pro Auto. Bis sich die Qualität der Dokumentation und das Sprachniveau verbessert haben, wird jedes Team am Anfang und am Ende einer Schicht zu einer 30-minütigen Übergabe unter Anwesenheit mehrsprachiger Übersetzer verpflichtet.
Wenn Arbeitsschritte bei der Übergabe nicht erledigt sind, übernehmen die nachfolgenden Teams diese Aufgabe, soweit es ihre Besetzung und Qualifikation erlauben.
Mehrmals am Tag kommt es vor, dass die Schicht- und Produktionsleiter Änderungen an der Konstruktion vornehmen. Das ist möglich, weil alle Teams in der Lage sind, jederzeit sämtliche Sonderwünsche und Änderungen im Produktionsprozess zu berücksichtigen und auszuführen. Unbeabsichtigt nimmt so die Variantenvielfalt der produzierten Autos erheblich zu. Der Kunde ist längst daran gewöhnt, ein individuelles Fahrzeug zu erhalten. Auch akzeptiert er das Fahrzeug, das er bekommt. Er liebt diese Form der Überraschung und die persönliche Einzigartigkeit seines Individual-Autos. Das individuelle und personalisierte Auto wird zum Markenzeichen der neuen deutschen Hersteller.
Anfangs kann es ungewohnt sein, doch der Kunde lernt schnell: Wo ist der Blinkerhebel, wo die Schaltung, wo das Radio, wo der Lichtschalter? Wie sind Gas-, Brems- und Kupplungsschalter angeordnet? Wo ist vorne, wo ist hinten?
In der Produktion können aufgrund der hohen Variabilität der Modelle und Vorgehensweisen keine Leistungsbeschreibungen oder Arbeitsrichtlinien mehr formuliert oder eingehalten werden. Deshalb kann jeder Montagemitarbeiter sein persönliches Wissen und seine Kreativität voll einbringen. Er darf seine Aufgaben so erledigen, wie er denkt, dass es richtig wäre. So fließt jederzeit das gesamte Know-how in das Endprodukt ein.
Die heute produzierten Autos verhalten sich im Übrigen sehr robust gegen unterschiedliche Herstellungsvarianten. Schrauben können sowohl rechtsherum wie linksherum festgedreht, Armaturenbretter rechts wie links eingebaut werden. Es soll sogar vorgekommen sein, dass ein Motor in den Kofferraum gebaut wurde und das Auto trotzdem funktioniert hat.
Allerdings müssen die Autohersteller und ihre Kunden einige Abstriche am Design akzeptieren. Es wird jedoch bereits fieberhaft nach weiteren Konstruktionsverbesserungen gesucht, damit die gewünschte Herstellungsflexibilität langfristig nicht mehr die Designqualität negativ beeinflusst. Personalisierung soll nicht zum Designkiller werden, so die klare Vorgabe der Hersteller.
Seit dem Vollzug des Brexits werden verstärkt englische Leasingkräfte mit Sondergenehmigungen eingeflogen und im Produktionsprozess eingesetzt. Die Automobilproduktion auf der Insel liegt bekanntlich am Boden. In England wird links gefahren, was die Produktionspraxis auch in deutschen Automobilwerken nachhaltig verändert hat. Armaturenbretter finden sich immer öfter rechts. Ebenso die Pedale. Weil diese Praxis zunimmt, überlegt die Bundesregierung, den Rechts- und Linksverkehr in Deutschland zuzulassen.
Sie hat zu diesem Zweck die Entwicklung eines umfassenden Steuerungs- und Managementsystems für den Straßenverkehr ausgeschrieben. Es soll eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der nächsten Legislaturperiode werden. Auch wird in einem zehnjährigen Übergangszeitraum die Polizei auf den Straßen deutlich verstärkt.
Die neue Art der Produktion lässt nicht zu, den Produktionsprozess exakt vorauszuplanen. Das ist auch nicht mehr nötig. Der Kunde bestellt längst nicht mehr. Er lässt sich überraschen.
Es bleibt den Mitarbeitenden überlassen, welches Material und Werkzeug wann und von wem an welchem Arbeitsplatz benötigt wird und welche Arbeitsschritte in welcher Reihenfolge zu erledigen sind. Deshalb werden das Material und die Werkzeuge heute wieder zentral oder an den Stellen gelagert, wo sie am wahrscheinlichsten benötigt werden. Um Lager- und Transportkosten zu senken, werden die Werke nur noch einmal wöchentlich beliefert.
Aus Kostengründen wurde der Umfang des zur Verfügung stehenden Werkzeugs in den vergangenen Jahren mehr als halbiert. Seitdem ist die Auslastung von Maschinen, Geräten und Werkzeugen extrem in die Höhe geschnellt – sehr zur Freude der Controller.
Die Mitarbeitenden kommen damit sehr gut klar. Sie verfügen heute über die Erfahrung und das technische Improvisationstalent, um mit dem Werkzeug und dem Material auszukommen, das sie gerade vorfinden. Sie wissen stets, wo sie etwas finden können und welche Arbeitsschritte sie gerade für wichtig erachten.
Lediglich neue Mitarbeitende haben in den ersten Wochen und Monaten ein Problem, denn sie verfügen noch nicht über diese Erfahrung. Die entstehenden Einarbeitungszeiträume sind zwar lang, doch werden sie von der Betriebsleitung gerne in Kauf genommen. Sie wirken sich motivierend auf das allerhöchste Gut im Unternehmen aus: auf Selbstständigkeit, Kreativität und Flexibilität. Mitarbeitende sind bis in die Haarspitzen hinein motiviert, jeden Tag neue Höchstleistungen zu erbringen. Dafür bleiben sie auch gerne einmal länger.
Mittlerweile werden neue Mitarbeitende nicht mehr strukturiert eingewiesen, denn das würde sie in ihrem persönlichen Freiheitsraum nur unnötig begrenzen und ihre Motivation zerstören. Sie sollen vielmehr maximale Flexibilität lernen. Angesichts der chaotischen Produktionsweise wüsste ohnehin niemand, wie eine solche Einweisung aussähe.
Für den Kunden hat diese Art der Produktion einen äußerst positiven Effekt: Die Lieferzeiten sind in den vergangenen Jahren um 300 Prozent, von durchschnittlich 2 auf 6 Monate, angestiegen. Jetzt steht mehr Zeit zur Verfügung, um auf das schöne, neue Auto zu sparen. Was auch dringend nötig ist, weil die Verkaufspreise sich innerhalb von drei Jahren um mehr als 50 Prozent erhöht haben, Tendenz epidemisch steigend.
Allen Vorbehalten zum Trotz ist die gute Nachricht: Jeder Kunde kann sich absolut sicher sein, dass sein Auto tatsächlich fährt. Die Vorfreude auf sein neues Fahrzeug steigt ins Unermessliche, denn er erhält ein maximal individuelles Produkt. Man könnte sogar sagen, dass kein Auto jemals mehr identisch hergestellt wird. Straßen voller personalisierter Unikate.
Allerdings − das ist die schlechte Nachricht − ist nicht mehr genau vorauszusehen, ob das Fahrzeug 100.000 oder 300.000 Kilometer ohne gravierende Reparaturen überstehen wird. Das muss den glücklichen Eigentümer allerdings nicht bekümmern, denn der Herstellerservice hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Die Anzahl der Reparaturwerkstätten wurde um mehr als 350 Prozent erhöht. Die Reparaturkosten übernimmt bis zu einer Laufleistung von 280.000 Kilometern ein eigens dafür eingerichteter Autoreparaturstrukturfond, den die Bundesregierung im letzten Jahr aufgelegt hat. In diesen Fond zahlen alle Führerscheinbesitzer und Hersteller ein. Nur Politiker, Beamte und Bayern sind von dieser Regelung ausgenommen. Für sie wird derzeit nach tragfähigen Alternativen gesucht. Aktuell wird darüber nachgedacht, für diese Gruppen ausschließlich den Besitz japanischer Autos zuzulassen.
Vielleicht war diese kleine Geschichte auch für Sie ein kleiner Blick in den Spiegel.
3 Das Konzept Lean Hospital im Überblick
Ein Buch über die Grundlagen und die Anwendung einer Methode beginnt traditionell mit einer Definition.
In der Literatur existieren unendlich viele Definitionen für Lean. Sie entspringen in der Regel einem eher wissenschaftlich universitären Denkansatz. Ihr Ursprung liegt in der Industrie, primär der Automobilindustrie. Derartige Definitionen kommen oft kompliziert daher und wirken auf Krankenhausmitarbeitende seelenlos, sie klingen technisch und damit anti-menschlich. Tatsache ist: Krankenhäuser bauen keine Autos.
Ich verwende deshalb sehr viel lieber die folgende Definition{1}:
Lean Management bedeutet, gemeinsam dauerhaft die richtigen Dinge richtig zu tun.
Gemeinsamheißt, dass möglichst viele – am besten sogar alle – Mitarbeitende daran arbeiten, Prozesse zu leben und besser zu machen. Sie arbeiten zusammen, nicht gegeneinander. Es geht selten um einmalige, große Verbesserungen. Große Würfe finden zu selten statt, als dass sie eine Organisation wirklich „retten“ könnten. Lean zielt vielmehr darauf ab, strukturiert, transparent, verlässlich und stabil zu arbeiten. Prozesse sollen in kleinen Schritten, dafür aber kontinuierlich und dauerhaft verbessert werden.
Wir sprechen deshalb im Lean Management nicht von Projekten, die bekanntlich immer ein Ende haben (sollten). Standards sollen dauerhaft gelebt werden. Verbesserungsarbeit muss kontinuierlich stattfinden, sie findet kein Ende.
Eine Organisation findet Schritt für Schritt und gemeinsam heraus, was Nutzen stiftet, was richtig oder falsch, besser oder schlechter ist (die richtigen Dinge). Wenn sie herausgefunden hat, was (heute) richtig ist, muss sie lernen, es richtig zu tun. Möglichst von der ersten Minute an soll von allen dauerhaft getan werden, was als die aktuell beste Lösung festgelegt wurde, so lange, bis etwas Anderes entschieden wird.
Meine Definition weist bereits deutlich darauf hin, worauf es im Lean ankommt. Wir wollen die bestmöglichen Prozesse. Sie sollen dauerhaft strukturiert und gleich ablaufen. Und wir wollen kontinuierlich und gemeinsam daran arbeiten, dass sie besser werden.
Erfolgreiche Lean-Entwicklung steht deshalb grundsätzlich auf zwei Säulen.
Das Produktionssystem und das Verbesserungssystem sind zwei Seiten einer Medaille. Ohne eine gute Produktionsmethode bleibt Organisationsentwicklung kompetenzfrei und richtungs- bzw. orientierungslos. Ohne eine funktionierende Verbesserungsmethode herrscht Stillstand. Im Lean Hospital betrachten wir also stets beide Seiten gemeinsam.
Wir wissen, wohin wir wollen, und wir finden heraus, wie wir dorthin gelangen und darüber hinaus.
Auf der Produktionsseite verbinden wir mit Lean Hospital, dass
alle Prozesse – von der Aufnahme bis zur Entlassung – in einem Rutsch durchgeführt werden,
alle Abläufe geplant, strukturiert und transparent ausgeführt werden,
Abläufe so standardisiert und einheitlich wie möglich durchgeführt werden,
Mitarbeitende in die Lage versetzt werden, jeden Vorgang störungs-, überlastungs- und verschwendungsfrei auszuführen,
alle Service- und Unterstützungsprozesse sich darauf ausrichten, den Patienten schnell durch seinen Behandlungsprozess
fließen
zu lassen,
die Stationen als Drehkreuze für den Prozess fungieren.
Im Ergebnis dieser Ausrichtung entsteht eine völlig andere Arbeitsweise:
Das Qualitätsniveau hängt weniger von individuellem Handeln ab, sondern vor allem von der Qualität und der Stabilität des Gesamtsystems. Das System trägt die Menschen, nicht umgekehrt.
Die Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende werden besser, weil sie ruhiger und störungsfreier ihre anstehenden Aufgaben erledigen können.
Verschwendung wird vermieden, weil jeder Vorgang effizient und stabil abläuft.
Es entstehen neue Routinen, die alles sicherer und leichter werden lassen.
Es treten weniger Risiken auf, weil Mitarbeitende standardisiert, routiniert und störungsfrei arbeiten können. Sie beherrschen ihre Organisation und werden nicht von ihr getrieben.
Mit diesen wenigen Sätzen wären die Richtung der Verbesserung im Lean und die Methoden definiert, denen unsere Behandlungsprozesse künftig folgen sollen. Das Produktionssystem ist damit im Grunde in seinen Eckpunkten vollständig beschrieben.
Als Zweites stellt sich jetzt die Frage, wie wir unsere riesige und komplexe Organisation in die Lage versetzen können, die heutigen Prozesse so zu verändern, dass sie dem Lean-Hospital-Ideal möglichst nahekommen. Wer soll verändern? Und wann? Wie soll verändert werden? Woran erkennen wir, dass sich etwas verbessert bzw. verändert hat?
Die Herausforderung besteht darin, ein unternehmensweites, funktionierendes, kontinuierliches Verbesserungssystem in der betrieblichen Routine fest zu verankern – die zweite Lean-Säule also. Das Instrument der Wahl, das ich Ihnen in diesem Buch vorstelle, trägt den Namen Teamboarding.
Die Idee hinter diesem Ansatz ist die folgende:
Jede Organisationseinheit, zum Beispiel eine Station oder der OP, verbessert selbstständig und mit höchster Kompetenz ihre Prozesse.
Verbesserung erfolgt kontinuierlich und in kleinen Schritten.
Wir schaffen mit Lean Teamboarding ein dezentrales Verbesserungssystem, das sich durch Transparenz und eine strukturierte, verbindliche Regelkommunikation auszeichnet.
Verbesserung verläuft dezentral sowie berufsgruppen- und hierarchieübergreifend.
Die dezentralen Verbesserungsteams werden von ihren Unterstützern, Schnittstellenpartnern und Dienstleistern konsequent und vor Ort in ihrer Verbesserungsarbeit unterstützt.
Die dezentralen Verbesserungsteams werden von ihren Führungskräften konsequent und vor Ort (am Ort des Geschehens) unterstützt.
Im Ergebnis schaffen wir ein Verbesserungssystem, das dafür sorgt, dass in jedem Bereich kontinuierlich gemeinsam daran gearbeitet wird, den Lean-Prozessgedanken konsequent umzusetzen. Wenn alle gleichzeitig verbessern, wird vieles besser.
Wir wissen, dass Prozesse künftig anders aussehen werden als heute und wir wissen, wie wir das erreichen können.
Im Verlaufe des Buches werde ich mit Ihnen gemeinsam Schritt für Schritt das Konzept eines Lean Hospital entwickeln. Wenn Sie dieses Buch studiert haben, werden Sie die zentralen Gedanken der Methode Lean kennen und anwenden können. Und Sie werden für sich die Voraussetzungen geschaffen haben, um in Ihrer Organisation ein unternehmensweites, kontinuierliches Verbesserungssystem fest in Ihrem betrieblichen Alltag zu verankern.
Das wäre mein Versprechen. Sie werden feststellen, dass es im Lean sehr häufig um Versprechen geht – und um das Einhalten von Versprechen.
Lassen Sie uns also starten. Sie werden nun meine Lieblingspflegekraft kennenlernen: Schwester Philin. Sie ist mit ihrer Station ein Paradebeispiel für eine schlanke Krankenhausorganisation. Wenn alle Mitarbeitenden im Krankenhaus so strukturiert, verlässlich und stabil arbeiten können wie Schwester Philin und alle Abläufe nahtlos ineinandergreifen, dann ist das Ziel erreicht: das Lean Hospital.
4 Schwester Philin oder die ideale Organisation
Lassen Sie uns nicht zuerst in die großen organisatorischen Baustellen einer typischen Krankenhausorganisation einsteigen und abermals nur über Probleme, Verschwendung, Risiken oder unattraktive Arbeitsplätze philosophieren. Wenden wir uns besser etwas Positivem zu und nehmen gemeinsam den Tagesablauf einer idealen chirurgischen Normalstation unter die Lupe. Der Tagesablauf dieser Idealstation entwirft ein Abbild dessen, wie Mitarbeitende im Lean Hospital arbeiten können und sollen. Er schafft ein organisatorisches Vorbild dessen, was konsequente, schlanke Prozesse in Zukunft ausmacht.
Die Protagonistin meines Beispiels ist Schwester Philin. Durch ihre Brille betrachten wir nun ihren Arbeitstag. Wir drehen einen Dokumentarfilm aus der Perspektive einer Pflegekraft.
Der Arbeitstag von Philin
Philin hat das Glück, auf einer perfekt organisierten chirurgischen Normalstation in einem perfekt organisierten Krankenhaus zu arbeiten. Ihre Station verfügt über 40 Betten in 6 Einbettzimmern, 11 Zweibettzimmern und 4 Dreibettzimmern. Schauen wir uns an, wie ihre Frühschicht verläuft.
An einem Dienstag beginnt Philins Dienst um 5.45 Uhr am Morgen.
Zu dieser Zeit verfügt sie über alle relevanten Informationen, die sie für einen reibungslosen Tagesablauf benötigt.
Sie betreut als Bereichspflegekraft 10 Betten mit aktuell 10 Patienten. Sie zeichnet verantwortlich für die allgemeinpflegerische Betreuung und die Umsetzung ärztlicher Anordnungen. Außerdem weiß sie, dass in ihrer Schicht drei Patienten entlassen und drei Patienten aufgenommen werden. Es sind drei Patiententransporte terminiert (jeweils Hin- und Rücktransport). Für Philin bedeutet das einen ganz normalen Tag.
Sie beginnt pünktlich und gut gelaunt ihren Dienst. Nach einer kurzen pflegerischen Übergabe bereitet sie als Erstes ihren (digitalen) Tagesplan vor. Der sieht an diesem Dienstag so aus.
Vor Philin liegt ein dichter Arbeitstag, 8 Stunden. Trotzdem geht sie entspannt und gut gelaunt an ihr Tagewerk. Sie weiß aus Erfahrung, dass ihr persönlicher Tagesplan so angelegt ist, dass sie zügig und dennoch in Ruhe ihre Aufgaben bewältigen kann. Sie weiß, dass ihr Plan nicht zu 100 Prozent stabil sein und immer einmal durcheinandergeraten wird. Doch es existieren genügend Zeitpuffer, um unvermeidliche Schwankungen gut kompensieren zu können. Sie kann sich sicher sein, dass sie mit der Übergabe auf den Spätdienst um 14.00 Uhr ihre geplanten Aufgaben abgeschlossen haben wird. Um 14.15 Uhr wird sie müde, aber sortiert das Krankenhaus verlassen und keinen Gedanken mehr an ihre Arbeit verschwenden. Am nächsten Morgen geht es wie gewohnt weiter.
Ideale Bedingungen schaffen
Wie hört sich dieser Arbeitstag für Sie an? Utopisch? Unmöglich? Den Ausdruck „langweilig“ habe ich auch schon gehört. Wer einen solchen Tagesablauf nicht von vorneherein als unmögliche Utopie abtut und zur alten Krankenhaustagesordnung zurückkehrt, der stellt sich die eine entscheidende Frage: Wie stellt diese chirurgische Station sicher, dass Philin (und all ihre Kolleginnen und Kollegen) ruhig, kontinuierlich und effizient ihre Aufgaben vollständig in der vorgesehenen Zeit erledigt?
Jeder Insider weiß, dass in der heutigen Organisation ein solcher Tagesablauf utopisch wäre. Philin würde auf jeder anderen Station vielfach durch Telefonate, persönliche Ansprachen bzw. Fragen oder sofort auszuführende „Befehle“ in ihrem Arbeitsfluss unterbrochen. Ihre Kolleginnen bäten sie um Hilfe. Der Transportdienst verspätete sich. Anordnungen wären unvollständig oder sie fehlten gänzlich. Es würde ein spezielles Arzneimittel fehlen, der Arztbrief käme zu spät oder sie würde durch einen plötzlichen Patientenstrom aus der Notaufnahme in ihrem Arbeitsfluss unterbrochen. Mindestens ein Patient hätte ein akutes Problem. Ihr Tagesplan wäre bereits um 9 Uhr Makulatur.
Philin dagegen arbeitet maximal effizient und nutzenorientiert. Ihr Arbeitsalltag beinhaltet nur ein Mindestmaß an (notwendiger) Verschwendung. Alles funktioniert wie geplant. Sie nutzt ihre Zeit maximal für ihre Arbeit an ihren Patienten und für ihre Patienten aus.
Philin rennt nicht die ganze Zeit gegen ein unüberschaubares Maß an Arbeit an. Sie weiß, dass sie alles schaffen wird. Sie kann sich vollkommen auf ihre Patienten konzentrieren und arbeitet ihre anstehenden Aufgaben zügig, aber in Ruhe ab. Sie bereitet ihre Arbeitsgänge sorgfältig vor, ihr unterlaufen keine Fehler und sie verschwendet keine Zeit mit Überflüssigem. Sie schafft nicht nur sämtliche Aufgaben ihrer Schicht, sondern beendet ihre einzelnen Tätigkeiten auch pünktlich. Auf diese Weise schafft sie die Voraussetzung für ihre Kolleginnen und Kollegen, ebenfalls pünktlich ihre Jobs zu erledigen.
Bewerten wir einmal ihren Arbeitstag genauer. Was sind die Zutaten für ihren „perfekten“ Tag?
Vollständige Information
: Sie verfügt über alle relevanten Informationen zu ihren Patienten.
Arbeiten in einem Rutsch
: Sie erledigt ihre Arbeiten ohne Unterbrechungen vom Anfang bis zum Ende.
In Ruhe arbeiten
: Sie arbeitet kontinuierlich, jedoch ruhig, ohne Ablenkung, Hektik oder Stress.
Wissen, was zu tun ist:
Sie kennt exakt die Aufgaben, die bei jedem Patienten auszuführen sind. Sie muss weder nachfragen, noch muss sie Aufgaben später nachholen.
Keine Störungen
: Sie verliert keine Zeit durch Anrufe oder Nachfragen.
Fachkompetenz
: Sie verfügt über die notwendige Expertise und führt die Aufgaben vollständig und routiniert, also geübt, aus.
Arbeitshilfen:
Ihre Arbeitsliste hilft ihr dabei, keine Tätigkeiten zu vergessen.
Kein unnötiger Aufwand
: Sie ist perfekt vorbereitet, ihr Pflegewagen vollständig gefüllt, sie kennt sich mit den Geräten und dem Material aus. Sie muss weder nachfragen noch suchen oder unnötige Wege gehen. Die Übergabe verläuft kurz, knapp und vollständig.
Keine Fehler:
Sie ist kompetent und geübt. Weil sie in Ruhe arbeitet und nicht gestört wird, erledigt sie alle Aufgaben nicht nur vollständig, sondern auch fehlerfrei.
Keine Überlastung:
Die Zeit reicht im Durchschnitt für ihr Patientenklientel und 10 Patienten aus. Geräte und Räume stehen ohne Einschränkungen zur Verfügung.
Zeitliche Orientierung:
Sie weiß, dass z. B. ihre Morgenrunde um 7.00 Uhr zur ärztlichen Übergabe beendet sein muss. Deshalb orientiert sie ihre Geschwindigkeit exakt auf diesen Zeitpunkt hin. Sie bezieht ihr Ziel „7.00 Uhr“ in die Priorisierung ihrer Aufgaben mit ein, was sie akut für wichtig oder unwichtig hält.
Philin benötigt also detaillierte, patientenbezogene Informationen über sämtliche Aufgaben, die sie im Verlauf ihrer Schicht zu erledigen hat, zum Beispiel:
die Anzahl und Art ihrer Patienten,
laufende ärztliche Anordnungen,
geplante Entlassungen und Aufnahmen,
anstehende Patiententransporte,
andere Sonderaufgaben.
Diese Informationen muss die Organisation zeitnah, vollständig und richtig zur Verfügung stellen. Mit diesen Informationen ist Philin in der Lage, einen persönlichen Tagesplan zu erstellen. Dieser verschafft ihr eine klare Orientierung und unterstützt sie darin, richtige (auch zeitliche) Prioritäten zu setzen. Ihr Plan hilft ihr dabei, sich auf jeden ihrer Arbeitsschritte perfekt vorzubereiten − kein Suchen, keine unnötigen Wege und kein sonstiger Mehraufwand.
Während ihrer Arbeitsvorgänge darf sie niemals gestört bzw. unterbrochen werden. Jede Störung kostet sie Zeit und birgt das Risiko, etwas zu vergessen oder falsch zu machen. Jede Störung führt dazu, dass ihr Plan aus dem Ruder gerät. Sie könnte niemals exakt sagen, ob und wann sie eine Aufgabe beenden wird.
Es dürfen keinerlei Engpässe oder sonstige Überlastungssituationen auftreten. Auf Philins Station fehlen weder Arzneimittel noch Material. Räume oder Geräte stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung. Denn jeder Mangel bzw. jeder Engpass würde dazu führen, dass sorgsam installierte Routinen nicht wie geplant ablaufen können. Es entstehen Verzögerungen, Störungen und damit unkalkulierbarer Mehraufwand und prozessuale Unzuverlässigkeit.
Jeder Vorgang läuft absolut effizient ab. Es gibt kein unnötiges Warten oder Suchen, keine unnötigen Wege. Alles ist an seinem Platz. Keine überflüssige oder unnötig komplizierte Dokumentation. Mit anderen Worten: Kein einziger Vorgang zwingt sie zu unnötiger Verschwendung von Zeit oder anderen Ressourcen.
Philin ist auf die perfekte Vorarbeit anderer angewiesen, ohne die sie ihre Aufgaben nicht zuverlässig erledigen kann. Vorarbeiten müssen (von Kolleginnen und Kollegen) vollständig und pünktlich geleistet werden. Das bedeutet: Nicht nur Philins unmittelbares Arbeitsumfeld hat strukturiert und zuverlässig zu agieren, sondern die gesamte Organisation – jede Organisationseinheit, jeder Prozess und jeder Mitarbeitende. Das System muss als Ganzes einen hohen Zuverlässigkeitsgrad aufweisen, damit Philin ihre eigenen Aufgaben perfekt und in einem Rutsch erledigen kann.
Philins Tagesplan mag Ihnen sehr detailliert erscheinen. Doch zeigt er deutlich die Genauigkeit, die in einer komplexen Organisation notwendig wird, um der Abhängigkeit und der wechselseitigen Verzahnung von Vorgängen Rechnung zu tragen. Wir werden später einen präziseren Blick auf diese Abhängigkeiten und deren Wirkungen werfen. Sie werden feststellen, dass organisatorische Details am Ende über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Eine solche Organisationspräzision setzt allerdings Verlässlichkeit voraus. Stabile Prozesse schaffen bedeutet, so genau wie möglich und nötig zu definieren, wer was wann wo und womit zu erledigen hat. Es werden verbindliche Regeln aufgestellt und Standards gesetzt – und eingehalten.
Jede stabilitätsorientierte Prozessorganisation ist darauf angewiesen, solche Regeln und Standards zu formulieren und ihre Einhaltung zu 100 Prozent sicherzustellen. Nur auf diese Weise etablieren sich sichere Routinen und stabile Abläufe über den kompletten Behandlungsprozess hinweg. Sie sichern ab, dass sich an jedem Punkt der Prozesskette genau zum richtigen Zeitpunkt exakt der Zustand einstellt, der sich einstellen soll.
Der Grundgedanke eines Lean Hospitals besteht darin, transparente, stabile, verlässliche und fehlerfreie Prozesse herzustellen und im betrieblichen Alltag sicherzustellen. Wir wollen gewährleisten, dass alle Mitarbeitenden jederzeit so entspannt, ruhig und perfekt arbeiten können wie die Protagonistin in unserem Beispiel.
Genauigkeit im Prozess führt dazu, dass die Individualität des Einzelnen zugunsten des Ganzen gezielt eingeschränkt wird. Denn im Lean Hospital besteht die zwingende Notwendigkeit, dass man möglichst präzise definiert, wie Prozesse und Arbeitsaufgaben auszuführen sind. So muss in unserem Beispiel definiert werden, wann genau der Arztbrief dieses einen Patienten fertiggestellt sein soll, damit er pünktlich entlassen werden kann. Bliebe die (letztmögliche) Uhrzeit dagegen unpräzise oder beliebig, hätte Philin keine andere Wahl, als ihren Patienten irgendwann oder ohne Briefzu entlassen. Ohne ein verlässliches Zeitziel könnte sie sich auf nichts Konkretes einstellen oder sie würde einen Prozessmangel in Kauf nehmen, wenn der Patient ohne Arztbrief das Haus verlässt. Die Nachsendung des Arztbriefes würde außerdem zusätzliche Verschwendung auslösen.
An diesem Sachverhalt erkennt man, wie wichtig es in Zukunft sein wird, zwei Brillen aufzusetzen. Der eine Blick richtet sich darauf, jede einzelne Tätigkeit geplant, strukturiert, verschwendungs-, störungs- und überlastungsfrei ausführen zu können. Philin führt jede ihrer Aufgaben maximal genau und pünktlich aus.
Der zweite Blick richtet sich auf den Gesamtprozess. In der wechselseitigen Abhängigkeit von Arbeitsschritten ist Stabilität alles entscheidend. Jeder Arbeitsschritt muss perfekt und pünktlich erledigt werden, damit der nachfolgende abhängige Arbeitsschritt präzise und pünktlich erledigt werden kann.
Mit jeder Instabilität setzen wir eine Kette ungewollter Effekte in Gang. Wir produzieren Dominoeffekte, zusätzliche Verschwendung, neue Risiken und ungewollte Qualitätsdefizite. Wir verlieren Zeit und Geld. Wir produzieren Hektik und Chaos − und damit unattraktive Arbeitsbedingungen, weil Mitarbeitende nicht gerne in Hektik und Chaos arbeiten wollen. Außerdem fehlt ihnen die Zeit, das zu tun, wofür sie ihren Beruf gewählt haben: die Arbeit am, mit und für Patientinnen und Patienten.
30 Prozent vermeidbare Verschwendung treten nicht allein deshalb auf, weil einzelne Vorgänge oder Aufgaben nicht effizient durchgeführt werden. Sie treten auf, weil Krankenhausprozesse hochkomplex sind und weitreichende Kettenreaktionen einsetzen. Ein solches organisatorische Gebilde braucht deshalb nicht nur perfekte Arbeit, sondern auch perfekte Arbeit zum richtigen Zeitpunkt.
Leider betrachten manche Akteure Verschwendung als ein singuläres Phänomen, das sich singulär lösen lässt. Sie identifizieren unnötiges Suchen, Warten, weite Wege und andere Sachverhalte als optimierbare Probleme. Jedoch setzen sie diese Sachverhalte nicht in einen systemischen Kontext. Sie berücksichtigen die wechselseitigen prozessualen Abhängigkeiten nicht. Sie missachten ihre wechselseitigen Wirkungen: Verschwendung führt zu Instabilität, Instabilität schafft Verschwendung.