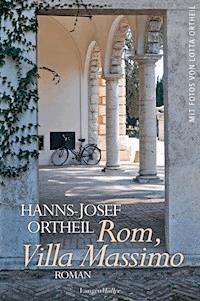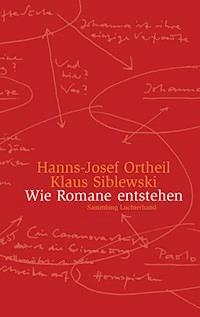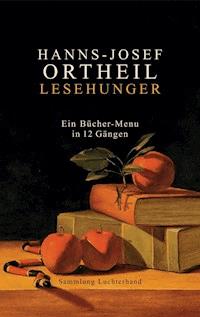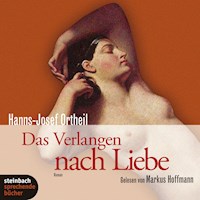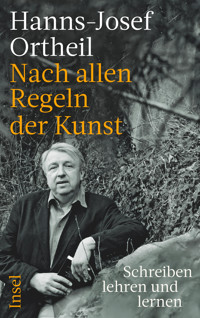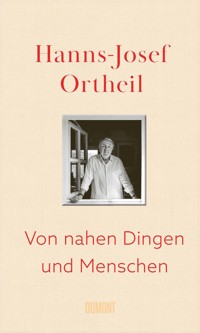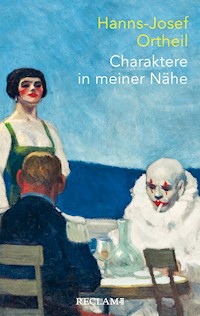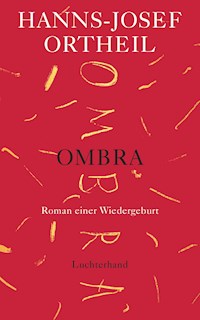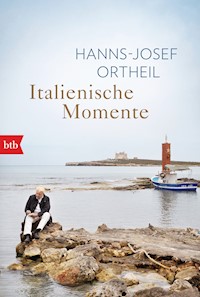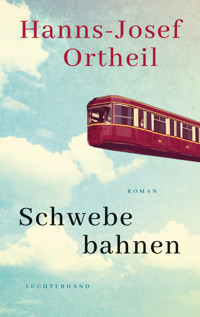
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einer Kindheit in Wuppertal: das berührende Panorama einer Gesellschaft nach dem Krieg
Ende der fünfziger Jahre zieht der sechsjährige Josef mit den Eltern von Köln nach Wuppertal in ein Haus voller Eisenbahnerfamilien. Er ist ein stark introvertierter Einzelgänger, der am liebsten nur Klavier spielen würde. Die Schule in Köln musste er abbrechen, in der neuen Heimat nimmt er einen zweiten Anlauf. Als er Mücke, die Tochter des Gemüsehändlers von gegenüber, kennenlernt, entwickelt sich zwischen den beiden Kindern eine enge Freundschaft, die ihm hilft, seine Hemmungen zu überwinden. Allmählich öffnet er sich auch anderen Menschen, wie etwa den Patres des Kreuzherrenordens, die ihm lautes Vorlesen und Singen beibringen, oder einem Jugendtrainer, der ihn im Langlauf trainiert. Den stärksten Halt aber gibt ihm das Aufschreiben von Geschichten, über Schwebebahnflüge entlang der Wupper, Expeditionen mit skurrilen Tieren im Zoo oder abenteuerlichen Kämpfen mit Jugendbanden in einem nahen Waldgebiet.
Berührend intensiv erzählt Hanns-Josef Ortheil vom inneren und äußeren Wiederaufbau im westlichen Nachkriegsdeutschland. "Schwebebahnen" ist die Geschichte eines anfänglich autistischen Jungen, der seine eigenen, von Musik getragenen Fantasiewelten entdeckt. Zugleich ist er das große Panorama einer zutiefst traumatisierten Gesellschaft, in der die Menschen ein stilles und vom zweiten Weltkrieg gezeichnetes Leben führen und angesichts eines wiederum drohenden Krieges noch immer angstvoll agieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Ende der fünfziger Jahre zieht der sechsjährige Josef mit den Eltern von Köln nach Wuppertal in ein Haus voller Eisenbahnerfamilien. Er ist ein stark introvertierter Einzelgänger, der am liebsten nur Klavier spielen würde. Die Schule in Köln musste er abbrechen, in der neuen Heimat nimmt er einen zweiten Anlauf. Als er Mücke, die Tochter des Gemüsehändlers von gegenüber, kennenlernt, entwickelt sich zwischen den beiden Kindern eine enge Freundschaft, die ihm hilft, seine Hemmungen zu überwinden. Allmählich öffnet er sich auch anderen Menschen, wie etwa den Patres des Kreuzherrenordens, die ihm lautes Vorlesen und Singen beibringen, oder einem Jugendtrainer, der ihn im Langlauf trainiert. Den stärksten Halt aber gibt ihm das Aufschreiben von Geschichten, über Schwebebahnflüge entlang der Wupper, Expeditionen mit skurrilen Tieren im Zoo oder abenteuerlichen Kämpfen mit Jugendbanden in einem nahen Waldgebiet.
Berührend intensiv erzählt Hanns-Josef Ortheil vom inneren und äußeren Wiederaufbau im westlichen Nachkriegsdeutschland. »Schwebebahnen« ist die Geschichte eines anfänglich autistischen Jungen, der seine eigenen, von Musik getragenen Fantasiewelten entdeckt. Zugleich ist es das große Panorama einer zutiefst traumatisierten Gesellschaft, in der die Menschen ein stilles und vom zweiten Weltkrieg gezeichnetes Leben führen und angesichts eines wiederum drohenden Krieges noch immer angstvoll agieren.
Zum Autor
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Hanns-Josef Ortheil
Schwebebahnen
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
unter Verwendung einer Illustration von © Ruth Botzenhardt
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31999-1V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
In Erinnerung an Gabriele Franz (1953 – 2020)
Einleben
Der Aufbruch
Es ist kurz vor zwölf, die Männer der Umzugsfirma haben die Möbel seit den frühen Morgenstunden nach unten getragen und im Möbelwagen verstaut. Zwei werden mit einem kleineren Auto vorausfahren, er darf mit der Mutter im Fahrerhaus des großen Wagens nachkommen. Links der schwergewichtige Fahrer, er in der Mitte, rechts die Mutter.
Der Fahrer nennt ihn »den kleinen Mann«. Der kleine Mann muss Abschied nehmen. Die ersten Jahre hat er in Köln gewohnt, jetzt geht es mit Mutter und Vater nach Wuppertal. Er war noch nie dort und weiß nicht, was ihn erwartet. Vater hat gesagt: »Wir wohnen im dritten Stock. Alle Mietparteien sind Eisenbahner.«
In Köln haben sie im ersten Stock gewohnt, und die Mietparteien waren »liebe Menschen«, wie Mutter sie nannte. Das Haus gehört einem guten Freund, der auch noch weitere Häuser in der Umgebung geerbt hat und von den Mieteinkünften lebt. Im Kreis der Familie wird er Onkel Ludwig genannt.
Im Hinterhof ist vor kurzem zum Glück noch eine kleine Werkstatt frei geworden. In den beiden Räumen, zu denen auch ein Bad und eine winzige Küche gehören, haben die Eltern einige Möbel untergebracht. An den Wochenenden oder wann immer es ihnen gefällt, können sie aus Wuppertal wieder zurück nach Köln fahren und im Hinterhof übernachten, als wären sie nie ausgezogen.
Diese Sicherheit beruhigt nicht nur die Eltern, sondern auch den kleinen Mann, der dadurch nicht das Gefühl hat, sich von den »lieben Menschen« für immer trennen und ab sofort nur noch unter lauter Eisenbahnern leben zu müssen. Was tun Eisenbahner? Sind es Lokführer oder Männer, die auf den Bahnsteigen der Bahnhöfe stehen und die Züge abfahren lassen, oder sind es Gleisarbeiter, die Weichen reparieren?
Er wartet und horcht, die Möbelpacker rufen sich etwas zu, doch er versteht es nicht. Je lauter sie rufen, desto lieber würde er sich verstecken. Jetzt im Keller oder in den Sträuchern am Rande des großen Platzes. Niemand würde ihn finden, er würde sich ins Dunkel oder auf die Erde legen und warten, bis es wieder still ist.
Er macht das oft, wenn er nicht weiterweiß: sich in einem Versteck auf den Rücken legen und hoffen, dass niemand ihn bemerkt. »Nach mir die Sintflut« denkt er dann und weiß, was die Mutter damit meint: Dass einem alles egal ist und auch egal, was die anderen von einem denken.
Er möchte für immer in Köln bleiben. »Wup-per-tal« ist ein fremdes Wort, das u ist dunkel, und die beiden p wollen es wegblasen, schaffen es aber nicht. Die Heckenrosen auf dem großen Platz zeigen sich in blassen rötlichen Farben. Wenn er ihnen zuhört, flüstern sie »Wuppertal wun-der-bar«, sie wollen ihn beruhigen oder verwirren, eins von beidem. »Wup-per-tal« bringen sie flott über die Lippen und sind stolz darauf, noch ein zweites »wu« in ihrem Sätzchen untergebracht zu haben. Sollen sie ruhig flüstern, er fällt nicht darauf herein.
Vor einem Jahr hat man ihn getestet und festgestellt, dass er ein »absolutes Gehör« besitzt. »Na sowas«, hat der Vater gesagt, »woher hat er das?« Und der Tester, der ein Klavierstimmer war, meinte: »Das ist ein großes Geschenk vom lieben Gott, aber auch eine Bürde.« Warum Bürde? fragte er sich, aber eine einleuchtende Antwort fiel ihm nicht ein.
Laut nachfragen – das tut er nicht. Er unterhält sich nicht gern, er ist ein stilles Kind, das zurückgezogen lebt, wie die Mutter anderen Erwachsenen manchmal erklärt. »Zurückgezogen leben« ist eine milde Version der Tatsache, dass er in sich gekehrt lebt. »Er spielt lieber Klavier, anstatt viel zu reden«, sagt der Vater. Das stimmt, er spielt lieber Klavier, nein, er spielt am liebsten Klavier! Er ist jetzt sechs Jahre alt, bald wird er sieben, seit drei Jahren spielt er Klavier, und das gar nicht so schlecht.
Weil er jeden Tag übt, morgens und nachmittags, insgesamt etwa vier Stunden, hat er nur wenig Zeit, sich lange zu unterhalten. Er wüsste auch nicht worüber, andere Jungs haben Themen, von denen er wenig oder nichts versteht. Das ist schade, aber nicht schlimm. Er unterhält sich mit sich selbst, das tut er leise und heimlich, aber auch mit dem Stift und auf Papier. Während der Ferien und der Aufenthalte im Westerwald, wo sich die Eltern gerade ein kleines, abgelegenes Ferienhäuschen mitten im Wald gebaut haben, hat ihm der Vater vor kurzem das Schreiben beigebracht.
Er schreibt gerne, fast so gerne wie er Klavier spielt. Beim Schreiben ordnen sich die Gedanken und machen im Kopf sogar etwas Musik. Sie erscheinen wie lebendige Wesen, die anklopfen, auftreten und freundlich wieder verschwinden. Manchmal liest er seine kurzen Geschichten dem Vater vor, der sich darüber freut. »Woher hat er das?« fragt der Vater und kann sich wirklich nicht erklären, woher der kleine Mann seine Ideen und Gedanken bezieht. »Die sind ein großes Geschenk, aber auch eine Bürde«, hat der Herr Pfarrer gesagt, dem der Vater einmal eine Seite gezeigt hat.
Die Eltern sind katholisch und gehen einmal in der Woche, fast immer am Sonntag, in die heilige Messe. Die Mutter betet, der Vater singt laut, und er selbst hat nichts zu tun und weiß auch nicht, was er tun sollte. Beten hat er nicht gelernt, singen erst recht nicht, auch in der heiligen Messe ist er ein stummer Mitmacher, der bald zur heiligen Kommunion gehen soll. Vielleicht ändert sich dann etwas, und er bekommt eine Ahnung, wie man betet und singt.
Das Tripelding
Der schwergewichtige Fahrer zündet sich eine Zigarette an und sagt: »Na, dann legen wir mal los!« Die Mutter mag nicht, wenn geraucht wird, sagt aber nichts. Und auch er, der kleine Mann, sagt nichts, schließlich ist er nur ein kleiner Mann und kein Mannsbild mit einem orkanartigen Vorbauch wie der schwergewichtige Fahrer. »Freust Du Dich auf Wuppertal?« fragt der ihn, aber er antwortet nicht. Den Kopf könnte er schütteln, doch er lässt das lieber, er schweigt und schaut starr geradeaus auf die Fahrbahn.
»Ist was, hat der Junge was?« fragt der Fahrer die Mutter, und sie antwortet: »Nein, er braucht nur länger als andere Kinder, um etwas zu verarbeiten.« – »Was verarbeitet er denn?« fragt der Fahrer, und die Mutter sagt: »Den Umzug! In Wuppertal ist alles neu für ihn.« – »Du brauchst keine Angst zu haben«, sagt der Fahrer, »Wuppertal ist eine solide Stadt, ehrlich und fleißig, Du wirst schon sehen. Ich bin da geboren, du kannst mir glauben.« Dann dreht er das Autoradio hoch und hört Schlager. Manche singt er leise mit.
Die Mutter mag keine Schlager, aber sie braucht einige Zeit, bis sie sagt: »Könnten Sie bitte die Musik abstellen?« Der Fahrer schaut sie von der Seite kurz an und antwortet: »Mache ich, ganz zu Diensten!« Man merkt, dass er genervt ist, niemand unterhält sich mit ihm, und seine Musik mögen die beiden neben ihm auch nicht. »Welche Musik hören Sie denn so?« fragt er nach. – »Mutter mag klassische Musik«, sagt der kleine Mann da plötzlich hinein in die Stille, und der Fahrer lacht kurz auf. »Klassische Musik! Beethoven oder was?« – »Im WDR läuft jetzt die Mittagsklassik«, sagt die Mutter, und der Fahrer sucht im Autoradio nach dem Programm.
Schließlich findet er Klassik, er bemerkt es anscheinend sofort, denn er atmet tief durch, stöhnt auf und sagt: »Klassik! Ganz zu Diensten!« In der Mittagsklassik läuft das Tripelkonzert von Beethoven. Cello, Violine, Klavier und Orchester. »Was ist das für ein Stück?« fragt der Fahrer. – »Es ist das Tripelkonzert in C-Dur, opus 56, von Ludwig van Beethoven«, sagt der kleine Mann und ist erstaunt, wie er so einen langen Satz, ohne zu stottern, hinbekommen hat.
Der Fahrer schaut ihn von der Seite an und fragt: »Spielst Du ein Instrument, kleiner Mann?« – »Ja«, antwortet der Junge, »ich spiele Klavier.« – »Donnerwetter«, sagt der Fahrer und zündet sich die nächste Zigarette an, »ich spiele kein Instrument, aber mit dem Akkordeon habe ich es früher mal versucht. Durchgehalten habe ich nicht, nach ein paar Monaten habe ich aufgegeben.« – »Ich gebe nicht auf«, sagt der kleine Mann, und der Fahrer sagt eine Weile nichts, hört auf die Musik und sagt schließlich: »Bravo! Niemals aufgeben! Fleißig sein und nicht aufgeben, dann bringst Du es in Wuppertal zu etwas!«
Der kleine Mann weiß nicht, zu was er es bringen soll. Er will gut Klavier spielen, mehr nicht. Wenn er weiter so übt wie bisher, sollte das klappen. Niemand braucht ihn anzufeuern, das mag er nicht. Beim Sport feuert man an, Klavierspielen ist aber kein Sport, sondern eine Beschäftigung.
In Wuppertal wird er bald eingeschult und die Grundschule besuchen. In Köln hat das nicht geklappt, er machte nicht mit, nicht im Unterricht und nicht auf dem Pausenhof. Kaum Kontakte mit anderen Kindern, keine Aufmerksamkeit im Unterricht, er galt als hoffnungsloser Fall. Die Schulbehörde hat ihn ausgemustert und erklärt, er sei zu früh eingeschult worden. Zu früh für sein Alter, ein Jahr später würde er es leichter haben. Nicht in Köln, sondern in Wuppertal, wohin der Vater sich hat versetzen lassen, damit die Schule noch einmal von vorn beginnt. Deshalb hat er dem Jungen das Schreiben beigebracht, das sollte er nun beherrschen, er wird im Unterricht der ersten Klasse nicht mehr zurück, sondern sogar etwas voraus sein, was Lesen und Schreiben betrifft.
Wir befinden uns in den späten fünfziger Jahren, Konrad Adenauer hat gerade die Bundestagswahlen mit absoluter Mehrheit gewonnen, und in Köln gibt es noch immer viele Ruinen. Der Zweite Weltkrieg ist nicht richtig vorbei, das Leben der Eltern ist von Kriegserlebnissen gezeichnet, aber sie sprechen mit niemandem darüber. Wuppertal ist die zweite Chance für den Jungen, das führt die Familie dorthin.
Als der zweite Satz des Tripelkonzerts im Autoradio läuft, packt die Mutter den Jungen mit ihrer linken Hand plötzlich an seiner kleinen rechten. Sie hält ihn fest, und die Musik schlägt über ihnen zusammen, nimmt sie mit und dringt tief in sie ein. »Ist was?« fragt der schwergewichtige Fahrer, und die Mutter sagt: »Nein, es ist nichts, hören wir doch einfach mal zu!«
Das Cello geht einige langsame Schritte spazieren und atmet aus, dann gesellt sich das Klavier hinzu und umkreist es von allen Seiten, danach meldet sich die Violine und stimmt mit ein. Es ist still geworden, der Motor des großen Wagens ist kaum noch zu hören, Cello, Klavier und Violine sind als Trio unterwegs, und das Orchester steht an den Straßenrändern und staunt und summt manchmal etwas mit.
Der kleine Mann spürt, wie gerührt die Mutter ist. Sie lässt seine Hand wieder los und krallt die linke etwas zusammen, als hätte sie ein heftiger Stich getroffen. Die Mutter kennt dieses Konzert gut, sie hat ihm den zweiten Satz schon einmal vorgespielt, bald wird er ihn auch üben und spielen.
Der Fahrer schweigt und hört zu. Als der zweite Satz zu Ende ist, fragt er: »Spielst du das auch? Oder ist das Tripelding noch zu schwer?« – »Nein«, sagt die Mutter, »es ist nicht schwer. Aber hören wir jetzt noch den dritten Satz!«
Die Fahrt nach Wuppertal dauert fast eine Stunde, sie führt über den Rhein und an Leverkusen vorbei, dann kommt Remscheid und schließlich Wuppertal. Der Fahrer fährt langsam und nennt manchmal die Namen der Ortschaften zu beiden Seiten der Straße. Der kleine Mann hat sie noch nie gehört. Ihm kommt es so vor, als führen sie in ein ganz anderes Land. Es heißt »Das Bergische«, so nennt es der Fahrer mehrmals, und es besteht aus vielen Hügeln und dunklen Schluchten.
Die Ankunft
Am Mittag kommen sie in Wuppertal an. Vor dem Mietshaus stehen einige Menschen, als bildeten sie ein Begrüßungskomitee. Ein Mann in mittlerem Alter kommt auf sie zu und stellt sich als Hausmeister vor. Die Männer von der Umzugsfirma sind jetzt vollständig und besprechen das weitere Vorgehen. Der Fahrer geht mit der Mutter in den dritten Stock, wo die Mutter erklären soll, welche Möbel in welches Zimmer gehören.
Der kleine Mann ist dabei. Im Treppenhaus stehen einige Mieter und unterhalten sich. Sie sind neugierig darauf, etwas von den neuen Mietern zu erfahren. Sie kommen also aus Köln? Und Sie sind auch »Eisenbahner«? »Ja, sind wir, mein Mann ist Geodät und arbeitet für die Bahn«, sagt die Mutter. Ah, ein Geodät! Haben wir noch nie von gehört! Was ist ein Geodät? – Ein Geodät ist ein Vermessungsingenieur!
Ein Mieter trägt eine rote Mütze und hat eine Signalpfeife dabei. Er ist gut drauf und für Späße zu haben. »Mein Name ist Rudel«, sagt er und lässt einen schrillen Signalton hören. »Am Nachmittag stehe ich auf dem Bahnsteig und lasse die Züge abfahren.« Die Mutter gibt ihm die Hand und bittet den kleinen Mann, ihm ebenfalls die Hand zu geben. »Willst Du mich mal auf dem Bahnsteig besuchen?« fragt Herr Rudel, und der kleine Mann antwortet: »Vielleicht. Heute aber noch nicht.«
Im dritten Stock angekommen, holt die Mutter ein Blatt aus ihrer Tasche und erklärt dem Fahrer anhand einer Zeichnung den Lageplan der Zimmer. Es gibt einen schmalen, langgestreckten Flur, von dem aus sie nach beiden Seiten abgehen. Kommt man in die Wohnung, wird es rechts ein Schlafzimmer mit Balkon und ein Bad geben, danach eine kleine Küche und ein Esszimmer. Geht man zuerst nach links, geht man in das Herrenzimmer und danach ins Wohnzimmer. Die Mutter bleibt in der Wohnung und wird sagen, wo die Möbel aufgestellt werden.
»Und wohin kommt das Klavier?« fragt der kleine Mann, und die Mutter sagt: »Das Klavier kommt ins Wohnzimmer, dort hinten ins Eck, da ist es hell genug, und Du kannst ungestört üben.« – »Das Klavier kommt zuletzt dran«, sagt der Fahrer, »erst die anderen Möbel, dann das Klavier!«
Der Fahrer verschwindet wieder, und die Mutter ist mit dem kleinen Mann für eine Weile allein. Sie stehen an einem Fenster und schauen herab auf die Straße, wo die Möbelpacker sich besprechen. Eine Straßenbahn kommt vorbei, und die Mutter sagt: »Die Bahn kommt aus der Stadt, wir können damit hochfahren, wenn wir unten in der Stadt eingekauft haben.«
Auf der anderen Seite der Wohnung gibt es einen schmalen Balkon. Auch von dort schaut man auf die Stadt und ihre Häuser im Tal. »Schau«, sagt die Mutter, »dort unten, das ist Wuppertal. Da wirst Du zur Schule gehen, hinab ins Tal und nach dem Unterricht wieder herauf! Freust Du Dich?« – »Nein«, sagt der kleine Mann und schweigt. In Köln gab es keine Hügel, die man hinab- und heraufgehen musste, in Köln war alles viel einfacher. Man konnte sogar mühelos Fahrrad fahren, das wird in Wuppertal schwerfallen.
Er steht nicht länger neben der Mutter, er will nicht, er möchte allein sein. Langsam schleicht er durch die leeren Zimmer, Herr Rudel bläst noch immer in seine Signalpfeife, und im Treppenhaus stehen jetzt viele Mieter herum, die das komisch finden. Der kleine Mann findet das Pfeifen nicht komisch, sondern doof, das hätte er am liebsten gesagt, aber so etwas tut er nicht, es könnte Herrn Rudel verärgern.
Im Wohnzimmer, dort, wo später sein Klavier stehen soll, legt er sich auf den Rücken und starrt gegen die Decke. Wie wird es sich anhören, wenn er hier spielt? Herr Rudel wird seine Pfeife bedienen, weil ihn Klaviermusik stört, und die anderen Mieter werden sagen: »Eine halbe Stunde am Tag kann er üben, aber bitte nur zu den vereinbarten Tageszeiten!« Was macht er dann? Er will mindestens vier Stunden am Tag üben und nicht zu bestimmten Zeiten, sondern dann, wenn er will.
Plötzlich wird ihm kalt, er steht auf, geht wieder ans Fenster und sieht, wie sich die nächste Straßenbahn den steilen Hang heraufquält. Im Haus gegenüber steht ein junges Mädchen im Fenster und winkt ihm zu. Was soll das? Warum winkt sie? Er mag nicht winken, noch nie hat ein anderes Kind ihm zugewinkt, er findet Winken albern, schließlich kennen sie sich nicht. Das kleine Mädchen trägt ein hellgelbes Kleid und hat die blonden Haare mit einer roten Schleife zusammengebunden.
Das Winken irritiert ihn, er weiß nichts damit anzufangen. Rasch setzt er sich hin und legt sich wieder auf den Rücken. Wer ist das Mädchen? Ist sein Vater auch ein Eisenbahner, oder wohnen im Haus gegenüber Menschen, die etwas ganz anderes tun als in Signalpfeifen zu blasen oder Waggons miteinander zu verkuppeln?
Wenn er die Augen schließt, sieht er sich auf einem Bahnsteig ankommen. Herr Rudel gibt ihm die Hand und hebt eine Kelle, aber es ist kein Zug zu sehen. »Abfahren!« ruft Herr Rudel, und es passiert nichts, denn am Bahnsteig wartet kein Zug. »Der Zug nach Opladen kommt in sechs Minuten!« sagt Herr Rudel, und der kleine Mann merkt sich ein neues Wort: »Opladen«, das passt zu »Wuppertal«, auch im Wort »Opladen« scheppert ein »p«.
Wie schade, dass das Klavier als Letztes heraufgetragen wird! Er würde jetzt gern Klavier spielen, das brächte Herrn Rudel zum Schweigen. Er zieht sich am Fenstersims langsam in die Höhe und äugt hinüber. Das kleine Mädchen steht noch immer im Fenster, aber es winkt nicht mehr. Es schaut ihn ruhig an, mit leicht geöffnetem Mund schaut es, was er als Nächstes tun wird. Da gibt er sich einen Ruck und winkt. Er winkt, als stünde er auf dem Bahnsteig und ließe den Zug nach Opladen abfahren. Er gibt ihm noch einen letzten Schubs mit seinem Winken, dann rollt er los. Das kleine Mädchen muss lachen, das gefällt ihm. Er lacht auch, aber nur ein wenig, zum ersten Mal gibt es in Wuppertal etwas zu lachen.
Mücke
Mutter beschäftigt sich mit den Umzugskisten, die in die Wohnung getragen und dort in hohen Stapeln an den Wänden gelagert werden. Sie öffnet einige und schaut kurz hinein, der kleine Mann spürt, dass er sie jetzt nicht ansprechen darf. Oft ist das so: Mutter ist nicht ansprechbar.
Vater sagt dann: »Mutter geht ihren Gedanken nach, wir sollten sie nicht stören.« Welchen Gedanken die Mutter nachgeht, würde der kleine Mann gerne wissen, aber er fragt nicht. Bestimmt sind es Gedanken, von denen er nichts versteht. Er stellt sich vor, dass es lange, verknotete Schnüre sind, die Mutter Knoten für Knoten auflöst und zu einem glatten Strang bürstet.
Nach und nach werden die Möbel in die Zimmer geschoben und stehen dann wie stumm gewordene, dumpfe Wesen traurig herum. Im Herrenzimmer hat sich der schwere Schreibtisch des Vaters breitgemacht, eine Schreibunterlage und das Schreibzeug stehen auf seiner staubig gewordenen Platte. Daneben wartet ein Ledersessel, in dem der Vater beim Lesen gerne sitzt. Eine Leselampe mit rundem Lampenschirm schaut dem Sessel über die Schulter. Der kleine Mann nimmt im Sessel Platz und schwingt ein Bein über das andere. Er stellt sich vor, dass ein Besuch eingetroffen ist, der mit ihm über wichtige Dinge sprechen will. Was aber könnte das sein?
Wichtig ist die Schule, in die er bald gehen soll. Wichtig ist auch der Klavierunterricht, den er erhalten wird. Früher hat ihn nur die Mutter unterrichtet, aber in Wuppertal soll noch ein Lehrer den Unterricht mit übernehmen, der viele Bücher geschrieben hat. Über Bach, Beethoven, Mozart, »kluge Bücher« hat der Vater sie genannt, obwohl er nur wenig von Musik versteht. Was mag wohl in solchen Musikbüchern drinstehen? Wie Mozart Klavier oder Geige geübt hat? Welche Instrumente er außerdem noch spielte? Wie Beethoven in der Natur unterwegs war und dem Gewitter Musik abgelauscht hat?
Vater hat einmal gesagt, Beethoven habe alle Musik dem Leben um ihn herum »abgelauscht«, aus den verschiedensten Geräuschen habe er Musik gemacht. Aus einem auf dem Boden herumrollenden Groschen, aus einem Spaziergang durch Täler und Höhen, aus einem Sturm – Beethoven habe sehr genau hingehört, solange er noch habe hören können. Später sei er taub geworden, habe aber davor genug Klänge und Töne im Kopf gesammelt, so dass er daraus weiter habe Musik machen können.
Der kleine Mann beschäftigt sich oft mit der Frage, ob auch er dem Leben Musik ablauschen kann. Seit ihm gesagt worden ist, dass er ein »absolutes Gehör« hat, denkt er daran. Er hat es versucht, indem er nach bestimmten Geräuschen horchte und auf dem Klavier Töne anschlug, die solche Geräusche nachmachten. Eine singende Amsel hat er in Musik verwandelt, einen Spazierstock, der auf dem Gehweg tacktack macht, auch. Dann aber hat die Mutter ihn gebeten, nicht weiter zu »klimpern«. »Klimpere nie!« hat der Komponist Robert Schumann den Kindern gesagt, die auf dem Klavier Töne anschlagen, aber keine richtigen Stücke üben und spielen. »Klimpere nie!« sagt die Mutter auch häufig. Das ist schade, denn ohne das Klimpern entdeckt der kleine Mann nicht die Melodien und Klänge, die er finden möchte.
Nachdem er mehrmals durch die Zimmer geschlichen ist, die sich allmählich mit Möbeln und Umzugskisten füllen, weiß er nicht weiter. Es gibt für ihn nichts zu tun, die Mutter ist sehr beschäftigt, und der Vater kommt erst später, um ihr beim Einrichten der Zimmer zu helfen. »Wann kommt das Klavier denn endlich?« fragt der kleine Mann die Mutter. Die schaut aber nur kurz auf und antwortet: »Lauf doch mal runter und schau nach! Aber sei höflich und freundlich zu den Mietern!«
Er verlässt die Wohnung und steht im Treppenhaus. Ein schmales Geländer aus Holz führt nach unten, er setzt sich drauf und rutscht von Etage zu Etage. Die meisten Mieter sind inzwischen verschwunden, aber im ersten Stock steht noch ein älteres Ehepaar, schaut ihn an, und der Mann sagt: »Das sehen wir hier gar nicht gern. Das Geländer ist nicht zum Rutschen da!« – »Entschuldigung«, antwortet der kleine Mann, »das wusste ich nicht. Ich mache es nicht wieder!« – »Ein guter Junge!« sagt der ältere Mann daraufhin zu seiner Frau, während die beiden ihre gefüllten Einkaufstaschen vor ihrer Wohnungstür abstellen.
Der Möbelwagen ist schon fast leer, das Klavier ist aber noch drin, ganz hinten, im Dunkel. Da steht plötzlich das kleine Mädchen vor ihm, das ihm von ihrem Fenster aus zugewinkt hat. »Ich bin die Mücke, und wer bist Du?« fragt das Mädchen, und der kleine Mann antwortet: »Ich heiße Josef und komme aus Köln.« – »Wollen wir etwas spielen?« fragt das Mädchen, und Josef sagt: »Was denn? Und wo?«
Das Mädchen gibt ihm ein Zeichen, er soll ihr folgen, es geht hinab in den Keller und durch die Waschküche hinaus in einen kleinen Hof. Dort hängt Wäsche zum Trocknen, und dahinter recken sich vier stramme, grüne Pappeln hintereinander in die Höhe und schauen ins Wuppertal. Am Rand des Hofes sperrt ein Lattenzaun den Zugang zu kleinen Beeten ab, in denen Gemüse wächst. Vor den Beeten liegt in einem Sandkasten ein Springseil. Spielen in diesem Hof Kinder? Es sieht nicht danach aus, aber das kleine Mädchen geht zur Wäscheleine, nimmt die Wäschestücke ab und geht mit ihnen in die Waschküche, wo sie in einen Korb wandern. Dann kommt es mit einem Federball und zwei Schlägern zurück.
»Magst Du Federball spielen?« fragt sie Josef, und er schaut auf die Schläger, zuckt mit den Schultern und antwortet: »Ich habe es noch nie gespielt.« – »Was hast Du in Köln denn gespielt?« – »Klavier! Ich habe Klavier gespielt.« – »Du kannst Klavier spielen?« – »Ich spiele Klavier seit drei Jahren.« – »Ihr habt ein richtiges Klavier?« – »Ja, es steht noch im Möbelwagen, ich warte darauf, dass es hochgetragen wird. Es kommt zuletzt dran.« – »Wenn es oben angekommen ist, spielst Du mir etwas vor. Machst Du das?« – »Mal sehen, ich weiß es noch nicht.« – »Gut, dann spielen wir erstmal Federball.«
Sie stehen zu beiden Seiten der Wäscheleine, und das kleine Mädchen lässt den Federball fliegen. Er macht ein kurzes, scharfes Geräusch, tanzt etwas im Wind und baumelt zu Boden. »Josef!« – das kleine Mädchen ruft ihm zu, »was ist los? Du sollst nicht schauen, Du sollst den Ball zurückschlagen.« Er bückt sich, hebt ihn auf und schlägt ihn zurück. Das kleine Mädchen reagiert und retourniert den Ball sofort. Diesmal ist das Geräusch anders, er hört einen Pfiff, als hätte der Ball sich beschleunigt. Es geht alles sehr schnell, er ist darauf nicht vorbereitet, und außerdem lenken die Geräusche ihn ab.
»Josef!« ruft das kleine Mädchen ein zweites Mal, »magst Du nicht spielen? Du musst nicht, wenn Du nicht willst.« – »Ich glaube, ich muss mich übergeben«, sagt Josef und bleibt stehen. – »Ist Dir schlecht?« – »Ja, mir ist schlecht. Ich habe zu wenig gegessen.«
Das kleine Mädchen nimmt ihm seinen Schläger ab und verschwindet mit den Spielgeräten wieder in der Waschküche. Dann kommt es mit einem Glas Wasser zurück. »Trink das mal!« sagt sie, »ich hole Dir gleich etwas zu essen.« – »Danke«, sagt er, »wie heißt Du denn richtig?« – »Ich bin die Mücke, und ich heiße auch so. Meine Eltern haben mich Rosa genannt. Furchtbar, nicht wahr? Vergiss den Namen gleich wieder, ich mag ihn nicht, niemand soll mich so nennen. Ich bin die Mücke.« – »Sind Deine Eltern auch Eisenbahner?« fragt Josef, und Mücke antwortet: »Nein, sind sie nicht. Meine Eltern haben ein Lebensmittelgeschäft, gleich gegenüber. Ich helfe ihnen, mein Vater ist nicht ganz gesund. Setz Dich erstmal hin. Ich komme wieder, ich bringe belegte Panini, danach geht es Dir besser und Du spielst mir was vor. Auf Deinem Klavier!«
Er schaut sie an. Meint sie das alles ernst? Sie heißt »Mücke«? Wirklich? Das kleine Mädchen dreht sich rasch um und verschwindet. Es steigt über den Lattenzaun, läuft ein paar Schritte die Straße entlang und ist nicht mehr zu sehen.
Fußballer
Er sitzt auf der Umrandung des kleinen Sandkastens, der Wind wühlt in den nahen Pappeln und fährt ihnen durch ihre zotteligen Blätter. Jede Wohnung hat einen Balkon zum Hof, manche Türen stehen weit offen, und man hört von drinnen Musik. Seit er in Wuppertal angekommen ist, ist er sehr aufgeregt. Er weiß nicht, wohin er mit den Eltern gehört. Zu den anderen Mietern hier auf der Höhe oder zu den Menschen unten im Tal? Oder gibt es noch andere Räume, wohin sie gehören? Spielplätze? Schwimmbäder?
Als Mücke wieder erscheint, hat sie einen Teller mit belegten Brötchen dabei. Ringsum liegen Paraden von Radieschen. »Magst Du Radieschen?« fragt sie, und er nickt. »Mittags gibt es in unserem Laden auch warmes Essen. Wenn du hingehst, bekommst Du Gemüsesuppe oder Lasagne. Meine Mutter stammt aus Sizilien, sie hat meinen Vater hier kennengelernt, unten in der Stadt, auf dem Markt, beim Einkaufen.« – »Hast Du Geschwister?« – »Nein, habe ich nicht. Hast Du welche?« – »Nein, auch nicht.« – »Dann passen wir gut zusammen, findest Du nicht auch?« – »Ja, finde ich auch. Andere Jungs gibt es hier nicht?« – »Doch, sogar viele. Am Nachmittag gehen sie zusammen auf den Freudenberg.« – »Was ist das?« – »Das sind zwei große Fußballplätze, auf denen man trainieren kann. Die Jungs machen das fast jeden Tag.« – »Du nicht?« – »Nein, sie wollen unter sich bleiben. Mädchen sollen nicht trainieren, sie verstehen nichts von Fußball, sagen die Jungs.« – »Würdest Du gerne mitspielen?« – »Nein, das ist nichts für mich.« – »Die deutsche Mannschaft ist Weltmeister geworden.« – »Ja, ist sie. Und im Stadion am Zoo spielt ein neuer Verein, da gehe ich manchmal mit meinem Vater hin und schaue zu.« – »Wie heißt der Verein?« – »Wuppertaler SV, die Jungs hier oben tragen beim Trainieren seine rot-blauen Trikots und wollen später einmal Nationalspieler werden. Alle wollen das, sie haben nichts anderes im Kopf.« – »Und was willst Du einmal werden?« – »Weiß ich noch nicht, vielleicht Fliegerin oder Pilotin.«
Die mit Tomatenscheiben belegten Käsebrötchen schmecken ihm, Mücke hat auch eine Flasche Mineralwasser dabei, daraus trinken sie zu zweit. Er freut sich, sie so rasch kennenzulernen, in Köln wäre das nicht passiert, dort galt er als Einzelgänger, der lieber für sich blieb. Aber wo sind bloß die vielen Jungs, von denen Mücke gesprochen hat? Es sind Ferien, da sind sie vielleicht mit ihren Eltern verreist.
Auf dem Balkon des zweiten Stocks steht jedoch plötzlich ein Junge, der in eine Trillerpfeife bläst. Der rollende, scharfe Ton ist weithin zu hören. »Das ist Peter«, sagt Mücke, »er gibt das Signal für den Aufbruch der Jungs zum Training. Gleich werden sie hier im Hof erscheinen und sich auf den Weg machen. Läufst Du mit?« – »Nein, heute nicht, ich warte, bis das Klavier in unsere Wohnung gebracht wurde.« – »Hast Du in Köln viel Fußball gespielt?« – »Nein, ich habe Klavier gespielt.« – »Richtig, hätte ich mir denken können. Du machst keinen Sport?« – »Doch, ich spiele Klavier, das ist Sport, wenn man es richtig macht. Man muss blitzschnell reagieren, und das mit zwei Händen.« – »Ich möchte Klarinette spielen, jemand hat mir eine geschenkt, bald soll ich Unterricht bekommen.«
Das Pfeifen wird lauter, und Peter ruft mehrmals »Leute! Der Freudenberg wartet!« Josef kann sich nicht vorstellen, dass er mit ihnen zusammen zum Training geht. Jetzt nicht, aber auch später nicht. Peter verschwindet vom Balkon, und dann öffnet sich die Tür zur Waschküche, und ein Junge nach dem anderen kommt in den Hof. Jeder trägt ein rot-blaues Trikot, wie Mücke gesagt hat. Und sie feuern sich an, als stünde ein wichtiges Spiel bevor.
Peter kommt auf ihn zu und sagt: »Du bist also der Neue. Aus Köln, stimmt’s?« – »Ja, aus Köln.« – »Hast Du in Köln Fußball gespielt?« – »Nein, es ergab sich nicht. Ich habe was anderes gespielt.« – »Anderes? Was kann denn besser sein als Fußball?« – »Klavier spielen. Oder Geschichten schreiben.« – »Ist das Dein Ernst?« Peter lacht ihn aus, das kennt er schon. Er ist in Köln oft ausgelacht worden, immer wieder, bei kleinsten, dummen Anlässen.
Peter hat einen Ball dabei, er tippt ihn laufend auf den Boden, anscheinend kann er sich nicht mehr gedulden, er will auf den Freudenberg, und das sofort. »Kommst Du mit?« fragt er, und Josef antwortet: »Nein, diesmal nicht.« – »Du spielst lieber Klavier?« – »Ja, ich freue mich drauf.« – »Na denn«, sagt Peter und läuft mit kleinen Trippelschritten voraus, die steile Straße hinter dem Hof hinauf in die Höhe. Die anderen Jungs schließen sofort auf, einige haben auch Bälle dabei. Sie laufen recht schnell, Josef wundert sich, da käme er nicht mit, schnelles Laufen muss er erst trainieren.
Sie sind kaum verschwunden, als der schwergewichtige Möbelpacker in den Hof kommt. »Wir wären so weit«, sagt er, »das Klavier ist jetzt dran.« – »Ich komme sofort«, sagt Josef, und Mücke sagt: »Ich komme mit.« Der Möbelwagen ist bis auf das Klavier vollkommen leer. Einige graue Decken liegen auf dem Boden, und das Klavier macht den Eindruck eines Wesens, das hofiert werden will. Es glänzt vom Polieren am Morgen und leuchtet, als man es aus dem Wagen zieht und über eine Rampe auf den Bürgersteig rollen lässt.
In den geöffneten Fenstern des Hauses stehen jetzt einige neugierige Menschen und beobachten das Schauspiel. Sie sind aber still und kommentieren es nicht. Josef geht langsam voraus und setzt sich im dritten Stock in das Wohnzimmer, genau dahin, wo das Klavier abgestellt werden soll. Mücke geht hinter dem Klavier her, während die Möbelpacker das Klavier mit viel lautem Rufen und Schreien die Stockwerke heraufschleppen. Oben setzt sie sich an eine Wand und schaut zu, wie das Klavier seinen Platz erhält.
Die Mutter kommt aus einem der anderen Zimmer hinzu und fragt: »Wer bist denn Du?« – »Ich bin Mücke, Josefs Freundin.« – Die Mutter tut, als hätte sie das überhört, öffnet den Klavierdeckel und fährt mit einem Staubtuch über die Tasten. »Okay, jetzt leg mal los!« sagt der Möbelpacker. Der kleine Mann setzt sich auf den runden Klavierhocker und schaut aus dem nahen Fenster. Schön ist es hier, etwas heller als in Köln, ja, es ist etwas heller!
Was soll er denn spielen? Und was wollen die anderen hören? Er wird jetzt einfach nur spielen, am besten sofort, ohne lange nachzudenken. Er beugt sich über die Tasten, dann fängt er an und spielt Ah vous dirai je, maman – zwölf kurze Variationen über ein Lied von Wolfgang Amadeus Mozart.
Er hat das Stück schon oft gespielt, er beherrscht es. Die kurzen Läufe der rechten Hand mag er besonders, sie sind wie aufschäumendes Wasser. Die Mutter geht ans Fenster und öffnet es, so dass die Perlen der Klänge ins Freie tanzen. Sie steht ruhig da und schaut hinaus, Josef ahnt, was sie jetzt denkt. Sie denkt Ah vous dirai je, maman.
Cannoli
An den nächsten Tagen sind die Eltern mit der Einrichtung der Wohnung beschäftigt und haben für Josef nur wenig Zeit. Der Vater hat sich ein paar Tage Urlaub genommen und hilft der Mutter. Frühmorgens spielt Josef wieder Klavier, so wie in Köln, vorerst aber nur eine Stunde und eine weitere am Nachmittag, die Nachbarn sollen sich erst langsam daran gewöhnen. Noch haben sie nicht reagiert, aber es ist damit zu rechnen, dass mehrmaliges Üben am Tag sie stört oder sogar verärgert.
Wenn die Stunde vorüber ist, zieht Josef den Vorhang am Fenster zur Seite, das ist ein vereinbartes Zeichen dafür, dass er Zeit hat und mit Mücke etwas unternehmen kann. Sie will ihm ihre Lieblingsplätze in der Umgebung zeigen. Ist sie bereit, winkt sie ihm vom Fenster gegenüber zu, und sie treffen sich unten im Hof.
Die anderen Jungs sind dann schon auf dem Freudenberg, Josef beobachtet manchmal, wie sie sich treffen und die steil ansteigende Straße hinauflaufen. Anscheinend liegt der Freudenberg ganz oben auf der Höhe im Wald, er würde auch gerne mal hin, möchte aber vorerst dort nicht den Jungs begegnen. Er weiß, dass er nicht gut genug Fußball spielt, er muss erst trainieren, aber nicht mit den Jungs, sie würden ihn auslachen, da ist er sicher.
Als Erstes hat Mücke ihm das Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern gezeigt. Mückes Vater humpelt ein wenig, er hat im Krieg ein Bein verloren und geht mit einer Prothese. Die Mutter heißt mit Vornamen Sira und »schmeißt den Laden«, wie Mücke es nennt. Sira flucht sizilianisch und ist eine gut gelaunte Frau mit schwarzen Haaren, die sich darüber ärgert, dass sie seit kurzem eine kleine Brille braucht, um die Aufschriften auf den Gläsern und anderen Waren zu lesen.
»Was isst Du denn am liebsten?« hat sie Josef gleich beim Kennenlernen gefragt, und er hat kurz überlegt und gesagt: »Mozartkugeln. Die habe ich mal in Salzburg gegessen!« Sira hat gestaunt und gelacht und geantwortet: »Mozartkugeln haben wir nicht, aber etwas ganz Ähnliches. Dolci aus Sizilien!« – »Was ist das?« – »Dolci sind Süßigkeiten, komm her, probier mal eins, aber vorsichtig, nicht fest hineinbeißen!« Sie hat aus der Theke einen Cannolo geholt und ihm angeboten. Es ist ein kleines, rundes, knuspriges Rohr, das mit Sahne und kandierten Früchten gefüllt ist. Wenn man vorsichtig hineinbeißt, zerspringt das Rohr und streut den Inhalt auf die Zunge. »Die machen wir selbst«, sagt Mücke und steckt sich auch einen Cannolo in den Mund.
Ihr Vater heißt Franz, er trägt während der Arbeit eine lange, dunkle Schürze und läuft, trotz seines Humpelns, rasch zwischen den Regalen umher. »Du kommst aus Köln?« fragt er Josef. – »Ja, wir haben in Köln gewohnt. Ich bin dort auch kurz zur Schule gegangen, habe aber versagt. Jetzt soll ich in Wuppertal zur Schule gehen und neu anfangen.« – »Du hast doch nicht versagt!« sagt Franz, »Jungs wie Du können gar nicht versagen. Wer sagt denn sowas?« – »Die Lehrer in Köln haben gesagt, dass ich nicht mitkomme im Unterricht. Und dass ich ein Einzelgänger bin, der nicht mit seinen Mitschülern spielt.« – »So ein Unsinn! Hier in Wuppertal kommst Du bestimmt mit, und eine Freundin hast Du ja schon zum Spielen!« – »Ich komme nach den Ferien in die zweite Klasse«, sagt Mücke, »ich kann Dir helfen und sagen, worum es im Unterricht geht.« – »Siehst Du, hier wird es ganz bestimmt klappen«, sagt Franz und fügt hinzu: »Die Kölner! – wie kann man nur so mit einem Jungen umgehen, der gerne Mozartkugeln und Cannoli isst?« – »Köln ist die schönste Stadt der Welt«, sagt Josef da leise und wischt sich mit der Hand über die Augen. Franz schaut ihn länger an und muss kurz überlegen. »Da hast du recht, mein Junge. Köln ist eine wirklich sehr schöne Stadt, aber einige Kölner, die nichts vom Leben verstehen, die sollte man verprügeln.« – »Verprügeln ist gut!« lacht Mücke und sagt stolz: »Papa verprügelt manchmal Leute, die sich nicht gut benehmen. Die bei uns klauen oder Unordnung machen, die gibt es. Da hilft nur verprügeln.«
Als sie den Laden verlassen, fragt Josef: »Verprügelt Dein Vater wirklich andere Leute?« – »Ach was, er gibt ihnen nur eins drauf. Früher war er mal Boxer, ein richtiger, der sogar im Ring aufgetreten ist. Dass er im Krieg ein Bein verloren hat, hat er lange nicht ertragen. Mutter hat gesagt, er habe früher einmal daran gedacht, sich deswegen das Leben zu nehmen. Damals hat sie ihn aber noch nicht gekannt. Er hat es dann doch nicht getan, nein, er hat sie kennengelernt und danach nicht mehr davon gesprochen. Ich mag ihn sehr, er ist ein guter Papa!«
Das Versteck
»Willst Du mein Versteck sehen?« fragt Mücke, und Josef fragt: »Was für ein Versteck?« Sie schüttelt den Kopf, mehr will sie nicht sagen, sie gehen die breite Straße ins Tal einige hundert Meter hinab. Zur Linken tut sich ein großer Wald auf, Eichen, Buchen, Kastanien. Die Bäume stehen sehr dicht, schmale Trampelpfade führen durch den Dschungel, Josef zieht unwillkürlich den Kopf ein, als müsste er sich kleiner machen, damit die Baumriesen ihn nicht sehen.
»Leise!« sagt Mücke und legt den Finger auf die Lippen. Sie schleicht voraus, und er versteht nicht, warum er leise sein soll, fragt aber wieder einmal nicht nach. Mücke tritt vorsichtig auf, als wäre der Boden zerbrechlich oder als könnte man abseits der Pfade in ihm versinken. Josef dagegen tritt kräftiger auf, er kennt solche Wälder aus dem Westerwald, wo er oft mit dem Vater oder auch allein unterwegs war. Wälder erkunden, auf Bäume klettern. Das immerhin kann er recht gut, es ist so ziemlich das Einzigste, was er immer wieder gerne getan hat. Der Vater hat ihm dabei geholfen. Wenn er auf den ersten hohen Ast klettern wollte, hat er ihn gestützt, bis er einen guten Halt gefunden hatte. Danach ging es einfacher, Ast für Ast, als hätte der Baum Stufen, bis ganz hinauf.
Er bleibt einen Moment stehen und schaut sich die Bäume an. Buchen mag er am liebsten, sie sind die idealen Kletterbäume. »Was ist?« flüstert Mücke. – »Ich würde gern klettern«, sagt er, und Mücke legt wieder den Finger auf die Lippen. – »Leise! Niemand darf uns hören, verstehst Du?« – »Nein. Wer soll uns denn hören? Hier ist doch niemand.« – »Hier im Wald gibt es zwei Banden«, sagt Mücke. »Die Hunnen und die Vandalen. Wenn sie uns erwischen, sind wir dran. Sie sind gefährlich und böse.« – »Banden?! Welche Banden?« – »Zu jeder der beiden Banden gehören drei oder vier Jungs. Sie kämpfen um das Revier. Hier sind die Hunnen zuhause, und die Vandalen wollen ihr Gelände erobern. Wenn sie aufeinandertreffen, schlagen sie sich, bis eine Bande abzieht. Sie dürfen uns nicht erwischen.« – Ihm ist wieder schlecht, er mag nicht mehr weitergehen. »Komm«, sagt Mücke, »Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn ich bei Dir bin, kann Dir nichts passieren. Ich passe auf, sie haben mich noch nie erwischt, dafür sind sie zu blöd, verstehst Du?«
Er nickt, aber er will nicht verstehen, von solchen Banden und ihren Kämpfen hat er noch nie gehört. Mit angehaltenem Atem schleicht er hinter Mücke her und schaut mehrmals nach allen Seiten. Hat man sie erkannt? Werden sie verfolgt? Nein, anscheinend nicht. Endlich erreichen sie eine Felswand, die von dichtem Moos überwachsen ist. Mücke bleibt stehen und legt wieder den Finger auf die Lippen. »Hier ist mein Versteck, komm hinter mir her, der Spalt ist sehr eng, pass auf!«
Sie befreit das Moos vom Laub und einigen morschen Ästen, bis eine schmale verrostete Tür auftaucht. Vorsichtig zieht sie an dem klappernden Griff und öffnet sie, dann duckt sie sich und schleicht ins Dunkel. Sie greift nach Josefs rechter Hand und zieht ihn hinein, dann schließt sie die Tür, und sie stehen in einer modrigen Höhle. Auf alten Obstkisten stehen mehrere Kerzen nebeneinander, auch Streichhölzer liegen bereit. Mücke steckt drei Kerzen an und hockt sich auf den Boden. »So, jetzt sind wir sicher. Hier findet uns niemand.«
»Bist Du oft hier?« – »Ja, bin ich, aber immer allein, Du bist der Erste, der mein Versteck sehen darf. Auch meine Eltern kennen es nicht, ich habe nie davon erzählt.« – »Und was machst Du hier?« – »Ich empfange Besuch. Mein Schutzengel kommt manchmal vorbei. Er passt auf mich auf, wir verstehen uns gut. Manchmal schenkt er mir etwas, und manchmal habe ich ein Geschenk für ihn.« – »Was schenkt Ihr Euch denn?«
Mücke zieht einen Vorhang beiseite, der mehrere Obstkisten zudeckt. Auf ihnen sitzen und liegen viele Stofftiere, darunter einige Affen, ein Löwe, ein Elefant, eine Schlange und ein Meerestier mit langen Saugarmen. »Was ist das?« fragt Josef, und Mücke antwortet: »Das ist mein Lieblingstier, der Oktopus. Er ist sehr klug und spricht Meereslatein.« – »Er spricht?!« – »Ja, wenn ich ihn an mein rechtes Ohr halte und fest drücke, flüstert er leise, als bewegte er sich im Meer.« – »Darf ich auch einmal?« – »Nein, vielleicht später einmal, wenn Du häufiger hier warst. Jetzt kennt er Dich noch nicht, er muss sich erst an Dich gewöhnen.«
»Ich habe keinen Schutzengel«, sagt Josef, und Mücke zieht das Gesicht etwas zusammen, als hörte sie das nicht gern. »Doch, hast Du! Du kennst ihn nur nicht, und Du sprichst nicht mit ihm. Er ist aber da, ganz bestimmt. Du musst nur an ihn glauben, dann besucht er Dich irgendwann.« – Josef will mit ihr nicht darüber streiten, deshalb sagt er nichts mehr dazu. Er setzt sich auf eine Kiste und lauscht. In der Kammer ist es sehr still, aber es kommt ihm so vor, als wären kleine Böen des Windes mit hineingeschlüpft. Sie lauern geballt unter der Decke und schwingen die Flügel.