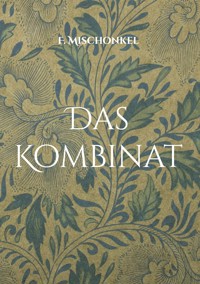
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Durch meine berufliche Tätigkeit kam ich für 12 Wochen nach Rumänien. Meine Aufgabe war, eine Chemieanlage in Betrieb zu setzen. In dieser Zeit lernte ich das Land und die Menschen kennen. In diesem Buch erzähle ich diese Erlebnisse welche in mancher Hinsicht anders waren als in den Medien wiedergegeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Etwas anderes
APC
Die Reise
Erster Flug nach Făgăraş
Im Kombinat
Unser Büro
Besuch von Nelson
Besuch von Dani
Das Protokoll
Zweiter Flug nach Făgăraş
Ausflug nach Braşov
Unser Appartement
Die Elektrolysezellen
Die Störungen
Besondere Erlebnisse in Rumänien
Dritter Flug nach Făgăraş
Die Beule oder der Spachtel
Besuch meiner Frau
Die Ersatzteile
Der Akzeptanztest
Die Heimreise und die Tage danach
Die Ausschreitungen in Braşov
Nachwort
Etwas anderes
Nach meinem Studium als Verfahrensingenieur liess ich mich in einer chemischen Fabrik anstellen, welche Produkte herstellte, deren Ausgangsmaterial Kochsalz war. Diese Produkte waren vor allem Salzsäure, Natronlauge und Natriumhypochlorit mit dem Handelsnamen «Javelle». Die weiteren Produkte waren diverse Chlorate und Perchlorat (APC). In dieser Firma hatte ich 1987 die Möglichkeit, für einige Wochen nach Rumänien zu gehen, wo ich die Aufgabe hatte, eine Elektrolyseanlage und die Produktionsanlage für APC in Betrieb zu setzen. Obwohl in den Medien immer wieder über grosse Probleme in Rumänien berichtet wurde, interessierte mich diese Aufgabe in einem kommunistischen Land sehr. Dieser Aufenthalt ermöglichte mir, die tatsächlichen Verhältnisse in diesem Land kennen zu lernen. Es war nicht nur die Lebensweise der Menschen und ihr Verhalten, das mich interessierte, auch die Organisation in der Firma und die Überwachung und Kontrolle durch den Staat, wie es in den westlichen Medien verbreitet wurde, weckten mein Interesse.
APC
Unsere Firma beschäftigte sich schon seit Ende des 20. Jahrhunderts mit der Herstellung von Chlorprodukten. Strom als wichtiges Element für die Herstellung war reichlich vorhanden. Hatte doch Peter Zai-Kappeler eine Turbine aus der nahen Spinnerei seines Schwiegervaters, Kappeler-Bebié, in die Schiffmühle mitgenommen und Strom produziert. Zusammen mit dem Chemiker Hans Landolt begannen sie, mit Salz, das in der Nähe reichlich vorkommt, Salzsäure, Natronlauge und Javelle herzustellen. Später kamen Chlorate und Perchlorate hinzu. Die Firma produzierte bereits mehrere Jahrzehnte diese Produkte, hatte so reiche Erfahrung gesammelt und war weltweit bekannt. Einerseits brauchte man Natriumchlorat und abgewandelte Chlorate für die Feuerwerkerei, deren Abnehmer bekannte Schweizer Unternehmen waren. Aber auch als Unkrautvertilgungsmittel wurde Natriumchlorat, mit dem Handelsnamen «Tursal», jahrzehntelang von der SBB eingesetzt. Ein anderes Anwendungsgebiet war die Raketenantriebstechnik. Hierfür wurde das weiterverarbeitete Ammoniumperchlorat (APC) benötigt. Dieses Produkt stellte unsere Firma jahrzehntelang für die NATO her sowie für die Amerikaner, die diese für den Antrieb von Weltraumraketen verwendeten. Als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Ammoniumperchlorat dient, wie bereits erwähnt, Kochsalz. In einem ersten Schritt wird diesem Kochsalz mit Hilfe elektrischen Stroms in einer Elektrolysezelle Natriumchlorat hergestellt. Aus dieser Lösung wird das Natriumchlorat kristallisiert. Dieses gereinigte Natriumchlorat wird nun in einer zweiten Elektrolyse, wieder mit Hilfe elektrischen Stroms, zu Natriumperchlorat. Nach einer weiteren Kristallisation wird es wieder aufgelöst und mit Ammoniumchlorid zu Ammoniumperchlorat umgesetzt und daraufhin wieder kristallisiert. Zum Abschluss wird das Kristall getrocknet und auf die gewünschte Korngrösse gemahlen. Alle diese Vorgänge sind mit einem Risiko verbunden, angefangen bei der Elektrolyse, bei der freier Wasserstoff entsteht, und später bei der Verarbeitung des Natrium- und Ammoniumperchlorat kann es bei unvorsichtigem Handling oder bei der Verarbeitung zu einer Selbstentzündung kommen. Um die Zeit, als ich in Rumänien weilte, ereignete sich in Amerika eine schwere Ammoniumperchloratexplosion. Die Gefährlichkeit des Produktes und moralische Bedenken veranlassten unsere Firma, die Produktion von Ammoniumperchlorat aufzugeben.
Bereits Anfang der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts interessierte sich eine südafrikanische Firma für das zum Herstellen von APC notwendige Know-how. Nachdem man sich geeinigt hatte, reiste eine Delegation aus Südafrika mit einem Spezialflugzeug hierher. Die Südafrikaner durften zu dieser Zeit nicht über den afrikanischen Kontinent fliegen, was viel näher gewesen wäre. Nein, sie mussten mit einem Flugzeug, das Zusatztanks für den Treibstoff mit sich trug, aussen herum über das Meer fliegen, nonstop von Johannesburg bis London, von wo aus sie mit einem anderen Flieger weiter nach Kloten reisten.
In dem Gespräch fragten wir die Südafrikaner: «Weshalb bezahlen Sie die Schwarzen so schlecht, dass sie davon kaum leben können?»
Da antworteten sie: «Wenn wir ihnen mehr Lohn gäben, würden sie am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit kommen. Sie arbeiten nur so viel, wie sie zum Leben benötigen, bekommen sie mehr, arbeiten sie einfach weniger.»
Mit dieser Aussage mussten wir uns zufriedengeben und sie hatte, aus Sicht der Südafrikaner, auch eine bestimmte Logik. Wir konnten dies ja nicht überprüfen. Zudem verbreiteten die Medien ja dauernd Berichte über Afrikaner, die lieber feierten als arbeiteten. Ob dies in jedem Fall zutraf, weiss ich nicht. Es waren auch keine Weissen, die mit dem, was sie haben, nie zufrieden sind.
Es kam ausserdem zu einer interessanten Begebenheit aus Unkenntnis der Sprache. In den Rührbehältern baute man sogenannte Stromstörer ein. Wörtlich übersetzt, hiess dies im Englischen «current breaker». So kam ein Telex mit der Frage ob dies auch stimme, was das denn mit dem elektrischen Strom für einen Zusammenhang hätte, sie vermuteten, dies sei ein Baffle, ein Umlenkblech, was natürlich auch zutraf. Aber in unserer Deutschschweizer Mundart waren dies eben Stromstörer, weil sie den Flüssigkeitsstrom störten. Ob und wie die Anlage in Südafrika funktionierte, haben wir nie erfahren.
Einige Jahre später erreichte die Firma eine Anfrage der Firma Nobel Chematur Bofors aus Karlskoga für die Lieferung von Know-how zur Herstellung einer Anlage von Ammoniumperchlorat. Mit gemischten Gefühlen willigte man ein und verkaufte das Know-how, das für eine Anlage in Rumänien bestimmt war. Für welche Zwecke Rumänien eine Anlage zum Herstellen von Ammoniumperchlorat brauchte, wussten wir nicht und haben uns auch nicht danach erkundigt. Obwohl es modernere Anlagen gab, entschied sich der Kunde für unsere. Es war eine alte Technik, aber sehr einfach in der Handhabung. Neue Anlagen werden mit Membrantechnik ausgeführt, sind aber viel heikler und aufwändiger im Betrieb. Vor allem bei Kleinanlagen lohnt sich eine Elektrolyseanlage mit Membrantechnik nicht. Auch die nachfolgende Kristallisation wird heute meist kontinuierlich ausgeführt, aber diese ist mit noch mehr Schwierigkeiten verbunden.
Wir hatten eine Versuchsanlage für die kontinuierliche Kristallisation gebaut, diese Technik aber wegen grosser Schwierigkeiten wieder aufgegeben. Stattdessen wurde die diskontinuierliche Kristallisation verbessert. In der Folge gab es in unserer Firma etliche Besuche von Ingenieuren von Nobel Chematur zur Besprechung der Abwicklung des Projektes. Einmal kamen die Ingenieure mit Detailplänen. Der Kunde wollte den Antrieb der Rührwerke mittels einer Transmission ausführen, einer Antriebsart, die man schon Mitte des letzten Jahrhunderts kaum mehr antraf. Wir hatten ein zwiespältiges Gefühl, wie die Anlage am Schluss funktionieren sollte. Gegen Ende der Projektierung weilte dann eine Delegation aus Rumänien bei uns. Es waren dieselben Leute, die ich später in Rumänien treffen sollte. Sie wohnten in einem nahegelegenen Hotel, von wo wir sie täglich abholen mussten. Der Kellner erzählte uns später, dass die Leute nur das assen, was im Pauschalarrangement bezahlt worden war, getrunken hätten sie immer nur Leitungswasser.
Was die Leute aus Rumänien eigentlich wissen wollten, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Die meiste Zeit hatten die Gespräche mit der Anlage nichts zu tun. Wir hatten den Eindruck, dass sie einige Tage Ferien auf Staatskosten machten. Unerklärlich war auch, dass derjenige, welcher für das Elektrische zuständig war, unsere Gleichstromverteilung abzeichnete, obwohl die Anlage in Rumänien sicher ganz anders aussehen würde. Unsere Gleichstromverteilanlage war für vier verschiedene Elektrolysen als Strombezüger sowie zwei Umrichter und drei Generatoren als Stromlieferanten konzipiert. In Rumänien musste sie lediglich zwei Elektrolysen mit Gleichstrom beliefern.
Die Reise
«Möchten Sie für zwei bis drei Monate nach Rumänien?», fragte mich Marcel, nachdem ihm zwei andere Kandidaten eine Absage erteilt hatten. Ein Chemiker, der bereits im Ruhestand war, wollte eine solche Aufgabe nicht mehr übernehmen und der andere, ein Vorgesetzter der Engineering-Abteilung, stand kurz vor der Pensionierung und beschäftigte sich vorwiegend mit dem Abschreiben von Untersuchungen seiner Mitarbeiter. Ich zögerte kurz und liess meine Gedanken hin und her schweben, denn ich wusste ja, um was es in Rumänien ging. Wir hatten zusammen mit Nobel Chematur aus Karlskoga, welche bereits in Rumänien tätig war, die Anlage geplant. Wir lieferten das Know-how und die Partner setzten dieses um.
«Ich muss es mir noch genauer überlegen und werde Ihnen bald Antwort geben.»
Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Zuhause besprach ich mich mit meiner Familie, die natürlich keine Freudensprünge machte. Aber in einem intensiven Gespräch konnte ich meine Frau davon überzeugen, dass es kein so grosses Risiko war, diese Aufgabe zu meistern. Dann kam die Frage auf, wie lebten die Menschen in Rumänien? Würde man vom Geheimdienst auf Schritt und Tritt beobachtet werden? Viele Geschichten hatte ich darüber schon gehört oder gelesen. Das Land war sehr arm, die Menschen hatten fast nichts zu essen und mussten vor den Läden lange anstehen, bis sie etwas kaufen konnten. Zumindest in den Medien sah man das und konnte es lesen. Alle diese Fragen bereiteten mir etwas Bauchschmerzen.
Zwei Tage später stand Marcel wieder vor mir und fragte mich: «So, haben Sie es sich überlegt»?
«Nicht gerne, aber ich werde es tun», gab ich ihm zur Antwort und machte so meinen gemischten Gefühlen, dem inneren Zwiespalt Luft. Sah ich es doch als Anstand an, eine von der Firma begonnene Arbeit zu Ende zu führen. Aber es faszinierte mich auch die Idee, einmal im Ausland die Inbetriebsetzung einer Chemieanlage durchzuführen. Noch nie war ich im Ausland tätig gewesen und gespannt, was da alles auf mich zukommen würde.
Marcel war mit meinem Einverständnis zufrieden und meldete dies an die Schweden weiter. Bereits zwei Tage später war Anders aus Karlskoga am Telefon.
«Können wir einen Termin für die Abreise ausmachen?»
«Am 25. Oktober, früher geht es mir nicht», gab ich ihm zur Antwort.
Einige Tage später kam ein Telex: «Kann Herr Silvano auch kommen? Er soll den Arbeitern gewisse Techniken bei der Herstellung der Anoden beibringen.»
Ich informierte Silvano sowie Marcel über die Wünsche der Schweden.
«Ich muss natürlich mit meiner Frau darüber sprechen, bevor ich zusage, aber interessant ist dies alleweil.»
Bereits am nächsten Tag sagte mir Silvano zu. Seine Frau hatte nichts dagegen einzuwenden, dass ihr Mann für eine Woche nach Rumänien fuhr.
Jetzt besorgten wir die Einreiseerlaubnis in der rumänischen Botschaft. Schon nach wenigen Tagen erhielten wir den Pass zurück zusammen mit dem Visum für die Einreise in Rumänien.
Wir bereiteten uns nun auf die Reise vor. Wo lag Făgăraş überhaupt? Irgendwo in den Karpaten. Es soll dort recht kalt werden können, sagte mir Anders. So besorgten wir uns je eine Helly-Hansen-Jacke, damit wir im Freien nicht einfroren. Die Flugtickets wurden von Anders organisiert und sollten bei der Swissair deponiert werden, nur waren diese dann nicht auffindbar. Mehr als eine Woche lang versuchte Frau Fasching vom Reisebüro Senator, bei der rumänischen Fluggesellschaft TAROM und der Swissair unsere Tickets zu erhalten. Am 23. Oktober rief ich die rumänische Botschaft in Bern an und erkundigte mich über den Verbleib der Tickets. Eine viertel Stunde später erhielt ich von Frau Fasching die Bestätigung, dass die Tickets aufgefunden worden seien.
So bereitete ich mich auf diese Mission vor, indem ich mir Unterlagen der Anlage beschaffte. Ich kopierte alle Dokumente der Anlage, verkleinert für einen A6-Ordner. Auch alle Berechnungsunterlagen kopierte ich und brachte sie im Ordner unter. Im Weiteren besprach ich mich mit dem Chemiker über den Betrieb der Anlage, andere Schwierigkeiten und sonst wie Wissenswertes.
Erster Flug nach Făgăraş
Es war Sonntag, der 25 . Oktober 1987 und für die Jahreszeit noch angenehm warm. In meinem Koffer hatte ich alle persönlichen Sachen und Dokumente, die ich für meinen ersten Aufenthalt in Rumänien benötigte. Am Nachmittag um 4 Uhr fuhr ich zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter zu Silvano und wir holten ihn und seine Frau ab. Beide hatten schon eine geraume Zeit am Fenster gestanden und Ausschau nach uns gehalten. Sie waren ganz aufgeregt. Schnell kamen sie, bewaffnet mit einem Koffer, die Treppe herunter. Wir begrüssten uns und machten noch einige Witze über unser Abenteuer. Den Koffer von Silvano verstauten wir im Kofferraum und die beiden nahmen auf dem Hintersitz neben unserer Tochter Platz.
Meine Nervosität löste sich nun etwas. Jetzt waren wir zu zweit für diese abenteuerliche Reise in eine ungewisse Zukunft in einem unbekannten Land. Zu fünft fuhren wir, bepackt mit Koffern und Reisetaschen, zum Flughafen Kloten. In einem Parkhaus suchten wir einen freien Platz. Das Ticket gab ich meiner Frau, damit sie wieder nach Hause fahren konnte. Mit dem Lift fuhren wir hinunter in die Passage zu den Terminals, wo wir als Erstes den Swissair-Schalter aufsuchten und unsere Tickets abholten. Nun konnten wir einchecken und unser Reisegepäck aufgeben.





























