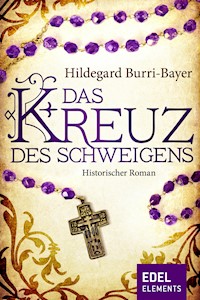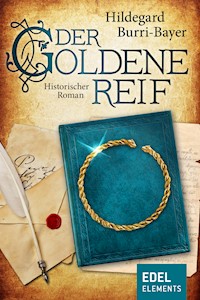Das Kreuz des Schweigens / Die Sühnetochter - Zwei Romane in einem Band E-Book
Hildegard Burri-Bayer
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Kreuz des Schweigens Toulouse, 1198: Frankreichs reicher Süden blüht. Christen, Juden und Katharer leben friedlich miteinander. Die »reine« Lehre, wie das Katharertum genannt wird, erlebt einen wahren Siegeszug – und Roms Vormachtstellung droht untergraben zu werden. Der Papst und der König von Frankreich rufen zum Kreuzzug von Christen gegen Christen – die Ketzer zu bekehren ist indes nur ein willkommener Vorwand. Denn vor allem will die Kirche einen geheimen Schatz in ihren Besitz bringen, der sich in den Händen eines jungen Mädchens befindet … Die Sühnetochter Zwei Tote, ein Grab und ein Geheimnis, das den König zu Fall bringen könnte! Paris, 1390. Anastasia muss einen Totengräber bestechen, um ihren Vater, den Tintenhändler und heimlichen Alchemisten Jakob Braque, in geweihter Erde zu bestatten. An dem geheimen Grab wird sie von Christine de Pizan ertappt. Anastasia fürchtet Schlimmstes – zu Unrecht. Bald wird Christine ihr zur Freundin und Vertrauten. Doch selbst die einflussreiche Dame kann nicht verhindern, dass Anastasia in die Nähe von Königsmördern gerückt, angeklagt und in den Kerker geworfen wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1368
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Das Kreuz des Schweigens
Toulouse, 1198: Frankreichs reicher Süden blüht. Christen, Juden und Katharer leben friedlich miteinander. Die »reine« Lehre, wie das Katharertum genannt wird, erlebt einen wahren Siegeszug – und Roms Vormachtstellung droht untergraben zu werden. Der Papst und der König von Frankreich rufen zum Kreuzzug von Christen gegen Christen – die Ketzer zu bekehren ist indes nur ein willkommener Vorwand. Denn vor allem will die Kirche einen geheimen Schatz in ihren Besitz bringen, der sich in den Händen eines jungen Mädchens befindet …
Die Sühnetochter
Zwei Tote, ein Grab und ein Geheimnis, das den König zu Fall bringen könnte!
Paris, 1390. Anastasia muss einen Totengräber bestechen, um ihren Vater, den Tintenhändler und heimlichen Alchemisten Jakob Braque, in geweihter Erde zu bestatten. An dem geheimen Grab wird sie von Christine de Pizan ertappt. Anastasia fürchtet Schlimmstes – zu Unrecht. Bald wird Christine ihr zur Freundin und Vertrauten. Doch selbst die einflussreiche Dame kann nicht verhindern, dass Anastasia in die Nähe von Königsmördern gerückt, angeklagt und in den Kerker geworfen wird …
Weitere Titel der Autorin bei Edel Elements
Das Vermächtnis des RabenDer goldene ReifDie BluterbinDie Thronfolgerin
Hildegard Burry-Bayer
Das Kreuz des Schweigens / Die Sühnetochter
Zwei Romane in einem Band
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Hildegard Burry-Bayer
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-223-9
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Das Kreuz des Schweigens
Kurzbeschreibung
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Nachwort
Literaturverzeichnis
Dramatis Personae
Die Sühnetochter
Kurzbeschreibung
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Epilog
Anmerkung
Literaturverzeichnis
Über das Buch:
Toulouse, 1198: Frankreichs reicher Süden blüht. Christen, Juden und Katharer leben friedlich miteinander. Die »reine« Lehre, wie das Katharertum genannt wird, erlebt einen wahren Siegeszug – und Roms Vormachtstellung droht untergraben zu werden. Der Papst und der König von Frankreich rufen zum Kreuzzug von Christen gegen Christen – die Ketzer zu bekehren ist indes nur ein willkommener Vorwand. Denn vor allem will die Kirche einen geheimen Schatz in ihren Besitz bringen, der sich in den Händen eines jungen Mädchens befindet …
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2014 by Hildegard Burri-Bayer Dieser Titel wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Covergestaltun: Anke Koopmann, Designomicon, München Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-900-8
www.facebook.com/EdelElements
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Evangelium nach Johannes
Der volle Christus ist erschienen nicht auf Erden, sein göttlich Menschenbild muss noch vollendet werden. Einst wird das Heil der Welt, Erlösung sich vollbringen, wenn Gott und Mensch im Geist lebendig sich durchdringen. Mag auch das Jesusbild, der Widerschein den Sinnen, im regen Strom der Zeit verzittern und zerrinnen; wenn alle Zeugnisse von Jesus auch zerschellten, der Gottmensch ist der Kern, das Herzlicht aller Welten.
Nicolaus Lenau, Die Albigenser
1
Rhedae, Südfrankreich, April 1207
Ein warmer Wind wehte Elysa entgegen, als sie mit ihrem Wasserkrug die schmale Gasse zum Marktplatz hinauflief, der sich an der höchstgelegenen Stelle der kleinen auf einem Hügel erbauten Stadt befand.
Obwohl es steil bergauf ging, beschleunigte sie unwillkürlich ihren Schritt und konnte es kaum erwarten, das Plateau zu erreichen, um ihren Blick über die blühenden Täler hinweg zu den schroff aufragenden Pyrenäen schweifen zu lassen, deren Gipfel bis in den Himmel zu reichen schienen.
Der Wind zerrte an ihren Haaren, wirbelte ihr den Staub des ausgetrockneten Bodens ins Gesicht und jagte die kleinen weißen Wolkenfetzen auf die Berge zu, wo sie sich auftürmten und in dem gelblichen Dunst verschwanden, der den Gipfel des Bugarach, des höchsten Berges des Massivs, verschluckte.
Elysa starrte auf die Berge und versuchte vergeblich, den Dunst zu durchdringen, der sich beständig ausbreitete und wie ein riesiger Schatten von den Bergen herab auf die Täler zukroch. Vielleicht würde es ein Unwetter geben oder doch zumindest regnen. Etwas braute sich da über ihr zusammen, das ihr schon jetzt Unbehagen einflößte. Sie beobachtete weiterhin die Berge, während sie ihren Weg fortsetzte. Der Himmel schien mit jedem Schritt, den sie tat, düsterer zu werden und die Wolkendecke dichter. Die Sonne schaffte es nicht mehr, sie zu durchbrechen. Nur wenn man ganz genau hinsah, konnte man sie noch hinter den Wolkenschichten erahnen, die an manchen Stellen silbrig glänzten.
Elysa hatte die Kirche fast erreicht, an der ein jeder vorbeimusste, der zum Brunnen am Ende des Marktplatzes wollte, als wütende Stimmen und Hundegebell die feierliche Sonntagsstille zerrissen.
Fünf barfüßige Mönche befanden sich vor der Kirche und drängten vor dem Portal die Bettler zur Seite, die eigens früh gekommen waren, um einen der begehrten Plätze vor der Kirche zu ergattern und von dort aus an das Mitgefühl der Gläubigen zu appellieren. Nur der blinde Jean hatte sich nicht verjagen lassen und war trotz der Drohungen der Mönche vor dem Eingang sitzen geblieben. Sein dünner Arm lag auf dem Rücken seiner struppigen schwarzweißen Hündin und hielt sie davon ab, auf die Diener des Herrn loszugehen. Das Tier knurrte warnend, als einer der Mönche auf Jean zutrat, ihn am Arm packte, unsanft nach oben riss und ihm einen Stoß in den Rücken versetzte. Jean ruderte mit den Armen durch die Luft und versuchte, sein Gleichgewicht wiederzufinden, stolperte dabei aber über seine Hündin, die nach vorne gesprungen war, um nach der Wade des Mönchs zu schnappen. Als Jean keinen Halt fand, stürzte er hilflos zu Boden. Elysa stellte ihren Krug ab und lief zu ihm hinüber, um ihm aufzuhelfen. Der Schreck stand Jean noch ins Gesicht geschrieben. Die Attacke des Mönchs war so unverhofft gekommen, dass er schon im Dreck gelandet war, bevor er überhaupt wusste, wie ihm geschah. Noch ein wenig benommen richtete er sich nun mit Elysas Unterstützung auf und tastete dabei nach seinem Hund. »Fleur!«, rief er. »Fleur, komm her.« Doch die Hündin hatte sich im Habit des Mönchs festgebissen und zerrte wütend daran. Elysa wandte sich nach dem Hund um, bereit, ihn zurückzuholen, falls er dem Ruf seines Herrn nicht folgen würde, und sah, wie der Mönch mit dem dicken Ende seines Knotenstocks ausholte und auf den Hund einschlug. Schließlich traf einer seiner Hiebe die Hündin am Kopf und streckte sie nieder. Ihre Hinterbeine zuckten noch einmal, dann blieb sie regungslos liegen. Der Mönch ließ daraufhin den Stock sinken und beförderte das Tier mit einem Tritt aus seinem Blickfeld. Danach wandte er sich um und sagte etwas zu einem seiner Mitbrüder, der vergeblich an dem verschlossenen Kirchenportal rüttelte. Der nickte darauf kurz und lief dann um das Gotteshaus herum, vermutlich um Pater Paul zu suchen, der den Schlüssel für die Kirche besaß.
Obwohl er nichts sehen konnte, spürte Jean, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. »Fleur?«, schrie er so laut, dass Elysa zusammenschrak. Er streckte seine magere Hand aus und bekam Elysa am Arm zu fassen. »Wo ist sie?«, fragte er ängstlich und presste ihr seine Fingernägel so fest ins Fleisch, dass es schmerzte. »Der Mönch hat ihr mit seinem Stock den Schädel eingeschlagen«, gab Elysa leise zurück, worauf Jean so verzweifelt aufschluchzte, dass es Elysa vor Mitleid beinahe das Herz zerriss. »Wo ist sie?«, wiederholte er. »Ich will zu ihr.« Elysa führte ihn zu der toten Hündin. Jean hob das Tier vom Boden auf und presste es an seine Brust, während ihm die Tränen über die schmutzigen Wangen strömten. »Ich habe gehört, dass die Guten Christen die Seelen ins Paradies bringen«, brachte er schließlich hervor. Seine leeren Augen richteten sich flehend auf Elysa. »Meinst du, sie werden auch Fleurs Seele ins Paradies bringen?«
Er streichelte über den Kopf seiner toten Begleiterin.
Elysa wusste, dass die Seelen der Menschen nach deren Tod den Körper verließen, um sich auf den Weg zu den Sternen zu begeben, aber sie hatte sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wohin die Seele eines Tieres ging. »Ich werde meinen Onkel fragen«, versprach sie Jean deshalb.
In der Zwischenzeit waren immer mehr Frauen mit ihren Krügen auf dem Marktplatz eingetroffen und neugierig vor der Kirche stehen geblieben.
Elysa sah zu den Mönchen hinüber, die sich miteinander besprachen, als ob nichts geschehen wäre. Kurz entschlossen ging sie auf die Männer zu.
»Wer seid Ihr, und wie konntet Ihr nur so grausam sein?« Ihre Stimme klang laut und fordernd. Der Mönch, der den Hund erschlagen hatte, drehte sich zu ihr um. Er war groß und wie viele seiner Brüder, die ihr Leben dem Herrn geweiht hatten, erstaunlich gut genährt, doch sein Blick war hart und unerbittlich. Elysa konnte nicht das geringste Mitgefühl für den armen Jean darin erkennen.
»Der Hund war alles, was der blinde Jean hatte«, sagte sie und hörte selbst, wie vorwurfsvoll ihre Stimme klang.
»Mein Name ist Peter von Castelnau – der Herr gibt, der Herr nimmt«, erklärte ihr der Angesprochene herablassend, ohne sie noch eines weiteren Blickes zu würdigen.
»Doch nicht der Herr hat den Hund erschlagen, sondern Ihr habt es getan«, gab Elysa zurück, die ihren Zorn nur mühsam beherrschen konnte.
Castelnaus dichte, dunkle Brauen zogen sich bedrohlich zusammen, und ein kühler Blick traf Elysa. Schon öffnete er den Mund, um etwas zu erwidern, doch da kehrte der dünne Mönch, gefolgt von Pater Paul, zurück und wies auf das Portal, das von der massigen Gestalt Castelnaus versperrt wurde. Unwillig über die Störung trat dieser einen Schritt zur Seite. Pater Paul schien nicht sonderlich erfreut über den Besuch der Mönche zu sein, wie sein mürrisches Gesicht deutlich verriet. Er nahm den eisernen Schlüssel, den er immer bei sich trug, vom Gürtel, öffnete wortlos das Portal und verschwand im Inneren der Kirche.
»Sei lieber vorsichtig mit dem, was du sagst«, flüsterte da Sarah, die hinter Elysa getreten war, dieser ins Ohr. »Die Kuttenträger sind nicht die, die sie vorgeben zu sein. Der große Mönch trägt zwar den Habit, hat aber ganz sicher noch niemals körperliche Arbeit in einem Kloster leisten müssen. Sieh dir doch nur einmal seine Hände an.«
Peter von Castelnau richtete seine Aufmerksamkeit nun erneut auf Elysa.
Sein Blick war jetzt weniger kalt als vielmehr lauernd. »Du wagst es, einem Diener Gottes zu widersprechen? Gehe ich recht in der Annahme, dass du folglich zu den Ungläubigen gehörst, die sich in ihrer Überheblichkeit die Guten Christen nennen?« Sarah legte warnend eine Hand auf Elysas Schulter.
Die Kirchturmglocke begann zu läuten. Elysa schüttelte die Hand ihrer Freundin ab und erhob ihre Stimme, um das Läuten zu übertönen.
»Wir schlagen jedenfalls keine Hunde tot«, erklärte sie, so laut sie nur konnte, doch ihre Worte gingen im Bimmeln der Glocken unter.
Die Mönche bauten sich nun wortlos vor dem Portal auf, sodass man fast auf den Gedanken hätte kommen können, sie wollten den Gläubigen den Zugang zur Kirche versperren. »Hat ihnen denn niemand gesagt, dass keiner mehr in die Kirche will«, kicherte die alte Anna boshaft, auch wenn niemand sie in dem Lärm verstehen konnte, und gesellte sich zu Sarah und Elysa.
In diesem Augenblick trafen auch die ersten Männer vor der Kirche ein, um nachzusehen, was das eindringliche Läuten der Glocken zu bedeuten hatte. Die Frauen am Brunnen ließen ihre Krüge stehen und folgten ihnen.
Dominikus Guzman, der Subprior des Bischofs von Osma, ein schmächtiger Mann mit ausgezehrten Gesichtszügen und leicht auseinanderstehenden dunklen Augen, atmete noch einmal tief ein, dann trat er entschlossen einen Schritt vor und starrte den Bewohnern Rhedaes finster entgegen. Seine Kutte aus grob gewebtem Stoff war mehrfach geflickt. Um seine Beine hatte er eine Eisenkette geschlungen, die ihm bei jeder Bewegung schmerzhaft ins Fleisch schnitt. Es war ihm zur Gewohnheit geworden, seinen Körper auf diese Weise während seiner Predigten zu kasteien, und er tat es mit der gleichen Inbrunst und Leidenschaft, mit der er Tag und Nacht zum Herrn betete.
Seine vier Gefährten, Diego von Azevedo, der Bischof von Osma, der Archidiakon Peter von Castelnau, Bruder Raoul und Arnold Amaury, der Abt von Cîteaux, waren das genaue Gegenteil ihres asketisch aussehenden Wortführers. Ihre runden Gesichter glänzten feist über einem wohlgenährten Bauch, den auch die Weite ihrer Kutten nicht mehr kaschieren konnte.
Elysa konnte sich kaum beruhigen. Als Dominikus Guzman in ihre Richtung sah, erwiderte sie offen seinen Blick, und er konnte in ihren Augen weder Respekt vor ihm noch die vor seinem Amt angemessene Demut erkennen.
Heiliger Zorn erfüllte ihn. Der Herr hatte ihn erwählt, um die Ungläubigen im Süden Frankreichs zu bekehren und jegliche Häresie auszurotten. Und dieses Mädchen war ganz offensichtlich eine Ketzerin und versuchte nicht einmal, dies zu verbergen.
Da kam auf einmal Bewegung in die Menge und lenkte seinen Blick auf einen hochgewachsenen Mann, vor dem die Menschen bereitwillig zur Seite wichen, um ihn nach vorn treten zu lassen.
Der Mann trug ein langes, schwarzes Gewand, und von seinem Hals hing, von ledernen Bändern gehalten, eine ebenfalls lederne Rolle bis auf die Brust hinab, in der sich vermutlich das Johannesevangelium befand, was wiederum bedeutete, dass er einen Führer der Guten Christen vor sich hatte. Der Mann blieb neben dem Mädchen stehen und sah ihm nun direkt in die Augen. Sein Blick war von solch einer Kraft und Intensität, dass Dominikus Guzman ihn kaum ertragen konnte, hatte er doch das Gefühl, als würde ihm der Ketzer bis auf den Grund seiner Seele blicken. Entsetzt wandte er sich ab und fühlte sich gleichzeitig öffentlich bloßgestellt, weil er dem Blick des anderen nicht hatte standhalten können.
Der Kirchenvorplatz hatte sich mittlerweile mit Leuten gefüllt, und Dominikus Guzman spürte sowohl die neugierige Erwartung als auch die Ablehnung, die ihm von diesen entgegenschlug.
Ungeduldig drängte sich die Menge vor ihm, dann wurden die ersten Rufe laut.
»Sag endlich, was du uns zu sagen hast, Mönch«, ertönte eine fordernde Stimme aus den hinteren Reihen, und andere Stimmen fielen in den Ruf mit ein.
Dominikus spürte die Erregung in sich aufsteigen. Der Augenblick, dem er jedes Mal vor einer Rede förmlich entgegenfieberte, war gekommen.
Er breitete die Arme aus, ein Vorrecht der geistigen Führer und eine Geste, die nur selten ihre Wirkung verfehlte.
»Hört auf meine Worte, ihr guten Leute. Gott der Herr hat mich zu euch gesandt, um euch zum rechten Glauben zurückzuführen, so wie ein guter Hirte seine Schafe sicher in den heimatlichen Pferch zurückführt. Wendet euch ab von den falschen Propheten mit ihren falschen Lehren, die mit den Mächten der Hölle im Bunde sind und die heiligen Sakramente der Kirche verleugnen!«
Seine Stimme war wohlklingend und besaß gewaltige Kraft. Eine Gabe, für die er dem Herrn jeden Tag dankte. Auch dieses Mal starrten ihn die Menschen überrascht an. Es war dieser Moment, in dem ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit der Gläubigen wie der Ungläubigen gehörte, der ihn für all seine Qualen entschädigte. Genauso mussten sich Petrus und die anderen Apostel gefühlt haben, wenn sie im Namen ihres Herrn und Meisters zu den Menschen gesprochen hatten. Er holte tief Luft und öffnete den Mund, um fortzufahren, als er bemerkte, wie sich ein junger Mann mit schwarzem, schulterlangem Haar und wild entschlossenem Blick einen Weg durch die Menge bahnte, indem er seine Laute wie ein Schwert vor sich herschwang.
Sein Rock war bunt und verschlissen, und seine nackten Füße starrten vor Schmutz. Dominikus erkannte den Wahn, der in den glühenden, schwarzen Augen des Mannes stand, und ihn fröstelte, obwohl die Sonne mit jedem Augenblick, der verging, heißer auf ihn herabbrannte. Er bekreuzigte sich hastig, was dem jungen Mann nicht mehr als ein höhnisches Grinsen entlockte. Dominikus kämpfte noch gegen den Zorn an, der erneut in ihm aufwallte, als der Barde sich abrupt umwandte und ihm demonstrativ den Rücken zudrehte. Er ließ die ersten Töne einer Melodie erklingen und begann dann zu singen. Seine Stimme war rau und leidenschaftlich und zog die Menschen um ihn herum sofort in ihren Bann.
Seid keck gegrüßt,
ihr braven Leut’,
und hört gut zu,
was ich euch sagen will.
Als Schelm von Carcassonne wurd’ ich geboren,
ein Esel hat mich im Galopp verloren.
Mein Vater hatte wenig Glück,
er endete am Galgenstrick.
Das Los der Mutter ist unbekannt,
sie ging zum Markte und verschwand.
Doch ich, ich bin ein Bard’ geworden,
ein Troubadour,
verteile Weisheit,
reich und pur.
Wer ist der Grund der Welt?
Könnt ihr die Frage lösen?
Vielsagend legte er eine Hand an die Stirn und wiegte rhythmisch seinen Kopf hin und her, während er mit der anderen Hand im Takt der Musik auf sein Instrument klopfte. Dann nickte er, als hätte er nichts anderes als Unverständnis von seinen Zuhörern erwartet.
Ich will’s euch also sagen:
Die Geister sind von Gott,
die Körper sind vom Bösen.
Er ließ einige Töne erklingen, machte mit der Hand eine weit ausladende Geste wie ein Fürst, der sich zu seinen Untertanen herablässt, und grinste frech, bevor er zum Refrain anhob.
Einige der Leute kannten sein Lied bereits und fielen lautstark in seinen Gesang mit ein.
Nahe sind die Zeiten schon,
wo die Welt sich ganz verkehrt,
zum Turnier der Pfaffe geht,
und das Weib die Predigt hält.
Die Leute lachten und belohnten den Barden mit lautem Händeklatschen.
Dann warf der Barde Dominikus Guzman noch einen glühenden Blick zu, bevor er sich blitzschnell umwandte und in der Menge untertauchte, noch ehe der Mönch oder einer seiner Begleiter etwas gegen ihn unternehmen konnten. Und dann sah er sie, hielt wie vom Blitz getroffen inne, mit einem brennenden Schmerz in der Brust.
Milch und Honig, sanfte Schönheit, vollendete Seele, starkes Herz, erwachender Frühling, überquellende Gefühle.
Er erinnerte sich an ihren Namen, stolperte aus dem Dorf, Reime im Kopf und im lodernden Herzen einen Schatz, sicher geborgen, gleich einem Dieb, der Dunkelheit entkommen, strebte er ins Licht.
Die Gedanken beflügelt, von Minne erfüllt, federleicht, der Gesang der Sterne überirdisch schön, verloren in ewiger Sehnsucht.
Elysa sah dem Sänger nach, als er wie betrunken aus dem Dorf taumelte, ohne darauf zu achten, wohin er seine Füße setzte. Sein wild flackernder Blick hatte sie zuerst erschreckt, aber dann hatte sie die Qual darin erkannt und gewusst, dass dieser Mann keine Gefahr für sie darstellte.
Unzufriedenes Gemurmel wurde laut und zog ihre Aufmerksamkeit zurück auf den Marktplatz, wo nun einige Männer Messer und Trinkbecher vom Gürtel nahmen und beide Teile geräuschvoll gegeneinanderschlugen. Andere schwangen wiederum ihre Stöcke, klatschten in die Hände oder stießen schrille Pfiffe aus.
Eine Rübe kam durch die Luft geflogen, die Dominikus Guzman nur um Haaresbreite verfehlte. Die Menge johlte begeistert auf und geizte nicht mit Schmährufen.
Doch während Dominikus’ Begleiter erschrocken zurückwichen, bis sie nur noch wenige Fuß von dem sicheren Kirchenportal entfernt waren, blieb er selbst hoch aufgerichtet an seinem Platz stehen, was einige der Zuhörer wider Willen beeindruckte.
Dominikus wusste, dass er verloren hatte. Dass niemand hier seine mahnenden Worte hören wollte. Satan hatte sich bereits in die Köpfe dieser Menschen eingeschlichen und sie blind gemacht für die göttliche Wahrheit.
Zornig ballte er seine Hände zu Fäusten, sein rechter Arm schoss drohend in die Höhe, und seine Stimme überschlug sich in glühendem Eifer.
»Seit mehreren Jahren haben wir euch die Sprache des Friedens hören lassen. Wir haben gepredigt, gefleht und geweint. Doch wo der Segen nicht hilft, hilft der Stock.
So werden wir die Fürsten und Prälaten gegen euch aufbringen, und jene werden Nationen und Völker aus allen Ecken der Erde zusammenrufen, und viele werden durch das Schwert umkommen. Eure Städte werden zerstört, ihre Mauern und Türme geschleift werden, und ihr werdet in die Sklaverei wandern. So herrsche denn Gewalt, wenn die Sanftmut scheitert!«
Doch seine Drohungen heizten die Stimmung nur noch mehr an. Wütende Rufe wurden laut, und weitere Rüben flogen durch die Luft.
Da eilte der Führer der Katharer nach vorne und stellte sich schützend vor Dominikus Guzman.
Allein sein Anblick brachte die Menge zum Schweigen. Ruhig, aber bestimmt sah er in die erregten Gesichter, bevor er seine Stimme erhob. Sie klang sanft und mahnend zugleich.
»Hört in euch hinein und ihr werdet wissen, welches der richtige und welches der falsche Glaube ist.
Die sieben Kirchen Asiens waren einst voneinander getrennt, aber keine von ihnen unternahm etwas gegen die Rechte der anderen. Und so hatten sie Frieden untereinander: Macht ihr es ebenso wie diese.«
Kurz drehte der Katharerführer sich zu Dominikus Guzman um und bemerkte dabei den unversöhnlichen Hass, der in den Augen des Mönchs stand, bevor dieser sich abwandte und etwas zu seinen Mitbrüdern sagte, das er aber nicht verstehen konnte. Allerdings kam ihm einer der Brüder merkwürdig bekannt vor. Er musterte ihn aufmerksam und erkannte schließlich den Bischof von Osma in ihm wieder. Er war ihm schon einmal in Lombers begegnet, wohin ihn die katholische Kirche samt seinen Glaubensbrüdern zu einem öffentlichen Disput über den wahren Glauben einbestellt hatte, um festzustellen, welche der beiden Glaubenslehren den Lehren des Evangeliums näherstünde. Der Disput hatte damit geendet, dass der Bischof von Osma alle Katharer mit dem Kirchenbann belegt und Papst Urban II. jedem Laien das Lesen und selbst den Besitz der Heiligen Schrift auf das Strengste untersagt hatte. Nur hatte der Bischof damals, in Lombers, noch keine einfache Kutte getragen, sondern war in Samt und Seide gekleidet gewesen, und mit Juwelen besetzte Goldringe hatten seine behandschuhten Hände geschmückt.
Nicola erinnerte sich noch gut an den herablassenden Blick des Bischofs, nachdem er den katholischen Geistlichen zu bedenken gegeben hatte, dass im Neuen Testament keine einzige Stelle zu finden sei, die von ihnen verlange, üppiger als selbst so mancher Fürst zu leben. Und obwohl der Bischof nun eine schlichte Kutte trug, spiegelte seine Miene noch immer dieselbe Herablassung und Verachtung wider, die er auch bei ihrer ersten Begegnung an den Tag gelegt hatte. Es sind eben nicht die Kleider, die einen wahren Christen ausmachen, dachte Nicola, sondern die Taten.
Die Mönche zogen sich nunmehr auf eine Geste Dominikus Guzmans in die Kirche zurück, und die Menge zerstreute sich. Während die Frauen zum Brunnen zurückgingen, blieben einige der Männer noch in kleineren Gruppen zusammenstehen, andere betraten die Schänke, in der jeden Sonntag Hochbetrieb herrschte.
»Im Norden von Frankreich sind viele Juden verbrannt worden«, erzählte Sarah. Ihre dunklen Augen waren vor Schreck geweitet, und ihr Gesicht war weiß vor Angst. »Meine Eltern gehörten zu den wenigen, die den Häschern der katholischen Kirche entkommen konnten. Sie werden außer sich sein, wenn sie nun von den Drohungen dieser Mönche erfahren.« Elysa legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Hab keine Angst«, sagte sie. »Niemand wird euch etwas tun.« Sie warf Nicola einen auffordernden Blick zu, damit er ebenfalls etwas sagte, was Sarah beruhigen würde. Doch ihr Onkel schüttelte unmerklich den Kopf.
Er war sich sicher, dass es keine weiteren Versöhnungsversuche mit der Kirche mehr geben würde, dafür hatten sich die Fronten zu sehr verhärtet, und auch wenn er nicht wusste, wer die anderen Männer waren, die zusammen mit dem Bischof von Osma nach Rhedae gekommen waren, ahnte er doch, dass ihr Erscheinen nichts Gutes zu bedeuten hatte.
Er hob seinen Blick zu dem düsteren Himmel empor, der das Land, so weit das Auge reichte, wie eine mächtige Kuppel umspannte. Niemals würde die katholische Kirche dessen göttliche Größe und Erhabenheit erreichen. Nicht einmal dann, wenn sie ihre Bauwerke zum Zeichen ihrer Macht, die in Wirklichkeit nichts weiter als Ohnmacht war, in noch so wahnsinnige Höhen trieb. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie ihren Drohungen Taten folgen lassen würde und jeden Menschen, der anders dachte oder glaubte, als sie es erlaubte, vernichtete. Es war an der Zeit, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, auch die, welche Elysa betrafen. Sie war noch zu jung, um ihn auf seinem Weg zu den Sternen zu begleiten, zu jung, um die Tragweite einer solchen Entscheidung zu verstehen.
Ihr Schicksal war ihr durch Geburt vorherbestimmt, durch den Tod der Mutter und durch das Blut des Vaters. Schon bei ihrem ersten Atemzug hatte eine schneeweiße Taube den Turm umkreist, in dem sich das Geburtszimmer befand. Und die sich in den Schwanz beißende Schlange, das Symbol der Ewigkeit, hatte sich über den heiligen Höhlen des Sabarthès bis hinauf zu dem verschneiten Gipfel des Pic de Montcalm erhoben.
Nicola kehrte aus seinen Gedanken in die Gegenwart zurück. Er schüttelte leicht den Kopf und erklärte dann zu Elysas Entsetzen: »Es wird keinen Frieden mehr geben. Die römisch-katholische Kirche wird ihren Worten Taten folgen lassen, weil ihre Worte allein nicht ausreichen, um uns zu bekehren.« Er sah die Angst in den Gesichtern der Mädchen, sogar die alte Anna wirkte beunruhigt. »Sie werden kommen, aber nicht heute und auch nicht morgen, es bleibt uns also noch genügend Zeit, um uns vorzubereiten.«
Sarah machte sich von Elysa los, die ihr tröstend einen Arm um die Schultern gelegt hatte. »Warum lässt Gott das zu?«, fragte sie leise. »Meine Mutter schrickt noch heute beim kleinsten Geräusch hoch und wacht Nacht für Nacht schweißgebadet auf.«
Nicola legte ihr sanft eine Hand auf den Kopf und hielt ihrem Blick stand, bis er spürte, dass sie ruhiger wurde.
»Furcht ist nicht in der Liebe; denn die Furcht hat Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wir aber sollen lieben, denn Er hat uns zuerst geliebt«, zitierte er aus dem Johannesevangelium, und Sarah spürte, wie die Wärme, die von seiner Hand ausging, durch ihren Körper strömte und ihre Angst vertrieb.
Als Nicola fühlte, wie sie sich entspannte, zog er seine Hand zurück, und Sarah lächelte glücklich und beruhigt. Sie hatte die Kraft des göttlichen Geistes gespürt, als Nicola sie berührt hatte, und die Liebe in seinen Augen gesehen, die allen Geschöpfen Gottes gleichermaßen galt. Nicola erwiderte ihr Lächeln. »Richte deinen Eltern aus, dass ihr herzlich willkommen bei unserem Gottesdienst seid. Ich werde euch heute von dem Tröster erzählen, den der Herr uns geschickt hat, um uns in schweren Stunden beizustehen.«
Pater Paul trat aus der Kirche und blickte suchend über den Marktplatz. Als er Nicola entdeckte, seufzte er erleichtert auf und wischte sich mit der Hand den Schweiß aus seinem leicht teigig wirkenden Gesicht. Dann stapfte er entschlossen auf Nicola zu.
»Es ist gut, dass ich Euch noch antreffe«, begann er und warf einen vorsichtigen Blick auf das Portal hinter sich, um sich zu vergewissern, dass sie nicht von einem der Mönche beobachtet wurden. »Das sind keine gewöhnlichen Mönche, wie ich zuerst gedacht habe«, sagte er in verschwörerischem Ton. »Sie sind in Wirklichkeit vom Heiligen Vater ausgesandt worden, um gegen die Ungläubigen vorzugehen, also auch gegen Euch. Das habe ich zufällig mit angehört, als sie sich da drinnen über ihre Mission unterhalten haben.«
»Ja, ich weiß. Einer von ihnen ist der Bischof von Osma. Ich habe ihn wiedererkannt«, entgegnete Nicola. »Wir sind uns schon einmal begegnet.«
»Dann wisst Ihr ja, wie gefährlich diese Leute für uns sind. Sie haben mich aus meiner Kirche hinausgeworfen und mir gedroht, mir meine Pfründe wegzunehmen und mich zu exkommunizieren, wenn ich nicht eine Liste mit den Namen aller Rhedaer anfertige, die nicht am Gottesdienst teilnehmen«, jammerte er. Nicola wunderte sich nicht wirklich darüber, dass Pater Paul bei ihm Beistand suchte anstatt bei seinen katholischen Glaubensoberen. Sie hätten eigentlich Konkurrenten sein müssen, aber Nicola hegte schon seit Längerem den Verdacht, dass Pater Paul insgeheim froh darüber war, dass er ihm seine Schäfchen abspenstig machte und ihm dadurch auch die damit verbundenen seelsorgerischen Pflichten abnahm.
»Vielleicht wäre es klüger, nur die Namen der Menschen aufzuschreiben, die an Eurem Gottesdienst teilnehmen«, schlug Nicola vor.
Pater Paul sah ihn fragend an. »Es ist doch einfacher, sieben oder acht Namen aufzulisten, als fast alle Bewohner von Rhedae«, erklärte ihm Nicola ruhig.
Pater Paul nickte eifrig. »Ihr habt recht, es ist nur so, ich meine, es ist viel Zeit vergangen, seitdem ich die Klosterschule verlassen habe, und ich war nie der beste Schüler.«
»Ihr braucht also jemanden, der Euch beim Schreiben behilflich ist?«, vermutete Nicola.
Pater Paul nickte wieder und wirkte nun regelrecht erleichtert.
»Und vielleicht könnte man ja ein paar Namen mehr auf die Liste setzen«, schlug er vor, ohne den Katharerführer dabei anzusehen.
»Ihr meint, das würde ein besseres Licht auf Euch werfen?«
Pater Paul nickte verlegen und mied weiterhin Nicolas Blick.
»Schließlich ist es ja auch ein wenig Eure Schuld, dass meine Kirche ständig leer bleibt«, meinte er vorwurfsvoll.
»Eine interessante Sichtweise«, bemerkte Nicola. »Ihr überseht dabei nur, dass unser Gottesdienst stets nach dem Euren stattfindet, damit niemand sich zwischen unseren beiden Glaubensrichtungen entscheiden muss.«
»Ihr braucht mich nicht auch noch zu verhöhnen«, beschwerte sich Pater Paul mürrisch.
»Nichts liegt mir ferner, aber habt Ihr einmal darüber nachgedacht, dass vielleicht mehr Gläubige an Eurem Gottesdienst teilnehmen würden, wenn Ihr Euren Lebenswandel ein wenig ändern würdet? Die Menschen wünschen sich einen Hirten, der so lebt, wie der Herr es uns gelehrt hat, und dem sie nacheifern können.«
»Ihr habt doch selbst gesagt, dass nicht alle Menschen gleich stark im Glauben sind, und ich gehöre eben zu den Schwächeren«, erklärte Pater Paul unbeirrt.
»Nur dass die katholische Kirche das ein wenig anders sieht als wir«, gab Nicola zu bedenken.
»Also werdet Ihr mir mit der Liste helfen?«, fragte Pater Paul und sah Nicola bittend an.
»Ich komme gleich nach dem Gottesdienst zu Euch und werde Euch als Schreiber zur Verfügung stehen«, versprach Nicola, »aber jetzt würde ich gerne meine Predigt vorbereiten.«
Peter von Castelnau hatte das Kirchenportal hinter sich zugezogen und wischte sich nun mit dem Ärmel seiner Kutte den Schweiß von der breiten Stirn, das Gesicht rot vor Wut. »Wir haben soeben ein weiteres Mal erleben müssen, wie unbelehrbar diese Ketzer sind. Seit Monaten predigen wir zu ihnen, ohne einen einzigen von ihnen bekehrt zu haben. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, deshalb denke ich nicht daran, auch nur noch einen Tag länger zu Fuß durch dieses verfluchte Land zu ziehen«, empörte er sich und musterte Arnold Amaury dabei böse. Denn schließlich war der Abt von Cîteaux schuld daran, dass sie wie Bettelmönche von einem Ort zum anderen zogen. Hatte dieser verrückte Dominikaner ihnen doch tatsächlich eingeredet, dass es notwendig sei, ihre Gewänder gegen diese armseligen Kutten zu tauschen und wie einst Jesus durchs Land zu ziehen, um die Ketzer auf diese Weise mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Dieser Arnold Amaury würde doch tatsächlich alles tun, um den Auftrag, den der Heilige Vater ihm erteilt hatte, zu erfüllen. Und das nur, weil er hoffte, dass der Papst ihn für seine Mühen eines Tages mit einem Kardinalshut oder einem Bistum belohnen würde.
Aber er, Peter von Castelnau, war nicht Legat des Papstes geworden, um wie ein Bettler herumzulaufen, im Stroh zu schlafen und sich von hartem Brot und stinkendem Ziegenkäse zu ernähren, während es sich die Bischöfe im kühlen Schatten ihrer prächtigen Paläste gut gehen ließen, in weichen Betten schliefen und knusprig gebratene Fasanenschenkel verzehrten, wo es doch ihre Aufgabe war, sich um die Ketzer in ihren Bistümern zu kümmern.
Er hielt inne. Ein triumphierendes Lächeln hellte sein breites Gesicht auf, als ihm dämmerte, dass er soeben die Lösung für all ihre Probleme gefunden hatte.
Arnold Amaury wiederum hob als Reaktion auf den empörten Ausbruch Castelnaus hin, der sich, wie er fand, für einen Mann dieses Standes nicht geziemte, nur mitleidig die Augenbrauen.
Eigentlich hatte Peter von Castelnau vorgehabt, seinen Triumph so richtig auszukosten, doch dieser verfluchte Abt schaffte es immer wieder, ihn durch seine herablassende Art in Rage zu versetzen.
»Wir werden allen Bischöfen im Süden von Frankreich mit der einstweiligen Enthebung von ihren Ämtern drohen und die Grafen und Fürsten mit dem Interdikt belegen, und zwar so lange, bis sie ihre verdammten Ketzerfreunde dazu gebracht haben, zum wahren Glauben zurückzukehren«, platzte Castelnau deshalb nun heraus und sah voller Genugtuung, wie sich Arnold Amaurys Miene verdüsterte.
Seit Jahren kämpften der Bischof und er schon um die Gunst des Heiligen Vaters und versuchten, sich gegenseitig zu übertreffen. Und nun würde er, Castelnau, als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen, schon bald mit einem großen Bistum belohnt werden und wie ein Fürst leben, während Arnold Amaury in seinem Kloster versauern würde. Er warf einen raschen Blick auf den Bischof von Osma, der ihm anerkennend zunickte, und frohlockte innerlich.
»Dann ist es also beschlossen«, sagte er und gab sich keine Mühe, seinen Triumph zu verbergen. »Ich werde noch heute einen Brief an den Heiligen Vater schreiben, in dem ich ihm unseren Vorschlag unterbreite.«
Während der blinde Jean auf dem Marktplatz seine Hündin noch immer vor die Brust gedrückt hielt und seinen Oberkörper dabei vor und zurück wiegte, ging Sarah mit der alten Anna zum Brunnen, nachdem Elysa ihr erklärt hatte, dass sie noch kurz mit Rorico sprechen und dann nachkommen wollte. Suchend blickte sich die junge Frau nun nach dem Nachbarssohn um, der ihr bester Freund war, und entdeckte ihn schließlich mit einigen anderen jungen Männern vor dem Haus der Martins, die mit dem Handel von Färberwaid-Stoffen reich geworden waren. Auf dem Boden neben ihnen standen halb mit Rüben gefüllte Säcke, die vermutlich aus der Vorratskammer der Martins stammten. Die zwei Söhne der Martins, Bernard und Arnaud, waren bei jeder Rauferei in Rhedae mit dabei und allerortens für ihre Wildheit und Zügellosigkeit bekannt. Elysa war deshalb keineswegs überrascht, dass sie zu den Rübenwerfern gehört hatten. Seit dem Tod ihres Vaters im letzten Jahr war es sogar noch schlimmer mit ihnen geworden, da es niemanden mehr gab, der ihrer Rauflust Einhalt gebot. Aber dass Rorico, der so etwas wie ein großer Bruder für sie war, ihnen beim Rübenwerfen geholfen haben sollte, überraschte Elysa.
»Wir könnten die Mönche unten im Tal abfangen und ordentlich verprügeln«, hörte Elysa Bernard gerade sagen, als sie auf die jungen Männer zuging. »Ich lass mir doch nicht von ein paar dahergelaufenen Bettelmönchen auf meinem eigenen Grund und Boden drohen.« Herausfordernd sah er in die Runde. »Wer von euch ist dabei?« Er führte den Krug, den er in der Hand hielt, zum Mund und trank dann direkt aus dessen Schnabel, bevor er ihn an seinen Bruder weiterreichte.
Entschlossen trat Elysa zu der Gruppe. Bernard stierte sie mit glasigen Augen an. Es war nicht zu übersehen, dass er schon mehr Wein getrunken hatte, als ihm guttat. »Du kommst mir gerade recht«, erklärte er ihr leicht lallend, »wenn dein Onkel sich nicht eingemischt hätte, hätten wir es denen mal so richtig gegeben.« Die Enttäuschung über die ihm entgangene Prügelei war ihm deutlich anzumerken.
Doch Elysa schenkte ihm keinerlei Beachtung, sondern wandte sich direkt an Rorico. »Ich muss mit dir reden.« Roricos Blick huschte unsicher zu Bernard, als ob er dessen Erlaubnis einholen wollte. »Sprich ruhig mit Elysa und geh dann zurück zu deinen Ziegen und Schafen, wo du hingehörst«, stieß Bernard höhnisch hervor. »Ihr Hirten seid nun mal nicht zum Kämpfen geboren.
»Genauso wenig wie die Söhne von Händlern und Bauern«, konnte Elysa sich nicht verkneifen zu sagen. Bernard betrachtete sie mit zusammengekniffenen Augen. »Was weißt du denn schon vom Kämpfen? Ich hingegen war bereits bei einem richtigen Turnier dabei.« Er genoss die neidischen Blicke seiner Freunde, die ihn erwartungsvoll ansahen. Obwohl sie die Geschichte schon kannten, konnten sie sie gar nicht oft genug hören, weil Bernard sie immer wieder ausschmückte und mit neuen, spannenden Details anreicherte.
Bernards Interesse an Elysa erlosch augenblicklich. Er gähnte mit offenem Mund, reckte sich und nahm noch einen weiteren Schluck Wein. Dann begann er, von dem Turnier in Carcassonne zu erzählen, von mächtigen Rössern und Rittern in glänzenden Rüstungen mit Lanzen und Schwertern und von hübschen Mädchen, nach denen man nur mit den Fingern zu schnippen brauchte, wenn einem danach war.
Elysa schob sich näher an Rorico heran, obwohl sie ahnte, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn sie einfach wieder verschwunden wäre. Aber darauf konnte sie jetzt keine Rücksicht nehmen.
»Weißt du vielleicht jemanden, der gerade Welpen hat?« Rorico runzelte angesichts der Störung unwillig die Stirn. Ebenso wie die anderen Jungen hing er an Bernards Lippen und lauschte gebannt dessen Worten. Er kannte Elysa allerdings gut genug, um zu wissen, dass sie keine Ruhe geben würde, bis er ihr nicht auf ihre Frage geantwortet hätte. Und dass sie Bernard nicht mit dem geringsten Respekt begegnet war, hatte ihn gewaltig beeindruckt. »Komm morgen mit auf die Sommerweiden. Dort treffen wir den alten Pierre. Seine Hündin hat vor ein paar Wochen geworfen«, sagte er deshalb und wandte sich dann demonstrativ wieder Bernard zu.
Das aufgeregte Blöken der Lämmer und Schafe empfing Elysa, als sie am nächsten Morgen außer Atem die Pferche am Rande der Stadt erreichte.
Rorico stand in der typischen Haltung eines Schäfers, mit beiden Händen auf seinen selbst geschnitzten Stock gestützt, neben dem Gatter und zählte mit angestrengter Miene die Schafe, die aus dem Pferch hinaus an ihm vorbeiliefen. Elysa trat ans andere Ende des Gatters und sah ihm belustigt zu.
»Soll ich dir vielleicht helfen?«, fragte sie, um ihn zu necken.
Rorico gab ihr keine Antwort. Er war stolz auf die Verantwortung, die sein Großvater ihm übertragen hatte, und wollte sich auf keinen Fall verzählen.
Erst als alle Schafe den Pferch verlassen hatten und der Weide zustrebten, wandte er sich Elysa zu.
»Ich bin so weit«, sagte er und bemühte sich, seiner Stimme einen tieferen Klang zu geben, um erwachsener zu wirken.
Die Schafe liefen Elysa und Rorico voraus und bogen nach einer Weile auf den schmalen, ihnen bekannten Pfad ein, der sie auf einen Hügel mit fetten, saftigen Wiesen führte.
Ein warmer Wind umschmeichelte Elysas Gesicht, und die Sonne schien heiß auf sie hinab. Sie wusste, dass es Roricos größter Wunsch war, Schäfer zu werden, und freute sich darüber, dass er seinem Ziel so nahe war.
»Ich werde Großvater beweisen, dass ich ein guter Schäfer bin, dann wird er mir die Schafe schon bald ganz überlassen«, sagte er voller Überzeugung.
»Ich werde dir dabei helfen«, meinte Elysa ernst.
»Ich schaffe das auch ohne ein kleines Mädchen wie dich«, meinte Rorico und warf sich übertrieben in die Brust.
»Du bist ein Angeber!« Übermütig boxte Elysa den Freund in die Rippen.
»Wenn du so weitermachst, werde ich dir kein Essen mehr bringen, und du musst dich vom Gras ernähren wie deine Schafe«, drohte sie ihm lachend.
Ihr Lachen löste ein warmes Gefühl in ihm aus; doch da war noch etwas anderes, etwas, das genauso fremd wie schön war. In den letzten Tagen hatte Rorico sich mehrmals dabei ertappt, auf die sanfte Wölbung ihrer Brust zu starren, die seit einiger Zeit nicht mehr zu übersehen war. Elysa war kein kleines Mädchen mehr, und die Gedanken, die ihr Anblick in ihm auslöste, waren ebenso beunruhigend wie faszinierend.
Wie schön wäre es doch, Elysa zum Eheweib zu haben, dachte Rorico bei sich. Er sehnte sich danach, sie berühren zu dürfen, ihre weiche Haut zu spüren und seine Hände durch ihr langes, seidiges Haar gleiten zu lassen, doch er hatte bisher nicht den Mut gehabt, sie zu fragen, ob sie ihn heiraten wollte.
Elysas Familie gehörte den Guten Christen an, so wie die meisten Leinenweberfamilien in Rhedae, und Nicola, ihr Onkel, war einer ihrer geistigen Führer. Obwohl Roricos Familie nicht dem Glauben der Guten Christen anhing, hatte ihn sein Großvater zusammen mit seiner Mutter schon mehrmals zu deren sonntäglichen Versammlungen mitgenommen. Gemeinsam hatten sie den Worten der Heiligen Schrift gelauscht, die sie alle verstehen konnten, da sie im Gegensatz zu den kirchlichen Gottesdiensten nicht in Latein, sondern in ihrer Sprache gelesen wurden.
Um Elysa heiraten zu können, würde er mit Freude zu ihrem Glauben übertreten, der Hoffnung versprach, wo die katholische Kirche mit ewiger Verdammnis drohte. Zumindest meinte das sein Großvater, der selbst lieber das Consolamentum erhalten wollte als die letzte Ölung, wenn es für ihn ans Sterben ging.
Eines der Lämmer hatte seine Mutter verloren und blökte so jämmerlich, dass Elysa sich bückte und es auf den Arm nahm. Rorico beobachtete gebannt jede ihrer Bewegungen, als sie es zu seiner Mutter zurückbrachte.
»Warum starrst du mich so an? Habe ich etwa eine Warze im Gesicht?«, fragte sie ihn lachend. Er glaubte, leisen Spott in ihrer Stimme zu hören, und wandte sich verlegen ab. Eine Weile liefen sie schweigend nebeneinander her. »Nicola hat gesagt, es wird keinen Frieden mehr geben«, sagte Elysa und wirkte mit einem Mal überhaupt nicht mehr fröhlich.
»Wegen der Mönche, die gestern da waren und uns gedroht haben?«, wollte Rorico wissen.
Elysa nickte.
»Meinetwegen können sie kommen«, erklärte er wichtigtuerisch. »Ich habe keine Angst vor ihnen und auch nicht vor ihren Stöcken.« Er hob seinen selbst geschnitzten Knotenstock und demonstrierte seine Furchtlosigkeit, indem er ihn wie ein Schwert durch die Luft wirbelte.
Doch Elysa war nicht so leicht zu beruhigen.
»Sarah hat gemeint, die Mönche wären nicht die, die sie vorgeben zu sein.«
»Und wer sind sie dann?«
»Jedenfalls sind sie keine gewöhnlichen Mönche. Ich habe meinen Onkel gefragt, und er meinte, der Papst habe die Geistlichen zu uns geschickt. Persönlich.«
Rorico winkte ab.
»Das waren doch nur ein paar betagte Mönche, die rasch gemerkt haben, dass sie nichts gegen uns ausrichten können, sonst wären sie nicht so schnell wieder aus Rhedae verschwunden.«
Elysa schüttelte energisch den Kopf.
»Sie werden nicht so schnell aufgeben. Die katholische Kirche ist aufgebracht, weil ihr die Gläubigen in vielen Städten Südfrankreichs nicht mehr den Zehnten zahlen, und uns gibt sie die Schuld daran.«
Rorico runzelte angestrengt die Stirn.
»Davon haben die Mönche aber nichts gesagt. Vom Zehnten meine ich.«
»Sie haben auch nicht gesagt, wer sie wirklich sind.«
Rorico war beeindruckt. Es gab kein Mädchen, das so schön und klug war wie Elysa. Sie hatten sich ins warme Gras gesetzt. Elysas Rock war nach oben gerutscht, und Rorico konnte ihre wohlgeformten weißen Schenkel sehen. Ihm wurde ganz heiß bei diesem Anblick. Er vergaß darüber sogar, wie hungrig er gerade eben noch gewesen war. Elysa packte Brot und Käse aus und zupfte ihren Rock zurecht. Hatte sie etwa seinen Blick bemerkt oder schlimmer noch: das Verlangen, das ihn seitdem erfüllte? Er beobachtete, wie sie ihr Messer aus der Lederscheide zog, die neben der kleinen Tasche an ihrem Gürtel hing, ein Stück von dem Brot abschnitt und den Käse in zwei unterschiedlich große Stücke teilte. Sie reichte ihm das größere Stück und begann, an dem kleineren zu knabbern, das sie für sich behalten hatte.
Eine Weile aßen sie schweigend. Elysa lehnte sich zurück, stützte den Oberkörper auf den Ellenbogen ab und blickte in den tiefblauen Himmel. Dicke weiße Wolken zogen träge über sie hinweg.
»Glaubst du, dass Tiere eine Seele haben, so wie wir?«
Rorico schaute nachdenklich zu seinen Schafen hinüber. »Es kann schon sein, dass sie eine haben, aber vielleicht fragst du besser Pater Paul danach. Oder deinen Onkel«, schlug er vor und überlegte erneut, ob er ihr nicht einfach seine Liebe gestehen sollte.
»Was willst du eigentlich mit dem Welpen?«
»Ich brauche ihn für den blinden Jean, damit er nicht mehr so traurig ist«, erklärte Elysa.
Verstimmt biss Rorico in sein Brot. Elysa hatte von den Mönchen gesprochen, von Sarah und vom Zehnten. Dann hatte sie darüber nachgedacht, ob Tiere Seelen hatten, und jetzt machte sie sich Gedanken um einen blinden Bettler. War bei all diesen Menschen überhaupt noch Platz für ihn?
Vielleicht hatte seine Mutter recht, und Elysa war wirklich nicht die richtige Frau für ihn. Trotzdem hatte er sich noch nach keinem anderen Mädchen so sehr gesehnt wie nach ihr.
2
Toulouse, April 1207
»Die Legaten des Papstes sind eingetroffen«, meldete Gordon von Longchamp und blieb abwartend in der Tür zum Privatgemach des Grafen von Toulouse stehen. Raimund VI. betrachtete den dunkelblonden Ritter nachdenklich. Der drittgeborene Sohn von Hugues de Longchamp war vor zehn Jahren im Gefolge Johanna Plantagenets, der Schwester von Richard Löwenherz, nach Toulouse gekommen. Johanna war seine dritte Gemahlin geworden, und Gordon war in seinen Dienst getreten, als seine Herrin drei Jahre später überraschend gestorben war. Raimund hatte Gordon selbst zum Ritter geschlagen und es nie bereut, ihn in seine Ritterschaft aufgenommen zu haben. Aus dem ungestümen Jungen von damals war ein athletisch gebauter Kämpfer geworden, der mit dem Schwert umzugehen verstand wie kaum ein anderer und der ihm darüber hinaus treu ergeben war.
»Und was hast du für einen Eindruck von dieser erlauchten Gesandtschaft?«
Gordon von Longchamp hatte sich längst daran gewöhnt, dass der Graf von Toulouse ihn ab und an nach seiner Meinung fragte, zumal er seinem Herrn grundsätzlich nur das sagte, was er auch dachte, und sich darin wohltuend von den meisten anderen Höflingen unterschied, die den Grafen ständig umschmeichelten. »Man könnte meinen, der Papst wäre höchstpersönlich erschienen«, erwiderte er und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Raimund lächelte nun ebenfalls.
»Dann werden wir sie wohl auch entsprechend behandeln müssen, um ihr Wohlwollen zu gewinnen«, sagte er und zweifelte nicht im Geringsten daran, dass ihm dies gelingen würde.
Es war das zweite Mal, dass die Kirche seine Ländereien mit dem Interdikt belegen und ihn exkommunizieren wollte, weil er nichts gegen die als Häretiker geltenden Katharer und die Juden in seinem Land unternahm und den Kirchen und Klöstern seine Hilfe bei der Bekämpfung der Ketzer verweigerte. Seine Toleranz gegenüber Andersgläubigen hatte zu einem seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt zwischen ihm und der katholischen Amtskirche geführt. Irgendwann war er der ständigen Drohungen und Klagen leid gewesen und hatte erklärt, es wäre allein die Sache der Bischöfe, die Häresie zu bekämpfen, während es seine Aufgabe sei, sich mit weltlichen Angelegenheiten zu befassen. Das hatte den damaligen Papst Coelestin III. so sehr erzürnt, dass er ihn im Jahre elfhundertsechsundneunzig mit dem Kirchenbann belegt hatte. Selbst der Umstand, dass Raimund daraufhin versichert hatte, er sei ein genauso guter Christ wie sein Vater und sein Großvater, die beide im Heiligen Land ihr Leben gelassen hatten, nutzte ihm nichts. Der Heilige Vater hatte sich weiterhin geweigert, den gegen ihn verhängten Bann wieder aufzuheben. Erst sein Nachfolger, Papst Innozenz III., hatte ihn zwei Jahre später vom Bann losgesprochen, und danach war alles weitergegangen wie bisher.
Er würde die leidige Sache mit dem drohenden zweiten Bann auf die gleiche Art und Weise aus der Welt schaffen, wie er es schon das erste Mal getan hatte: Indem er die Legaten fürstlich bewirtete, ihnen anschließend den reumütigen Sünder vorspielte und ihnen dann versicherte, all ihre Bedingungen anzunehmen.
Gordon folgte dem Grafen von Toulouse in den großen Saal. Schon auf dem Weg dorthin wehte ihnen der Duft von Gebratenem, würzigen Kräutern und köstlichen Backwaren entgegen.
Raimund VI. hatte seinen Truchsess, den Juden Nathan, beauftragt, den päpstlichen Legaten Peter von Castelnau und seine beiden Begleiter, Bruder Raoul und Ritter Albert, zu den Ehrenplätzen an der mit weißem Linnen bedeckten Tafel zu geleiten. Pater Stephan, der Burgkaplan, staunte nicht schlecht, als er ebenfalls einen Platz am oberen Ende der Tafel zugewiesen bekam und nicht wie üblich eingekeilt zwischen dem ewig mürrischen Stallmeister und dem zänkischen Falkner sitzen musste.
Der Truchsess, der ihn normalerweise kaum beachtete, schenkte ihm höchstpersönlich Wein in seinen Becher, und als Peter von Castelnau seinen Becher hob und ihm ganz selbstverständlich zunickte, als wäre er einer der Seinen, konnte er sein Glück kaum fassen. Die heilige Mutter Kirche war in der Gestalt ihres Legaten erschienen, um endlich die gerechte Ordnung wiederherzustellen, zu der auch gehörte, dass man ihre Priester mit dem ihnen zustehenden Respekt behandelte.
Seit dem Tod des vorangegangenen Grafen, Raimund V., der ein tapferer Kreuzritter und strenggläubiger Katholik gewesen war, hatte sich einiges am Hofe der Grafen von Toulouse geändert. Die Oberhäupter der Katharer, der Guten Christen oder auch der Vollkommenen, wie sie allgemein hießen, wurden, sobald sie auftauchten, voller Ehrfurcht begrüßt und an der Tafel eigenhändig vom Grafen bedient, während man ihn schlichtweg übersah, so als wäre er gar nicht vorhanden. Offiziell war er zwar noch immer der Beichtvater Raimunds VI., aber es war viele Jahre her, dass der Graf das letzte Mal nach seinem geistigen Beistand verlangt hatte. Er hatte sich damit abgefunden, weil ihm nichts anderes übrig geblieben war.
Peter von Castelnau, der links neben ihm saß, unterbrach ihn in seinen Gedanken und beugte sich vertraulich zu ihm hinüber. »Es ist sicher nicht einfach für Euch, unter all diesen Ungläubigen zu leben«, meinte er.
Pater Stephan war gerührt ob so viel ungewohnter Anteilnahme. »Ich bete Tag und Nacht für die Seele des Grafen und die anderen verlorenen Seelen hier am Hof«, beteuerte er. Peter von Castelnau sah ihm direkt ins Gesicht. »Wir wissen, dass Ihr Eure Pflicht gewissenhaft erfüllt und auch, dass Ihr Euch ganz besonders um Eure weiblichen Schäfchen verdient gemacht habt.« Der Tonfall von Castelnaus Stimme war mit jedem Wort schärfer geworden, bis am Ende jede Freundlichkeit aus ihr verschwunden war.
Pater Stephan erbleichte. Wenn die Gesandtschaft des Heiligen Vaters von seinem heimlichen Verhältnis mit der Wäscherin Marguerite wusste, was wussten sie dann noch? Dass er bei der Beichte kleinere und größere Gefälligkeiten für die Erteilung der Absolution entgegennahm? Mal ein Fässchen Wein, einen Schinken oder ein Lammfell gegen die Kälte im Winter?
Er wagte es nicht, den Legaten des Papstes länger anzusehen, und senkte seinen Blick wie ein ertappter Sünder. Peter von Castelnau fuhr daraufhin in einem etwas milderen Ton zu sprechen fort, aber vielleicht kam es ihm auch nur so vor, weil der Gesandte nun so leise sprach, dass er fast schon flüsterte. »Wir wünschen einen wöchentlichen Bericht über alles, was an diesem Hof vor sich geht. Behaltet insbesondere den Grafen im Auge und stellt fest, mit wem er sich trifft, an wen er Boten sendet, wer seine wahren Freunde sind und wer seine Feinde. Euren Bericht hinterlegt ihr am Vorabend eines jeden Sonntags auf dem Boden hinter dem Altar.« Pater Stephan wurde es auf einmal ganz anders. Ausgerechnet er sollte seinen Herrn bespitzeln? Wenn das herauskäme, wäre er endgültig erledigt. Er fuhr sich über den fast kahlen Schädel, der nur noch von einem schmalen Kranz struppiger gelber Haare bewachsen war, und sah den Legaten des Papstes bittend an. »Euer Vertrauen ehrt mich, Ehrwürden, aber ich bin nur ein einfacher Priester und verstehe nicht viel von solchen Dingen.« Er öffnete den Mund, um etwas hinzuzufügen, doch der scharfe Blick des Truchsesses ließ ihn verstummen. Peter von Castelnau wedelte Nathan mit einer ungeduldigen Handbewegung fort, obwohl dieser nur in Ausübung seines Amtes zu ihnen getreten war, um sich zu vergewissern, dass sich noch genügend Wein in ihren Bechern befand. Dabei hatte Nathan allerdings auch die Gelegenheit genutzt, Pater Stephan einen warnenden Blick zuzuwerfen.
»Der Kerl, der uns bedient, ist ein Jude, oder nicht?« Peter von Castelnau, dem der Blickwechsel zwischen den beiden Männern nicht entgangen war, sprach so laut, dass der Truchsess ihn hören musste. Pater Stephan fühlte sich immer unbehaglicher. Er nickte nur wortlos und sah sich vorsichtig um, um festzustellen, wie Nathan auf die abfällige Bemerkung des Legaten reagieren würde. Doch der Truchsess ließ sich nichts anmerken. Mit unbewegter Miene verrichtete er seinen Dienst an der Tafel, wies den Mundschenk an und erteilte den Dienern Befehle.
»Ihr fürchtet Euch doch nicht etwa vor einem Juden?«, fragte Peter von Castelnau ungläubig, dem der ängstliche Blick des Priesters nicht entgangen war. Pater Stephan begann zu schwitzen. Der Legat des Papstes hatte gut reden. Er würde schon bald wieder abreisen, während er selbst hierbleiben und zusehen musste, wie er zurechtkam. Es gab Gerüchte, dass die Juden im Norden von Frankreich nicht sonderlich angesehen waren und bisweilen sogar verfolgt wurden, aber in Toulouse besaßen alle Bürger die gleichen Rechte, und zudem war der Truchsess auch noch ein besonderer Günstling des Grafen. Pater Stephan war noch immer dabei, sich zu überlegen, wie er sich am besten aus der Affäre ziehen konnte, als der Graf mit seinem Gefolge den Saal betrat und seinen Platz an der Tafel einnahm. Die Musikanten begannen zu spielen, und der erste Gang wurde aufgetragen. Pater Stephan bemerkte erleichtert, wie das Interesse des Legaten an seiner Person augenblicklich nachließ. Die knusprigen Rehkeulen, die zum ersten Gang gereicht wurden, waren mit Honig übergossen und dufteten einfach himmlisch. Dazu wurden junge, in Milch gekochte Bohnen, Früchte und weißes Brot gereicht. Es folgten Hasen- und Entenpasteten, Krebse und Aale in verschiedenen Soßen, ein mächtiges Wildschwein, das von den Dienern geschickt in mundgerechte Stücke zerteilt wurde, und süße Törtchen in geflochtenen Körben. Es war ein Festmahl, das es nur an ganz besonderen Tagen gab. Raimund von Toulouse war der vollendete Gastgeber, der Höflichkeiten mit den neben ihm sitzenden Gesandten austauschte, sobald die Spielleute aufhörten zu musizieren, sodass man meinen konnte, hätte man es nicht besser gewusst, er wäre seinen Gästen freundschaftlich verbunden. Pater Stephan hatte die Köstlichkeiten nicht so recht genießen können. Sosehr er die Aufmerksamkeit der hohen Kirchenherren zu Anfang genossen hatte, sosehr wünschte er sich nun, man hätte ihn einfach in Ruhe gelassen.
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete er, wie Peter von Castelnau sich das dritte Törtchen in den Mund schob und es mit einem großen Schluck Wein hinunterspülte. Als hätte der Legat seinen Blick gespürt, neigte er leicht den Kopf in seine Richtung.
»Gleich werdet Ihr Zeuge sein, wie die Kirche mit den Feinden des wahren Glaubens verfährt«, erklärte er, und obwohl es fast beiläufig klang, spürte Pater Stephan, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Peter von Castelnau nahm das Tischtuch, wischte sich damit die Krümel und das Fett vom Kinn und aus den Mundwinkeln, rülpste vernehmlich und richtete seinen Blick geradewegs auf den Grafen von Toulouse.
»Wahrlich ein köstliches Mahl, von einem Juden serviert und einem Verräter gerichtet«, sagte er dann so laut, dass ein jeder an der Tafel es hören konnte. Seine Worte waren ungeheuerlich. Die Ritter am oberen Ende der Tafel sprangen auf. Eine Bank wurde umgestoßen, und die Hunde unter der Tafel begannen zu bellen. Waffenmeister, Jagdaufseher und Schreiber ließen Messer und Becher sinken, das Kichern der Damen erstarb, und die Dienerschaft erstarrte. Alle Blicke richteten sich auf den Legaten des Papstes, der sich, noch während er sprach, erhoben hatte und mit dem Finger anklagend auf seinen Gastgeber wies.
»Du, Graf Raimund von Toulouse, bist ein Meineidiger und ein Verräter an der heiligen katholischen Kirche, den der Papst zu Recht zum zweiten Mal mit dem Bann belegt.«
Die Stille im Saal war erdrückend. Niemand wagte es, sich zu bewegen oder auch nur zu atmen, und selbst die Kerzen in den silbernen Leuchtern schienen nicht mehr zu flackern.
Der Graf führte seelenruhig, ohne irgendeine Reaktion zu zeigen, seinen Becher zum Mund und befeuchtete seine Kehle mit einem Schluck des rubinroten Weins, der aus den Weinbergen des Artois stammte und dessen Geschmack mit keinem anderen Wein zu vergleichen war.
»Ist es im Vatikan üblich, seinen Gastgeber zu beleidigen?«, fragte er schließlich gelassen.
Peter von Castelnau kniff die Augen zusammen. Er bebte am ganzen Körper vor Wut.
»Wir sind gekommen, um Euch die Hand zur Versöhnung zu reichen, und Euch fällt nichts Besseres ein, als uns zu beleidigen, indem Ihr uns von einem Juden bedienen lasst? Der Zorn des Allmächtigen wird über Euch kommen und wird Euch zermalmen.« Seine Faust krachte heftig auf die Tafel nieder, als wolle von Castelnau damit den Zorn des Herrn demonstrieren. Einige der Anwesenden zuckten erschrocken zusammen.
Doch Raimund VI. musterte den päpstlichen Legaten nur mit einem kühlen Blick.
»Die Freiheit des Glaubens ist ein Bestandteil unserer Tradition. Wir sind deswegen keine schlechteren Christen.«
»Ihr sprecht wie ein Ketzer.«
»Ich bin Ritter und Christ.«
»Dann beweist es, indem Ihr schwört, fortan der Kirche zu dienen, die Ketzerei auszurotten und alle Juden aus ihren Ämtern zu entlassen«, beharrte Peter von Castelnau.
»Ihr wisst genau, dass ich diese Forderungen nicht erfüllen kann«, erwiderte der Graf.
»Dann werdet Ihr ein Ausgestoßener bleiben, und der Zorn des Herrn wird Euch und Euer Land zerschmettern«, erklärte Peter von Castelnau ungerührt.
Es gab nichts weiter zu sagen. Der Abgesandte des Papstes gab seinen Gefährten ein Zeichen zum Aufbruch. Unter eisigem Schweigen verließen die Kleriker den Saal.
In dieser Nacht fand der Graf von Toulouse keinen Schlaf. Zu viele Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Einer seiner Agenten hatte ihm noch am Abend zuvor berichtet, dass Papst Innozenz III. eine Allianz mit dem König von Frankreich geschlossen hatte. Ziel dieser Allianz war es, alle Ketzer im Süden des Reiches zu vernichten. Nun gab es keinen Zweifel mehr: Dieses Mal machte die Kirche ihre Drohungen wahr.
Das Herrschaftsgebiet der Grafen von Toulouse reichte von Agen im Westen bis zum Marquisat de Provence und schloss das Herzogtum Narbonne, die Grafschaft Foix, das Quercy, das Toulousain, Rouergue und Vivarais ein. Raimund VI. war de facto gleichzeitig Vasall des Königs von Frankreich und des Heiligen Vaters und im Fall der Grafschaft von Melgueil bei Montpellier sogar ein Vasall der Kurie. Zugleich aber war er alleiniger und unabhängiger Herrscher über das Languedoc, auch wenn er sich die Macht in den Städten mit dem jeweiligen Rat und den von Bürgern gewählten Konsuln teilte.
Und diese Unabhängigkeit, auf die sie alle so stolz waren und die dem König von Frankreich schon lange ein Dorn im Auge war, stand nun auf dem Spiel.
Die im Languedoc auf demokratischen Prinzipien beruhende soziale Ordnung, zu der auch die Freiheit des Glaubens gehörte, war im Süden Frankreichs fest verwurzelt. Der offene Dialog zwischen seinen Bewohnern Bestandteil des Alltags. Wenn man diese Wurzeln durchschnitt, zerstörte man auch den Baum, seine Äste, seine Blätter.
Die Absätze seiner Stiefel bohrten sich in den harten Lehmboden, als er den einsam daliegenden, in Dunkelheit getauchten Burghof überquerte. Es hatte lange nicht geregnet, und der Boden war trocken und rissig. Wenn nicht bald Regen käme, würde die Ernte auf den Feldern vertrocknen, und man würde ihm die Schuld daran geben, nicht etwa dem König oder dem Papst. Das Volk war wie ein knurrendes Raubtier, solange man es fütterte, blieb es ruhig, aber wehe, es musste hungern.
Er bemühte sich leiser aufzutreten, schlich wie ein Dieb durch die Nacht, und sein Zorn auf Papst und König, die ihm ihren Willen aufzwingen wollten, wuchs mit jedem Schritt. Er sehnte sich nach der Stille seiner Kapelle, obwohl ihm aufgrund des Kirchenbanns das Betreten jedes Gotteshauses verboten war. Sie können mich exkommunizieren, aber den Zutritt zu meiner Kapelle können sie mir nicht verwehren, so weit reicht selbst ihre Macht nicht, überlegte Raimund grimmig.
Ein Lichtstreifen über der Wehrmauer kündigte den neuen Tag an. Ein auffrischender Wind wehte ihm entgegen und führte den Geruch von feuchter Erde und aufsteigenden Pflanzensäften mit sich. Es wird bald regnen, dachte er erleichtert.
Vor ihm ragte der schmale Glockenturm in den heller werdenden Himmel.
Er streckte die Hand nach dem eisernen Türriegel aus und wäre fast über den kleinen, leblosen Körper gestolpert, der vor dem Kirchenportal auf dem Boden lag und in der Dämmerung fast ganz mit dem Untergrund verschmolz.
Eine böse Ahnung beschlich ihn. Er beugte sich hinab, um besser sehen zu können, doch noch bevor seine Hand die kalte Stirn berührte, wusste er, dass das ein Kind zu seinen Füßen war. Seine kleinen Hände waren wie zum Gebet gefaltet, und es starrte mit leerem Blick in den Himmel, der ihm trotz seiner Unschuld versperrt war. Raimund erschauerte.
Der über ihn verhängte Bann wurde jeden Sonntag in allen Kirchen des Languedoc öffentlich verkündet, und wie jeder Christ konnte er die Worte des Spruchs genauso wie das Vaterunser aus dem Stegreif heraus aufsagen.
»Die Ausgestoßenen seien verflucht in der Stadt«, begann er leise vor sich hin zu murmeln, »und außerhalb der Stadt, verflucht auf dem Land und allerorts; verflucht sei die Frucht ihres Leibes und die Frucht ihrer Felder; verflucht sei alles, was ihnen gehört, verflucht sei, wer bei ihnen eingehe und wer bei ihnen ausgehe. Sie sollen mit ewigem Fluch geschlagen sein. Die Kirche Gottes sei ihnen verschlossen, Friede und Gemeinschaft mit den Christen verwehrt. Nicht einmal am Tag ihres Todes sollen sie den Leib und das Blut Christi empfangen dürfen, vielmehr sollen sie ewigem Vergessen anheimfallen, und ihre Seelen sollen im Gestank der Hölle untergehen.«
Bei diesen Worten angekommen, warfen die Priester stets alle Kerzen auf den Boden und zertraten sie im Staub, um den Gläubigen mit aller Deutlichkeit vor Augen zu führen, wie es einem jeden von ihnen ergehen würde, der es wagte, sich gegen die Kirche zu stellen.