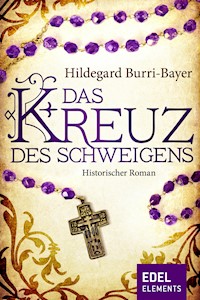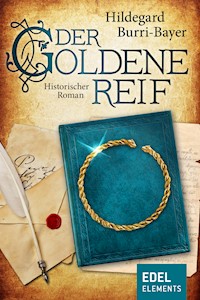4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Tote, ein Grab und ein Geheimnis, das den König zu Fall bringen könnte! Paris, 1390. Anastasia muss einen Totengräber bestechen, um ihren Vater, den Tintenhändler und heimlichen Alchemisten Jakob Braque, in geweihter Erde zu bestatten. An dem geheimen Grab wird sie von Christine de Pizan ertappt. Anastasia fürchtet Schlimmstes – zu Unrecht. Bald wird Christine ihr zur Freundin und Vertrauten. Doch selbst die einflussreiche Dame kann nicht verhindern, dass Anastasia in die Nähe von Königsmördern gerückt, angeklagt und in den Kerker geworfen wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch:
Zwei Tote, ein Grab und ein Geheimnis, das den König zu Fall bringen könnte!
Paris, 1390. Anastasia muss einen Totengräber bestechen, um ihren Vater, den Tintenhändler und heimlichen Alchemisten Jakob Braque, in geweihter Erde zu bestatten. An dem geheimen Grab wird sie von Christine de Pizan ertappt. Anastasia fürchtet Schlimmstes – zu Unrecht. Bald wird Christine ihr zur Freundin und Vertrauten. Doch selbst die einflussreiche Dame kann nicht verhindern, dass Anastasia in die Nähe von Königsmördern gerückt, angeklagt und in den Kerker geworfen wird …
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2011 by Hildegard Burri-Bayer Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf — auch teilweise — nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-905-3
DRAMATIS PERSONAE
Historisch verbürgte Personen sind mit * gekennzeichnet
Adèle, Köchin auf dem Gut von Bureau de la Rivière
Aghinolfo de Pizan, jüngerer Bruder von Christine de Pizan
Anastasia Braques, Tochter des Tintenhändlers Jacob Braques, begnadete Buchmalerin. Von der historisch verbürgten Buchmalerin, die nur ein einziges Mal in einer Chronik im Zusammenhang mit Christine de Pizan als Illustratorin mehrerer derer Werke auftaucht, kennt man nur den Vornamen.
Anna de Pizan, Schwester von Thomas de Pizan und Tante von Christine de Pizan
Arnaud, Graf von Dreux, Hüter von alten Geheimnissen und Mitglied des untergegangenen Templerordens in den Katakomben von Paris
Bernard, Graf von Dreux, Sohn von Arnaud von Dreux, Ritter und Jagdgefährte Karls VI.
Bersumée, Spion und Handlanger von Gervais Chretién
*Bureau de la Rivière, Berater und Vertrauter König Karls V. von Frankreich. Wurde nach dem Tod Karls V. Berater König Karls VI. Nach dem Ausbruch von Karls Geisteskrankheit flüchtete er in das Château d’Auneau, wo er 1392 verhaftet wurde. Man warf ihm vor, dass er den König falsch beraten und sich außerdem bereichert habe. Nach seiner Verbannung zog er sich in die Dauphine zurück. Er kam noch einmal wieder nach Paris, wo er aber keine politische Rolle mehr spielte. Nach seinem Tod erhielt er das außergewöhnliche Privileg, in der Basilika Saint-Denis beerdigt zu werden.
Carmina, Magd des Buchbinders und mit Anastasia befreundet
*Christine de Pizan, Tochter von Thomas de Pizan, kam 1368 an den französischen Hof und verbrachte eine vermutlich recht unbeschwerte Kindheit im Kreis der französischen Hocharistokratie. Ihr Vater förderte ihre Wissbegier gegen den Willen seiner Gemahlin und ließ Christine Unterricht erteilen, was sie später als großes Privileg empfand. Christine nutzte ihr Wissen, um sich für die Rechte der Frauen einzusetzen, was für die damalige Zeit ein außergewöhnliches Unterfangen war. Sie entfesselte den ersten Pariser Literatenstreit in der Geschichte der französischen Literatur und wurde später als »erste Frauenrechtlerin Europas« bezeichnet.
Eleonore, Frau des Buchbinders, Mutter von Gaston und Carminas Herrin
*Étienne du Castel, Christine de Pizans Gemahl, war der Sohn eines königlichen Kammerdieners und Notar Karls V.
Gaston, Sohn des Buchbinders und Nachbar von Anastasia
Geoffrey Maupoivre, Kaufmann und Verehrer von Christine de Pizan
George Duchesnes, Buchbinder in Paris
*Gervais Chrétien, Hofchirurg Karls V. und Kanoniker der Kathedrale Notre-Dame in Paris.
Seine Rolle als Verschwörer ist frei erfunden und basiert auf dem Gedanken, dass bei zwei königlichen Leibärzten einer zu viel ist.
Gilles, Handlanger von Gervais Chrétien
*Gilles Malet, Bibliothekar Karls V. und Karls VI.
Helen, Hure in Paris und zusammen mit Anastasia eingekerkert
Hugues, alter Diener Bureau de la Rivières in Crécy-en-Brie
Jacques, Totengräber und heimlicher Verehrer von Anastasia
Jacob Braques, Anastasias Vater, Tintenhändler und heimlicher Alchemist
*Jean de Pizan, Sohn Christine de Pizans
Jeanne, Magd auf dem Gut von Bureau de la Rivière
Johanna, Hure in Paris und zusammen mit Anastasia eingekerkert
*Isabeau de Bavière, Königin von Frankreich und Gemahlin Karls VI.
*Karl V. der Weise umgab sich mit guten Beratern und erließ ein Landfriedensgesetz, das der breiten Bevölkerung eine größere Sicherheit gewährleisten sollte. Er stabilisierte den Geldwert, förderte die Künste und Wissenschaften und stiftete die königliche Bibliothek in Paris. Er erweiterte den Louvre und setzte die Pariser Befestigungen wieder instand, wobei er auch die Bastille erbaute. Allerdings verursachte seine starke Zentralisierungs- und Steuerpolitik auch Unzufriedenheit und wurde ungewollt zum Auslöser des großen Abendländischen Schismas, das fast vierzig Jahre dauerte.
*Karl VI. der Vielgeliebte oder Wahnsinnige war das älteste von drei am Leben gebliebenen Kindern Karls V. und Johanna von Bourbons und kam mit zwölf Jahren auf den Thron.
Er erwies sich als gutwillig, aber schwach und sprunghaft. Später verfiel er dem Wahnsinn, wenn es auch immer wieder kurze Phasen gab, in denen er bei klarem Verstand war. Diese Situation nutzten seine Onkel Ludwig von Anjou, Johann von Berry und Philipp der Kühne, um hinter seinem Rücken zu agieren. Nach und nach trat als ihr Konkurrent auch Karls ehrgeiziger jüngerer Bruder Ludwig von Orléans auf den Plan.
Seine letzten Lebensjahre stand Karl VI. stark unter dem Einfluss seiner Gemahlin Isabeau de Bavière, die ihn im Vertrag von Troyes enterbte.
Leonardo, Kammerdiener von Bureau de la Rivière
Lucien, Knappe von Bernard von Dreux
*Ludwig von Valois, Herzog von Orléans, hatte in jungen Jahren ein enges Verhältnis zu seinem drei Jahre älteren Bruder Karl VI. Da dieser schubweise an Zuständen geistiger Verwirrung litt, übernahm er zeitweise die Regierung und versuchte sich gegen den Regentschaftsrat durchzusetzen, der von seinen Onkeln, den Herzögen Ludwig von Anjou, Johann von Berry und Philipp dem Kühnen von Burgund, gebildet wurde.
1407 wurde Ludwig von Orléans von Meuchelmördern, die von seinem burgundischen Cousin und Rivalen Johann Ohnefurcht gedungen worden waren, auf offener Straße niedergestochen.
*Madame de Pizan, Tochter des Arztes Thomas Mondini aus Venedig und Mutter von Christine de Pizan
Marie, Hure in Paris und zusammen mit Anastasia eingekerkert.
Maurice, Gefängniswärter in Paris
Monsieur Montreuil, Christine de Pizans Notar in Paris
*Paolo de Pizan, Bruder von Christine de Pizan, kehrte nach dem Tod seines Vaters Thomas de Pizan mit seinem Bruder Aghinolfo nach Italien zurück.
*Pierre Montagu, Großkämmerer und Siegelbewahrer Karls VI.
Pierre, Bruder von Jacques dem Totengräber
*Philipp der Kühne von Burgund, Bruder von Karl V. und Onkel Karls VI. und Ludwig von Orléans
*Philippe de Mézières war Soldat, Diplomat und Schriftsteller und einer der letzten Propagandisten der Kreuzzugidee.
Er gehörte zu den vertrautesten Beratern Karls V. und wurde später zum Tutor Karls VI.
Nach dem Tod Karls V. musste er zusammen mit den anderen Räten abdanken und zog sich in den Konvent der Zölestiner in Paris zurück.
Die Verleumdungen, mit denen sein Name von burgundischen Geschichtsschreibern überzogen wurde und die vermutlich auf seiner Nähe zu Ludwig von Orléans beruhten, haben mich auf die Idee gebracht, ihn an einer der unzähligen Verschwörungen gegen Karl VI. teilnehmen zu lassen, deren sich dieser sein Leben lang erwehren musste.
Raimund Braques, Bruder von Jacob Braques und Anastasias Onkel
Raimund, Ritter und Waffenbruder Bernard von Dreux’
Reinold von Pons, Handlanger von Gervais Chrétien
Rainald, Stallmeister König Karls VI.
Raoul, Verwalter von Bureau de la Rivières Gut
Remigius, Pater auf dem Gut von Bureau de la Rivière
Robert, Bruder von Gilles
Robert de Molay, Nachfahre des einstigen Großmeisters der Templer, Jacques de Molay, hütet in den Katakomben von Paris mit seinen Mitstreitern die Geheimnisse der »armen Kampfgefährten Christi und des salomonischen Tempels«, wie sich die Tempelritter vollständig nannten
*Robert le Coq, Bischof von Laon und Pair von Frankreich. Der Kirchenmann machte gemeinsame Sache mit dem Sprecher der Kaufleute Étienne Marcel und hielt aufrührerische Reden in der Versammlung der Generalstände. So forderte er die Verbannung königlicher Ratsmitglieder. Deswegen später vom Dauphin angeklagt, musste er aus Frankreich fliehen.
Simon, Waffen- und Zuchtmeister König Karls VI.
Schwester Agnes, Nonne in einem Kloster außerhalb von Paris
Schwester Marietta, Nonne in einem Kloster außerhalb von Paris
*Thomas de Pizan, war bis 1356 Professor der Astrologie an der Universität von Bologna. 1364 bekleidete er das Amt eines Rats der Stadt Venedig und erlangte solche Berühmtheit, dass gleich zwei europäische Könige, Ludwig von Ungarn und Karl V. von Frankreich, ihn an ihren Hof baten. Thomas entschied sich für Frankreich, wo er Hofastrologe und Leibarzt Karls wurde.
Valerie, Hure in Paris und zusammen mit Anastasia eingekerkert.
Alle Künste auf Erden sind göttlich. Sie sind aus Gott, und nichts kommt aus einem anderen Grund.
Aureoli Theophrasti ab Hohenheim
Im Menschen nämlich sind Sonne und Mond und alle Planeten.
Aureoli Theophrasti ab Hohenheim
PROLOG
16. September im Jahre des Herrn 1380, Frankreich, Schloss Beauté-sur-Marne
Unzählige Fackeln erleuchteten den Treppenaufgang zu den königlichen Privatgemächern, und doch kam es dem Astrologen Thomas de Pizan so vor, als wäre der Gang noch nie so düster gewesen; als hätte sich ein Schatten über seine Seele gelegt und seinen Blick verdunkelt, und das beunruhigte ihn. Er hatte gelernt, sich auf seine Ahnungen zu verlassen, und wäre nun gerne für eine Weile alleine gewesen, um sich ganz auf sie konzentrieren zu können, doch der König hatte ihn rufen lassen, und er wusste, wie ungeduldig Karl V. sein konnte, wenn man ihn warten ließ.
Die Wachen lehnten träge an der Wand und ließen ihn mit gelangweilter Miene passieren.
»Der König erwartet Euch bereits«, verkündete der erste Kammerdiener Karls V. mit näselnder Stimme und musterte dabei abfällig den knielangen, schwarzen Rock des Astrologen, der längst aus der Mode war.
Ein behagliches Feuer loderte in dem offenen Kamin an der Stirnseite des länglichen Saals. Durch die grünlichen in Blei gefassten Fensterscheiben sickerte das spärliche Licht des schwindenden Herbsttages.
Karl V. saß zurückgelehnt in seinem Stuhl. Er schien endlich wieder fieberfrei zu sein. Seine braunen Augen waren klar, und er wirkte so entspannt wie schon seit Langem nicht mehr. Es schien ihm deutlich besser zu gehen, was Thomas de Pizan mit heimlicher Genugtuung erfüllte, denn er hatte die vollständige Genesung des Königs prophezeit.
Karl V. nickte seinem Besucher ungeduldig zu und forderte den Astrologen mit einer Handbewegung auf, sich zu ihm zu setzen. Während ein Diener seinem Gast Wein einschenkte, schlug er das vor ihm auf dem Tisch liegende Buch auf und betrachtete die kunstvoll ausgemalte Bildinitiale am Anfang der Seite, die Adam und Eva im Paradies zeigte. Dicht über dem Paar schwebte ein Engel.
Plötzlich wurde ihm schwindelig. Das Bild verschwamm vor seinen Augen, und seine Hände begannen zu zittern. In dem Bemühen, sich seine Schwäche nicht anmerken zu lassen, griff er nach seinem Weinbecher und trank einen großen Schluck. Wie erhofft ließ das Zittern seiner Hände nach, und der Schwindel verschwand. Er atmete einige Male tief durch und senkte seinen Blick erneut auf das Buch. Im flackernden Schein der beiden silbernen Kerzenleuchter auf dem Tisch erwachte die Bildinitiale zum Leben, glühte das blutrote Gewand des Engels.
Lockend hielt Eva Adam den Apfel entgegen, während sich der himmlische Wächter zu Adam herabzubeugen schien und warnend die Hand hob. Dann erstarrte die Szene in einem der dramatischsten Augenblicke der Menschheit.
Karl V. räusperte sich, um seine Ergriffenheit zu verbergen. Seine innersten Gefühle gingen niemanden etwas an, und er hatte schon früh gelernt, sie vor anderen zu verbergen. Er ließ seine Finger über die mit einem Eberzahn polierten, goldenen Textzeilen auf dem Prunkdeckel des Kodexes gleiten, der in aufwendiger Handarbeit hergestellt worden war, fühlte das weiche Leder, die Metallbeschläge und die silbernen Schließen. Ein intensiver Geruch nach Pigmenten, Leder und Leim stieg ihm in die Nase, und er verspürte einen metallenen Geschmack im Mund, den er mit einem weiteren Schluck Wein fortspülte. Der Geruch störte ihn nicht, er würde bald verfliegen. Wichtig für ihn war nur, dass das enzyklopädische Werk über die himmlischen Sphären nun endlich fertig geworden war. Er hatte es selbst in Auftrag gegeben, und Gervais Chrétien, der nicht nur sein Leibarzt, sondern auch Kanzler der Universität von Paris war, hatte Illumination, Bindung und Ausstattung des prachtvollen Werkes überwacht und es ihm zu seiner großen Freude am heutigen Nachmittag übergeben.
»Ich möchte Euch eine Stelle aus diesem Buch vorlesen, zu der ich gerne Eure Meinung hören würde«, teilte er Thomas de Pizan mit.
»Es wird mir ein Vergnügen sein, Euch zuzuhören, Sire.« Der kleine Schwächeanfall des Königs war Thomas de Pizan nicht entgangen, genauso wenig wie der rührende Versuch, diesen vor ihm zu verbergen, doch er ließ sich nichts anmerken, sondern lehnte sich in seinem Stuhl zurück und neigte den Kopf, um den Worten des Königs zu lauschen.
Karl V. räusperte sich noch einmal, dann begann er laut zu lesen.
»Als Adam und Eva aus dem Paradies kamen, da empfanden sie, was die Welt war, da empfanden sie den Mond, den Jovem, den Merkurium, den Martem, den Saturnum. Sie empfanden den Jammer der Welt und das Elend der Menschen. Als der Mensch vom Baum der Erkenntnis aß, da trennten sich Makro- und Mikrokosmos voneinander. Nun erst nahm der Mensch die nichtmenschliche Welt von außen wahr. Er erlebte Mond und Sterne außerhalb von sich, und sein Elend begann.«
Das erhebende Gefühl, das ihn beim Lesen überkommen hatte, hielt an, und ihm war sonderlich zumute, als würde er selbst vor dem verlorenen Paradies stehen und Adams Verzweiflung spüren, der gleich ihm eine schwerwiegende Entscheidung getroffen hatte, die sich nicht mehr zurücknehmen ließ.
Er sah von dem aufgeschlagenen Buch auf, blickte Thomas de Pizan an und besann sich wieder auf sein eigentliches Anliegen.
»Wie anders wäre die Geschichte der Menschheit verlaufen, wenn Adam nicht der Versuchung Evas erlegen wäre«, sagte er, als wäre ihm dieser Gedanke gerade erst gekommen.
Es erging ihm, wie es den Mächtigen dieser Erde häufig ergeht, wenn sie die Folgen ihrer Handlungen zu spüren bekommen. Sein Geist irrte auf der Suche nach einem tieferen Sinn, einer gültigen Weltordnung, umher, die sein Leben, seine Stellung und seine Taten rechtfertigen würden, weil ihm sein Leben plötzlich so fremd erschien, als wäre es das eines anderen. Und das beunruhigte ihn.
Thomas de Pizan nahm seinen Weinbecher in die Hand, setzte ihn dann aber wieder ab, ohne daraus zu trinken. Ihm war noch nicht ganz klar, worauf der König hinauswollte.
»Ein interessanter Gedankengang. Aber glaubt Ihr nicht, dass Gott in Seiner Weisheit Adams und auch Evas Verhalten vorausgesehen hat? Schließlich hat Er sie beide erschaffen«, gab er zu bedenken.
Karl V. schüttelte ein wenig unzufrieden den Kopf. Gerade von seinem Astrologen hatte er erwartet, dass er ihn verstand.
»Ich meine etwas anderes.« Er hielt Thomas de Pizans Blick fest.
»Adam hat eine Entscheidung getroffen, welche die Geschichte der Menschheit verändert hat, ebenso wie Pilatus, Hannibal, Cäsar und alle großen Männer in der Geschichte. Würde die Welt heute anders aussehen, wenn Pilatus Jesus freigelassen hätte, anstatt ihn kreuzigen zu lassen, oder Cäsar seine Begehrlichkeit nicht auf Germanien gerichtet hätte?«
Thomas de Pizan dachte einen Moment lang über die Worte des Königs nach, bevor er ihm antwortete.
»Der Mensch ist, wie er ist, und ich glaube nicht, dass sich der Verlauf der Geschichte im Wesentlichen geändert hätte. Die Grenzen der einzelnen Reiche wären nur anders verschoben worden, und Jesus hätte einen anderen Märtyrertod gefunden, weil es nun einmal seine Bestimmung war, sein Leben für die Menschen zu geben.«
»Es war also ihr Schicksal, diese Entscheidungen zu treffen«, stellte Karl V. zufrieden fest.
Thomas de Pizan nickte.
Sie saßen in breiten Lehnstühlen am Kopfende des schweren Eichentisches nah am Kamin. Der König hatte seine Diener hinausgeschickt. Er liebte die vertraulichen Gespräche mit seinem Astrologen, den er vor einigen Jahren an seinen Hof geholt hatte und den er nun immer häufiger zurate zog.
Thomas de Pizan hatte endlich verstanden, dass Karl V. die vorgelesene Stelle als Metapher benutzte, um ihm etwas mitzuteilen, ohne es direkt aussprechen zu müssen. Er wusste, dass Karl V. nach einer Lösung suchte, um das unselige Schisma zu beenden, an dessen Entstehung er selbst nicht ganz unschuldig war und das Frankreich in tiefe Verzweiflung gestürzt hatte. Eine Aufgabe, um die er den König wahrlich nicht beneidete.
Karl V. hatte die Wahl Urbans VI. für ungültig erklärt und den daraufhin im Konklave gewählten Klemens VII. offiziell als Papst anerkannt, doch dann war das Undenkbare geschehen, mit dem niemand gerechnet hatte: Urban VI. weigerte sich, die Entscheidung des französischen Königs zu akzeptieren und sein Amt als Kirchenoberhaupt niederzulegen. Er regierte weiterhin von Rom aus, während Klemens VII. notgedrungen seinen Sitz nach Avignon verlegt hatte.
Die Heilige Mutter Kirche war gespalten, die Christenheit tief zerrissen, das Schisma zur schrecklichen Wirklichkeit geworden. Der König haderte mit der Entscheidung, die er getroffen hatte, tröstete sich aber, da sie sich nicht mehr rückgängig machen ließ, damit, dass es nun einmal sein Schicksal war, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Ein Schicksal, das er mit vielen berühmten Männern teilte.
Empfand er vielleicht sogar Genugtuung bei dem Gedanken, dass all diese Männer gerade nur aufgrund ihrer Entscheidungen in die Geschichte eingegangen waren? Das hoffnungsvolle Funkeln in Karls Augen verriet ihn. Thomas de Pizan senkte rasch seinen Blick. Er wusste, wie sehr der König es hasste, durchschaut zu werden.
Normalerweise genoss er die Dispute mit dem König, doch an diesem Abend fiel es ihm schwer, sich auf ihr Gespräch zu konzentrieren. Bevor ihn die Einladung des Königs erreicht hatte, war sein Blick wie jeden Abend in den nächtlichen Himmel gerichtet gewesen, und die Konstellation der Gestirne hatte ihn mehr beunruhigt, als er sich eingestehen wollte.
Saturn stand lauernd zwischen Fisch und Stier. Der Vollmond überstrahlte ihn zwar, aber schon morgen würde die Kraft seiner Strahlen nachlassen. Er würde keine Macht mehr über Saturn haben, und Thomas de Pizan konnte das Böse, das von dem stumpfen, blauen Gestirn ausstrahlte, fast körperlich fühlen.
»Ihr seid heute Abend sehr wortkarg, mein Freund.« Ein unüberhörbarer Vorwurf schwang in der Stimme Karls V. mit.
Thomas de Pizan riss sich zusammen.
Der König hatte ihn zu sich gerufen, um mehr über Makround Mikrokosmos und die himmlischen Sphären zu erfahren.
»Alles was außen ist, ist auch innen«, begann er schließlich. »Die Erde ist nichts ohne den Himmel, denn der Himmel ist das Leben. Der Mensch ist nichts ohne den Himmel. Der Himmel ist unser Vater und die Erde unsere Mutter. Die Gestirne spiegeln sich in unserem Geist wider, in unserer Seele, die nach unserem Tod in den Himmel zurückkehrt, während unser Körper der Erde zurückgegeben wird, der er entstammt.«
Knusprig gebratene Fasanenkeulen und mit süßen Beeren gefüllte Rehpasteten, die den Appetit des Königs anregen sollten, standen vor ihnen auf dem Tisch, doch Karl hatte bislang noch keine der Köstlichkeiten angerührt. Stattdessen tranken sie gemeinsam den schweren, tiefroten Wein aus Burgund, der ihnen die Wangen rötete und das Herz wärmte.
»Ihr sagt also, dass die Gestirne sich im Geist des Menschen widerspiegeln?«, vergewisserte sich Karl V.
Thomas de Pizan nickte. »Das innere Gestirn ist seinem Lauf und Stand nach gleich mit dem äußeren, es unterscheidet sich allein in Form und Stoff. Wir müssen Herr werden über unseren Leib, um eins zu werden mit unserem Geist, nur dann werden wir zu wahrer Weisheit gelangen.
Auch wenn Saturn die Geburt eines Menschen überschattet, so kann sich dieser doch seinem Einfluss entziehen. Er kann ihn überwinden und ein Kind der Sonne werden. Wir selbst sind es, die entscheiden, welchen Weg wir einschlagen, ob wir der Versuchung erliegen oder unserem Gewissen folgen.«
Karl V. wirkte nachdenklich, als er seinen Astrologen am späten Abend entließ.
Bis zum Morgengrauen starrte Thomas de Pizan von seiner Kammer im obersten Stockwerk aus in den nächtlichen Himmel. Pegasus, das schwarze Pferd der Unterwelt, scharrte ungeduldig mit den Hufen, während die Sonne im Sternbild des Löwen zusehends verblasste.
Am nächsten Morgen herrschte dumpfe Ratlosigkeit im Schlafgemach des Königs. Der Kronrat hatte sich um das mit weißem Linnen bezogene Bett Karls V. herum versammelt, außerdem sein Leibarzt Gervais Chrétien und Thomas de Pizan, Physikus und Astrologe, dessen Berufung aus seiner Heimatstadt Bologna an den französischen Hof Chrétien sehr verärgert hatte und ihm noch immer ein Dorn im Auge war.
Der Astrologe hatte als Letzter das königliche Gemach betreten und starrte nun entsetzt auf den König, der umrahmt von schweren, in Gold und Purpur gehaltenen Vorhängen in seinem Bett saß. Trotz der stützenden Kissen in seinem Rücken konnte er sich nur mühsam aufrechthalten.
Seine halbgeschlossenen Augen lagen tief in den Höhlen, und die hohen Wangenknochen traten deutlich aus seinem eingefallenen, grauen Gesicht hervor.
Thomas de Pizan spürte einen Kloß in seinem Hals. Er hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, und blickte zu den hohen Fenstern an der Stirnseite hinüber, deren Flügel allesamt geschlossen waren. Die abgestandene, verbrauchte Luft in dem königlichen Schlafgemach war kaum geeignet, um einen Kranken gesunden zu lassen. Ärgerlich wandte er seinen Blick von den Fenstern und sah Gervais Chrétien an, der ihn lauernd beobachtete. Seine kalten, grauen Augen glitzerten triumphierend.
Wie die Augen eines Menschen, der sich gerächt hat und seine Rache nun genießt, dachte Thomas de Pizan. Und das nur, weil er durchgesetzt hatte, dass die Fenster im königlichen Schlafgemach geschlossen wurden? Es war unbegreiflich, wozu Hass und Eifersucht einen Menschen treiben konnten.
Seufzend wandte er sich von Chrétien ab.
Jetzt war nicht die Zeit, sich um den Leibarzt Gedanken zu machen.
Der Zustand des Königs war ernst, und er hatte keine Ahnung, wie es zu diesem Rückfall hatte kommen können, nachdem Karl sich zuvor so gut erholt zu haben schien.
»Hattet Ihr nicht die vollständige Genesung unseres geliebten Herrschers vorausgesagt?«, unterbrach Chrétien herausfordernd seine Gedanken.
Ein ungutes Gefühl beschlich den Astrologen. Er spürte das Misstrauen, das ihm von den Mitgliedern des Rates entgegenschlug, die das Volk spöttisch Marmousets, alte Käuze, nannte und auf diese Weise mit den Fratzengesichtern verglich, welche an den Toren der großen Palais als Türklopfer dienten.
Lastendes Schweigen kehrte ein. Thomas de Pizan wandte sich erneut zu Chrétien um, der gerade einen zufriedenen Blick mit Philippe de Mézières tauschte, einem engen Ratgeber Karls V. In seiner Miene war keinerlei Betroffenheit zu erkennen. Der schwere Rückfall des Königs scheint ihn nicht im Geringsten zu überraschen, man könnte fast glauben, er hätte ihn erwartet, dachte Thomas de Pizan und fühlte sich noch unbehaglicher. Irgendetwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. Als ob der Tod Karls V. schon beschlossene Sache wäre.
Erschrocken versuchte er den Gedanken aus seinem Kopf zu verscheuchen, getrieben von der vagen Hoffnung, das Schicksal auf diese Art beeinflussen zu können, doch es gelang ihm nicht.
Im königlichen Schlafgemach war es so still geworden, dass nur noch der rasselnde Atem des Königs zu hören war.
Wenn er sein Gesicht wahren wollte, musste er Chrétien antworten, doch was sollte er ihm sagen? Dass er sich geirrt hatte?
»Wie ich sehe, seid Ihr nicht einmal in der Lage, mir eine Antwort auf meine nur allzu berechtigte Frage zu geben«, stellte Chrétien höhnisch fest. »Ihr habt uns versichert, dass der König vollständig genesen würde. Sieht so Eure Genesung aus? Durch Eure Prophezeiung habt Ihr verhindert, dass wir weiter nach den Ursachen seiner Krankheit geforscht haben. Man könnte fast glauben, Ihr hättet dies mit Absicht getan. Genauso, wie Ihr den König davon abgehalten habt, seine Medizin regelmäßig einzunehmen.« In den Mienen der Ratsmitglieder zeigte sich offene Empörung. Chrétien nahm es zufrieden zur Kenntnis. Und obwohl sich der Leibarzt direkt an ihn gewandt hatte, wusste Thomas de Pizan, dass seine Worte nicht ihm, sondern dem königlichen Rat galten.
Chrétien zog die Augenbrauen hoch und beobachtete ihn aus schmalen Augen, die knochenbleichen Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ein schwarzer Rock mit wulstigen Ärmeln umgab seine hagere Gestalt. Er sieht aus wie eine aufgeplusterte, boshafte Krähe, die bereit ist, sich auf ihr Opfer zu stürzen, dachte Thomas de Pizan und begann zu schwitzen.
»Jede Medizin soll ihre Stunde haben, das ist doch lächerlich und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Eine Leber wird von Euch nur an einem Donnerstag behandelt, die Galle an Dienstagen und das Gehirn ausschließlich an Montagen. Und wenn der Kranke vorher verstirbt, weil Ihr ihn nicht rechtzeitig behandelt habt, dann gebt Ihr Saturn oder Jupiter die Schuld daran.
Mit Eurem vorgeblichen Wissen könnt Ihr vielleicht das einfache Volk beeindrucken, aber nicht einen Magister der Universität von Paris!«
Thomas de Pizan sah den unverhüllten Hass in Chrétiens Augen, der ihn zum ersten Mal offen angriff und es darüber hinaus auch noch wagte, ihn in Gegenwart des Königs als Scharlatan hinzustellen. Eine gefährliche Situation, die er nicht unterschätzen durfte. Chrétien hatte ihm den Fehdehandschuh vor die Füße geschleudert, und er hatte keine andere Wahl, als ihn aufzunehmen.
Etwas brüsk wandte er sich an seinen Gegner.
»Wollt Ihr etwa bestreiten, dass die Zeiten des Jahres ungleich sind? Der Winter bringt Eis und Schnee, der Frühling vertreibt, was der Winter gebracht hat, und lässt Schnee und Eis zu Wasser schmelzen und uns ein feuchtes, lockeres Erdreich bekommen, das der Sommer trocknet.
So wie es nicht zu jeder Zeit gut ist, in Lehm und Erde zu graben, Holz zu fällen oder zu hacken, so ist es noch viel weniger gut, zu jeder Zeit Kräuter zu sammeln. Jeder Bauer weiß, dass sich Früchte, die nach Mitternacht bis zum Aufgang der Sonne geerntet werden, am längsten halten. Zu dieser Zeit besteht keine Geilheit oder gärende Feuchtigkeit in den Früchten und allen anderen Gewächsen der Erde, was eine Ursache für den Verlust der Kräfte und der Fäulnis ist.«
Chrétien schnaubte verächtlich. »Ich rede von Wissenschaft, während Ihr Eure Erfahrungen auf ungebildete, dumme Bauern stützt, die weder lesen noch schreiben können.«
Thomas de Pizan merkte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er versuchte, sich zu beruhigen und Ordnung in seine wild durcheinanderwirbelnden Gedanken zu bringen. Hatte er sich denn nur eingebildet, dass es dem König wieder besser ging, und die Anzeichen für eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes übersehen, weil er sie nicht wahrhaben wollte? Bilder des gestrigen Abends zogen an ihm vorbei, und aus einem Grund, den er sich selbst nicht erklären konnte, gab es plötzlich nichts Wichtigeres für ihn, als diese Bilder festzuhalten wie einen kostbaren Schatz, der ihm zu entgleiten drohte. Doch die Bilder ließen sich genauso wenig festhalten, wie sich der köstliche Duft knuspriger Fasanenkeulen festhalten ließ. Er schalt sich einen Narren ob dieses Versuchs, um dann wieder in die Gegenwart mit ihren Problemen zurückzukehren, deren Wichtigstes die Genesung des Königs war.
Die Sterne lügen nicht, dachte er von einer merkwürdigen Unruhe erfüllt.
Erst hinterher, als es bereits zu spät war, um noch etwas ändern zu können, sollte er schmerzhaft erfahren, welch fatalen Fehler er begangen hatte, indem er Saturns Nähe zu Merkur unterschätzte, genauso wie er Chrétiens Hass unterschätzt hatte.
Nachdenklich ließ er seinen Blick über die Anwesenden schweifen, als hoffte er in ihren abweisenden Mienen eine Antwort auf die Frage zu finden, was den Rückfall des Königs ausgelöst haben könnte. Durch seine Prophezeiung hatte er sich angreifbar gemacht, dabei war er sich so sicher gewesen. Und Chrétien hatte die Chance genutzt und seine Behandlungsmethoden vor den königlichen Ratgebern ins Lächerliche gezogen. Aber Chrétien war einer von ihnen, während er selbst all die Jahre über ein Ausländer für sie geblieben war.
Schließlich traf sich sein Blick mit dem des Königs, und der Ausdruck, der in seinen Augen lag, ließ ihm den Atem stocken. Er wusste, dass er diesen Ausdruck – das Wissen um die grausame Endgültigkeit und die stille Trauer – nie mehr in seinem Leben vergessen würde. Gleichzeitig fühlte er sich seltsam berührt von der unbestimmten Sehnsucht, die er zu erkennen glaubte und die dazu verdammt war, unerfüllt zu bleiben.
»Ich wünsche, allein mit meinem Astrologen zu sprechen«, befahl Karl V. mit brüchiger Stimme, und als er sprach, bemerkte Thomas de Pizan entsetzt, dass sein Zahnfleisch blutete.
Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag, die Zeichen waren eindeutig. Der König war vergiftet worden!
Aber wie war das möglich? Karl V. ging kein Risiko ein, er aß und trank nichts, was nicht vorgekostet worden war. Außerdem hatte er seinen Leibkoch immer bei sich. Den König zu vergiften, war unmöglich, es sei denn, man gehörte zu seinen engsten Vertrauten. Aber wer konnte ein Interesse daran haben, den König zu vergiften? Der Astrologe ließ seine Gedanken die zwölf Tierkreise durchlaufen, um sie zu ordnen, wie er es immer tat, wenn er an den Punkt gelangte, an dem sie sich sinnlos im Kreis zu drehen begannen, ohne Anfang und ohne Ende.
Das höhnische Gesicht Chrétiens tauchte wieder vor seinem inneren Auge auf, und gleichzeitig fielen ihm die mahnenden Worte seines Vaters ein. »Jedes Heilmittel ist auch ein Gift. Ob es heilt oder tötet, kommt nur auf die jeweilige Dosis an.« Chrétien! Der Gedanke war so schrecklich, dass er kaum wagte, ihn weiterzudenken. War es möglich, dass Chrétien nicht nur ihn, sondern auch den König hasste?
Die fahle Blässe und das Zittern des Königs hätten ihn warnen müssen, noch bevor er sein blutendes Zahnfleisch bemerkt hatte. Es waren Zeichen einer Vergiftung, vielleicht einer zu hohen Dosis Quecksilber, das in geringer Dosierung gegen die Verstopfung des Darms half, unter der Karl V. manchmal litt. Hatte Chrétien ihm versehentlich eine zu hohe Dosis verabreicht? Oder war es tatsächlich seine Absicht gewesen, den König zu vergiften?
Seine Gedanken überschlugen sich, während er auf die hohen Fenster zustürmte und einen Flügel nach dem anderen aufriss, obwohl er wusste, wie sinnlos sein Tun war und dass auch die frische Luft nichts mehr am Zustand des Königs ändern konnte. Danach stürzte er zurück an Karls Bett, fühlte die Temperatur seiner Stirn und zählte dann seinen Pulsschlag, der erschreckend langsam war.
»Ich werde sterben«, unterbrach Karl V. ihn ruhig, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen. »Meine Seele löst sich bereits von meinem Körper, ich kann es fühlen.«
Thomas de Pizan erstarrte, dann öffnete er den Mund, um heftig zu widersprechen, doch Karl V. hielt ihn mit einer Handbewegung davon ab.
»Es ist der Wille unseres Herrn und nicht Eure Schuld, ich möchte, dass Ihr das wisst«, sagte er auf die gestrige Prophezeiung seines Astrologen anspielend und rang sich ein Lächeln ab, das ihm nur mühsam gelang. »Unsere Dispute werden mir fehlen, mein teurer Freund, doch jetzt ruft die anderen wieder herein und schickt nach meinem Notar und meinem Beichtvater, mir bleibt nicht mehr viel Zeit, um meine Angelegenheiten zu regeln.«
Es gelang dem Astrologen nicht länger seine Tränen zurückzuhalten, während er Karl V. unverwandt ansah. Schmerzhaft wurde ihm bewusst, wie sehr er den König liebte, seine Weisheit und seine Güte, aber auch seine Würde, die er selbst in dieser schweren Stunde noch zu bewahren wusste.
Der König hielt seinen Blick fest. »Tut jetzt, um was ich Euch gebeten habe«, mahnte er sanft, »und schließt mich in Eure Gebete ein.«
Die Nachricht vom nahenden Tod des Königs verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Schlossbewohner strömten vor den königlichen Gemächern zusammen und drängten in den mit farbenprächtigen Wandteppichen geschmückten Ankleideraum des Herrschers. Niemand sprach ein Wort. Zu sehr war man sich der Anwesenheit des Todes bewusst, der nicht einmal vor dem König haltmachte. Unheimliche Stille breitete sich aus und steigerte die Spannung ins Unerträgliche.
Trotz der vorherrschenden Enge stand Thomas de Pizan abseits der anderen Höflinge. Doch er war so versunken in seinen Schmerz und seine Trauer, dass er diesen Umstand gar nicht bemerkte.
Er hatte noch immer das Bild des sterbenden Königs vor Augen, als er plötzlich einen schon fast vergessenen Geruch wahrnahm. Einen Geruch, der ihn an seine Heimat erinnerte. Etwas stimmte nicht, und plötzlich wusste er auch, was es war. Im Schlafgemach des Königs hatte es nach Knoblauch gerochen, obwohl Knoblauch am französischen Hof verpönt war!
Und während überall Trauerfahnen gehisst wurden, verließ Thomas de Pizan eilig das Schloss, um den einzigen Mann in Paris aufzusuchen, der ihm Klarheit bezüglich seines schrecklichen Verdachts verschaffen konnte.
Media vita in morte sumus. (Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben.)
Notker I. von St. Gallen, 9. Jh. n. Chr.
1
Paris, Oktober 1390
Eine merkwürdige Unruhe trieb den Tintenhändler Jacob Braques bereits am frühen Morgen aus seinem warmen Bett. Er hatte schlecht geschlafen. Die düsteren Träume, die ihn seit zehn Jahren quälten, rüttelten unnachgiebig an seinem Gewissen. Sie kannten kein Erbarmen, und er wusste, dass sie ihn weiterverfolgen würden, solange er atmete.
An manchen Tagen dachte er, es wäre nur gerecht so, weil er sich ebenso an die Vergangenheit klammerte wie diese sich an ihn. Gleich einem Ertrinkenden, der sich weigerte, von dem rettenden Ast zu lassen, und voller Sturheit an ihm festhielt, obwohl er wusste, dass sein Schicksal besiegelt war und die Kraft in seinen Händen ihn ohnehin bald verlassen würde.
Er selbst war es, der die Toten nicht zur Ruhe kommen ließ, weil es nichts Tröstlicheres für ihn gab als die Erinnerung. Die Erinnerung an seine geliebte, wunderschöne, sanfte Frau, die ihn so früh verlassen hatte. Noch immer hatte er ihren Duft in der Nase, und wenn er die Augen schloss, meinte er sogar, ihre warme, weiche Haut zu fühlen und ihr Lächeln sehen zu können. Dieses unvergleichliche Lächeln, das ihre Augen strahlen und ihr Gesicht heller leuchten ließ als die Sonne. Er hasste den Gedanken, die Erinnerung an sie könnte eines Tages verblassen, so wie die untergehende Sonne verblasste, wenn sie beim Hereinbrechen der Nacht dem aufsteigenden Mond weichen musste.
Seine Hände zitterten, und das Atmen fiel ihm noch schwerer als sonst. Auf seiner Jagd nach dem »Grünen Löwen« hatte er Gott gespielt, indem er einige Stoffe in ihrer Eigenschaft verändert hatte, um sie auf diese Weise neu zu erschaffen. Er hatte Arsen und Quecksilber geschmolzen, Steine zu Pulver zerrieben und ihre Pigmente mit Säuren und lebendigem Schwefel vermischt, die er dann mit tierischen und pflanzlichen Stoffen verband. Der verfluchte Rubinschwefel hatte ihn reich gemacht, und gleichzeitig hatten seine Versuche mit dem betörend glänzenden Gift seine Gesundheit ruiniert. Wie gerne würde er heute diesen Reichtum gegen seine Gesundheit eintauschen, doch es war zu spät. »Der Grüne Löwe« ließ sich nicht bändigen, und Phoenix, der Vogel des Hermes, hatte sich verflüchtigt, anstatt ihn zu verjüngen, wie er es erhofft hatte.
Und nun wartete der Sensenmann auf ihn, um seine schwarze Seele zu sich zu holen, und er spürte, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb, seine Angelegenheiten zu regeln, deren wichtigste die Rettung seines Seelenheils war. Sein Mund verzog sich bitter. Doch wie sollte er in diesen Zeiten, in denen sich Clemens VII. und sein Gegner Papst Urban VI. gegenseitig exkommuniziert hatten, sein Seelenheil retten? Niemand wusste, ob die Sterbesakramente überhaupt noch gültig waren, nachdem der Bann der beiden Päpste auch ihre jeweiligen Anhänger und Priester mit einschloss. Die Plätze auf den Kirchhöfen waren teuer geworden und geweihte Erde rar, seitdem jeder versuchte, wenigstens eine Schaufel davon zu ergattern, um sie den Dahingegangenen mitzugeben, die das Pech hatten, auf einem der städtischen Friedhöfe begraben zu werden. Mittlerweile wurden manche Kirchhöfe sogar bewacht, und die Totengräber verdienten ein Vermögen mit dem Handel geweihter Erde, die von Kirchhöfen stammte, welche noch vor dem Bann der beiden Päpste angelegt worden waren. In einer Zeit wie dieser, in der nicht einmal mehr die Sakramente der Priester sicher waren, war geweihte Erde daher seine einzige Hoffnung, und er würde sich nicht mit einer Schaufel davon begnügen. Irgendwie musste er einfach einen Weg finden, einen Platz auf einem der alten Kirchhöfe zu erhalten!
Einen Weg, wie ihn die listige Frau des Buchbinders gefunden hatte, die sich nicht damit abfinden konnte, ihren Sohn in ungeweihter Erde zu wissen, nur weil er unglücklicherweise noch vor der Taufe gestorben war. Sie hatte ihrem Mann so lange in den Ohren gelegen, bis dieser schließlich nachgegeben und die sterbliche Hülle seines Sohnes in einer finsteren, mondlosen Nacht heimlich unter der Traufe von Pater Bernards Haus vergraben hatte. »Der Regen, der vom Himmel in die Traufe fällt, sickert in die darunterliegende Erde bis zum Grab. Es ist wie eine himmlische Taufe, so steht es geschrieben«, hatte sie in ihrer Sturheit behauptet, dabei konnte sie weder lesen noch schreiben, und nicht einmal ihr Mann hatte eine Ahnung, wo sie diese Erkenntnis herhatte.
»Wer weiß schon, was in den Weibern vorgeht? Wenn sie sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, ist es schier unmöglich, es ihnen wieder auszutreiben«, hatte der Buchbinder gejammert, als er ein Säckchen Gallustinte bei ihm gekauft und bei dieser Gelegenheit auch seinen Weinvorrat erheblich dezimiert hatte.
Tief in Jacob Braques’ Innerem schlummerte die heimliche Hoffnung, dass sich Gott der Herr vielleicht doch noch erbarmen ließe, wenn er genügend für die Armen spenden und einige Wallfahrten von eigens dafür bezahlten Pilgern durchführen lassen würde. Er hatte alles genau bedacht und sein Testament dementsprechend abgefasst. In diesem war die Anzahl der Klageweiber, Fürbitten und Seelenmessen ebenso festgelegt wie die Anzahl teurer Wachskerzen, die seiner Seele in der Dunkelheit leuchten sollten. Nur das Grab in geweihter Erde fehlte noch. Anastasia würde sich darum kümmern müssen, weil er selbst schon zu schwach dazu war. Sie hatte es auf die Bibel geschworen und würde einen Weg finden. Frauen fanden immer einen Weg, sie waren listig und erfinderisch, wenn es darum ging, ihr Ziel zu erreichen.
Erst nachdem er alle Einzelheiten noch einmal durchgegangen war, wurde er ruhiger und nahm ein letztes Mal sein Werkstattbuch zur Hand, um wehmütig darin herumzublättern.
Die Farbpalette der von ihm zusammengemischten, außergewöhnlich farbenprächtigen Tinten reichte von hellem Bleiweiß bis hin zu dem leuchtenden Zinnober, das den idealen Hintergrund für die kostbaren Gold- und Silbertinten bot, deren Glanz die Zeiten überdauerte.
Ein plötzlicher Hustenanfall schüttelte ihn, und feine, hellrote Blutspritzer, deren Leuchtkraft die seines Zinnobers verblassen ließen, verteilten sich auf den aufgeschlagenen Seiten des Buches.
Seine linke Hand verkrampfte sich, und das Buch fiel ihm aus der Hand. Er hörte nicht, wie die Türe geöffnet wurde und Anastasia hereinkam. Sie hatte Geräusche im Arbeitszimmer gehört und sich gewundert, dass ihr Vater schon auf war.
Jacob Braques’ Augen traten ihm beinah aus den Höhlen. Verzweifelt rang er nach Luft und bemühte sich zu sprechen. Anastasia sah ihn erschrocken an. Sie begriff nicht, was mit ihrem Vater geschah. Sie sah nur, dass sein linkes Lid schlaff herunterhing und seine Hand zu einer Klaue verkrampft war. Seine entstellten Gesichtszüge machten ihr Angst. »Ich rufe den Physikus«, rief sie aus und wollte sich schon abwenden, doch ihr Vater hielt sie mit einer hilflosen Geste seiner steifen Hand zurück. Anastasia beugte sich mit dem Ohr näher an seinen Mund, um ihn zu verstehen. Langsam und leise kamen die Worte schließlich über seine blutleeren Lippen. »Geweihte Erde, du hast es versprochen.« Flehend hingen seine Augen noch eine Weile an Anastasia, die ihm zum Zeichen dafür, dass sie ihn verstanden hatte, beruhigend zunickte.
Rasselnd tat Jacob Braques seinen letzten Atemzug, dann kippte er wie ein gefällter Baum zur Seite, noch bevor Anastasia ihn auffangen konnte.
»Vater!«, schrie sie außer sich vor Angst und strich ihm hilflos über die schweißnasse Stirn. Dann packte sie ihn an den Schultern, um ihn zu schütteln, damit das Leben wieder in ihn zurückkehrte, aber in ihren Armen war keine Kraft mehr. Sie küsste ihn tröstend auf seine erkaltende Stirn, so wie er es immer bei ihr getan hatte, als sie noch ein Kind gewesen war, und strich ihm sanft über die wächserne Wange. Ihre Bewegungen wirkten kraftlos und müde. Tränen strömten ihr aus den Augen und benetzten das Gesicht des Toten, bis dessen leerer Blick vor ihren Augen verschwamm.
»Geweihte Erde, du hast es versprochen.« Eindringlich, wie ein Echo, das nicht verklingen wollte, hallten seine letzten Worte in ihrem Kopf wider. Eine mahnende Stimme aus dem Jenseits, der sie folgen musste. Aber durfte sie ihn wirklich alleine lassen? Nach den geltenden Gesetzen hatte sie die Nachbarn zu verständigen, damit sie die Totenwache hielten. Der Priester musste kommen und seinen Segen sprechen, Wachskerzen mussten bestellt und eine Messe gelesen werden.
Anastasia wischte sich die Tränen aus den Augen und erhob sich. Ihr blieb nicht mehr viel Zeit, wenn sie den letzten Wunsch ihres Vaters erfüllen wollte. Bis dahin durfte niemand erfahren, dass er gestorben war. Entschlossen trat sie an Jacob Braques’ Arbeitstisch, öffnete mit einem kurzen Druck ihres Zeigefingers das Geheimfach, das sich zwischen grüngoldenen Intarsien verbarg, und nahm einen mit Münzen gefüllten Beutel heraus. Dann zog sie ihren Mantel an und verließ das Haus. Stürmischer Wind schlug ihr entgegen und wirbelte bunte Blätter und Staub durch die engen Gassen, die von Frauen mit Weidenkörben am Arm, tobenden Kindern, streunenden Katzen, Pferden und Fuhrwerken bevölkert waren.
Das trockene Rascheln der Blätter kam ihr unnatürlich laut vor, und die Menschen, an denen sie vorüberkam, schienen unendlich weit von ihr entfernt zu sein, obwohl sie nur ihre Hand auszustrecken brauchte, um sie zu berühren. »Geweihte Erde«, hämmerte die Stimme in ihrem Kopf und trieb sie weiter durch die Gassen auf die Grand Pont zu, die als einzige Brücke die Île de la Cité mit dem Rest von Paris verband.
Der Morgennebel hatte sich verzogen. Blasses Sonnenlicht lag auf den weißen Steinen der Kirche Unserer Lieben Frau. Das Licht betonte die klaren Linien ihrer Spitzbögen, drang durch das Maßwerk der mächtigen Fensterrose und ließ die in Stein gehauenen Szenen und Figuren über den Portalen noch einmal deutlicher hervortreten.
An ihrem östlichen Ende, im Schatten der gewaltigen Strebebögen, erstreckte sich der Kirchhof, auf dem viele Günstlinge der Krone in der Nähe ihrer Könige ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten.
Obwohl es noch früh am Morgen war, war die Luft so schwül, als ob ein heißer Wüstenwind seinen Weg über das Meer und über das flache Land bis nach Paris gefunden hätte. Eine gerade erwachte Krähe stieß ein müdes Krächzen aus, dann senkte sich erneut Stille über den verlassen wirkenden Kirchhof, dessen kaltem Boden der eigenartige schwere Geruch feuchter Erde entströmte, wie er nur durch Verwesung und Tod entstand.
Jacques war als Erster da! Ein Überlebender des Schwarzen Todes, der vor zehn Jahren Paris heimgesucht und seine Eltern und fünf seiner Geschwister mit sich genommen hatte.
Übrig geblieben waren nur er und der kleine Pierre, der ihm mit seinen großen glänzenden Kinderaugen dabei zugesehen hatte, wie er die sterblichen Überreste ihrer Familie notdürftig in der Erde verscharrte, weil es selbst in den Massengräbern keinen Platz mehr für sie gab.
Danach war der Glanz in Pierres Augen erloschen, und Jacques hatte weitere Tote begraben müssen, um seinen Bruder und sich durchzubringen. Irgendwann waren ihm die Toten dann näher gewesen als die Lebenden, weil sie stumm und gleichgültig waren, so stumm wie Pierre, dem die Begegnung mit dem Tod die Lippen für immer verschlossen hatte.
Jacques entdeckte sie, noch bevor sie den Kirchhof betrat. Sie wirkte in sich gekehrt. Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen und ließen ihr Gesicht noch blasser erscheinen, als es ohnehin schon war. Sie konnte nicht älter als siebzehn sein, und ihre Kleidung verriet, dass sie die Tochter eines wohlhabenden Bürgers war. Heute Abend würde er Pierre gutes weißes Hühnerfleisch mitbringen können und vielleicht sogar einen Apfel.
Er löste sich aus dem Schatten der Strebebögen und ging ihr entgegen, damit sie es sich nicht noch anders überlegen und kehrtmachen konnte.
Sie war schön und still wie seine Toten, und etwas an ihr erinnerte ihn an Pierre.
Er wusste, dass sie ihn bemerkt hatte, obwohl sie ihn nicht ansah, sondern ihren Blick weiterhin gesenkt hielt, als er näher kam. Als Bürgerin durfte sie ihm nicht in die Augen sehen, weil es Unglück brachte, den aus der Gesellschaft Ausgestoßenen in die Augen zu blicken, zu denen unter anderem all jene gehörten, die mit dem Tod zu tun hatten, ihn herbeiführten wie der Henker und seine Gehilfen oder von ihm lebten, wie er und seinesgleichen es taten.
Es machte ihm nichts aus, er hatte sich längst daran gewöhnt.
»Eine Schaufel geweihter Erde kostet einen Pariser Franc«, sagte er und musterte ungeniert ihre feinen Gesichtszüge, das etwas hervorspringende Kinn, die schmale, gerade Nase und die weichen, roten Lippen. Er hätte gerne gewusst, welche Farbe ihre Augen hatten, und stellte sich vor, dass sie blau wären, während er auf ihre Antwort wartete.
Ihre Antwort überraschte ihn.
»Und ein Grab? Ein Grab in geweihter Erde?«, fragte sie entschlossen. »Wie viel kostet das?« Ihre Stimme war klar und hell.
Jacques hatte schon viel erlebt, seitdem es zwei Päpste gab: Mütter, die so viel geweihte Erde kauften, dass sie die Särge ihrer ungetauften Kinder dreimal damit hätten füllen können. Angehörige von Exkommunizierten oder zum Tode verurteilten Verbrechern, die noch ein paar Francs drauflegten, um einige Krümel Erde von den Gräbern der Heiligen, besonders von dem des heiligen Dionysius, zu ergattern. Erde, die sie wie ein kostbares Gewürz über die Dahingegangenen streuten, aber ein Grab auf dem Kirchhof Unserer Lieben Frau war bisher noch nie dabei gewesen. Die Grabplätze waren allesamt dem hohen Klerus und dem Adel vorbehalten, und jedermann wusste, dass man sich nicht einfach ein Grab dort kaufen konnte.
Jacques betrachtete sie abschätzend. Ihre Lider zitterten leicht, und ihre Lippen waren fest zusammengepresst.
Wahrscheinlich hat ihr die Trauer den Verstand getrübt, überlegte er. Und weil er nicht wusste, wie er reagieren sollte, wartete er einfach ab.
Nach einer Weile spürte er, wie sie unruhig wurde. Sie erwartete eine Antwort von ihm, aber was sollte er ihr sagen? Dass es unmöglich war, ein Grab auf dem Kirchhof zu kaufen, so wie man einen Fisch oder ein Stück Fleisch auf dem Markt kaufte?
»Ich habe es versprochen. Es war der letzte Wunsch meines Vaters«, flüsterte sie, und er hörte die Verzweiflung, die in ihrer Stimme lag.
Alle waren sie verzweifelt, wenn sie zu ihm kamen. Die Begegnung mit dem Tod erschütterte sie bis ins Innerste, erinnerte der Tod sie doch stets daran, dass er auch sie nicht verschonen würde. Niemand konnte dem Tod entrinnen.
Jacques überlegte. Er brauchte Geld, denn Pierres Husten war schlimmer geworden, und er musste Holz für den Winter kaufen, damit sein Bruder nicht wieder Fieber bekam, wenn der eisige Nordwind durch die dünnen Wände ihrer kleinen Hütte fegte.
Nun bot ihm das Schicksal eine Chance, die er sich nicht entgehen lassen durfte.
Sein Blick fiel auf das Grab, das er am Tag zuvor ausgehoben hatte, und plötzlich hatte er eine Idee, die ihn nicht mehr losließ. Warum war er nicht schon eher darauf gekommen?
»Ich könnte das Grab dort ein wenig tiefer ausheben, damit zwei Tote übereinander hineinpassen, aber das wird nicht billig«, schlug er vor.
»Wie viel verlangt Ihr?«
»Ich müsste die ganze Nacht graben und den Toten mit meinem Karren abholen, noch bevor der Morgen graut«, überlegte Jacques laut. »Und wir brauchen Steine, die wir statt des Toten in den Sarg legen, damit niemand etwas merkt.«
»Wie viel?«
»Dreißig Francs.« Seine Gedanken überschlugen sich. Mit dreißig Francs konnte er ein Mittel gegen Pierres quälenden Husten kaufen und genügend Holz, um es den ganzen Winter über warm und auch noch einen vollen Bauch zu haben. Gespannt wartete er auf ihre Antwort.
Anastasia atmete erleichtert aus, und die Anspannung fiel von ihr ab, während sie eifrig in eine Falte ihres Mantels griff und einen Beutel aus fein gegerbtem Kalbsleder hervorzog, so als befürchtete sie, er könne es sich noch einmal anders überlegen.
An das, was danach geschehen war, konnte sie sich nur noch schemenhaft erinnern, vielleicht weil sie nicht glauben wollte, was sie getan hatte. Vielleicht aber auch, weil die Begegnung mit dem Totengräber, der feierliche Versehgang unter Führung des Priesters, die schrillen Laute der Klageweiber und die Beerdigung einer mit Steinen gefüllten Holzkiste einen Tag später ihr wie ein nicht enden wollender unwirklicher Traum erschien, den sie am liebsten für immer aus ihrer Erinnerung getilgt hätte.
Nachdem endlich alles vorbei war, hatte sie sich mit letzter Kraft nach Hause und in ihre Kammer geschleppt. Dort ließ sie sich auf ihr Bett fallen und sank in einen unruhigen Schlaf, aus dem sie immer wieder schweißgebadet erwachte. Es war noch dunkel, als sie ihren Mantel nahm und erneut das Haus verließ. Ihre Gedanken kreisten um ihren Vater, der ihr entsetzlich fehlte und jetzt verlassen und einsam in der kalten Erde ruhte.
Unmerklich wurde es heller. Die Geräusche der langsam erwachenden Stadt drangen bis auf den Kirchhof, doch Anastasia nahm sie nur am Rande wahr. Mit leerem Blick starrte sie auf das Grab. Sie brachte es nicht über sich, ihren Vater zu verlassen, ihn alleine zu lassen in seinem letzten Ruhebett, alleine mit dem Fremden, dessen Namen sie nicht einmal kannte, obwohl sie wusste, dass es gefährlich war, zu lange zu bleiben. Wenn sie nun jemand an dessen Grab stehen sehen würde? Vielleicht sogar ein Angehöriger des Verstorbenen? Man würde sich über ihre Anwesenheit wundern und anfangen Fragen zu stellen, auf die sie keine Antwort geben konnte.
Dass sie tatsächlich schon seit geraumer Zeit beobachtet wurde, ahnte sie nicht.
Der Tod ist Voraussetzung für die Wiedergeburt, und es ist Saturn, der die Schwelle dazwischen hütet.
Ruediger Dahlke und Nicolaus Klein
2
»Vater kommt zurück!«
Von freudiger Erwartung erfüllt stieg Christine de Pizan die steilen Treppen des Barbeauturms hinunter, bereit sich in Étiennes starke Arme zu stürzen. Sie hatte ihn schrecklich vermisst. Jeden Tag, jede Stunde und besonders in den Nächten, die ihr ohne ihren Gemahl endlos erschienen waren.
In der geöffneten Haustüre standen ihre drei Kinder. Jean, mit seinen sieben Jahren der ältere ihrer beiden Söhne, hatte einen Arm um seinen kleinen Bruder gelegt und hielt sich mit dem anderen an seiner neun Jahre alten Schwester fest. Aus großen Augen starrten die Kinder den Besucher an, bei dessen Anblick sich Christines Magen zusammenzog. Sie stieg die letzten Stufen hinab und spürte ihre Hände feucht werden. Mit hölzernen Bewegungen durchquerte sie die Eingangshalle, bis sie hinter ihren Kindern stand und mit einem unguten Gefühl enttäuscht auf den königlichen Boten blickte, dessen eiserne Rüstung unter dem Wappenrock in der Sonne glänzte.
Was hatte das alles zu bedeuten? Warum hatte Étienne einen Boten geschickt, anstatt selbst zu kommen? Wusste er denn nicht, wie sehnsüchtig sie ihn erwartete?
Der Bote hatte ein scharfkantiges Gesicht und wache, graue Augen, die er wegen des Sonnenlichts leicht zusammenkniff.
Seine Miene verriet nichts von dem, was er fühlte oder dachte.
»Was hat Euer Besuch zu bedeuten? Wo ist mein Gemahl? Ist er aufgehalten worden?« Christines Stimme klang ungewohnt schrill.
»Seid Ihr Christine de Pizan, die Gemahlin des königlichen Notars Étienne du Castel?«, vergewisserte der Bote sich, ohne auf ihre ängstlichen Fragen einzugehen. Für einen winzigen Augenblick trafen sich ihre Blicke.
Christine nickte. »Ja, die bin ich, aber wollt Ihr mir nicht endlich sagen, wo mein Gemahl ist?« Ihre Stimme klang jetzt brüchig. Der Bote senkte seinen Blick. Anstelle einer Antwort zog er einen Brief aus seinem Ärmel und erbrach das Siegel.
Eine dunkle Wolke schob sich vor die Sonne, und Christine begann, am ganzen Körper zu zittern. Sie war unfähig, sich zu bewegen.
Wie durch einen dichten Nebel drang die Stimme des Boten an ihr Ohr.
Wir bedauern sehr, Euch mitteilen zu müssen, dass Unser geliebter Notar, Étienne du Castel, am siebenundzwanzigsten Tag des Oktobers seiner schweren Krankheit erlegen ist.
Der Herr erbarme sich seiner Seele.
Gezeichnet in tiefer Trauer
Seine Majestät Karl VI.
König von Frankreich
Der Bote beugte sich vor und hielt ihr den Brief hin.
Jegliche Farbe wich aus Christines Gesicht, ihre Knie gaben nach, und sie sank ohnmächtig in sich zusammen.
Sie spürte nicht, wie sie von mehreren Armen hochgehoben und in ihre Kammer getragen wurde. Sie sah nicht die verstörten Gesichter ihrer Kinder und die besorgte Miene ihrer Mutter, die neben ihrem Bett saß und ihre Stirn mit Kampfer und Rosenöl betupfte. Schwerelos trieb sie durch die Dunkelheit. Eine seltsame Gleichgültigkeit hatte Besitz von ihr ergriffen. Sie fühlte sich müde, so unendlich müde, und hatte nur noch den Wunsch zu schlafen.
Das kleine Mädchen starrte wie gebannt auf die golden schimmernden Flügeltüren, die von zwei Wachen in glitzernden Rüstungen flankiert wurden, und fieberte dem Augenblick entgegen, an dem sich diese endlich öffnen würden.
Dahinter, hatte ihre Mutter ihr erklärt, erwarte sie der König, und Christine konnte es kaum erwarten, den König zu sehen.
Die Luft war erfüllt von raschelnder Seide und betörenden Duftwässern, die sich gegenseitig zu übertrumpfen suchten, doch Christine hatte keinen Blick für die prächtig gekleideten Edelleute, die sie und ihre Familie umringten.
Sie wollte endlich den König sehen und den Hofknicks, den sie während der langen Reise von Bologna nach Paris unter der Aufsicht ihrer Mutter einstudiert hatte, vor ihm machen.
Der durchdringende Klang einer Fanfare ließ das dahinplätschernde Gemurmel um sie herum verstummen. Erwartungsvolle Spannung breitete sich aus.
Christine hielt den Atem an und sah staunend, wie die Flügeltüren aufschwangen, als wären sie von unsichtbaren Händen bewegt. Dann schritt sie an der Seite ihrer Eltern auf den König zu.
Karl V. saß erhöht auf einem mit tiefblauem Samt ausgeschlagenen Thronsessel unter einem Baldachin, der mit funkelnden Sternen übersät war wie der Nachthimmel in einer lauen Sommernacht, und lächelte ihr freundlich entgegen. Sie hatte nur Augen für ihn, den König, von dem ihr Vater mit einem ehrfürchtigen Klang in der Stimme sprach, den sie bei ihm noch nie zuvor wahrgenommen hatte.
Das Lächeln Karls V. vertiefte sich, als Christine ihren Rock raffte und graziös vor ihm knickste, noch bevor ihre Mutter ihr das vereinbarte Zeichen gegeben hatte. Einen Lidschlag lang verweilte sie in dieser Haltung, dann hob sie ihren Kopf und musterte Karl mit der unverhohlenen Neugier, die nur Kindern zu eigen ist, unverstellt und ohne Arg.
Sie vergaß die Ermahnungen ihrer Mutter, den König von Frankreich auf keinen Fall anzustarren. Fasziniert betrachtete sie den Mann, den sie so oft versucht hatte, sich vorzustellen.
Er war hochgewachsen, hatte einen kräftigen Körperbau und freundliche braune Augen, die ihr jetzt verschwörerisch zublinzelten. Ein glückliches Lächeln legte sich auf ihr Gesicht, während sie weitere Einzelheiten in sich aufnahm: den prächtigen, scharlachroten Mantel mit dem breiten Hermelinbesatz, der ihn umhüllte, die funkelnden Ringe mit den bunten Steinen an seinen Händen und den spitzen, mit schimmernden perlenbesetzten Hut.
Karl V. war ein König, der sein Volk beschützte, und er würde auch sie und ihre Familie in dem fremden Land beschützen, das von nun an ihre Heimat war, davon war sie fest überzeugt.
Karl V. lächelte noch immer, als sich die schwarzen Trauerfahnen auf ihn herabsenkten und ihn verhüllten, bis nur noch seine Augen zu sehen waren.
Ein dumpfes Grollen breitete sich vom Boden her aus und übertönte die erschrockenen Schreie, die sich rhythmisch wiederholten und dabei immer lauter wurden, bis Christine sie nicht länger ertragen konnte und beide Hände gegen ihre Ohren presste.
»Der König ist tot!«
Vier Worte, die so grausam waren, dass sie Christine bis auf den Grund ihrer Seele erschütterten.
Gleißendes Licht drang durch die Dunkelheit um sie herum, dann durchbrachen Geräusche die friedliche Stille.
Christine schlug die Augen auf. Ihr Herz hämmerte wie wild in ihrer Brust. Der König war tot, und es hieß, ihr Vater trüge die Schuld daran.
Sie presste die Hände gegen ihre Schläfen, in dem vergeblichen Versuch, den Schmerz zu lindern, der hinter ihrer Stirn tobte. Bilder wirbelten durch ihren Kopf, doch sie war noch zu schlaftrunken, um unterscheiden zu können, welche davon Traum und welche grausame Wirklichkeit waren.
Der Tod Karls V. vor zehn Jahren war ein Schock für sie und ihre ganze Familie gewesen, ein Schock, von dem ihr Vater sich nie mehr erholt hatte.
Vor drei Jahren war er dem König gefolgt.
Sie sah ihn vor sich: seine dunklen Augen, die zu lächeln schienen, wenn er sie ansah, und sie liebevoll ermunterten, wenn sie etwas nicht gleich verstand. Es war ein tröstliches Bild, das sie nun verzweifelt festzuhalten versuchte, weil sie tief in ihrem Inneren wusste, dass etwas Furchtbares geschehen war. Ihre Gedanken glitten durch die Zeit, von ihrer unbeschwerten Kindheit an den Ufern der Seine zu ihrer Heirat mit Étienne, dem Mann, den sie von ganzem Herzen liebte, zur Geburt ihres ersten Kindes, dem zwei weitere folgten. Danach brach die Erinnerung an die Ereignisse des gestrigen Tages mit aller Macht über sie herein.
Das Trommeln der Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster und die freudigen Rufe ihrer Kinder klangen ihr noch immer in den Ohren wie das fröhliche Echo aus einer fernen glücklichen Zeit. War es tatsächlich erst zwei Tage her, dass Fortuna sich von ihr abgewandt hatte?
Ihr geliebter Étienne war tot! Gestorben in der Fremde, an einer Seuche, die nicht einmal einen Namen hatte. Sie hatte ihre ganze Kraft gebraucht, um das Leichenbegängnis und die anschließende Bestattung mit Würde zu überstehen, und sich inmitten all der festlich gekleideten Menschen, die dem Leichenzug folgten, so verloren gefühlt wie noch nie.
Wie betäubt starrte Christine durch das schmale Fenster in den silbergrauen Himmel und versuchte gar nicht erst ihre Tränen zurückzuhalten, die ihr wie Sturzbäche über die Wangen strömten. Sie ließ sie fließen, bis sie den furchtbaren Schmerz in ihrem Inneren fortgespült hatten und nur noch dumpfe Trauer zurückblieb.
Gott hatte Frankreich verlassen und dem Tod Tür und Tor geöffnet!
Es hielt sie nicht länger in ihrem Bett. Sie wollte ihrem Gemahl so nah wie möglich sein und musste einfach zu ihm.
In fliegender Hast kleidete sie sich an und verließ das Haus. Den Weg zum Kirchhof rannte sie fast, als hätte sie Angst, ihr Mann könnte sich noch weiter von ihr entfernen, wenn sie nicht schnell genug bei ihm wäre. Es gab so vieles, was sie ihm noch sagen wollte.
Außer Atem erreichte sie den Kirchhof, wo sie ungläubig auf die junge Frau starrte, die am Grab ihres Mannes stand.
Obwohl es viel zu warm für diese Jahreszeit war, begann Christine zu frösteln und zog ihren mit Feh gefütterten Mantel enger um ihre Schultern. Wer war das fremde Mädchen am Grab ihres Mannes, das so versunken in seine Trauer war, dass es gar nichts anderes mehr um sich herum wahrnahm?
Christine konnte ihren Blick nicht von der jungen Frau abwenden, sie vergaß kurzzeitig sogar ihre eigene Trauer, die sie zu Étiennes Grab gezogen hatte, erfüllt von der vagen Hoffnung, ihm dort näher zu sein.
Ein Gedanke drängte sich in ihr Bewusstsein, der so schrecklich war, dass sich ihr Herz schmerzhaft zusammenzog. War es möglich, dass ihr geliebter Étienne eine Mätresse gehabt hatte? Sie wagte nicht, den Gedanken weiterzudenken. Allein schon die Vorstellung, dass ihm eine andere Frau so nahe gewesen war wie sie, war unerträglich.
Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf. Nein, Étienne war anders als die meisten Männer, für die eine Frau nur dazu da war, ihre Triebe zu befriedigen. Étienne hatte sie geliebt und ihr den Respekt entgegengebracht, der einer Frau zustand. Er hätte niemals etwas getan, das sie verletzte.
Und wenn sie sich irrte? Das erste Mal in ihrem Leben spürte sie den giftigen Stachel der Eifersucht, der sich tief in ihr Herz bohrte. Étienne war ein Mann gewesen, der die Blicke der Frauen auf sich zog. Sie war so stolz auf ihren schönen Gemahl gewesen und hatte alles getan, um ihm zu gefallen, und er hatte es ihr gedankt, indem er zärtlich und rücksichtsvoll ihr gegenüber gewesen war. Niemals hatte er seine Stimme gegen sie erhoben oder sie gar geschlagen.
Aber er war ein Mann und in seiner Aufgabe als königlicher Notar viel zu oft von zu Hause fort gewesen, unterwegs mit dem König, den sie beide so verehrt hatten und den der Herr so unerwartet und viel zu früh zu sich genommen hatte. Nach dessen Tod hatte sein Sohn Karl VI. Étiennes Dienste weiterhin in Anspruch genommen, und auch mit diesem neuen König war er durch die königlichen Ländereien gereist.
Das Mädchen am Grab ihres Gemahls war jung und schön wie der Sommer mit seiner hellen Haut und den goldenen Locken, die bis zur Hüfte hinabreichten. Unter seinem Mantel trug es einen fein gefalteten grünen Rock aus flandrischem Tuch und darüber ein mit Stickereien versehenes Mieder, das sich eng um seine schmale Taille und seine Brüste schmiegte, dem prallen Busen einer Jungfrau, deren Schoß noch keine Kinder geboren hatte.
Christine de Pizan unterdrückte den Impuls, sich auf das Mädchen zu stürzen, um die Wahrheit aus ihm herauszuschütteln. Stattdessen atmete sie einige Male tief durch, bis sie wieder klar denken konnte. Es kamen noch andere Möglichkeiten für die Anwesenheit des Mädchens in Betracht. Sie durfte nicht gleich das Schlimmste denken. Das Mädchen war jung und unerfahren und konnte in seiner Trauer Étiennes Grab mit einem anderen verwechselt haben. Schließlich war Étiennes Epitaph noch nicht gesetzt worden und ohne Grabstein sahen alle frisch aufgeschütteten Gräber gleich aus.