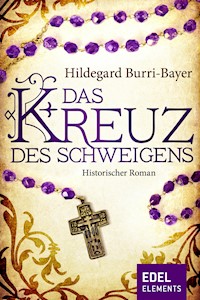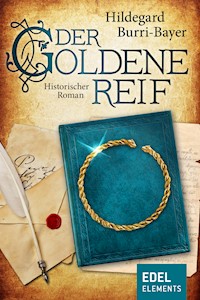3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Aila kommt aus der Vergangenheit - durch einen Zeitsprung wird die junge Frau aus der Eisenzeit ins heutige Schottland versetzt. Sie hat eine wichtigen Auftrag, denn sie allein kann den Goldenen Reif, der über das Schicksal ihres Volkes entscheiden wird, finden und zurückbringen. Doch als sie mit dem Reif in die Vergangenheit zurückkehrt, gerät sie in tödliche Gefahr, die nur der Druide Mog Ruith von ihr abwenden kann. Denn Mog Ruith kennt Ailas Geheimnis, und nur er kann ihr den Weg zurück ermöglichen: den Weg zurück ins Heute, zurück ins Leben, zurück zu dem Mann, den sie liebt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hildegard Burri-Bayer
Das Vermächtnis des Raben
Historischer Roman
Die Autorin
Hildegard Burri-Bayer wurde 1958 in Düsseldorf geboren. Nach dem Realschulabschluss ließ sie sich zur Dozentin für Museumspädagogik weiterbilden und wurde später Leiterin eines privaten Stadtmuseums für Ausgrabungen. Hildegard Burri-Bayer wurde durch ihre Bestseller »Die Sternenscheibe« und »Der goldene Reif« bekannt. Die Autorin ist verheiratet und hat fünf Kinder.
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2005 by Hildegard Burri-Bayer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-901-5
facebook.com/EdelElements
Für meine Eltern
Die Zeit für das Glück
ist heute,
nicht morgen.
(David Donn)
I
1
Das flackernde Feuer tauchte den Raum in ein warmes Licht. Miriam starrte nachdenklich in die Flammen, die vor ihr auf und ab tanzten.
Lange Jahre des Friedens lagen hinter ihr, die sie glücklich und zufrieden mit ihrem Mann Calach und der gemeinsamen Tochter Aila im nördlichsten Teil des Caledonischen Hochlands verbracht hatte. Sie waren froh, dass die Römer angesichts des heftigen Widerstands der so genannten Barbaren alle Versuche aufgegeben hatten, den dünn besiedelten Norden zu erobern. Nur wenige Male hatte Miriam um das Leben ihres Mannes bangen müssen, wenn er mit seiner Gefolgschaft aufgebrochen war, um den verbündeten Fürsten gegen die Römer zu Hilfe zu eilen. Sie beherrschten freilich immer noch weite Teile des Landes, aber mittlerweile hatten sich die meisten der Gaufürsten mit ihnen arrangiert. Aufstände waren die Ausnahme geworden und wurden von den Römern niedergeschlagen, noch bevor die Nachricht davon bis in den hohen Norden dringen konnte.
Miriams Leben wurde vom Wechsel der Jahreszeiten bestimmt, und sie dachte nur noch selten an die seltsame Vergangenheit, die sich wie ein fast vergessener Traum in einem hinteren Teil ihres Gedächtnisses verbarg. Vor über siebzehn Jahren war sie ihrem Herzen gefolgt und hatte ein großes Abenteuer begonnen: Nach einer Zeitreise hatte sie die Bequemlichkeit des dritten Jahrtausends gegen das Leben mit einem Caledonischen Fürsten im ersten Jahrhundert nach Christus eingetauscht.
Sie genoss die Wärme, die von dem Mann an ihrer Seite ausstrahlte, und freute sich auf die Reise am morgigen Tag, die sie gemeinsam mit ihm unternehmen würde.
Boten hatten gemeldet, dass der Briganterfürst Venutius sich eine erbitterte Fehde mit Aneirin, dem Fürsten der Trinovanten, lieferte, die das Land weiter südlich bewohnten. Durch sein Amt als Vergobretos – der Vollstrecker der Urteile – hatte Calach die Pflicht, alles zu unternehmen, um den Streit zwischen den beiden Stämmen zu schlichten und die alten Bündnisse zu erneuern. Ein sorgenvoller Zug lag über Calachs Gesicht, als er sich an Miriam wandte. »Der lange Frieden gefällt den jungen Männern nicht. Immer mehr von ihnen verlassen uns, um sich in anderen Teilen des Landes den dort lebenden Fürsten zu verpflichten. Wenn das so weitergeht, werden in unserem Dorf bald nur noch alte Männer leben.«
Miriam musste lachen. Sie liebte die späten Abendstunden, an denen sie ihren Mann für sich allein hatte und gemütlich mit ihm am Feuer saß, um über die Ereignisse des Tages zu reden. »Ihr Männer seid alle gleich. Erst kämpft ihr für den Frieden, und jetzt, wo ihr endlich euer Ziel erreicht habt, sehnt ihr euch wieder nach Krieg.« Sie schmiegte sich enger an Calach und drückte ihm einen zärtlichen Kuss auf den Mund. »Es leben noch genügend junge Männer in unserem und auch in den umliegenden Dörfern, die so streitlustig sind, dass die nächste kleinere Fehde nicht weit entfernt sein kann, die sie wieder für eine Weile beschäftigen wird. Warum lässt du die Männer nicht auf den Feldern arbeiten? Den ganzen Tag verbringen sie mit Jagen und Trinken oder schleichen um die jungen Mädchen herum. Sie wären viel ruhiger, wenn sie regelmäßig arbeiten müssten.«
Calach bewunderte seine schöne, kluge Frau. Sie wusste zu allem etwas zu sagen, und oft schon hatte er auf ihre Worte gehört. Verliebt sah er ihr in die Augen.
»Sicher hast du Recht, doch die alten Bräuche besagen nun einmal, dass die Gefolgschaft eines Gaufürsten für die Jagd und den Krieg bestimmt ist. So war es seit jeher und wird es auch immer sein. Denk nicht so viel über die Angelegenheiten der Männer nach – erfülle lieber deine Pflicht als Ehefrau.« Er verschloss ihren Mund mit einem leidenschaftlichen Kuss und zog sie sanft auf die gemeinsame Schlafstätte.
»Sitten und Gebräuche ändern sich im Laufe der Zeit«, murmelte Miriam zwischen zwei Küssen, doch Calach hörte ihr nicht mehr zu. Sie spürte seine Hände über ihren Körper wandern, fordernd und doch zärtlich. Mit einem gespielten Seufzer ließ sie sich von seiner Leidenschaft mitreißen und vergaß alles um sich herum. Sie liebte Calach wie am ersten Tag ihrer Begegnung und hatte es nie bereut, dass sie ihr altes Leben gegen diese Liebe eingetauscht hatte.
Als sie am nächsten Morgen aus dem Haus traten, bedeckten schwere graue Wolken den Himmel und der auffrischende Wind blies ihnen kühle Luft ins Gesicht. Miriams Wangen hatten sich gerötet, und ihre Augen blitzten vor Vergnügen. Sie war seit Jahren nicht mehr aus dem Dorf gekommen und würde die Reise fernab von ihrem alltäglichen Leben genießen. Während Calach die Pferde aufzäumte, verabschiedete Miriam sich von ihrer Freundin Ira. »Bitte vergiss nicht dein Versprechen, auf Aila zu achten«, sagte sie zum Abschied noch.
Die junge Frau lächelte ihr fröhlich zu und streichelte über die warmen Nüstern von Miriams Stute. »Es wäre leichter, auf den Wind zu achten, als auf deine Tochter, aber mit Hilfe der Götter wird es mir hoffentlich gelingen.« Grüßend hob sie die Hand und sah ihrem Bruder und seiner Frau immer noch lächelnd nach, als die beiden die Pferde bestiegen und langsam zum Tor hinausritten.
Der Wind spielte mit den rotgoldenen Locken des jungen Mädchens, das still zwischen den mächtigen Eichen stand. Wären die flatternden Haare nicht gewesen, hätte man sie für eine wunderschöne Statue halten können. Ihre weit geöffneten Augen blickten merkwürdig starr und schienen die Umgebung um sie herum nicht wahrzunehmen. Lange verharrte sie in der gleichen Haltung, bevor ihre Augen sich wieder mit Leben füllten. Lässig wandte sie sich um und strich eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht. Ihre Bewegungen waren geschmeidig wie die einer Katze und genauso leise.
Ohne auch nur auf einen einzigen der trockenen Äste unter ihren schmalen Füßen zu treten, verließ sie den heiligen Hain, der in dem schwindenden Licht der untergehenden Sonne noch düsterer wirkte als sonst. Ein großer grauer Schatten tauchte neben ihr auf und bewegte sich ebenso lautlos wie sie.
Sie war erschöpft, als sie das Dorf erreichte und sich auf ihre Bettstelle sinken ließ, ohne ihr Gewand abzulegen. Das Knistern des Feuers, das eine der Leibeigenen entzündet hatte, begleitete sie in den Schlaf. Sie bemerkte nicht mehr, wie Ira hereinkam und eine warme Decke über ihrem schmalen Körper ausbreitete. Vorsorglich legte Ira noch einige Holzscheite nach, bevor sie das Haus wieder verließ. Die Nächte wurden mit jedem Tag kälter und feuchter, und es würde nicht mehr lange dauern, bis der Wind auch die letzten bunten Blätter von den Bäumen fegte und die dunkle Jahreszeit begann.
Aila hatte seltsame Träume. Immer wenn Mog Ruith sie in den heiligen Hain rief, wurde sie anschließend von diesen Träumen gequält, die sie nicht verstehen konnte und die ihr Angst machten. Sie hatte mit Barco, dem Dudelsackspieler, darüber gesprochen, der ihr ein guter Freund geworden war. Barco hatte sie sanft aus seinen schräg stehenden dunklen Augen angesehen. »Vertraue Mog Ruith, er wird wissen, wie weit er dich führen kann.« Seine Worte ließen sie sofort ruhiger werden. Sie hatte großes Vertrauen zu dem Barden, der ein Schüler Mog Ruiths war. Er besaß die Gabe, immer im richtigen Moment zu erscheinen, als würde er genau wissen, wann sie seinen Trost oder einen Rat von ihm herbeisehnte.
Als sie an diesem Morgen erwachte, strich sie sich mit einer energischen Handbewegung über die Stirn, als wollte sie die dunklen Träume fortschieben, die ihre Gedanken immer noch umklammert hielten. Sie sprang aus dem Bett und öffnete die Türe, um die kühle Morgenluft einzulassen. Die Sonne erhob sich schwerelos hinter den Bäumen, die das Dorf umgaben.
Ailas Stimmung stieg. Es würde ein schöner Tag werden, und sie beschloss, ihn in ihrem geliebten Wald zu verbringen. Sie brach ein Stück von dem frisch gebackenen Brot ab, das auf dem Holzregal neben der Türe lag, und zog sich ihren Umhang über. Kauend lief sie zum Fluss, um sich zu waschen. Caru, der graue Kriegshund, folgte ihr auf Schritt und Tritt, wie er es von dem Tag an tat, als sie ihm furchtlos einen schmerzhaften Dorn aus der Pfote gezogen hatte. Doch das war lange her. Damals war sie noch ein kleines Mädchen gewesen, und ihr Mitleid hatte über ihre Angst vor dem großen Tier gesiegt, das wütend jeden anknurrte, der sich ihm nähern wollte.
Sie hob einen Ast vom Boden auf und schleuderte ihn in den Fluss. Sofort jagte Caru dem Ast nach. Während sie sich in dem kalten Wasser Gesicht und Hände wusch, brachte Caru den Ast ans Ufer und legte ihn auffordernd vor sie auf den mit Steinen übersäten Ufersand. »Meinst du, dass du noch nicht sauber genug bist?« Lachend warf sie den Ast ein zweites Mal und sah zu, wie der Hund sich in das kalte Wasser stürzte. Dann zog sie einen dünnen Haselnusszweig aus dem Beutel an ihrem Gürtel und reinigte sorgfältig ihre Zähne, so wie Miriam es ihr schon als Kind beigebracht hatte.
Sie war gerade fertig, als die ersten Bewohner des Dorfes am Fluss eintrafen. Verico befand sich unter ihnen. Er war ein stürmischer junger Mann, der es kaum abwarten konnte, seine Prüfungen abzulegen, um endlich in die Reihen der Krieger aufgenommen zu werden. Er warf Aila einen feurigen Blick zu. Für ihn kam kein anderes Mädchen im Dorf als Calachs Tochter in Frage. Er liebte sie, seit er denken konnte, und trainierte härter als alle anderen, um der Beste zu sein, wenn der große Tag anbrechen würde. Es war seine einzige Chance, die Fürstentochter zur Frau zu bekommen. Er war sich sicher, dass Calach, der seine Tochter über alles liebte, niemals den Zweitbesten für Aila wählen würde.
Aila war sich bewusst, dass die Blicke des jungen Mannes ihr folgten, als sie sich erhob und in Richtung Wald lief. Verico war nicht der einzige Mann, der ihr nachsah, und sie genoss die Bewunderung der jungen Männer, die ihr ein Gefühl von Überlegenheit gab. Bei dem Gedanken daran, dass ihre Eltern noch eine ganze Weile fortbleiben würden, legte sich ein unbekümmertes Lächeln über ihre feinen Gesichtszüge. Niemand würde ihr Vorschriften machen, und für die nächsten Tage war sie von der langweiligen Nähstube befreit, in der sich alle unverheirateten Frauen und Mädchen beinahe täglich trafen, um zu nähen, zu weben und zu spinnen. Die Nähstube war das begehrte Ziel der jungen Männer, die ständig nach einem Vorwand suchten, um sich ihrer Angebeteten nähern zu können.
Aila machte einen großen Bogen um den heiligen Hain und lief tiefer in den Wald. Unterwegs pflückte sie einige Beeren, die sie hungrig verzehrte. Nach einer Weile öffnete sich der Wald und gab den Blick auf eine Lichtung frei, die von einer blühenden Wiese überzogen war. Die Lichtung war kreisrund und übte immer wieder eine starke Anziehungskraft auf Aila aus. Sie war überzeugt davon, dass sich hier ein Geheimnis verbarg; vielleicht hatte sie sogar einen der Zugänge in die andere Welt entdeckt. Jedenfalls liebte sie diesen Platz, den sie vor einiger Zeit gefunden hatte und an dem sie ungestört ihren Gedanken nachhängen konnte. Bisher hatte sie niemandem von dieser Lichtung erzählt, nicht einmal Barco. Er sollte ihr Geheimnis bleiben, ein Zufluchtsort, den sie ganz für sich allein behalten wollte.
Die Spitzen einiger schmaler, verwitterter Steine ragten aus den hohen Gräsern. Sie hätte zu gern gewusst, wer sie dort aufgestellt hatte und was sich dahinter verbarg. Ob Mog Ruith es ihr sagen konnte? Irgendwann einmal würde sie ihn danach fragen. Sie ließ sich in der Mitte des Kreises in das weiche Gras sinken und genoss den würzigen Duft der Kräuter, der über der Wiese hing. Dann rollte sie sich träge auf den Rücken und betrachtete gedankenverloren die kleinen weißen Wolken, die am Himmel trieben. Zu gern hätte sie die Wölkchen einmal berührt, um zu wissen, wie sie sich anfühlten. Ihre Mutter hatte ihr vor langer Zeit erklärt, dass Wolken nur aus Wasser bestanden, doch diese Vorstellung gefiel ihr nicht. Sie wollte, dass sie so weich und luftig waren, wie sie aussahen. Sie war stolz auf ihre kluge und schöne Mutter, die mehr wusste als die anderen Menschen in ihrem Dorf und die viel von ihrem Wissen an sie weitergegeben hatte. Trotzdem hatte sie die Erfahrung machen müssen, dass Wissen auch Träume zerstören konnte, und sie hatte sich schon oft gefragt, ob es das wirklich wert war.
Die Sonne stand jetzt hoch über ihr, und sie genoss die warmen Sonnenstrahlen, die auf ihr Gesicht fielen. Ihre Gedankengänge wurden träger, und ohne es zu bemerken, schlief sie ein. Mog Ruith stand vor ihr. Er trug einen waid-blau gefärbten Umhang über seinem weißen Gewand. Sein langer Bart reichte ihm fast bis auf die Brust. Aus funkelnden, wässrig blauen Augen sah er sie an. In seinen Augen, die sonst Weisheit und Güte ausstrahlten, stand jetzt tiefe Trauer. Er hielt den goldenen Reif in den Händen, der die Kraft der Tiefe und die Macht der Elemente in sich vereinte und durch den alles Leben floss. Der Reif war in zwei Teile zerbrochen. Fassungslos vor Entsetzen starrte Aila auf das zerstörte Heiligtum. Die ruhige Stimme des Druiden drang an ihre Ohren. »Ich habe dich seit deiner Geburt auf die Aufgabe vorbereitet, die dir bevorsteht. Die Zeit ist jetzt gekommen, in der sich dein Schicksal zum Wohle unseres Volkes erfüllen wird.«
Nebelschwaden stiegen von dem Boden unter ihren Füßen hoch und breiteten sich rasch aus. Der unheimliche Nebel wurde immer dichter, bis ihre Augen ihn nicht mehr durchdringen konnten, und nahm ihr die Luft zum Atmen. Verzweifelt rang sie nach Luft und versuchte aus dem Nebel herauszufinden, doch es gelang ihr nicht. Das furchtbare Gefühl zu ersticken war das Letzte, was sie spürte, bevor sie das Bewusstsein verlor und der Nebel um sie herum sich in tiefe Schwärze verwandelte, die sie unbarmherzig in sich hineinzog.
2
Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sie erwachte. Voller Angst schlug sie die Augen auf und schnappte gierig nach Luft. Der schreckliche Nebel war verschwunden, wie sie erleichtert feststellte. Benommen blieb sie noch eine Weile liegen. Sie war eingeschlafen und hatte geträumt, doch warum fühlte sie sich so matt nach diesem Traum? Ihr war schwindelig und elend, wie damals, als sie krank gewesen war. Suchend sah sie sich um. Wo war Caru? Er hatte sich noch nie von ihr entfernt, wenn sie schlief. Von dem grauen Hund war nichts zu sehen.
»Caru, wo bist du?« Ihre helle Stimme schallte über die Wiese, doch niemand antwortete, oder kam freudig auf sie zugesprungen. Der düstere Traum hielt sie immer noch gefangen. Ihr Mund war wie ausgetrocknet, und sie verspürte brennenden Durst. Immer wieder rief sie den Namen des Hundes, während sie sich auf den Weg zu einem der zahllosen Bäche machte, die das Hochland durchzogen. Doch Caru blieb verschwunden.
Nachdem sie ihren Durst gelöscht hatte, sah sie sich genauer um und stellte fest, dass sich die Landschaft verändert hatte. Der Wald um sie herum war hell und licht. Was war nur geschehen? Beunruhigt machte sie sich auf den Rückweg, während sie weiter nach ihrem treuen Freund rief. Viel zu schnell erreichte sie den Waldrand und starrte fassungslos auf die riesige Heidelandschaft um sich herum. Die vorher noch dicht bewaldeten Hügel waren kahl, wenn man von den vereinzelten Bäumen absah, die einen jämmerlichen Anblick boten.
Erschrocken zuckte sie zusammen, als ein Birkhuhn neben ihr aufflog und sich kreischend in die Lüfte erhob. Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder, doch die Bäume blieben genauso verschwunden wie Caru. Ihr Magen zog sich zu einem dicken Klumpen zusammen. Aila fühlte sich einsam wie noch nie in ihrem Leben, und sie hatte Angst. Angst vor dem, was mit ihr geschehen war, und vor dem, was noch kommen würde. Sehnsucht nach dem sanften Barco stieg in ihr hoch, doch auch er kam nicht, um sie zu trösten. Tapfer bemühte sie sich, ihre Verzweiflung zu unterdrücken, und lief weiter in Richtung Dorf. Der Weg unter ihren Füßen war ihr fremd. Vielleicht hatte sie sich verlaufen? Im gleichen Moment, in dem der Gedanke in ihrem Kopf war, wusste sie, dass sie sich etwas vormachte. Zu oft war sie diesen Weg schon gegangen, genau wie alle anderen Wege hier in der Gegend. Dass sie sich verlaufen hatte, war unmöglich.
Sie lief, bis es dunkel war und ihre Füße von dem ungewohnten Untergrund zu schmerzen begannen. Die wadenhohe Heide bestand überwiegend aus ineinander verschlungenem Geäst, das ihre Beine blutig kratzte. Sie hatte Hunger und verstand nicht, was mit ihr geschehen war. Tränen der Verzweiflung rollten über ihre Wangen, als sie sich neben einen Baumstamm sinken ließ. Müde rollte sie sich unter der verkrüppelten Kiefer zusammen und zog ihren Umhang fester um ihre Schultern. Dann fiel sie in einen tiefen traumlosen Schlaf.
Als Aila am nächsten Morgen von dem Gezeter zweier Birkhühner geweckt wurde, waren ihre Kleider feucht und klamm. Zitternd vor Kälte erhob sie sich. Der Himmel war von einer dicken grauen Wolkenschicht bedeckt, die der Landschaft etwas Schwermütiges verlieh und zu ihrer Stimmung passte. Aila hätte gern ein Feuer entzündet, doch sie hatte keinen Feuerstahl dabei.
Ihr Magen gab ein knurrendes Geräusch von sich, und sie vermisste Caru, von dem sie noch nie lange getrennt gewesen war. Suchend sah sie sich um. So sehr sie sich auch bemühte, es gelang ihr nicht, einen Anhaltspunkt dafür zu finden, welche Richtung sie nehmen sollte, und sie entdeckte auch sonst keinen vertrauten Anblick. Traurig und frierend ging sie weiter und wanderte über fremd aussehende, kahle Hügel und durch weite Täler. Nur wenige Male legte sie eine Pause ein, um ihren Durst an einem der Bäche oder Flüsse zu stillen, an denen sie vorbeikam. Nachts schlief sie unter Bäumen, deren Äste und Zweige ihr ein wenig Geborgenheit gaben. Die endlose Einsamkeit um sie herum begann sie zu erdrücken, aber was noch schlimmer war, sie konnte die Götter nicht mehr spüren. Sie dachte darüber nach, ob es etwas mit ihrer Aufgabe zu tun hatte. Hatten die Götter sie verlassen, um sie zu prüfen?
Sie fand einige Wurzeln, die sie mit einem spitzen Ast ausgrub und hungrig verzehrte. Am Nachmittag bahnte sich die Sonne einen Weg durch die dichte Wolkendecke, und Aila genoss die Wärme. Sie wanderte weiter, bis es dunkel geworden war, und suchte sich ihr Nachtlager wie schon in den Nächten zuvor unter einem Baum. Nachdem sie sich in ihren Umhang gewickelt hatte, fielen ihr vor Erschöpfung die Augen zu.
In ihren Träumen erschien Mog Ruith. Er sah durch sie hindurch, obwohl er direkt vor ihr stand. Aila überlegte, was der Traum bedeuten könnte. Alle Träume, die der Druide ihr schickte, hatten eine Bedeutung. Wollte er ihr zeigen, dass er bei ihr war? Sie breitete ihre Arme aus und konzentrierte ihre Gedanken auf ihn, so wie sie es gelernt hatte, doch sie erhielt keine Antwort. Trotzdem fühlte sie sich etwas besser, als sie ihren Weg fortsetzte, in der Hoffnung, endlich auf Menschen zu treffen.
Sie kam an einem funkelnden See vorbei und beschloss, dort zu rasten und ihre schmerzenden Füße zu kühlen. Gerade hatte sie sich auf dem weichen Ufersand niedergelassen, als sie Schritte hinter sich vernahm. Voller Erwartung drehte sie sich um. Vor ihr stand ein Mann mittleren Alters, der einen dünnen, schwarzen Stock in der Hand hielt.
»Guten Tag«, grüßte John Lansbury freundlich, während er das Mädchen neugierig musterte. »Ich wollte ebenfalls eine kurze Rast an diesem wunderschönen See einlegen und hoffe, Sie haben nichts dagegen.« Ihre Blicke trafen sich, und eine Weile sahen die beiden sich an. Er ist unbewaffnet und sieht freundlich aus, dachte Aila. Ihr Blick wanderte über seine fein gewebten Kleider. Das Hemd war leuchtend rot, genau wie die Hosenbeine, die er trug. Der dünne schwarze Stock, den er bei sich hatte, besaß eine scharfe Spitze, aber er sah nicht wie eine Waffe aus. Ob man damit Fische fangen konnte? Er hatte sie in einer Sprache angesprochen, die sie nicht verstand. Seine warmen braunen Augen erwarteten ihre Antwort.
»Ich bin Aila, die Tochter von Calach, und habe den richtigen Weg verloren. Kannst du mir helfen?«, fragte sie.
Die dunklen Augenbrauen des Mannes schoben sich erstaunt nach oben. Das Mädchen hatte gälisch gesprochen, eine Sprache, die kurz vor dem Aussterben stand und nur noch an wenigen Schulen unterrichtet wurde.
»Sprichst du kein Englisch?«, versuchte er es noch einmal. Das Mädchen schüttelte den Kopf und zuckte leicht die Achseln. John Lansbury ließ sich ein Stück von ihr entfernt nieder und nahm seinen Rucksack vom Rücken. Er öffnete ihn und holte seine Trinkflasche heraus. Durstig trank er einen großen Schluck, bevor er die Flasche neben sich in den Sand legte. Er versuchte sich einige gälische Vokabeln ins Gedächtnis zu rufen, doch es war zu lange her.
Das Mädchen beobachtete ihn ruhig. Sie war wunderschön in ihren seltsamen Kleidern, wie eine Elfe aus einer anderen Welt. Er konnte kein Gepäck bei ihr entdecken, und soweit er wusste, befand sich kein Dorf in der Nähe. Das war der Grund, warum er diese Gegend zum Wandern ausgewählt hatte, weit entfernt von dem üblichen Touristenrummel. Er war ein viel beschäftigter Anwalt, und das Wandern war seine Art der Entspannung, die er sich leider viel zu selten gönnte. Ob das Mädchen tatsächlich alleine unterwegs war? Er hatte niemanden außer ihr gesehen.
Die Sonne war hinter einer dicken Wolkenschicht hervorgekommen und verwandelte das Wasser des Sees in einen glitzernden Traum. Er nahm eine Plastikdose mit belegten Broten aus seinem Rucksack und öffnete sie. Auffordernd hielt er sie dem Mädchen hin. »Möchtest du etwas essen? Ich habe genügend Brote mitgenommen, sie werden für uns beide reichen.« Aila lächelte ihn dankbar an und nahm eines der Brote. Hungrig biss sie hinein. Das Brot war dick mit Käse belegt und schmeckte köstlich. Sie verzehrte es mit großem Appetit. Sie wirkte regelrecht ausgehungert, und er bot ihr ein zweites Brot an, das sie sofort nahm. Was machte ein so junges Mädchen in einer einsamen Gegend wie dieser hier? Ob sie sich verirrt hatte? Wieder bemühte er sich, aus den wenigen Vokabeln, die er kannte, einen Satz in seinem Kopf zu bilden, doch es gelang ihm nicht.
Als sie auch das zweite Brot gegessen hatte, versuchte er es mit Zeichensprache. »Wohin gehst du?«, fragte er und wies mit dem Finger erst auf ihre Brust und anschließend in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Das Mädchen sah ihn an und schüttelte wieder den Kopf. Sie schien sich tatsächlich verlaufen zu haben.
»Möchtest du, dass ich dir den Weg zum nächsten Ort zeige?«, fragte er weiter. In ihren Augen sah er, dass sie ihn nicht verstanden hatte. Er nahm seinen Stock und malte einige Häuser in den Sand. Diesmal schien sie ihn zu verstehen, denn sie nickte mehrmals. John erhob sich und packte die Dose und die Trinkflasche in den Rucksack. Das Mädchen war ebenfalls aufgestanden. Schweigend liefen sie eine Weile nebeneinander her. Aila hatte keine Mühe, mit ihm Schritt zu halten, wie er es insgeheim befürchtet hatte. Bei jedem Schritt stieß John den Stock in den Boden, als wollte er sich darauf stützen. Aila hätte zu gern erfahren, warum er das tat, und sie bedauerte, dass sie ihn nicht danach fragen konnte.
Die Sonne, die sich immer wieder einen Weg durch die Wolken brach, stand schon hoch am Himmel, als sie den Gipfel des nächsten Hügels erreichten. Von oben sahen sie unzählige Schafe, die wie kleine weiße und schwarze Punkte auf den Hängen verteilt grasten. Dann entdeckte sie die Zäune, die sich quer durch die ansonsten unberührte Landschaft zogen. Die Menschen hier mussten sehr reich sein, wenn sie so viele Schafe besaßen, und sorglos noch dazu, denn sie konnte weit und breit niemanden sehen, der auf die Tiere achtete. Sie fand es merkwürdig, machte sich aber weiter keine Gedanken darüber. Der Anblick der Schafe hatte sie etwas beruhigt. Wo Schafe waren, konnten die Siedlungen nicht weit sein. Sicher würde sie bald auf Menschen treffen und erfahren, wo sie überhaupt war.
John blieb stehen und wies auf den schmalen Weg, der sich ins Tal hinunterschlängelte und wieder den nächsten Hügel hinauf. Von dort aus konnte man Inverurie sehen. Es waren höchstens noch drei Stunden zu laufen, und das Mädchen konnte gefahrlos alleine weitergehen. Der kleine Ort, in dem seine Frau ihn erwartete, lag in der entgegengesetzten Richtung, und er würde ein scharfes Tempo einschlagen müssen, wenn er ihn noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wollte. Mary Ann würde sich Sorgen machen, wenn er so spät bei ihr eintraf. Sein Handy hatte im Hochland keinen Empfang, und er konnte sie nicht einmal anrufen, um sie zu beruhigen.
»Du brauchst nur diesem Weg zu folgen, dann kommst du nach Inverurie«, sagte er.
Aila schien ihn zu verstehen. »Ich möchte dir für deine Freundlichkeit danken.« Sie lächelte ihm noch einmal zu, bevor sie sich von ihm abwandte und mit großen Schritten den Hügel hinunterlief. John sah ihr nachdenklich nach. In Gedanken wünschte er ihr Glück. Ein Mädchen wie dieses hatte er noch nie getroffen, und fast tat es ihm Leid, dass er nicht mehr über sie erfahren hatte. Er dachte eine Weile darüber nach, was es war, das ihn so an ihr faszinierte, doch er fand keine Erklärung dafür.
3
Zwei Stunden später hatte Aila die Spitze des nächsten Hügels erreicht. Sie sah das kleine Steinhaus mit dem flachen Dach schon von weitem und lief erleichtert darauf zu. Als sie näher kam, stellte sie enttäuscht fest, dass es unbewohnt war. Die kleine Holztür war verschlossen, und das Haus sah aus, als wäre es schon vor langer Zeit verlassen worden. Trotzdem lief sie um das Haus herum und entdeckte dabei etwas Merkwürdiges. Eine Öffnung, größer als die Öffnungen, die der Belüftung in ihren Häusern diente, war in die Hauswand eingelassen. Sie konnte durch die Öffnung in das Haus sehen, aber nicht hindurchfassen. Ungläubig berührte sie die Glasscheibe, die sich kalt und glatt anfühlte.
Vor dem Fenster stand ein Tisch, auf dem sich Gegenstände befanden, die ihr fremd waren. Ob das kleine Haus einem Römer gehörte? Wie alle anderen Dorfbewohner hatte sie jedes Mal staunend an den Lippen der Händler gehangen, die manchmal an ihrem Dorf vorbeikamen und Unglaubliches von den Römern zu berichten wussten.
Ailas Neugier war erwacht und für einen Moment freute sie sich beinahe über das Abenteuer, das vor ihr lag. Sie besaß die gleiche Unbekümmertheit wie ihr Vater. Was würde sie als Nächstes entdecken? Beschwingt lief sie weiter, und am frühen Nachmittag tauchten, wie sie es erwartet hatte, Häuser vor ihr auf. Sie waren noch zu weit entfernt, um Genaueres erkennen zu können. Als sie näher kam, begann ihr Herz vor Aufregung schneller zu klopfen. Sie wusste, dass sie vorsichtig sein musste, wenn die Siedlung vor ihr tatsächlich von Römern bewohnt wäre. In diesem Fall wäre sie auch weiter von zu Hause entfernt, als sie angenommen hatte. Ob die Römer wirklich so klein und dunkelhaarig waren, wie die Händler es berichtet hatten?
Plötzlich drang ein merkwürdiges Geräusch an ihre Ohren, das sie nicht zuordnen konnte. Es wurde rasch lauter und kam direkt auf sie zu. Ihre Ohren begannen von dem ungewohnten Lärm zu dröhnen, und sie sprang erschrocken zur Seite, als ein merkwürdiges Wesen sich in gleichmäßigem Tempo auf sie zu bewegte. Es war größer als sie und seltsam starr und glatt. Verschiedene Gedanken schwirrten durch ihren Kopf, während sie das Wesen, das sich rasch an ihr vorbeibewegte, mit weit aufgerissenen Augen anstaunte. Am schlimmsten war das Geräusch, das von ihm ausging; es war schrecklich laut und machte ihr Angst. Sie ließ sich auf den Boden fallen und hielt sich die Ohren zu. Zu ihrer Erleichterung entfernte das Wesen sich von ihr, und sie hoffte inständig, dass es nicht zurückkommen würde. Der Schreck saß ihr noch in den Gliedern, als sie weiter auf die Häuser zulief.
Die Menschen, die dort wohnten, schienen sich sehr sicher zu fühlen, denn die Siedlung war nicht umfriedet wie die Dörfer, die sie kannte. Dafür besaß jedes Haus, an dem sie vorbeikam einen eigenen Zaun.
Vor einem der Häuser stand eine alte Frau und fütterte einige Hühner, die sie aufgeregt gackernd umringten. Wie eine Römerin sah sie nicht aus. Ihre blaugrauen Augen waren trüb, und ihr weißes Haar war zum größten Teil von einem Tuch bedeckt, das sie unter dem Kinn zusammengebunden hatte.
Zögernd trat Aila auf die Frau zu.
»Bitte gewährt mir eure Gastfreundschaft. Ich habe Hunger und würde mich gern eine Weile bei euch ausruhen«, sagte sie leise.
Überrascht sah die alte Frau auf. Es war lange her, seitdem sie die alte Sprache das letzte Mal gehört hatte, aber sie verstand, dass die junge Frau vor ihr hungrig war. Misstrauisch musterte sie das Mädchen von oben bis unten.
»Wenn du etwas zu Essen willst, musst du arbeiten«, erwiderte sie abweisend. Sie dachte nicht daran, eine Fremde ins Haus zu bitten. Seit ihr Mann verstorben war, lebte sie ganz allein. Vielleicht war die Frau vor ihr eine Betrügerin oder eine Kriminelle? Man las so viel in den Zeitungen, und sie würde kein Risiko eingehen. Das Mädchen legte bittend eine Hand auf ihren Arm und sah sie aus ihren schönen Augen an. In ihrem Blick lag etwas so Flehendes, dass die Alte nicht widerstehen konnte. Seufzend gab sie nach. Sie schüttelte die Hand des Mädchens von ihrem Arm und bedeutete ihr, draußen zu warten. Dann bewegte sie sich humpelnd auf die Haustür zu und verschwand im Haus.
Nach einer Weile kam sie wieder und reichte Aila ein Brot und ein Stück Käse, die sie in ein Taschentuch gewickelt hatte. Dankbar nahm das Mädchen das Brot und biss hungrig hinein. Das Brot und der Käse schmeckten köstlich, und sie aß mit großem Appetit. Die alte Frau beobachtete sie.
»Geh jetzt, mehr habe ich nicht für dich«, forderte sie das Mädchen auf und unterstrich ihre Worte mit einer unmissverständlichen Handbewegung.
Aila verstand sie sofort. Sie nickte der alten Frau noch einmal zu und verließ das Grundstück, ohne sich noch einmal umzusehen. Die Leute in diesem Dorf waren weder gastfreundlich noch höflich. Die Götter mussten sehr zornig auf sie sein. Ob es an den Römern lag, dass die alte Frau so abweisend zu ihr gewesen war?
Sie kam an mehreren Gärten vorbei, in denen Menschen ihrer Arbeit nachgingen. Doch nicht einer von ihnen sprach sie an oder lud sie in sein Haus ein. Sie beachteten sie nicht einmal. Es war schon merkwürdig, was die Römer aus ihnen gemacht hatten, dachte Aila traurig und fühlte sich einsam. Sie kam nicht dazu, weiter über das Verhalten der Menschen in diesem Dorf nachzudenken. Ein grüner viereckiger Wagen bewegte sich leise brummend auf sie zu. Sie konnte gerade noch zur Seite springen und sah erschrocken dem Gefährt nach, das vor einem der Häuser anhielt. Der Wagen war von allen Seiten geschlossen und hatte nur kleine Räder, die ganz schwarz waren.
Ungläubig beobachtete sie, dass sich ein Teil des Wagens öffnete und ein junger Mann aus ihm herausstieg. Der Wagen besaß einen merkwürdigen Glanz, wie poliertes Metall. Sie hatte nicht gewusst, dass es grünes Metall gab, doch das war noch nicht alles. Neugierig lief Aila auf das seltsame Fahrzeug zu und berührte es vorsichtig. Es fühlte sich genauso glatt an, wie es aussah. Wie konnte es fahren, ohne von einem Pferd gezogen zu werden? Plötzlich fielen ihr die Geschichten ihrer Mutter wieder ein, die sie als Kind so geliebt hatte. Miriam hatte ihr von Menschen erzählt, die in solchen Wagen fuhren und sich sogar in die Lüfte erheben konnten wie die Vögel. Es waren nur Geschichten gewesen, obwohl Miriam ihrer Familie stets versichert hatte, dass sie der Wahrheit entsprachen.
Aber das war lange her. In den letzten Jahren hatte Miriam nicht mehr über diese fremde Welt gesprochen, in der sie einen großen Teil ihres Lebens verbracht hatte, und auch Aila hatte lange Zeit nicht mehr daran gedacht. Ihre Mutter hatte ihr erzählt, dass die Welt, aus der sie kam, in der Zukunft lag, und sie hatte versucht, ihr zu erklären, wie weit diese Zukunft von ihrem Leben entfernt war.
Ailas Kopf begann zu schmerzen von den vielen Gedanken, die von allen Seiten auf sie einstürmten. Sie rieb sich über die Stirn, wie sie es immer tat, wenn ihr ihre Träume oder Gedanken zu viel wurden. Sie musste endlich herausfinden, wo sie war. Der Mann, der aus dem Wagen gestiegen war, kam zurück aus dem Haus und holte eine Kiste aus dem hinteren Teil des Autos. Er beachtete die junge Frau nicht, die nur wenig entfernt von seinem Auto stand. Seine rötlichen Haare waren kurz geschnitten, und er trug eine enge blaue Hose, deren Beine bis zu dem Schuhwerk reichten, das aus glänzendem Leder gefertigt war. Aila sprach ihn an.
»Ich bin Aila, die Tochter von Calach und würde gerne wissen, in welchem Dorf ich hier bin.« Der Mann vor ihr betrachtete sie nachdenklich. Das Mädchen war auffallend hübsch, auch wenn es etwas zerzaust wirkte. Die langen rotgoldenen Locken, die ihr über die schmalen Schultern fielen, waren ungekämmt, und sie trug schlichte Sandalen an ihren Füßen, die wie selbst gefertigt aussahen. Ob sie eine Touristin war? Um allein zu reisen, war sie eigentlich zu jung. Sicher hatte sie sich verlaufen und war auf der Suche nach ihrer Unterkunft. Viele Touristen kamen den Sommer über hierher, um durch das Hochland zu wandern oder es mit dem Mountainbike zu durchqueren.
Still stand das Mädchen vor ihm und wartete auf seine Antwort.
Die Sprache, die sie gesprochen hatte, war ihm fremd, und er hatte kein Wort verstanden. »Sprichst du auch englisch?«, fragte er zurück und sah ihr in die großen, grauen Augen. Das Mädchen erwiderte seinen Blick, sagte aber nichts. Sie sah traurig aus, und er lächelte ihr aufmunternd zu. »Wenn du immer geradeaus gehst, bis du an der Kirche bist, gelangst du zu unserer Touristikinformation, dort kann man dir bestimmt helfen.« Er wies die Straße hinunter und zuckte mit den Achseln. »Ich wüsste nicht, wie ich dir weiterhelfen kann, wenn du mich nicht einmal verstehst.«
Er drehte sich um und ließ Aila stehen. Sie hat mir ja nicht einmal den Namen ihres Hotels oder ihrer Pension genannt, dachte er. Aila sah ihm nach, bis er im Inneren des Hauses verschwunden war. Dann erst setzte sie ihren Weg fort. Was hatte sie diesen Menschen getan, dass sie ihr die Gastfreundschaft verweigerten? Unfreundlich waren sie nicht, nur unhöflich und abweisend. Sie konnte es nicht verstehen. Sie war allein und ohne Schutz und wollte doch nur wissen, wie sie zurück nach Hause gelangen konnte.
Tränen stiegen ihr in die Augen, als sie an Caru dachte. Sie vermisste ihn schrecklich. Sicher verstand er nicht, warum sie nicht mehr bei ihm war, genauso wenig, wie sie es selbst verstehen konnte.
Die Häuser standen immer dichter aneinander, je weiter sie ins Innere des Dorfes kam. Auch der Boden unter ihren Füßen hatte sich verändert. Er war grau und glatt. Menschen gingen achtlos an ihr vorbei. Sie schienen es eilig zu haben, denn sie liefen sehr schnell. Aila fiel auf, dass sie alle an der Seite des Weges gingen, und tat es ihnen nach. Bald bemerkte sie auch den Grund dafür. Wagen, die in allen Farben glänzten, fuhren in der Mitte, manche laut brummend, andere summten nur leise, wie ein Schwarm Bienen. Einige der Wagen hinterließen einen stinkenden Nebel, der noch eine Weile über dem Weg hing, bevor er sich auflöste. Sie staunte immer mehr. Die Häuser wurden jetzt höher und standen wie eine Mauer nebeneinander.
Nach einer Weile öffnete sich die Häuserfront und sie gelangte an einen großen Platz, der von einem mächtigen Haus mit einem hohen Turm beherrscht wurde. Sie war so fasziniert von dem Turm, dass sie ihre Müdigkeit vergaß. Lange staunte sie das Bauwerk an und überlegte, was für Menschen etwas so Beeindruckendes bauen konnten. Sie mussten in jedem Fall sehr klug sein.
Auf dem Platz vor dem Haus saßen viele Menschen auf Stühlen und aßen und tranken gemeinsam. Aila beobachtete sie eine Weile und stellte fest, dass einige sich allein an einen Tisch setzten, andere zu zweit oder mit ihren Kindern, ohne von den Bewohnern der Häuser dazu aufgefordert zu werden. Nach einer Weile kamen die Leibeigenen aus den Häusern und brachten ihnen etwas zu essen. Ailas Stimmung hob sich. Ihr Magen gab ein unmissverständliches Geräusch von sich, und ihre Kehle war ganz ausgetrocknet. Zögernd trat sie auf einen Tisch zu, an dem ein Mann und eine Frau mittleren Alters saßen. Die Leute sahen sie an, sagten aber nichts. Sie lächelte ihnen freundlich zu und setzte sich auf einen der beiden freien Stühle.
»Mein Name ist Aila und ich bin die Tochter von Calach«, sagte sie zu der Frau, die sie unverwandt anstarrte. Als ihre Augen sich trafen, senkte die Frau den Blick und wandte sich ihrem Mann zu, der beruhigend ihre Hand drückte.
»Wir würden es vorziehen, alleine zu essen«, sagte er zu dem Mädchen, das einen ungewohnten Geruch verströmte.
Aila lächelte ihm zu. Sie verstand nicht, was er ihr sagen wollte. In diesem Moment kam eine der Leibeigenen und stellte eine schlanke Karaffe mit Wasser auf den Tisch, die so klar war, dass man durch sie hindurchsehen konnte, dazu zwei Trinkbecher aus dem gleichen Material. Nach einem Blick auf das Mädchen lief sie zurück ins Haus und kam mit einem weiteren Trinkbecher zurück, den sie wortlos auf den Tisch stellte. Sie nahm die Karaffe und füllte die Becher. Anschließend reichte sie jedem der drei eine Karte.
Aila beobachtete, wie der Mann und die Frau das hauch-dünne Etwas nahmen und es genau betrachteten. Sie zögerte einen Moment, dann tat sie es ihnen nach. Die Karte fühlte sich glatt an und war mit Buchstaben bedeckt, die sie nicht lesen konnte. Plötzlich wurde ihr klar, dass es so etwas wie eine Schriftrolle sein musste, wie manche der Händler sie mit sich führten. Der Mann und die Frau redeten leise miteinander und beachteten sie nicht weiter. Aila beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Ob sie irgendetwas falsch gemacht hatte? Die Menschen hier verhielten sich ihr gegenüber merkwürdig, und sie sahen nicht so aus, wie sie sich die Römer vorgestellt hatte. Sie waren weder dunkel, noch klein, und sie hatten auch keine schwarzen Augen. Ihre fein gewebten Kleider leuchteten in allen Farben, und sie trugen glänzendes Schuhwerk an ihren Füßen. Als die Frau nach ihrem Trinkbecher griff, nahm Aila ebenfalls ihren Trinkbecher und trank einen großen Schluck. Ihre Kehle begann zu kribbeln, und sie verschluckte sich. Erschrocken sprang sie auf und stieß dabei ihren Becher um. Das Getränk schmeckte wie Wasser, aber es hinterließ ein komisches Gefühl im Hals.
Der Mann und die Frau sahen sie abweisend an, sagten aber nichts. Aila fasste sich wieder und setzte sich zurück auf ihren Stuhl.
Die Leibeigene kam an den Tisch, wischte mit einem Tuch die verschüttete Flüssigkeit auf und stellte den Trinkbecher wieder vor sie hin. Sie nahm die Karten an sich und hörte aufmerksam dem Mann zu, der ihr anscheinend einen Befehl gab. Nachdem die Frau ebenfalls etwas zu der Leibeigenen gesagt hatte, wandte sie sich auffordernd an Aila. Aila nickte ihr freundlich zu, als die junge Frau sie ansprach. Die Leibeigene drehte sich um und lief wieder ins Haus. Kurze Zeit später kam sie mit drei Tellern in der Hand zurück und stellte sie auf den Tisch. Wieder sagte der Mann etwas zu ihr, worauf sie einen weiteren Teller mit Essbesteck brachte. Aila betrachtete hungrig den Teller, der vor ihr stand. Das Essen sah fremd aus, aber es roch köstlich. Sie beobachtete, wie der Mann das Essbesteck nahm und ein kleines Stück von dem Fleisch abschnitt.
Aila gab sich große Mühe, sich an die offenbar hier herrschenden Sitten zu halten, aber es gelang ihr nicht, das Fleisch so zu schneiden, wie der Mann und die Frau an ihrem Tisch es vormachten. Das Messer, das man ihr gegeben hatte war stumpf und nach vorne hin abgerundet – wie sollte man damit schneiden? Als sie sich einen Moment unbeobachtet glaubte, riss sie das Fleisch rasch mit ihren Fingern auseinander und steckte sich ein Stück davon in den Mund. Es schmeckte so salzig, dass sie vorsichtig einen Schluck von dem Wasser trank. Nun war sie vorbereitet auf das Kribbeln in ihrem Hals. Höflich lächelte sie den Mann an, der etwas freundlicher zu sein schien als die Frau, die ihren Blick fest auf den Teller vor ihr gerichtet hielt. Der Mann erwiderte ihr Lächeln nicht und aß schweigend weiter.
Aila verspürte plötzlich keinen Hunger mehr. Sie war es nicht gewöhnt, so abweisend behandelt zu werden. Traurig betrachtete sie das Treiben um sich herum. Frauen schoben ihre Kinder in kleinen Wagen mit großen Rädern vor sich her. Manche trugen ihr Haar kurz, andere lang. Mit offenem Mund starrte sie einer jungen Frau hinterher, die eine so kurze Bluse trug, dass man einen Teil ihres flachen Bauches sehen konnte. Ihre langen Beine steckten in einer hautengen Hose. Doch das war noch nicht alles. Unter ihren Schuhen befanden sich kleine Stöcke, die bei jedem Schritt klapperten und sie größer aussehen ließen, als sie tatsächlich war.
Die junge Frau blieb stehen und sah sich suchend um. In diesem Moment trat ein dunkelhaariger Mann auf sie zu und nahm sie lachend in den Arm. Er küsste sie vor allen Menschen auf den Mund und legte frech eine Hand auf ihr Hinterteil. Aila konnte kaum glauben, was sie sah. Sie wandte ihren Blick von dem Pärchen ab, um zu sehen, wie der Mann und die Frau an ihrem Tisch reagierten, doch die beiden waren nicht mehr da. Sie waren ohne ein Wort des Abschieds einfach gegangen.
Aila stiegen die Tränen in die Augen. Inmitten der vielen Menschen um sich herum fühlte sie sich einsam wie noch nie in ihrem Leben. Unentschlossen stand sie auf und überlegte, was sie jetzt tun sollte.
Plötzlich stand die Leibeigene neben ihr und hielt ihr ein Blatt hin. Aila nahm es höflich entgegen und lächelte der Frau freundlich zu. Dann drehte sie sich um und wollte gehen, doch die Leibeigene packte sie grob am Arm und hielt sie fest. Ihre Stimme klang aufgeregt und schrill. Aila verstand nicht, was sie sagte, aber der Ton war mehr als unangemessen für eine Leibeigene. Stolz richtete sie sich auf. Sie war die Tochter eines Gaufürsten und konnte es nicht dulden, dass eine Bedienstete in diesem Ton zu ihr sprach. Mit einer heftigen Bewegung wischte sie die Hand des Mädchens von ihrem Arm.
»Ich bin Aila, die Tochter von Calach. Wage es nie wieder, so mit mir zu reden«, sagte sie. Ihre Augen funkelten die Leibeigene zornig an. Dann drehte sie sich um und verließ mit stolz erhobenem Kopf den Tisch. Sie war erst wenige Meter gegangen, als sie von hinten festgehalten wurde. Zwei Männer standen neben ihr. Aila wurde von oben bis unten gemustert.
»Du hast deine Rechnung noch nicht bezahlt«, sagte Ron McLeod, der ältere der beiden Männer, in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Wütend blitzte Aila ihn an. Doch nach einem Blick in die harten Augen des Mannes wurde ihr ganz mulmig im Bauch.
»Ich verstehe dich nicht«, sagte sie leise, während ihr die Tränen über die Wangen strömten.
4
Die Polizisten sahen sich erstaunt an. Die Sprache, die das Mädchen sprach, war ihnen fremd. Sie sah merkwürdig aus in ihrem selbst gewebten Rock und wirkte mehr verstört als kriminell. Trotzdem stimmte etwas nicht mit dem Mädchen, und Ron McLeod beschloss, der Sache nachzugehen. Er besaß ein feines Gespür dafür, wenn es etwas aufzuklären gab, und sein Gefühl hatte ihn bisher noch nie getäuscht.
»Wir werden sie mit zur Wache nehmen und dort vernehmen«, sagte er zu seinem Kollegen gewandt. Widerstandslos ließ Aila sich von den beiden Polizisten fortführen. Sie spürte, dass sie keine Wahl hatte. Die vielen neuen Eindrücke und die Ungewissheit darüber, was mit ihr geschehen würde, waren einfach zu viel. In diesem Moment war sie beinahe erleichtert darüber, dass jemand anderer eine Entscheidung für sie traf.
Die beiden Männer brachten sie zu einem Wagen und öffneten die Tür. Mit einer Handbewegung forderte Ron McLeod sie auf, in den Wagen zu steigen. Als sie zögerte, drückte der andere Polizist mit sanfter Gewalt ihren Kopf nach unten, damit sie sich nicht stoßen konnte, und schob sie energisch ins Innere des Wagens. Dann ließ er sich neben ihr auf dem Sitz nieder, während Ron McLeod vorne Platz nahm.
Der Motor heulte auf, und Aila wurde ganz flau im Bauch, als der Wagen sich summend in Bewegung setzte. Ängstlich sah sie aus dem Fenster. Sie hatte das Gefühl, zu schweben. Menschen und Häuser zogen so schnell an ihr vorbei, dass sie kaum etwas von ihnen erkennen konnte. Es war unerträglich eng in dem Auto, und sie fürchtete, keine Luft mehr zu bekommen. Es schien für die Menschen hier normal zu sein, sich in diesen engen Wagen zu setzen, doch sie war noch nie so eingesperrt gewesen, und das Gefühl erdrückte sie beinahe. Als sie glaubte, die Enge nicht länger ertragen zu können, hielt der Wagen an und der jüngere Polizist öffnete die Tür. Erleichtert stieg Aila aus.
Die beiden Polizisten nahmen sie in die Mitte und führten sie auf ein Haus zu. Ron McLeod berührte ein kleines Ding neben der Tür, worauf eine Frauenstimme erklang. Aila sah sich suchend um. Woher war die Stimme gekommen? Es war niemand zu sehen. Doch sie kam nicht weiter zum Nachdenken. Mit einem Summen sprang die Tür auf, und sie wurde ins Innere des Hauses geführt. Ron McLeod brachte sie in einen Raum, in dem ein großer Tisch und einige Stühle standen, und forderte sie auf, sich zu setzen. Er selbst nahm auf der anderen Seite des Tisches Platz, auf dem ein flaches Brett lag. Seine Finger spielten eine Weile auf dem Brett herum, bevor er sie unvermittelt ansah.
»Sprichst du englisch?«, fragte er. Aila sah ihn fragend an.
Der Mann vor ihr wies mit dem Finger auf seine Brust. »Ron McLeod« sagte er. Aila verstand was er meinte. »Ich bin Aila, die Tochter von Calach«, erwiderte sie stolz. Der Mann vor ihr griff nach einem merkwürdigen schwarzen Ding und hielt es sich ans Ohr. Dann begann er mit dem Ding zu sprechen. Es sah so komisch aus, dass Aila trotz ihrer Verzweiflung zu lachen begann. Sie lachte, bis ihr die Tränen die Wangen hinunterliefen.
Ron McLeod starrte sie verblüfft an. Er legte das Telefon zurück auf den Tisch und musterte sie abschätzend. Ob das Mädchen Drogen genommen hatte? Ihre Pupillen sahen normal aus, und ihre schönen Augen waren klar, wie er nach einem raschen Blick feststellte. Vielleicht war sie verrückt, oder war es möglich, dass sie sich lustig über ihn machte? Er kam zu dem Schluss, dass sein Gefühl ihn nicht getäuscht hatte. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Mädchen, obwohl sie harmlos wirkte.
Er hatte schon viele Touristen gesehen, aber diese hier benahm sich mehr als seltsam. Es lag nicht nur an ihrer Sprache oder der grob gewebten Kleidung. Ihm war nicht entgangen, wie sie mit weit aufgerissenen Augen die Dinge um sich herum ansah. Sie betrachtete sie nicht einfach nur, sondern staunte sie an wie ein Kind.
Gewohnheitsmäßig nahm er jedes Detail in sich auf, um es anschließend wie ein Puzzle zusammenzusetzen. Das Mädchen war zweifelsohne eine Schönheit, und sie besaß eine faszinierende Ausstrahlung. Ihr schmales Gesicht mit den feinen Gesichtszügen wurde von den großen Augen beherrscht, in denen sich ihre Gefühle widerspiegelten. Während er sie noch beobachtete und überlegte, was ihre Faszination ausmachte, betrat eine seiner Kolleginnen den Raum.
Mit einer Handbewegung gab er ihr zu verstehen, dass sie mit der Untersuchung noch warten solle. Sie setzte sich auf den Stuhl neben Aila und unterhielt sich mit Ron McLeod. Aila kümmerte sich nicht um die beiden, obwohl sie spürte, dass sich das Gespräch um ihre Person drehte. Sie sah sich weiter in dem Raum um, in dem sich so viele seltsame Dinge befanden.
Die Wände waren weiß und glatt. In der Mitte der ihr gegenüberliegenden Wand, hingen Bilder von Menschen, die Aila an die Fotos erinnerten, die Miriam von ihr und ihrem Vater gemacht hatte, als sie noch ein kleines Mädchen war. Fasziniert betrachtete sie die Bilder. Sie hätte sie gern berührt, wagte aber nicht aufzustehen.
Es war dämmrig geworden in dem Zimmer, und Ron McLeod stand auf, um das Licht einzuschalten. Erschrocken starrte das Mädchen auf die Lampe über ihr, die plötzlich wie die Sonne erstrahlte. Sie war ganz blass geworden vor Schreck und schloss geblendet die Augen. Der Polizist warf seiner Kollegin einen Blick zu, den sie mit einem Achselzucken erwiderte.
»Es ist kaum zu glauben. Hast du ihre Reaktion gesehen, als ich das Licht eingeschaltet habe?«, fragte er. »Als ob sie noch nie elektrisches Licht gesehen hat. Ich bin wirklich gespannt darauf, was dahinter steckt.«
Aila hatte ihre Augen wieder geöffnet und starrte immer noch schockiert in die Lampe, die ihre Augen blendete. Ron McLeod beobachtete jede ihrer Bewegungen. Das Mädchen wurde ihm zunehmend rätselhafter. Er warf einen ungeduldigen Blick auf seine Armbanduhr. Wie lange dauerte es denn noch, bis der angeforderte Dolmetscher eintraf? Er war seit dem frühen Morgen auf den Beinen und die Geschichte hier sah ganz nach Überstunden aus. Seine Frau würde ärgerlich sein, wenn er schon wieder zu spät zum Essen käme und er konnte es ihr nicht einmal verübeln.
Endlich wurde die Tür geöffnet, und sein alter Freund Professor Williams betrat das Zimmer. Er reichte Ron McLeod und seiner Kollegin die Hand und begrüßte sie höflich, bevor er auf einem der freien Stühle Platz nahm. Er war Sprachwissenschaftler, sprach sieben Sprachen fließend und konnte darüber hinaus noch weitere Sprachen zumindest verstehen.
Freundlich wandte er sich an Aila und reichte ihr die Hand, die sie nach einigem Zögern nahm. Die Menschen hier hatten wirklich seltsame Sitten. »Mein Name ist Steven Williams, und ich möchte Ihnen gern bei der Verständigung mit den Polizeibeamten behilflich sein.«
Aila sah ihn an. Der alte Mann vor ihr strahlte Weisheit und die Anteilnahme aus, die sie bei den Menschen, die ihr bisher begegnet waren, so sehr vermisst hatte.
»Latha math. Tha an t-ainm Aila orm, tha mi toilichte dh' fhaicinn. Guten Tag, ich bin Aila, es freut mich, dich zu sehen«, erwiderte sie und lächelte den alten Mann dankbar für seine Freundlichkeit an.
Steven Williams beugte sich aufgeregt nach vorn. Damit hatte er nicht gerechnet. Das Mädchen vor ihm antwortete ihm auf Gälisch, als wäre es ihre Muttersprache, allerdings mit einer seltsamen Betonung der Vokale. Es gab nur noch wenige Menschen in Schottland, die diese alte Sprache fließend sprachen, und er war einer von ihnen. »Die Herren hier möchten gern deinen vollständigen Namen und deine Adresse von dir wissen.«
»Ich bin Aila, und mein Vater ist Calach, der Feldherr und Vergobretos«, wiederholte das Mädchen ungerührt. »Ich war mit meinem Hund im Wald und muss mich wohl verlaufen haben, obwohl ich jeden Weg in unserem Wald kenne. Ich bin tagelang gewandert, bis ich euer Dorf erreicht habe. Kannst du mir helfen, zurückzufinden? Mir gefällt es hier nicht, die Menschen sind unhöflich und unfreundlich.« Hoffnungsvoll sah sie ihn aus ihren schönen grauen Augen an.
Steven Williams brauchte einen Moment, um das gerade Gehörte zu verdauen. Das Mädchen neben ihm wirkte nicht wie eine Verrückte, sondern eher ein wenig verwirrt.
»Das ist wirklich seltsam«, sagte er zu Ron McLeod, ohne den Blick von dem Mädchen zu nehmen. »Sie behauptet, dass sie die Tochter von einem Feldherrn ist und sich verlaufen hat. Sein Name soll Calach sein; ich habe noch nie von ihm gehört.«
»Bitte fragen sie, ob sie Papiere bei sich hat«, forderte der Polizist ihn auf.
Steven Williams wandte sich wieder an Aila. »Haben Sie einen Ausweis bei sich?«, kam er der Aufforderung nach. Das Mädchen schüttelte verständnislos den Kopf. »Was ist ein Ausweis?«, fragte sie zurück. Professor Williams griff nach seiner Brieftasche und nahm seinen Ausweis heraus. Er klappte ihn auf und hielt ihn dem Mädchen hin.
Aila zuckte die Achseln und gähnte ungeniert.
»Ich fürchte, wenn Sie sich nicht ausweisen können, wird man Sie hier behalten«, gab er zu bedenken. Das junge Mädchen tat ihm Leid, aber sie hatte auch sein Interesse geweckt. »Welche Sprachen sprechen Sie noch außer Gälisch?«, fragte er neugierig. Seine hellen Augen blinzelten vor Vergnügen.
»Ich kenne nur diese Sprache. In unserem Dorf sprechen alle Leute so wie ich. Nur die Händler kennen die Sprache der Römer und die der anderen Völker in unserem Land. Ich habe unser Dorf noch nie verlassen.«
»Wie heißt denn das Dorf, in dem du lebst?«, versuchte es der Professor weiter.
»Es hat keinen Namen.« Das Mädchen lächelte ihn so freundlich an, dass ihm ganz warm ums Herz wurde.