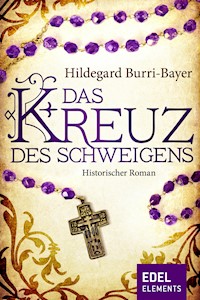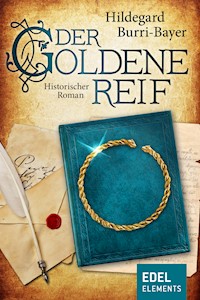4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie oft hat sich die junge Brokerin Jana schon nach einem einfachen Leben im Einklang mit der Natur gesehnt! Als sie sich plötzlich durch die Entdeckung einer mystischen Sternenscheibe in der Bronzezeit wiederfindet, scheint sich ihr Wunsch auf magische Weise zu erfüllen. Ein keltischer Jäger entdeckt sie und bringt sie in sein Dorf, wo sie ein völlig anderes Leben beginnt. Doch bald gerät sie in Gefahr und muss in die Gegenwart zurückkehren. Aber die Vergangenheit lässt Jana nicht los, und sie stößt auf mysteriöse Spuren längst vergangener Tage in ihrer eigenen Familiengeschichte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hildegard Burri-Bayer
Die Sternenscheibe
Roman
Copyright der E-Book-Ausgabe © 2013 bei hey! publishing, München
Originalausgabe © 2002 bei Knaur Verlag, 2004
Hildegart Burri-Bayer wird vertreten durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Umschlaggestalltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: FinePic®, München
ISBN 978-3-942822-19-0
www.heypublishing.com
Danksagung
Nachwort
Glossar
Literaturverzeichnis
Für meinen Freund Werner
Danksagung
Mein besonderer Dank gilt meinem Mann und meinen Kindern, die in den letzten Jahren häufig auf meine Aufmerksamkeit verzichten mussten.
Herzlich danken möchte ich dem Archäologen Dr. Johann Tinnes, der mir geholfen hat, die Bronzezeit, die eine schriftlose Zeit war, anhand von Literatur und experimenteller Archäologie besser kennen und verstehen zu lernen.
Ganz herzlich danken möchte ich Michael Stefan und seinem Bruder, die es mir ermöglicht haben, einen Einblick in die Mystik längst vergangener Zeiten zu erhalten, die auch heute noch real sein kann.
Besonders danken möchte ich meinem lieben Freund Guido Deussing, ohne den ich diesen Roman nie geschrieben hätte.
Herzlich danken möchte ich meiner Schwester Maria und ihrem Mann Stefan und meinen Freundinnen Brigitte, Sissi und Doris Würz. Sie alle haben mich unterstützt und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Alle Namen, Personen und Gegebenheiten in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Jana starrte den Bildschirm ihres Computers an, ohne etwas wahrzunehmen von dem, was sie sah. Ihre Augen brannten, und der Schmerz in ihrem Kopf ließ jedes Geräusch in ihrer Umgebung zur Qual werden.
Müde stand sie auf und holte sich ein Glas Wasser. Sie nahm zwei Aspirin aus dem Röhrchen in ihrer Handtasche und ließ sie in das Glas fallen. Sprudelnd begannen die Tabletten sich aufzulösen.
Während sie schluckweise die bittere Flüssigkeit trank, wanderte ihr Blick durch das große, helle Büro an der Königsallee, in dem sie als Brokerin arbeitete. Sie konnte nicht mehr verstehen, was sie an diesem Beruf einmal gereizt hatte. War es doch nichts anderes als die brutale Jagd nach dem schnellen Geld, das manch einen ihrer Kunden für immer ruinierte. Der ständige Stress, nur unterbrochen von dem ewig gleichen Getratsche ihrer Kollegen, ging ihr jeden Tag mehr auf die Nerven.
Sie sah auf ihre goldene Armbanduhr, ein Geschenk von Richard. Zwei Stunden musste sie noch durchhalten, bevor ihr Wochenende begann.
Die Zeit bis zum Feierabend verging quälend langsam. Als es endlich fünf Uhr war, nahm sie ihre Handtasche und verließ, so schnell sie konnte, das Büro. Sie stieg in ihr rotes Mercedescoupé und fädelte sich in den dichten Verkehr ein. Die ganze Welt schien an diesem Tag mit dem Auto unterwegs zu sein. Immer wieder stockte der Verkehr auf der Stadtautobahn, bis er schließlich ganz zum Erliegen kam. Der einsetzende Nieselregen war ebenfalls nicht geeignet, Janas Stimmung zu bessern. Die Dächer der farblosen Häuser in der Innenstadt von Düsseldorf gingen nahtlos in den tief hängenden, grauen Himmel über.
Schon als sie ihre Wohnungstür aufschloss, hörte sie das Telefon klingeln. Sie kickte ihre schwarzen Pumps in eine Ecke des kleinen Flurs und ließ sich mit einem tiefen Seufzer in ihren Lieblingssessel sinken, dessen Sitzfläche in der Mitte abgewetzt war und der in keiner Weise zu dem Rest ihrer Möbel passte.
Seit dem Auszug aus ihrem Elternhaus vor acht Jahren hatte sie den schweren braunen Sessel bei jedem Umzug mitgeschleppt. Er gab ihr ein Gefühl der Geborgenheit. Schon als kleines Mädchen hatte sie sich unverletzbar gefühlt, wenn sie sich tief in den Sessel geschmiegt hatte und der herbe Ledergeruch in ihre Nase zog, der noch heute Kindheitserinnerungen wach werden ließ.
Der Anrufbeantworter sprang an. Sie hatte ihn laut gestellt, damit sie hören konnte, wer anrief, bevor sie das Gespräch annahm. Es war Richard.
»Hallo, Süße, bist du schon zu Hause?«, hörte sie seine vertraute Stimme. »Ich wollte dich fragen, ob es bei unserer Verabredung bleibt. Achim und ich würden gerne so früh wie möglich losfahren.«
Er rief noch dreimal an, bevor Jana sich bequemte, den Hörer abzunehmen.
»Richard, sei mir nicht böse, aber ich bin total erledigt, ich glaube, ich werde mein Wochenende auf der Couch verbringen.«
Doch Richard war nicht bereit, auf Janas Gesellschaft zu verzichten.
»Komm schon«, versuchte er sie zu überreden. »Du verbringst den ganzen Tag im Büro, ein bisschen frische Luft wird dir gut tun. Ich habe eine viel versprechende Stelle gefunden, und die Landschaft im Kyffhäuser ist atemberaubend. Ich habe den Wetterbericht gehört, es soll schön werden.«
Er redete noch eine ganze Weile auf sie ein, bevor sie nachgab. Er hatte Recht, sie musste dringend einmal durchatmen, und das war hier in Düsseldorf unmöglich.
»Schon gut, du hast mich überredet«, lachte sie, ihre Kopfschmerzen hatten nachgelassen und ihr Unternehmungsgeist war zurückgekehrt. »Wann soll es denn losgehen?«
»Ich hole dich morgen früh um acht Uhr ab. Pack deine Zahnbürste ein, wir werden dort übernachten.«
Zufrieden legte er den Hörer zurück auf die Feststation. Er würde Jana das ganze Wochenende bei sich haben. Wie er diese Frau liebte! Was würde er dafür geben, wenn sie ihm ganz gehören würde. Wie so oft schon stellte er sich vor, sie in seinen Armen zu halten, den Duft ihrer weichen Haut einzuatmen und ihren herrlichen Körper mit seinen Händen zu erkunden.
Am nächsten Morgen um halb acht hielt er vor Achims Wohnung.
»Jana kommt auch mit«, sagte er, während er Achims Suchgerät in seinem Jeep verstaute.
»Das kann ja wohl nicht wahr sein«, stieß Achim enttäuscht hervor. »Ich habe mich so auf das Wochenende mit dir gefreut.« Richard war sein bester Freund, er ging gerne mit ihm auf Schatzsuche. Doch die Sucherei war Männersache, Frauen störten dabei nur, und davon abgesehen würde er Richards Aufmerksamkeit mit Jana teilen müssen. Es war einfach nicht dasselbe, wenn sie mitkam. Seit Richard Teilhaber der Consultingfirma war, hatte er kaum noch Zeit, die Wochenenden mit ihm zu verbringen. Und als er dann auch noch Jana kennengelernt hatte, war es ganz vorbei. Er konnte ihn gut verstehen, Jana war eine tolle Frau, und von solchen Frauen konnte er nur träumen. Frauen wie Jana verliebten sich nicht in kleine rothaarige Männer wie ihn. Schlecht gelaunt setzte er sich auf den Beifahrersitz.
»Ich würde lieber mit dir allein fahren. Frauen stören nur bei der Sucherei, ich habe mich so darauf gefreut, mit dir allein zu sein so wie früher«, maulte er.
Richard tröstete ihn. »Wir werden schon eine Gelegenheit haben, etwas zu unternehmen, ohne dass Jana dabei ist.«
Wie bald diese Gelegenheit kommen würde, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ahnen.
Der Regen hatte nachgelassen, als sie Düsseldorf hinter sich ließen. Der Himmel klärte sich mehr und mehr auf, je weiter sie Richtung Osten fuhren. Sie kamen gut voran und hielten nur einmal an einer Raststätte an, um etwas zu essen. Jana hatte sich freiwillig nach hinten gesetzt, um Achim nicht noch mehr zu verärgern. Sie wusste, dass er lieber mit Richard allein gefahren wäre.
Nachdenklich betrachtete sie den blonden Mann, der vor ihr am Steuer saß. Richard war der bestaussehende Mann, den sie kannte. Er war fürsorglich, charmant und zuverlässig. Wo er auftauchte, drehten sich die Frauen nach ihm um. Warum konnte sie ihn nicht lieben? Sie hätte keinen besseren Mann finden können.
Am frühen Nachmittag erreichten sie ihr Ziel. Sie waren quer durch Deutschland gefahren in der Hoffnung, hier Regenbogenschüsselchen zu finden. Kleine, gewölbte Goldmünzen aus der Zeit der Kelten, in deren Mitte oft ein Kreuz oder ein stilisiertes Pferd geprägt worden war.
Manchmal wurden sie auf frisch gepflügten Feldern sichtbar und funkelten im Licht der Sonne, in dem sich ein Regenbogen bildete.
»Nur wo der Strahl des Regenbogens die Erde berührt, liegt das Gold der alten Götter«, zitierte Richard gut gelaunt die Legende, während er den schwarzen Jeep sicher durch den dichten Verkehr lenkte.
»Mein Suchgerät ist besser als jeder Regenbogen.« Achim grinste. Er kannte keinen Respekt, schon gar nicht vor alten Geschichten.
Richard fuhr von der Autobahn herunter auf eine schmale Landstraße, die sich endlos durch Felder und Wälder zog, nur unterbrochen durch einige kleine Dörfer, die man als Fremder problemlos miteinander verwechseln konnte. Wären die Skateboard fahrenden Kinder nicht gewesen, die plötzlich vor ihrem Auto auftauchten, hätte man meinen können, die Zeit wäre an diesen Dörfern vorbeigezogen, ohne sie zu beachten. Die wenigen Häuser und Geschäfte drängten sich eng um einen kopfsteingepflasterten Marktplatz, der von einer erdrückend großen Kirche beherrscht wurde.
Die Zahl der entgegenkommenden Autos verringerte sich, je weiter sie fuhren. Richard nahm den Fuß vom Gas und blickte suchend durch das halb geöffnete Fenster. Nach einer Weile fand er, was er gesucht hatte.
»Hier müsste es sein«, sagte er zufrieden. Er bog links in einen kleinen Feldweg ein, der durch einen verwitterten Grenzstein gekennzeichnet war, und parkte den Wagen am Rand einer brachliegenden Wiese. Topografische Karten hatten ihn auf diese Ringwallanlage aufmerksam gemacht.
Mit steif gewordenen Beinen stiegen sie aus dem Auto und holten Rucksäcke, Klappspaten und Suchgeräte aus dem Kofferraum. Eine gespannte Erwartung lag auf den Gesichtern der drei Menschen, die hierher gekommen waren, um nach stummen Zeugen der Vergangenheit zu suchen. Der Himmel war strahlend blau, und frischer Wind blies ihnen ins Gesicht, als sie in verschiedene Richtungen aufbrachen.
Nur ein geschultes Auge konnte die Reste des Ringwalls erkennen, der aus grauer Vorzeit stammte. Das Bauwerk war größer als erwartet, die Zeichen seiner Existenz im Laufe der Zeit mehr und mehr verblasst. Wo einst Wehranlagen in den Himmel ragten, zeugten jetzt nur noch Unebenheiten in der Erde von einer längst vergessenen Kultur.
Jana hatte sich bewusst von ihren Begleitern getrennt, um Achim die Möglichkeit zu geben, Richard eine Weile für sich zu haben, aber auch um endlich einen klaren Kopf zu bekommen.
Glücklich darüber, der abgasgetränkten Stadtluft Düsseldorfs entkommen zu sein, sog sie die klare, würzige Luft des erwachenden Sommers tief in ihre Lungen und freute sich über das freie Wochenende, das vor ihr lag. Der Wind, der ihr durch die langen blonden Haare strich, verstärkte das Gefühl von Freiheit, das sie auf den sanft ansteigenden grünen Hügeln vor Nebra verspürte. Während sie langsam, ihren Metalldetektor vor sich her schwenkend, über die lang gezogene Erhebung lief, fielen die Anspannungen der letzten Wochen von ihr ab.
Dass sie heilige Erde betreten hatte, konnte sie nicht wissen. Es war auch nicht wichtig. Die alten Götter waren längst vergessen. Vor langer Zeit beherrschten sie Bäume, Erde, Wasser und Himmel, selbst die Steine waren von ihnen bewohnt gewesen. Heute aber kannte sie niemand mehr.
Unbemerkt wie ein dichter werdender Schleier senkte sich die Dämmerung über den lichten, noch jungen Wald. Die Entfernung zwischen Jana und ihren beiden Begleitern wurde größer, als Jana sich, einer inneren Stimme folgend, nach Süden wandte. Der scharfe Ostwind, der den aufsteigenden Vollmond begleitete, trieb ihr die Tränen in die Augen.
Sie genoss es allein zu sein. Sie brauchte Zeit zum Nachdenken und war froh darüber, dem stillen Vorwurf in Richards Augen für eine Weile entkommen zu sein. Sie liebte seine ruhige Zuverlässigkeit, aber etwas fehlte. Wenn sie nur wüsste, was es war? Es wäre unfair gewesen, ihn zu heiraten, obwohl sie es hasste, ihn zu verletzen.
Am Rande der abgeernteten Felder, auf die sie zulief, konnte Jana einen kleinen Wald und eine Hügelkette ausmachen. Schwarz und geheimnisvoll stachen sie von dem helleren Himmel ab. Kleine Tiere huschten an ihr vorbei und durchbrachen die Stille dieses historischen Ortes.
Nach und nach verschwand die Umgebung aus Janas Bewusstsein. Die gleichmäßige Bewegung, mit der sie ihr Suchgerät hin und her schwenkte, ließ sie ruhiger werden. Ihr Blick richtete sich auf den von niedrigen Gräsern und wilden Kräutern bewachsenen duftenden Boden, der unter ihren Schritten nachgab. Ihre Gedanken kreisten jetzt nur noch um die Suche nach Funden längst vergangener Zeiten. Anders als es bei Achim und Richard der Fall war, galt ihr Interesse weniger dem Gold, das hier vielleicht zu finden war, als vielmehr den stillen Zeugen der Geschichte, die Generationen von Menschen hier hinterlassen hatten.
Ihre Begleiter waren längst in der Dunkelheit verschwunden, als ein leises Signal ertönte. Jana brauchte einige Sekunden, bis sie begriff, dass es aus ihrem Suchgerät kam.
Ein Blick auf das Display ließ ihre Hände vor Aufregung zittern. Gold! Die Nadel zeigt Gold! Sie konnte es kaum glauben. Nie vorher hatte sie Gold gefunden. Erneut schwenkte sie den Detektor über die Stelle, um den unbekannten Metallgegenstand genauer orten zu können. Wieder ertönte das Signal, und die Nadel zeigte erneut Gold an. Sie bückte sich und zog eine kleine Maurerkelle und einen Schraubendreher aus ihrer dicken gesteppten Weste. Geschickt schob sie die obere Humusschicht beiseite und griff nach ihrem Schraubendreher, um den darunter liegenden härteren Boden aufzulockern. Sie konnte es kaum erwarten, ihren Fund in die Hände zu bekommen. Ihr Herz begann zu rasen. Was hatte sie wohl gefunden? Vielleicht ein goldenes Collier? Oder sogar eine Amphore gefüllt mit Goldmünzen? Schnell arbeitete sie weiter und beförderte immer mehr Erde aus dem größer werdenden Loch. Sie war ungefähr dreißig Zentimeter tief im Boden, als der Schraubendreher auf etwas Hartes stieß und dabei ein kratzendes Geräusch machte. Vorsichtig entfernte sie die letzten Erdklumpen, die sich noch zwischen ihr und dem unbekannten Metallgegenstand befanden. Sie konnte nicht genau erkennen, was da in dem dunklen Loch vor ihr lag. Es sah aus wie ein großer, alter Teller. Enttäuscht legte sie den Schraubendreher zur Seite. Einen etwas spektakuläreren Fund hatte sie schon erhofft. Mit der Hand wischte sie den Rest Erde von dem runden Metallstück. Noch immer konnte sie nicht viel von dem erkennen, was dort vor ihr lag. Sie griff nach ihrer Taschenlampe und richtete den Lichtstrahl auf das Loch. Was sie jetzt sah, ließ ihr beinahe den Atem stocken.
Mond und Sterne glänzten ihr golden entgegen.
Ein Schauer rann durch ihren Körper. Obwohl es mittlerweile ziemlich kalt geworden war, lief ihr der Schweiß von der Stirn. Eine seltsame, unwirkliche Stimmung hatte sich über den Wall gelegt. Ihre Hände zitterten, als sie den runden Gegenstand aus der weichen Erde zog. Er war schwerer als erwartet. Voller Stolz betrachtete sie ihren Fund. Etwas Geheimnisvolles strömte von ihm aus. Es war ihr erster großer Fund – wie alt mochte der Gegenstand sein? Sanft strich sie über den runden Mond, der in die Scheibe eingelegt war und sich weich und glatt anfühlte, ebenso die Sterne, die in verschiedenen Gruppen um den Mond angeordnet waren. Etwas Ähnliches hatte sie noch nie gesehen, obwohl sie seit Jahren ihre gesamte Freizeit der Sucherei widmete. Dazu hatte sie Unmengen von Büchern über Bodenfunde aus verschiedenen Epochen gelesen.
Ihr Herz hämmerte wie nach einem Marathonlauf. Tief sogen ihre Lungen die kalte Luft ein, und Gedanken sprangen kreuz und quer durch ihren Kopf, während ihre Hände sich fest um das kalte Metall schlössen. Ein eisiges Gefühl durchfuhr sie, kroch unaufhaltsam ihren Körper hoch.
Sie fühlte, dass sie nicht länger allein war. Beunruhigt sah sie sich um, konnte aber niemanden entdecken.
»Richard, Achim, seid ihr es?«, rief sie fragend in die Dunkelheit. Niemand antwortete. Es war jetzt so still, dass Jana ihren Atem hören konnte.
Ihr Blick wurde von einer allein stehenden, noch jungen Esche angezogen. Schwärzer als die Hölle und sonderbar glänzend, bewegte sich etwas Unheimliches in dem Baum, genau an der Stelle, wo die Äste sich teilten.
Die Angst packte Jana mit einer Wucht, die ihr Luft nahm. Zitternd starrte sie das schwarze Ding in dem Baum an. Sie spürte die Macht, die von ihm ausging, körperlich. Etwas, das mächtiger war als alles, was sie kannte, und sie begriff, dass es ein Fehler gewesen war, die Sternenscheibe dem Schutz der Erde zu entreißen. Wahrscheinlich hatte sie Tausende von Jahren dort gelegen, sicher vor den gierigen Augen der Menschen verborgen. Die furchtbare Angst in ihr ließ sie erstarren. Sie spürte, dass ein Kampf stattfand. Ein Kampf, in dem sie selbst nicht wichtiger war als ein Staubkorn.
Ein Hirschkopf schälte sich aus dem Baum. Er hatte beinahe menschliche Gesichtszüge. Sein riesiges Geweih ging in die Äste der Esche über.
Eine Ewigkeit schien vergangen zu sein. Jana wagte kaum noch zu atmen. Sie glaubte, die furchtbare Angst nicht eine Sekunde länger ertragen zu können. Die Stille um sie herum zerrte an ihren Nerven. Das Blut in ihren Ohren rauschte immer stärker, bis es wie ein reißender Fluss durch ihre Adern donnerte. Ihr Kopf schien zu platzen. Sie sehnte die herannahende Ohnmacht herbei, in die sie sich fallen lassen konnte.
Wie aus dem Nichts senkte sich eine Aura aus Licht über den Baum. Janas Angst verschwand augenblicklich, und Sehnsucht nach dem überirdisch leuchtenden Licht ergriff Besitz von ihr. Der Wunsch und die Sehnsucht nach diesem Licht wurden übermächtig. Sie wollte aufspringen und hineinlaufen, doch es war ihr unmöglich, sich zu bewegen. Das Licht kam näher, löste sich von dem Baum, kam direkt auf Jana zu.
Dann geschah das Unglaubliche, vom Schicksal Vorherbestimmte, Unabänderliche. Es geschah ohne Vorwarnung. Ein gleißender Mondstrahl schoss auf die Scheibe, und heiße Stromschläge rasten durch Janas Körper. Arnethystfarbene Blitze sprühten aus der Scheibe und tauchten den Wall für einige Augenblicke in ein gespenstisches Licht. Jana wurde zum Spielball der Gewalten, war zum bloßen Zuschauen verdammt. Pulsierendes Blau umhüllte ihre Hände. Sie fühlte weder Schwere noch die Hitze, die sich in konzentrischen Wellen von der Scheibe ausbreitete. Hilflos bemerkte sie, wie ihr Körper sich in Milliarden winziger Teile auflöste, die wie silbrige Perlen in dem schimmernden Nebel, der sie umgab, versanken.
Stimmen von Millionen von Menschen aus Tausenden von Jahren flüsterten ihr zu. Die alles umfassende, unbegreifbare Zeitdimension war fest verwoben mit der Vergangenheit, der einen Herzschlag dauernden Gegenwart und der Zukunft. Gedanken vermischten sich mit Handlungen, Hoffnungen, Träumen. Die Zeiten flössen ineinander, verloren sich in dem schimmernden Nebel. Geburt und Tod umarmten sich, wurden eins.
Der wunderbare, schreckliche, immerwährende und vollkommene Gesang der Elemente begleitete sie in den Sog aus Zeit und Raum. Er zog sie tiefer und tiefer, saugte sie in seinen Schlund. Alles drehte sich, dann verlor sie das Bewusstsein. Das Letzte, was sie wahrnahm, war die Scheibe, auf der die Sterne und der Mond golden glänzten und die sie fest in ihren sich auflösenden Händen hielt.
Richard fuhr erschrocken herum, als ihn ein Lichtstrahl von der Seite direkt ins Auge traf. Das gesamte Areal hinter ihm war in violett gefärbtes Licht getaucht. Kleine Blitze sprangen zuckend hin und her. Das Licht kam aus der Richtung, in der Jana vor wenigen Minuten – oder war es länger her – verschwunden war.
»Ich habe schon wieder eine gefunden, heute ist mein Glückstag!«, stieß Achim freudig hervor und grub ein weiteres Regenbogenschüsselchen aus. Er steckte die kostbaren Funde in seine Hosentasche und kümmerte sich nicht um das, was um ihn herum geschah. Liebhaber würden ein kleines Vermögen für die Münzen zahlen, die er gerade aus dem Boden holte. Er war so sehr in seinem Element, dass er die Welt um sich herum vergaß.
Richard, der das Interesse an der Schatzsuche verloren hatte, beobachtete nachdenklich die Phänomene, die er zunächst einem Gewitter zuschrieb. Woher kamen die Blitze? Es war kein Unwetter gemeldet worden. Der Himmel war sternenklar. Nach wenigen Augenblicken war der Spuk vorbei. Er versuchte, die Dunkelheit mit seinen Blicken zu durchdringen und Jana zu erspähen. Vergeblich. »Jana!«, rief er in die Dunkelheit hinein. Keine Antwort. Er wiederholte seinen Ruf, doch es kam keine Antwort. Seine Stimme wurde lauter, drängender. Langsam machte er sich Sorgen. Ob ihr etwas passiert war?
Achim hockte noch immer einem Frosch ähnlich über dem Boden und zerbröselte kleine Erdklumpen mit seinen Fingern, um sich auch nicht den kleinsten Fund entgehen zu lassen. Eine dunkle verkrustete Münze kam zum Vorschein, die er zu den anderen in die Tasche steckte.
»Hör sofort auf!«, zischte Richard, der sich mit Achims Geldgier noch nie hatte anfreunden können. Doch Achim suchte weiter. »Du sollst damit aufhören!«, verlangte Richard barsch und zog Achim hoch. »Hast du die Blitze nicht gesehen?«, wollte er wissen.
»Was für Blitze?«, entgegnete Achim, den Blick immer noch in der Hoffnung, mehr zu erspähen, fest auf den Boden gerichtet. »Was interessieren mich deine Blitze? Eine so gute Stelle hatten wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich bleibe die ganze Nacht hier und drehe alles auf links, bevor uns jemand zuvorkommt. Ich habe schon sechs Regenbogenschüsselchen gefunden, und hier liegen garantiert noch mehr.«
Richard packte Achim an der Jacke.
»Hör auf, um dich selbst zu rotieren. Markiere dir die Stelle und lass uns Jana suchen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Vielleicht ist ihr etwas passiert.« Aufsteigende Panik schwang in seiner Stimme mit und ließ sie leicht vibrieren.
»Ach, die kann gut auf sich selbst aufpassen, die braucht keinen Babysitter«, entgegnete Achim und wollte sich wieder hinhocken, als er Richards wütenden Blick spürte. Er zögerte. Etwas in der Stimme seines Freundes irritierte ihn. Konnte es sein, dass Richard tatsächlich Angst hatte?
»Schon gut, ich komme mit«, gab er nach.
Er ließ seinen Metalldetektor liegen, um die Stelle leichter wiederzufinden, und stapfte ärgerlich über die Unterbrechung hinter dem fast zwei Köpfe größeren Richard her, der mit energischen Schritten auf die Stelle zulief, an der er Jana vermutete. Den Blick hielt er finster auf den Boden gerichtet, der so viele Schätze barg. Er hatte es ja gewusst, sobald eine Frau mitkam, gab es immer nur Ärger, und es war unmöglich, in Ruhe zu suchen. Davon abgesehen konnte er nicht verstehen, warum Richard so viel Wert darauf legte, dass Jana ständig mitfuhr, wo die Schatzsucherei doch reine Männersache war. Schon als Kinder hatten sie die Felder nach Schätzen abgesucht. Es hatte einfach mehr Spaß gemacht ohne Jana.
Auf dem Ringwall angekommen, hielten sie inne. Es herrschte absolute Stille. Selbst der scharfe Wind, der eben noch Bewegung in die Landschaft geblasen hatte, schien den Atem angehalten zu haben. Ein leichter Geruch von verbrannter Erde und angesengtem Gras stieg in ihre Nasen. Der Mond erhellte gleichmütig den Wall und die wenigen Bäume und Sträucher, die darauf standen. In Richard kroch ein mulmiges Gefühl hoch. Hier stimmte etwas nicht. Es war zu still. Von Jana war nichts zu sehen. Er suchte die Umgebung mit der Taschenlampe ab. Keine Spur von Jana.
»Es muss ihr etwas zugestoßen sein.« Die Angst um Jana, die er über alles liebte, schnürte ihm die Kehle zu. Nie würde er den Abend vergessen, an dem er ihr feierlich den keltischen Liebesring überreicht und sie gefragt hatte, ob sie ihn heiraten wolle. Sie hatte ihn nur traurig angesehen und leise geantwortet: »Es wäre nicht fair, wenn ich dich heirate, ich liebe dich, aber nicht so, wie man seinen Mann lieben sollte, sondern wie einen Freund. Es tut mir Leid, doch ich kann dir keine andere Antwort geben, obwohl es niemanden gibt, mit dem ich meine Zeit lieber verbringe als mit dir.«
Er hatte die Welt nicht mehr verstanden, trotzdem genoss er jede Minute, die er mit Jana verbringen konnte. Er hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, Jana eines Tages doch noch für sich gewinnen zu können.
»Sieh mal dort!«, unterbrach Achim seine Gedanken. Etwas Metallenes hatte den Lichtstrahl der Taschenlampe reflektiert. Beide liefen darauf zu, diesmal Achim voran.
»Janas Suchgerät, es ist noch eingeschaltet.« Instinktiv nahm er das Gerät auf. Da ertönte auch schon ein Signal. Im gleichen Augenblick entdeckte er das Loch, das Jana zuvor gegraben hatte.
»Sie muss etwas Außergewöhnliches gefunden haben!«, stieß Achim fast euphorisch hervor. »Ich würde zu gern wissen, was es ist.« Ohne sich weiter Gedanken um das Schicksal von Jana zu machen, nahm er seine Suche wieder auf. Schnell und routiniert sondierte er Tiefe und Größe des Metalls unter ihm und zog einen Klappspaten aus seinem Militärrucksack. Rasch befreite er den Fund von der störenden Erde, und innerhalb weniger Minuten hatte er ihn freigelegt.
Überrascht sah Richard, dass Achim ein Schwert aus dem Boden zog und es mit einem triumphierenden Aufschrei über seinem Kopf schwang. Zur Kontrolle sondierte er noch einmal den Boden, um sich zu vergewissern, dass er nichts übersehen hatte. Wieder ertönte ein Signal. Achim bückte sich und zog nach kurzer Zeit ein zweites Schwert aus dem Boden.
»Zeig mal her«, forderte er Achim auf. Achim reichte ihm eines der Schwerter. Was er sah übertraf alle seine Erwartungen.
»Das ist unglaublich. Ein Vollgriffschwert aus Bronze.« Fasziniert drehte Richard das Schwert in seiner Hand und betrachtete es von allen Seiten. Es war ungefähr fünfzig Zentimeter lang und komplett aus Bronze. In den Tausenden von Jahren, die es in der Erde gelegen hatte, hatte sich eine dunkelgrüne Patina auf das Schwert gelegt. In der Mitte befand sich eine lange Gussnaht. Rechts und links daneben zogen sich Fäden aus Gold bis zu der Spitze des Schwerts. Der schmale, längliche Griff endete in einem aufgesetzten Hut und war durch zackenförmige Ritzungen ringsum verziert worden.
»Das hier ist kein keltisches Schwert«, sagte er zögernd, während seine Finger vorsichtig über das glatte Metall strichen. »Es sieht älter aus. Wenn ich mir den Griff anschaue, würde ich meinen, dass es aus der Bronzezeit stammt. Auf jeden Fall ist es wesentlich älter als die Münzen, die wir hier gefunden haben.«
Er kam nicht dazu, seiner Freude über den sensationellen Fund weiteren Ausdruck zu verleihen. Noch einmal geschah das Unfassbare. Kräftige Mondstrahlen wurden wie Speere auf die Schwerter geschleudert. Richard und Achim spürten Stromschläge heiß durch ihre Körper zucken. Violette Blitze sprangen um die Schwerter und erhellten wieder den Wall. Die beiden Männer sahen fassungslos zu, wie ihre Körper sich auflösten. Dann wurden auch sie, von dem zeitlosen Gesang der Elemente begleitet, in den Sog aus Zeit und Raum gerissen.
Die drei Sucher waren verschwunden.
Bauer Kowatzki war der einzige Mensch, der die Blitze und das seltsame Licht ebenfalls gesehen hatte. Wie jeden Mittwoch war er zum Skatspielen in seine Stammkneipe gefahren und hatte kräftig mit seinen Kameraden gebechert. Er fuhr gerade mit seinem Fahrrad auf dem kleinen Wirtschaftsweg hinter der Erhebung nach Hause, als er die Blitze sah. Fröstelnd trat er schneller in die Pedale. Es war kein Unwetter gemeldet, hoffentlich fing es nicht auch noch an zu regnen. Schwerfällig zogen die Gedanken durch sein von Alkohol umnebeltes Gehirn.
Nach und nach kehrte Janas Bewusstsein zurück. Es war, als würde sie aus einem tiefen Traum erwachen. Ihr gesamter Körper fühlte sich fast taub an. Nur langsam kehrte die Empfindung in ihre bleischweren Glieder zurück. Das unangenehme Gefühl des Nichts wich einem dumpfen Schmerz, der sich überall zu befinden schien, vor allem aber in ihrem Kopf. Vergeblich versuchte Jana, ihre trockenen Lippen mit der Zunge zu befeuchten. Sie öffnete ihre Augen, konnte aber nur verschwommene Umrisse wahrnehmen. Nach einer Weile schälten sich immer klarer werdende Konturen aus dem Nebel heraus.
Ihr Blick fiel auf die ausladende Krone einer riesigen alten Eiche, deren Stamm so mächtig war, dass drei erwachsene Männer ihn nicht hätten umfassen können. Die Sonne schien warm durch das dichte Blätterdach der Baumkrone, und die Vögel zwitscherten so fröhlich, dass es wie ein Morgengruß klang. Unbekannter Blumenduft vermischte sich mit den wild wachsenden Kräutern und einem Hauch von Verwesung und Vergänglichkeit, der wie eine Drohung über der hellen Lichtung hinter den Eichen lag.
Verwirrt und benommen strich sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und stand auf. Der Ringwall und die Felder waren verschwunden. Sie befand sich mitten in einem wild gewachsenen Eichenhain. Aber nicht nur die Pflanzen in ihrer Umgebung hatten sich verändert. Es war viel wärmer geworden. Und es war heller Tag. Ihre Gedanken überschlugen sich. Was war mit ihr geschehen? Wie war sie hierher gekommen? Sie drehte sich um und ließ ihren Blick über die fremde Umgebung streifen in der Hoffnung, eine Antwort zu finden.
Der Eichenhain wirkte idyllisch und friedlich. Ein kleines Eichhörnchen flitzte einen Baum hinauf. Neugierig sah es auf sie herunter. Bewunderung für die majestätischen Bäume, die für die Ewigkeit gewachsen schienen, erfüllte sie trotz ihrer Benommenheit. Die weit ausladenden Kronen hatten sich zu einem natürlichen Dach verflochten und erinnerten an einen Tempel. Ihr Blick fiel auf eine kleine Quelle, neben der die vor Kraft strotzenden, gewaltigen Eichenstämme wie stumme Wächter standen. Durstig lief sie zu dem Wasser, das in dem warmen Sonnenlicht glitzerte. Schattenlichter tanzten auf der silbernen Oberfläche. Mit den Händen schöpfte sie das kühle Nass und ließ es über Gesicht und Hals laufen. Als sie erfrischt aufstand, entdeckte sie einen kleinen Pfad, der sich zwischen den Bäumen hindurchschlängelte und im Wald verschwand. Unentschlossen ging sie darauf zu.
Ich muss Richard finden. Der Gedanke an seine kluge Art, die Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlte, tröstete sie ein wenig. Sie beschloss, den schmalen Pfad zu nehmen, und war erst wenige Meter gelaufen, als ein lautes Rascheln und das Knacken brechender Äste im Unterholz sie aus ihren Gedanken riss. Was war das? Erschrocken blieb sie stehen und drehte den Kopf in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Tiefes, wütendes Gebrüll kam bedrohlich schnell immer näher auf sie zu. Die eisige Angst, die in ihr hochkroch, lähmte sie. Ein riesiger Bär brach direkt vor ihr aus dem Unterholz. Fassungslos sah sie zu, wie er brüllend auf sie zustürmte. Er war verwundet und stutzte knurrend, als er sie bemerkte. Seine kalten, grausamen Augen musterten sie böse. Blut quoll aus einer hässlichen offenen Wunde an seiner linken Seite, als er sich schwer atmend aufrichtete. Dampfender Aasgeruch entströmte seinem großen Maul mit den scharfen, gelben Zähnen und schlug ihr ins Gesicht. Jana wurde übel, trotzdem konnte sie nicht aufhören, den Bären anzustarren. Für einen Moment sah es aus, als überlege er. Dann siegte seine Wut über die seltsamen Zweibeiner, die ihn jagten und ihm Schmerzen zugefügt hatten.
Er war gerade im Begriff, sich auf die wehrlose Jana stürzen, als eine Lanze durch die Luft schwirrte und ihm die Kehle zerriss. Der Bär bäumte sich ein letztes Mal auf, und tiefe, verwunderte Traurigkeit stand in seinen Augen. Der Todeskampf dauerte nur kurze Zeit. Nach einem letzten verzweifelten Laut brach das gewaltige Tier zusammen und blieb regungslos liegen. Helles Blut färbte das Gras rot und sickerte in den weichen Waldboden.
Lautlos betrat Balder, der Jäger, die Lichtung. Obwohl er den Bären getroffen hatte, schäumte er vor Wut. Es war kein guter Tag gewesen. Seit dem frühen Morgen war er mit seinen Männern auf der Jagd, ohne Erfolg zu haben. Ein mächtiger Hirsch hatte ruhig grasend vor ihm und seinen Jägern gestanden. Er war gerade dabei, den Bogen zu spannen, als Cai, einer seiner Jagdgenossen, auf einen Ast getreten war, der laut knackend unter seinem Fuß zerbrach. Der Hirsch hatte die Flucht ergriffen, noch bevor sein Pfeil ihn treffen konnte, und war als Jagdbeute verloren. Als sie dann der Fährte eines Bären folgten, hatte Cai seinen Pfeil zu früh abgeschossen und das Tier nur verwundet.
Es war gegen ihre Regel, die besagte, dass bei größerem Wild alle Männer gleichzeitig schössen, um die Chancen zu erhöhen, das Tier zu erlegen. Seit langem wusste Balder, dass Cai ihn aus vollem Herzen hasste und ihm seine Jagderfolge missgönnte.
Der Bär war rasend vor Angst und Schmerz in Richtung der heiligen Quelle gestürmt, die nicht weit von ihrem Dorf entfernt war. Balder bekam Angst um die Dorfbewohner und um sein kleines Mädchen, das so gerne in den Wald lief. Zu gut kannte er die Gefahr, die von einem verwundeten Bären ausging. Er stürmte hinter dem verletzten Tier her, ohne auf Dornen zu achten, die seine Kleider zerrissen und ihm lange und tiefe Kratzer zufügten. An der Quelle hatte er ihn endlich eingeholt.
Mit Entsetzten sah er das Tier, das sich aufgerichtet hatte und im Begriff war, sich auf eine junge Frau zu stürzen, die starr vor Angst nur wenige Meter von ihm entfernt stand. Er zwang sich, ruhig zu atmen, hatte nicht mehr die Zeit, den Bogen zu spannen. Der Bär drehte ihm die rechte Seite zu. Es gab nur eine Chance, die Frau zu retten. Laut den Namen seines Jagdgottes Cernunnos rufend, schleuderte er seine Lanze auf den Bären und traf ihn in die Kehle.
Unfähig, sich zu bewegen, stand Jana an der gleichen Stelle wie vorher und begriff nicht, das sie längst in Sicherheit war.
Den gespannten Bogen in der Hand, lief der Jäger vorsichtig auf den riesigen Bären zu. Erst als er sicher sein konnte, dass der Bär tot war, beugte er sich über ihn. Mit einem kräftigen Ruck zog er die blutige Lanze aus dem Kadaver und wischte sie am Gras ab. Dann erst ging er verwundert auf Jana zu.
Die Frau war so groß wie er. Lange, goldene, aus den Strahlen der Sonne gewebte Haare umrahmten ihr schmales Gesicht. Schweigend hob sie ihren Blick und sah ihn aus großen turmalinblauen Augen an. Der Himmel schien zu verblassen neben diesen Augen. Überwältigt vor Staunen und Ehrfurcht sank er auf die Knie.
»Corventina, Muttergöttin, wie kann ich dir dienen?«, stammelte er fassungslos über das Glück, dass ausgerechnet ihm die Göttin erschienen war. Er sprach eine raue, fremd klingende Sprache. Jana sah zögernd auf den Jäger hinunter. Sie war immer noch wie gelähmt vor Schreck. Er sah gut aus, die eckigen, fast schon zu breiten Wangenknochen harmonierten mit dem schmalen Mund und der geraden Nase. Unter einem einfachen Lederwams trug er ein knielanges, grob gewebtes blaues Hemd. Darunter schauten halblange, zerrissene Hosenbeine hervor. Seine durchbrochenen Ledersandalen waren dunkel und speckig. Über der Schulter hing ein Köcher aus Leder, in dem einige Pfeile steckten. An dem breiten, mit Strichmuster verzierten Ledergürtel war eine gefütterte, hölzerne Scheide befestigt, die durch ein Bronzeortband zusammengehalten wurde. Der Griff eines Schwertes schaute daraus hervor. Ein lederner Beutel und ein Dolch vervollständigten seine Ausrüstung.
Die drei Männer, die nacheinander aus dem Dickicht hinter ihm getreten waren, starrten sie ebenfalls verblüfft an. Sie waren in grobe Stoffgewänder gekleidet und mit Speer und Bogen bewaffnet.
Das war zu viel! Die Männer, die aussahen, als kämen sie aus einer längst vergangenen Zeit, der tote Bär, die blutige Lanze, dies alles war wie ein Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gab. Ohne weiter nachzudenken, drehte Jana sich um und rannte den kleinen Pfad hinunter, erfüllt von der Hoffnung, zurück zum Jeep zu gelangen.
Ich muss Richard und Achim finden, war ihr einziger Gedanke.
Nach wenigen Minuten erreichte sie den Waldrand. Außer Atem, mit brennenden Lungen trat sie aus dem Wald und blieb verblüfft stehen. Vor ihr lag ein kleines, fremdartig aussehendes Dorf mit rechteckigen Häusern, geschützt durch einen Erdwall und eine Umfriedung aus Holz. Von weitem drangen Kinderstimmen und Hundegebell an ihr Ohr. Enttäuscht starrte sie auf das Dorf. Wo war der Jeep? Und wo waren ihre Begleiter?
Der Jäger, der ihr gefolgt war, blieb dicht hinter ihr stehen. Sein Atem ging ruhig, während er sie aus schmalen, zusammengekniffenen Augen aufmerksam musterte. Er hatte sich geirrt. Sie war keine Göttin, sondern nur eine verängstigte Frau, die mit erschrockenen, weit aufgerissenen Augen vor ihm stand. Woher mochte sie gekommen sein? Und diese seltsame Kleidung, die sie trug. Eine blaue enge Hose, darüber ein langärmeliges Hemd und eine dicke Weste, deren Taschen sich beulten. Sein Blick blieb an ihren goldenen Haaren hängen, die ihn faszinierten. Sie war wunderschön. Egal, woher sie kam und wer sie war: Er hatte sie gefunden, deswegen gehörte sie ihm.
Besitzergreifend nahm er ihre Hand und zog sie wortlos hinter sich her in sein Dorf. Jana gab auf. Willenlos ließ sie sich mitziehen.
Zwischen den einzelnen Häusern standen runde Hütten, die mit Holzschindeln gedeckt waren. Eine kleine Hütte auf Holzstelzen sah düster auf sie herunter. Jana erschauerte, als sie die von der Sonne gebleichten Tierschädel entdeckte, die an beiden Seiten des schmalen Eingangs befestigt worden waren. Dicke, bunt schillernde Fliegen saßen dicht gedrängt darauf. Eine schmale, in einen Baumstamm geschlagene Treppe führte zu dem finsteren Eingang hinauf, der von einer kleinen Tür versperrt wurde. Beißender Qualm stieg ihr in die Augen, als sie an einem kaminähnlichen, nach oben spitz zulaufenden Ofen aus Lehm vorbeiliefen. Als sie weitergingen, kamen sie an einem mit Weidengeflecht umzäunten Pferch vorbei, in dem neun Ferkel aufgereiht wie eine Perlenkette neben ihrer Mutter lagen und zufrieden grunzten. Sie waren kleiner als die Schweine, die sie kannte.
Schmutzige, halb nackte Kinder rannten ihnen fröhlich kreischend entgegen. Frauen in bunt gemusterten, bis zu den Knöcheln reichenden Gewändern traten neugierig aus ihren Häusern. Aus einigen der mit Stroh gedeckten Dächern wehten Rauchfahnen, die wie ein wärmender Pelzmantel schützend über den schlichten Holzhäuser lagen.
Irgendetwas passte nicht, verstärkte die Unwirklichkeit dieser Situation. Jana blickte sich suchend um, versuchte, sich zu konzentrieren. Sie kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn, um besser nachdenken zu können. Ihr Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Was war es bloß, was hier nicht stimmte? Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Er war so ungeheuerlich, dass sie kaum wagte weiterzudenken. Sie lauschte angestrengt, legte den Kopf schief, um besser hören zu können. Das war es! Nicht das kleinste vertraute Motorengeräusch war zu hören. Es gab kein klingelndes Telefon, keinen Fernseher, der lief, nicht einmal ein Radiosender plärrte die unvermeidliche Werbung heraus für ein Produkt, das, wenn man erst einmal von ihm erfahren hatte, für die Zukunft unverzichtbar geworden war.
Ungläubig starrte Jana die Frauen an. Ihr Verstand weigerte sich zu begreifen, was ihre Augen sahen.
Sie kramte nach ihrem Handy. Kein Empfang, dabei hatte sie es extra gestern aufgeladen.
Die Neuigkeit, dass die Männer eine fremde Frau mit goldenen Haaren mitgebracht hatten, verbreitete sich rasend schnell. Immer mehr Menschen betraten den großen Platz, der sich in der Mitte des Dorfes befand. Die Dorfbewohner, zu denen sich mittlerweile auch die Männer gesellt hatten, starrten Jana wortlos und fasziniert an.
Die Stille über dem Dorfplatz war erdrückend und wurde nur durch das Summen einiger aufdringlicher Bremsen unterbrochen.
Nach einer Weile traten die Menschen auseinander und machten ehrfürchtig einem kräftigen Mann mittleren Alters Platz, der mit energischen Schritten auf sie zukam und sie aus dunklen, kalten Augen misstrauisch musterte. Über seinem für diesen Tag viel zu warmen, bunt gemusterten Umhang glänzte einen goldener Brustschmuck, der aus immer drei aneinander hängenden, mit Kreisen verzierten Scheiben bestand. Ein kostbarer gedrehter Goldreif lag um seinen dicken, kurzen Hals.
Verzweifelt versuchte Jana, dem kalten, durchdringenden Blick standzuhalten.
»Wer bist du, Frau, dass du ohne Begleiter in unser Dorf kommst?« Ungeduldig wartete er auf Antwort, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Er sprach die gleiche Sprache, die schon der Jäger benutzt hatte. Wie kam es, dass sie diese Sprache verstehen konnte? Janas Gedanken liefen im Kreis. Die Ereignisse der letzten Stunden forderten ihren Tribut. Starker Schwindel ergriff sie. Ihre Beine gaben nach. Dunkle Schleier legten sich über ihre Augen.
Balder, der Jäger, der sie keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte, bemerkte, wie ihre Augen glasig wurden. Er öffnete die Arme, um sie aufzufangen. Nach einem leisen Seufzer sank sie bewusstlos in seine starken Arme.
Er trug sie in das Haus seines Bruders Argor. Der zarte, blumige Duft, den ihre Haut verströmte, berauschte ihn. Vorsichtig legte er sie auf eine mit Hirschfellen bedeckte Holzbank. Nach einem langen Blick auf ihr blasses, von der Anstrengung gezeichnetes schönes Gesicht legte er eine aus Schafwolle gewebte Decke über sie und strich ihr vorsichtig über das seidenweiche Haar. Dann verließ er nach kurzem Zögern das Haus. Gefühle, die ihm fremd waren und die er nicht einordnen konnte, beherrschten seine Gedanken und irritierten ihn. Sie war so ganz anders als die Frauen, die er kannte.
Er winkte Laya, die Frau seines Bruders, zu sich und forderte sie auf, in die Hütte zu gehen, um den Schlaf der fremden Frau zu bewachen. Laya gehorchte wortlos. Neugierig betrachtete sie die fremde Frau, die friedlich auf ihrem Lager schlief. Es ging nichts Bedrohliches von ihr aus. Sie streckte ihre Hand aus und berührte zaghaft eine der goldenen Haarsträhnen. Wie weich sie sich anfühlten, vielleicht würde die Fremde ihr Glück bringen? Sie sah aus wie eine Göttin. Der Duft fremder Blumen umgab sie. Sicher hatte Corventina ihre Bitten erhört und ihr die Frau ins Haus geschickt. Wie sehr wünschte sie sich einen Sohn.
Wenn sie Argor einen Sohn schenken könnte, würde er bestimmt wieder freundlich zu ihr sein, so wie er es früher gewesen war. Seufzend setzte sie sich ans Feuer und stellte sich vor, wie es wäre, einen Sohn zu haben. Keine der anderen Frauen würde es mehr wagen, ihr mitleidige Blicke zuzuwerfen oder abfällige Bemerkungen zu machen, weil sie nur Mädchen gebären konnte.
Als Balder aus dem Haus seines Bruders trat, erwarteten ihn die Männer bereits ungeduldig und neugierig. Ohne sich um die Frauen zu kümmern, die mit gespitzten Ohren hinter ihnen standen und die Köpfe zusammensteckten und tuschelten, betraten sie das große Langhaus ihres Stammesführers, das als Versammlungsraum diente. Frauen brachten aus Honig und Gerste gebrautes Bier und füllten die Becher und Hörner der Männer. Darin entzündeten sie das Feuer und verschwanden wieder.
Eine Gruppe halbwüchsiger Jungen prügelte sich lautstark um den besten Platz an der kleinen, fensterähnlichen Öffnung, die als Belüftung diente, in der Hoffnung, einige Worte der Männer aufschnappen zu können.
Fintan, der Stammesführer, ließ sich auf einen lederbezogenen Klappstuhl fallen, der an allen vier Ecken mit bronzenen Klappergehängen verziert war und seine Stellung als Dorfoberhaupt hervorhob. Die anderen Männer setzten sich im Halbkreis auf roh gezimmerte, halbe Baumstämme, die quer über zwei kleineren Hölzern lagen, um die mit großen Steinen geschützte Feuerstelle. Schweigend warteten sie darauf, dass Fintan das Wort ergriff.
Dieser nahm sein kostbar verziertes silbernes Horn und trank es in einem Zug leer. Nach einem kräftigen, erleichternden Rülpser wandte er sich dem Jäger zu.
»Wo kommt die fremde Frau her?«
»Ich habe sie an der heiligen Quelle gefunden. Der Bär, den wir gejagt haben, wollte sie angreifen, doch ich habe ihn erlegt«, sagte er stolz.
Sein Blick streifte über die gespannt zuhörenden Männer, bevor er mit seinem Bericht fortfuhr.
»Als ich sie gesehen habe, dachte ich zuerst, sie sei Corventina. Doch dann habe ich die Angst in ihren Augen entdeckt, und Göttinnen haben keine Angst. Sie hat mich angesehen wie ein Tier, das in der Falle sitzt. Gib sie mir zur Frau«, forderte er dann. »Ich habe sie gefunden, deswegen gehört sie mir. Sie hat schon viele Sommer erlebt, aber mir gefallen ihre Haare, und Kinder kann sie bestimmt auch noch bekommen.«
Erstaunt starrte Fintan seinen Bruder an. Selten hatte Balder so viel gesprochen, vielleicht hatte die fremde Frau ihn verzaubert? Er kratzte sich den Kopf und schnippte mit den Fingern eine Laus ins Feuer.
»Wer war noch bei ihr?«
»Ich habe niemanden sonst gesehen, sie war allein.«
Fintan warf seinem Bruder einen vorwurfsvollen Blick zu, den dieser jedoch nicht zu bemerken schien. Hatte die Frau ihm den Verstand geraubt? Es ging um die Sicherheit des Dorfes. In scharfem Ton fuhr er fort.
»Sie kann nicht allein gewesen sein. Keine Frau begibt sich ohne Begleitung in eine fremde Gegend. Dass sie nicht von hier stammt, steht fest. Oder hat einer von euch sie schon einmal gesehen?« Die Männer schüttelten den Kopf. Fintan hatte nichts anderes erwartet. Eine Frau mit solchen Haaren wäre jedem Mann aufgefallen.
»Wir müssen so schnell wie möglich herausbekommen, wie viele Begleiter sie hat und ob diese uns angreifen wollen. Geh und suche die Gegend um die Quelle herum nach Spuren ab. Nimm so viele Männer mit, wie du brauchst. Dann erst holt den Bären. Seid aber vorsichtig! Vielleicht gehört sie zu den Räubern.«
Bei dem Gedanken an die dreisten Überfälle, die sich in den letzten Monden ereignet hatten, stieg ohnmächtige Wut in ihm hoch. Drei von seinen Männern, die aus den Bergen kamen, wo sie kostbares Kupfer abgebaut hatten, waren überfallen und heimtückisch ermordet worden. Nicht einmal die Kleider hatten die Mörder ihnen gelassen. Ihre Leichen fand man nackt und grausam zerstückelt.
Der riesige Kupfervorrat, den die Götter in ihren Bergen für sie bereitgehalten hatten, war mehr und mehr geschrumpft. Der Bedarf an Kupfer hingegen war größer geworden. Immer tiefer gruben sich die Männer in den Berg.
Um die Götter zu besänftigen, mussten viele Tiere geopfert werden, und die Zahl der Dorfbewohner, die satt werden wollten, vermehrte sich ständig. Aber was noch schlimmer war: auch Wanderhändler gehörten zu den Opfern. Wenn sich die Überfälle in der Gegend herumsprachen, würden die Wanderhändler sie nicht mehr beliefern. Wie sollten sie ohne die benötigten Rohstoffe über den Winter kommen? Die Räuber mussten Fremde sein, die sich vor nichts fürchteten, denn die Straße der heiligen Steine stand unter dem Schutz der Götter.
Bisher hatten selbst die vereinzelt herumziehenden Räuberbanden das Recht der Händler auf freies Geleit nie verletzt und sie höchstens bestohlen, wenn sie unvorsichtigerweise neben der Straße eingeschlafen waren. Keiner wusste, wer die Mörder waren oder wie sie aussahen, es gab nicht einen Überlebenden. Nicht die kleinste Spur hatten sie hinterlassen. Wie böse Geister schlugen sie zu, um anschließend spurlos zu verschwinden. Die wildesten Geschichten waren bereits im Umlauf, und jeder versuchte, den anderen mit noch unheimlicheren Vermutungen zu übertreffen. Sorgenvoll runzelte Fintan die Stirn.
»Cian und Ladra, holt die Männer von den Feldern und stellt Wachen auf«, befahl er. Gehorsam standen die beiden Männer auf. Sie hätten gern mehr von dem Gespräch mitbekommen. Aber Fintans Befehlen hatte man zu gehorchen, wollte man sich nicht seinen Zorn zuziehen. Cian war zierlich und noch bartlos, seine schmalen knabenhaften Hände waren wie gemacht für die Flöte, die er spielte. Jetzt fingerten sie unruhig an seinem Umhang. Dunkles Haar quoll unter seiner runden Kappe hervor. Ladra war nicht größer als Cian, sein Körper quadratisch. Seine groben Gesichtszüge waren die eines wilden Stieres, doch das täuschte. Wache Intelligenz sprühte aus den dunklen, humorvollen Augen.
So verschieden sie waren, liebten die beiden Männer sich doch wie Brüder. Beide waren unverheiratet. Cian war zu jung, und Ladra hatte noch keine Frau gefunden, die bereit war, freiwillig sein Lager zu teilen. Die jungen Frauen fürchteten sich vor ihm. Bisher war es ihm gleichgültig gewesen, doch in letzter Zeit sehnte er sich nach einer Frau. Er war schon mehrmals kurz davor gewesen, Jegra, den Töpfer, zu fragen, ob er ihm nicht seine Schwester Tena zur Frau geben wolle. Sie war fleißig und immer freundlich. Bestimmt würde sie nicht so viel jammern, wie es manche der anderen Frauen taten, die ihren Männern dadurch das Leben vergällten.
»Die fremde Frau ist wunderschön, obwohl ich noch nie eine Frau in Hosenkleidern gesehen habe«, begann Cian verlegen das Gespräch, während sie gemeinsam das Langhaus ihres Stammesführers verließen. Ladra, der viel gutmütiger war, als die meisten Dorfbewohner vermuteten, hatte sofort die schwärmerischen Blicke bemerkt, mit denen sein Freund die junge Frau bedachte.
»Vergiss sie«, riet er. »Hast du nicht bemerkt, wie der Jäger sie angesehen hat? Er wird sie zur Frau nehmen. Es sind jetzt schon viele Monde vergangen, seit seine Frau Emer zu den Göttern gegangen ist. Es ist nicht gut, wenn ein Mann lange allein lebt.«
In ihre Unterhaltung vertieft gingen die beiden Männer auf die Felder, um ihren Auftrag zu erfüllen. An diesem Tag arbeiteten nur die Frauen weiter, die meisten der Männer tranken Bier und warteten ab.
Jana erwachte mit einem schalen Geschmack im Mund. Ihr Magen knurrte bedenklich. Ein Blick durch das Langhaus, in dem sie sich befand, ließ sie sofort aufspringen. Die Decke, mit der sie zugedeckt war, stank nach altem Schweiß und Moder, angeekelt schob sie sie zur Seite. Nahm dieser Traum denn gar kein Ende? Es war dämmrig, Licht fiel nur durch das mit Stroh gedeckte Dach herein. Spinnweben hatten sich ungestört ausgebreitet und fingen einen Teil der ständig herabrieselnden Staubkörner und Strohfragmente auf. In dem Dach befand sich genau über der großen Feuerstelle eine Öffnung, die den Raum beherrschte. An einer schweren Kette hing ein großer Bronzetopf, und in dem fest gestampften, mit frischem Stroh bedeckten Lehmboden steckten einige Vorratsgefäße aus Ton.
Verschiedener Hausrat war an Regalen aus einfachen Holzbrettern gehängt worden. Auf den Regalen standen Tonkrüge und Tonbecher in verschiedenen Größen. Ein aus krummen Ästen gebauter Webstuhl war zur Hälfte mit grobem, längs gemustertem Stoff bedeckt. In dem kleinen Kuppelbackofen aus Lehm zeugte leicht glimmende Glut davon, dass vor kurzer Zeit Brot darin gebacken worden war. Auf einem Stein mit einer Mulde in der Mitte lagen noch Reste von gemahlenem Korn unter einem grauen Schiebestein.
Ihr gegenüber standen weitere Bettstellen aus Lehm mit Fellen darauf. Mehrere Lanzen, Schaufeln aus Geweih, eine Harke mit drei Zähnen und zwei riesige Jagdbogen hingen an den mit Lehm verschmierten Wänden aus Weidengeflecht. Es roch nach Stall und Dung und kalter Asche.
Aus dem dahinter liegenden Raum hörte man das Stampfen der Pferde und das Muhen einer Kuh. Jana fuhr sich nervös mit den Fingern durch die Haare und bemerkte erst jetzt die Frau, die still an der Feuerstelle gesessen hatte.
»Ich heiße Jana«, sprach sie Laya nach kurzem Zögern an. »Kannst du mir etwas zu trinken geben, ich habe großen Durst.« Ihr wurde plötzlich bewusst, dass sie die Sprache der Dorfbewohner sprach. Obwohl sie in ihrer eigenen Sprache dachte, kamen die fremden Worte mühelos über ihre Lippen.
Laya stand auf, füllte aus einem Tonkrug eine goldgelbe Flüssigkeit in einen Becher aus Ton und reichte ihn ihr. Gierig trank Jana den Becher leer. Es schmeckte nach Honig und Alkohol, doch es war genau das, was sie jetzt brauchte. Sie ließ sich den Becher erneut füllen und betrachtete die Frau, die kleiner war als sie und sie bewundernd aus dunklen, glühenden Augen ansah. Sie mochte Ende zwanzig sein, hatte aber bereits einen Zahn verloren. Ihre Weiblichkeit löste sich in der oft mit dem Alter schleichend eintretenden Geschlechtslosigkeit auf, die alten Frauen und Männern, aber auch Babys eigen ist.
Sie trug einen schlichten blauen Umhang über der roten Bluse, die sie in ihren knöchellangen bunten Rock gesteckt hatte. Ihr einziger Schmuck bestand aus einer Radfibel und einer untertellergroßen Gürtelscheibe mit Spiralmuster, aus deren Mitte ein Dorn ragte. Die Füße waren mit Wolllappen umwickelt, die mit bunten Bändern an den Knöcheln festgebunden waren.
Schüchtern reichte ihr die junge Frau ein großes Stück Käse und ein noch warmes, duftendes Brot. Hungrig biss Jana in das Brot. Es war hart und trocken. Sie probierte den Käse und ließ sich noch einmal den Becher füllen. Wieder und wieder wanderte ihr Blick über das Innere der Hütte. Verstohlen kniff sie sich in den Arm. Der Schmerz kam sofort, doch sie war immer noch hier. Spätestens jetzt hätte sich alles in leichte Traumschleier auflösen müssen. Voller Verzweiflung starrte sie auf den primitiven Lehmboden. Sie verstand nichts mehr. Was war mit ihr geschehen? Warum war sie hier? Und wichtiger noch, wie kam sie wieder von hier fort? In dieser verstaubten Hütte wollte sie nicht länger bleiben.
Sie sprang so plötzlich auf, dass Laya erschreckt zusammenzuckte. Mit großen Schritten stürmte sie zu der schiefen Holztür, die man mit einem breiten Holzriegel verschließen konnte. Die Sonne blendete sie, als sie aus dem halbdunklen Haus trat.
Gehetzt sah sie sich um. Es konnte einfach nicht wahr sein, was ihre Augen sahen und ihr Verstand nicht begreifen wollte. Die mit Stroh gedeckten Dächer schienen den Boden zu berühren. Ein kleineres, aus Holz und Fellen bestehendes Rundzelt und ein großer Holzbrunnen standen am Ende des Dorfes. Die Türen waren alle zu der mit ungleichmäßigen Holzbohlen ausgelegten Straße ausgerichtet. In der Mitte befand sich ein großer Platz, von dem aus Schafe und Rinder in die einzelnen Häuser getrieben wurden.
Es war schon später Nachmittag, und die Sonne bereitete sich darauf vor, dem Mond Platz zu machen. Tobende Kinder bewarfen sich übermütig mit Lehmklumpen und kreischten begeistert auf, als ein Hahn zu Tode erschrocken zur Seite sprang. Vor dem Haus gegenüber saßen drei Frauen mit hölzernen Handspindeln auf einer grob gezimmerten Holzbank. Andere Frauen waren dabei, Stoffe mit Staudensaft einzufärben. Über einem großen Gestell aus Holz wurde Fleisch geräuchert, dessen Duft alle anderen Gerüche übertönte. Ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, beobachteten die Dorfbewohner misstrauisch die fremde Frau. Jana überlegte. Sie musste irgendetwas unternehmen, aber was?
Sie war noch zu keiner Entscheidung gekommen, als der Jäger mit seinen Männern und dem riesigen Bären zurückkam.
Die kleinen struppigen Hunde, die überall im Dorf herumliefen, stürzten sich mit wütendem Gekläff auf den Bären, wurden aber von den Männern fortgejagt.
Schaudernd sah Jana auf den riesigen Schädel des toten Bären. Ihr fiel ein, dass sie sich nicht einmal bei dem Jäger für ihre Rettung bedankt hatte.
Widerwillig lösten die Frauen ihre Blicke von Jana. Unter den auffordernden Rufen der Begleiter des Jägers begannen sie, sich des Bären anzunehmen. Mit scharfkantigen Messern aus Feuerstein häuteten sie den Bären, schabten das Fell sauber und verteilten das Fleisch. Auch die wartenden Hunde bekamen ihren Anteil. Jana trat auf den Jäger zu.
»Danke, dass du mir das Leben gerettet hast«, sagte sie leise und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Verblüfft sah er sie an, während er sich mit der Hand über die Wange strich, auf die Jana ihn geküsst hatte. Ihre Stimme gefiel ihm. Sie war weich und warm.
Die Frauen, welche die kleine Szene beobachtet hatten, begannen aufgeregt zu tuscheln. Das Verhalten der fremden Frau war unerhört. Wie konnte sie es wagen, einem Mann in aller Öffentlichkeit so nahe zu treten? Und der Jäger? Er stand da, die Hand an der Wange, und schaute sie mit dümmlichem Blick an. Es war unglaublich. Seit dem Tod seiner Frau, die vom Fieber dahingerafft worden war, hatte er keine andere mehr angesehen. Dabei gab es einige Frauen, die gerne Emers Platz eingenommen hätten. Balder war ein guter Mann. Er war mutig und hatte seine Frau immer gut behandelt. Nie hatte er sie geschlagen, wie es viele Männer taten.
Er besaß als Bruder des Dorfältesten ein großes Haus und würde Fintans Platz einnehmen, wenn dieser zu den Göttern gehen würde. Denn Fintan hatte keinen Sohn. Seine Frau hatte ihm nur Töchter geboren, worüber er sehr zornig war. Und jetzt das. Die Frau war schön und fremd mit ihren goldenen Haaren und der zarten Haut. Und ihre Kleidung, da war man sich einig, war schamlos. Diese Frau gehörte nicht hierher. Sie würde nur Unruhe bringen. Besser, man behielt sie im Auge.
Endlich kam Balder wieder zu sich.
»Komm mit, Frau.« Er nahm Janas Hand und führte sie in das Haus seines Bruders Fintan. Schweißgeruch, vermischt mit dem beißenden Qualm feuchten Holzes, schlug ihr entgegen und ließ ihre Augen tränen.
Fintan und der Rest der männlichen Dorfbewohner saßen oder lagen mittlerweile stark angetrunken an der Feuerstelle, deren Holz zu glühender Asche verglommen war. Zwei der jüngeren Männer stritten heftig miteinander. Mit glasigen Augen standen sie sich wütend gegenüber, die Hände zu Fäusten geballt.
Fintan hatte sich schwerfällig aufgesetzt und war bemüht, Würde und Autorität auszustrahlen. Er war sich bewusst, dass alle Blicke auf ihn gerichtet waren, selbst die beiden Streitenden hielten inne. Ihre Arme sanken nach unten, die zusammengeballten Fäuste öffneten sich.
Finster starrte er dem Jäger und der Frau entgegen. Als wenn er nicht schon genug Ärger hätte. Der Jäger sah ihn zufrieden an.
»Kein Fußabdruck weit und breit, wir sind bis zum Fluss hinuntergeritten, sie war tatsächlich allein, nicht der kleinste Ast war abgebrochen, auch sonst habe ich nichts entdecken können, woraus wir schließen könnten, dass sie Begleiter hatte oder Gefahr droht.«
Fintan vertraute den scharfen Augen des Jägers, denen nichts entging. Sein Gesicht verlor etwas von seiner Härte.
»Wer bist du, und was willst du hier?«, wiederholte er seine Fragen an Jana.
Jana überlegte verzweifelt. Wie sollte sie diesen Menschen etwas erklären, was sie selbst nicht einmal annähernd verstehen konnte. Doch sie hatte keine Wahl. Zögernd begann sie ihre Geschichte zu erzählen.
»Ich komme aus einem fernen Land. Wir befanden uns auf einer Reise und sind unterwegs überfallen worden. Ich wurde entführt, konnte mich aber befreien und bin geflohen. Dann bin ich durch den Wald gelaufen, bis ich zu der Quelle kam, wo ich von einem Bären angegriffen worden bin. Dieser Mann« – sie wies mit dem Finger auf den Jäger – »hat mich gerettet und in euer Dorf gebracht.«
Fintan sah sie misstrauisch an.
»Und deine Begleiter? Wo sind die geblieben?«
»Die sind von den Männern getötet worden, die uns überfallen haben.« Erleichtert darüber, dass ihr die Geschichte eingefallen war, sah sie Fintan an. Ob er ihr glauben würde? Doch Fintan gab sich damit nicht zufrieden.
»Wer waren die Männer, die dich entführt haben?«, bohrte er weiter, ohne Jana aus den Augen zu lassen. Jana begann zu schwitzen. Kleine Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn, was Fintan nicht entging.
»Die Männer waren mir fremd. Ich kann dir nicht sagen, woher sie gekommen sind. Mein Dorf steht viele Tagesreisen von hier entfernt, wir sind lange Zeit unterwegs gewesen.« Sie merkte selbst, dass sie nicht besonders glaubwürdig war. Sie konnte noch nie gut lügen. Doch ihr war einfach keine bessere Geschichte eingefallen.
Fintan war gerissen, schlau und misstrauisch. Er überlegte gut, bevor er eine Entscheidung traf. Den uneingeschränkten Respekt seiner Stammesgenossen konnte er nur so erhalten, seinen Führungsanspruch nur durch Erfolg begründen. Er wandte sich wieder an den Jäger.
»Selbst wenn es stimmt, dass ihre Begleiter tot sind, halten sich aber die Männer, die sie überfallen haben, noch in dieser Gegend auf. Sicher sind sie längst auf der Suche nach der Frau. So lange wir nichts Genaues über sie wissen, ist sie eine Gefahr für das Dorf.«
Cai mischte sich in das Gespräch. Er konnte den Jäger seit dem Tag nicht leiden, da dieser Emer zur Frau bekommen hatte. Er hätte sie selbst gerne geheiratet, aber Emers Vater hatte es vorgezogen, dem Jäger seine Tochter zu geben.
»Wir sollten Mabon holen«, schlug er vor. »Er wird die Götter befragen. Dann wissen wir, ob sie eine Gefahr für uns ist oder nicht.«
Auffordernd blickte er in die Gesichter der Männer. Als sein Blick den des Jägers traf, verzog er hämisch das Gesicht. Er gönnte Balder die fremde Frau nicht, die ihm ebenfalls gefiel. Lüstern musterte er Janas lange Beine, die sich unter der engen Jeans abzeichneten. Einige der Männer begannen zustimmend zu nicken. Balder wurde blass vor Schreck. Mabon würde sie der großen Erdgöttin opfern. Er warf einen Blick auf Jana, die still neben ihm stand. Nein, er wollte sie nicht verlieren. Fest sah er Fintan in die Augen.
»Ich habe die Frau gefunden, und deswegen gehört sie mir. Ich werde sie zur Frau nehmen, sie kann sich um Isa kümmern und mir einen Sohn schenken«, sagte er energisch, ohne Cai zu beachten.