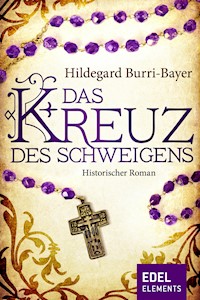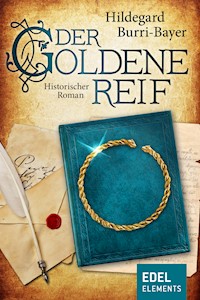3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre unerklärliche Gabe wird zum Fluch … Das mitreißende Schicksal einer starken jungen Frau. Packende geschichtliche Details und ein Schuss Mittelalter-Mystik – spannend, dicht, atmosphärisch erzählt. Im Schatten der mächtigen Kathedrale von Bourges fristet Marie, die Tochter eines begüterten Tuchhändlers, ein einsames Dasein. Die Kathedrale ist es auch, die sie mit den drei Männern zusammenführt, die ihr Leben aus dem Gleichgewicht bringen werden: König Ludwig IX. stellt sie unter seinen Schutz; doch Bischof Radulfus, der eine krankhafte Leidenschaft für Marie hegt, liefert sie – von ihr zurückgewiesen – der Inquisition aus. Robert, ihrem Geliebten, bleiben nur wenige Tage, um sie vor dem Scheiterhaufen zu bewahren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch:
Ihre unerklärliche Gabe wird zum Fluch …
Das mitreißende Schicksal einer starken jungen Frau. Packende geschichtliche Details und ein Schuss Mittelalter-Mystik – spannend, dicht, atmosphärisch erzählt.
Im Schatten der mächtigen Kathedrale von Bourges fristet Marie, die Tochter eines begüterten Tuchhändlers, ein einsames Dasein. Die Kathedrale ist es auch, die sie mit den drei Männern zusammenführt, die ihr Leben aus dem Gleichgewicht bringen werden: König Ludwig IX. stellt sie unter seinen Schutz; doch Bischof Radulfus, der eine krankhafte Leidenschaft für Marie hegt, liefert sie – von ihr zurückgewiesen – der Inquisition aus. Robert, ihrem Geliebten, bleiben nur wenige Tage, um sie vor dem Scheiterhaufen zu bewahren …
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2017 by Hildegard Burri-Bayer Dieser Titel wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf — auch teilweise — nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-903-9
www.facebook.com/EdelElements
PROLOG
Der Aufruf der stolzen Bürgerschaft von Bourges, im Jahre 1247 des Herrn, verbreitete sich leise flüsternd mit dem Wind bis in die armseligste Behausung der Provinz und löste eine regelrechte Landflucht aus.
»Jeder, der ein Jahr innerhalb unserer Stadtmauern verbringt, ohne dass sein Herr ihn findet und zurückfordert, wird fortan ein freier Bürger sein«, lautete die vielversprechende Botschaft der berittenen Stadtboten von Bourges, die so schnell wieder verschwanden, wie sie gekommen waren.
Getragen von der stillen Hoffnung auf Freiheit und auf ein menschenwürdiges Leben, folgten einzelne Familien, aber auch ganze Dörfer deren verlockendem Ruf, und immer mehr ausgemergelte und verdreckte Gestalten tauchten mit ihren wenigen Habseligkeiten bepackt vor den Toren der Stadt auf.
Die mächtige Steinmauer, die sich, nur von düster aufragenden Wachtürmen unterbrochen, um die Stadt zog, löste die verschiedensten Gefühle in den Menschen aus. Obwohl sie Schutz versprach, wirkte sie abweisend und bedrohlich. Allein die Hoffnung überwand alle Bedenken.
Unter den misstrauischen Augen der Stadtwachen schlichen die Menschen geduckt durch die hohen Tore, um wenig später hilflos in einer anonymen, bunt brodelnden Masse aus Menschen und Tieren unterzugehen.
Sie waren nicht vorbereitet auf den Lärm und den Gestank, der unvermittelt über sie hereinbrach und ihr schlichtes Gemüt hoffnungslos überforderte.
Ergeben ließen sie sich treiben, vorbei an großen Steinhäusern und hübschen Fachwerkhäusern, die allesamt Paläste waren im Vergleich zu den primitiven Katen und Hütten, die sie bisher gekannt hatten.
Irgendwann erreichten sie unweigerlich den Vorplatz der Kathedrale. Dort blieben sie unwillkürlich stehen und starrten geschockt zu dem kalten und stolzen Moloch empor, der sich in wahnwitziger Größe vor ihnen erhob und unter dessen Ehrfurcht einflößendem Schatten sie ihr weiteres Leben verbringen würden.
1
Nachdem das letzte Gerüst entfernt worden war, konnte niemand mehr sagen, wie viele Jahre es insgesamt gedauert hatte, um die Kathedrale größer und mächtiger in die Höhe wachsen zu lassen als jedes andere Bauwerk in der Provinz Berry.
Bischof Henri de Sully, der zu Ehren des Allmächtigen mit dem gewaltigen Bau begonnen hatte, war schon vor geraumer Zeit in dessen Reich eingegangen und genauso aus dem Gedächtnis der Lebenden verschwunden wie der Schweiß und das Blut mehrerer Generationen von Baumeistern, Handwerkern und Arbeitern, deren Leben allein durch den Bau der Kathedrale bestimmt worden war.
Das fünfschiffige, lichtdurchflutete Bauwerk mit seinen unzähligen Pfeilern und Bögen war schlichtweg überwältigend und erschien den Menschen wie ein Wunder, und so kamen jeden Tag mehr Besucher, um es zu bestaunen und zu begaffen. Mochten sie sich im ersten Augenblick im Schatten dieses machtvollen Bauwerkes auch armselig und klein fühlen, letztendlich überwog in ihnen doch stets das triumphale Gefühl, die Schwerkraft überlistet zu haben. Die unermesslichen Waldgebiete, die dem Bau zum Opfer gefallen waren, zählten nicht mehr und auch nicht die vielen menschlichen Dramen, die sich in den vergangenen Jahren rund um die Baustelle herum abgespielt hatten.
Obwohl es noch früh am Morgen war, hatte sich bereits eine lange Schlange gottesfürchtiger Menschen vor dem Westflügel gebildet, die geduldig darauf wartete, eingelassen zu werden, um auch das Innere dieses Wunders bestaunen zu können.
Die vierzehnjährige Marie, Tochter eines ehrgeizigen Tuchhändlers, hatte an diesem Morgen von ihrer Mutter den Auftrag erhalten, der Bäckerswitwe die übrig gebliebenen Reste einiger Stoffballen zu bringen, aus der sie Kleider für ihre neun Kinder nähen konnte.
Die Menschen, die ihr unterwegs begegneten, starrten Marie, deren ungewöhnlich helle, fast schon weiße Haut an jungfräulichen Neuschnee erinnerte, neugierig an. Ihr lockiges, dunkelbraunes Haar fiel ihr offen bis auf die schmale Taille herab und wurde nur am Kopf durch einen schmalen bronzenen Reif gebändigt. Das Auffälligste an Marie waren jedoch nicht ihre feinen ebenmäßigen Gesichtszüge, sondern ihre Augen, die so ungewöhnlich dunkel und dabei von solch außergewöhnlichem Glanz waren, dass sie dem Betrachter bis tief in die Seele zu blicken schienen. Nicht wenige, die ihr begegneten, drehten sich nach ihr um und sahen dem schlanken hochgewachsenen Mädchen hinterher, das in ihrem blauen Kleid mit den weiten Ärmeln und dem langen Mantel aus feinstem flandrischen Tuch, der von einer kupfernen Fibel zusammengehalten wurde, wie ein Engel wirkte.
Schüchtern nahm sie die Dankbarkeit der verhärmt aussehenden Frau entgegen, die ihr und ihrer Mutter Gottes Segen wünschte. Auf dem Rückweg konnte sie nicht widerstehen, den kleinen Umweg an der Kathedrale vorbei zu nehmen.
Das erhabene Bauwerk war Maries Freund, seitdem sie denken konnte. Innerhalb seiner breiten Mauern fühlte sie sich sicher und geborgen und glaubte Gott näher zu sein. Hier hing sie ihren kindlichen Träumen nach und wagte es leise flüsternd, den stummen, mit Gold bemalten Heiligenfiguren ihre Ängste und Hoffnungen anzuvertrauen.
In stiller Erwartung lief sie durch das Goldene Tor und betrat die »Heilige Stadt«, die sich weit über die Häuser der Handwerker und Kaufleute erhob.
Sie war eine Stadt in der Stadt, in der die hohen Kirchenherren, umgeben von einem Heer aus Mönchen, Dienern, Knechten und Mägden, nahezu ungestört für sich lebten.
Die »Heilige Stadt« besaß ihre eigenen Kornspeicher und Ställe, gut gefüllte Weinkeller, Kräuter-, Obst- und Gemüsegärten und natürlich die Zehntscheune, in der jeder Bürger einmal im Jahr seine Abgaben an den Klerus entrichtete. Zwischen der Zehntscheune und den unscheinbaren Holzhäusern der Dienerschaft lagen wiederum Bade- und Krankenstuben, und sie alle wurden vom Glanz des Bischofspalastes überstrahlt.
Marie hatte das Ende der Menschenschlange bei der Kathedrale schon beinahe erreicht, als plötzlich zwei halb verhungerte Straßenköter knurrend und zähnefletschend auf sie zugejagt kamen. Erst kurz vor ihr stoben sie auseinander, um sich direkt hinter ihr wieder aufeinanderzustürzen. Der kleinere der beiden hielt eine laut fiepende, aus mehreren Wunden blutende, fette Ratte im Maul und versuchte sie mit allen Mitteln gegen seinen größeren Rivalen zu verteidigen.
Maries Herz zog sich vor lauter Schreck und Mitleid mit der im Todeskampf zuckenden Ratte zusammen. Auch wenn die meisten Menschen Ratten für Ausgeburten der Hölle hielten, waren sie doch gleichfalls Geschöpfe Gottes, die wie jedes andere Lebewesen Schmerz empfanden.
Marie glaubte die unerträglichen Schmerzen des Tieres am eigenen Leib zu verspüren, und sie bekam zunehmend immer weniger Luft zum Atmen. Der Raum um sie herum begann auf einmal leer und kleiner zu werden. Was übrig blieb, war allein das furchtbare Knacken der Knochen im Leib der Ratte, das ihr in den Ohren dröhnte. Ein heftiger Schwindel ließ den Boden unter ihren Füßen wanken, und obwohl sie versuchte dagegen anzukämpfen, gelang es ihr nicht. Mit weit geöffnetem Mund rang sie verzweifelt nach Luft, dann schwanden ihr die Sinne, und sie sank bewusstlos auf das harte Kopfsteinpflaster.
Für die Gassenjungen, die überall stets dort auftauchten, wo es Fremde gab, und nur auf eine Gelegenheit lauerten, diese zu bestehlen, waren die Hunde eine willkommene Abwechslung. Vergnügt bildeten sie johlend einen Kreis um die miteinander kämpfenden Tiere. Beide Hunde hatten ihre Reißzähne jetzt tief in der Ratte vergraben und zerrten sie knurrend zwischen sich hin und her. Niemand achtete dabei mehr auf Marie, die sich mittlerweile von schweren Krämpfen geschüttelt auf dem harten Kopfsteinpflaster wand.
Stattdessen wurden schon die ersten Wetten auf die Hunde abgeschlossen und per Handschlag bekräftigt. Endlich war es den Tieren gelungen, die Ratte in zwei Teile zu reißen. Mit ihrer Beute im Maul suchten sie sich einen Weg zwischen den Beinen der Neugierigen und stoben in verschiedene Richtungen davon.
Erst jetzt wurden die Menschen auf das bewusstlos am Boden liegende Mädchen aufmerksam. Dunkle, weit aufgerissene Augen starrten den Gaffern blicklos entgegen, während der schmale Mädchenkörper immer wieder von Krämpfen geschüttelt wurde. Schaum rann Marie aus beiden Mundwinkeln und bildete eine kleine Pfütze auf den Steinen, und ihr vorher ebenmäßiges Gesicht war durch den Anfall zu einer hässlichen Fratze verzerrt, die den Menschen kleine Schauer über den Rücken laufen ließ.
Wieder bildete sich ein Kreis, und die Menschen stierten nunmehr genauso auf das zuckende Mädchen herab, wie sie zuvor auf die Hunde gestarrt hatten. Keiner der Zuschauer kam Marie zu Hilfe. Die Vorsichtigen unter ihnen hielten einen wohl berechneten Abstand zu dem Mädchen ein, während sich die Neugierigen weiter nach vorne drängten, um sich nur ja nichts von dem spannenden Schauspiel entgehen zu lassen.
»Es ist Marie, die Tochter des Tuchhändlers. Sie ist von Dämonen besessen«, brüllte einer der Gassenjungen in die schweigende Menge hinein, die sich noch nicht schlüssig war, was sie von dem Ganzen halten sollte und ob es hier überhaupt mit rechten Dingen zuging.
Ein kräftiger Mann mittleren Alters, bei dem es sich den feinen Kleidern nach zu urteilen um einen reichen Kaufmann handelte, sah den Jungen scharf an. »Was stehst du dann noch hier herum? Lauf und hol ihn«, forderte er mit befehlsgewohnter Stimme.
Verärgert, seinen Mund so weit aufgerissen zu haben, kam der Junge dem Befehl nach und rannte, so schnell er konnte, auf die schmalen, mehrstöckigen Fachwerkhäuser der Kaufleute und Händler zu, die sich eng aneinandergedrängt um den nahen Marktplatz herumzogen.
Geschickt sprang er dabei von einem Trittstein zum anderen, um nicht in den knöcheltiefen Unrat zu treten, der sich zwischen und neben den Platten befand. Jetzt würde er gewiss das Beste verpassen, doch er tröstete sich mit dem Gedanken, mit ein wenig Glück vielleicht etwas zu essen für seine Gefälligkeit heraushandeln zu können, und er sollte nicht enttäuscht werden.
Auf sein drängendes Klopfen hin wurde ihm die Türe zum Haus des Tuchhändlers von Elsa, der Magd der Familie, geöffnet. Misstrauisch sah sie auf den Jungen herab, dessen zerrissene Kleider vor Schmutz starrten.
»Was gibt es denn so Dringendes, dass du beinahe die Türe einschlägst?«, fragte sie unfreundlich.
»Marie ist zu Boden gefallen und sieht ganz komisch aus«, gab der Junge zur Antwort. »Ungefähr so.« Geschickt imitierte er das Zucken von Maries Gliedern und stellte erfreut fest, dass die Magd vor Schreck ganz blass wurde.
»Gott im Himmel, führe mich sofort zu ihr«, befahl ihm Elsa aufgeregt. Sie wischte ihre mit Mehl bestäubten Hände an der Schürze ab und rief dann nach dem Knecht, der mit hochrotem Kopf hinter ihr im Türrahmen erschien.
»Ich habe Hunger«, meinte der Junge entschieden, nicht bereit, die sich ihm bietende Chance nutzlos verstreichen zu lassen. Elsa überlegte nur kurz und kam dann zu dem Schluss, dass keine Zeit für lange Reden war. Rasch lief sie in die Küche zurück und kehrte von dort mit einem Stück duftenden Brotes in der Hand zurück.
Dem Jungen lief das Wasser im Mund zusammen. Gierig griff er nach dem Brot, doch die Magd zog die Hand, in der sie das Brot hielt, blitzschnell wieder zurück und versteckte sie hinter ihrem Rücken.
»Erst will ich sehen, ob du die Wahrheit gesprochen hast.«
Sogleich lief ihr der Junge mit flinken Schritten voran, und Elsa hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Keuchend musste sie einige Male stehen bleiben, um nach Luft zu ringen. Doch schließlich öffnete sich die schmale Gasse und gab ihr den Blick auf die alles dominierende Kathedrale frei.
Schon von Weitem konnte sie die Menschenmenge erkennen, die sich auf dem Kathedralenvorplatz gebildet hatte. Als sie schließlich bei ihr ankam, half ihr der Junge, sich einen Weg durch die Menschen zu bahnen, die dicht gedrängt nebeneinanderstanden. Doch noch bevor sich die Magd voller Sorge über Marie beugen konnte, hatte ihr der Junge auch schon blitzschnell das versprochene Brot aus der Hand gerissen und war damit davongerannt, um sich ein stilles Plätzchen an der Stadtmauer zu suchen, wo er sich in Ruhe darüber hermachen konnte.
Der Knecht war Elsa gefolgt und stand nun seitlich hinter ihr. Mit offenem Mund glotzte er auf Marie herab.
»Was stehst du da Maulaffen feilhaltend herum, heb sie schon auf«, zischte Elsa wütend und bedachte die Menge mit abfälligen Blicken. Was dachten sich diese Gaffer nur dabei, so nutzlos herumzustehen, ohne auch nur den geringsten Versuch zu unternehmen, dem Mädchen zu helfen?
Der Knecht zögerte, und ein ängstlicher Ausdruck legte sich über seine etwas dümmlich wirkenden Gesichtszüge.
»Jetzt mach schon, oder muss ich dir erst einige Stockhiebe versetzen lassen?«, fauchte Elsa ihn an, der Maries starr aufgerissene Augen große Angst bereiteten.
Der Knecht wagte es schließlich nicht länger, sich ihrem Befehl zu widersetzen. Gehorsam hob er das bewusstlose Mädchen auf und trug es hinter Elsa her, die, ohne noch weiter nach rechts und links zu blicken, zielstrebig voranlief und ihm den Weg durch die Menge frei machte.
Als sie zu Hause angekommen waren, ließ Elsa Marie sofort in die Kammer bringen, die sie sich mit ihren drei älteren Schwestern teilte. Danach herrschte sie den Knecht an, Wasser zu holen und die Herrin des Hauses zu verständigen.
Eleonore, Maries Mutter, war eine schöne und stolze, aber vom Leben verbitterte Frau, die an der Strenge ihres Herrn Gemahls beinahe zerbrochen war. Nie hatte sie auch nur das geringste Anzeichen von Zuneigung, geschweige denn Liebe von ihm empfangen, und so fiel es ihr schwer, Gefühle zu zeigen, selbst ihren eigenen Kindern gegenüber. Beherrscht und voller Pflichtgefühl verhielt sie sich stets, wie man es von einer Frau ihres Standes erwartete.
Sie war gerade dabei, die im Kontor gelagerten Stoffballen auf Motten und anderes gefürchtetes Ungeziefer hin zu untersuchen, als der Knecht aufgeregt hereinstürzte, um ihr zu berichten, was sich zugetragen hatte.
Eleonores schmales Gesicht mit der hohen Stirn zeigte keinerlei Regung; nur die schönen goldbraunen Augen blitzten ärgerlich ob der Störung auf. Sie legte den Stoff zur Seite und stieg mit angemessenen Schritten die steile Treppe zu Maries Kammer empor.
Die Herrin des Hauses hatte nie besonders viel für ihre jüngste Tochter übriggehabt, deren unnatürlich weiße Haut ein Erbteil der Familie ihres Mannes war und mit der sie auch sonst nur wenig gemein hatte. Marie war es außerdem gewesen, die Eleonores Traum, ihrem Mann einen Sohn schenken zu können, endgültig zunichtegemacht hatte.
Maries Geburt war schwer gewesen, und irgendein Körperteil war damals in ihrem Inneren so sehr beschädigt worden, dass sie nie wieder ein Kind hatte bekommen können. Zusammen mit ihrem Schoß hatten sich auch ihre Brüste für immer verschlossen.
Doch Gott hatte andere Pläne mit Marie gehabt und entschieden, das zarte Mädchen leben zu lassen. Noch am Tage ihrer Geburt hatten sie eine halb verhungerte junge Frau vor ihrer Türe gefunden, die zudem gerade ihr Neugeborenes verloren hatte; ihre Brüste waren schwer von Milch gewesen.
Auf Eleonores Gesicht zeigte sich ein Anflug von Ekel, als sie auf das bewusstlose Mädchen herabsah, dessen Körper noch immer von Zuckungen beherrscht wurde.
»Worauf wartest du noch? Nimm Bitterwurz, gib etwas Alraune hinzu, und dann wisch sie sauber«, herrschte sie Elsa an, bevor sie sich mit einem kurzen Seufzer abwandte und wieder nach unten ging. Als ob sie nicht schon genug Probleme hätte.
Elsa schob die blonde Haarsträhne, die sich durch den raschen Lauf gelöst hatte, wieder unter ihre weiße Haube zurück und begab sich in die Küche. Dort kochte sie eine kleine Menge Wein auf, in die sie, wie ihr geheißen, zerstoßenen Bitterwurz und eine kleine Menge Alraune gab. Anschließend goss sie den Wein in einen Becher und rührte ihn noch einmal sorgfältig um. Als sie zurück in die Kammer kam, wischte sie Marie sauber und flößte ihr den Wein Tropfen für Tropfen ein.
Es schien tatsächlich zu helfen, denn die Krämpfe begannen nachzulassen. Maries Atem wurde gleichmäßiger, aber sie erwachte nicht, sondern schlief erschöpft bis zum nächsten Tag.
2
Zwei Wochen nach ihrem Anfall erwachte Marie eines Morgens vom dröhnenden Hufgeklapper eines mächtigen Kutschpferdes, das sich mühte, mit dem vollbepackten Wagen, an den es geschirrt war, durch die schmalen Gassen zu kommen. Der Kutscher auf dem Bock fluchte laut, als ihn der übel riechende Inhalt einer Bettpfanne traf und sich genau über seinen Umhang ergoss.
Eine unerträgliche Hitze hatte sich über die Stadt gelegt, die mit jedem Tag schlimmer wurde und die Menschen ungeduldig und reizbar machte.
Marie warf einen raschen Blick auf ihre Schwestern und stellte erleichtert fest, dass diese noch schliefen. Schnell sprang sie aus dem Bett, wusch sich Gesicht und Hände in der Waschschüssel, die auf einem eigens dafür angefertigten Holztisch stand, und schlüpfte in ihr Gewand. Nachdem sie gekleidet war, griff sie nach ihrem Holzkamm, kämmte sich damit sorgfältig ihre langen Haare nach hinten und setzte sich dann zum Abschluss ihrer Toilette den schmalen bronzenen Reif auf.
Als sie fertig war, stieg sie mit leisen Schritten die Holztreppe hinunter und beeilte sich, in die Küche zu kommen, in der Elsa um diese Zeit das Feuer im Kamin schon immer geschürt hatte.
Der große, gemauerte Kamin bildete den Mittelpunkt des geräumigen Fachwerkhauses und führte durch das gesamte erste und zweite Stockwerk bis zum Dach hinauf, was den Vorteil hatte, dass man unten feuern und dadurch gleichzeitig fast alle anderen Zimmer mit beheizen konnte.
Vom Kamin aus gingen Diele, Stube und Küche ab. Letztere lag zum Garten hin, und unter dem Küchenfenster befand sich eine Kompostgrube, in die man die Küchenabfälle kippen konnte. Das vermied nicht nur viel Dreck, sondern ersparte auch eine Menge Lauferei.
In der Küche traf Marie auf Elsa, die der einzige Mensch im ganzen Haus war, bei dem sie etwas Wärme fand. Um wie viel lieber hätte sie bei der Magd in der winzigen Gesindekammer direkt unterm Dach geschlafen als bei ihren Schwestern, die sie immer nur herumschubsten und bei jeder sich bietenden Gelegenheit ärgerten. Doch ihre Mutter hatte es nicht erlaubt und ihr sogar mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, als sie sich trotz des bestehenden Verbotes einmal heimlich in Elsas Kammer geschlichen hatte.
Beim Anblick des Mädchens legte sich ein gutmütiges Lächeln auf Elsas rundes Gesicht, das im Gegensatz zu sonst jedoch etwas gequält wirkte, denn auch sie litt unter der schrecklichen Hitze der letzten Tage.
Marie bemerkte es voller Sorge. »Ich werde dir helfen«, verkündete sie mit heller Stimme und begann mit geschickten Händen die einzelnen Zöpfe für den Hefekranz zu formen, den sich ihr Vater in den wenigen Tagen des Jahres, an denen er sich in seinem Haus aufhielt, anstelle des üblichen Haferbreis zum Frühstück wünschte.
Jean Machaut verbrachte den größten Teil des Jahres auf den großen Messen in der Champagne.
Von Anfang Januar bis zur Mittfastenzeit befand er sich in Lagny und bis Himmelfahrt dann in Bar-sur-Aube. Danach ging es nach Provins und anschließend zur »foire chaude«, zur Heißen Messe nach Troyes weiter, die von Johanni bis Mitte September dauerte. Auf diese folgte wiederum die Saint-Ayoul-Messe in Provins und nach Allerheiligen schließlich die »foire froide«, die Kalte Messe von Troyes.
»Bist ein gutes Kind.« Elsa strich ihr mit der mehlbepuderten Hand über die Wange und stellte ihr einen Becher Milch hin. Das arme Mädchen war viel zu blass und viel zu dünn. Die Milch würde Marie guttun und sie wieder zu Kräften kommen lassen.
»Dumme Elsa, du sollst die Milch nicht so verschwenden, ich werde es Mutter erzählen.« Die schrille Stimme von Katharina, Maries ältester Schwester, die hochmütig in die Küche hereinstolziert kam und sich auf den Stuhl neben Marie setzte, ließ sowohl Marie als auch Elsa erschrocken zusammenzucken.
Mit einem raschen Blick auf Elsa, die gerade den Hefekranz in den vorgeheizten Ofen schob, nahm sie Marie den Becher aus der Hand und trank ihn in einem Zug leer. Marie ließ es wortlos geschehen. Traurig sah sie Katharina an, doch die wandte ihren Blick ab.
Nach Katharina betraten nun auch die restlichen Familienmitglieder nach und nach die Küche und nahmen ihren Platz an dem mit einem weißen Linnen überzogenen Tisch ein. Martha, die zweitälteste der Schwestern, erschien wie immer zusammen mit der zierlichen Agnes, die gerade einmal elf Monate jünger war als sie selbst und die ihr wie ein Schatten überallhin folgte.
Die beiden Knechte, Henry und Pierre, saßen am unteren Ende der Tafel und warteten geduldig darauf, dass ihr Herr eintraf. Alle verstummten, als das Oberhaupt der Familie schließlich den Raum betrat.
Der Tuchhändler war ein hagerer, strenger Mann ohne jeden Sinn für Humor, dessen einziger Lebensinhalt ausschließlich darin bestand, sein Vermögen zu vermehren. Sein kantiges Gesicht mit dem spitzen Kinn wurde von den gleichen dunklen Augen beherrscht, die auch Marie besaß.
Machaut selbst hielt sich für einen gerechten Mann, der über seine Familie herrschte wie ein Vasall über seine Knappen. Mit lauter Stimme sprach er das Tischgebet und ließ sich anschließend ein großes Stück von dem duftenden Hefekranz reichen, den Elsa auf den Tisch gestellt hatte.
»Elsa hat Marie vor dem Frühstück Milch gegeben«, sagte Katharina und warf Marie dabei einen boshaften Blick zu.
Schon des Öfteren hatte sie Elsa dabei ertappt, wie sie Marie heimlich eine Leckerei zusteckte. Einmal war es ein Apfel, ein anderes Mal ein Stück von dem köstlichen Schinken gewesen, den es nur an besonderen Feiertagen gab. Katharina war eifersüchtig auf Marie, und sie konnte nicht verstehen, warum ihre Mutter ihre Schwester nach deren letzten beiden Anfällen auf der Straße und in der Kirche nicht im Haus eingesperrt hatte, wo sie keinen weiteren Schaden anrichten und nicht mehr unangenehm auffallen konnte.
Hatte ihre Mutter denn nicht gemerkt, dass die Leute schon über die Familie Machaut redeten und sich Gedanken über Maries seltsame Krankheit machten? Warum musste sie auch ausgerechnet während des Gottesdienstes diese unheimlichen Krämpfe bekommen? Sie würde nie vergessen, wie die Leute die anderen Familienmitglieder angestarrt hatten und zur Seite gerückt waren, als hätten sie alle eine ansteckende Krankheit. Am liebsten wäre Katharina im Boden versunken, so sehr hatte sie sich geschämt.
Seitdem zerrissen sich die Leute die Mäuler über die Machauts und beobachteten sie voller Misstrauen.
Erst einen Tag zuvor hatte Katharina gehört und gesehen, wie die Frauen aus der Nachbarschaft ihre Stimmen gesenkt und die Köpfe enger zusammengesteckt hatten, als sie die Gasse zu ihrem Haus hochgelaufen gekommen war.
Eine Schar bösartiger alter Krähen, deren Gesichter sich jedoch unter den gesenkten Hauben nicht alle hatten erkennen lassen.
»Es ist ein Zeichen für schlechtes Blut, aber vielleicht ist ja auch der Leibhaftige in sie hineingefahren. Jeder weiß doch, dass er dafür am liebsten unschuldige Jungfrauen auswählt.« Das feiste Gesicht der Frau des Salzhändlers drehte sich dabei vergewissernd nach allen Seiten. Rasch schlug sie ein Kreuzzeichen, bevor sie mit gesenkter Stimme fortfuhr:
»Und habt ihr neulich den Geruch bemerkt, der aus dem Haus der Machauts kam?«
Die Köpfe der anderen Frauen schossen aufgeregt vor. Zwei der farbenprächtigen Hauben stießen zusammen und verhedderten sich an den Nadeln, mit denen sie am Kopf befestigt waren. Es dauerte eine Weile, bis ihre Besitzerinnen sie zeternd und schimpfend wieder auseinanderbekamen. »Jetzt sagt schon, von welchem Geruch ihr sprecht.« Die neugierige Stimme kam aus einem langen, dürren Hals.
»Es war eindeutig Schwefel«, die Stimme der Frau des Salzhändlers vibrierte genussvoll vor wohligem Entsetzen.
Ein Ochsenkarren ratterte mit viel Lärm an ihnen vorbei, gefolgt von einer Schar tobender Kinder, die mit ihren Stecken ein paar ängstlich quietschende Ferkel vor sich her jagten.
Die Frauen warfen sich verschwörerische Blicke zu, während sie darauf warteten, dass der Lärm wieder abebbte und die Frau des Salzhändlers endlich fortfahren konnte.
»Ich sage euch, es war Schwefel, stinkender gelber Schwefel, der oben aus dem Dach gefahren ist und mitten in die riesige schwarze Wolke hinein, die direkt über dem Haus hing.«
Die Frauen schlugen hastige Kreuzzeichen und flatterten wie aufgeregte Hühner durcheinander.
»Das Böse ist also direkt in unserer Mitte, sodass wir nur beten und den Herrn anflehen können, uns und unsere Kinder vor ihm zu bewahren«, schloss sie theatralisch.
Katharina war rasch ins Haus gelaufen. Zuerst war sie nur unangenehm berührt gewesen. Nachdem sie jedoch Haube und Umhang abgelegt hatte, war ihr plötzlich die Gefahr bewusst geworden, die vom boshaften Geschwätz der Frauen nicht nur für Marie, sondern für sie alle ausging. Allein der Gedanke, dass ihr Verlobter Jacques davon erfahren und daraufhin ihre Verlobung lösen könnte, was wiederum zur Folge haben würde, dass sie ihr Leben als alte Jungfer in diesen stinkenden Gassen verbringen müsste, ließ Katharina den Atem stocken.
Doch dann hatte sie erkannt, dass alles noch viel schlimmer war. Grausige Bilder der Vergangenheit stiegen aus ihrer Erinnerung empor, und mit ihnen zusammen kamen Angst und Entsetzen. Katharina begann zu zittern. Eine eisige Kälte kroch ihren Leib empor und legte sich schwer auf ihr Herz.
Vor ihren Augen tauchte wieder das Gesicht des Juden und seine stumme Angst auf, die sich in namenloses Entsetzen verwandelt hatte, als er begriffen hatte, dass er sterben würde. Es war schrecklich gewesen. Nie würde sie es vergessen.
Der jüdische Geldverleiher war der Ketzerei angeklagt gewesen und vor den Augen der ehrbaren Bürger von Bourges auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden.
Tage danach hatte sie noch immer seine entsetzlichen Schreie in den Ohren gehabt, die nicht hatten verstummen wollen.
Seitdem war die Heilige Inquisition in Bourges allgegenwärtig, und wo immer die Domini canes, die Hunde des Herrn, in ihren schwarzen Kapuzenkutten auftauchten, wichen die Menschen ehrfürchtig vor ihnen zurück. Durch ihre Anwesenheit waren die Einwohner der Stadt unablässig dazu gezwungen, an ihre Sünden zu denken und sich ihre jämmerliche Unzulänglichkeit schmerzhaft ins Bewusstsein zu rufen.
Katharina wusste zwar, dass der Angeklagte ein Jude gewesen war, also ein Ungläubiger, während sie selbst immerhin der achtbaren Bürgerschaft angehörte, doch der Schock, den sie damals erlitten hatte, war so groß gewesen, dass sie ihn nicht wieder hatte vergessen können.
Eleonore sah Elsa streng an. »Ich werde dir die Milch von deinem Lohn abziehen«, sagte sie und wandte sich dann an Marie: »Und du wirst zur Strafe auf dein Essen verzichten und in deine Kammer gehen.«
Schweigend nahm Marie ihre Strafe entgegen. Elsa sah ihr mitleidig nach, als sie sich traurig erhob, um den Befehl ihrer Mutter zu befolgen.
Niemand sprach mehr ein Wort, und nachdem Jean zusammen mit seinen Knechten die Küche verlassen hatte, erhob sich auch Eleonore vom Tisch, um sich ihrer täglichen Näharbeit zu widmen.
Sie würde sich wohl bald nach einer neuen Magd umsehen müssen, denn Elsa war störrisch und ungehorsam, sobald es um Marie ging. Sie hatte geradezu einen Narren an dem Mädchen gefressen, und Eleonore konnte diese Bevorzugung ihrer jüngsten Tochter auf keinen Fall noch länger dulden.
Jean würde wütend werden, wenn er merkte, dass sie nicht einmal die Magd unter Kontrolle hatte.
Elsa hatte die Küche verlassen und war die enge Treppe zum Vorratskeller hinuntergestiegen. Kaum war sie fort, da drehte sich Martha, die Zweitälteste, zu Katharina um.
»Jetzt müssen wir sogar noch das Geschirr wegräumen und das Gemüse putzen, während Marie es sich in der Kammer gemütlich machen kann«, beschwerte sie sich. Sie war kleiner und rundlicher als Katharina und hatte ebenso wie Agnes die dunklen Haare ihres Vaters geerbt.
»Marie ist dumm«, bemerkte Agnes und steckte ihren Finger in den offenen Honigtopf, um ihn anschließend genüsslich abzulecken. Sie war grundsätzlich derselben Meinung wie Martha, die sie über alles liebte.
»Marie ist schuld daran, dass die Leute sich die Mäuler über uns zerreißen«, grollte Katharina, immer noch ganz von ihren düsteren Gedanken beherrscht.
Doch Elsa hatte ihre Worte gehört. Mit einer heftigen Bewegung warf sie das Fleisch und die Fische, die sie aus dem Vorratskeller geholt hatte, auf den Tisch und drehte sich dann zu Katharina um.
»Du solltest dich schämen. Anstatt Mitleid mit deiner Schwester zu haben, denkst du nur an das Gerede der Leute. Aber die würden sich das Maul auch über uns zerreißen, wenn Marie nicht krank wäre, weil sie neidisch auf unseren Reichtum sind, den ihr ja deutlich genug zur Schau stellt«, rief sie aufgebracht und voller Empörung, auch wenn es ihr nicht zustand, die Tochter des Hauses zurechtzuweisen.
»Marie ist der Schandfleck unserer Familie«, bemerkte Katharina und bedachte Elsa mit einem hochmütigen Blick. Sie war jetzt erwachsen, und Elsa war nur eine unbedeutende Magd, die ihr nichts mehr zu sagen hatte, während sie selbst schon bald eine Gräfin sein würde.
»Ich werde mit Mutter darüber reden. Sie muss Marie verbieten, das Haus zu verlassen, sonst wird bald niemand mehr etwas mit uns zu tun haben wollen«, setzte sie entschlossen hinzu.
»Ich will nicht, dass die Leute schlecht über uns reden«, jammerte Agnes mit weinerlicher Stimme.
Martha legte tröstend einen Arm um ihre Schulter.
»Du brauchst keine Angst zu haben. Mutter wird nicht zulassen, dass so etwas passiert.«
3
Marie war gehorsam nach oben in ihre Kammer gegangen, wo sie nun traurig aus dem halb offenen Fenster hinaussah, eine bauliche Neuerung, die längst nicht jedes Haus in der Stadt aufwies und die den neu erworbenen Reichtum ihrer Familie zur Schau stellte. Denn nur wenige Bürger konnten sich ein Fenster aus Glas leisten, durch das man hindurchsehen konnte, als ob es gar nicht vorhanden wäre.
Katharinas Ablehnung tat ihr weh, obwohl sie ihre Schwester gut verstehen konnte.
Sie allein war schuld daran, dass ihre Familie ins Gerede gekommen war, und diese Schuld lag schwer wie ein Mühlstein auf ihrer Seele. Nach dem Vorfall in der Kathedrale hatte Katharina sie wütend beschimpft, aber ihre Stimme war dabei vor lauter Angst ganz schrill geworden. Marie hatte es nicht ertragen können, Katharina so voller Angst zu sehen.
»Die alte Frau hatte solche Schmerzen, ich musste ihr einfach helfen«, hatte sie ihr zu erklären versucht, aber Katharina hatte sie nur verständnislos angestarrt.
»Was willst du damit sagen?«
»Ich habe sie geheilt«, flüsterte Marie zitternd. Flehend sah sie Katharina an, in der Hoffnung, dass diese jetzt verstehen würde, dass sie keine Wahl gehabt hatte, doch nach einem Blick in ihr verkniffenes Gesicht wusste sie, dass ihre Hoffnung vergeblich war. Eine Stimme tief in ihrem Inneren hatte sie bisher davor gewarnt, darüber zu reden, aber der Wunsch, Katharinas Zuneigung zu erringen, war für einen Augenblick stärker gewesen.
Katharina hatte wortlos ausgeholt und ihr so heftig ins Gesicht geschlagen, dass ihre Wange brannte.
»Wie kannst du es wagen, mir so frech ins Gesicht zu lügen und dann auch noch Gott zu lästern. Gib doch endlich zu, dass du dich nur wichtig machen wolltest.« Ihre Stimme hatte sich beinahe überschlagen vor lauter Wut.
»Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Hast du verstanden? Du bist nicht ganz richtig im Kopf und außerdem auch noch von Dämonen besessen. Niemand wird jemals etwas mit einer Besessenen wie dir zu tun haben wollen.«
Der Hass, der in Katharinas Stimme mitschwang, war mehr, als Marie ertragen konnte. Flehend streckte sie Katharina ihre Hand entgegen, doch Katharina hatte sie zur Seite gestoßen und war gegangen.
Danach hatte sie es nie wieder gewagt, mit jemandem über diese Dinge zu reden, die ihr selbst unerklärlich waren.
Eine Weile beobachtete Marie die kleinen Wölkchen, die mit unglaublicher Langsamkeit über den tiefblauen Himmel zogen. Danach wanderten ihre Gedanken wie immer, wenn sie Zeit zum Träumen fand, unweigerlich zur Kathedrale und der Anwesenheit Gottes, der ihr unerreichbar schien. Doch allein der Gedanke, dass es Ihn gab, war ein großer Trost für sie.
Sobald Marie die Menschen und ihre schmalen Häuser mit Gott und der mächtigen Kathedrale von Bourges verglich, konnte sie sich Seine unermessliche Größe besser vorstellen. Wie gerne hätte sie einmal mit Ihm gesprochen, um zu erfahren, warum Er ausgerechnet sie dafür auserwählt hatte, den Menschen ihre Schmerzen zu nehmen. Oder bildete sie sich das alles nur ein? War sie vielleicht doch nicht ganz richtig im Kopf, wie Katharina behauptet hatte? Als sie der alten Frau in der Kathedrale in das schmerzverzerrte Gesicht gesehen hatte, war es zu spät gewesen, um so zu tun, als ob sie nichts gesehen hätte. Sie hätte es auch nicht übers Herz gebracht. Es wäre nicht richtig gewesen.
Dennoch erfüllte Marie tiefe Scham, weil sie ihrer Familie so viel Sorgen bereitete. Die Ablehnung ihrer Eltern und Schwestern empfand sie deshalb als gerechte Strafe. Sie gab sich die größte Mühe, es allen recht zu machen, und hoffte verzweifelt, dass ihre Familie ihr irgendwann verzeihen und ihr die Liebe entgegenbringen würde, nach der sie sich mehr als alles andere sehnte. Aber sie durfte sich nicht so treiben lassen, sondern musste sich zusammennehmen.
Ohne weiter auf den Gestank zu achten, der durch die feuchte Schwüle noch verstärkt wurde, wandte sich Marie nun wieder den bunt gekleideten Menschen zu, die durch die Gasse eilten. Mitten im Gewühl entdeckte sie auch einen grauen Schecken, der einen breiten, mit Zunder beladenen Wagen zog und dabei die genüsslich vor ihm im Schlamm suhlenden Schweine aufschreckte.
Das Fell des kräftigen Pferdes glänzte vor Schweiß, als es gehorsam die Befehle seines Herrn befolgte, doch dann steckte es fest.
Direkt vor dem Wagen war eine Bande halbwüchsiger Gassenjungen gerade damit beschäftigt, mit Holzstecken in der Hand eine neue Rangordnung unter sich auszukämpfen, und unternahm daher keinerlei Anstalten, zur Seite zu treten, um das Fuhrwerk vorbeizulassen.
»Gebt endlich den Weg frei, ihr nutzlosen Kakerlaken«, schimpfte der Zunderhändler.
In seinem mehrfach gestreiften Überrock war er eine imposante Erscheinung, zumal er seine Worte auch noch unterstrich, indem er drohend die lange Peitsche hob.
Die Jungen bedachten ihn ihrerseits mit unflätigen Worten, gaben dann aber endlich nach und drückten sich eng an die Häuserwände, um den Wagen passieren zu lassen.
Plötzlich blitzte ein Feuerstrahl in der Hand eines der Jungen auf. Mit geübtem Griff entzündete er ein kleines Stück Zunder, das er aus seinem Beutel gezogen hatte, an einem Feuerstein, rannte hinter dem Zunderhändler her und warf den glimmenden Zunder auf den Wagen. Danach lief er, gefolgt von seinen Freunden, blitzschnell davon, um das weitere Geschehen aus sicherer Ferne zu verfolgen.
Voller Entsetzen konnte Marie beobachten, wie der Zunder Feuer fing und die Flammen sich in rasendem Tempo auf dem Wagen ausbreiteten.
Der Händler hob schnuppernd den Kopf und wandte sich, beunruhigt über den Brandgeruch, nach hinten. Die Ware auf dem Wagen stellte seinen gesamten Besitz da. Wenn er sie verlor, würden er und seine Familie den Winter über hungern müssen.
Als er sah, dass der Zunder auf dem Wagen brannte, kam Bewegung in seine behäbige Gestalt. Er sprang vom Kutschbock und begann verzweifelt und auf allen vieren die Zunderlappen, die bereits Feuer gefangen hatten, aus dem Wagen zu werfen. Dabei achtete er weder auf sein Pferd, das, beunruhigt durch den Brandgeruch, mit den schweren Hufen scharrte, noch auf seine Hände, an denen sich die ersten Brandblasen zeigten. Die Wut auf die verdammten Gassenjungen ließ ihn seine Schmerzen vergessen. Wie eine Wanze würde er jeden einzelnen von ihnen zerquetschen, wenn er ihn zwischen die Finger bekäme. Doch dazu blieb keine Zeit mehr. Er musste jetzt handeln.
Laut fluchend versuchte er zu retten, was noch zu retten war. Monatelang hatte er mit seinen Söhnen nach den begehrten Schwämmen gesucht und sie mühsam von den Bäumen geschnitten. Während seine Frau den minderwertigen gemeinen Feuerschwamm und den rotrandigen Baumschwamm zu Kappen, Hausschuhen und Trinkbechern weiterverarbeitete, hatte er die Zündwilligkeit der aus den Baumschwämmen gewonnenen Zunderlappen durch Einlegen in Urin und Holzaschenlauge verbessert, sie mit Holzschlägeln breit geklopft und anschließend zum Verkauf in gleich große Stücke geschnitten. Besondere Sorgfalt hatte er den höherwertigen Baumschwämmen zukommen lassen, die wegen ihrer blutstillenden Wirkung bei der Wundbehandlung unersetzlich waren. Mit der Arbeit eines halben Jahres auf dem Wagen hatte er schließlich den weiten Weg in die Stadt angetreten. Die Städter waren auf seinen Zunder angewiesen, da die Wälder in der näheren Umgebung längst abgeholzt und mit ihnen zusammen auch die Baumschwämme verschwunden waren.
Der Holzverbrauch der Städter war so hoch wie nie zuvor. Allein für den Bau einer einzigen der unzähligen Kirchen wurde das Holz von ungefähr zwanzigtausend Eichen benötigt. Die Städter benötigten außerdem immer mehr Holz für Kisten, Truhen, Besteck, Badezuber und Kerzenleuchter. Auch der Bedarf zum Kochen und Heizen im Winter stieg ständig weiter an. Dazu kam noch der Verbrauch der Handwerker.
Die Schmieden brauchten Holz für ihre Öfen, genauso wie die Bäcker, Töpfer, Kutschen-, Schiffs- und Brückenbauer. Doch am meisten Holz verbrauchten die Köhler, die das Holz zur Kohle verschwelten und damit die Ziegel- und Kalkbrennereien, aber auch die Salinen im Umkreis belieferten.
Einige Funken sprangen auf den Überrock des Händlers, der sofort zu brennen begann. Zwar versuchte er eilig, sich den brennenden Umhang vom Leib zu reißen, doch dazu musste er sich erst einmal wieder aufrichten.
Im gleichen Moment verlor das Kutschpferd endgültig die Nerven. Angstvoll schnaubend raste es in blanker Panik los. Durch den plötzlichen Ruck, mit dem sich der Wagen in Bewegung setzte, verlor der Zunderhändler das Gleichgewicht und stürzte rückwärts in den brennenden Zunder.
Der herrenlos gewordene Wagen raste in vollem Tempo auf den Marktplatz zu, der um diese Zeit hoffnungslos überfüllt war.
Fahrendes Volk und allerlei Gesindel hatten sich dort unter die Handwerker, Kaufleute und Bauern gemischt. Die Menschen, die den Markt aufgesucht hatten, um zu kaufen, Beziehungen zu knüpfen oder einfach nur ein Schwätzchen zu halten, ahnten nichts von der Gefahr auf vier Rädern, die auf sie zukam.
Ahnungslos bemühten sie sich darum, einen Platz im Schatten zu finden, um so wenig wie möglich von der gnadenlos brennenden Sonne abzubekommen. Dicht gedrängt umrundeten sie feilschend und streitend die verschiedenen Händler, Handwerker und Kesselflicker, die ihre Waren teils in überdachten Buden, teils auf grob gezimmerten, auf Böcken aufliegenden Ladentischen feilboten, an denen farbig bemalte Schilder mit den Namen der Standbesitzer hingen.
Die Standbesitzer, deren Stände in der prallen Sonne standen, versuchten durch das provisorische Aufspannen von Tüchern etwas Schatten zu erhalten, was den Nachteil besaß, dass der Blick auf die feilgebotenen Waren stark eingeschränkt wurde. Aus diesem Grund priesen sie lauthals ihre Waren an, um die Aufmerksamkeit der Leute doch noch auf sich zu lenken. Es war ein fast aussichtsloser Versuch, den vorherrschenden Lärm von Menschen und Tieren zu übertönen.
Der Wagen hatte jetzt das Ende der schmalen Gasse erreicht, die sich öffnete und direkt in den Marktplatz mündete. Das schrille Kreischen des Zunderhändlers, dessen Kleider lichterloh brannten, steigerte die Panik des Pferdes noch mehr. Als das Tier dem ersten Stand auswich, geriet der Wagen ins Schleudern. Er überschlug sich und zerbarst mit lautem Krachen in mehrere Einzelteile. Brennende Zunderlappen mischten sich mit den umherspritzenden Holz- und Eisenstücken und flogen in die Menge, die sich verzweifelt vor den Pferdehufen in Sicherheit zu bringen versuchte.
Der Zunderhändler wurde aus dem Wagen geschleudert und knallte gegen den Zaun eines Töpferstandes, wo er bewusstlos liegen blieb, während sich das mächtige Kutschpferd blind vor Angst weiter in die vor Panik schreiende Menschenmenge drängte, der nur wenig Platz zum Ausweichen blieb. Und so nahm das Unglück seinen Lauf.
Eine Frau, mit einem kleinen Mädchen an der Hand, sank getroffen von einem Hufschlag zu Boden. Ihre Tochter wurde zur Seite geschleudert, wo sie still und mit seltsam verdrehten Gliedern liegen blieb.
Der Kaufmann Pierre Gilbert achtete nicht auf die ängstlichen Schreie hinter sich, denn er war gerade auf dem Weg in die gegenüberliegende Schenke.
Ein kühler Krug Wein würde genau das Richtige sein, um seine ausgedörrte Kehle zu befeuchten. Zufrieden mit dem Geschäft, das er im Zelt des Gewürzhändlers gerade abgeschlossen hatte, war er ins Freie getreten und blinzelte noch immer in die Sonne, weil sich seine Augen noch nicht an das grelle Tageslicht gewöhnt hatten.
Da tauchte plötzlich wie aus dem Nichts das mächtige Kutschpferd vor ihm auf. Abwehrend hob er die Arme und fuchtelte wild mit ihnen durch die Luft.
Das Pferd bäumte sich erschrocken auf und wieherte schrill.
Trotz seiner Körperfülle erwies sich der Kaufmann als äußerst beweglich. Blitzschnell warf er sich zur Seite, noch bevor die schweren Hufe des Pferdes wieder den Boden berührten und es seine wilde Flucht fortsetzte.
Auf seinem Weg zertrampelte es alles, was ihm in die Quere kam. Buden und Stände brachen zusammen, Splitter und Verkaufsgegenstände flogen durch die Luft und verletzten auch Menschen, die nicht unmittelbar die Bahn des Tieres gekreuzt hatten. Mit großen Sprüngen setzte der verängstigte Schecke über Verkaufstische, wich mit Stöcken fuchtelnden Menschen aus und überrannte dafür andere, die nicht schnell genug etwas zur Hand hatten, womit sie das Pferd abwehren konnten, bis es endlich das andere Ende des Marktplatzes erreicht hatte und in eine ruhige Gasse gelangte. Schwer atmend und aus mehreren Wunden blutend blieb es zitternd vor Angst stehen.
Marie hielt es nicht länger in ihrer Kammer. Ohne weiter darüber nachzudenken, dass es ihr verboten war, das Haus zu verlassen, lief sie die schmale Treppe hinunter und folgte dem Wagen.
Nach wenigen Minuten erreichte sie den Markt und sah entsetzt auf die Verheerung, die durch den dummen Streich der Gassenjungen ausgelöst worden war. Eine Schneise der Zerstörung zog sich mitten durch den Marktplatz, und überall lagen mehr oder weniger schwer verletzte Menschen auf dem Boden.
Maries Herz zog sich vor Mitleid zusammen, als sie auf den Zunderhändler zulief, der gerade wieder stöhnend zu sich kam.
Trotz der Hitze begann sie zu frieren, ihr Atem ging stoßweise, und ihr war zum Weinen zumute.
Die Blicke der Menschen folgten dem zierlichen Mädchen, dessen außergewöhnliche Schönheit sie sofort in ihren Bann zog. Ihre helle, durchscheinende Haut ließ sie noch zarter wirken, und ihre Bewegungen waren voller Anmut, als sie sich über den schwer verletzten Mann beugte.
Eine alte Frau bekreuzigte sich mehrmals hintereinander. Sie war ärmlich gekleidet, und die Gicht hatte ihren Rücken so verkrümmt, dass sie ihren Hals verbiegen musste, um geradeaus sehen zu können.
»Ein Engel ist vom Himmel herabgestiegen«, murmelte sie und fuhr fort, sich zu bekreuzigen, während ihre Blicke dem Mädchen folgten.
Der Zunderhändler lag hilflos auf dem Rücken und erinnerte an eine fette Küchenschabe.
»Meine Beine«, schrie er verzweifelt. »Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen.«
Marie strich ihm mitfühlend über die verschwitzte Stirn, die vom Ruß geschwärzt war, und begann, seine Verletzungen zu untersuchen. Die Haut des Mannes wies schwere Verbrennungen auf und war überall mit Brandblasen überzogen, die an manchen Stellen bereits aufplatzten.
Mit dem Erwachen aus der Bewusstlosigkeit waren auch die unsäglichen Schmerzen wieder zurückgekehrt.
Ein gequälter Ausdruck verzerrte seine Züge, verwandelte sich aber in ehrfürchtiges Staunen, als er in die schönen Augen des Mädchens blickte, die dunkel und tiefgründig waren. Auch ihm erschien das Mädchen wie ein Engel.
»Bin ich im Himmel?«, fragte er heiser. Marie musste lächeln und schüttelte sanft ihren Kopf. Sie spürte, wie die Schmerzen des Händlers von ihrem Körper Besitz ergriffen und ihre Sinne langsam schwanden.
Im Gegenzug begannen sich die Züge des Zunderhändlers immer mehr zu entspannen, bis das Mädchen schließlich bewusstlos neben ihm zusammensank und wie von unsichtbaren Händen geschüttelt wurde. Ihre unschuldigen, schönen Züge hatten nichts mehr mit der Fratze gemein, zu der sich ihr Gesicht jetzt verzerrte. Heller Schaum rann ihr aus den Mundwinkeln, während immer neue Krämpfe ihre Glieder in bizarr wirkende Zuckungen versetzten.
Der Zunderhändler erhob sich schwerfällig und strich sich die vom Rauch geschwärzten Haare aus der Stirn. In seinem Gesicht stand ein Ausdruck von Ungläubigkeit geschrieben, als er auf seine Hände herabsah. Seine Schmerzen waren vollständig verschwunden, genau wie die Brandblasen an seinen Händen. Eine nie gekannte Leichtigkeit beschwingte ihn. Es war wie ein Wunder.
Eine rasch größer werdende Menschenmenge umringte ihn und das Mädchen. In den Gesichtern der Menschen standen Sensationslust und Neugier.
Ein kleinwüchsiger Narr mit viel zu großem Kopf und spitzen, abstehenden Ohren drängte sich entschlossen nach vorne. Die Zuschauer wichen zurück, als er auf krummen Beinen um das bewusstlose Mädchen herumsprang und obszöne Grimassen in die Menge schnitt.
Als er sich der Aufmerksamkeit aller sicher war, die er wie die Luft zum Atmen brauchte, begann er in einer übertriebenen Darstellung, die Zuckungen des Mädchens zu imitieren, und stieß dabei kurze, schrille Schreie aus, die direkt aus der Tiefe der Hölle zu kommen schienen.
Ein bösartiger, hässlicher Kobold aus der Unterwelt, der für Satan tanzte. »Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, flüsterte die krumm gewachsene Frau von vorher ängstlich ihrer Nachbarin zu, doch obwohl sie große Angst hatte, gelang es ihr dennoch nicht, ihren Blick von dem traurigen Schauspiel abzuwenden.
»Es ist Teufelswerk«, kreischte eine dürre Person nicht weit von ihr entfernt und wies mit dem Finger auf das zuckende Mädchen. »Die Dämonen der Hölle sind in sie gefahren und zeigen endlich ihr wahres Gesicht.«
Der Zunderhändler war kein gelehrter Mann. Er konnte weder lesen noch schreiben und hatte das Denken über höhere Dinge bisher dem Klerus überlassen. Aber nun beschlich ihn ein eigenartiges Gefühl, und es war ihm, als ob eine Stimme in seinem Inneren ihm befehlen würde, das Mädchen vor dem lärmenden Mob zu beschützen.
»Weiß irgendjemand, wer sie ist?«, fragte er und durchbrach damit für einen Moment die sich langsam aufbauende ungute Stimmung.
»Sie ist die Tochter des Tuchhändlers Jean Machaut, der erst vor wenigen Jahren in die Stadt gekommen ist. Sein Haus befindet sich dort drüben in der Kaufmannsgasse«, antwortete eine Frau.
Ohne sich weiter um die Menge zu kümmern, hob der Kutscher das Mädchen daraufhin hoch und lief mit weit ausholenden Schritten auf die angegebene Gasse zu. Er machte sich große Sorgen um sein Pferd, doch zuerst wollte er das Mädchen in Sicherheit bringen.
Schon von Weitem sah er das Zunftzeichen des Tuchhändlers, das auf ein Schild neben dem Eingang gemalt war. Noch bevor er klopfen konnte, wurde ihm die Türe bereits von Elsa geöffnet, der nicht entgangen war, dass Marie das Haus verlassen hatte.
Seitdem hatte sie immer wieder ihre Arbeit unterbrochen und war ans Fenster getreten, um in die Gasse hinunterzusehen, in der Hoffnung, Marie dort zu entdecken, bevor Eleonore ihr Verschwinden bemerken würde.
Es war noch nie vorgekommen, dass das Mädchen sich den Anordnungen seiner Mutter widersetzt hatte, und Elsa machte sich ernsthafte Sorgen. Ihre Sorge wuchs noch mehr, als sie Marie nun in den Armen des nach Rauch stinkenden und von Ruß geschwärzten Zunderhändlers entdeckte. In seinen dunklen Augen stand die Angst um Marie, aber auch seine Unsicherheit deutlich geschrieben. Die Situation, in der er sich befand, schien ihm allerdings wenig zu behagen.
Ruhig und bestimmt forderte Elsa ihn auf, ihr zu folgen, und wies ihm den Weg zu Maries Kammer. Behutsam, als wäre sie zerbrechlich, legte der Mann das Mädchen auf das große Bett. Anschließend wurde er von Elsa wieder zur Tür begleitet.
»Sie ist ein Engel«, begann der Mann, aber Elsa gebot ihm zu schweigen. Warnend legte sie einen Finger auf ihren Mund und lauschte nach unten. Doch zu ihrer Erleichterung drang kein Laut aus den unteren Geschäfts- und Lagerräumen zu ihnen nach oben.
»Geht jetzt«, wies sie ihn an. »Ich muss mich um Marie kümmern.«
So leise wie möglich schloss sie die Türe hinter dem Zunderhändler und lief dann zurück in die Küche, wo sie gerade damit beschäftigt gewesen war, das Mittagessen vorzubereiten. Sie stellte den schweren Eisenkessel mit dem Gemüseeintopf zur Seite und machte sich sofort daran, Bitterwurz und Alraune aufzukochen. Dann eilte sie nach oben, um Marie den stärkenden und beruhigenden Trank zu verabreichen. Mit ein bisschen Glück würden Maries Mutter und ihre Schwester nichts bemerken, und Marie würde einer Strafe ob ihres Ungehorsams entgehen.
4
Elsas Hoffnung wurde jedoch enttäuscht, denn Katharina erschien plötzlich an der Tür der Kammer. Jacques, ihr Verlobter, hatte sich für den heutigen Tag angemeldet, er wollte mit ihrem Vater den anstehenden Hochzeitstermin besprechen, und Katharina war nach oben gekommen, um sich noch ein wenig herauszuputzen und vor allem das kostbare, mit Almandinen verzierte Fibelpaar anzulegen, das er ihr zur Verlobung geschenkt hatte.
Als sie Marie nun von Krämpfen geschüttelt auf dem Bett liegen sah, verzog sich ihr Gesicht vor Abscheu. Es dauerte nur einen Moment, bevor sie zu begreifen anfing.
»Sie ist nicht in der Kammer geblieben, wie Mutter es befohlen hat«, bemerkte sie kühl und überlegte, ob diese Erkenntnis von Nutzen für sie sein könnte. Doch dann wurde ihr einmal mehr bewusst, dass sie sich selbst ins eigene Fleisch schneiden würde, sobald sie Marie verpetzte. Denn wenn Jacques auch nur das Geringste davon erfuhr, würde er sie nicht mehr heiraten, das stand fest.
Aufgeregt drehte sie sich um und rannte die steile Treppe hinunter, um mit ihrer Mutter zu beratschlagen, wie man verhindern konnte, dass er etwas von Maries Krankheit erfuhr.
Eleonore blickte Katharina missbilligend entgegen, als diese mit hochrotem Kopf in den Lagerraum gestürmt kam, wo sie mit Argusaugen über die Angestellten ihres Mannes wachte, die gerade dabei waren, die von verschiedenen Kunden bestellten Stoffballen zusammenzustellen und auf einen Wagen zu schaffen.
»Dein Benehmen entspricht nicht dem, was ich dich gelehrt habe«, wies sie Katharina in scharfem Ton zurecht.
Aber Katharina ließ sich dadurch nicht einschüchtern und sah ihre Mutter entschlossen an.
»Ich muss sofort mit Euch reden«, forderte sie und bedachte die beiden Männer, die ihre Arbeit unterbrochen hatten und sie neugierig anstarrten, mit einem hochmütigen Blick.
»Zuallererst werden wir die Bestellungen hier fertig machen. Du weißt, wie ungeduldig dein Vater sein kann, wenn es Verzögerungen gibt und nicht alles nach seinem Plan verläuft«, erwiderte Eleonore kühl.
Henry, ein gut aussehender Bursche, grinste Katharina daraufhin schadenfroh an. Es war noch nicht lange her, dass sie seine bewundernden Blicke genossen hatte, doch seit ihrer Verlobung mit dem Grafen sah sie durch ihn hindurch, als wäre er Luft. Henry konnte zwar nicht lesen und schreiben, aber immerhin war er sehr geschickt im Umgang mit Zahlen. Und so war es ihm im Laufe der Jahre gelungen, sich zur rechten Hand seines Herrn hochzuarbeiten, der zu seinem großen Kummer keinen leiblichen Sohn besaß.
Bis zur Verlobung Katharinas hatte er die stille Hoffnung gehegt, sie eines Tages heiraten zu dürfen.
Katharina war eine Schönheit, auch wenn sie in seinen Augen ein wenig zu hochnäsig war. Ihr langes, dunkelblondes Haar hatte sie ebenso wie die glänzenden, goldbraunen Augen von ihrer Mutter geerbt, und nachts, wenn er in seiner Kammer auf dem Stroh lag und sich vorstellte, wie sich ihr weicher Mädchenkörper mit dem festen Busen wohl anfühlen würde, schoss ihm jedes Mal das Blut in die Lenden, und seine sündigen Gedanken begannen sich zu verselbstständigen. In Gedanken ritt er sie dann so lange, bis sich ihre Hochnäsigkeit in wilde Leidenschaft verwandelte und sie sich stöhnend vor Lust unter ihm zu winden begann, genauso wie Emma, die Magd des Gewürzhändlers, es tat, die er des Öfteren an seinen freien Abenden traf.
Anfangs hatte er wegen seiner lüsternen Gedanken an den darauf folgenden Tagen immer ein schlechtes Gewissen gehabt und einen großen Bogen um die Kathedrale geschlagen.
Aber sein Gewissen hatte sich im Laufe der Zeit beruhigt, und er tröstete sich damit, dass Gott ganz sicher anderes zu tun hatte, als sich um einen so unwichtigen Mann wie ihn zu kümmern. Gewiss waren seine Verfehlungen nicht einmal von Ihm bemerkt worden.
Jedenfalls geschah es Katharina ganz recht, wenn einmal etwas nicht nach ihrem Willen lief.
Noch immer vor sich hin grinsend, warf er sich einen Ballen kostbaren Tuches über die Schulter und schaffte ihn zum Wagen, der sich aus Sicherheitsgründen in dem von einer hohen Brandmauer umgebenen Hof direkt hinter dem Haus befand.
Pierre, der Knecht mit dem dümmlichen Gesichtsausdruck, folgte ihm.
Katharina war jetzt mit ihrer Mutter allein.
»Marie hat heimlich die Kammer verlassen und wieder einen ihrer Anfälle bekommen. Was sollen wir nur tun? Wenn Jacques davon erfährt, wird er mich ganz sicher nicht mehr heiraten«, jammerte sie. Ihre Stimme wurde flehend. »Ich bitte Euch, unternehmt etwas, Mutter.«
Eleonore seufzte gedankenverloren und nickte dann. Katharinas Angst war durchaus berechtigt. So konnte und durfte es nicht weitergehen. Dass Marie die Kammer entgegen ihrer Anordnung verlassen hatte, war schon schlimm genug, und sie würde mit aller Härte durchgreifen müssen, um sich wieder den nötigen Respekt zu verschaffen.
Aber Maries Krankheit wurde ihr langsam unheimlich. Bereits als kleines Kind hatte sie unter diesen merkwürdigen Anfällen gelitten, und weder Bader noch Magister hatten einen Rat gewusst, sondern Eleonore nur an einen Priester verwiesen, der jedoch ebenso ratlos gewesen war. Der Geistliche hatte Marie mit Weihwasser besprengt, wobei er sorgfältig darauf achtete, sie nicht zu berühren, und den Dämonen in ihrem Körper befohlen, im Namen des Herrn wieder daraus zu verschwinden. Anschließend hatte er den Machauts empfohlen, ihre Gebete durch das Spenden von Wachskerzen zu unterstützen, und sie alle ermahnt, ein tugendhafteres Leben zu führen.
Danach war Marie tatsächlich für eine Weile von den Krämpfen verschont geblieben, und Eleonore hatte schon gehofft, dass es endgültig mit ihnen vorbei wäre, doch ihre Hoffnung hatte sich als trügerisch erwiesen.
Abgesehen von ihren vereinzelt auftretenden Anfällen, verhielt sich Marie allerdings vollkommen normal und zeigte keinerlei Anzeichen von geistiger Verwirrtheit, wie sie besessene Menschen sonst oft aufwiesen.
In ihrer Familie hatte es, soweit sie wusste, niemals Krankheiten dieser Art gegeben, und ihr Mann sprach mit ihr nicht über seine Familie, die sie nie kennengelernt hatte. Das Einzige, was ihr Jean jemals erzählt hatte, war, dass seine Eltern verstorben waren, als er noch ein Kind gewesen war. Danach war er bei seinem Onkel aufgewachsen, einem strengen, gottesfürchtigen Mann, der ihn jeden Tag geschlagen hatte und ihn von morgens bis abends in seiner Färberei hatte schuften lassen.
Einmal nur hatte sie es dennoch gewagt, ihn nach seiner Familie zu fragen, damals, vor sechs Jahren, als Marie das erste Mal Anzeichen ihrer merkwürdigen Krankheit gezeigt hatte, woraufhin Jean mit einer solch abweisenden Kälte auf ihre Fragen reagiert hatte, dass sie ihn nie wieder darauf angesprochen hatte.
Doch Maries Krankheit war zu einem ernsthaften Problem geworden, für das sie bald eine Lösung finden mussten.
Katharina war jedoch noch immer nicht zufrieden, sie wollte, dass Marie für das, was sie ihnen allen antat, bezahlen musste.
»Sicher hat sie es mit Absicht gemacht, weil sie mir Jacques nicht gönnt und mein Leben zerstören will«, hetzte sie weiter. »Ihr müsst sie einsperren und ihr verbieten, das Haus zu verlassen, wenigstens bis zur Hochzeit«, drängte sie.
»Ich werde heute noch mit deinem Vater darüber sprechen«, beschwichtigte Eleonore ihre Tochter. »Doch jetzt geh wieder an deine Arbeit. Dein Vater wird sehr wütend sein, wenn wir nicht fertig werden und er morgen früh nicht pünktlich aufbrechen kann.«
Sie gab Henry, der zurückgekommen war, noch einige Anweisungen. Dann erhob sie sich, um mit Elsa noch einmal die Speisenfolge für das bevorstehende Nachtmahl durchzugehen; immerhin hatten sie heute Abend einen wichtigen Besucher bei sich zu Gast.
Lustlos begab sich Katharina in den dunklen Lagerraum zu ihren Schwestern, in dem es aus Sicherheitsgründen keine Fenster, sondern lediglich einen nach außen hin offenen, schmalen Lichtschacht gab, der die Luftzufuhr gewährleistete.
Ihr Vater hatte ihnen aufgetragen, ein purpurfarbenes Kreuz auf einen kostbaren, golddurchwirkten Schal zu sticken, der von einem Baron in Flandern für den Altar seiner Kapelle bestellt worden war. Allein der Stoff kostete schon ein kleines Vermögen.
Aus diesem Grund mussten sie nun auch in dem nur von Kienspänen beleuchteten Kontor sitzen, damit Eleonore besser darauf achten konnte, dass ihnen kein Fehler unterlief. Wenn sie mit dem Schal fertig wären, würden sie endlich wieder in der Stube nähen können, wo man immerhin ab und zu einen Blick aus dem Fenster werfen konnte und sich nicht ganz so vom Leben ausgeschlossen fühlte.
Während ihre Finger geschickt die feine Knochennadel führten, die aus dem hinteren Wadenbein eines Schweins hergestellt worden war, glitten ihre Gedanken für einen Moment lang zu ihrer gemeinsamen Zukunft mit Jacques ab.
Seine Familie war entfernt mit der von Johanna von Toulouse verwandt, der Gemahlin Alfons von Poitiers, der seinerseits wiederum ein Bruder König Ludwigs IX. war. Jacques besaß drei Tagesreisen von Bourges entfernt, in der Nähe von Poitiers, eine kleine Burg mit bescheidenen Ländereien. Er war der jüngste von drei Söhnen und hatte sich im Gegensatz zu seinen Brüdern erfolgreich dagegen gesträubt, ein Ritter zu werden oder ins Kloster zu gehen.
Von klein auf hatte es ihn in die Ferne gezogen, und mit einigem Geschick und etwas Glück war es ihm schließlich durch den sich ständig weiter ausbreitenden Fernhandel gelungen, ein Vermögen zu verdienen.
Jahrelang war er quer durch ganz Asien gereist und hatte dort kostbare Seidenstoffe erstanden, die er nun, wieder nach Frankreich zurückgekehrt, teuer weiterzuverkaufen gedachte.
Seine Ware transportierte er, soweit es möglich war, auf dem Seeweg, um so die immer zahlreicher werdenden Zollstationen zu umgehen. Nachdem er außerdem mehrere Niederlassungen von Marseille über Damaskus bis hin zu Shanghai aufgebaut hatte, konnte er es sich nunmehr leisten, seine Güter auf die beschwerliche Reise nach China zu schicken und nur noch an Großhändler zu verkaufen.
Einer dieser Großhändler war Jean Machaut, der sich auf edles und ausgefallenes Tuch wie Seide, Brokat, Damast, Baldachin und Scharlach spezialisiert hatte, mit dem er wiederum kleinere Händler belieferte, die ihrerseits die Stoffe anschließend an reiche Bürger und Adlige weiterverkauften.
Bereits bei seinem ersten geschäftlichen Besuch hatte Jacques beschlossen, Jean Machauts Tochter Katharina zu heiraten.
Ihre kühle Schönheit gefiel ihm, und er konnte sie sich gut als Mutter seiner zukünftigen Söhne vorstellen. Sein Vater war vor einiger Zeit verstorben, und sein ältester Bruder hatte seinen Platz als Graf und Burgherr eingenommen. Durch sein Vermögen war Jacques unabhängig, und seine Mutter versuchte erst gar nicht, ihn zu einer standesgemäßen Heirat zu zwingen, nachdem er ihr mehr als deutlich klargemacht hatte, dass er lieber wieder auf Reisen gehen würde, als sich dieser Forderung zu beugen.
Und so hatte er sich ein großes Steinhaus am Rande der Stadt bauen lassen, von dem aus er auch seine Geschäfte tätigte, und beschlossen, dass es nun an der Zeit wäre, seine eigene kleine Familie zu gründen und den ersehnten Erben zu zeugen.
Zwar war es durchaus möglich, dass er früher oder später durch seinen Beruf als Kaufmann seine Privilegien als Adliger verlieren würde, doch das nahm er billigend in Kauf.
Auf seinen Reisen hatte er viel gelernt, und er betrachtete es als Glück, in einer Zeit zu leben, in der alles möglich war. Unfreie und Leibeigene konnten mittlerweile ihre Freiheit und sogar das Bürgerrecht erlangen, indem sie in die Städte zogen. Mit etwas Glück konnten sie es dort darüber hinaus zu so viel Reichtum bringen, dass manch ein Adliger, der hochnäsig in seiner Burg saß und sich weigerte, die vielen Veränderungen, die in seinem Land vor sich gingen, wahrzunehmen, blass vor Neid wurde.
Menschen wie Jean Machaut gehörte sein ganzer Respekt und seine Bewunderung, denn sie hatten es aus eigener Kraft heraus geschafft, Besitz zu erlangen, und waren für viele ihrer Zeitgenossen, die sich bis dahin ergeben in ihr Schicksal gefügt hatten, zu Hoffnungsträgern geworden.
Die Reisen, die Jacques unternommen hatte, hatten seinen Horizont erweitert und ihm neue, aber auch gefährliche Denkanstöße geliefert, die, hätte die Kirche Kenntnis von ihnen erhalten, mit Sicherheit von ihr als ketzerisch verdammt worden wären. Schade war nur, dass er in den Ländern, die er bereist hatte, nur selten auf jemanden gestoßen war, mit dem er sich hatte austauschen können, auf jemanden wie den Großkahn, dem er in China begegnet war und der ihn eingeladen hatte, sein Gast zu sein.
Mangu Khan war in der Tat ein ungewöhnlicher, wenn auch grausamer Mann, der von dem Gedanken besessen war, alles, was in der Welt vor sich ging, zu erfahren. Aus diesem Grund hatte er auch regelmäßig Angehörige der verschiedensten Religionen zu gelehrigen Disputationen an seinen Hof eingeladen, in der Hoffnung, dadurch zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.
Jeder der Geladenen war überzeugt davon gewesen, dass seine Religion die einzig wahre wäre. Mangu Kahn hatte nur gelächelt, sobald die Dispute immer hitziger geworden und zuletzt in wüste Beschimpfungen ausgeartet waren.
Erst dann hatte er seinen Gästen mit lauter Stimme zu schweigen befohlen und so lange gewartet, bis Stille in den prunkvollen Saal eingekehrt war. Mit mahnenden Worten hatte er sodann die Debatte abgebrochen.
»So wie Gott der Hand verschiedene Finger gab, so gab Er den Menschen verschiedene Wege. Euch gab Gott die Heilige Schrift, aber ihr Christen richtet euch nicht danach. Uns aber gab Er Weissager, und wir tun, was sie uns sagen, und wir leben in Frieden.«
Wie oft hatte Jacques schon darüber nachgedacht, ob seine Landsleute wohl anders gewesen wären, wenn sie wie er das Glück gehabt hätten, ferne Länder und Menschen mit fremden Religionen kennenlernen zu können. Anfangs waren diese alle Heiden und Ungläubige für ihn gewesen, doch dann hatte ihn die demütige Inbrunst ihres Glaubens beeindruckt, mit der die Chinesen ihren Buddha verehrten und die Sarazenen und Mauren ihren Mohammed. Sie hatten ihre eigene Religion und würden niemals einen anderen Glauben annehmen.