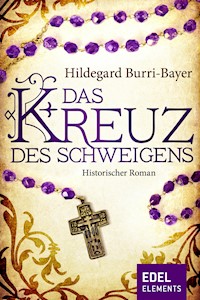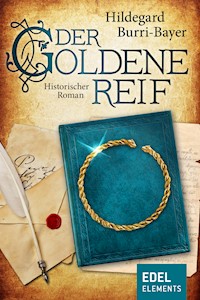4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karl der Kühne von Burgund hat große Pläne mit seiner Tochter Maria. Durch Heirat soll sie das Reich und die Stellung Burgunds gegenüber seinem mächtigsten Gegner, den König von Frankreich, sichern. Die möglichen Verlobten kommen und gehen, Bündnisse werden geschlossen und wieder gebrochen. Maria ahnt zunächst nichts von der verbissenen Heiratspolitik, die sich hinter ihrem Rücken abspielt. Aber als zwei Bewerber nacheinander offiziell um ihre Hand anhalten und vergiftet werden, wird Maria schmerzhaft bewusst, dass sie in dem Gerangel um Macht und Land nur eine Schachfigur ist. Als sich Maria jedoch in Maximilian, den Sohn Kaiser Friedrichs III. und nächsten Heiratskandidaten, verliebt und er sich in sie, überschlagen sich die Ereignisse. Karl der Kühne fällt in der Schlacht von Nancy und der König von Frankreich zögert nicht seine Ansprüche auf Burgund geltend zu machen. Durch eine hinterhältige Intrige treibt er einen Keil zwischen Maria und die Vertreter der Generalstaaten, der Marias treueste Ratgeber zum Opfer fallen. Gleichzeitig will eine Bande aufsässiger Genter ihre Heirat mit Adolf von Geldern erzwingen und ihre Schwiegermutter Margarete sie mit dem Herzog von Clarence verheiraten. Völlig isoliert nimmt Maria den Kampf gegen ihre übermächtigen Gegner auf, bis ihr Maximilian mit einer List schließlich zu Hilfe eilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch:
Gent, 1472. Um die Hand von Maria, der Tochter Karls des Kühnen, halten zahllose Männer aus dem ganzen Herzogtum an. Doch die starke junge Frau will nicht zur Marionette im politischen Ränkespiel ihrer Berater werden. Erst in Maximilian, den Sohn von Kaiser Friedrich III., verliebt sie sich wirklich. Die beiden tauschen glühende Liebesbriefe aus und wollen heiraten. Doch dann stirbt Marias Vater, und der Kampf um die Macht eskaliert …
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2009 by Hildegard Burri-Bayer Dieser Titel wurde vermittelt durch die Literaturagentur Lianne Kolf. Korrektorat: Martha Wilhelm Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
Für meinen Vater, der in unseren Herzen weiterlebt.
Es ist notwendig, dass ein Teil des Widerspruchs wahr sei; wenn es notwendig ist, alles entweder zu behaupten oder zu verneinen, können nicht beide zugleich falsch sein.
Aristoteles
PROLOG
Zweiter März im Jahre des Herrn 1468
Louvre, Paris
Der Anblick des Herzogs Karl von Guyenne und seiner Mätresse, die sich ganz offensichtlich in dem prunkvollen Bett vergnügten, war abstoßend und faszinierend zugleich.
So wie Gott den Tag und die Nacht erschaffen hatte, so hatte er auch schöne und weniger schöne Menschen erschaffen, dachte der Mörder in der grün-golden gestreiften Livree eines Dieners und starrte gebannt auf das Bild, das sich ihm bot. Der Gedanke an Gott behagte ihm dabei nicht ganz, und er zwang sich, ihn zur Seite zu schieben, was nicht weiter schwierig war, weil die aufsteigende Hitze in seinen Lenden ganz andere Vorstellungen in ihm wachrief.
Über den seidenen Kissen, nur wenige Ellen von ihm entfernt, breitete sich eine Flut rotblonder Locken aus, die bis zu den vollen, weiß schimmernden Brüsten Colette de Chambes reichten. Diese hielt ihre leicht schräg stehenden, grünen Augen geschlossen, und ihrem schönen Mund entrang sich ein Stöhnen, das den dürren, etwas verwachsenen Mann über ihr anzuspornen schien, denn seine Bewegungen wurden schneller. Sein Gesicht mit der spitzen Nase und dem ebenso spitzen Kinn war genauso hässlich wie sein Körper.
Fahle, durchscheinende Haut spannte sich über dünne Kinderknochen, deren Anblick unweigerlich an Krankheit und Tod denken ließ.
Die beiden schienen es eilig gehabt zu haben, ins Bett zu kommen, wie die über den gesamten Boden hinweg verteilten Kleidungstücke bezeugten, und sie hatten sich auch nicht erst die Mühe gemacht, die schweren Brokatvorhänge zuzuziehen, die das Bett umrahmten.
Ein grausames Lächeln umspielte den schmalen Mund des Mörders, als er die nackten, ineinander verschlungenen Körper der Liebenden betrachtete, deren Leidenschaft sie alles andere um sich herum vergessen ließ.
Vielleicht fällt es Colette ebenso schwer wie mir, den Anblick des Herzogs zu ertragen, und sie hält deshalb ihre Augen geschlossen, dachte er, und der Gedanke erfüllte ihn mit grimmiger Genugtuung.
Ohne besondere Eile stellte er die große Silberschale mit den duftenden Pfirsichen auf dem zierlichen Tisch vor dem Fenster ab, legte ein glänzendes Messer griffbereit daneben und verschwand dann ebenso lautlos, wie er gekommen war.
Am nächsten Morgen glich Paris einem brodelnden Hexenkessel. Die Gemüter der Menschen waren erhitzt, und Gerüchte liefen von Haus zu Haus, durch Garküchen, Schänken und sogar bis in die letzten Winkel der Stadtmauern, in denen die Bettler und Ausgestoßenen hausten.
Es hieß, Guyenne sei beim Schälen eines Pfirsichs mit einem vergifteten Messer zu Tode gekommen und der König selbst habe den Mord an seinem Bruder in Auftrag gegeben.
König Ludwig XI. lehnte sich zufrieden in seinem Thronsessel zurück und zog seinen scharlachroten, mit Zobelpelz gefütterten Umhang enger um seine Schultern. Der schwarze Turban, den er sonst nur bei offiziellen Anlässen trug, verdeckte seine fliehende Stirn und ließ seine Nase noch spitzer erscheinen, als sie es ohnehin schon war.
Er setzte eine betrübte Miene auf, als sein heimlicher Ratgeber Philippe Commynes den Saal betrat, obwohl er innerlich triumphierte. Philippe Commynes ging am burgundischen Hof ein und aus und galt als ein enger Vertrauter seines Erzfeindes Herzog Karl.
Ein Blick in die eng zusammenstehenden Augen des Königs genügte Philippe, um zu erkennen, dass dessen Trauer über den Tod seines Bruders nur gespielt war. Er fühlte sich unbehaglich, als er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt sah.
Ein Brudermord war ein abscheuliches Verbrechen, ein Verbrechen, das sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zog seit der Zeit, als Kain seinen Bruder Abel ermordet hatte.
Sein Unbehagen verstärkte sich nochmals, als er sich widerwillig eingestand, dass er nicht ganz unschuldig an Guyennes Tod war. Immerhin war er derjenige gewesen, der Ludwig von dessen hartnäckigen Bemühungen um Marias Hand unterrichtet hatte.
Siedend heiß wurde ihm bewusst, dass die Augen des Königs noch immer auf ihm ruhten, und es schien ihm, als hätte sich des Königs Blick dabei verfinstert, oder bildete er sich das nur ein?
Er zwang sich zu einem kühlen, unverbindlichen Lächeln und hoffte, dass sein Gesichtsausdruck ihn nicht verraten hatte. Unwillkürlich straffte er die Schultern. Seine Sinne waren aufs Äußerste gespannt, denn es war nicht ungefährlich, sich im Dunstkreis der Mächtigen aufzuhalten, und die langen Jahre am Hof Karls des Kühnen hatten sein Gefühl für Gefahr geschärft. Mittlerweile konnte er sie sogar schon riechen, wo sie für andere Menschen noch nicht einmal im Ansatz greifbar war. Wie jeder Mensch, der etwas zu verbergen hatte, konnte Ludwig nicht tatenlos hinnehmen, wenn ihn jemand durchschaute und dadurch unweigerlich zum Mitwisser seiner schändlichen Taten wurde.
Doch die nächsten Worte des Königs überraschten ihn.
»Wisst Ihr, mein lieber Commynes, ich habe fast den Eindruck, dass es Gott gefällt, manche Schwierigkeiten von mir zu nehmen. Sicher habt auch Ihr längst von meinem herrlichen Obstgarten gehört?«
Philippe Commynes schluckte hart, als Ludwig so offen auf die Gerüchte zu sprechen kam und Worte dafür fand, die keinem anderen Menschen in seiner Situation über die Lippen gekommen wären. Er schien sich nicht im Geringsten um seinen Ruf zu sorgen und den Schrecken, den er seinem Volk durch den heimtückischen Brudermord zugefügt hatte, allem Anschein nach auch noch zu genießen.
In leichtem Plauderton fuhr der König fort. »Es ist Zeit für das Mittagsmahl, würdet Ihr mir wohl die Ehre erweisen und mein Gast sein?«
Philippe Commynes verneigte sich tief und stumm und spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten.
Zu zweit nahmen sie an der Tafel Platz, deren Länge auf nicht mehr als zehn Personen ausgerichtet, heute aber nur für sie beide eingedeckt worden war. Ludwig liebte es, in kleinem Kreise zu speisen, wobei er seine Tischpartner jedoch sorgfältig auswählte.
Die Diener reichten Pastete und Wild, dazu frisches Gemüse, duftendes weißes Brot und gebratene Fische, dann entfernten sie sich auf einen Wink des Königs wieder.
»Gottes Wege sind unergründlich, findet Ihr nicht auch?«, eröffnete Ludwig das Tischgespräch mit vollem Mund und bekreuzigte sich schmatzend.
Philippe Commynes fühlte sich eigentümlich betroffen, als Ludwig den Namen Gottes aussprach.
Giftig wie eine Natter, spann Ludwig aus dem Hintergrund heraus seine tödlichen Fäden, in denen sich jeder, der ihm im Wege war, unweigerlich verfing.
Sein Bruder, der Duc de Guyenne, erster Anwärter auf die Krone, sollte Ludwig etwas passieren, stellte nun keine Bedrohung mehr für ihn und seinen neugeborenen Sohn Charles dar. Weder konnte er Charles die Krone streitig machen noch die Braut, die er ihm zugedacht hatte: Maria, die Erbin Burgunds, deren Glanz Frankreich wie einen leuchtenden Stern erstrahlen lassen würde.
»Was meint Ihr, mein Freund, könnten wir mit Herzog Karl einig werden, wenn wir ihm für die Hand seiner Tochter, sagen wir mal, Amiens und vielleicht auch noch St. Quentin abtreten würden?«, wechselte er abrupt das Thema.
Es klang beiläufig, als wäre ihm der Gedanke gerade erst gekommen, doch der gierige Ausdruck in seinen berechnenden schwarzen Augen entlarvte ihn.
Diese Frage war der endgültige Beweis für Philippe, dass er Recht gehabt hatte, was den Mord anging, aber auch, dass der König ihm vertraute, indem er sich keinerlei Mühe gab, seine ehrgeizigen Pläne vor ihm zu verbergen.
Ludwig hatte seine Maske endgültig fallen gelassen. In seinem blassen, etwas verweichlichten Gesicht waren weder Betrübnis noch Trauer zu erkennen, als er Philippe jetzt verschwörerisch zublinzelte.
Eine Welle der Erleichterung ging durch Philippes Körper, während er fieberhaft nach einer Antwort suchte, die Ludwig zufrieden stellen würde.
Er kannte die hochtrabenden Pläne des Herzogs von Burgund nur zu gut und wusste genau, dass Karl seine Erbtochter niemals mit Ludwigs Sohn verheiraten würde, solange er die Hoffnung hatte, durch eine Heirat Marias mit dem Kaisersohn Maximilian selbst noch die Königskrone zu erlangen, doch das konnte er Ludwig unmöglich sagen.
Er entschloss sich daher, diplomatisch vorzugehen.
»Wie Ihr wisst, kämpft der Herzog von Burgund an vielen Fronten, sodass der Weisheit Eurer Majestät viel Raum zum Handeln gelassen ist«, begann er schmeichelnd. »In dieser Angelegenheit sollte man deshalb den richtigen Moment abwarten, einen Moment der Schwäche, in dem der Herzog in seiner Entscheidungsfreiheit eingegrenzt ist. Genügend Feinde hat er sich ja schon geschaffen, selbst in den eigenen Reihen, und dazu die ständigen Unruhen an den verschiedenen Grenzen seines wahrlich unübersichtlichen Reiches. Noch hat er hochtrabende Pläne und nutzt alle Bewerber um Marias Hand für seine Zwecke, allen voran den Herzog von Lothringen. Solange er ihnen Hoffnungen machen kann, ist er ihrer Loyalität sicher, doch wie schnell kann sich das Blatt wenden und geht Glück in Unglück über?«
Er legte eine kurze Pause ein, um Ludwig Zeit zu lassen, über seine Worte nachzudenken. Schließlich hatte er ihm soeben durch die Erwähnung des Herzogs von Lothringen eine Möglichkeit aufgezeigt, wie er dem Herzog von Burgund eine empfindliche Schlappe versetzen und diese Möglichkeit gleichzeitig auch noch als seine eigene Idee ausgeben konnte. Diese Chance würde er sich sicher nicht entgehen lassen. Zu gut kannte Commynes die grenzenlose Eitelkeit Ludwigs, die nur noch von seinem Machthunger und seiner Gier übertroffen wurde.
Zwei Diener kamen mit einer großen Silberschale glänzender Pfirsiche herein und stellten sie auf dem Tisch ab. Ludwig bedeutete ihnen, sich zu entfernen, dann beugte er sich über die Pfirsiche und nahm einen nach dem anderen in die Hand. Es sah aus, als würde er ihre Reife prüfen. Dann schien er endlich einen Pfirsich gefunden zu haben, der nach seinem Geschmack war, und begann damit, ihn eigenhändig in kleine Stücke zu schneiden, die er auf Commynes’ Teller legte.
Commynes wurde blass.
Die Natter hatte ihm einen Pfirsich gereicht, genau wie die Schlange einst Eva den Apfel gereicht hatte. Seine Gedanken überschlugen sich. Wollte der König nun etwa auch ihn vergiften? Konnte es möglich sein, dass seine Miene entgegen allem Anschein seine heimlichsten Gedanken zuvor doch verraten hatte?
Was sollte er nur tun?
Auf seiner Stirn bildeten sich feine Schweißperlen.
König Ludwig beobachtete ihn lächelnd, bevor er seiner Qual ein Ende bereitete.
»Habt Ihr wirklich vor, diese köstlichsten aller Früchte zu verschmähen?«, fragte er beinahe liebevoll und zog den Teller zu sich herüber. Dann steckte er sich genüsslich ein Stück nach dem anderen in den Mund.
Philippe atmete erleichtert auf. Er würde sich niemals an den makaberen Humor der Franzosen gewöhnen. Und er erkannte, dass der biblische Vergleich, der ihm gerade durch den Kopf geschossen war, gar nicht so falsch gewesen war. Nur dass in diesem Fall der Pfirsich für die Erkenntnis stand, die der König beschlossen hatte, mit ihm zu teilen.
Als der König ihn entließ, hatte Philippe sich wieder beruhigt. Er hatte gewusst, auf was für ein gefährliches Spiel er sich eingelassen hatte, indem er sich von Herzog Karl abgewandt und in König Ludwigs Dienste begeben hatte. Doch er hatte gerade noch rechtzeitig erkannt, dass es mit Karl kein gutes Ende nehmen würde. Dessen brennender Traum, das alte burgundische Königreich wiederauferstehen zu lassen, war zu ehrgeizig für einen einzigen Mann, und die Ritterideale, die er durch den Orden vom Goldenen Vlies zu erhalten versuchte, fanden keinen Platz mehr in einer Zeit, in der die Bürger immer selbstbewusster wurden und mit zäher Unnachgiebigkeit auf ihre eigenen Rechte pochten. Eine Tatsache, die er sehr bedauerte, da Karl ihm im Grunde seines Herzens näherstand als dieser durchtriebene und heimtückische Franzosenkönig.
Aus allen Toren der Stadt ritten Boten aus, um die Nachricht vom Tode des Herzogs von Guyenne an die Höfe Europas zu tragen, zu Kaiser Friedrich III. nach Wien, nach England und Lothringen, zum Bischof von Metz und nach Bern, dem Vorort der Eidgenossenschaft, und schließlich auch nach Gent, wo Karl, der Herzog von Burgund, sie nachdenklich zur Kenntnis nahm.
Guyenne war einer der hartnäckigsten Bewerber um Marias Hand gewesen, doch er, Karl, hatte die Heirat bewusst in der Schwebe gehalten, wie er es bei allen Bewerbern machte. Er hatte noch viel Zeit, um Maria zu verheiraten, Zeit, die er nutzen würde, um Burgund zu vergrößern und sein Reich zu festigen.
Um Guyenne war es nicht weiter schade, aber Ludwig hätte eigentlich wissen müssen, dass er es niemals zugelassen hätte, dass sich sein eigenes Blut mit dem dieses unansehnlichen kränkelnden Mannes vermischen und in seine Erblinie eingehen würde.
Ludwig hätte sich den Mord sparen können, der ihm, Karl, nun eine willkommene Gelegenheit bot, gegen den verhassten Feind vorzugehen und sein eigenes Volk und seine Verbündeten gegen ihn aufzuwiegeln.
Einem Brudermörder konnte man nicht trauen, er konnte kein gottgewollter König sein und würde Tod und Verderben über jeden bringen, der sich nicht schleunigst von ihm abwandte.
Er spürte, wie der alte Hass wieder in ihm hochstieg, und schleuderte unbeherrscht den kostbaren Silberpokal gegen die Wand, aus dem er gerade noch getrunken hatte. Ludwig, dieser tückische kleine Verräter, war weitaus gefährlicher als jeder Saulus.
Sein Vater, Philipp der Gute, hatte ihn einst wie einen Sohn aufgenommen, als er flüchtig und heillos zerstritten mit dem eigenen Vater gewesen war.
Ohne zu zögern hatte Philipp der Gute damals die Belagerung von Deventer abgebrochen, die eine Expedition zur Eroberung Frieslands einleiten sollte, und war nach Brüssel geeilt, um Ludwig willkommen zu heißen.
In den darauf folgenden Jahren, die Ludwig am burgundischen Hof verbracht hatte, hatte Karl Seite an Seite mit ihm gejagt und war ihm stets ein guter Freund gewesen.
Er hatte seiner einzigen Tochter auf Ludwigs Wunsch hin sogar den Namen von dessen Mutter, der Königin von Frankreich, gegeben und ihm zu allem Überfluss auch noch die Ehre erwiesen, Marias Pate zu werden und sie über das Taufbecken zu halten.
Als Dank dafür hatte Ludwig in seiner hinterhältigen, feigen Art immer wieder versucht, einen Keil zwischen seinen Vater Philipp und ihn zu treiben, was ihm auch fast gelungen wäre und Vater und Sohn beinahe für immer entzweit hätte.
Hugonet, der liebe, gute Hugonet hatte ihn richtig beraten. Und er erkannte jetzt, was sein Kanzler schon lange vor ihm erkannt hatte: Dass ein Bündnis mit England die einzige Möglichkeit war, um Frankreich die Stirn zu bieten und gleichzeitig zu verhindern, dass sich der englische König Eduard VI. hinter seinem Rücken mit Ludwig zusammenschloss.
Noch am selben Tag verließ der größte Teil der französisch sprechenden Ritter und Höflinge Burgund in Richtung Frankreich, um dafür zu sorgen, dass sich die Kunde von der schändlichen Tat des Königs im ganzen Land verbreitete. Kaiser Friedrich III. befand sich trotz des feinen Nieselregens in seinem privaten Teil des Schlossgartens an einem seiner Pflanztische, als Dr. Georg Heßler, sein Protonotar und Vertrauter, mit der Botschaft vom Tod Guyennes erschien.
Die Hände des Kaisers waren mit brauner Erde überzogen, und seine klaren Gesichtszüge wirkten wohltuend entspannt, fast schon verklärt, während er vorsichtig die winzigen Zwiebeln seltener Blumen in die weiche Erde drückte.
Er war so in sein Tun versunken, dass Dr. Heßler sich mehrmals räuspern musste, um von ihm bemerkt zu werden.
Friedrich empfing ihn trotz der Störung in seiner Lieblingsbeschäftigung ruhig und freundlich, während seine kräftigen Hände, mit denen er sogar Eisenstangen biegen konnte, behutsam fortfuhren, die winzigen schwarzen Blumenzwiebeln in die Erde zu stecken.
Dr. Heßler wusste, dass Friedrich wenn sie allein waren, keinen Wert auf die übliche Etikette legte, und kam daher sofort zur Sache.
»Der Duc von Guyenne ist vergiftet worden, und es heißt, der König von Frankreich hätte diesen Mord in Auftrag gegeben.«
Friedrich sah auf und schenkte ihm einen kurzen Blick aus seinen ehrlichen braunen Augen. »Wie weise ist doch Gott unser Herr, der dem menschlichen Handeln zusieht, ohne darin einzugreifen, und weise ist auch der Ackersmann, der im richtigen Moment erntet, was er gesät hat.«
Bevor er sich wieder seinen Zwiebeln zuwandte, warf er noch einen nachdenklichen Blick in den grau verhangenen Himmel, und Dr. Heßler wusste, dass er entlassen war. Wie töricht doch die meisten Menschen waren; verwechselten kluges Abwägen und Warten mit Unentschlossenheit und Feigheit. Hätte jedoch jedes Land einen solchen Herrscher wie diesen Kaiser, würde es keine Kriege mehr geben und endlich Friede auf Erden herrschen.
Vor den kaiserlichen Stallungen traf er auf einen hochgewachsenen blonden Jungen, der sich gerade furchtlos auf ein unruhig tänzelndes, mächtiges Schlachtross schwang. Der breitschultrige grauhaarige Stallmeister hatte Mühe, das temperamentvolle Tier zu halten. Immer wieder warf es seinen Kopf hoch und scharrte dabei ungeduldig mit den Hufen. Der Junge ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, grinste Dr. Heßler übermütig an und hob grüßend die Hand.
Der Protonotar verneigte sich. »Seid gegrüßt, junger Herr«, sagte er und beobachtete, wie Maximilian, der Sohn des Kaisers, dem Pferd die Fersen in die Flanken stieß.
Das Pferd machte daraufhin einen mächtigen Satz nach vorn und riss dem Stallmeister die Zügel mit einem Ruck aus der Hand, sodass er aus dem Gleichgewicht geriet. Nur mit Mühe gelang es ihm, sich wieder zu fangen. Mürrisch sah er dem davonjagenden Reiter nach.
»Irgendwann wird sich der Bengel in seinem Leichtsinn noch das Genick brechen«, murmelte er respektlos.
Als er den Protonotar erkannte, nahm sein Gesicht einen ehrerbietigen Ausdruck an.
»Euer Pferd steht bereit, es ist gefüttert und getränkt«, versicherte er ihm beflissen und sah sich nach den Stallburschen um, der wie immer, wenn man ihn brauchte, verschwunden war. Er legte zwei Finger an den Mund und stieß einen lauten Pfiff aus. Sofort eilte ein kräftiger junger Bursche herbei, um seinen Befehl entgegenzunehmen. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß.
»Bring das Pferd von Dr. Heßler«, befahl der Stallmeister und wandte sich wieder dem Protonotar zu, der ihn aus zusammengekniffenen Augen musterte.
»Ihr solltet besser auf den jungen Herrn achtgeben«, bemerkte er mahnend. Der Vorwurf in seiner Stimme war unüberhörbar.
Der Stallmeister seufzte nur und zuckte die Schultern.
»Selbst der wildeste Hengst ist noch eine Schindmähre gegen das Temperament dieses Jungen«, verteidigte er sich gegen den in seinen Augen ungerechten Vorwurf. Der hohe Herr hatte gut reden. Schließlich musste er nicht Tag für Tag gegen die Wünsche des jungen Herrn ankämpfen, der zuletzt doch jedes Mal seinen Willen durchsetzte.
Im Stillen gab Dr. Heßler dem Stallmeister Recht. Er war wahrhaftig nicht um seine Verantwortung zu beneiden. Im Gegensatz zu seinem Vater war Maximilian abenteuerlustig und voller Tatendrang. Und um eine Entscheidung zu treffen, brauchte er nicht länger als einen Wimpernschlag. Für seine zukünftige Rolle als Kaiser war er viel zu heißblütig und unbedacht. Sein Temperament zu zügeln war daher die dringlichste Aufgabe, vor welche die Lehrmeister des Kaisersohns gestellt waren.
Dr. Heßler saß auf und ritt aus dem Hof, doch seine Gedanken kreisten auch noch um den Sohn des Kaisers, als er das Schloss schon längst wieder verlassen hatte.
1
Der festlich geschmückte Bankettsaal schimmerte golden im flackernden Licht unzähliger Kerzen, und sein fast schon überirdischer Glanz wurde von den sanften Klängen unsichtbarer Instrumente noch unterstrichen, als wären die himmlischen Heerscharen persönlich vom Himmel herabgestiegen.
Die Gespräche verstummten, als der Herzog von Burgund seinen Ehrengast, Karl von Guyenne, durch die weit geöffneten Flügeltüren führte.
Eine unnatürliche Stille breitete sich aus, die nur hier und da von raschelnder Seide und knisterndem Brokat unterbrochen wurde.
Entsetzte Blicke folgten dem Bruder des Königs von Frankreich, der neben der kraftvollen Gestalt des Herzogs noch schmächtiger und unansehnlicher wirkte, als er ohnehin schon war.
Guyenne war nach der neuesten Mode gekleidet, doch sein prächtiger Brokatrock konnte weder seinen verwachsenen Rücken verbergen noch die krankhafte Blässe seiner wenig ansprechenden Gesichtszüge.
In silbernen Schnabelschuhen, deren Spitzen so lang waren wie die Linie seiner Abstammung, stolzierte er an der Seite seines zukünftigen Schwiegervaters auf seine Braut zu.
Maria erstarrte und ihre Augen weiteten sich in ungläubigem Staunen, als sie den verwachsenen, alten Mann auf sich zukommen sah. Mit diesem Mann sollte sie das Bett teilen und ihm Söhne gebären? Mit einem Mann, der so gar nichts mit dem edlen Ritter gemein hatte, den sie in ihren Träumen stets an ihrer Seite gesehen hatte?
Nein, versuchte sie sich zu beruhigen, das konnte nicht sein, ihr Vater würde sie niemals zwingen, einen Mann wie Guyenne zu heiraten. Er liebte sie, sie war seine einzige Tochter, und er würde nicht zulassen, dass sie unglücklich werden würde.
Zweihundert Augenpaare hefteten sich auf ihr Gesicht, beobachteten jeden einzelnen Wimpernschlag von ihr und gierten sichtbar nach einer Reaktion.
Es war so still, dass sie ihren eigenen Atem hören konnte.
Maria begann zu zittern. Und mit einem Mal fühlte sie sich so fremd inmitten all dieser Menschen wie noch nie zuvor in ihrem Leben.
Verzweifelt suchte sie den Blick ihres Vaters, doch Karl hatte nur Augen für seinen Gast. Wäre sie weniger aufgewühlt gewesen, hätte sie die Verachtung und den grimmigen Hass in seinen schwarzen Augen bemerkt, den er nur mühsam hinter den Förmlichkeiten der steifen Hofetikette verbarg, und gewusst, dass er gar nicht daran dachte, seine einzige Tochter einem Franzosen zur Frau zu geben und noch dazu Ludwigs Bruder, doch sie ahnte nichts von dem, was in ihm vorging, und wurde immer verzweifelter.
Ihr Herz raste. Fort, nur fort, hämmerte es in ihrem Kopf. Schon wollte sie sich umdrehen und den Saal verlassen, konnte sich aber nicht von der Stelle rühren, und dann war es zu spät. Guyenne stand direkt vor ihr.
Sie spürte seine Nähe, roch den säuerlichen Geruch, den er verströmte, und kämpfte gegen die in ihr aufsteigende Übelkeit an.
Er nahm ihre eiskalte Hand, beugte sich über sie und hauchte einen Kuss darauf.
Von oben gesehen wirkte seine Nase noch spitzer, und sie konnte die roten Äderchen sehen, die sich durch seine durchscheinende, fahle Haut zogen wie Flüsse und Bäche auf einer Landkarte.
Guyenne ließ ihre Hand los und betrachtete sie mit dem Stolz eines Mannes, der soeben eine besonders prächtige Stute erworben hatte.
Röte stieg ihr in die Wangen. Noch nie hatte es ein Mann gewagt, sie so anzusehen.
Seine kleinen, schwarzen Augen huschten prüfend über ihr schmales Gesicht, den schlanken weißen Hals bis zu ihrem Dekolleté hinunter, das den Ansatz ihrer festen, kleinen Brüste erkennen ließ. Dort verweilten sie und saugten sich gierig fest.
Marias Atem ging schneller und ihre Brüste hoben und senkten sich noch mehr, während der alte Mann ihren Körper begaffte.
In seine Augen trat ein lüsterner Ausdruck, und er leckte sich genießerisch über die blassen Lippen.
Schaudernd senkte Maria ihren Blick und starrte erschrocken auf sein anschwellendes Geschlecht, das sich deutlich unter den engen grünen Beinlingen abzeichnete.
Schreiend fuhr Maria aus dem Schlaf. Ihr Körper war schweißüberströmt, und ihre Haare hingen ihr wirr ins Gesicht. Sie strich die langen, blonden Strähnen zurück und setzte sich benommen auf. Doch es dauerte noch eine Weile, bis sie sich aus den Fängen des Albtraums befreit hatte. Die beunruhigenden Bilder verblassten nur langsam. Sie verabscheute diesen Traum, genauso wie sie Guyenne verabscheute und ihn doch nicht aus ihrem Kopf verbannen konnte.
Wie zur Beruhigung suchte ihr Blick den farbenprächtigen, mit Gold und Silberfäden überzogenen Gobelin, der sich an der ihrem Bett gegenüberliegenden Wand befand. Im Licht der einfallenden Morgensonne schien der lebensgroße blonde Ritter darauf zum Leben zu erwachen. In goldenem Harnisch und mit erhobenem Schwert stand er kampfbereit vor dem Feuer speienden Drachen, um seine Prinzessin zu retten. Sein Anblick war ihr so vertraut, dass ihr die Tränen in die Augen traten.
Schon als kleines Mädchen hatte sie davon geträumt, einen edlen und mutigen Ritter wie ihn zu heiraten, und nun hatte ihr Vater sie mit einem abstoßenden alten Mann verlobt, dessen Anblick sie kaum ertragen konnte. Wie hatte er ihr das nur antun können? Allein der Gedanke an Guyenne löste Ekel in ihr aus.
Völlig aufgelöst schlüpfte Maria durch die grüngoldenen Damastvorhänge, die von hoch oben zwischen den Bettpfosten verstrebten Stangen auf den Boden herabfielen und ihre Schlafstätte umgaben, und trat mit nackten Füßen an eines der hohen, schmalen Fenster, die sich über die gesamte Front ihres Schlafgemachs erstreckten.
Ihre Mutter hätte einer Verlobung mit diesem schrecklichen Mann niemals zugestimmt, dachte sie traurig und grübelte wie schon so oft darüber nach, wie sie der Heirat mit Guyenne entkommen konnte.
Bisher war jedoch keiner ihrer Pläne zufriedenstellend gewesen. Weder gefiel ihr der Gedanke, sich in ein Kloster zurückzuziehen, wie ihre Großmutter es getan hatte, noch die Idee, eine Krankheit vorzutäuschen und dann Monate, vielleicht sogar Jahre im Krankenbett verbringen zu müssen.
Schließlich tröstete sie sich damit, dass ihr schon noch etwas einfallen würde. Der Tag der Hochzeit war schließlich noch nicht festgelegt worden, und bis es so weit sein würde, war sie auf jeden Fall vor Guyenne sicher.
Von ihrem Fenster aus hatte sie einen herrlichen Blick über den weitläufigen Schlosshof und auf den von der Leie gespeisten Wassergraben, der sich nordwärts des Schlosses zu einem Teich verbreiterte, bis hin zu den weitläufigen Parkanlagen mit ihren kunstvollen Wasserspielen.
Feiner Nebeldunst hing wie ein durchsichtiger Schleier über der Landschaft und verlieh ihr einen geheimnisvollen Zauber.
Wie gerne würde sie jetzt auf ihrer geliebten Stute Sturmwind über die taufeuchten Wiesen galoppieren, jeden Gedanken an Guyenne weit hinter sich lassen und, losgelöst von jeglichen Zwängen der Etikette, erregende Augenblicke völliger Freiheit genießen.
Stattdessen standen ihr eintönige Lateinstunden bei dem gestrengen Magister Sylvius bevor.
Als sich das unvermeidliche Klappern der dreitausend Webstühle Gents mit dem fröhlichen Gezwitscher der Vögel zu mischen begann, wandte sich Maria leise seufzend ab.
Das gleichförmige, dumpfe Grollen der Holzgestelle, das der Wind an manchen Tagen aus der Stadt zum Schloss hinüberwehte, erinnerte sie wieder an ihre Pflichten.
Sie griff nach dem goldenen Glöckchen, um nach ihrer Zofe zu klingeln, als die Türe auch schon aufflog und Catherina mit hochroten Wangen ins Zimmer gestürzt kam.
In ihren verschwommenen, hellen Augen stand ein Ausdruck von Entsetzen. Vom schnellen Laufen außer Atem, schnappte sie mehrmals nach Luft.
»Der Herzog von Guyenne ist ermordet worden«, platzte sie heraus, noch bevor sie die Türe hinter sich zugezogen hatte. »Und du errätst nie, von wem.«
Maria erbleichte. Allein die Erwähnung von Guyennes Namen versetzte sie in Panik.
Catherina sah, wie Maria um Fassung rang, und ihr Nacken kribbelte vor Erregung. Wie würde sie erst reagieren, wenn sie erfuhr, wer Guyenne ermordet hatte?
Es war Catherina unmöglich, ihr Wissen auch nur einen Moment länger für sich zu behalten.
»Dein Patenonkel war es. Der König von Frankreich hat seinen eigenen Bruder auf dem Gewissen.« Ihr blasses Gesicht glühte, und sie bekam vor lauter Aufregung kaum noch Luft.
Marias Gedanken überschlugen sich.
Sie würde Guyenne nicht heiraten müssen!
Eine Welle der Erleichterung floss durch ihren Körper, doch gleichzeitig meldete sich ihr schlechtes Gewissen. Wenn sie sich über seinen Tod freute, war sie nicht viel besser als ihr Patenonkel.
Sie zweifelte keinen Augenblick an dem Wahrheitsgehalt von Catherinas Worten, und der Gedanke, dass ihr Patenonkel ein Brudermörder war, verursachte ihr Unbehagen.
Sie konnte sich nur noch dunkel an ihn erinnern, denn sie hatte ihn nicht wieder gesehen, nachdem seine hinterhältige Intrige, durch die er gehofft hatte, einen Keil zwischen ihren Großvater und ihren Vater zu treiben, um anschließend selbst Karls Platz einzunehmen, gescheitert war. Ludwig hatte das Gerücht verbreiten lassen, ihr Vater würde mit dem bretonischen Herzog gegen Philipp den Guten konspirieren. Dass man Karl die Statthalterschaft über die Normandie übertragen habe, sei schließlich der beste Beweis dafür.
Und auf den darauf folgenden Bruch zwischen Vater und Sohn hin hatte Ludwig seine Mörder nach Gorkum ausgesandt, um Karl zu beseitigen, der sich dorthin zurückgezogen hatte. Allein der Aufmerksamkeit der Einwohner von Gorkum war es zu verdanken gewesen, dass ihr Vater Ludwigs Anschlag überlebt hatte. Die Gorkumer waren misstrauisch geworden, als die Fremden in ihrem Hafen gelandet waren und sie beobachtet hatten, wie diese heimlich das Schloss ausspionierten, auf Befestigungen herumkletterten und die Wälle überprüften.
Seit jenem Tag war Ludwig Burgunds erklärter Feind, der keine Gelegenheit ausließ, um ihrem Vater zu schaden.
Bei dem Gedanken, von diesem Mann über das Taufbecken gehalten worden zu sein, begann Maria zu frösteln.
»Jetzt sag doch endlich etwas«, forderte Catherina sie auf.
»Bist du nicht froh, dass Guyenne tot ist und du ihn nicht mehr heiraten musst?«
Ihre Augen hefteten sich erwartungsvoll auf ihr Gesicht.
Aber Maria konnte kein Mitgefühl in ihnen entdecken, nur brennende Neugier.
»Wir werden in die Kapelle gehen und für Guyennes Seele beten, und jetzt hör auf, mich anzustarren, und hilf mir lieber beim Ankleiden«, erwiderte sie betont ruhig, doch Catherina kannte Maria gut genug, um zu wissen, dass sie längst nicht so gelassen war, wie sie vorgab.
Ihre Nasenflügel bebten, und in ihren goldbraunen Augen stand ein eigentümlicher Ausdruck, den Catherina noch nie zuvor gesehen hatte.
Maria schwieg, während Catherina ihr eine karmesinrote Robe mit weiten Ärmeln über die enge Cotte zog, sorgfältig ihr langes, blondes Haar kämmte, es mit geübten Griffen eindrehte und zum Schluss ein schimmerndes, mit Perlen besetztes Haarnetz darüber schlang.
Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie würde Guyenne nicht heiraten müssen, er stellte keine Bedrohung mehr für sie dar, weil sein eigener Bruder ihn ermordet hatte. Sein eigener Bruder! Der Gedanke ließ sie erschauern und eisige Kälte kroch in ihr hoch, als sie begriff, dass allein sie der Grund für diesen Mord gewesen war. Und dabei ging es noch nicht einmal um sie als Person, sondern einzig und allein nur um ihre Funktion und Stellung als reichste Erbin des Abendlandes.
Guyenne hätte sie selbst dann geheiratet, wenn ihr Rücken ebenso verwachsen gewesen wäre wie sein eigener, und selbst wenn sie schielen würde oder ihr Kopf kahl gewesen wäre, hätte er sich von der Heirat nicht abbringen lassen.
Die Entscheidung ihres Vaters hatte ihr Vertrauen in ihn bis ins Innerste erschüttert. Nichts würde mehr so sein wie früher, und die wunderbare Geborgenheit, die für sie stets selbstverständlich gewesen war, war für immer aus ihrem Leben verschwunden.
Mit einem Mal fühlte sie sich schrecklich allein und wünschte sich, dass ihre Mutter bei ihr sein könnte, um ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, doch ihre Mutter war tot und würde sie nie wieder trösten können.
Das Eintreffen ihrer Erzieherin riss sie aus ihren traurigen Gedanken.
Madame Halewyn war eine energische und kluge Frau, die nur selten ein Blatt vor den Mund nahm. Marias Vater hatte sie an den Hof geholt, um ihren Mann, einen hohen und einflussreichen Würdenträger der Stadt Gent, durch diese Geste seines Wohlwollens enger an sich zu binden.
Ein warmes Lächeln trat auf ihre Züge, als sie Maria erblickte. Sie sah entzückend aus in ihrem karmesinroten Kleid, das ihr seidiges, hellblondes Haar zum Leuchten brachte und ihre zierliche Figur betonte. Lange Wimpern umrahmten die goldbraunen Augen, die ihr anmutig geschnittenes Gesicht beherrschten und dunkel vor Zorn werden konnten, jetzt aber ungewöhnlich ernst wirkten.
»Ich habe dir eine wichtige Mitteilung zu machen, mein Kind«, begann sie mit mühsam unterdrückter Erregung.
»Ist es wegen Guyenne?«, fragte Maria leise. »Catherina hat mir schon von seinem Tod erzählt.«
»Das, was ich dir zu sagen habe, hat nichts mit Guyenne zu tun«, wehrte Madame Halewyn ab und warf Catherina einen vorwurfsvollen Blick zu, den Catherina trotzig erwiderte. Dass die Mädchen aber auch nie ihren Mund halten können, dachte sie ärgerlich.
Insgeheim war sie erleichtert gewesen, als sie von Guyennes Tod erfahren hatte. Denn an der Seite dieses alternden Lüstlings wäre Maria wie eine Blume ohne Licht und Wasser verwelkt, davon war sie fest überzeugt, und deshalb hatte sie auch jeden Tag seit der Verlobung zu Gott gebetet und ihn darum angefleht, ihren Schützling vor diesem Schicksal zu bewahren.
Madame Halewyn seufzte. Es war ein Fehler, ein Kind, das einem nur auf eine bestimmte Zeit hin anvertraut worden war, zu sehr zu lieben, doch gegen die Liebe war nun einmal kein Kraut gewachsen.
Marias Leben war von der Stunde ihrer Geburt an vorgezeichnet gewesen, und es war ihre Pflicht, zum Wohle ihres Landes zu heiraten, dafür würde sie es immer warm haben und niemals hungern müssen.
Maria spürte, dass es sich bei dem, was Madame Halewyn ihr zu sagen hatte, um eine Angelegenheit von großer Bedeutung handeln musste, und suchte in dem vertrauten, klaren Gesicht mit den graublauen Augen daher nach einem Zeichen, das sie beruhigen würde, aber sie konnte keines entdecken.
Madame Halewyns volle Lippen waren zu einem Strich zusammengepresst und verrieten ihre nur mühsam unterdrückte Erregung.
»Ist etwas mit meinem Vater?«, fragte Maria ängstlich, und ihre schönen Augen füllten sich mit Tränen.
Madame Halewyn legte beruhigend ihren Arm um Marias schmale Schultern und streichelte sie liebevoll. Sie kannte Marias Angst, nach dem Tod der Mutter nun auch noch ihren Vater zu verlieren, den sie abgöttisch liebte. Er war ihr strahlender Held mit seinen kühn geschnittenen Gesichtszügen, den schulterlangen schwarzen Locken und den durchdringenden schwarzen Augen, und obwohl er Maria schrecklich enttäuscht hatte, konnte sie dennoch nicht aufhören, ihn zu lieben.
»Dein Vater hat beschlossen, eine neue Gemahlin zu nehmen.« Endlich war es heraus. Sie hätte Maria die Botschaft gerne schonender beigebracht, aber es war ihr unmöglich, den Ausdruck von Ungewissheit und Bestürzung, der in Marias Gesicht stand, auch nur einen Augenblick länger zu ertragen.
Marias Augen weiteten sich vor Schreck, doch in den Schrecken mischte sich Erleichterung darüber, dass ihrem Vater nichts geschehen und er wohlbehalten wieder im Prinzenhof eingetroffen war.
»Wer ist es? Wer wird meine neue Mutter?«, fragte Maria flüsternd und schmiegte sich schutzsuchend an ihre Gouvernante an.
Madame Halewyn räusperte sich. Gerne hätte sie ihr die Wahrheit noch eine Weile erspart, doch es würde nichts nutzen. Die Gerüchte im Schloss verbreiteten sich rasend schnell, und Maria sollte die unglaubliche Neuigkeit von ihr erfahren.
»Es ist Margarete von York, die Schwester des englischen Königs.«
Maria erbleichte. Fassungslos starrte sie Madame Halewyn an.
Eine Engländerin aus dem Hause York sollte ihre neue Mutter werden?
Sie vergaß ihren Patenonkel und Guyenne und dachte daran, wie abfällig sich ihr Vater jedes Mal über die Yorkisten geäußert hatte, die für ihre Gefühlskälte und ihren Neid bekannt waren und denen man auf keinen Fall trauen durfte.
Letzteres hatte Karl sogar einmal wortwörtlich zu seinem Kanzler gesagt, dem lieben und klugen Hugonet, der wie ein Onkel für Maria war und der ihr immer ein kleines Geschenk mitbrachte, wenn er an den Prinzenhof kam.
Wie von selbst wanderten ihre Gedanken von Hugenot weiter zu ihrem Geschichtslehrer, dem etwas farblosen Magister Edgar, der ihr erst kürzlich mit näselnder Stimme von dem mörderischen Bruderkrieg zwischen York und Lancaster erzählt hatte, den beiden englischen Adelshäusern, die seit Jahren erbittert miteinander um den englischen Thron kämpften und ihr Land darüber in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt hatten.
In ihrer Vorstellung war daraufhin ein Bild von fischäugigen, blassen Menschen entstanden, denen Freundschaft und Treue nicht das Geringste bedeuteten.
Madame Halewyn sah, wie es hinter Marias hoher Stirn arbeitete, und sie ahnte, dass Maria die Entscheidung ihres Vaters nicht leichtnehmen würde.
Schließlich war sie selbst über die Entscheidung des Herzogs entsetzt gewesen, obwohl sie wusste, dass diese Hochzeit nicht aus Liebe, sondern einzig und allein aus politischen Erwägungen heraus geschlossen worden war, genauso wie Marias Verlobung mit Guyenne.
Siedend heiß wurde ihr dabei bewusst, dass es längst an der Zeit gewesen wäre, Maria über diese Dinge aufzuklären, um sie behutsam auf ihre eigenen Pflichten als Erbprinzessin vorzubereiten, aber sie hatte es bisher nicht übers Herz gebracht, Maria aus ihrer kindlichen Traumwelt zu reißen, in die sie sich vor drei Jahren nach dem Tod ihrer geliebten Mutter geflüchtet hatte.
Es war ein Fehler, dachte sie, während ihre Augen langsam über Marias schmale Gestalt glitten.
Unter dem eng am Oberkörper anliegenden Kleid zeichneten sich deutlich die ersten Wölbungen ab, die Maria eine neue, verführerische Weiblichkeit verliehen, wie Madame Halewyn in diesem Augenblick schmerzhaft bewusst wurde.
Doch Maria schien mittlerweile eine Entscheidung getroffen zu haben.
Ihre Augen blitzten.
»Ich werde zu meinem Vater gehen, er soll es mir selbst sagen«, verkündete sie entschlossen und ließ die verdutzte Madame Halewyn und die erschrockene Catherina einfach stehen.
Mit wehendem Kleid eilte sie durch das endlose Gewirr von Gängen, die vom raunenden Flüstern der Dienerschaft und Höflinge erfüllt waren, bis sie die breite Treppe zum Audienzsaal erreicht hatte, in dem sich ihr Vater um diese Zeit gewöhnlich mit seinen Ratgebern aufhielt, wenn er einmal gerade nicht durch seine Länder zog, um aufständische Fürsten und aufsässige Städter zur Ordnung zu zwingen, und so den Frieden in Burgund sicherte.
Die misstrauischen Augen der Wachen folgten dem vorbeihastenden Mädchen. Bewegungslos wie Statuen verharrten sie auf ihrem Posten und wurden von den meisten Menschen am Hof kaum noch wahrgenommen.
Am Fuß der Treppe zögerte Maria einen Moment. Sie zwang sich dazu, ihr aufgewühltes Gemüt wieder zu beruhigen, und atmete einige Male tief durch, bis ihre Gedanken wieder klar und ihre Gesichtszüge ohne jedes äußere Anzeichen von Erregung waren, ganz wie Madame Halewyn es sie gelehrt hatte.
Bis zum heutigen Tag war sie niemals ungehorsam gewesen und hatte sich gegen keine Entscheidung ihres Vaters aufgelehnt, doch jetzt ging es um das Andenken ihrer Mutter, deren aufwendig aus Marmor gehauenes Grabmal noch nicht einmal fertig gestellt war, auch wenn es nun kurz vor der Vollendung stand, wie man ihr versichert hatte.
Sie ahnte, dass ihr Vater zornig über ihr unaufgefordertes Erscheinen sein würde, aber das unbestimmte Bedürfnis, die Tote gegen die Lebenden verteidigen zu müssen, war stärker als ihre Angst.
Mit stolz erhobenem Haupt stieg sie die Treppenstufen hoch, vorbei an der langen Reihe der Bittsteller, die sich schon am frühen Morgen eingefunden hatten, obwohl der Herzog sie kaum vor dem Mittagsmahl empfangen würde.
Ein Raunen ging durch die Reihen, und bewundernde Blicke folgten Maria, die von der Aufmerksamkeit, die sie erregte, nichts zu bemerken schien und an den Bittstellern vorbeieilte, als wären sie gar nicht vorhanden.
Und noch bevor die Wache stehenden Soldaten in ihren prächtigen Waffenröcken reagieren konnten, war sie auch schon durch eine der beiden mit Gold überzogenen und bemalten Flügeltüren in den Audienzsaal geschlüpft.
Am anderen Ende des Saales, weit genug von den spitzen Ohren der ausländischen Gesandten entfernt, saß der Herzog erhöht unter dem mit Silber und Goldfäden bestickten Baldachin auf seinem Thronsessel.
Er hatte seine engsten Berater um sich herum versammelt; seinen Halbbruder Antoine, seinen Kanzler Hugonet, Sir Humbercourt, den Statthalter von Gent, sowie den Grafen von Campobasso, einen ehemaligen Vertrauten seines verstorbenen Vaters, und Olivier de la Marche, seines Zeichens Feldmarschall und Zeremonienmeister.
Nur einer fehlte: Philippe Commynes, der Karl verraten hatte und zu Ludwig übergelaufen war.
Graf Humbercourt hatte wie selbstverständlich dessen Platz eingenommen, und nicht einmal Antoine, der außerehelich geborene Sohn des Herzogs von Burgund, hatte gewagt, dagegen aufzubegehren.
»Die Genter werden zufrieden sein, wenn sie von dem Kontrakt mit England erfahren und sie ihre Wolle und ihr Tuch wieder nach Britannien verkaufen können«, stellte Humbercourt gerade fest. In seiner Stimme lag keine Spur von Unsicherheit. Er war so überzeugt von dem, was er sagte, dass jeder, der ihm zuhörte, es ebenfalls war. Seine Unbeirrbarkeit und die Art, wie er die Dinge auf den Punkt brachte, hatten Karl beeindruckt, und so war er schon nach wenigen Monaten, die er am Hof weilte, in den engsten Kreis seiner Berater aufgestiegen.
»Hoffentlich zufrieden genug, um mir ihre Beutel zu öffnen und meine Kriegskasse wieder aufzufüllen«, knurrte Karl missgelaunt, obwohl er allen Grund zur Freude gehabt hätte.
Eduard VI., der König von England, hatte endlich seine Einwilligung zur Heirat seiner Schwester Margarete mit ihm erteilt und den entsprechenden Kontrakt unterschrieben, obwohl Ludwig nichts unversucht gelassen hatte, um diese Heirat, und damit ein Bündnis seiner beiden mächtigsten Feinde, zu verhindern.
Karl zog eine Braue hoch und sah Humbercourt finster an.
»Ich erwarte von Euch, dass Ihr Euch darum kümmert.«
Humbercourt hielt seinem düsteren Blick stand. »Nun, die Genter werden einsehen müssen, dass sie keine andere Wahl haben; jedes Bündnis hat nun einmal seinen Preis«, gab er kühl zurück.
Seine Züge verhärteten sich, als er an die Zunftmeister und die reichen Kaufleute dachte, die den Rat der Stadt Gent bildeten. Denn sobald es um ihr Geld ging, herrschte seltene Einigkeit zwischen ihnen, und jede einzelne Münze in ihrem Stadtsäckel wurde verbissen verteidigt.
Karls Miene hellte sich bei Humbercourts Worten jedoch unerwartet auf.
Es war nicht der Tuchhandel, der ihn interessierte, sondern einzig und allein seine Kriegskasse. Er dachte an die zehntausend Krieger, die sein zukünftiger Schwager Eduard VI. ihm zugesichert hatte, und seine Laune hob sich noch mehr. Die gefürchteten englischen Bogenschützen würden seine Truppen unschlagbar machen. Mit ihrer Hilfe würde er Frankreich erobern und Ludwig endgültig vernichten.
Am anderen Ende des Saales erhob sich ein bewunderndes Raunen, und Karl sah auf und traute seinen Augen nicht.
Isabella, seine unvergessene, über alles geliebte Gemahlin, schritt mit hocherhobenem Haupt auf ihn zu.
Brennende Sehnsucht erfüllte ihn, doch dann erkannte er, das es nicht Isabella war, die nun vor ihm stand, sondern seine Tochter Maria.
Sie sah Isabella so ähnlich, dass es ihn schmerzte.
Stille herrschte plötzlich in dem großen Saal, und Maria schlug züchtig die Augen nieder und trat herausfordernd einen Schritt näher an den Thronsessel heran, als es die Etikette erlaubte.
Einer Bittstellerin gleich sank sie vor ihrem Vater auf die Knie und neigte graziös ihren schönen Kopf.
Doch bevor Karl überhaupt entscheiden konnte, wie er reagieren wollte, traf ihn schon ein flammender Blick aus Marias zornig funkelnden Augen.
»Vater, ist es wahr? Werdet Ihr zulassen, dass eine Engländerin aus dem Hause York Mutters Platz einnimmt, deren Grabmahl noch nicht einmal fertig gestellt ist?« Die letzten Worte hatte sie fast herausgeschrien.
Karls Gesicht färbte sich dunkelrot.
Furchtlos hielt Maria seinem Blick stand, und Karl spürte, wie ihm das Blut in die Adern schoss. Es war das gleiche Blut, das auch durch Marias Adern floss.
Die Männer im Saal hielten den Atem an. Niemand von ihnen hätte gewagt, was dieses Mädchen wagte.
Zu groß war ihre Furcht vor Karl, der in seiner Grausamkeit ebenso maßlos sein konnte wie in seinem übertriebenen Gerechtigkeitssinn und in seiner an Verschwendung grenzenden Großzügigkeit.
Wehe dem Unglücklichen, der es wagte, ihn zu kritisieren, oder, schlimmer noch, seinen ehrgeizigen Zielen in die Quere kam.
Lediglich das heftige Ausatmen verriet die Spannung der Versammelten.
Nie zuvor hatten sie den Herzog sprachlos erlebt. Sie ahnten nichts von dem Sturm, der in seinem Inneren tobte.
Wie konnte Maria es wagen, seine Besprechung zu stören? Und wie geringschätzig das Wort Engländerin aus ihrem Mund geklungen hatte.
Er hatte den besten Unterricht und die beste Erziehung für Maria befohlen, die fähigsten Lehrer aller Universitäten an den Hof geholt, und was war dabei herausgekommen? Seine jäh aufsteigende Wut vernebelte ihm den Verstand, und er dachte nicht mehr daran, wie abfällig er selbst des Öfteren über seine neu gewonnenen Verbündeten gesprochen hatte und noch immer sprach.
Es war immer das Gleiche: Wo immer er auch hinkam, stieß er auf mangelnde Ordnung und Disziplin, bis hin zur offenen Rebellion. Hinter seinem Rücken wurden Befehle verweigert oder nur halbherzig ausgeführt, allen voran das aufsässige Geldern am einen Ende seines Reiches und die oberrheinischen Pfandlande am anderen. Er hatte es satt.
Hugonet sah mit Sorge, wie sich das Gesicht des Herzogs verdüsterte und die Ader auf seiner Stirn anschwoll. Er kannte den Herzog von Burgund gut genug, um zu wissen, dass dieser kurz davor stand, die Beherrschung zu verlieren und sich in einem seiner allseits gefürchteten Wutanfälle Luft zu verschaffen.
In dem Versuch, ihn zu besänftigen, legte er seine Hand auf Karls Arm und warf einen bedeutsamen Blick auf die ausländischen Gesandten. Karl fegte seine Hand jedoch hinweg und sah ihn böse an. Einen Augenblick lang befürchtete Hugonet sogar, Karl würde ihn schlagen, doch Karl wandte sich abrupt von ihm ab und wieder seiner Tochter zu.
»Es ist beschlossen, also wirst du dich damit abfinden müssen«, sagte er kalt und gab Maria durch eine herrische Bewegung seiner Hand zu verstehen, dass sie entlassen war.
Was fiel dem Mädchen nur ein, hier hereinzuplatzen und ihn vor den Augen aller Versammelten in Verlegenheit zu bringen?
Er hatte sich jetzt wieder einigermaßen gefasst und wirkte nach außen hin ruhig und kühl wie zuvor.
Nur Hugonet ahnte, was für eine große Anstrengung ihn seine Zurückhaltung kostete. Trotz der Demütigungen, die er durch ihn erfuhr, liebte und bewunderte er Karl und empfand keinerlei Hass für ihn. Stattdessen spürte er die Qualen, die Karls Inneres verzehrten und unter denen er litt, als wären es seine eigenen.
Unter halb geschlossenen Lidern musterte Karl die Gesandten.
In ihren Gesichtern las er unverhohlene Bewunderung für seine Tochter.
Der derbe Graf von Nassau verschlang sie geradezu mit seinen Blicken, und in die berechnenden Augen des Grafen von Kleve war ein gieriger Glanz getreten.
Trotz seines Ärgers war er insgeheim stolz auf Maria.
Das Mädchen war von faszinierender Schönheit. Ihr Haar glänzte wie fein gesponnenes Gold, ihre Gesichtszüge waren edel und wie von Meisterhand geformt, und ihre Haut war rein und milchweiß. Sanft geschwungene Augenbrauen betonten ihre großen, braunen Augen.
Er hatte sie monatelang nicht gesehen, war gerade erst aus Nancy zurückgekehrt und sah nun, dass sie zu einer eindrucksvollen jungen Frau herangewachsen war, die die Schönheit ihrer Mutter, aber auch seinen eigenen ungestümen Willen in sich vereinigte.
Marias Anwesenheit war noch zu spüren, als sie den Saal schon längst wieder verlassen hatte. Ihr unerwarteter Auftritt hatte allen Anwesenden deutlich vor Augen geführt, dass sie das heiratsfähige Alter erreicht hatte, und diese Tatsache war bedeutend genug, um sie in die Überlegungen jedes einzelnen Anwesenden mit einzubeziehen.
Einige der ausländischen Gesandten starrten noch immer auf die Türe, durch die Maria entschwunden war, als hätten sie eine Erscheinung gesehen.
»Sie ist eine Prinzessin, eine Königin, nein, was sage ich, sie ist eine Madonna«, stieß der Graf von Nassau beinahe ehrfürchtig hervor und wischte sich mit einem Seidentuch den Schweiß von der Stirn.
Der Herzog von Kleve, Generalstatthalter von Gent, musterte ihn spöttisch.
»Gebt Euch bloß keinen falschen Hoffnungen hin. Ihr würdet in der langen Schlange der Bewerber um ihre Hand sowieso ganz hinten stehen.«
»So wie Ihr«, schnaubte der Graf von Nassau beleidigt zurück und wandte ihm demonstrativ den Rücken zu.
Johann von Kleve biss sich wütend auf die Lippen. Lange genug hatte er sich der Hoffnung hingegeben, Maria mit seinem Sohn Philipp vermählen zu können, bis er sich schließlich hatte eingestehen müssen, dass er sich die ganze Zeit über etwas vorgemacht hatte. Gegen die reichen und mächtigen Bewerber, zu denen sich zu allem Übel nun auch noch der Sohn des Kaisers gesellt hatte, hatte er nie eine Chance gehabt.
»Was für ein außergewöhnliches Zusammentreffen von Schönheit und Anmut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in den Niederlanden eine noch kaum erblühte Rose wie diese gibt«, hörte er eine gezierte Stimme hinter sich sagen.
Ärgerlich wandte er sich um und sah in das Gesicht eines elegant gekleideten jungen Mannes mit glänzenden schwarzen Haaren und gestutztem Lippenbärtchen, der zum Gefolge des Herzogs von Mailand gehörte.
Allein die Kleider dieses verwöhnten Bürschchens mussten mehr gekostet haben, als ihm seine Grafschaft in einem Jahr einbrachte, was seinen Ärger noch mehr steigerte.
Der Italiener öffnete gerade den Mund, um fortzufahren, doch der Herzog von Kleve fiel ihm grob ins Wort.
»Eine Rose, die Ihr jedenfalls ganz bestimmt nicht pflücken werdet. Es würde Euch daher weit besser anstehen, Euch um Euren eigenen Garten zu bekümmern«, bemerkte er unhöflich.
»Und für Euch wäre es sicher besser, Eure Zunge zu hüten«, gab der Gesandte hochmütig zurück.
»Wollt Ihr mir etwa drohen?« Die Stimme des Älteren klang so herablassend, dass dem Italiener das Blut in den Kopf schoss.
Er sprang auf. In seiner Hand blitzte eine Klinge, und seine schwarzen Augen glitzerten tückisch.
Aus den Augenwinkeln heraus sah der Herzog von Kleve zwei Wachen herbeieilen, die noch im Laufen ihre Schwerter zogen.
Sein Mund verzog sich verächtlich. Er lehnte sich zurück und verschränkte herausfordernd die Arme vor der Brust.
Das Bürschchen würde es nicht wagen, ihn anzugreifen.
Der Junge stand da wie ein düsterer Racheengel, und es dauerte eine Weile, bis er bemerkte, wie lächerlich sein Auftritt auf die Umstehenden wirken musste.
Wütend steckte er das Messer wieder ein und ließ sich auf seinen Stuhl zurücksinken.
Johann von Kleve warf ihm noch einen letzten höhnischen Blick zu, der dem Italiener erneut das Blut in den Kopf steigen ließ, dann wandte er sich zufrieden von ihm ab.
Er konnte diese verdammten Italiener nun einmal nicht leiden.
2
Schwarze Gewitterwolken türmten sich bedrohlich über dem Reichenauer Tal, und die feuchtschwüle Luft wurde mit jeder Minute, die verging, drückender.
Die Dohlen verstummten fast gleichzeitig, und sogar der Steinadler, der eben noch seine Kreise am Himmel gezogen hatte, war plötzlich verschwunden.
Auch die Männer, die hintereinander durch das Tal ritten, bemerkten, dass sich ein heftiges Gewitter über ihren Köpfen zusammenbraute, und trieben ihre Pferde daher zur Eile an. Sie folgten einem ausgetretenen, engen Pfad, der sich umsäumt von saftigen Wiesen durch das Tal schlängelte.
Für einen kurzen Moment schob sich ein letzter, gleißender Sonnenstrahl durch die Wolken und lenkte den Blick des vordersten Reiters auf die Steilwand, die sich schroff über dem Tal erhob.
Sein Atem stockte, als er dort in etwa hundert Klafter Höhe einen Gamsbock entdeckte, der regungslos auf einem felsigen Vorsprung verharrte.
Er hob die Hand zum Zeichen für die Reiter, die ihm folgten, brachte seinen Hengst zum Stehen und warf einen abschätzenden Blick nach oben. Seine hellen, braunen Augen funkelten vergnügt, hatte er die Hoffnung, am heutigen Tag noch eine Gams zu erlegen, doch längst aufgegeben.
Seine Begleiter folgten seinem Blick.
»Der Bock steht zu hoch, um ihn zu erreichen, Max«, gab sein Freund und Jagdgefährte Albrecht von Sachsen zu bedenken.
Berthold von Henneberg stimmte ihm insgeheim zu, kannte Maximilian, den Sohn des Kaisers, aber gut genug, um zu wissen, dass ihn gerade das unmöglich Erscheinende besonders reizte.
»Ich wette einen Fuder Wein, dass du ihn nicht triffst«, sagte er herausfordernd, und in seine grauen Augen trat ein lauernder Ausdruck. Maximilian hatte während der heutigen Jagd bereits zwei Rehböcke mit einem Blattschuss erlegt, und es konnte nicht schaden, wenn er sich endlich einmal eine Niederlage einhandeln würde.
Er selbst hatte weniger Glück gehabt. In seinem Ehrgeiz, Maximilian zu übertreffen, hatte er die Sehne seines Bogens so weit gespannt, dass sie gerissen war und ihm einen schmerzhaften Striemen auf seiner Wange hinterlassen hatte, der noch immer wie Feuer brannte.
Maximilian zögerte.
»Traust du dir zu, ihn mit deiner Büchse zu erlegen, Jörg«, wandte er sich an einen hochgewachsenen, sehnigen Mann mit wachen, blauen Augen.
Der Büchsenmacher schüttelte bedauernd den Kopf.
»Albrecht hat Recht, an den Bock kommen wir nicht ran.«
Wortlos griff Maximilian nach seiner Armbrust, legte einen Bolzen ein und spannte sie.
»Wir werden ja sehen«, gab er zurück und legte an.
Er bot das vollkommene Bild eines Jägers. Seine Muskeln unter dem blauen Waffenrock waren gespannt, sein Blick konzentriert.
Einen Augenblick lang verharrte er ebenso bewegungslos wie die Gams über ihm, nur sein schulterlanges, blondes Haar, flatterte im auffrischenden Wind.
Berthold und Albrecht hielten den Atem an, als sich Maximilians Zeigefinger um den Abzugshahn krümmte.
Dann drückte er ab, der Bolzen schnellte aus der Armbrust und traf den Bock mitten ins Herz.
Wie ein gefällter Baum kippte das Tier auf die Seite, rutschte über den Vorsprung und prallte nicht weit von ihnen entfernt auf einer Wiese auf.
Maximilian wandte sich triumphierend um. Sein Gesicht strahlte vor Stolz, während ihn Albrecht mit offenem Mund anstarrte. Mit einem solchen Treffer hatte er nicht gerechnet.
»Was für ein Schuss«, rief er aus und schlug Maximilian begeistert auf die Schulter.
Bertholds Augen verengten sich dagegen zu schmalen Schlitzen. Wie zum Teufel war es nur möglich, dass Maximilian absolut alles gelang, was er sich in den Kopf gesetzt hatte?
»Fortuna scheint dir wie immer wohlgesinnt zu sein«, knurrte er verächtlich und zeigte damit deutlich, dass er Maximilians Treffer lediglich für einen glücklichen Zufall hielt.
Doch Maximilian ließ sich seine gute Laune nicht verderben und grinste.
»Was hältst du von einem kleinen Wettschießen morgen früh, nur wir beide?«, erwiderte er, ganz wie Berthold es erwartet hatte.
Berthold zuckte gleichmütig die Schultern.
»Ihr Wunsch ist mir Befehl, Sire«, erwiderte er und neigte spöttisch seinen Kopf.
Jörg Burghart beobachtete Berthold unter halbgeschlossenen Lidern.
Berthold war ein schlechter Verlierer und verhielt sich, wie er fand, oft unnötig grausam, vor allem gegenüber Schwächeren.
Er kannte Berthold von dem Tag an, als sein Vater ihn an den Wiener Hof geschickt hatte, und wusste, wie sehr Neid und Ehrgeiz an seiner ruhelosen Seele nagten. Doch er hatte noch nie so recht begriffen, was es wirklich war, was den Jungen so sehr quälte.
Ein ohrenbetäubendes Krachen ließ Reiter und Pferde zusammenschrecken. Mit einem Schlag wurde es so dunkel, dass man kaum noch die Hand vor Augen erkennen konnte. Blitze zuckten über den Himmel, und Donner rollte nun fast ununterbrochen über sie hinweg. Ein heftiger Regenguss folgte. Innerhalb weniger Augenblicke waren Reiter und Pferde bis auf die Knochen durchnässt, und der Pfad unter ihren Füßen verwandelte sich in eine gefährlich rutschige Schlammbahn.
»Wir sollten machen, dass wir nach Hause kommen, um den Bock kümmern wir uns später«, meinte Jörg warnend, als er sah, dass Maximilian vom Pferd stieg.
»Hilf mir lieber«, erwiderte Maximilian ungerührt. »Ich werde nicht ohne die Gams zurückkehren.«
Jörg Burghart hatte eine ähnliche Antwort schon befürchtet. Seufzend stieg er ab, um Maximilian zu helfen. Gemeinsam hievten sie den Bock auf Maximilians Pferd und ritten so schnell es ging zurück. Die Hufe der Pferde sanken allerdings mit jedem Schritt tiefer in den Matsch, sodass sie nur sehr mühsam vorankamen.
Hinter ihnen erklang erneut ein Grollen, das zunächst warnend wie das leise Knurren eines Hundes war, innerhalb weniger Sekunden aber zu einem ohrenbetäubenden Krachen anschwoll. Diesmal war es jedoch kein Donner, und Maximilians Nackenhaare sträubten sich. Er wusste sofort, was das Grollen bedeutete: Eine der gefürchteten Muren ging aus den Bergen ins Tal ab und kam direkt auf sie zu.
»Wir müssen aus dem Tal raus«, schrie er dem hinter ihm reitenden Berthold zu und trieb sein Pferd die Anhöhe hoch. Doch die Wiese war durch den vielen Regen glitschig, und der Hengst rutschte immer wieder ab. Schließlich sprang Maximilian vom Pferd und zog es keuchend die Anhöhe hoch.
Albrecht und Jörg taten es ihm nach.
Berthold wollte ihnen folgen, doch sein Pferd fand einfach keinen Halt. Ungeduldig riss er an den Zügeln, nahm dann seine Gerte und drosch unbeherrscht auf das verängstigte Tier ein, das immer mehr in Panik geriet. Seine Flanke war bereits wund, und es wieherte gequält auf.
Maximilian drehte sich zu Berthold um und wurde im nächsten Moment von einer unbändigen Wut gepackt. Ohne lange nachzudenken, sprang er auf Berthold zu, riss ihm die Gerte aus der Hand und versetzte ihm eine Ohrfeige, die ihn taumeln ließ.
Dann legte er dem verängstigten Tier die Hand auf die Nüstern und flüsterte ihm ein paar beruhigende Worte zu.
Hinter ihnen brach die Hölle los. Das Pferd drohte erneut in Panik auszubrechen, doch Maximilian gab nicht auf, und Jörg eilte ihm zu Hilfe.
Mit vereinten Kräften zogen sie den Hengst aus der Gefahrenzone.
Keinen Augenblick zu früh.
Denn als sie sich schnaufend umwandten, sahen sie nur noch, wie der Boden, auf dem sie gerade noch gestanden hatten, unter der Wucht der Mure vom Hang wegbrach und mitgerissen wurde.
Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit raste der Strom aus Wasser, Stein, Schlamm und Schutt nur wenige Ellen unter ihnen hinweg und riss auf seinem Weg ins Tal alles mit sich, was sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.
»Das war knapp!« Maximilian strich sich erleichtert eine tropfende Haarsträhne aus dem Gesicht und sah Albrecht an, dem der Schreck noch immer ins Gesicht geschrieben stand.
Es war ein erregendes Gefühl, dem Tod so knapp entkommen zu sein, und in diesem Moment fühlte Maximilian sich, als könnte er die ganze Welt aus den Angeln heben.
»Was für ein Abenteuer!«, rief er begeistert aus und stieg auf sein Pferd.
Albrecht starrte an ihm vorbei auf die gurgelnde, braune Masse aus Steinen und Geröll, brachte keinen Ton heraus.
»Jetzt mach nicht so ein Gesicht, es ist doch noch einmal alles gut gegangen«, sagte Maximilian unbekümmert, worauf Albrecht ein Grinsen versuchte, was ihm jedoch gründlich misslang. Er wollte sich keine Blöße geben, konnte aber das Zittern in seinen Knien nicht abstellen.
Erst nach dem dritten Anlauf schaffte er es auf sein Pferd.
»Durch deinen Leichtsinn hast du uns alle in Gefahr gebracht«, brummte Jörg Burghart vorwurfsvoll.
Maximilian sah ihn mit einem merkwürdigen Blick aus seinen hellen, braunen Augen an.
»Gerade du solltest doch wissen, dass ein Jäger weder seine Beute noch ein Pferd oder einen Mann aus seinem Gefolge jemals zurücklässt.«
Seine muskulöse Gestalt straffte sich. Er nahm die Zügel in die linke Hand und warf einen raschen Blick auf seine Begleiter. Er achtete nicht auf Berthold, der ihn voller Hass ansah.
»Lasst uns nach Hause reiten und dem heiligen Georg für den Schutz danken, den er uns in seiner unermesslichen Güte gewährt hat.«
Jörg Burkhard war wider Willen beeindruckt.
Maximilian ist der geborene Führer, dachte er, und die Männer folgen ihm schon jetzt.
Die unerschütterliche Sicherheit, mit der der Kaisersohn auf sein Glück vertraute, zog die Menschen zu ihm hin, und Jörg Burkhard konnte nur hoffen, dass das Glück, welches Maximilian bei seiner Geburt von den Astrologen vorausgesagt worden war, auch weiterhin anhalten würde.
Der Stallmeister wartete mit wachsender Ungeduld auf die Rückkehr der Jagdgesellschaft. Ein Gewitter in den Bergen konnte äußerst gefährlich sein und war schon manch einem Unvorsichtigen zum Verhängnis geworden.
Obwohl er es niemals zugegeben hätte und ständig über Maximilians Leichtsinn schimpfte, liebte er den Sohn des Kaisers, wie er einen eigenen Sohn nicht mehr hätte lieben können, und der Gedanke, dass ihm etwas zustoßen könnte, war ihm unerträglich.
»Sie kommen«, rief einer der Knechte aufgeregt.
Der Stallmeister schickte ein Stoßgebet zum Himmel und lief den Reitern, gefolgt von einigen Knechten, entgegen.
Die Knechte hoben die Gams von Maximilians Hengst, nahmen den durchnässten Reitern die Zügel aus der Hand und führten die Pferde in die Stallungen.
Maximilian bestand jedoch darauf, sein Pferd selbst zu versorgen. Eigenhändig führte er seinen Hengst ins Trockene, zäumte ihn ab und rieb ihn anschließend liebevoll mit Stroh trocken.
»Ich werde nie verstehen, warum du so ein Aufhebens um deinen Gaul machst«, bemerkte Berthold herablassend, um Maximilan zu provozieren. Er war immer noch wütend wegen der Ohrfeige. Maximilian hatte ihn vor den Augen der anderen gedemütigt, und er hatte sich geschworen, es ihm bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit heimzuzahlen.
Er wartete einen Augenblick auf Maximilians Reaktion. Als diese jedoch ausblieb, wandte er sich ab und verließ den Stall.
Maximilian sah ihm nachdenklich nach.
Sein Vater hatte ihn schon früh gelehrt, dass man das Vertrauen eines Pferdes nur dann gewinnen konnte, wenn man sein Wesen erkannte, und um dieses zu erreichen war es unerlässlich, sich viel Zeit für das Tier zu nehmen. Denn nur wenn dieses Ziel erreicht war, konnte man sich in jeder Situation auf das Tier verlassen, was in zukünftigen Schlachten, die er schon bald zu führen gedachte, ein nicht zu unterschätzender Vorteil sein würde.
»So, mein Alter, für heute hast du genug getan«, sagte er zu dem Pferd und klopfte ihm zärtlich den Hals. Der Hengst spitzte die Ohren und schnaubte, als würde er jedes Wort verstehen. Dann stupste er Maximilian auffordernd mit der Nase in die Rippen.
Maximilian lachte, zog eine Mohrrübe unter seinem Umhang hervor und hielt sie dem Hengst hin. Anschließend führte er das Tier zurück in seine Box und sorgte dafür, dass es genug Wasser und Heu erhielt.
Erst danach begab er sich in seine Gemächer, wo sein Kammerdiener trockene Kleider für ihn bereithielt.
Er hatte sich gerade umgekleidet, als Rosina von Kraig, die Zofe seiner Schwester Kunigunde, ihren Kopf zur Tür hereinstreckte. Sie war hochgewachsen und schlank, mit lockigem, braunem Haar, honigfarbenen Augen und verführerisch glänzenden Lippen und lebte mit ihrem Vater am kaiserlichen Hof, seit Maximilian denken konnte.
»Hat dir niemand gesagt, dass es sich nicht schickt, heimlich in die Gemächer eines Mannes einzudringen«, fragte Maximilian mit gespielter Strenge.
Rosina sah ihn vorwurfsvoll an.
»Ich habe mir Sorgen wegen des Unwetters gemacht. Konntest du nicht etwas früher zurückkehren? Ich bin vor lauter Angst, dass dir etwas geschehen sein könnte, schier gestorben«, erwiderte sie.
Maximilian winkte ab.