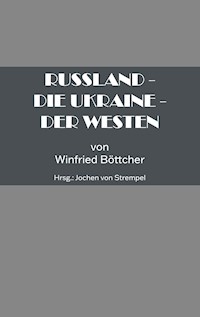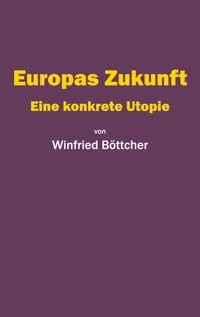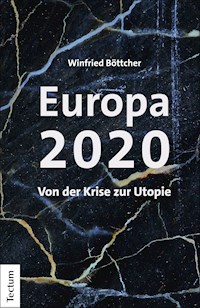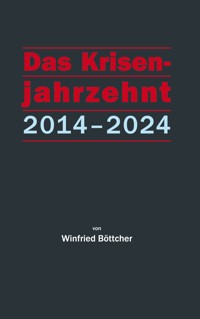
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Krise ist der Übergang von einer bestimmten Ordnung des Verdichtens zu einer anderen; ein Übergang, der an gewissen Zeichen und Symptomen spürbar wird. Während einer Krise scheint die Zeit ihr Wesen zu verändern; die Zeitdauer wird auf andere Weise wahrgenommen als beim normalen Stand der Dinge; statt den Beharrungszustand zu messen, misst die die Veränderung. Voraussetzung jeder Krise ist die Intervention neuer Ursachen, die ein labiles oder stabiles Gleichgewicht, das vor dem Bestand, erschüttern. Paul Valery (1871-1945)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warum dieses Buch?
Seit im Jahr 2008 der Zusammenbruch der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers eine weltweite Finanzkrise auslöste, befindet sich die Welt in einer Dauerkrise mit einer neuen Realität.
Die wichtigsten Krisen seit dieser Zeit habe ich in meinem Buch von 2021 »Europa 2020 - Von der Krise zur Utopie« vorgestellt:
Die Flüchtlingskrise,
Der Ukraine-Konflikt,
Der Brexit,
Das Virus des Nationalismus,
Die Natur als Politikum - Umwelt und Klimakrise,
Die Coronakrise - Eine Zeitenwende
Diese krisengeschüttelte Zeit seit der völkerrechtswidrigen Annektion der Krim 2014 fühlt sich für mich wie Vorkriegszeit an.
Was veranlasst mich, die neben den Buchveröffentlichungen während des Krisenjahrzehnts 2014 – 2024 verstreuten Texte nochmal in Buchform zusammenzufassen?
Diese Texte sind mir besonders wichtig, weil sie meine Auseinandersetzung mit zentralen politischenThemen verdichtend abbilden. Vielleicht haben sie das entscheidende Krisenjahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkrieges geprägt.
Seit den vergangenen fast 80 Jahren haben wir neben der Kubakrise 1962 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 keine Zeit erlebt wie die letzten zehn Jahre. Diese zehn Jahre haben sich in ihren krisenhaften Auswirkungen so verdichtet, dass man den Eindruck bekommt, wir befänden uns in einer Dauerkrise.
Das wichtigste Argument, diese Texte vorzulegen, ist jedoch, dass die Anmerkungen in den Texten nach wie vor an Aktualität nichts eingebüßt haben. Keine der angeführten Krisen konnte bewältigt werden. Vielmehr scheint sich nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dem Bruch des Völkerrechts, die Krise zuzuspitzen.
Zusätzlich deutet die Wiederwahl eines paranoiden Anti-Demokraten zum Präsidenten der USA darauf hin, dass wir es mit einer schwelenden Fundamentalkrise der Demokratie zu tun haben. Einer Auseinandersetzung damit, ob das seit Jahrhunderten entstandene Model einer Demokratie, in der die menschliche Würde die Zentralinstanz der Politik ist, eine Überlebenschance hat.
Die vorliegenden Texte sind als Gastbeiträge in drei Tageszeitungen erschienen. »Kölner Stadanzeiger« – Trierischer Volksfreund« – »Aachener Zeitung«. Sie haben in etwa alle einen ähnlichen Umfang.
Die zweiten ausgewählten Texte unterschiedlichen Umfangs wurden auf einer Online-Plattform des allzu früh verstorbenen Axel Jürgens veröffentlicht. Er gründete Ende der 1990-er Jahre »eyes of europe« mit dem Portal »elcor international«. Teilweise sind diese Texte auch in russischer Sprache veröffentlicht.
Inhaltsverzeichnis
Warum dieses Buch?
Eine Retroperspektive nach 80 Jahren
Beiträge in Tageszeitungen
Kölner Stadt Anzeiger
Europafähigkeit und Weltoffenheit statt »deutscher Leitkultur«
Ungarn – Eine Diktatur mitten in Europa
Die Denkblockade durchbrechen
»Mehr war nicht drin«
Freiheit unter Druck
Wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor
Irrglaube an die Logik der Abschreckung
Die Hypothek einer Staatsräson
Schlag nach bei Shakespeare
Trierischer Volksfreund
Mein Interview »Der Friede in Europa ist sehr zerbrechlich«
Mein Interview »Es ist brandgefährlich, Putin in die Enge zu treiben«
Leitkultur – ein verstörender Begriff
Aachener Zeitung
Anmerkungen zum Nahost-Konflikt
»Die Würde des Menschen ist unantastbar«
Der Sieg des Autoritarismus
Beiträge Online eyes of europe/ elcor international
Innenpolitik der Bundesrepublik
Zum Deutschlandbild der Briten
Die Insel und das Festland
Nachlese zur Bundestagswahl 2017
17 Thesen für eine Minderheitsregierung
Eine Koalition des Fortschritts?
Europa
Europa in der Globalisierung
Europa in Not
Fünf Thesen zu Katalonien
Europas Ohnmacht
Die Zukunft Europas und der Nationalstaat
Zur Flüchtlingskrise
Internationale Konflikte
Beginn einer anderen Zeit
Die EU und Russland in psycho-logischer Blockade – Eine Anmerkung
Der Ukraine-Krieg und seine Folgen (Vortrag)
Der Nahe Osten – ein schwelender Dauerkonflikt
Nachtrag
Interview im »stern«
Personenregister
Verwendete Literatur
Bücher und Zeitschriften
Eine Retroperspektive nach 80 Jahren
Zwanzig fünf und zwanzig sind 80 Jahre vergangen, seit der Zweite Weltkrieg endete und Deutschland vom Nationalsozialismus befreit wurde.
Aus den Kriegsalliierten wurden erbitterte Feinde, die versuchten, ihre politischen Systemvorstellungen – dort der Kommunismus, hier der Kapitalismus – weltweit zu exportieren.
Die vergangenen achtzig Jahre waren mehr oder weniger acht Krisenjahrzehnte.
Die beiden ersten Krisenjahrzehnte waren geprägt durch eine hochgerüstete Konfrontation zwischen Ost und West im »Kalten Krieg«.
Bis zur Kuba-Krise 1962 war die internationale Ordnung polarisiert in einem Freund-Feind-Denken zwischen den USA und der UdSSR. Dieses Denken führte die Welt an den Rand eines atomaren Abgrunds.
Aber sowohl Nikita Chruschtschow (1894–1971) als auch John F. Kennedy (1917–1963) hatten durch die Dramatik der Kuba-Krise gelernt, dass ein erfolgreiches Krisenmanagement folgende Grundsätze zu berücksichtigen hat:
Die höchstinstanzliche Kontrolle über militärische Optionen muß erhalten bleiben.
Die Dynamik militärischer Aktionen muß durch Atempausen gebremst werden.
Diplomatische und militärische Schritte müssen koordiniert werden.
Ein etwaiges militärisches Vorgehen sollte sich auf solche Schritte beschränkten, die der Gegenseite unmissverständlich die eigene Entschlossenheit signalisieren und den eigenen Zielen angemessen sind.
Zu vermeiden sind militärische Schritte, die der Gegenseite den Eindruck vermitteln, man plane einen »richtigen« Krieg, und sie daher zu einem Präventivschlag provozieren können.
Es sollten diplomatisch militärische Optionen gewählt werden, die der anderen Seite signalisieren, dass man Verhandlungen einer militärischen Lösung vorzieht.
Es sollten diplomatisch.militärische Optionen gewählt werden, die der anderen Seite einen Weg aus der Krise offen lassen, der mit ihren fundamentalen Interessen vereinbar ist.
Diese Wandlung in der Wahrnehmung des jeweils anderen verändert auch das Selbstbildnis. Zudem eröffnet es den jeweiligen Verbündeten Spielräume für eigene Politikgestaltung.
(Craig/George, 229.f.)
Die Kuba-Krise war aus der Perspektive Kennedys ein Wendepunkt im politischen Denken der USA, vom rein konfrontativen Freund-Feind-Denken hin zu einer Wahrnehmung des Gegners in Differenzen.
In einer nachdenklichen Rede am 1. Juli 1963 vor Studierenden der American University in Washington brachte Kennedy dies auf den Punkt:
Er mahnte seine Zuhörer, sich nicht nur ein verzerrtes Bild von der anderen Seite zu machen, Konflikte nicht als unvermeidlich, eine Verständigung nicht als unmöglich und einen Dialog als bloßen Austausch von Drohungen anzusehen. Weiter erklärte er: »Keine Regierung und kein Gesellschaftssystem sind so schlecht, daß man den unter ihnen lebenden Menschen jede Tugend absprechen muß.« (zit. ibid.,S. 145f.)
Etwas mehr als ein Jahrzehnt später kam es in den vergangenen 80 Jahren zur größten Chance, die Konfrontation zwischen Ost und West endgültig in einer gemeinsamen neuen Ordnung zu überwinden.
Die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki vom 1. August 1975 signalisierte einen Aufbruch in eine neue Zeit. In der Präambel versicherten sich die 35 Staats- und Regierungschefs der »Solidarität zwischen den Völkern«, erinnerten an die »gemeinsame Geschichte«, wiesen auf die Notwendigkeit hin, das Misstrauen zu überwinden, die »Vergrößerung des Vertrauens« zu stärken und betonten die »Erkenntnis der Unteilbarkeit der Sicherheit Europas«.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion schien sich der Gedanke eines Ost-West-Ausgleichs durch einen gemeinsamen Neuaufbau des euro-atlantischen Raumes zu verfestigen.
So hieß es in der »Charta von Paris für ein neues Europa« vom 21. November 1990, verabschiedet von den Staats- und Regierungschefs der KSZE:
»Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, daß sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit.
…
Wir verpflichten uns, die Demokratie als einzige Regierungsform unserer Nationen aufzubauen, zu festigen und zu stärken«.
Zwar unterschrieb Michail Gorbatschow (1931–2022) das Pariser Dokument kurz nach der deutschen Einheit, unterschrieb aber auch, das die »Sicherheit unteilbar« sei und kein Land die eigene Sicherheit auf Kosten eines anderen verbessern dürfe.
Besonders zwei weitere Treffen der Staats und Regierungschefs schienen diesen Gedanken zu vertiefen, der Sicherheitsgipfel vom 5./6. Dezember in Budapest und und die NATO-Russland-Akte vom 27. März 1997.
Liest man heute diese hier ausgewählten vereinbarten Dokumente zwischen Ost und West im Lichte des Krieges in der Ukraine, so hat man den Eindruck, sie stammten aus einer anderen Welt. Nie waren wir einem dauerhaften Frieden in Europa näher als am Ausgang des 20. Jahrhunderts.
Hoffnung gab es zunächst auch nach der ersten Wahl Wladimir Putins zum russischen Präsidenten.
Am 25. September 2001 hielt er unter großem Beifall der Abgeordneten eine beachtenswerte Rede im Deutschen Bundestag. Im Mittelpunkt stehen die deutsch-russischen Beziehungen, die zukünftige Rolle Russlands in einem vereinigten Europa und die internationale Sicherheit.
Das Hauptziel Russlands als ein »freundlich gesinntes europäisches Land – sei ein stabiler Friede auf dem Kontinent«. Noch sei dieser nicht erreicht, weil die Konfrontation der Systeme nach wie vor in »alten Wertsystemen« gefangen sei.
Zwar spreche man von Partnerschaft, aber einander zu vertrauen habe man nach wie vor nicht gelernt.
Wir brauchen eine neue Entwicklung, um »eine moderne, dauerhafte und standfeste internationale Sicherheitsstruktur [zu] schaffen«. Eine solch Entwicklung wird jedoch nur in einem Klima des Vertrauens gelingen.
In dieser Rede kommt die tiefe Überzeugung des russischen Präsidenten zum Ausdruck, dass Europa einen neuen Aufbruch gemeinsam mit einem demokratischen Russland erleben kann.
Geprägt muss dieser Aufbruch von gegenseitigem Vertrauen sein, ein Aufbruch der Kooperation anstatt bisheriger Konfrontation, ein Aufbruch mit einer neuen gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur.
Wladimir Putin vermittelte damals den Eindruck, gemeinsam mit dem Westen, insbesondere mit Deutschland in eine neue Zeit aufzubrechen.
Er formulierte apodiktisch: »Der Kalte Krieg ist vorbei«.
Keine sechs Jahre vergingen, als eine neue Zeit, nicht der Kooperation, sondern zunehmender Konfrontation, sich abzeichnete, die 2022 zum Krieg in der Ukraine führte.
Die Rede auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar 2007 zeigte nach meiner Einschätzung deutlich, dass Putin jegliches Vertrauen in den Westen verloren hatte. Russland fühlte sich durch die zweite NATO-Osterweiterung, 2004 mit Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen Rumänien, Slowakei und Slowenien, ernsthaft bedroht.
Der Westen reagierte mehr oder weniger arrogant, anstatt das Bedrohungsgefühl Russlands ernst zu nehmen.
Schon 1997 warnte einer der besten westlichen Russland Kenner, George Kennan (1904–2005), vor einem »strategische Fehler, möglicherweise epischen Ausmaßes«, wenn die NATO sich bis an die Grenzen Russlands ausdehne (vgl. Talbott,2002, 220).
An anderer Stelle bezeichnete er die Osterweiterung der NATO als einen verhängnisvollen politischen Irrtum historischen Ausmaßes … einen »verhängnisvollen Fehler amerikanischer Politik in der Ära nach dem Kalten Krieg, weil die Entscheidung erwarten ließe, dass die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen in der Meinung Russlands entzünden werden, dass sie einen schädlichen Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie in Russland haben, das sie die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Beziehungen zwischen Osten und Westen wieder herstellen und die russische Außenpolitik in Richtungen zwingen, die uns entschieden missfallen werde« (zit.n. Weimar/ Crosette, in: New York Times, 18. März 2005)
Was wäre uns erspart geblieben, hätten die politischen Entscheider solch kluge Mahnungen ernst genommen.
Im NATO-Russland-Rat 2008 wies Putin erneut auf die direkte »Bedrohung« seines Landes durch den NATO-Block an den russischen Grenzen hin. Zwar verhinderte Deutschland und Frankreich durch ihr Veto die Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die NATO, dies hielt jedoch Russland nicht kurze Zeit später davon ab, Georgien zu überfallen und Südossetien und Abchasien abzuspalten und unter russischen Schutz zu stellen.
Als die Ukraine ihre in der Verfassung festgelegte immerwährende Neutralität aufhob und die Aufnahme in die NATO beantragte, war das Verhängnis nicht mehr aufzuhalten. Die völkerrechtswidrige Annektion der Krim 2014 und der vier ost-ukrainischen sogenannten Volksrepubliken deutete die Richtung an, in die Putin gehen wollte.
Beiträge in Tageszeitungen
Kölner Stadt Anzeiger
Europafähigkeit und Weltoffenheit
Ungarn – eine Diktatur mitten in Europa
Die Denkblockade durchbrechen
Mehr war nicht drin [Flüchtlingskrise]
Freiheit unter Druck
Wer Frieden will, bereite Frieden vor
Irrglaube an der Abschreckung
Hypothek einer Staatsräson
Schlag nach bei Shakespeare
Europafähigkeit und Weltoffenheit statt »deutscher Leitkultur«
Die »neue Leitkultur« des Thomas de Maizière (vgl. Bild am Sonntag v. 30.4.2017) zeigt aus mehreren Gründen in die falsche Richtung:
Sie ist »Wasser auf die Mühlen« der Rechtspopulisten, die sich in ihrem Rückzug auf das Nationale bestätigt fühlen.
Sie schadet den deutschen Interessen, da das noch immer latent vorhandene Misstrauen gegenüber Deutschland gestärkt wird.
Sie verstellt den Blick auf die Notwendigkeit, mit unseren europäischen Nachbarn gemeinsam eine europäische Identität zu finden, ohne die Europa nicht gebaut werden kann. Anstatt eine »deutsche Leitkultur« zu fordern, sollten wir Europafähigkeit und Weltoffenheit ins Zentrum unseres Denkens stellen. Ein solches Denken kann das Bewusstsein für ein dringend notwendiges Mehr an Europa in verstörenden Zeiten fördern.
Wie sehr wir europäisch, wie wenig national wir sind, hat der große spanische Philosoph Ortega y Gasset 1930 in seinem Buch »Der Aufstand der Massen« so ausgedrückt:
»Machten wir Bilanz unseres geistigen Besitzes – Theorien, Normen, Wünsche und Vermutungen –, so würde sich herausstellen, dass das meiste davon nicht unserem jeweiligen Vaterland, sondern dem gemeinsamen europäischen Fundus entstammt. In uns allen überwiegt der Europäer bei weitem den Deutschen, Spanier, Franzosen … Wenn wir uns versuchsweise vorstellen, wir sollten lediglich mit dem leben, was wir als ›Nationale‹ sind …, werden wir bestürzt sein, wie unmöglich eine solche Existenz schon ist; vier Fünftel unserer inneren Habe sind europäisches Gemeingut«.
Nur vier von vielen zentralen Elementen unseres »gemeinsame europäischen Fundus« als Teil der europäischen Kultur wollen wir hier in gebotener Kürze nachgehen. Hierbei ist Kultur der Ausdruck für alle Wirkungszusammenhänge, die uns zu dem werden ließen, was wir heute sind. Ohne eine ständige Besinnung darauf, was sollen wir tun, wie wollen wir in Zukunft leben, woher kommen wir, können wir nicht wissen, wohin wir gehen.
Solche Fragen können wir nur dann beantworten, wenn wir uns immer wieder einiger, gemeinsamer europäischen Grundwerte besinnen.
Zunächst verweisen wir auf die Würde und Freiheit des Individuums. In Europa – spätesten seit der Virginia Act von 1776 und der Französischen Revolution von 1789 – wurde dieses Prinzip personaler Freiheit zum Bindungsprinzip des Staates entwickelt. Hierbei erwächst konkrete Freiheit aus der Kommunikation mit dem Mitmenschen. Freiheit ist immer die »Freiheit des anders Denkenden«, wie Rosa Luxemburg so treffend Formulierte.
Als zweites wichtiges Element des »gemeinsamen europäischen Fundus« nennen wir die Rechtsstaatlichkeit, die notwendige Ergänzung und Garantie der Freiheit in Würde des Menschen. Der Rechtsbindung des Staates an die Verfassung und, hieraus abgeleitet, dem Gesetzesrecht liegt – systematisch gedacht – das sittliche Postulat der Gerechtigkeit zugrunde, wie sie es beinhalten und stützen sollen.
Als drittes, übergreifendes Element, das in unmittelbarem Zusammenhang mit der Würde der Person und der Rechtsstaatlichkeit steht, ist die soziale Verantwortung gegenüber den Schwächeren in unseren Gesellschaften zu nennen. Zwar hat das Sozial staatsprinzip Verfassungsrang, aber zunächst orientiert es sich nicht auf einer Skala europäischer Grundwerte an staatlichem Handeln, sondern vielmehr an der konkreten Bereitschaft zur mitmenschlichen Hilfe im Alltag, wann immer Menschen in Not geraten.
Als letztes der ausgewählten typisch europäischen Wesensmerkmale soll hier noch die seit der frühen griechischen Philosophie immer neu gestellten Frage nach Wahrheit angeführt werden. Die ständige Überprüfung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Suche nach immer neuen Methoden, um dem Anspruch auf Wahrheit besser zu entsprechen, wird den »Alternativen Fakten« immer überlegen bleiben.
So sehr die Geschichte europäische Identität prägt, so bleibt sie museal, wenn nicht ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Gegenwart hinzukommt. Der Umgang mit der Gegenwart wird geprägt durch eine Kultur, die in ihrem weitesten Sinne »die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte« einer Gemeinschaft kennzeichnet. Eine solche Definition schließt nicht nur »Kunst und Literatur ein sondern auch Lebensformen, die Grundrechte der Menschen, Wertesysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen« (UNESCO-Erklärung von Mexiko 1982).
Ein solch moderner Kulturbegriff widerspricht inhaltlich wie logisch, emotional vielleicht, einem Begriff wie »Leitkultur«. »Leitkultur« behindert den »Umgang mit Differenzen« als einer »Kultur der Moderne«.
National, europaweit, ja weltweit haben wir es mit sich ähnelnden Problemen zu tun. Die Politisierung kultureller, dazu noch nationaler Unterschiede führt in immer schärfere Radikalisierung und Fundamentalisierung. Wir besinnen uns zu wenig auf das Gemeinsame, die Europafähigkeit, und zu Ende gedacht auf die Weltoffenheit.
Europafähigkeit bedeutet, Europa zu verstehen. Verstehen heißt aber, den Nachbarn in seinen Eigenarten zu begreifen, ihn in seinen Sonderungen zu akzeptieren, sein Anderssein als gleichwertig mit dem Eigensein anzunehmen.
Die Forderung – mit einer Leitkultur unvereinbar – muss also sein, Andersartiges, Fremdes – in einer globalisierten Welt sind wir alle Fremde –, Uneindeutiges, Widerständiges, scheinbar Unvereinbares als Bereicherung für die eigene Identitätsbildung und nicht als Bedrohung verstehen zu lernen.
Europa, genauso wie Deutschland als dessen integraler Bestandteil, ist immer dann bei sich selbst, wenn es aufgeschlossen und neugierig ist, die Spannung der Gegensätze kreativ und produktiv gestaltet. Durch zuwandernde Menschen mit fremden Kulturen wird Europa in seiner unberechenbaren Schaffenskraft nur gestärkt.
[Mai 2017]
Ungarn –Eine Diktatur mitten in Europa
Als am 25. April 2010 Viktor Orbán mit seiner Partei Fidesz (Bund junger Demokraten) in Koalition mit der KDNP (Christdemokratische Volkspartei) eine Mehrheit mit Zweidrittel der Parlamentssitze gewann, begann eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren EU-Geschichte.
Bei der Siegesfeier verkündete er seinen Anhängern:
»Eine Ordnung kann man nicht verändern, man kann sie nur umstürzen und eine neue errichten.«
Dieses Alarmzeichen politischer Sprache verhallte, wurde nicht Ernst genommen oder gar nicht gehört. Mit welcher Konsequenz Orbán die politische Ordnung Ungarns umstürzte, um eine neue zu errichten, wird uns zunehmend erschreckend bewusst.
Wer die zehn Jahre seiner Machtergreifung in einem liebenswürdigen Land der Europäischen Union verfolgt, kann Schritt für Schritt beobachten, wie in einem vom Kommunismus befreiten Land ein illiberales, hybrides Regime entsteht:
Ungarn wird zentralisiert
die Medien kontrolliert
der angeblich illoyale Beamtenapparat gesäubert
die Verfassung nach Belieben angepasst
die Gerichte und Staatsanwaltschaften gleichgeschaltet
die Nichtregierungsorganisationen drangsaliert
die Minderheiten diffamiert
die Sozialstaatsmaßnahmen und die Arbeitnehmerrechte eingeschränkt
die Wahlgesetze so manipuliert, dass schon 40 Prozent der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament sichern, das zur Abnickmaschine degeneriert.
Der ungarische Philosoph Gáspár Miklós Tamás fasste dies kürzlich so zusammen:
»Unser Land ist politisch, moralisch und geistig kaputtgegangen … Kein Rechtsstaat, kein Verfassungsstaat, aber auch keine Diktatur im russischen oder türkischen Sinne. Oppositionelle sitzen nicht im Gefängnis oder werden ermordet. Deswegen bedarf es mangels Widerstand gegen Orbán auch nicht. In Ungarn herrscht Ordnung und Ruhe. Es ist ein zum Weinen unglückliches Land.«
Das Armutszeugnis der Europäischen Union
Die neugewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält sich mit ihrer Kritik zurück. Verständlich. Als sie vom Europäischen Parlament mit neun Stimmen Mehrheit gewählt wurde, hatte sie ihre Wahl der Orbán-Partei zu verdanken. Die zwölf Fidesz-Abgeordnete stimmten für sie. Schon bei ihrer Nominierung im Rat der Staats- und Regierungschefs hatte sie in Viktor Orbán einen ihrer stärksten Unterstützer, weil sie im Gegensatz zu dem aufrechten Demokraten Frans Timmermans die Rechtsstaatsverletzungen der Ungarn und Polen nicht beim Namen nannte.
Zwar wird nach Artikel 7 des EU-Vertrages ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, das zum Stimmentzug führen könnte, jedoch nicht führen wird. Denn dieser Entzug müsste im Rat der Staats- und Regierungschefs einstimmig erfolgen. Mit Sicherheit wird Polen dagegen stimmen, weil es selbst in ein Verfahren verwickelt ist. Auch werden Tschechien, die Slowakei und Slowenien dagegen sein. Orbán weiß das natürlich und braucht sich um die Kritik der anderen Staaten nicht zu kümmern. Dies ist ein erneutes Beispiel wie sehr das Einstimmigkeitsprinzip der EU ihre Handlungsfähigkeit blockiert.
Von der Europäischen Union muss sich Orbán auch noch belohnt fühlen, wenn er trotz seines antidemokratischen Verhaltens im Jahr 2018 fünf Milliarden Fördergelder erhält, in dieser Größenordnung Jahr für Jahr. Dies entspricht ca. vier Prozent des Bruttoinlandsprodukt Ungarns. Der unnachvollziehbare Höhepunkt europäischen Fehlverhaltens zeigte sich erst jüngst bei der Verteilung von Coronamitteln.
Orbán ließ sich in der Coronakrise per Parlamentsbeschluss bestätigen, dass er unbegrenzte Zeit per Dekret regieren kann. Ein Ermächtigungsgesetz, das uns an die dunkelsten Zeiten europäischer Geschichte erinnert. Als Anerkennung dafür erhielt Ungarn aus dem CRII (Coronavirus Response Investment Initiative Plus) 5,6 Milliarden Euro. Dies entspricht 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukt Ungarns. Dies, obwohl es in Ungarn nur 20 Infektionsfälle ohne Tote gab. Italien dagegen, das in der EU neben Spanien am stärksten betroffene Land erhält aus diesem Topf 2,3 Milliarden Euro. Dies entspricht 0,1 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Aber Scham ist natürlich keine politische Kategorie. Von europäischer Solidarität ganz zu schweigen.
Donald Tusk, der Präsident der EVP-Familie Europas, versucht seit geraumer Zeit, die Fidesz-Partei auszuschließen. Bisher ohne Erfolg. Er findet keine Mehrheit, weil die EVP-Mitglieder Frankreichs, Spaniens, Italiens und Deutschland dies verhindern, In einem jüngsten Brief an die Vorsitzenden der EVP-Familie verschiedener Staaten, darunter der CDU und CSU, greift Viktor Orbán Donald Tusk an, indem er ihm vorwirft, die EVP als »Spielplatz« seiner »polnisch-innenpolitischen Spiele« zu missbrauchen. Außerdem bediene er sich der Sprache von »europäische Liberalen und Linken«.
Es wird also höchste Zeit, dass sich der Rat der Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel mit der Entwicklung in Ungarn beschäftigt, um sich nicht selbst zu beschädigen, und Ungarn solange aus der Rechts- und Werte gemeinschaft ausschließt bis zur Rückkehr des Landes zum Rechtsstaat.
Natürlich weiß ich, wie kompliziert das ist, auch weiß ich welche Widerstände einzelner Staaten dem entgegenstehen, ich weiß aber auch, dass die Glaubwürdigkeit der Bürgerinnen und Bürger auf dem Spiel steht.
Nicht zuletzt an dem Beispiel Ungarns wird sich zeigen, ob Europa eine Rechts- und Wertegemeinschaft ist oder nur eine Geldverteilungsmaschine.
[April 2020]
Die Denkblockade durchbrechen
Die »Logik« des Krieges lässt nur noch die Überlegungzu, wie man den Gegner am besten vernichten kann
Nach Wladimir Putins Rede an die Nation, die auch nicht im Ansatz Verhandlungsbereitschaft signalisierte, durch die Aussetzung des New-Start-Abkommens sogar eine zusätzliche Eskalation andeutete, scheint die Diplomatie keine Chance zu haben. Das heißt, der Westen wird noch mehr Waffen an die Ukraine liefern, immer stärker zur Kriegspartei werden. Putin wird immer mehr Russen der Sinnlosigkeit opfern. Er geht offenbar von einem langen Krieg aus, sonst hätte er seinen Soldaten nicht nach 6 Monaten Heimat Urlaub versprochen – denjenigen, die dann noch leben. Dies alles läuft auf einen Abnutzungskrieg hinaus, bis zur Erschöpfung einer oder beider Seiten.
Wenn Putins Rede seinen »Wirklichkeitssinn« wiedergibt, muss es doch auch so etwas geben wie dem »Möglichkeitssinn«, der altes Denken hinter sich lässt. Hier bietet die Wissenschaft von der internationalen Politik mit Hilfe der »Graduismustheorie« Lösungsmöglichkeiten an. Die Theorie wurde entwickelt, um in der Kuba-Krise 1962 einen Atomkrieg zu verhindern, sie hält aber auch Vorschläge bereit, wie im Ukraine-Konflikt eine paranoide Sprachlosigkeit überwunden werden kann.
Der Teufelskreis das bloßen Freund-Feind-Denkens mit dem sich steigernden Misstrauen muss durchbrochen werden. Die Mentalität des Krieges führt zu einer Denkblockade, die nur noch die Überlegung zulässt, wie man am besten den Gegner vernichten kann. Die wesentlichen Gründe für dieses Verhalten sind psychologischer Natur. Das Bewusstsein fest verwurzelten Feindbilder lassen kein objektives Urteil zu. Der Gegner wird aus dieser Mentalität heraus jeweils genau mit den entgegengesetzten Merkmalen zu denjenigen beurteilt, die man sich selbst zuschreibt. So gelingt es, ein und dasselbe Verhalten genau entgegengesetzt zu bewerten. Die daraus resultierende Denkweise wird konsequent durchgehalten, erscheint geradezu »logisch« und ermöglicht im eigenen Denken die absolute Verteufelung des Gegners.
Ausstieg aus der Spirale in drei Phasen
Will die Ukraine Absprache mit dem Westen aus der Eskalationsspirale heraus, dann geht dies nur, wenn Sie den ersten Schritt tut und nicht darauf besteht, dass dieser vom Aggressor ausgehen müsse. Ein möglicher Ausstieg aus der Spirale vollzieht sich in mehreren Schritten:
In der ersten Phase bietet die Ukraine in Übereinstimmung mit ihren westlichen Partnern Verhandlungen an. Um Vladimir Putin die Ernsthaftigkeit zu signalisieren, nimmt der Westen in Übereinstimmung mit der Ukraine eine Sanktion zurück, die besonders das russische Volk betrifft. Aus einem solchen Angebot kann die Gegenseite den guten Willen erkennen, dass die Ukraine wünscht, mit Russland ins Gespräch zu kommen. Eine Erwiederung der Gegenseite ist zwar wünschenswert, aber keine notwendige Bedienung dafür, die begonnene Politik des Umdenkens vorzusetzen.
In der zweiten Phase, wenn das Angebot der ersten Phase unbeantwortet bleibt, wird der Westen in Absprache mit der Ukraine erneut eine Sanktion mit größeren Folgen für die russische Bevölkerung aufheben. Allerdings wird im Gegensatz zur ersten Phase nun eine Erwiderung mit gleichwertigen Angebot von russischer Seite erwartet. Reagiert Russland im Sinne der Erwartung der Ukraine positiv, in dem es zum Beispiel ankündigt, den Raketenbeschuss außerhalb der Front zu unterbrechen, kann die dritte Phase eingeleitet werden.
In Phase 3 beginnt die eigentliche Suche nach eine Annäherung. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, dass tiefsitzende gegenseitige Misstrauen in kleinen Schritten abzubauen. Je besser dies gelingt, desto bereiter werden beide Seiten sein, Kompromisse einzugehen. »Von nun an werden die Konzessionen gleichzeitig nach Abprache, gemäß einem aufgestellten Zeitplan gemacht werden und mit Inspektionen – etwa unter Aufsicht der UN – verbunden sein«, wie Amitai Etzioni 1965 in seinem Klassiker »Der harte Weg zum Frieden« schreibt.
Apokalyptisches Risiko eines Atomkriegs
Nach Einschätzung des bisherigen Kriegsverlauf sollte es in beidseitigen Interesse liegen, den Konflikt diplomatisch zu lösen. Die nukleare Bewaffnung der beiden größten Atommächte der Welt – verbunden mit der äußerst schwierigen Kontrolle der künstlichen Intelligenz, einer in dieser Konstellation nie vorher da gewesenen Situation – macht jeden Krieg zwischen diesen Konfliktparteien zum apokalyptischen Risiko.
Zur Beherrschung dieses Risikos gibt es keine Alternative. Selbst wenn die Ukraine glaubt, sie könne mit immer mehr westlichen Waffen und der aufopferungsvollen Tapferkeit ihrer Menschen den Krieg gewinnen und ihre territoriale Integrität wiederherstellen, widerspricht dies allen realistischen Möglichkeiten. Die USA und die anderen Staaten, die die Ukraine unterstützen, sind schon lange Kriegspartei. Somit haben auch alle das Recht und die Pflicht, auf Verhandlungen zu dringend. Die Interessen der USA und Europas sind nicht deckungsgleich. Zunächst ist und bleibt Russland Europas Nachbar.
Der Westen darf auch die Augen nicht davor verschließen, dass er sich an den menschenverachtenden Morden mitschuldig macht, indem er mit seiner Unterstützung die Ukraine zur Fortsetzung des Krieges anhält. Zudem ist es ein Irrglaube, mit immer härteren Sanktionen gegen Russland – und damit gegen uns selbst – können man Putin zum Einlenken bewegen. Unsere Gesellschaft ist nicht so gefestigt, dass sie über diese Frage nicht in zwei feindliche Lager zerfällt. Irrig ist es auch, darauf zu hoffen, das System Putin könne an innerem Auseinandersetzungen zerbrechen. Selbst wenn, ist mehr als unsicher, dass der nächste Machthaber ein bequemerer Verhandlungspartner wäre.
Die Schlussfolgerung: die beteiligten Akteure müssen alles dafür tun, der Diplomatie eine Chance zu geben, die Inhumanität zu beenden.
[Februar 2023]
»Mehr war nicht drin«
Der Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt hat keine Antwort gefunden, wie die Politik das Massenphänomen Migration menschenrechtbasiert lösen will.