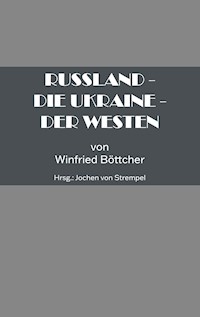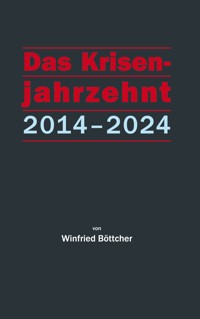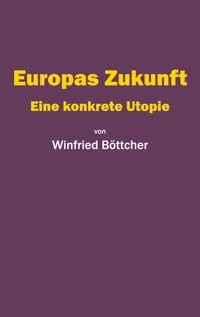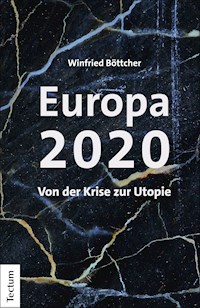
24,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Jahrzehnt von 2010 bis 2020 zeigt sich im Rückblick als eine Krise des humanen Fortschritts. An sechs Ereignissen belegt der Autor diese These mit Blick auf die besondere Rolle Europas: der Flüchtlingskrise, dem Ukraine-Konflikt, dem Brexit, der Natur als Politikum, dem Virus des Nationalismus und der Corona-Krise. Diese sechs Beispiele, die das vergangene Jahrzehnt erschütternd geprägt haben, werden auch im kommenden Jahrzehnt die politische Agenda be-stimmen. Die Europäische Union hat in ihrer derzeitigen Verfassung keine Zukunft. Eine Neugründung ist das Gebot der Stunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Winfried Böttcher Europa 2020
WInfried Böttcher
Europa 2020
Von der Krise zur Utopie
Tectum Verlag
Winfried Böttcher
Europa 2020
Von der Krise zur Utopie
© Tectum Verlag – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021
ePub: 978-3-8288-7485-5
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4462-9 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlag: Tectum Verlag, unter Verwendung des Bildes # 452159176
von Imagine Photographer | www.shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Nachdenkliches Hinführen
Es gibt einen Imperativ für die Zukunft.
Wenn die nachfolgenden Generationen noch
in einer lebens- und liebenswerten Welt leben wollen,
dann müssen wir uns radikal ändern,
und zwar sofort, und nicht erst morgen.
Artikel 1 des Grundgesetzes:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Kardinal Richelieu (1585–1642):
„Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen.“
Václav Havel (1936–2011):
„Ohne einen Traum für ein besseres Europa können wir kein besseres Europa schaffen.“
Ernst Gellner (1925–1995):
„Dass das Realexistierende auch das Vernünftige sei, gehört zu den schwachsinnigsten Behauptungen, die in der Philosophie je vertreten wurden.“
Walisische Autonomisten:
„Sich selbst zu regieren ist besser, als gut regiert zu werden.“
Denis de Rougemont (1906–1985):
„Die autonomen, selbstverwalteten und föderativen Regionen sind also die einzige Alternativezum Nationalstaat“, dort in der Region „ist der Raum der Bürgerbeteiligung,
wo der Mensch der Welt als auch sich selbst bewusst werden kann.“
Robert Menasse (*1954):
„Die Menschen sind doch in Wahrheit in ihrer Region verwurzelt, durch das Leben.
Was ist schon ‚nationale Identität‘, verglichen mit Heimatgefühl?
Heimat zu haben, ist ein Menschenrecht, nationale Identität nicht.
Die regionale Identität ist die Wurzel der europäischen.“
Inhalt
Nachdenkliches Hinführen
Inhalt
0 Intention des Buches
1 Zum Krisenbegriff
2 Das Krisenjahrzehnt
2.1 Der Beginn
2.2 Die Flüchtlingskrise
2.3 Der Ukraine-Konflikt
2.4 Der Brexit
2.5 Das Virus des Nationalismus
2.6 Die Natur als Politikum – Umwelt und Klimakrise
2.7 Die Corona-Krise – Eine Zeitenwende?
3 Was tun?
4 Das Mögliche ist das Reale
5 Zur Neugründung Europas
5.1 Europa – Eine Zustandsbeschreibung
5.2 Die doppelte Systemkrise
5.3 Ideologische Grundzüge von Staatlichkeit182
5.4 Europa – Eine regionalisierte europäische Republik
6 Epilog
7 Verwendete Literatur
8 Personenregister
Danksagung
0 Intention des Buches
Europa hat viele Krisen nach der doppelten Urkatastrophe des Ersten und Zweiten Weltkrieges durchlebt. Mit mehr oder weniger klugen Kompromissen wurde immer ein Ausweg gefunden. Ja, nicht selten schien Europa nach der Krise stärker als vorher. Wie wir schon bei Hippokrates (460–370) lernen können, eröffnet jede Krise auch gleichzeitig eine Chance für eine positive Entwicklung danach. Für gesellschaftliche Krisen trifft das allerdings nur dann zu, wenn diese nicht an den Grundfesten des Systems rütteln. Bei einem Teil unserer ausgewählten Krisen – Migration, Nationalismus, Umwelt und Klima – trifft dies in Gänze, bei den anderen in Teilaspekten zu.
Im Kapitel 5 des Buches begründe ich, warum wir in einer doppelten Systemkrise stecken, einer Krise, die in erster Linie eine Krise des Nationalstaates ist. Da die Europäische Union den Nationalstaat niemals überwunden hat, auf den Nationalstaaten gründet, reißt der Nationalstaat das europäische Projekt zwangsläufig mit hinein (vgl. hierzu Kap. 5.2).
Im ersten Teil des Buches habe ich neben den drei oben bereits erwähnten systemischen Krisen vier weitere Krisen – Finanzen, Ukraine, Brexit und Corona – ausgewählt, die Elemente unserer grundsätzlichen Krisenerscheinung aufweisen. An diesen sieben Krisenbeispielen können wir dann verdeutlichen, wie tief wir schon in einer Fundamentalkrise stecken, die nicht durch Kompromisse zu regeln, schon gar nicht zu lösen ist.
Bisher wurden Krisen, sowohl in einzelnen Nationalstaaten wie auch auf internationaler Ebene oder in der Europäischen Union, mehr oder weniger durch Kompromisse − nicht selten nur vorübergehend – geregelt. Sie konnten jederzeit wieder aufbrechen. Nur durch eine Beseitigung der Ursachen kann eine Krise gelöst werden.
Nach Beschreibung und Analyse der Krisen, die in den real-existierenden nationalen und internationalen Systemen, wozu auch die Europäische Union gehört, nicht zu lösen sind, mache ich einen Vorschlag für einen Systemwechsel. Ich beschränke mich allerdings nur auf die europäische Ebene.
Natürlich weiß ich, dass die Vorwürfe kommen werden, ich machte unrealistische Vorschläge. Ich weiß aber auch, dass vor jeder praktischen Umsetzung eine Idee steht und dass „keine Idee eine gute ist, die nicht am Anfang als völlig illusorisch erschien“ (Albert Einstein, 1879–1955).
Ich gehe also davon aus, dass der Nationalstaat seine historische Funktion erfüllt hat, zum Beispiel seinerzeit mit der Abschaffung des Feudalismus. Weiter gehe ich davon aus, dass mit den Nationalstaaten Europa nicht zu bauen ist, wie siebzig Jahre Integrationsversuche gezeigt haben.
Von daher schlage ich in einer Skizze in Kapitel 5.4 einen Systemwechsel vor, Europa ohne Nationalstaaten in einer Regionalisierten Republik neu zu gründen.
1 Zum Krisenbegriff
Der zentrale Begriff im ersten Teil des Buches heißt: Krise.
An sieben ausgewählten Krisenszenarien für das unruhige Jahrzehnt 2010 bis 2020 verdeutlichen wir unterschiedliche Veränderungsprozesse, die durch ganz unterschiedliche Krisen hervorgerufen wurden, auf ganz unterschiedlichen Feldern, und die ganz unterschiedlich noch andauern.
Alle ausgewählte Krisen – die Flüchtlingskrise, der Ukrainekonflikt, der Brexit, das Virus des Nationalismus, die Umwelt- und Klimakrise, die Coronakrise – zeigen in ihrer Breite und Tiefe individuelle, familiäre, gruppenspezifische, gesellschaftliche, regional-, national-, europa- und globalsystemische Facetten. So wird das Phänomen Krise an sieben Beispielen aus vielen Ecken beleuchtet.
(Im Weiteren zum Krisenbegriff übernehme ich das Kapitel aus meinem Buch Klassiker des europäischen Denkens 2014, teilweise überarbeitet und ergänzt.)
„Es ist wahr, der Persische Krieg übertrifft an Bedeutung alle Taten früherer Zeiten. Indessen war derselbe bald zu Ende, und alles wurde durch zwei Schlachten zu See und auf dem Lande entschieden“ (Thukydides 1925, I, 23, s. auch: III, 31–83).
Für Randolph Starn ist die „wichtigste und interessanteste Auslegung des Begriffs“ bei dem griechischen Arzt Hippokrates (460–377), einem Zeitgenossen von Thukydides, zu finden, wenn er über die Krise bei Krankheiten nachdenkt: „Die Krise tritt in Krankheiten immer dann auf, wenn die Krankheiten an Intensität zunehmen oder abklingen oder in eine andere Krankheit übergehen oder überhaupt ein Ende haben“ (Hippokrates: De affectionibus, zit. bei: Starn 1973, 53).
Aus dem Krisenbegriff bei Hippokrates können wir mehrere verallgemeinernde Schlüsse ziehen. Danach ist jede Krise ein offener Prozess. Der Ausgang ist nicht vorhersehbar, also nicht zwangsläufig. Je nach Verlauf der Krise entscheidet sich, ob sie eine Wendung zum Besseren oder zum Schlechteren nimmt. Jede Krise hält also Alternativen bereit, beinhaltet auch Chancen. Krisen sind beeinflussbar, beherrschbar, wenn das Krisenmanagement eine Vorstellung davon hat, welche Veränderungen durch die Krise erreicht werden sollen.
„In jedem Fall geht es hier um eine in sich unhaltbare Situation, die sich durch extreme Ambivalenz ihrer Entwicklungsmöglichkeiten auszeichnet und in der ,etwas geschehen muß‘. Genauer gesagt ist diese Situation eine objektive Gegebenheit, die bestimmte Subjekte unter Entscheidungs- und Aktionszwang setzt, weil sie eine Bedrohung von Zielen darstellt, die für diese Akteure unaufgebbar sind. Ein weiteres Merkmal des entscheidungstheoretisch konzipierten Krisenbegriffs ist der Zeitdruck. ,Krise ist ein Entscheidungsprozeß unter Zeitdruck‘ (Karl Deutsch)“ (Jänicke 1973, 33, vgl. auch: Vierhaus, in: Jordan 2002, 193–197).
Das ungewisse Nichtwissen erschwert die Lösung einer Krise, für die es eben d i e Lösung nicht gibt. Da Krisen immer ein offener Prozess sind, mit einer Art Janusgesicht, dem römischen Gott des Anfangs und des Endes, gibt es immer mehrere Möglichkeiten, Krisen zu bewältigen. Krisen offenbaren einen Zustand, der auf Veränderungen zielt. Individuelle Krisen sind niemals rückwärtsgewandt, sondern deuten in ihrem Prozess auf Zukünftiges hin. Selbst wenn eine Revolution durch eine Konterrevolution niedergeschlagen wird, ist der gesellschaftliche Zustand danach ein anderer.
Krisenbewältigung ist auch deshalb besonders kompliziert, weil es meist keine monokausale Erklärung für den Ausbruch einer Krise zu einer bestimmten Zeit gibt.
An drei Beispielen wollen wir noch den Krisenbegriff in gebotener Kürze illustrieren: Karl Marx (1818–1883), Jacob Burckhardt (1818–1897), Paul Valéry (1871–1945) (vgl. Böttcher, 2014, 387ff., 377ff., 480ff.).
Bei Marx waren Krise und Überproduktion zwei Seiten derselben Medaille. Für ihn entstanden Krisen durch eine massive Gleichgewichtsstörung von Produktion und Konsumption. Er ging von der These aus, dass im Kapitalismus ein Gleichgewicht nicht möglich sei, von daher in kapitalistischen Gesellschaften eine Krise die nächste ablöse. Erst die Aufhebung (im Hegelschen Sinne) der kapitalistischen Gesellschaft im Kommunismus könne wieder ein stabiles Gleichgewicht herstellen.
„Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut der Konsumptionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktionskräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde“ (MEW 1970, Bd. 25, 501, vgl. auch MEW 1971, Bd. 24, 318, Anmerkung, MEW 1972, Bd. 4, 466ff., Starn 1973, 55f., auch: Böttcher,2014, 387ff.).
„Überproduktionskrisen“ sind zunächst ökonomische Krisen, die jedoch mit zunehmender Verschärfung alle Gesellschaftsbereiche befallen.
Während Marx sein Krisenszenario als Auseinandersetzung zwischen Klassen entfaltet, untersucht Jacob Burckhardt in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ Krisen als Ursache für eine notwendige Weiterentwicklung der Gesellschaft. Ohne Krisen gibt es keinen gesellschaftlichen Wandel. Krisen, in denen „die politische und soziale Grundlage nie erschüttert wird“ (WB 1941, 260), können nicht als echte Krisen angesehen werden. Als „wahre Krise“ sieht er die Völkerwanderung, eine „Verschmelzung einer neuen materiellen Kraft mit einer alten, welche aber in einer geistigen Metamorphose, aus einem Staat zu einer Kirche geworden, weiterlebt“ (ibid., 261).
Grundsätzlich sind Krisen etwas Positives. Mit „Leidenschaft“ werden „ungeahnte Kräfte“ freigesetzt, „die etwas Neues und nicht nur das Umstürzen des Alten“ wollen (ibid., 288).
Selbst den Krieg als Urkatastrophenkrise sieht Burckhardt, anknüpfend an Heraklit (535–475), nicht nur negativ. Es sind wohl im Wesentlichen vier Gedanken Heraklits, an die Burckhardt anknüpft: „Alles Geschehen erfolge infolge eines Gegensatzes. […]. Das Widerstrebende vereinige sich und aus den entgegengesetzten (Tönen) entstehe die schönste Harmonie, und alles Geschehen erfolge auf dem Wege des Streites. […] Kampf ist der Vater von allem, der König von allem; […] Man muss wissen, daß der Kampf das Gemeinsame ist und das Recht der Streit und daß alles Geschehen vermittels des Streites und der Notwendigkeit erfolgt“ (Herakleitos in: Capelle 1963, 133ff.).
Allerdings „müsste es womöglich ein gerechter und ehrenvoller Krieg sein, etwa ein Verteidigungskrieg, […]“ (WB 1941, 255).
Da sich die „geistigen Entwicklungen“ nicht kontinuierlich, vielmehr „sprung- und stoßweise“ äußern, ist eine Krise „ein neuer Entwicklungsknoten, der aufgelöst werden muss. Dies gilt sowohl für die Entwicklung des Individuums“ als auch für die gesamte Gesellschaft.
„Die Krisen räumen auf: zunächst mit einer Menge von Lebensformen, aus welchen das Leben längst entwichen war, und welche sonst mit ihrem historischen Recht nicht aus der Welt wären wegzubringen gewesen. […] Die Krisen beseitigen auch die ganz unverhältnismäßig angewachsene Scheu vor ,Störung‘ und bringen frische und mächtige Individuen empor“ (ibid., 289, vgl. auch: Böttcher, 2014, 377ff.).
Ganz unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges, der dem „kleine(n) alte(n) Kontinent“ nichts als „Elend, Zerstörung und Tod“ gebracht hat, der die europäische Kultur im „Innersten getroffen“ hat, in dem die gesamte Zivilisation „ihren eigenen Ruin“ erzeugt hat, unter diesem Eindruck erläutert Paul Valéry sein Krisenverständnis (vgl. Valéry 1995, 531).
„Krise ist der Übergang von einer bestimmten Ordnung des Verdichtens zu einer anderen; ein Übergang, der an gewissen Zeichen und Symptomen spürbar wird. Während einer Krise scheint die Zeit ihr Wesen zu verändern; die Zeitdauer wird auf andere Weise wahrgenommen als beim normalen Stand der Dinge; statt den Beharrungszustand zu messen, mißt sie die Veränderung. Voraussetzung jeder Krise ist die Intervention neuer ,Ursachen‘, die ein labiles oder stabiles Gleichgewicht, das vor dem Bestand, erschüttern“ (ibid., 55).
Allen in diesem Buch ausgewählten Krisen ist gemeinsam die Frage, was die Krise für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nach der Krise bedeutet. Die Zeit danach wird nicht zuletzt dadurch bestimmt, in welcher Art und Form die Krisenmanager auf der einen Seite miteinander umgehen und die von der Krise unmittelbar Betroffenen die zwangsläufigen Einschränkungen akzeptieren. Jede Krise ist in ihren Anforderungen an die Menschen mehrdimensional: biologisch, sozial, kulturell, rechtlich, ökonomisch, politisch u.a. Natürlich müssen nicht alle Variablen bei allen Krisen gleichzeitig auftreten. Je mehr Variablen, desto schwieriger die Bewältigung.
Fazit in Thesen:
• Krisen sind normale, historische mehrdimensionale Erscheinungen, die für die Herbeiführung eines gesellschaftlichen Wandels notwendig sind.
• Krisen signalisieren frühzeitig Symptome des Übergangs von einem gesellschaftlichen Aggregatzustand in einen anderen.
• Krisen erschüttern mehr oder weniger, je nach Intensität, Verlauf und Krisenmanagement die ökonomischen, sozialen und politischen, manchmal auch die kulturellen Grundlagen einer Gesellschaft.
• Krisen sind ein offener Prozess mit Alternativen, erzeugen einen Entscheidungsdruck auf die handelnden Akteure und haben einen ungewissen Ausgang.
• Nach der Bewältigung einer Krise ist der Rückfall in den alten Zustand nicht möglich, d.h. jede Krise verändert den jeweils gegenwärtigen Zustand in jedem Fall und eröffnet somit Zukunft.
2 Das Krisenjahrzehnt
2.1 Der Beginn
Das Krisenjahrzehnt 2010 bis 2020 begann eigentlich schon im Jahr 2008 mit dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers. Zwar löste dies eine weltweite Finanzkrise aus, jedoch war sie nur ein Symptom für tieferliegende Ursachen. Seit dem Untergang der Sowjetunion 1990 befindet sich die Welt in einer neuen Realität. Das atomare Patt, das eine Koexistenz der Systeme garantierte, verlor seine Wirkung. Die Welt wurde multipolar. Der kapitalistische Westen glaubte, sein System werde sich nun weltweit endgültig durchsetzen. Welch ein Irrglaube.
Auf drei der tieferliegenden Ursachen, die heute die Menschen verunsichern, werde ich kurz eingehen: die Globalisierung, den Kapitalismus und die Vertrauenskrise der Bürger*innen.
Der globale Weltmarkt, die Gier Profitmaximierung schränken mehr und mehr politisches Handeln ein. Die „Ideologie der Weltmarktherrschaft“ blendet außer der ökonomischen Dimension weitgehend andere Dimensionen aus, wie etwa die ökologische, kulturelle, soziale, zivilgesellschaftliche und politische. In einer global vernetzten Welt lässt sich das Hauptziel am besten optimieren, wenn „Staat, Gesellschaft, Kultur und Außenpolitik wie ein Unternehmen geführt werden. Es handelt sich in diesem Sinne um einen Imperialismus des Ökonomischen […]“ (Beck/Lange, 7).
Die Globalisierung lebt von einer offenen Weltgesellschaft. „Geschlossene Räume“ sind nur noch eine Fiktion. Alles, was sich in der Welt abspielt, selbst anscheinend nur örtliche Vorgänge, betreffen in gewisser Weise die ganze Welt. „Globalität so verstanden, kennzeichnet die neue Lage der ‚Zweiten Moderne‘. Dieser Begriff bündelt damit zugleich elementare Gründe dafür, warum die Standardantworten der ‚Ersten‘ für die ‚Zweite Moderne‘ untauglich und widersprüchlich werden. Politik muss für die ‚Zweite Moderne‘ neu begründet und neu erfunden werden“ (ibid., 8).
In der ‚Ersten Moderne‘ konnten noch Räume, nämlich Nationalstaaten mit ihren Nationalgesellschaften, ökonomischem und anderem Handeln, „Macht- und Konkurrenzverhältnisse“ zugeordnet werden. Die ‚Zweite Moderne‘, damit die Globalisierung, ist gekennzeichnet durch Grenzenlosigkeit auf der einen sowie durch Dichte und Stabilität von Beziehungsgeflechten, zwischen einer schier unübersehbaren Anzahl von Akteuren auf der anderen Seite. So haben wir es nicht nur mit 193 mehr oder weniger selbstständigen Staaten zu tun, sondern auch mit 45000 NGOs weltweit (vgl. Megrew, 17). Globalisierung bezieht sich somit auf eine „Weltgesellschaft ohne Weltstaat und Weltregierung“ (Beck/Lange, 8).
Nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges und mit dem Frieden von Münster und Osnabrück, dem Westfälischen Frieden 1648, hat das Moderne Staatensystem begonnen. Dieses System beruht auf den Grundsätzen der Territorialität, der Souveränität und der Unabhängigkeit nach Innen. Dieses mehr oder weniger gut funktionierende internationale System befindet sich spätestens seit 1990 in einer neuen Phase der Transformation.
Anthony Megrew setzt den Beginn der ersten von drei Wellen der Globalisierung 200 Jahre vor dem Westfälischen Frieden an. Hierüber besteht in der Literatur ein weitgehender Konsens. Mit der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts beginnt also danach die Moderne.
„In the first wave, the age of discovery (1450–1850), globalization was obsessively shaped by European expansion and conquest. The second wave (1850–1945) evidenced a major expansion in the spread and entrenchment of European empire. By comparison, contemporary globalization (1960 on) marks a new epoch in human affairs. Just as the industrial revolution and the expansion of the West in the nineteenth century defined a new age in the world history, so today the microship and the satellite are icons of a globalized world order“ (Megrew 2008, 22).
Einen neuen Schub hat die Globalisierungswelle mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem unaufhaltsamen Aufstieg Chinas erfahren. Seit 1990 befinden wir uns in einer vierten Welle der Globalisierung.
Seit den 1980er-Jahren findet eine zunehmende „Entstofflichung“ der Märkte statt. Die elektronische Kommunikation hat fundamental die Art und Weise geändert, wie Staaten, Märkte und Individuen weltweit miteinander umgehen. Jedes lokale Ereignis in einem Teil der Welt ist unmittelbar in dem anderen Teil verfügbar. Man kann also von einer exponentiellen Beschleunigung der Globalisierung sprechen. Von daher ist sie weder planbar noch gestaltbar noch beherrschbar. Dies betrifft zunehmend vor allem den Finanz- und Dienstleistungssektor. Beide Sektoren machen sich immer stärker unabhängig von der realen Warenwelt. Am Devisenmarkt kann man besonders gut diese zunehmende Beschleunigung bei gleichzeitig fehlender Kontrolle demonstrieren.
„Seit den achtziger Jahren hat sich das Finanzwesen entlang einer ganz anderen Wachstumsphase entwickelt als andere globalisierte Sektoren, die ebenfalls immens angewachsen sind. Seit 1980 ist der Gesamtbestand der finanziellen Akten dreimal schneller gewachsen als das gesamte Bruttoinlandsprodukt der 23 hochentwickelten Länder, aus denen sich während dieser Zeit die OECD hauptsächlich zusammensetzte; das Volumen des Handels mit Devisen, Wertpapieren und Aktien ist ungefähr fünfmal schneller gewachsen und übertrifft das gesamte BIP jetzt bei Weitem. […]. Der Wert der jährlichen Devisengeschäfte betrug 1983 das Zehnfache des gesamten Welthandels, 2004 aber war er das Siebzigfache, wobei auch der Welthandel über diesen Zeitraum stark gewachsen war. Im Jahr 2001 betrug der durchschnittliche Tagesumsatz der Devisenmärkte 1,3 Billionen [Dollar], 2004 waren es 1,8 Billionen, das macht beinahe ein Fünftel des Wertes des Welthandels für das gesamte Jahr 2003 aus“ (Sassen 2008, 404f.).
Diese Entwicklung setzt sich seitdem ungebremst fort, 2007 waren es bereits 3,3 Billionen, 2010 ca. 3,9 Billionen, 2013 ca. 5,3 Billionen (vgl. Statista 2014). Im Jahr 2010 betrug der tägliche Devisenhandel bereits mehr als 25 Prozent des jährlichen Welthandels.
Auf die sogenannte „Entstofflichung“ der Märkte können die einzelnen Nationalstaaten keinen, internationale Zusammenschlüsse wie die Europäische Union nur bedingt Einfluss nehmen.
„Im Hinblick auf die Zähmung des wildgewordenen Finanzkapitalismus kann sich niemand über den majoritären Willen der Bevölkerung täuschen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus konnte im Herbst 2008 das Rückgrat des finanzmarktgetriebenen Weltwirtschaftssystems nur noch mit Garantien von Steuerzahlern vor dem Zusammenbruch gerettet werden. Und diese Tatsache, dass sich der Kapitalismus nicht mehr aus eigener Kraft reproduzieren kann, hat sich seitdem im Bewusstsein von Staatsbürgern festgesetzt, die als Steuerbürger für das ,Systemversagen‘ haften müssen“ (Habermas 2011, 117).
Die europäische Währungsunion war schon bei ihrer Gründung im Maastrichter Vertrag (1992) mit einem „Geburtsfehler“ behaftet. Damals waren die Experten in ihrer Beurteilung gespalten. Die Befürworter des heute existierenden Systems glaubten, mit Hilfe einer einheitlichen Währung auch eine politische Einigung zu erreichen. Sie vertraten dies, obwohl es historisch kein Beispiel gibt, das diese Auffassung hätte bestätigen können.
Die zweite Gruppe war dagegen der Meinung, nur eine vorher erreichte politische Union rechtfertige als „Krönung“ eine gemeinsame Währung. Wie es aussieht, hat – zumindest bis heute – diese zweite Gruppe Recht behalten. Weitgehend einig sind sich die Experten in der Begründung für diese Krise.
Den Herausforderungen der heutigen Zeit sind die Nationalstaaten nicht mehr gewachsen. Die Märkte sind globalisiert, schnell in ihren weltweiten Reaktionen, die Staaten sind nach wie vor nationalisiert, schwerfällig in ihren Reaktionen, oft auch starr und gelähmt. In Zeiten, als der Euro noch zu funktionieren schien, hat die Eurozone verabsäumt, eine gemeinschaftliche Budgetplanung, eine einheitliche Finanz- und Steuerverwaltung und europäische Obligationen einzurichten.
Bevor man die Finanz- und Steuerunion in Angriff nimmt – sie geht mit erheblichem Souveränitätsverlust einher – muss zunächst einmal die Schuldenproblematik ins Zentrum der Entscheidungen rücken. Die Probleme der Altschulden, der Vergemeinschaftung der Schulden und einheitlicher Regeln für die Aufnahme von neuen Schulden müssen gelöst werden.
Die Forderung, insbesondere von Deutschland, zunächst müsse Ordnung in den einzelnen Nationalstaaten zu Hause geschaffen werden, um davon Solidarität abhängig machen zu können, führt zu mehr Renationalisierung als zu mehr Gemeinschaft. Hätte man zu Beginn der Krise, als Griechenland von den Ratingagenturen herabgestuft wurde, Solidarität mit Griechenland geübt, wäre die Bewältigung der Krise sehr viel billiger geworden. Aber so weitsichtig waren die Staats- und Regierungschefs nicht, gemeinsam für die griechischen Anleihen gerade zu stehen. In diesem Punkt ist Deutschland besonders seiner Verantwortung als größte Volkswirtschaft Europas nicht gerecht geworden (vgl. Cohn-Bendit/Verhofstadt 2012, insbes. 88ff., zur Staatsschuldenkrise ausführlich: Welfens 2012, Berlin).
Dramatischer noch als die Finanzkrise ist die mit ihr einhergehende Vertrauenskrise der Bürgerinnen und Bürger.
„Aber all die leidvolle Erfahrung, die wir heute mit unserer Währung machen, diese Krise, die enormen Kosten, die Vernichtung von Lebensqualität von Millionen, die Vernichtung von Chancen, die Vernichtung von Planungssicherheit (Einkommen, Pensionen), die Vernichtung von sozialen Netzen, all das haben wir, hat die davon betroffene Mehrheit der Menschen den von ihnen gewählten Repräsentanten ihrer nationalen Interessen im Europäischen Rat zu verdanken“ (Menasse 2012, 54).
Die vielen Krisen der europäischen Integrationsversuche (z.B. die gescheiterte EVG 1954, der leere Stuhl 1966, die Eurosklerose ab 1970) haben eine gemeinsame Erkenntnis gebracht. Sie zeigen ein Krisenmanagement der politischen Akteure, das immer wieder kurzfristig Krisen regelt, aber nicht die Ursachen beseitigt, sie somit also nicht löst. Eine Krisenlösung ist nur durch einen Systemwechsel zu erreichen. Dafür müssen wir jedoch die Frage beantworten, in welchem Europa wir leben wollen. Hierfür reicht nicht der Formelkompromiss, der seit fast 60 Jahren lautet: „den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, […], weiterzuführen“ (EUV, Präambel). Auf die Formel – Entschlossen, eine Föderation der Völker Europas zu schaffen – konnte man sich nicht einigen.
Auf diese Fragen komme wir im zweiten Teil des Buches zurück und schlagen einen grundsätzlichen Systemwechsel vor. Wir denken, Europa muss sich ein Wort von Friedrich Nietzsche (1844–1900) (leicht abgewandelt) zu eigen machen:
„Die Zeit für kleine Politik ist vorbei“, es gilt der „Zwang zur großen Politik“ (Nietzsche 1953, Bd. 2, 672).
2.2 Die Flüchtlingskrise
Vorbemerkung
„Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und die Ungezwungenheit unserer Gefühle. Wir haben unsere Verwandten in den polnischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden, und dies bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt“ (Arendt, 2018, 10f.).
Mit solch eindrucksvollen, zeitlosen Worten beschreibt Hannah Arendt die Verzweiflung, die jeder Flüchtling fühlt, wenn er gezwungen wird, seine Heimat zu verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Und uns, die wir zufällig in einer besseren Welt leben dürfen, fehlen die Antworten auf das „Massenphänomen der Gegenwart“, die Flüchtlingskrise.
Die Rechtslage
Migration gibt es, seit der Mensch sich aufgemacht hat, Räume zu besiedeln. Von Anbeginn, als der Homo Sapiens vor ca. 400000 Jahren vom Süden in den Norden einwanderte, war Migration ein fester Bestandteil unserer Lebensweise. Flüchtlinge, wie wir sie heute verstehen, können wir in relevantem Ausmaße erstmals nach der Zeit der konfessionellen Auseinandersetzungen im Frankreich des 16./17. Jahrhunderts ausmachen.
Heinrich IV. (1553−1610) zog im Edikt von Nantes (1598) einen Schlussstrich unter die Religionsstreitigkeiten. Die calvinistischen Protestanten erhielten mit der Religionsfreiheit die vollen Bürgerrechte. Fast hundert Jahre später, 1685, widerrief Ludwig XIV. (1638−1715) das Edikt. Damit beraubte er die französischen Protestanten sämtlicher religiöser und bürgerlicher Rechte und löste eine Massenflucht der sogenannten Hugenotten aus (vgl. Ploetz, 2008, 762, 998f., 1004).
Bis zum 19. Jahrhundert bezog sich das Wort „Flüchtling“ wesentlich auf die Hugenotten. In Deutschland gab es im 19. Jahrhundert das Wort „Flüchtling“ als eigenständigen Begriff nicht. Herders Staatslexikon von 1889 verweist unter dem Begriff „Flüchtling“ auf „Auslieferung“. Auch die „Encyclopaedia Britannica“ von 1910 kennt das Wort „refugee“ nicht als selbstständigen Terminus. Beide Lexika beschäftigen sich mit dem Asylrecht, indem sie bis auf das Altertum zurückverweisen. „Schon im Altertum galten die heiligen Stätten als Zufluchtsorte für Verfolgte und Schutzsuchende (Staatslexikon, 1889, 515). Allerdings: „Das Asylrecht ist in seiner historischen wie rechtstechnischen Ausgestaltung nicht etwa ein Recht der Flüchtlinge auf Aufenthalt im fremden Staate, sondern ein Recht des Staates, ihn bedingungsweise zu dulden“ (ibid., 518).
Das 20. Jahrhundert war dasjenige der Massenvertreibung und der Flüchtlingsströme. Es begann mit der Bildung von zusätzlich 20 neuen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg. Völker wurden auseinandergerissen, Minderheiten willkürlich geschaffen und Massenflucht ausgelöst. Dies setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg nahtlos fort. Allein die Bundesrepublik Deutschland hat zwischen 1945 und 1988 vierzehn Millionen Flüchtlinge aufgenommen (vgl. Sassen, 1996, 99ff.).
Das wichtigste internationale Abkommen über Aufnahme, Behandlung und Rechtsstellung der Flüchtlinge ist die Konvention von 1951 und das Protokoll von 1967 (vgl. UNHCR, 1951/1967).
Schon die Präambel hebt hervor, dass auch für Flüchtlinge die Menschenrechte und Grundfreiheiten gelten, dass alle Staaten den sozialen und humanitären Charakter des Flüchtlingsproblems anerkennen und dass dadurch zwischenstaatliche Spannungen vermieden werden.
Nach dieser Konvention wird als Flüchtlinge eine Gruppe anerkannt, die „aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will“ (ibid., 2).
Dieser Konvention und/oder dem Protokoll sind 145 Staaten beigetreten.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, als das weitere wichtige Dokument, garantiert jedem Menschen das Recht auf Freizügigkeit und die freie Wahl des Wohnsitzes innerhalb eines Staates (Art. 13). Das Recht auf Asyl und Schutz in anderen Ländern zu suchen, legt Artikel 14 fest. Auch hat jeder Mensch das Recht auf eine eigene Staatszugehörigkeit, die ihm nicht willkürlich entzogen werden darf. Eingeschlossen ist hier die Möglichkeit, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln (vgl. Musulin, 1962, 150ff.).
Das in unserem Zusammenhang besonders wichtige Dokument ist das Dublin-Abkommen von 1997, geändert 2013, das die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union regelt, insbesondere das Asylverfahren. Ohne auf die Einzelheiten einzugehen, interessiert hier vor allem, in welchem Land Einreisende in die Europäische Union ihren Asylantrag stellen dürfen. Drittstaatsangehörige oder Staatenlose müssen dort ihren Antrag stellen, wo sie erstmalig den Boden eines EU-Landes betreten. Das ist die Regel für ein geordnetes Verfahren. Zwar regelt der Artikel 13, Absatz 1 der Verordnung 604/2013 des Europäischen Parlaments, Dublin III, die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bei illegalem Grenzübertritt, scheitert allerdings, wenn es zu einer Massenbewegung von Flüchtlingen nach Europa kommt. Aber nicht nur für die größte Massenbewegung seit derjenigen nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 2015 ist die Regelung in diesem Artikel ungeeignet. Auch versagt er bei der Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtung der Europäischen Union gegenüber den Schutzsuchenden, die über das Mittelmeer nach Griechenland oder Italien flüchten.
Nicht der Wortlaut des Artikels 13 versagt, sondern das unsolidarische Verhalten einiger Mitgliedstaaten, sich an einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in der Europäischen Union zu beteiligen, wie Ungarn, Polen, Bulgarien und Rumänien.
Das bedrohlich Fremde
Im Dritten Definitivartikel zum ewigen Frieden formuliert Immanuel Kant (1724−1804):
„Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen H o s p i t a l i t ä t eingeschränkt sein“.
„Es ist hier, wie in dem vorigen Artikel, nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden“ (Kant, 1794/2013, 21).
Kant verweist darauf, dass der Fremde keinen Anspruch auf ein Gastrecht hat, wohl aber auf ein Besuchsrecht, „welches allen Menschen zusteht“, solange sie sich friedlich verhalten.
Von einem „Weltbürgerrecht“ sind wir fast 220 Jahre nach Kants Tode weit entfernt.
Tagtäglich werden wir konfrontiert mit bei uns schutzsuchenden Menschen, die durch Krieg oder Hunger gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.
Bei vielen Menschen – nicht nur in Europa – lösen die Fremdlinge Angst aus. Hierfür können viele Gründe angeführt werden. Zunächst ist die Angst tief eingeprägt in die menschliche Psyche. Alles, was einem fremd ist, verunsichert einen, macht einen vorsichtig. Fremdheit verbindet man mit Gefahr.
„Fremde lösen gerade deshalb Ängste aus, weil sie ‚fremd‘ sind – also auf