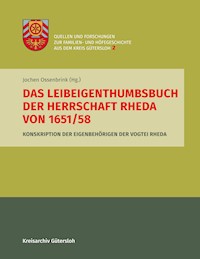
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Quellen und Forschungen zur Familien- und Höfegeschichte aus dem Kreis Gütersloh
- Sprache: Deutsch
Mauritz Graf zu Bentheim-Tecklenburg hat 1651/58 in einem Leibeigenthumbsbuch auf 103 Höfen und Kotten, die zu seiner Herrschaft Rheda gehörten, die ihm eigenbehörigen Leute in den Kirchspielen Clarholz, Herzebrock, Rheda, St. Vit und Wiedenbrück aufschreiben lassen. Die bäuerlichen und kleinbäuerlichen Besitzer sind darin mit ihren Geschwistern und ihren Kindern sowie den noch lebenden Vorbesitzern namentlich erfasst worden. Angaben zur Herkunft der aufheiratenden Ehepartner und zum Verbleib der ausbestatteten Söhne und Töchter ergeben familiäre Verbindungen zu 180 anderen Höfen und Kotten. Alles Heiraten geschah in einer grundherrschaftlichen Gemengelage und bei einem Wechsel der Grundherrschaft meistens noch durch Tausch der Eigenbehörigen, an dem hier 25 Gutsherren beteiligt waren. Das vorherrschende Anerbenrecht zwang daneben 25 Familien nicht erbender Kinder zu einem Heuerlingsdasein auf der elterlichen oder einer fremden Stätte. Das Leibeigenthumbsbuch bietet so für die letzten Jahrzehnte des Dreißigjährigen Krieges und das erste Jahrzehnt danach einen einzigartigen Einblick in die ländlich-bäuerlichen Familienverhältnisse. Die landesherrliche Erfassung ist die erste ihrer Art für die Rhedaer Eigenbehörigen und steht damit am Anfang vieler Familiengeschichten in der Herrschaft Rheda und im Wiedenbrücker Land, die sich mit den gleichzeitig beginnenden Kirchenbüchern fortschreiben lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinem Förderer
Moritz Graf zu Bentheim-Tecklenburg
Betreuer des Fürstlichen Archivs Rheda
geboren am 27. Oktober 1881 in Würzburg
gestorben am 22. Februar 1967 in Rheda
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Die „Herren“ im Hause Rheda
Die Verfasser des Lager- und Leibeigenthumbsbuches
Hinweise zur Edition
Weitere Quellen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Glossar
Gliederung des Editionstexts
Editionstext
Register
Vorwort
Christian Loefke hat unsere als Gemeinschaftswerk konzipierte Reihe mit dem ersten Band über die Eigenbehörigen der Stadt Wiedenbrück begonnen. Ihm danke ich für seine Anregungen und Hilfestellungen sowie die technische Realisation meines Beitrages, den ich hiermit vorlege.
Der zweite Band der neuen Schriftenreihe des Kreisarchivs Gütersloh, „Quellen und Forschungen zur Familien- und Höfegeschichte aus dem Kreis Gütersloh“, wendet sich der Herrschaft Rheda zu, die 1815 mit dem Amt Reckenberg und der Grafschaft Rietberg zum Kreis Wiedenbrück vereinigt wurde. Hier ist unmittelbar nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges eine familiengeschichtlich hochbedeutsame Quelle entstanden, die die damals einsetzende Kirchenbuchführung ergänzt und mit ihren Angaben darüberhinaus zurückreicht.
Das 1651 angelegte „Lager- und Leibeigenthumbsbuch“ verzeichnet „alle diejenigen“, die den Grafen zu Bentheim-Tecklenburg etc. an deren Haus Rheda „mit Leibeigenthumb verhafft(et)” waren. Das Buch erfasst demnach auf den ersten Blick die „Leibeigenen” des Landesherrn als Besitzer des „Hauses Rheda” unabhängig von ihren Wohnorten innerhalb und außerhalb der „Herrschaft Rheda”. Bei näherer Betrachtung handelt es sich aber nur um alle gräflichen Leibeigenen, die zur Vogtei Rheda zählten, einer von zwei Verwaltungseinheiten innerhalb der Herrschaft Rheda, die neben der Vogtei Gütersloh bestand. Der Vogtei Rheda unterstanden neben rund einhundert inländischen Höfen und Kotten auch ein halbes Dutzend Höfe und Kotten im benachbarten Amt Reckenberg, deren Besitzer den Herren von Rheda ebenfalls „leibeigen” waren.
Im Titel des Buches hat der Verfasser auch ein „Lagerbuch” angeführt. Hierunter wäre ein Verzeichnis aller Güter des Hauses Rheda mit ihren Bestandteilen und den Belastungen zu erwarten. Diese Angaben fehlen hier vollständig. Stattdessen sind aus der Hand desselben Verfassers Fragmente eines eigenständigen Lagerbuches überliefert, das er wohl nicht mehr hat vollenden können.[1]
Im Buchtext kommt der Begriff des „Leibeigenen” nicht vor. Hier ist stattdessen von „Eigenbehörigen” die Rede. In der Herrschaft Rheda und in den ihr benachbarten Territorien bezeichnen beide Begriffe in gleicher Weise die rechtliche Stellung der von ihren Gutsherren abhängigen bäuerlichen Bevölkerung und ihre Nachkommenschaft, soweit diese sich nicht durch Freikauf und Freilassung aus ihrer Bindung an den Gutsherrn befreit hatte. Die Leibeigenschaft bzw. Eigenbehörigkeit ergab sich aus den auf dem platten Land vorherrschenden Besitzverhältnissen. Während die Gutsherren ihre Güter gegen Abgaben und Dienste zur Nutzung überließen und so das Obereigentum daran beanspruchten, waren ihre Bauern und Kötter von ihnen persönlich abhängig und ihnen gegenüber abgabe- und dienstpflichtig, durften als erblich nutzungsberechtigte Untereigentümer aber erwarten, dass jeweils eines ihrer Kinder das elterliche „Erbe” antreten und sie selbst im Alter hier die „Leibzucht” genießen konnten.
Nachdem die Rechtsverhältnisse zwischen den Gutsherrn und ihren Leibeigenen in der frühen Neuzeit noch nach altem Herkommen gepflegt worden waren, sind sie für Minden und Ravensberg sowie Osnabrück und Münster im 17. und 18. Jahrhundert in besonderen Eigentumsordnungen kodifiziert worden. Das 1770 für das Fürstbistum Münster erlassene Gesetz hat die Herrschaft Rheda 1784 übernommen. Im Zuge der Umwälzungen, die sich durch die französische Revolution von 1789 ergaben, hat Napoleon die Leibeigenschaft im Jahre 1808 für das Großherzogtum Berg und so auch für die ehemalige Herrschaft Rheda aufgehoben. Damit entfielen die persönlichen Bindungen an den Gutsherrn, während die sich aus der Nutzung ihrer Güter ergebenden Verpflichtungen der ehemaligen Leibeigenen erst im Laufe des 19. Jahrhunderts abgelöst werden konnten.[2]
Das Leibeigenthumbsbuch war mir schon vor 60 Jahren bei meinen Archivbesuchen mit Graf Bentheim in Rheda aufgefallen und ist von mir dann erstmalig abgetippt worden. Nach längerer Unterbrechung konnte ich meine Studien in den Quellen des Fürstlichen Archivs im Westfälischen Archivamt in Münster fortsetzen. Dabei bin ich von den Herren Dr. Horst Conrad, Dr. Peter Worm und Dr. Daniel Droste immer bestens beraten und unterstützt worden. Ihnen gilt mein Dank ebenso wie den Damen und Herren, die im Lesesaal die Aufsicht geführt und im Verborgenen meine Wünsche bearbeitet haben. Die bewundernswerte Nachsicht meiner Frau Mechtild geb. Oppermann und ihre immerwährende Unterstützung haben es mir letztlich ermöglicht, diese Quelle für den Druck zu bearbeiten.
Gummersbach, im Juli 2022
Jochen Ossenbrink
1 FA Rha.E.AK II R 88: Lagerbuch der rhedischen Eigenbehörigen (ohne Datum, wohl nach 1660).
2 Vgl. zur Eigenbehörigkeit bzw. Leibeigenschaft in der Herrschaft Rheda die Untersuchungen des Verfassers in: MEIER/OSSENBRINK, Leben unter dem Krummstab, S. 397-510 u. 546-552. Ebenso in: OSSENBRINK, Kirchspiel Herzebrock, sowie in: OSSENBRINK, Kleinstaat im Alten Reich.
Einleitung
Die Grafen von Tecklenburg konnten sich nach einer 125 Jahre hindurch geführten verlustreichen Fehde mit den Edelherren zur Lippe in einem Friedensschluss von 1491 als Herren in Rheda durchsetzen. Im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts wurden ihre Herrschaftsansprüche hier aber erneut und zwar vom Osnabrücker Fürstbischof angegriffen und zum Teil erfolgreich geschmälert. Im Ergebnis mussten sie auf den zuvor behaupteten östlichen und südlichen Teil des Kirchspiels Gütersloh und auf eine der beiden Bauerschaften des Kirchspiels St. Vit verzichten. Im Bielefelder Rezess von 1565 wurde ihnen ein Territorium von rund 160 qkm zugestanden, dass sie bis zum Ende des Alten Reichs behaupteten. Dazu gehörten einerseits die Stadt und das Kirchspiel Rheda, die zum Kirchspiel Wiedenbrück zählende Bauerschaft Ems sowie die Kirchspiele Herzebrock, Clarholz und Lette, die zusammen die Vogtei Rheda bildeten, sowie andererseits das Dorf Gütersloh mit den Gütersloher Bauerschaften Pavenstädt, Blankenhagen und Nordhorn mit Sundern, für die es eine eigene Vogtei in Gütersloh gab.[3] Diese Zweiteilung hatte ihre Entsprechung im fürstbischöflich-osnabrückischen Amt Reckenberg, das die Vogtei Langenberg und die Wöstevogtei kannte.[4]
Im frühen 16. Jahrhundert waren die Klöster Herzebrock, Clarholz und Marienfeld sowie einzelne Burgmannsfamilien neben den Grafen von Rietberg die meistbegüterten Grundherren innerhalb der damals noch größeren Herrschaft Rheda. Der Herrschaftsanspruch der Grafen von Tecklenburg stützte sich insbesondere auf die Edelvogteien über die genannten Klöster, auf eine noch eher kleine eigene Grundherrschaft sowie auf die Besteuerung der Untertanen und die Rechtsprechung durch die eigenen Freistühle. Aus dem Nachlass Walters von Varensell konnten die Tecklenburger ab 1530 umfangreichen Grundbesitz im Kirchspiel Gütersloh und weitere einzelne Güter in den Kirchspielen Rheda und Herzebrock erwerben. Seither griffen Graf Konrad von Tecklenburg und seine Nachfolger auch massiv in die Markenhoheit der Herzebrocker Äbtissin und der Gütersloher Kirche ein, indem sie zahlreich neue Siedlungsstellen zuließen und weitere Zuschläge aus den Marken erteilten.[5]
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts verzeichnete der Notar und Klostersekretär Arnold Hermann Böemken im Kirchspiel Herzebrock und in der Clarholzer Bauerschaft Heerde allein 50 Siedlungsstellen, die hier nach Herzebrocker Auffassung widerrechtlich entstanden waren. Von fünf weiteren Kotten wurde angenommen, dass sie der Landesherr aus ursprünglich Herzebrocker Abhängigkeit entfremdet hatte.[6] Die Hinweise Böemkens werden in der nachfolgenden Übersicht ergänzend wiedergegeben. Schließlich gerieten zwei weitere Kotten in die Eigenbehörigkeit des Landesherrn, weil dieser das Patronat über die Kirchen und Kapellen in Rheda ausübte, nämlich der in der Bauerschaft Ems gelegene und der Rhedaer Kirche gehörende Papenbreer[7] und der ehemals altarfreie uffm Tran gen. Cordes in Groppel, der einst im Schutze der Rhedaer Burgkapelle gestanden hatte.[8] Im Laufe und gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges sahen sich darüberhinaus einzelne Adelige gezwungen, ihre Güter zu verkaufen. Die Herren von Rheda nutzten auch diese Gelegenheit, ihre Grundherrschaft zu vergrößern. In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht der eigenbehörigen Erben und Kotten werden diese Erwerbungen im einzelnen belegt.
Im Jahre 1651 legte der Rhedaer Notar und Gerichtsschreiber Christoph Stambler als Hausvogt in Rheda ein „Lager- und Leibeigenthumbsbuch” an, in dem alle Leibeigenen bzw. Eigenbehörigen des Hauses Rheda verzeichnet werden sollten.[9] 1658 setzte er seine Aufzeichnungen fort. Spätere Nachträge stammen von Stamblers Sohn Otto Friedrich. Stambler wählte für sein Vorhaben einen Folioband, dessen Vorderdeckel nachträglich mit einem Pergamentblatt aus einer liturgischen Handschrift überzogen wurde. Stamblers Foliant umfasst 132 fortlaufend bezeichnete Blätter (fol. 1 bis 100 und 102 bis 133). Davon sind die Blätter 79 bis 82, 84-87, 90 bis 94 und 123 bis 133 leer geblieben. Die Aufschreibungen Stamblers befinden sich in der Regel auf den Blattvorderseiten.
Inhaltsübersicht des Leibeigenthumbsbuches mit ergänzenden Hinweisen zum Erwerb, zur Steuerklasse und zur Verortung:
fol.
[
10
]
Ksp.
[
11
]
Brs.
[
12
]
Nr.
[
13
]
Eigenbehörige Erben und Kotten
Kl. 1636
[
14
]
Bem.
[
15
]
Anschrift
[
16
]
1r
(Titelblatt)
2r
Rhe
Nrh
1
Melohe
2
3r
Rhe
Nrh
21
Maßman
2
1467
4r
Rhe
Nrh
19
Herdeman
2
5r
Rhe
Nrh
2
Herman zum Waldt
3.1
1532
6r
Rhe
Nrh
20
Reitheger
4.1
7r
Rhe
Nrh
14
Curd Vogedes jetzo Johan Kocker
3.1
8r
Rhe
Nrh
22
Elbracht
dop
o.A. dop
9r
Rhe
Nrh
13
Creutzkamp
4.1
10r
Rhe
Nrh
7
Bünde
4.1
11r
Rhe
Nrh
22
Elbracht
4.1
1618 dop
12r
Rhe
Nrh
17
Öldehoff
6.1
13r
Rhe
Nrh
16
Eicholtz
6.1
14r
Rhe
Nrh
11
Johan uf der Heyde
6.1
15r
Rhe
Nrh
18
Petter zum Creützkamp
6.3
16r
Rhe
Nrh
Curd Iebrüger
6.3
o.A.
17r
Rhe
Nrh
12
Berndt Baumbeck
6.3
18r
Rhe
Nrh
RullAnna
6.3
19r
Rhe
Nrh
15
Engelbert Eycholtz
6.3
19v
Rhe
Nrh
24
Vogelsenger
[
17
]
20r
Wie
Ems
6
Uckman
3.3
21r
Wie
Ems
16
Papenbreye wiedumb zu Rheda
5.1
22r
Wie
Ems
15
Wittenbrüng
6.3
o.A.
23r
Wie
Ems
5
Johan Dreß
6.3
24r
Her
Dor
6
Herman in Bocken [alias Bußmeyer]
6.1
w
HC Brocker Straße 4
25r
Her
Bro
33
Thieman
3.1
1532
HC Brocker Straße 60
26r
Her
Bro
Baumbeck
3.1
RW Benzstraße
27r
Her
Bro
35
Hülßman
3.1
HC Brocker Straße 62
27v
Her
Bro
50
Bunckfueß
4.1
1651
HC Linsenbusch 2
28r
Her
Bro
34
Bextern
3.1
1618
HC Brocker Straße 71
28v
Her
Bro
30
Grothe Buxel
4.1
1651 1652
HC Hofkamp 1
29r
Her
Bro
39
Vielstede
4.1
1652
HC Oelder Straße 6
30r
Her
Bro
26
Nottbruch
6.1
w
HC Brocker Straße 48
31r
Her
Bro
32
LünninghMayer [alias Schlautman]
5.3
w
HC Brocker Straße 52
32r
Her
Bro
31
OrthCraß
6.1
w
HC Brocker Straße 57 (?)
33r
Her
Bro
27
Diestelkamph
6.2
w
HC Brocker Straße 50
34r
Her
Bro
24
[Johan vor dem Baum sive] Herman Nottbroch
6.3
w
HC Oelder Straße 1
35r
Her
Bro
20
Johan Huncke
6.3
w
HC Oelder Straße 9
36r
Her
Bro
23
Kayßer
6.3
w
HC Oelder Straße 3
37r
Her
Bro
22
Herman zu Mersch [alias Brummer]
6.3
w
HC Oelder Straße 5
38r
Her
Bro
Elbracht zu Bextern, Johan, [alias Sagenernst]
6.3
w
39r
Her
Gro
4
Jasper uffm Tran [alias Joan Cordes]
5.1
w
HC Weißes Venn 11
40r
Her
Gro
8
Dreß zur Marck
6.3
w
HC Wachfuß 37
41r
Her
Gro
?
Curdt zum Außel
6.1
o.A.
42r
Her
Gro
Petter zum Kocker
6.3
w
43r
Her
Que
27
Waßeman
2.1
Abbr.
44r
Her
Que
21
Gnegel
2.1
HC Groppeler Straße 53
45r
Her
Que
13
Poggenbergh
2.1
HC Quenhorner Straße 35
46r
Her
Que
15
Lohman
3.1
HC Quenhorner Straße 16
47r
Her
Que
34
RautenFrantz
5.3
HC Groppeler Straße 37
48r
Her
Que
1
Peter uf der Heyde [sive Kirian]
5.3
HC Quenhorner Straße 29
49r
Her
Que
28
[Beckeclauß sive] Herman Wittkamp
6.1
w
HC Udenbrink 28
50r
Her
Que
32
Jasper zum Poggenbergh
6.2
w
HC Groppeler Straße 52
51r
Her
Que
?
[Beckbalß sive] Johan Witkamp
6.3
w
52r
Her
Que
?
Alter Witkamp
6.3
entfr.?
53r
Her
Que
24
Kniep oder Heinrich Witkamp
6.2
HC Groppeler Straße 51
54r
Her
Que
12
Flirr [Flehr] alias KleineHeinrich
6.1
w
HC Sandknapp 15
55r
Her
Que
2
Hecker Gerdt
6.2
w
HC Sandknapp 8
55v
Her
Que
3
Craß [alias Billeke] Moller
6.3
w
HC Sandknapp
56r
Her
Que
4
Vogelroß
6.3
w Abbr.
57r
Her
Pix
11
Peterman
2.1
1532
HC Gütersloher Straße 114
58r
Her
Pix
1
Schäffer zu Waßumb
4.1
w
HC Pixeler Straße 28
59r
Her
Pix
25
Füchtenkamp
5.1
entfr. w
HC Tecklenburger Weg 5
60r
Her
Pix
28
Johan Ernst
4.1
entfr. w
HC Gütersloher Straße 53
61r
Her
Pix
29
Johan Wittern
5.3
w
HC Gütersloher Straße 55
61v
Her
Pix
33
SchnidkerGerdt
6.3
w
HC Gütersloher Straße 65
62r
Her
Pix
20
ReckHerman
6.3
w
HC Gütersloher Straße 96
63r
Her
Pix
35
Rueße
5.3
w
HC Tecklenburger Weg 17
64r
Her
Pix
19
Falckenreck
5.3
HC Gütersloher Straße 98
64v
Her
Pix
40
Martin Landwehr
6.2
w
HC Udenbrink 17
65r
Her
Pix
16
Claues Gories
5.1
w
HC Tecklenburger Weg 10
66r
Her
Pix
18
Pauel Merßman
5.3
w
HC Gütersloher Straße 104
67r
Her
Pix
23
Johan Vielmeyer
5.3
entfr. w
HC Tecklenburger Weg 6
[
18
]
68r
Her
Pix
6
Wöstenbusch
6.1
entfr. w
HC Pixeler Straße 8
68v
Her
Pix
32
Gerd Falckenreck jetzo Hanß Merßman
6.3
w
HC Tecklenburger Weg 11
69r
Her
Pix
34
Herman Dietz
5.3
w
HC Tecklenburger Weg 16
70r
Her
Pix
36
Schnußenbergh
6.1
w
HC Tecklenburger Weg 20
71r
Her
Pix
?
Dreß zu Herde [alias Clüsener]
6.2
w
71v
Her
Pix
30
Severin Meinerß
6.3
w
HC Tecklenburger Weg 7
72r
Her
Pix
22
Fridrich Vielmeyer
6.2
w
HC Tecklenburger Weg 12
72v
Her
Pix
?
Lameheinrich
6.3
w
73r
Her
Pix
21
Füchtenhanß
6.2
w
HC Tecklenburger Weg 14
73v
Her
Pix
41
Petter [tom] Schöningh
6.2
w
HC Udenbrink 21 (?)
74r
Her
Bre
11
Creinhardt
3.1
HC Bredeck 11
75r
Her
Bre
5
Scharpenbaum
5.1
HC Bredeck 5
76r
Her
Bre
9
Vechteljohan
6.1
HC Bredeck 9
77r
Her
Bre
10
Rovekamp
6.1
HC Bredeck 10
83r
Cla
Cla
100
FohrJohan
4.1
HC Greffener Straße 62
88r
Cla
Hee
20
Westphechtell
1
1652
HC Sprockenbrinkstraße 6
89r
Cla
Hee
21
Hülßmansche von Westvechtel
6.3
1652
HC Emstal 4
95r
Cla
Hee
?
Heinrich uff der Heyde
5.1
96r
Cla
Hee
59
Frantz Becker oder BuschJohan
6.1
w
HC Am Pferdekamp 6
97r
Cla
Hee
61
Johan Gröne oder Hagen Schneider
6.2
w
HC Am Pferdekamp 4
98r
Cla
Hee
?
Anna zur Westen
6.3 pp
99r
Cla
Hee
16
Johan uf der Strot oder Piper
6.3
w
HC Breede 4
100r
Cla
Hee
17
Johan ufm Poll
6.3
op
HC Sprockenbrinkstraße 17
102r
Cla
Hee
56
Heinrich Toppe
6.2
w
HC Stiege 1
103r
Cla
Hee
62
Reineke
6.3
652
HC Am Pferdekamp 5
104r
Cla
Hee
63
Lütke Reineke
fehlt
HC Am Pferdekamp 3
105r
Cla
Hee
57
Topp Johan
6.2
w
HC Stiege 2
105v
Cla
Hee
8
Herman von Behelen
6.2
652
HC Schwarzer Weg 13
106r
Cla
Hee
41
Johan von Behlen
6.3
652
HC Marienfelder Straße 98
107r
Cla
Hee
44
Steinkerß frohn
fehlt
w
HC Haardt 6
108r
Cla
Hee
56
Heinrich Rodde
6.2
HC Stiege 1
109r
Cla
Hee
17
Poll Johan
6.3
dop
HC Sprockenbrinkstraße 17
110r
Cla
Hee
36
Schwer
4.1
1652
HC Marienfelder Straße 92
112r
Vit
Gew
Beckstede
4
113r
Vit
Ren
Veringmayer
3
114r
Wie
Bat
Kniphover
3
115r
Wie
Röc
Weckingh
2
116r
Wie
Lin
Grafflag
1
o.A.
fehlt
Vit
Gew
[Rumsel]
2
fehlt
116v
2 Einzelnachrichten
117r-119r
1 Freikauf und 23 Wechselungen in der Vogtei Gütersloh
120r-121v
Konskription zu 16 Heuerlingsfamilien
122r
Ausstellung eines Kurzettels
Innerhalb der Herrschaft Rheda hat Stambler nacheinander zunächst die beiden Bauerschaften Nordrheda und Ems erfasst, sodann die sechs Bauerschaften des Kirchspiels Herzebrock und schließlich die Bauerschaften Clarholz und Heerde im Kirchspiel Clarholz. Das nicht zur Rhedaer Vogtei gehörende Kirchspiel Gütersloh fehlt in der Konskription. Die Vogtei Rheda umfasste nach Stamblers Auflistung 103 eigenbehörige Stätten innerhalb und weitere 5 Höfe und Kotten außerhalb der Herrschaft Rheda, die in den Kirchspielen St. Vit und Wiedenbrück lagen. Rumsel, einen weiteren Rhedaer Hof in St. Vit, hat Stambler wohl übersehen und nicht erfasst. Bei drei Brinkliegerstätten (Curdt zum Außel, Curd Iebrüger und Wittenbrüng) und einem Erbe (Grafflag in Lintel) fehlen Angaben zu den eigenbehörigen Bewohnern. Eine weitere Brinkliegerstätte (RullAnna in Nordrheda) war niedergelegt worden und verwaist. Das Anwesen Elbracht in Nordrheda verzeichnete Stambler zunächst als Erbkotten auf fol. 8r, löschte den Eintrag dann aber, um dieselbe Stätte als Markkotten auf fol. 11r erneut zu erfassen. Einen Doppeleintrag erfuhr die Brinkliegerstätte PollJohan in der Clarholzer Bauerschaft Heerde, die auf den folii 100r und 109r erfasst worden ist.
Stambler hat den Namen der an Eigenbehörige vergebenen Stätten in vielen Fällen auch die Steuerklasse hinzugefügt. Der Vergleich mit einem älteren Landregister,[19] das um 1636 entstanden sein dürfte und auf einer 1629 verordneten Neuklassifizierung der schatzbaren Güter beruhte,[20] ergibt das folgende Ergebnis: In der Vogtei Rheda besaß der Landesherr einschließlich der zuletzt getätigten Ankäufe als eigenbehörige Stätten ein Erbe, sieben Halberben, neun Erb- und elf Markkotten sowie 15 Gemeinkotten und 57 Brinkliegerstätten, außerdem drei Stätten, die in den Schatzungslisten fehlen. Die Schatzungsanschläge des älteren Landregisters werden sowohl in der vorstehenden Übersicht und als Zitate in den Fußnoten zu den einzelnen Stätten ergänzend aufgeführt. Die im benachbarten Amt Reckenberg gelegenen Rhedaer Höfe wurden dort als geheele Erben (1), Halberben (2), Erbkotten (2) und Markkotten (1) besteuert.[21] Neben den im Leibeigenthumbsbuch erfassten eigenbehörigen Gütern besaß der Landesherr einige als Lehen vergebene Höfe (Bosfeld in Herzebrock sowie Johan Maes und Martin Maes in Röckinghausen) und eine Reihe weiterer Güter und Liegenschaften, die entweder selbst bewirtschaftet wurden oder pachtweise ausgegeben waren.
Von 1467 bis 1652 hatte der Landesherr innerhalb der Vogtei Rheda 15 Höfe und Kotten durch Tausch und Kauf erworben. Mit den angeblich entfremdeten und widerrechtlich errichteten Stätten war der Grundbesitz der Herren von Rheda hier bis zu Stamblers Erfassung um nicht weniger als 63 Höfe und Kotten vermehrt worden. Zum älteren Besitz des Hauses Rheda dürften 14 Halberben, Erb- und Markkotten gehört haben, während etwa 18 Gemeinkotten und Brinklieger in der Neuzeit unangefochten von Rheda neu angesiedelt worden waren.[22]
Christoph Stamblers Sohn Friedrich ist nach dem Tod seines Vaters in dessen Fußstapfen getreten. Er hat die älteren Aufzeichnungen seines Vaters in vielen Fällen um jüngere Ereignisse ergänzt und im Leibeigenthumbsbuch darüberhinaus neben zwei Einzelnachrichten über Rhedaer Eigenbehörige (fol. 116v) eine Freilassung mit nachfolgender Eigengebung sowie 23 Wechselungen aus der Vogtei Gütersloh aufgezeichnet (fol. 117r-119r), sodann 16 Heuerlingsfamilien erfasst (fol. 120r-121v), die dem Haus Rheda innerhalb der gleichnamigen Vogtei ebenfalls eigenbehörig waren, und abschließend die Auslobung einer einzelnen Wechselung in ihrem Ablauf dokumentiert (fol. 122r).
Die Aufschreibung der Eigenbehörigen beginnt auf jeder Stätte mit dem Namen des colonus als rechtmäßigem Bebauer des Anwesens und Ehemann bzw. Vater der Kinder sowie dem Namen seiner Ehefrau (uxor). Dabei wird zugleich festgestellt, wer von den beiden auf der Stätte geboren worden ist und wer dort eingeheiratet hat bzw. von welcher anderen Stätte kommend er hier aufgefahren ist. Für den Grund- bzw. Gutsherrn war es wichtig zu wissen, ob ihm der jeweils auf der Stätte geborene Elternteil zweifelsfrei eigenbehörig war. Da die Hörigkeit stets der Mutter folgte, musste darauf geachtet werden, dass insbesondere die Mutter des Hoferben oder der Hoferbin entweder durch ihre Geburt oder durch Wechselung oder durch Freikauf und nachfolgende Eigengebung in die Eigenbehörigkeit Rhedas gelangt war. Wenn der auf den Hof gekommene Elternteil von einer anderen Rhedaer Stätte stammte, bedurfte es keines Übertritts, wenn auch dort insoweit geordnete Verhältnisse vorgelegen hatten. Weil im Laufe des Dreißigjährigen Krieges aber nicht immer alles so genau beachtet worden war, bedurfte es hier in manchen Fällen nachträglicher Korrekturen.
Die im Leibeigenthumbsbuch verzeichneten Auf- und Abheiraten spiegeln die kleinteilige Gemengelage zahlreicher Grundherrschaften wider. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts ergaben sich heiratsbedingte Verwandtschaftsbeziehungen der Rhedaer Eigenbehörigen zu rund 180 Höfen, Kotten und Häusern anderer Guts- bzw. Grundherren. Von 172 Stätten, deren Lage und Zugehörigkeit identifiziert werden konnte, gehörten den Klöstern Clarholz, Herzebrock und Marienfeld, deren Edelvogt der Landesherr war, insgesamt 95 Stätten, dem Kloster Herzebrock davon allein schon 61 Erben und Kotten. Auf die Landesherrschaften Reckenberg und Rietberg entfielen 29 Stätten, auf die Vogtei Gütersloh der Herrschaft Rheda 21 eigenbehörige Güter. Die verbleibenden 27 Stätten waren Streubesitz der Grafschaft Tecklenburg (1), des ravensbergischen Amtes Sparrenberg (1), des Stifts St. Mauritz in Münster (1) und der Stadt Wiedenbrück (2) sowie von 10 vorwiegend landsässigen Adelsfamilien (19) und des Herzebrocker Kaufmanns und Wiedenbrücker Bürgers Ernst Funcke (4).
Zu den am Austausch der Eigenbehörigen beteiligten Adelshäusern gehörten zunächst einmal vier Adelssitze, die die Herrschaft Rheda von Ost nach West umlaufend einkreisten: Haus Außel in Batenhorst (Familie von Haxthausen), Haus Neuhaus in St. Vit (Familie von der Wieck), Haus Nottbeck (Familie von Oer) und Haus Möhler (Familie von Wend). Daneben kommen entfernter gelegene Adelshäuser vor: Haus Geist im Kirchspiel Oelde (Familie von Büren), Familien von Ledebur zu Mühlenburg und von Horst zu Milse; außerdem einige andere Familien, die als landesherrliche Beamte zu den Honoratioren zählten: von Gresten zu Bielefeld, Runde gen. Schulte und von Wippermann.
Im Rückgriff auf frühere Freilassungen und Wechselungen begegnen uns im Leibeigenthumbsbuch darüberhinaus vier weitere Adelshäuser, die sich von ihrem Besitz innerhalb der Herrschaft Rheda zwischen 1636 und 1652 trennten (Häuser Assen, Hovestadt und Crassenstein sowie die Herren von Korff gen. Schmiesing zu Tatenhausen). Zu den Erwerbern gehörte neben dem Kloster Clarholz und dem Landesherrn in Rheda auch Ernst Funcke.[23] Nachdem der Herzebrocker Kaufmann zwischen 1648 und 1651 verstorben war, traten seine Schwiegersöhne als Gutsherren auf: Heinrich Pavenstede (Meiners in Nordrheda),[24] Johannes Boele in Warendorf (Kleygreve in Groppel und Vortmann in Brock) sowie der Herzebrocker Klostersekretär Heinrich Lördemann (Bunckvoet, Bunckfuß in Brock), der das ihm zugefallene Gut 1651 dem Landesherrn in Rheda überließ und dafür von ihm die allgemeine Steuerfreiheit seines neuen Anwesens in Herzebrock verbrieft bekam.[25]
Die allgemeinste Form des Übertritts von der einen Grundherrschaft in eine andere bildete bei der kleinteiligen Gemengelage bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die Wechselung durch Hörigentausch. Dabei bot der aufnehmende Gutsherr dem bisherigen Gutsherrn des aufgenommenen Eigenbehörigen drei nach Geschlecht und Rangstellung (Steuerklasse) gleichwertige Personen zur Auswahl an, indem er einen Kurzettel mit den entsprechenden Namen dieser Personen übermittelte. Der bisherige Gutsherr wählte daraus eine ihm als gleichwertig erscheinende Person aus. Diesen Vorgang nannte man Chur (Kur). Die ausgewählte Person wurde in athumb abgegeben bzw. in wiederathumb angenommen. Der erste Akt eines solchen Vorgangs ist beispielhaft auf fol. 122r/122v des Leibeigenthumbsbuches dokumentiert. Wiederholt kam es vor, dass eine auszuwechselnde Frau bereits Kinder hatte. In diesen Fällen wurden – soweit möglich – andere Frauen mit Kindern zur Wechselung angeboten. Überzählige Kinder verblieben dabei aber einstweilen in der Eigenbehörigkeit des abgebenden Gutsherrn.
Wechselungen zwischen größeren Grundherrschaften wurden als „stehende Wechsel“ vorgenommen, indem jede Seite fortlaufend notierte, wer im Benehmen und mit Genehmigung der eigenen Herrschaft zur anderen Seite hinübergewechselt war, um dann nach einer Reihe von Jahren im Rahmen einer Generalwechselung die abgegebenen und die aufgenommenen eigenbehörigen Personen summarisch gegeneinander aufzurechnen.
Eine Alternative zum Hörigentausch ergab sich durch Freikauf und nachfolgende Eigengebung, ein Weg, der um die Mitte des 17. Jahrhunderts noch die Ausnahme bildete, wie es die Beispiele Johandreiß (fol. 23r), aufm Tran gen. Cordes (fol. 39r.) und Creinhardt (fol. 94r) belegen. Dieser Weg bot sich insbesondere dann an, wenn Übertritte aus entfernt gelegenen oder besonders kleinen Grundherrschaften anstanden und keine Gelegenheit zu einem Hörigentausch gefunden wurde. In diesen Fällen blieb nur die Möglichkeit eines Freikaufs vom bisherigen Gutsherrn und der anschließende Verzicht auf die gewonnene Freiheit durch Eigengebung und Aushändigung des erworbenen Freibriefs an den neuen Gutsherrn, wie dies 1664 einmal bei der Besetzung des Rhedaer Erbes Pipenbroch in Blankenhagen mit einer Eigenbehörigen des Bielefelder Gografen Joachim von Gresten geschehen ist (fol. 117r).
Ansonsten blieb ein Freikauf den Brüdern und Schwestern bzw. den Söhnen und Töchtern der coloni vorbehalten. Im Leibeigenthumbsbuch werden aber nur 13 derartige Freilassungen erwähnt, die insgesamt 17 Eigenbehörige betrafen. Diese Freikäufe erfolgten insbesondere dann, wenn Angehörigen der eigenbehörigen Familien ein bürgerliches Leben ermöglicht werden sollte. Dies betraf einmal Töchter, die freie Ehemänner zu heiraten gedachten, und zum anderen Söhne, die ein zünftiges Handwerk anstrebten. Dies wird dort sichtbar, wo im Zusammenhang mit den Freilassungen auch die Aufenthaltsorte (Osnabrück, Paderborn, Rheda und Warendorf) und die Berufe (Burgschulte, Glasmacher, Leineweber) erwähnt werden.
In fünf Fällen erwähnt Stambler, dass der colonus oder die colona vor ihrer Auffahrt auf die eigenbehörige Stätte frei gewesen waren und sich eigen gegeben hatten, ohne auf einen vorausgegangenen Freikauf zu verweisen. Nun war jemand persönlich frei, wenn seine Mutter zur Zeit seiner Zeugung persönlich frei gewesen war. Als frei galt um die Mitte des 17. Jahrhunderts auch das zweitgeborene Zwillingskind, wie es das Leibeigenthumbsbuch fünfmal dokumentiert. Schließlich hatte man in älterer Zeit den Frauen, die auf ihre Freiheit verzichteten, ersatzweise auch die Freiheit für ihr erstgeborenes Kind zugesichert. Diese Gepflogenheit wird an drei Stellen erwähnt.
Nachdem die Wechselungen im fürstbischöflich-osnabrückischen Amt Reckenberg schon im Jahre 1700 aufgegeben worden waren, wurden sie seit 1711 auch in Rheda nicht mehr praktiziert. Stattdessen hatte sich jeder Eigenbehörige vor seinem Übertritt in eine andere Grundherrschaft zunächst freizukaufen, um den erworbenen Freibrief dann im Zusammenhang mit seiner Auffahrt bei seinem neuen Gutsherrn wieder abzugeben. Das neue Verfahren war für die Gutsherren weniger aufwendig und bescherte ihnen zugleich Einnahmen, die oft um ein Vielfaches höher waren als die früheren Wechselgebühren.
Nach den Eltern wurden im Leibeigenthumbsbuch zunächst deren Kinder und diese bei den jüngeren mit Angabe ihres Alters erfasst. In Einzelfällen vermerkte Stambler bei Zwillingen auch, wer der erst- und wer der letztgeborene Zwilling war. Wegen der Rechtsfolgen wurde hierauf oft auch schon bei den Taufeinträgen des Pfarrers geachtet.
Schließlich registrierte Stambler auch Angaben zu den Geschwistern der Eheleute und deren Verbleib sowie zu deren Kindern und sonstigen Familienverhältnissen. Damit wurden die vielfältigen familiären Verflechtungen offengelegt, die nicht selten über die Grenzen des Kirchspiels hinausreichten und sich auch ins benachbarte Ausland erstreckten. So werden auch die nicht erbenden Kinder in fremder Umgebung quellenkundig, die als Heuerlinge oder Gesindekräfte namentlich im Schatten ihrer Wirte und Dienstherren standen und deren angestammten Namen dann verblassten.
Christoph Stambler erwähnt bei seiner Aufschreibung der Geschwister und der Kinder der coloni wenigstens 16 eigenbehörige Abkömmlinge, die als nicht erbende Söhne und Töchter verheiratet waren und mit ihren Familien als Heuerlinge auf dem elterlichen Anwesen (4-5) oder auf einer fremden Stätte (11-12) lebten. Darüberhinaus hat es viele Töchter gegeben, die mit Kindern aus nichtehelichen Verbindungen wohl vorwiegend ebenfalls in ihren Elternhäusern wohnten. Stamblers Sohn Friedrich verdanken wir schließlich Angaben zu weiteren 16 Heuerlingsfamilien, die 1666 verzeichnet worden sind.
Die „Herren“ im Hause Rheda
Die im Leibeigenthumbsbuch erfassten Besitzer der landesherrlichen Güter und ihre Familienmitglieder waren 1651 dem Grafen Mauritz zu Bentheim-Tecklenburg etc. an sein hauß Rheda mit leibeigenthumb verhafft(et) (fol. 1r). Als solche waren sie die Eigenbehörigen des Landesherrn in Rheda. Graf Mauritz (1623/34-1674) war am 31. Mai 1615 im Schloss zu Rheda als zweiter Sohn des Grafen Adolf zu Bentheim-Tecklenburg (1577/1606-1623) von Mar ga retha von Nassau (1589-1660) geboren worden. Nach dem frühen Tod des Erbprinzen und seines Vaters hatte er schon 1623 die Nachfolge des Erbprinzen angenommen. Während seines Studiums in Steinfurt und einer nachfolgenden „Reise durch Holland, England und Frankreich, von der er 1634 zurückkehrte“[26], hatte seine Mutter zunächst als Witwe vormundschaftlich die Regentschaft übernommen. Nach ihrer Wiederheirat mit dem Freiherrn Wilhelm von Wanitzky, die am 29. Juni 1631 in Rheda erfolgte,[27] wurde sie von ihm darin unter stützt, wie es einzelne Hinweise im Leibeigenthumbsbuch belegen. Graf Mauritz heiratete 1636 Johanna Dorothea von Anhalt-Dessau (1612-1685).[28]





























