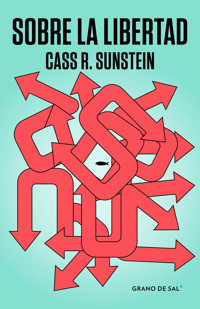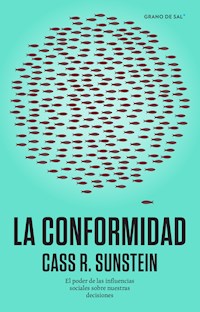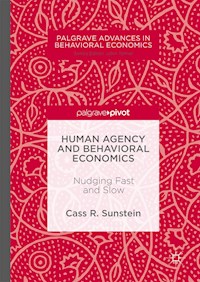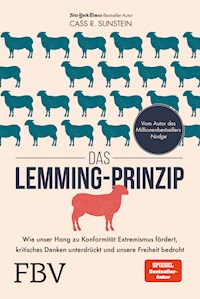
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in Zeiten der Polarisierung und sozialen Spaltung. Menschen nach Religion, Ethnie und Geschlecht zu trennen scheint wieder legitim. Wie ist das geschehen? Cass R. Sunstein sieht die Erklärung im Phänomen der Konformität – doch wieso laufen wir oft wie Lemminge unseren Mitmenschen hinterher? Sunstein zeigt, welchen Schaden eine Gesellschaft nimmt, wenn der Einzelne seinen moralischen Instinkt unterdrückt. Nur wenn wir Andersdenkende und individuelle Stimmen akzeptieren, statt sie als egoistische Individualisten zu sehen, können wir uns langfristig auf Demokratie und Freiheit verlassen und uns vor Extremismus schützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
New York Times-Bestsellerautor
CASS R. SUNSTEIN
DAS LEMMING PRINZIP
Wie unser Hang zu Konformität Extremismus fördert, kritisches Denken unterdrückt und unsere Freiheit bedroht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2021
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
D-80779 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
CONFORMITY
Copyright © 2019, Cass R. Sunstein
All rights reserved
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Petra Pyka
Redaktion: Ulrike Reinen
Korrektorat: Hella Neukötter
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: Foxys Graphic/shutterstock.com
Satz: ZeroSoft, Timisoara
Druck: CPI books GmbH, Leck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95972-326-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-842-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-640-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
INHALT
Dank
Vorwort
EINLEITUNG: DIE MACHT SOZIALER EINFLÜSSE
Erstes Kapitel: WIE KONFORMITÄT FUNKTIONIERT
Schwierige Fragen
Leichte Fragen
Gute Gründe und grobe Fehler
Wie sich Konformität steigern (oder verringern) lässt
Schocks, Autorität und Kompetenz
ZWEITES KAPITEL: KASKADEN
Informationskaskaden: das Grundphänomen
Wie sich Kaskaden erzeugen und unterbrechen lassen
Wenn Schweigen Gold ist
Reputationskaskaden
Eingeschränkt rationale Kaskaden
DRITTES KAPITEL: GRUPPENPOLARISIERUNG
Das Grundphänomen
Empörung
»Hidden Profiles« und »Self-Silencing« in der Gruppe
Wie kommt es zu Polarisierung?
Debatten in Schieflage
Mehr oder weniger Extremismus
VIERTES KAPITEL: DAS RECHT UND SEINE INSTITUTIONEN
Ein Gesetz als Signal
Die Voraussetzungen für Normenmanagement
Dissens und Krieg
Ein Verfassungsrahmen
Richter
Diversität und positive Diskriminierung an Hochschulen und Universitäten
FAZIT: KONFORMITÄT UND IHRE SCHATTENSEITEN
Endnoten
Über den Autor
Dank
Dieses Büchlein hat einen langen, verschlungenen Weg hinter sich. Anfang 2003 hielt ich an der juristischen Fakultät der Harvard University die »Oliver Wendell Holmes, Jr., Lectures« unter dem Titel »Konformität und Dissens«. Mithilfe der Kommentare, die während des Vortrags und danach eingingen, wurde das Vorlesungsmaterial neu ausgerichtet, erweitert und zu einem Buch ausgearbeitet, das Ende 2003 unter dem Titel Why Societies Need Dissent bei Harvard University Press erschien. Natürlich gibt es maßgebliche Überschneidungen zwischen der Originalfassung und diesem Buch. Dennoch liegt mir der ursprüngliche Vorlesungstext weiterhin sehr am Herzen. Er war nicht nur deutlich kürzer, sondern auch fokussierter, weniger polemisch und nicht ganz so moralisierend – aber auch zweifelnder und in gewisser Hinsicht von bleibenderem Charakter (wie ich gern glauben möchte).
Während ich diese Zeile schreibe, genießen das Problem der Konformität und der damit verbundene Themenkreis – Identität, Extremismus, Kaskaden, Polarisierung und Diversität – weltweit zunehmende Aufmerksamkeit. Dieses Buch ist eine zeitgemäße Version des ursprünglichen Vorlesungstextes, versehen mit einem neuen Vorwort und verschiedenen Änderungen, die vor allem der Aktualisierung und der Klarstellung bestimmter Sachverhalte dienen sollen. Mir ist absolut bewusst, dass sich die zugrunde liegende Sozialwissenschaft seit 2003 wesentlich weiterentwickelt hat. Ich habe mich nach Kräften bemüht, die maßgeblichen Entwicklungen zusammenzufassen und mich möglichst nicht auf kontroverse Thesen und Erkenntnisse zu stützen, doch die Forschung auf diesem Gebiet bleibt natürlich nicht stehen.
Es brauchte ein ganzes Dorf. Wertvolle Diskussionen und Beiträge verdanke ich Jacob Gersen, Reid Hastie, David Hirshleifer, Christine Jolls, Catherine MacKinnon, Martha Nussbaum, Susan Moller Okin, Eric Posner, Richard Posner, Lior Strahilevitz, Edna Ullmann-Margalit und Richard Zeckhauser. Mein besonderer Dank gilt meiner Agentin Sarah Chalfant für ihre Hilfe und Unterstützung und meiner Redakteurin Clara Platter für unschätzbare Anregungen das ganze Buch betreffend, vor allem aber im Zusammenhang mit dem Vorwort. Andrew Heinrich und Cody Westphal waren mir eine große Hilfe bei den Recherchen.
Vorwort
Konformität ist so alt wie die Menschheit. Schon im Garten Eden folgte Adam dem Beispiel Evas. Dass sich die großen Weltreligionen verbreiten konnten, ist unter anderem eine Folge der Konformität. Dieses Thema gäbe noch viele Bücher her – besonders mit Blick auf Christentum, Islam und Judentum.1 Großherzigkeit und Güte, Sorge um Schwächere, Rücksichtnahme, Schutz des Privateigentums, Achtung vor der Menschenwürde – dem allen liegt Konformität zugrunde, die eine Art sozialen Klebstoff liefert.2
Konformität macht aber auch Gräuel möglich. Der Holocaust war vieles – und ganz gewiss ein Tribut an die gewaltige Macht der Konformität. Diese Macht offenbarte sich ebenfalls im Aufstieg des Kommunismus. Der Terrorismus unserer Zeit ist keinesfalls ein Produkt von Armut, psychischen Störungen oder mangelnder Bildung. Er entstammt nicht zuletzt dem Druck, den manche Menschen auf andere ausüben. Und dieser Druck beruht voll und ganz auf Konformität. Wenn die Anhänger einer politischen Partei gemeinsam marschieren, Dogmen entwickeln, Begeisterungsstürme entfachen und die Angehörigen einer anderen Partei verhöhnen, dann ist Konformität am Werk. In seiner schlimmsten und seiner besten Form speist sich auch der Nationalismus aus Konformität.
Wie wir sehen werden, ist das Konzept der Konformität weit interessanter und komplexer, als es scheint. Zwei Grundgedanken decken es aber weitgehend ab. Erstens liefern die Handlungen und Äußerungen anderer Informationen darüber, was wahr und richtig ist. Huldigen Ihre Freunde und Nachbarn einem bestimmten Gott, haben Angst vor Einwanderern, verehren den derzeitigen Landesvater, halten den Klimawandel für Schwindel oder glauben, es sei gefährlich, genetisch veränderte Lebensmittel zu konsumieren, dann haben Sie einigen Grund, das alles zu glauben. Gut möglich, dass Sie die Überzeugungen anderer als Indizien dafür werten, was Sie für richtig halten sollten.
Zweitens verraten Ihnen die Handlungen und Äußerungen Ihrer Mitmenschen, was Sie tun und sagen sollten, wenn Sie bei diesen hochangesehen bleiben (oder werden) möchten. Selbst wenn Sie in Ihrem tiefsten Inneren anderer Meinung sind, halten Sie sich in Gesellschaft womöglich bedeckt oder stimmen in den vorherrschenden Tenor ein. Tun Sie das, könnten Sie feststellen, wie Sie sich innerlich verändern und bald ähnlich handeln oder sogar denken wie die anderen.
Das Thema Konformität ist nicht an einer bestimmten Zeit oder einem Ort festzumachen – und seine Erörterung hier ebenso wenig, wie ich hoffe. Wohlgemerkt lässt die moderne Technik – allen voran das Internet – viele seit Langem beobachtete Phänomene in einem neuen Licht erscheinen. Angenommen, Sie leben in einem kleinen, abgeschiedenen Dorf mit einem hohen Grad an Homogenität. In diesem Fall dürfte sich Ihr Wissen weitgehend auf das in diesem Dorf Bekannte beschränken. Durchaus möglich, dass Ihre Überzeugungen denen Ihrer Nachbarn gleichen. Sie selbst mögen vollkommen rational sein – was Sie glauben, ist jedoch möglicherweise alles andere als das. Wie der US-Verfassungsrichter Louis Brandeis feststellte: »Die Menschen hatten Angst vor Hexen und verbrannten Frauen.«3
Sofern Sie nicht durch Ihre Vorstellungskraft und Ihre Erfahrungen in eine andere Richtung gelenkt werden, werden Sie handeln und denken wie Ihre Nachbarn. Manche Menschen sind von Haus aus Rebellen. Sie können den Wissensbestand der Gesellschaft erweitern. Ihnen erscheint Widerspruch ansprechender als Konformität. Sie wollen anders sein. Doch unsere Welt ist begrenzt, und damit auch unser Horizont. Entsprechend eingeschränkt sind unsere Erfahrungen und Vorstellungen.
Nehmen wir an, dass Sie – wo immer Sie leben – viel Zeit online verbringen. In gewisser Hinsicht steht Ihnen also die ganze Welt offen. Wenn Sie »Weltreligionen« googeln, erfahren Sie in kürzester Zeit eine ganze Menge. Der Suchbegriff »Klimaschwindel« führt Sie zu unterschiedlichen Ansichten, und Sie können sich zumindest grob darüber informieren, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat. Suchen Sie nach »Gesundheitsrisiken durch gentechnisch veränderte Lebensmittel«, stoßen Sie auf ganz verschiedene Studien und diverse Berichte, von denen manche viel Sachkenntnis voraussetzen. Welche Informationen wirklich belastbar sind, ist nicht immer auf Anhieb erkennbar. Da draußen kursieren zahllose Unwahrheiten. Der Knackpunkt ist aber: Wenn Sie zu Konformität neigen, dann müssen Sie ein bisschen Mühe investieren, um zu entscheiden, womit – oder mit wem – Sie konform gehen.
Das ist für die Menschheit in vieler Hinsicht ein gewaltiger Schritt nach vorn. Unser potenzieller Horizont ist weiter denn je, und er erweitert sich ständig. Gleichzeitig ist der Mensch aber offenbar im Stammesdenken verhaftet. Ganz gleich, wo wir leben – ob in einem kleinen Dorf oder in New York, Kopenhagen, Jerusalem, Paris, Rom, Peking oder Moskau –, wir entwickeln ein Zugehörigkeitsgefühl. Ist das erst passiert, richten wir uns mehr nach den Informationssignalen ganz bestimmter Personen als nach den Signalen anderer. Wir wünschen uns die Anerkennung der Menschen, die wir lieben, bewundern, sympathisch finden und denen wir vertrauen. Aus diesem Grund bleibt der Gruppenzwang bestehen, selbst wenn es da draußen viele verschiedene Stämme gibt, zwischen denen wir uns einigermaßen frei entscheiden können. (Eine neue Freundin antwortete mir einmal auf die Frage, weshalb wir einander so mochten, wie aus der Pistole geschossen: »Derselbe Stamm.«)
Während ich an diesem Buch arbeite, erlebt die Welt anscheinend eine Wiedergeburt des Stammesdenkens. In den Vereinigten Staaten, Europa und Südamerika ordnen sich die Menschen offenbar bestimmten Stämmen zu, die sich nach Politik, Religionszugehörigkeit, Rasse und ethnischer Herkunft definieren. Der Schein kann natürlich trügen, und um festzustellen, ob tatsächlich eine solche Renaissance im Gang ist, bedarf es einer sorgfältigen Analyse. Eines steht aber außer Frage: Das Internet im Allgemeinen und die sozialen Medien im Besonderen eröffnen dem Gruppenzwang ganz neue Möglichkeiten.
Das geht schon bei den Informationssignalen los: Auf Ihrer Facebook-Seite oder in ihrem Twitter-Feed erhalten Sie alle möglichen Informationen von Menschen, die Sie mögen oder denen Sie vertrauen – über einen Staatschef, die Kriminalität, Russland, das FBI, die Europäische Union, ein neues Produkt, Kindererziehung, eine neue politische Bewegung oder ein beliebiges anderes Thema. Was Ihnen diese Menschen erzählen, könnte allein deshalb glaubwürdig sein, weil sie es sagen. Denken Sie in diesem Zusammenhang an Ihre Sorge um Ihre Reputation und Ihre gesellschaftliche Stellung: Vertritt Ihre Online-Community bestimmte Standpunkte, sind Sie vielleicht nicht geneigt, ihr zu widersprechen – beziehungsweise eher geneigt, ihr beizupflichten. Natürlich hängt das stark davon ab, wie eng Ihre Bindungen zu diesen Menschen sind (oder eben nicht). Vielleicht ist Ihnen ja auch ziemlich gleichgültig, was sie von Ihnen halten. Doch vielen Menschen ist das nicht egal – weshalb sie zu Konformität tendieren.
Eine einfache Bewertung von Konformität wäre wenig zielführend. Auf der einen Seite ermöglicht sie die Zivilisation, auf der anderen aber Gräueltaten und die Vernichtung von Kreativität. Der Schwerpunkt meiner Betrachtung liegt auf der Dynamik der Konformität – darauf, was sie bewirkt und wie sie funktioniert. Ich hoffe, dass die Bewertung insgesamt nuanciert ausfällt. Wird die Erörterung dann besonders lebhaft, wenn es um Außenseiter und Rebellen geht, mögen Sie mir das bitte nachsehen.
So viel Gutes Konformität bewirkt – sie kann auch das Wertvollste und Lebendigste in der menschlichen Seele abtöten. Bob Dylan hat das kryptisch (und meiner Ansicht nach sehr treffend) folgendermaßen formuliert: »To live outside the law, you must be honest« (Um ohne Gesetz zu leben, muss man ehrlich sein).4
Einleitung: DIE MACHT SOZIALER EINFLÜSSE
Wie beeinflussen sich Menschen gegenseitig? Welche gesellschaftliche Funktion erfüllen Andersdenkende, Querulanten, Sonderlinge und Skeptiker? Welche Auswirkungen haben die Antworten auf diese Fragen auf die gesellschaftliche Stabilität, auf die Entstehung von Bewegungen in der Gesellschaft, auf Recht und Politik und auf die Gestaltung privatwirtschaftlicher und öffentlicher Institutionen? Hier drei Anhaltspunkte zur Orientierung.
1. Vor ein paar Jahren wurde eine Reihe von Bürgern aus zwei verschiedenen Städten in kleine Gruppen zusammengefasst, die in der Regel aus sechs Personen bestanden.1 Die Gruppen sollten sich mit drei der umstrittensten Fragen ihrer Zeit auseinandersetzen: Klimawandel, positive Diskriminierung und gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Bei den beiden Städten handelte es sich um Boulder – bekannt für seine überwiegend linkslastigen Wähler – und Colorado Springs, wo nachweislich mehrheitlich konservativ gewählt wird. Die teilnehmenden Bürger wurden zunächst aufgefordert, ihre Ansichten jeder für sich anonym aufzuzeichnen und dann gemeinsam zu beratschlagen, um in der Gruppe zu einer Entscheidung zu finden. Im Anschluss sollten die einzelnen Teilnehmer wieder jeder für sich anonym festhalten, wie er nach der Beratung über diese Fragen dachte. Was, meinen Sie, ist wohl passiert?
Infolge des Gruppengesprächs haben sich die Menschen aus Boulder in allen drei Fragen nach links bewegt. Die Leute aus Colorado Springs dagegen äußerten sich nach der Beratung deutlich konservativer. Die Diskussion in der Gruppe hatte den Effekt, dass sich die Meinungen der Einzelnen tendenziell extremisierten. »Gruppenurteile« zum Klimawandel, zur positiven Diskriminierung und zu gleichgeschlechtlichen Verbindungen fielen extremer aus als die durchschnittlichen Ansichten der einzelnen Gruppenmitglieder vor der Diskussion. Auch die anonymen Stellungnahmen der einzelnen Mitglieder waren nach der Besprechung extremer als zuvor.
Das Gruppengespräch ließ die Differenzen zwischen den Bürgern von Boulder und den Einwohnern von Colorado Springs also deutlich stärker zutage treten. Davor gab es bei Einzelnen aus beiden Städten noch erhebliche Überschneidungen, danach waren diese sichtlich geringer. Die Kluft zwischen Liberalen und Konservativen war größer geworden. Sie bewegten sich allmählich in vollkommen eigenen politischen Welten.
2. Ganz normale Bürger wurden gebeten, sich einzeln dazu zu äußern, wie streng ein Delinquent für ein bestimmtes Fehlverhalten bestraft werden sollte.2 Ihre Antworten sollten auf einer Skala von 0 bis 8 eingeordnet werden, wobei 0 für Straflosigkeit stand und 8 für eine »extrem schwere« Strafe. Nachdem alle Befragten ihr persönliches Urteil abgegeben hatten, wurden sie in sechsköpfige Jurys eingeteilt, die sich beraten und dann ein einstimmiges Urteil fällen sollten. Traten die einzelnen Jurymitglieder für eine milde Bestrafung ein, neigten die Jurys zu mehr Nachsicht. Das hieß, ihre Einstufung fiel systematisch niedriger aus als der Median der einzelnen Mitglieder, bevor sie miteinander gesprochen hatten. Anders formuliert: Die Jurys urteilten nachsichtiger als der Median ihrer Mitglieder vor der Beratung.
Befürworteten die einzelnen Jurymitglieder dagegen eine schwere Strafe, urteilte die Gruppe insgesamt härter. Das hieß, die Einstufung fiel systematisch höher aus als das Median-Rating der einzelnen Mitglieder vor der Beratung. Jurys urteilen nach der Beratung also tendenziell strenger als ihr eigener Median. In welche Richtung und wie sehr sich das Urteil veränderte, richtete sich nach dem Median-Rating der Einzeljuroren. Hatten diese eingangs nachsichtig geurteilt, wurden sie als Gruppe noch nachsichtiger. War das Urteil der einzelnen Jurymitglieder bereits harsch ausgefallen, verstärkte sich diese Tendenz in der Gruppe noch. Dabei ist vor allem die folgende Feststellung interessant: Sind einzelne Mitglieder einer Gruppe empört, ist die ganze Gruppe am Ende noch empörter.
3. In den Vereinigten Staaten wurde eine große Zahl von Gerichtsurteilen und -entscheidungen daraufhin untersucht, ob sich Richter an US-Appellationsgerichten in einem dreiköpfigen Senat von ihren Kollegen beeinflussen lassen.3 Nun möchte man meinen, dass Richter nach ihrer juristischen Einschätzung entscheiden und sich nicht von Konformitätsdruck leiten lassen – doch weit gefehlt.
Ein von einer republikanischen Regierung ernannter Richter, der mit zwei von republikanischen Präsidenten berufenen Kollegen tagt, urteilt mit höherer Wahrscheinlichkeit stereotyp konservativ in Fällen, die Bürgerrechte, sexuelle Belästigung, Umweltschutz und viele andere Aspekte berühren. Noch erstaunlicher ist womöglich, dass ein von den Demokraten berufener Richter mit zwei republikanischen Kollegen ebenfalls mit höherer Wahrscheinlichkeit stereotyp konservativer entscheidet. Und wenn drei von republikanischer Seite berufene Richter gemeinsam tagen, passiert etwas Bedeutungsvolles: Die Wahrscheinlichkeit eines stereotyp konservativen Urteils steigt sprunghaft. Bei von demokratischen Präsidenten ernannten Richtern zeigt sich ein ähnliches Muster. Ein Senat aus drei solchen Richtern urteilt höchstwahrscheinlich stereotyp liberaler.
Kurz, wie von Demokraten beziehungsweise von Republikanern ernannte Richter urteilen, hängt stark davon ab, ob einer oder beide Senatskollegen von Präsidenten berufen wurden, die ebenfalls der jeweiligen Partei angehören. Es zeigt sich ganz klar ein Konformitätsmuster: Demokratische Richter mit republikanischen Senatskollegen urteilen oft wie republikanische Richter und republikanische Richter mit demokratischen Senatskollegen wie demokratische Richter.
Konformität ist für uns alle oft ein durchaus vernünftiges Vorgehen, doch wenn wir uns ausnahmslos (oder zumindest mehrheitlich) konform verhalten, kann es passieren, dass die Gesellschaft am Ende schlimme Fehler begeht. Ein Grund für Konformität ist, dass uns oft eigene Informationen fehlen – über Gesundheit, Investments, Recht und Politik – und die Entscheidungen anderer die besten verfügbaren Informationen darüber darstellen, was zu tun ist. Das Kernproblem: Verbreitete Konformität beraubt die Öffentlichkeit notwendiger Informationen. Konformisten gelten häufig als Wahrer gesellschaftlicher Interessen, die der Gruppe zuliebe ihren Mund halten, während Andersdenkende in aller Regel als egoistische Individualisten wahrgenommen werden, die eigene Absichten verfolgen. Dabei trifft in ganz wesentlicher Hinsicht das Gegenteil viel eher zu. In vielen Situationen profitieren die anderen von den Abweichlern, während die Konformisten nur sich selbst nützen.
In einer funktionierenden Demokratie verringern Institutionen die mit Konformität einhergehenden Gefahren – unter anderem, weil sie dafür sorgen, dass Konformisten von Andersdenken erfahren und lernen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Informationen eruiert werden, was allen Beteiligten zugutekommt. Ein hochrangiger Amtsträger im Zweiten Weltkrieg schrieb die Erfolge der Alliierten und die Niederlage Hitlers und der übrigen Achsenmächte dem Umstand zu, dass Bürger von Demokratien besser kritisch bewerten und widersprechen und dadurch bisherige und geplante Vorgehensweisen optimieren können – auch im Zusammenhang mit Militäreinsätzen.4 Kritische Prüfung und Widerspruch wurden möglich, weil Skeptiker nicht strafrechtlich verfolgt wurden und die informelle Strafe in Form des gesellschaftlichen Drucks vergleichsweise gering war.
Im Zusammenhang mit dieser These behaupte ich, dass tieferer Einblick in Gruppeneinflüsse und ihre potenziell schädlichen Effekte ein neues Licht auf viele verschiedene Themen wirft, zum Beispiel: die Beschaffenheit gut funktionierender konstitutioneller Strukturen, Extremismus, die Popularität des Autoritarismus, die Bedeutung der Gewaltenteilung, das »Echokammer«-Problem, die Grundvoraussetzungen für ein System der Meinungsfreiheit, die prägenden Merkmale liberaler politischer Ordnungen, die Laster und Tugenden der modernen sozialen Medien, die Funktionen des Zweikammersystems, die einschränkenden Effekte gesellschaftlicher Normen, die Ursachen von interethnischen Anfeindungen und politischem Radikalismus, die Bedeutung von Bürgerrechten in Kriegszeiten und Zeiten der gesellschaftlichen Ängste und Hexenjagden, die Leistung der Gerichte, die Auswirkungen von Diversität auf die US-amerikanischen Bundesgerichte, positive Diskriminierung in der Hochschulbildung sowie die potenziell enormen Konsequenzen von Gesetzen, selbst wenn diese nie vollstreckt werden.
Ich fokussiere dabei durchgehend zwei Einflüsse auf die Überzeugungen und das Verhalten Einzelner: Der erste hängt mit den Informationen zusammen, die durch die Handlungen und Äußerungen anderer übermittelt werden. Hält eine Reihe von Menschen eine bestimmte Behauptung für wahr, besteht Grund zu der Annahme, dass sie auch wirklich wahr ist. Was wir über Fakten, Moralität und Recht denken, ist nicht ein Produkt unserer Kenntnisse aus erster Hand, sondern der Erfahrungen, die uns das Verhalten und Denken anderer vermitteln – und zwar, obwohl sich auch diese womöglich nur an der Masse orientieren. Das führt im Leben womöglich zu gewaltigen Problemen. Im Rechtswesen der USA kann dieses Phänomen das Präzedenzsystem vor große Schwierigkeiten stellen, denn wenn sich Revisionsgerichte nach der vorausgegangenen Instanz richten und diese wiederum nach ihren Vorläufern, entsteht die Gefahr, dass sich Fehler verbreiten und fortpflanzen. Diese Probleme können wir per se als bedeutsam begreifen, aber auch als Metapher für viele soziale Phänomene.
Außerdem trifft zu, dass manche Menschen weit mehr Einfluss ausüben als andere – einfach, weil die Entscheidungen dieser Menschen mehr Informationen übertragen. Besonders gern orientieren wir uns an Menschen, die Sicherheit ausstrahlen (die »Vertrauensheuristik«), über Fachkenntnisse verfügen, uns sehr ähnlich erscheinen, besonders gut dastehen oder zu denen wir aus anderen Gründen Vertrauen haben. Die Betonung liegt dabei auf »sehr ähnlich«: Das sind – im positiven wie im negativen Sinne – die Menschen, deren Überzeugungen die unseren am stärksten prägen.
Der zweite Einfluss ist der alles beherrschende Wunsch des Menschen, bei anderen hochangesehen zu sein und zu bleiben. Glauben mehrere Menschen dasselbe, ist das allein schon ein Grund, ihnen nicht zu widersprechen – zumindest nicht öffentlich. Andere sollen eine gute Meinung von uns haben, und das bringt Konformismus hervor und unterdrückt Widerspruch – vor allem, aber nicht nur, in Gruppen, deren Mitglieder einander durch Loyalität und Zuneigung verbunden sind. Das kann Lerneffekte verhindern, Unwahrheiten zementieren, Dogmatismus verstärken und die Leistung der ganzen Gruppe mindern, was bis in die höchsten Ränge der Regierung – das Weiße Haus eingeschlossen – zum ernsthaften Problem werden kann. Wie wir sehen werden, sind Gruppen einander nahestehender Menschen oft weniger erfolgreich, weil durch diese Nähe Konflikte und Meinungsverschiedenheiten unterbunden werden. So gehen Beschäftigte mit weit höherer Wahrscheinlichkeit vor Gericht, wenn das andere Mitglieder aus ihrer Arbeitsgruppe bereits vor ihnen getan haben.5 Junge Mädchen, die erlebt haben, wie Gleichaltrige schon Kinder bekommen, werden selbst häufiger schwanger.6 Vorgelebtes Verhalten anderer hat auch einen großen Effekt auf die Gewaltkriminalität.7 Fernsehsender ahmen einander nach, was zu ansonsten unerklärlichen Modeerscheinungen im Programm führt.8 Und erstinstanzliche Gerichte tun dasselbe, weshalb vor allem in sehr fachspezifischen Bereichen Justizfehler oftmals nie korrigiert werden.9
Doch über diese sozialen Einflüsse sollten wir weder lamentieren, noch sollten wir sie wegwünschen, denn in den meisten Fällen ergeht es den Menschen besser, wenn sie berücksichtigen, wie andere vorgehen. Manchmal ist es sogar am besten, anderen blind zu folgen. Doch soziale Einflüsse können auch die insgesamt verfügbaren Informationen verringern. Oftmals laufen Einzelne und Institutionen dadurch Gefahr, einen falschen Kurs einzuschlagen. Dissens kann ein wichtiges Korrektiv sein. In viele Gruppen und Institutionen gibt es davon zu wenig.10
Wie wir noch sehen werden, sind Konformisten Trittbrettfahrer, während Andersdenkende anderen Vorteile bringen. So eine Fahrt auf dem Trittbrett ist durchaus verführerisch. Doch wir werden noch feststellen, dass sozialer Druck ganze Gruppen Gleichgesinnter zu extremen Positionen führen kann. Steigern sich Gruppen in Hass und Gewalt hinein, dann nur selten, weil es ihnen wirtschaftlich schlecht geht11 oder weil sie schon immer bestimmte Verdachtsmomente erkannten.12 Weitaus häufiger geschieht das aufgrund der hier angesprochenen Informations- und Reputationseinflüsse. Tatsächlich ist unbegründeter Extremismus vielfach das Ergebnis einer »verkrüppelten Erkenntnistheorie«, wonach Extremisten auf eine kleine Teilmenge einschlägiger Informationen reagieren, die sie meist voneinander beziehen.14
Es gibt noch weitere ähnliche, aber weniger dramatische Prozesse. Viele maßgebliche Veränderungen in der Gesetzgebung, der Demokratie und der Rechtsprechung lassen sich am besten mit einem Verweis auf soziale Einflüsse erklären. Zeigt die Legislative plötzlich Interesse an einem bislang vernachlässigten Problem wie illegale Einwanderung, Klimawandel, Sondermülldeponien oder Fehlverhalten von Unternehmen, dann häufig infolge von Konformitätseffekten – nicht, weil ihr das Problem wirklich am Herzen liegt. Natürlich könnte es dafür gute Gründe geben. Doch wenn soziale Einflüsse die Menschen dazu animieren, Informationen, über die sie verfügen, zurückzuhalten, oder wenn sich Blinde als Blindenführer betätigen, so führt das voraussichtlich zu größeren Problemen.
Es gibt allerdings noch einen weiteren Aspekt: Bei vergleichsweise leichten »Schocks« kann es vorkommen, dass ähnliche Gruppen durch sozialen Druck zu ganz anderen Überzeugungen und Handlungen gedrängt werden. Gibt es gesellschaftliche Unterschiede oder ereignen sich größere Veränderungen über längere Zeit, liegt der Grund dafür häufig nicht dort, wo wir ihn vermuten würden, sondern in kleinen, mitunter schwer definierbaren Faktoren.15 Größere Veränderungen lassen sich oft durch glückliche Zufälle erklären. Tiefgründigere Erklärungen bezüglich Kultur oder Geschichte sind zwar oft tröstlich, aber falsch.
Wer um die Einflüsse von Informationen weiß, und darum, wie wichtig den Menschen die gute Meinung anderer ist, erkennt leichter, wie und wann ein Gesetz Verhaltensänderungen bewirken kann, ohne vollstreckt zu werden – nämlich allein durch das Signal, das es aussendet. Der Knackpunkt: Das Gesetz kann belastbare Indizien dafür liefern, was man tun sollte, und dafür, was man nach Ansicht der meisten Menschen tun sollte. In beiden Fällen kann es eine Menge einschlägiger Informationen übermitteln. Denken Sie nur an das Verbot, in der Öffentlichkeit zu rauchen, oder an das Verbot sexueller Belästigung. Bringt das Gesetz nach Ansicht der Menschen die Überzeugung der Mehrheit oder der Gesamtheit der Menschen zum Ausdruck, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Gesetzesbrecher rauchen oder jemanden sexuell belästigen. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Opfer versuchen, das Gesetz privat durchzusetzen – etwa, indem sie andere auf ihre gesetzlichen Pflichten hinweisen und darauf bestehen, dass Verstöße eingestellt werden. Die #MeToo-Bewegung der Jahre 2017 und 2018 hatte viele Ursachen und ist eng mit mehreren der Phänomene verknüpft, auf die ich mich hier fokussiere. Möglich gemacht hat sie unter anderem das Gesetz, das sexuelle Belästigung untersagt. Unter diesem Aspekt können wir die umstrittene Behauptung, das Recht habe eine »expressive Funktion«, besser einordnen.16 Durch diese Funktion kann es sogar soziale Kaskaden stoppen oder beschleunigen. Auch diesbezüglich sind das Rauchen und die sexuelle Belästigung aussagefähige Beispiele. Und die #MeToo-Bewegung kann durchaus als Kaskade angesehen werden. Wären die Möchtegerngesetzesbrecher allerdings Teil einer andersdenkenden Untergruppe, könnten sie sich dem expressiven Effekt des Gesetzes womöglich problemlos entziehen. Gleichgesinnte Abweichler können sich zusammenrotten und einander dazu animieren, gegen das Gesetz zu verstoßen. Tatsächlich können informations- und reputationsbezogene Faktoren sogar zur verbreiteten Zuwiderhandlung ermuntern, wie es beispielsweise beim Drogenmissbrauch oder bei Verstößen gegen das Steuerrecht der Fall ist.17 Die expressive Macht des Gesetzes ist zum Teil eine Funktion seiner moralischen Autorität. Fehlt dem Gesetz diese Autorität bei einer Untergruppe, dann kann das ausgesendete Signal bedeutungslos oder sogar kontraproduktiv sein. Das Gesetz sagt dann vielleicht »Nein!«, aber manch anderer wird dann gern »Ja!« rufen.
Dieses Buch ist in vier Kapitel untergliedert. Im ersten Kapitel entwickle ich ein zentrales, übergreifendes Thema – nämlich, dass Einzelne in vielen Situationen ihre privaten Signale (dazu, was wahr und richtig ist) unterdrücken, was erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten kann. Im zweiten Kapitel wende ich mich den sozialen Kaskaden zu, durch die sich eine Idee oder Praxis rasch von einem Menschen zum anderen verbreitet, was potenziell zu radikalen Veränderungen führt. Mit Fokus auf der Gruppenpolarisierung setzt sich das dritte Kapitel mit den Fragen auseinander, wie, warum und wann Gruppen Gleichgesinnter in den Extremismus abgleiten.
Das vierte Kapitel schließlich ist den Institutionen gewidmet. Ich vertrete den Standpunkt, dass der Hauptbeitrag der Väter der US-Verfassung zum einen darin liegt, dass sie sich für eine deliberative Demokratie ausgesprochen haben, zum anderen in ihrem Beharren darauf, dass kognitive Diversität auf jeden Fall etwas Gutes ist und den Partizipationsprozess vermutlich verbessert. Die Begeisterung für kognitive Vielfalt erklärt die Systeme der Gewaltenteilung und des Föderalismus. Ich behaupte ferner, dass es wichtig ist, bei Bundesrichtern auf Meinungsvielfalt zu achten. Es sollte sogar geprüft werden, ob nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht werden sollte, dass sich Senate am Revisionsgericht aus Richtern zusammensetzen, die von Präsidenten verschiedener Parteien berufen wurden.
Die Analyse der Diversität bei Bundesrichtern ist per se von Interesse, soll hier aber auch als Beispiel für die große Zahl von Situationen dienen, in denen kognitive Vielfalt wichtig ist und Konformität verheerende Folgen haben kann. Ich dringe ferner darauf, dass es in Fällen, in denen ethnische Vielfalt den Diskurs bereichert, absolut legitim ist, wenn Hochschulen und Universitäten versuchen, diese proaktiv zu fördern.
Erstes Kapitel: WIE KONFORMITÄT FUNKTIONIERT
Warum und wann orientiert der Mensch sein Verhalten an anderen? Um das zu beantworten, müssen wir zwischen schweren und leichten Fragen differenzieren. Es gibt guten Grund zu der Annahme, dass Menschen, die sicher sind, dass sie recht haben, eher tun, was sie für richtig halten, und sich nicht nach der Meinung der Masse richten. Diese Spekulation wird gleich von mehreren Experimenten gestützt, die jedoch auch zu überraschenden Wendungen führen. Vor allem aber gehen daraus drei Gesichtspunkte hervor, auf die ich durchgängig abhebe:
Wer selbstbewusst und sicher auftritt, hat besonders viel Einfluss und kann ansonsten identische Gruppen in ganz andere Richtungen führen.
Der Mensch ist extrem anfällig für einstimmige Auffassungen anderer. Deshalb dürfte bereits ein einziger Andersdenkender – eine Stimme der Vernunft – enorme Wirkung haben.
Von Angehörigen einer Gruppe, der wir misstrauen oder die uns unsympathisch ist – einer sogenannten »Outgroup« –, lassen wir uns mit weit geringerer Wahrscheinlichkeit beeinflussen, selbst wenn es um ganz einfache Fragen geht.1 Vielleicht sagen oder tun wir sogar genau das Gegenteil (»reaktive Abwertung«). Gehören andere dagegen der gleichen Gruppe an wie wir, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in leichten und schweren Fragen auf sie hören, weitaus größer. Sympathie wirkt sich maßgeblich darauf aus, wie wir auf das reagieren, was andere sagen und tun.
Zwar habe ich durchaus auch einiges über das Alltagsleben zu sagen, doch letztlich will ich ergründen, wie sich diese Aspekte auf Politik und Recht auswirken. Beginnen wir damit, indem wir einige klassische Studien auswerten.
Schwierige Fragen
In den 1930er-Jahren führte der Psychologe Muzafer Sherif einfache Experimente zur Sinneswahrnehmung durch.2