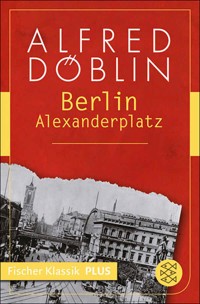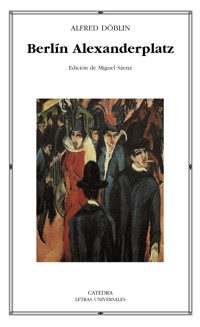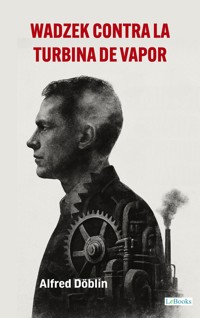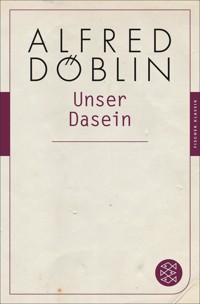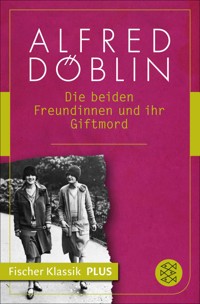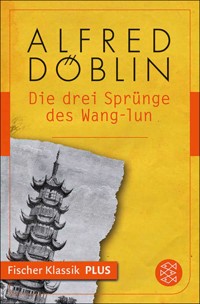
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alfred Döblin, Werke in zehn Bänden
- Sprache: Deutsch
Mit einem Nachwort von Gabriele Sander. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk. Alfred Döblins erster großer Roman Terror und politische Verfolgung, Religion und Gewaltlosigkeit sind die zentralen Themen des erstmals 1915/16 im S. Fischer Verlag erschienenen ›Wang-lun‹. Mit seiner modernen Erzähltechnik und den beeindruckenden Massenszenen begeisterte das Buch die zeitgenössische Kritik. »Nimmt man es in der heutigen Zeit des Terrorismus in die Hand«, so Günter Grass, »wirkt das Werk ungeheuer aktuell.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alfred Döblin
Die drei Sprünge des Wang-lun
Chinesischer Roman
Über dieses Buch
Religion und Gewalt sind die zentralen Themen dieses erstmals 1915/16 erschienenen Romans, der im China des 18. Jahrhunderts spielt. Erzählt wird die Geschichte des Sektenführers und Rebellen Wang-lun, der zunächst, dem »Wu wei«-Dogma des Nichtwiderstrebens folgend, absolute Gewaltlosigkeit predigt. Als dann aber die von Wang-lun angeführte Sekte der »Wahrhaft Schwachen« zu einer realen Gefahr für die Mandschu-Dynastie wird, sieht sich der in seiner Position bedrohte Kaiser gezwungen, Wang-luns Sekte mit aller Staatsmacht zu bekämpfen. Die »Wahrhaft Schwachen« schwören im Zuge der politischen Verfolgung dem Dogma der Gewaltfreiheit ab, ziehen von Verbrechen zu Verbrechen und führen erbitterte Kämpfe gegen die kaiserlichen Truppen. Am Ende schließlich kommt es zur entscheidenden Schlacht ...Mit seiner modernen Erzähltechnik und den beeindruckenden Massenszenen begeisterte Döblins chinesischer Roman unmittelbar nach seinem Erscheinen die zeitgenössische Kritik. »Nimmt man es in der heutigen Zeit des Terrorismus in die Hand«, so Günter Grass, »wirkt das Werk ungeheuer aktuell.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Alfred Döblinwurde am 10. August 1878 in Stettin an der Oder geboren. Nach dem Studium der Medizin arbeitete er fünf Jahre lang als Assistenzarzt und eröffnete 1911 in Berlin eine eigene Praxis. Nach der Veröffentlichung erster Erzählungen, darunter ›Die Ermordung einer Butterblume‹, erschien Döblins erster großer Roman, ›Die drei Sprünge des Wang-lun‹, im Jahr 1915/16 bei S. Fischer. Sein größter internationaler Erfolg war der 1929 ebenfalls bei S. Fischer publizierte Roman ›Berlin Alexanderplatz‹. 1933 flüchtete Döblin vor dem Nationalsozialismus nach Zürich. Die meiste Zeit seiner Jahre im Exil verbrachte er in Frankreich und den USA. Aus dem Exil zurückgekehrt, lebte Döblin zunächst wieder in Deutschland, zog dann aber 1953 mit seiner Familie nach Paris. Alfred Döblin starb am 26. Juni1957
Impressum
Covergestaltung: bilekjaeger, Stuttgart
Coverabbildung: ullstein bild – Heritage Images / The Print Collector
Veröffentlicht als E-Book 2013.
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Aus technischen Gründen ist das "Zweite Buch" in zwei Teilen gespeichert und mit einer Zwischenüberschrift im Inhaltsverzeichnis versehen worden.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402289-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Zueignung
Erstes Buch
Zweites Buch [Teil 1]
Zweites Buch [Teil 2]
Drittes Buch
Viertes Buch
Anhang
Editorische Notiz
Daten zu Leben und Werk
Alfred Döblin
Nachwort
Entstehung: Anregungen und Quellen
Die zeitgenössische Rezeption
Die »Zueignung«
Döblins »chinesischer Roman« – eine literarische Inszenierung des Fremdkulturellen
Literaturhinweise
1. Texte von Alfred Döblin
2. Texte über Alfred Döblin
Gesammelte Werke im Taschenbuch
Zueignung
DASS ICH nicht vergesse –.
Ein sanfter Pfiff von der Straße herauf. Metallisches Anlaufen, Schnurren, Knistern. Ein Schlag gegen meinen knöchernen Federhalter.
Daß ich nicht vergesse –.
Was denn?
Ich will das Fenster schließen.
Die Straßen haben sonderbare Stimmen in den letzten Jahren bekommen. Ein Rost ist unter die Steine gespannt; an jeder Stange baumeln meterdicke Glasscherben, grollende Eisenplatten, echokäuende Mannesmannröhren. Ein Bummern, Durcheinanderpoltern aus Holz, Mammutschlünden, gepreßter Luft, Geröll. Ein elektrisches Flöten schienenentlang. Motorkeuchende Wagen segeln auf die Seite gelegt über das Asphalt; meine Türen schüttern. Die milchweißen Bogenlampen prasseln massive Strahlen gegen die Scheiben, laden Fuder Licht in meinem Zimmer ab.
Ich tadle das verwirrende Vibrieren nicht. Nur finde ich mich nicht zurecht.
Ich weiß nicht, wessen Stimmen das sind, wessen Seele solch tausendtönniges Gewölbe von Resonanz braucht.
Dieser himmlische Taubenflug der Aeroplane.
Diese schlüpfenden Kamine unter dem Boden.
Dieses Blitzen von Worten über hundert Meilen:
Wem dient es?
Die Menschen auf dem Trottoir kenne ich doch. Ihre Telefunken sind neu. Die Grimassen der Habgier, die feindliche Sattheit des bläulich rasierten Kinns, die dünne Schnüffelnase der Geilheit, die Roheit, an deren Geleeblut das Herz sich klein puppert, der wässerige Hundeblick der Ehrsucht, ihre Kehlen haben die Jahrhunderte durchkläfft und sie angefüllt mit – Fortschritt.
O, ich kenne das. Ich, vom Wind gestriegelt.
Daß ich nicht vergesse –.
Im Leben dieser Erde sind zweitausend Jahre ein Jahr.
Gewinnen, Erobern; ein alter Mann sprach: »Wir gehen und wissen nicht wohin. Wir bleiben und wissen nicht wo. Wir essen und wissen nicht warum. Das alles ist die starke Lebenskraft von Himmel und Erde: wer kann da sprechen von Gewinnen, Besitzen?«
Ich will ihm opfern hinter meinem Fenster, dem weisen alten Manne,
Liä Dsi
mit diesem ohnmächtigen Buch.
Erstes Buch
Wang-lun
AUF DEN Bergen Tschi-lis, in den Ebenen, unter dem alles duldenden Himmel saßen die, gegen welche die Panzer und Pfeile des Kaisers Khien-lung gerüstet wurden. Die durch die Städte zogen, sich über die Marktflecken und Dörfer verbreiteten.
Ein leiser Schauer ging durch das Land, wo die »Wahrhaft Schwachen« erschienen. Ihr Name Wu-wei war seit Monaten wieder in allen Mündern. Sie hatten keine Wohnstätten; sie bettelten um den Reis, den Bohnenbrei, den sie brauchten, halfen den Bauern, Handwerkern bei der Arbeit. Sie predigten nicht, suchten niemanden zu bekehren. Vergeblich bemühten sich Literaten, die sich unter sie mischten, ein religiöses Dogma von ihnen zu hören. Sie hatten keine Götterbilder, sprachen nicht vom Rade des Daseins. Nachts schlugen viele ihr Lager auf unter Felsen, in den riesigen Waldungen, Berghöhlen. Ein lautes Seufzen und Weinen erhob sich oft von ihren Raststätten. Das waren die jungen Brüder und Schwestern. Viele aßen kein Fleisch, brachen keine Blumen um, schienen Freundschaft mit den Pflanzen, Tieren und Steinen zu halten.
Da war ein frischer junger Mann aus Schan-tung, der das erste Examen mit Auszeichnung bestanden hatte. Er hatte seinen Vater, der allein im Fischerboot ausgefahren war, aus schwerster Seenot gerettet; ehe er dem Vater nachfuhr, gelobte er, den Wu-wei-Anhängern zu folgen. Und so ging er, kaum daß die freudevollen Examensfeiern vorbei waren, still aus dem Haus. Es war ein ehrerbietiger, etwas scheuer Jüngling, mit eingekellerten Augen, der sichtlich schwer unter seinem seelischen Zwiespalt litt.
Ein Bohnenhändler, ein rippendürrer Mann, lebte fünfzehn Jahre in kinderloser Ehe. Er grämte sich tief, daß niemand nach seinem Tode für ihn beten würde, seinen Geist speisen und pflegen würde. Als er fünfundvierzig Jahre alt wurde, verließ er seine Heimat.
Tsin war ein reicher Mann vom Fuße des Tschan. Er lebte in dauernder Wut, weil er, wie sehr er sein Geld schützte, alle Monate bestohlen wurde, wenn auch nur um Kleinigkeiten. Dazu kamen Erpressungen durch die Polizisten, Steuerbeamten; mehrmals brannten Häuser von ihm ab, von Böswilligen angesteckt. Er fürchtete, daß er eines Tages ohne Habe und Gut dastehen würde. Er fühlte sich macht- und rechtlos. Da verschenkte er sein ganzes Geld an blinde Musikanten, alte Hurenwirtinnen, Schauspieler; zündete selbst sein Haus an und ging in den Wald.
Junge Wüstlinge zusammen mit Dirnen, die sie aus den bemalten Häusern befreit hatten, wanderten herzu. Oft sah man die Dirnen, die zu den verehrtesten Schwestern gehörten, in eigentümlichen Verzückungen unter den purpurnen Kallikarpen, in den Hirsefeldern, und hörte sie unverständlich stammeln.
Sechs Freundinnen vom nördlichen Kaiserkanal, die man als Kinder verheiratet hatte, sprangen in dem Monat, in dem sie in das Haus ihrer Gatten gebracht werden sollten, mit einer Pferdekette aneinandergebunden, unterhalb ihrer Heimatstadt in den Kanal. Sie wurden, da sie beim Hineinstürzen sich an den Ufermauern verletzten, hängen blieben und laut schrien, gerettet von einigen vorüberziehenden Karrenschiebern, welche sie auf das nächste Polizeigewahrsam transportierten, nachdem sie die ganz willenlosen Mädchen mit Kleiderfetzen zur Not verbunden hatten. Als sie, auf dem Amt freundlich verpflegt, sich erholten und zurecht machten, kamen ihre Väter draußen angestürzt. Die Mädchen hörten die lärmende Auseinandersetzung mit den Wachen, stiegen durch ein hinteres Fenster hinaus und entkamen. Sie schlugen sich von Ortschaft zu Ortschaft durch, hielten sich in einer geschützten Berghöhle verborgen, verschafften sich durch Aushilfsarbeit auf den umliegenden Gehöften, in den Mühlen Nahrung. Die Jüngste von ihnen, ein fünfzehnjähriges blühendes Mädchen, die Tochter der Nebenfrau eines alten Lehrers, starb da, indem ihr ein Räuber Gewalt antat und sie dann erwürgte. Der Räuber trat nicht viel später zusammen mit den Mädchen einer Gruppe der Sektierer bei.
Im nordöstlichen China, in den Provinzen Tschi-li, Schan-tung, Schan-si, ja in Kiang-su und Ho-nan, in großen Städten mit hunderttausenden von Einwohnern, in den tüchtigen Arbeitsdörfern wie in den Spelunkennestern kam es alle paar Tage vor, daß einer auf den Markt ging und vor irgendeinem Betrüger, vor einem Bettelpriester, vor einem lahmen Kind, in einen Eselstrog sein Geld und seine Wertsachen ausschüttete. Daß Ehemänner aus kinderreichen Familien verschwanden; man traf sie nach Monaten in entfernten Distrikten, mit den Vagabunden bettelnd. Es ging hie und da ein unterer Beamter wochenlang wie benommen und träge herum, antwortete bissig auf jede Frage, zuckte frech mit der Achsel bei einer Rüge; dann beging er plötzlich ein erstaunliches Verbrechen, unterschlug öffentliche Gelder, zerriß wichtige Aktenbündel oder griff einen harmlosen Menschen an und zerbrach ihm Rippen. Verurteilt ertrug er seine Strafe und Schande gleichmütig, oder entwich aus dem Gefängnis, ging in den Wald. Dies waren die Leute, denen die Trennung von Familie und Besitz am schwersten wurde und die sich nur durch ein Verbrechen von ihnen ablösen konnten.
Sie trugen nichts vor, was man nicht schon wußte. Eine alte Fabel, die sie erzählten, ging von Mund zu Munde:
Es war einmal ein Mann, der fürchtete sich vor seinem Schatten und haßte seine Fußspuren. Und um beiden zu entgehen, ergriff er die Flucht. Aber je öfter er den Fuß hob, um so häufiger ließ er Spuren zurück. Und so schnell er auch lief, löste sich der Schatten nicht von seinem Körper. Da wähnte er, er säume noch zu sehr; begann schneller zu laufen, ohne Rast, bis seine Kraft erschöpft war und er starb. Er hatte nicht gewußt, daß er nur an einem schattigen Ort zu weilen brauchte, um seinen Schatten los zu sein. Daß er sich nur ruhig zu verhalten brauchte, um keine Fußspuren zu hinterlassen. –
Ein Seufzen preßte das Land aus. Man hatte so glückverschleierte Augen nie gesehen. Ein Zittern ging durch die Familien. Und wenn abends wieder von den »Wahrhaft Schwachen« und der alten Fabel gesprochen wurde, sah einer den andern an und morgens forschten sie, wer verschwunden sei.
Ein geheimes süßes Leiden schien besonders die jungen kräftigen Männer und Frauen befallen zu haben. Sie schienen fortgezogen zu werden von einer Art bräutlichem Schmerz.
WANG-LUN war das Haupt der Bewegung.
Er stammte aus Schan-tung, aus einem Küstendorfe namens Hun-kang-tsun, im Distrikt Hai-ling; der Sohn eines einfachen Fischers. Er erzählte später in beiläufigen Wendungen, sein Vater sei der erste der dortigen Fischerzunft gewesen; an der Wand des Zunfthauses stünde noch der Name seines Vaters, des Begründers dieses Hauses. Aber in ganz Hai-ling gab es kein Gildenhaus. Die zweihundertzwanzig Familien des Örtchens schlugen sich mühselig durch. Die Männer schwammen zum Fang auf dem Meere; die Frauen bestellten die wenigen Felder. Der Boden war so knapp, daß man künstliche Äcker auf den breiten Terrassen der Kalkfelsen anlegte, welche dicht an den Strand traten. Mühsam schleppte Mann und Weib die lockere Erde auf Holzmulden herauf, über die schmalen Serpentinen, Mulde nach Mulde, dann warfen sie den spärlichen Dünger, trockene Krebsschalen und Menschenkot.
Dort über dem Meere wirtschafteten Weiber, Kinder und alte Männer tagsüber; Geplärr und dumpfes Rumoren scholl herunter in das leere Dorf. Es hatten früher hier mehr Familien gewohnt. Aber über fünfzig Häuser waren eines Tages von einem vorüberziehenden plündernden Haufen, der von Tschifu herkam, in Brand gesteckt worden. Dem alten Dorfschulzen hatten sie zwischen zwei Gneisblöcken die Füße gequetscht, als er nicht die zweihundert Taels zahlte, die sie verlangten, dann ihm mit einem Balkenschlag den linken Arm zermalmt und ihn, nachdem sie ein breites Loch in das Eis geschlagen hatten – es war Winter –, in einen Tümpel geschleudert. Das stoßweise Gebrüll der sechs Mann, die den jammernden Schulzen immer wieder mit Brettern niederdrückten, das Klatschen der Planken auf der Eisfläche, das laute Schlingen und Wasserspeien des Ertrinkenden, dazu das ungeduldige Wiehern ihrer gestohlenen Pferde, war eine der wenigen Kindheitserinnerungen Wang-luns.
Mit Sonnenaufgang fuhr der alte Wang in den beiden heißen Monaten aufs Meer hinaus, auf einer zweimastigen Dschunke, die am Bug aus zwei großen grünen gemalten Glotzaugen spähte. Zu fünfen saßen die Fischer drin. Die Segel schwellten; sie legten die Ruder hin; gleichmäßig glitten sie einher über dem dunklen Pei-ho neben der Nachbardschunke. Sie warfen draußen das verschlungene scharfriechende Netz aus, spannten es von Dschunke zu Dschunke. Die Drehrollen, die das Netz senkten und zogen, knarrten, heulten, standen fest.
Die Männer blieben bis zum späten Nachmittag draußen. Die Sonnenhitze fiel wie ein trockener sengender Regen über Mensch und Getier. Dickwanstig saß der alte Wang unter seinem tellerförmigen riesigen Strohhut auf der Ruderbank und warf mit spitzen Steinen nach den Seemöwen, die hinter den Dschunken aus der flimmernden Luft tauchten. Während die andern Bootsleute im Schiff die Pfeife rauchten oder Tabak kauten. Sobald Wang seine Schleuder ordnete, setzte sich ein kleiner Bootsmann vor ihn an den hinteren Mast, rauchte sorglos, holte vorsichtig einen elastischen Weidenstock unter dem Tauwerk hervor. Die Schleuder knarrte, der Kleine reckte sich mit tönendem Gähnen, die Schleuder wickelte sich um seinen Stock und ausgestreckten Arm, knallte mit dem Stein unfehlbar dem gespannt wartenden Wang vor die Brust oder auf die Beine. Betrübt sah er seiner schwirrenden Möwe nach. Das Boot schwankte unter dem Lachen der vier, die sich auf die nassen Bretter legten.
Wang torkelte großspurig durch die Teestuben, bewarb sich einmal, eines unbeschäftigten Morgens aus seinem Bohnenfeldchen aufstehend, um die Stelle eines Ortsvorstehers auf dem Amt, zur weinenden Wut seiner abgerackerten Frau, die den Spott über Wang voraushörte. Gern lag er im Sande, neben den Becken, die seine beiden Söhne mit Holzkohlen füllten zum Trocknen der Tintenfische. Zündeten sie um die Zeit der Ebbe die Becken auf der Dschunke selbst an, so trabte er zum Strande und hockte sich hin. Da lagen halb umgestülpt die leeren Fischkörbe, ausgebreitet im Sande die gedörrten Tiere, die in der Sonne sich schön färbten. Sie fühlten sich glühend an.
Der Dickwanst stocherte in den Schlammlöchern herum, zog lange Sandwürmer heraus, von denen er die Hälfte seiner Frau zum Trocknen und Verkauf gab. Er selbst behielt sich abseits ein großes Maß, trocknete sie heimlich und schlürfte seine herzhaft köstliche Suppe hinter den Körben.
Dann kamen nach einer Weile die beiden Knaben von der Dschunke herüber, wickelten ihm, da er schwitzte, seine Beinbinden los. Sie kauerten ernst vor ihm mit ihren kleinen Rattenschwänzen, den Zöpfchen und legten die Hände auf den Schoß. In hochmütig näselndem Tone, laut, daß ihn die Nachbarn hörten, redete Wang über sie hinweg, den feisten Rumpf aufgetakelt, rückwärts gestützt auf den Ellenbogen; das nannte er seine Unterrichtsstunde. Er kannte in der Tat die Fibel, das Buch der tausendachtundsechzig Worte des Tscheou-hing-tse; bis auf einige Fehler kannte er es auswendig; es schien auch, als ob er aus dem Frauenbuche einige Sätze gelernt hätte. Immer wieder erklärte er den Kindern, daß er bedaure, nicht streng genug zu ihnen zu sein; Strenge zu ihnen sei seine heilige Pflicht, denn – und die Kinder fielen singend ein: »Erziehung ohne Strenge ist des Vaters Trägheit.«
Und alle paar Tage hörte der künftige Lehrer dreier Provinzen, daß Freude, Zorn, Kummer, Furcht, Liebe, Haß und Begier die sieben Leidenschaften seien. Nicht oft konnten die Kinder ihn unbeschäftigt anhören. Wang-luns Gesicht war schwarzbraun und viereckig, breit; kräftige Linien holten ein reges, verschlagenes Gesicht aus. Die zarte mehr gelbe Tönung der Haut seines gleichaltrigen Bruders nahm trotz aller Meeresgluten keinen tieferen Schatten an; der Knabe blieb elastischer, weicher und ernster als Wang-lun, der wegen seiner bösartigen Späße unter den Spielgefährten wenig beliebt war, auch wenig Verständnis für einen der Sätze seines Vaters hatte: daß zu den fünf höchsten sittlichen Beziehungen die Bruderliebe gehörte.
Munter, mehr spielend als tätig, saßen sie rotkäppig auf den kantigen Steinen des Strandes an dem großen Fischnetz. Auf einer grasbewachsenen Düne hinter ihnen zehn Männerschritte entfernt lagerte der unförmige alte Wang; die nackten, dunkelbehaarten Beine aufgestellt und übereinander geschlagen, kratzte er sich die kleinen eingetretenen Muscheln von der klobigen Fußsohle ab. Er hielt in seiner liegenden rechten Hand ein Ende des Netzes, das die Knaben mit dem dickflüssigen Saft der Mandarinenschale färbten. Er rückte sich höher; die Kinder schnalzten musikalisch, er spuckte und grunzte. Dröhnend entfuhr ihm von Zeit zu Zeit eine Belehrung, zum Beispiel: »Der Kürbis gilt seit altersher als Zeichen der Fruchtbarkeit.« Bis ihm ein Windstoß scharfen Sand ins Gesicht wehte, er sich hustend aus seiner Grube herauswälzte und ihre Farbschüssel umwarf. Mit kläglich bettelndem Blick sagte er, sie hätten wohl nicht den richtigen Ort zum Färben gewählt. Und sie wickelten ihm seine Binden wieder um und zogen ein paar Schritt weiter.
Das größte Ereignis im Leben von Wang-luns Vater war, als der Alte zu seinem Bruder reiste, zur Hochzeit seines Neffen, dreihundert Li entfernt von Hun-kang-tsun. Der Alte sah drei Wochen den Strand und die mageren Bohnenfelder nicht. Ein Barbier, der nebenbei Zauberer war, wohnte im Hause seines Bruders; Wang-schen saß abends viel mit ihm zusammen.
Und am Morgen, nachdem er zurückgekehrt war, ging er mit langsamen Schritten zu einem Manne, der Tischlerarbeit verstand, versprach ihm ein Maß getrockneter Sandwürmer, entsprechend einem Wert von vierhundertfünfzig Käsch, wenn er ihm ein rotes hohes Schild schnitzte mit der Inschrift: »Wang-schen, Schüler des berühmten Zauberers Kwoai-tai aus Lui-hsia-tsun, Wind- und Wettermeister.« Als es dunkel geworden war, nach sechs Tagen, holte er das blanke Schild, schwarze Charaktere auf himbeerrotem Grunde, blau gerändert, mit seinem ältesten Sohne ab, band es mit zwei Fischertauen, auf das Dach seines Hauses steigend, am vorspringenden Firstbalken an, während seine Frau schlief, so daß da über den Torweg frei ein Schild herabhing: »Wang-schen, Schüler des berühmten Zauberers Kwoai-tai aus Lui-hsia-tsun, Wind- und Wettermeister.«
Die Frau bekam am Morgen, als sie das prunkende Schild sah und ihren noch schlafenden Mann geweckt hatte, ihren Nervenanfall, den sie seit Jahren nicht gehabt hatte. Sie hatte damals, als einer der Brandstifter zum Fenster hereinrief, ob außer ihr noch jemand in der Wohnung wäre, voll Entsetzen die beiden einjährigen Kinder zwischen ihren weiten Pluderhosen festgehalten, dabei mit dem »Nein« scharf den Kopf nach rechts geworfen. Jetzt wogte ihr etwas Grünes durch den Kopf, die beiden Taue des Schildes wuchsen breit wie Blätter, sägten ihr zwischen den Augen; ein blauer gelenkloser Arm langte zwischendurch, eine Hand strömte ihre Finger auf sie zu. Im Takt warf die Frau ihren Kopf von links nach rechts, von rechts nach links, ihre Beine schlugen zusammen, sie tanzte wie die Figur eines Puppenspielers; die Kinder versteckten sich vor ihr auf dem Ofenbett.
Und hell schrien sie auf und rasten auf die Dorfstraße zwischen kläffende kleine Hunde, als aus dem Hof Wang, der alte elefantenbeinige Klumpen, in das räucherige Zimmer drang, mit einer Tigermaske hin und her stapfte und dabei schnaufend sang, über die Frau, die hingesunken war, strich, flüsterte. Nach einer halben Stunde schlief die Frau. Eine Menge von Kindern und Weibern stand an der Tür, schwieg auf dem Hof, stob vor der nahenden Tigermaske schnatternd auseinander.
Dieser Tag war eine Wendung im Leben Wang-schens. Seine Frau sagte kein Wort über das rote Schild, ja sie wurde wortkarg im Umgang mit dem Mann, schlich ihm aus dem Wege.
Er gab sich jetzt nicht mehr als kleiner Gelegenheitslehrer. Er studierte emsig im Hofe unter einer Erle die sonderbaren Zeichen auf einer Bambustafel, die er von dem Zauberer mitgebracht hatte, ging zwischen dem Misthaufen und Geräteschuppen gehobenen Hauptes auf und ab, zitierte laut: »Acht mal neun gleich zweiundsiebzig. Zwei regiert das Paar. Durch Paar vereinigt man das Unpaar. Das Unpaar regiert den Zodiak. Der Zodiak beherrscht den Mond. Der Mond beherrscht die Haare. Daher wachsen die Haare in zwölf Monaten.« Verblüfft sah er von Zeit zu Zeit auf die Tafel; sann, über sich selbst beschämt, nach, befreite sich durch eine rasche niederwerfende Geste. Er ging mit krauser Stirn zwischen den eifrig arbeitenden Fischern am Strand abends herum, äugelte versunken mit den violetten Wolkenballen, blieb vor dem kleinen Pudel eines Korbarbeiters lange nachdenklich stehen, sagte träumerisch, als wenn er mit sich spräche: »Sieben mal neun gleich dreiundsechzig. Drei beherrscht den Polarstern. Dieser die Hunde. Daher werden die Hunde in drei Monaten geboren.«
Nur in der ersten Zeit lachte man hinter ihm, dann bürgerte sich die Auffassung ein, daß er wahrhaft das Zeug zu einem taoistischen Doktor habe, dieser ehemalige Clown des Dorfes. Er wußte so vieles: daß die Schwalben und Sperlinge ins Meer tauchen und zu Eidechsen werden; er konnte den tausendjährigen Fuchsdämon, den neunköpfigen Fasanendämon und den Skorpiondämon bannen; und niemand verstand, was er vom Yin und Yang, dem lichtvollen Männlichen und dem finsteren brütenden Weiblichen sagte.
Er fuhr auf See. Als er eines Morgens versuchsweise nicht zu den Dschunken herabgegangen war, stand seine Frau still vor ihm am Ofenbett. Er erkannte zwischen den zwinkernden Augenlidern, daß sie ihn wie sonst mit einem Faustschlag in die Seite wecken wollte, aber dann ging sie, weckte den fünfzehnjährigen Lun und den Bruder. Und jeden Morgen vor Sonnenaufgang weckte sie die beiden Burschen; oben schnarchte einer behaglich im Halbschlaf.
Wang-schen ging vormittags zum Nachdenken in den kleinen Tempel des Medizingottes, im vorletzten Gebäude des Dorfes. Da er mit jedem im Dorf und in der Nachbarschaft bekannt war, nahmen die Leute viel seine eigentümlichen Dienste in Anspruch, seine Kunst, den »Teufelssprung« zu üben, besonders aber, die »Schwangerschaft zu brechen«. So nannten die Bewohner dieses Teils von Schan-tung eine sonderbare Sitte. Man fürchtete, wenn sich in der Nähe einer schwangeren Frau alte Männer oder kränkliche Kinder fänden, daß sie in den Leib der Schwangeren einziehen könnten, vielleicht um sich so gesund und wieder jung zu machen. Wang-schen tobte bei solcher Not in seiner weißen Tigermaske vor der hockenden Frau im Zimmer herum, feite ihren Leib, indem er ihn mit Schilfsträngen schlug, stieß schwitzend unkenntliche Silben aus. Bisweilen brachte er tausend Käsch von diesen Übungen nach Hause.
Aber einmal kam er von einer Austreibung über die Straßen, sachte, in seiner quer über das Gesicht gezogenen Maske, gelaufen, in seinen Hof, vor seine Stubentür, wo er plump hinfiel. Die Frau riß ihm das Holzbrett vom bleischwarzen Gesicht. Er keuchte. Aus seiner Brust pfiff es; er wälzte seinen Leib und griff um sich. Die Frau rannte nach Kräutern, machte zwei Ziegelsteine für seine Füße heiß. Ein kleines Mädchen schickte sie; das mußte betteln, als hätte es keinen Käsch, um Geld für ein Bambuslos im Medizintempel. Der Krämer und Dorfapotheker gab den Absud, den die Losnummer bezeichnete. Wang spie ihn wieder aus.
Dann erhob sich nachmittags Lärm von vielen Stimmen vor dem Hause. Unaufhörlich Gongschlag auf Gongschlag; Klingeln, Rufe von weither. Schwere Trägerschritte dröhnten vom Hof herein in das stickige Krankenzimmer. Der Medizingott kam selbst, eine rohbemalte Holzsäule, zu seinem Schüler, die Diagnose zu stellen, die Heilung zu bringen. Die Mutter rief dem Schlafenden in die Ohren: »Zeige dich, zeige dich doch!« Sie stützten den Halbblinden, der murmelte und gähnte. Im Zimmer war es wieder still.
Draußen schritt der Gott zum Apotheker; die Träger schwankten in den Laden mit ihren Stangen, der Stab des Gottes zeigte an die unterste Ecke des Regals. Heimlich und entsetzt machte der junge Apothekergehilfe, den Rücken gegen sie gekehrt, das Abwehrzeichen des Tigers; der Stab hatte den Trank des schwarzen Wassers bezeichnet.
Und dem Kranken half nichts mehr.
Der Gott stand schon allein in seinem verfallenen ärmlichen Häuschen am Ende des Dorfes. Es war finster geworden. Sein dicker Schüler, der tapfere Dämonenzwinger, wälzte sich um die dritte Nachtwache hastig auf den Rücken. Die Frau fragte ihn, was er wollte. Sie konnte ihm nur noch die Schuhe anziehen, mit denen man den Totenfluß überschreitet, die Schuhe bestickt mit Pflaumenblüte, Kröte und Gans, und mit einer weißen offenen Wasserlilie.
DER ALTE hatte gewünscht, daß sich Lun zum ersten Examen vorbereite. Aber dessen Talente lagen anderswo und waren ganz besonders. Man bemerkte schon beim Scheren und Rasieren seines kugelrunden Kopfes ein längliches schwarzbraunes Mal auf der rechten Schläfenschuppe, das sein Vater als die Perle der Vollkommenheit deutete.
Wang-lun wuchs heran, gewandt und riesenstark. Unter seiner Roheit und Hinterlist hatten Esel, Hunde, Fische und Menschen zu leiden. Zum Diebstahl wurde er als sechsjähriger Junge von seinem Vater selbst angeleitet, auf merkwürdige Weise. Es war im Dorf üblich, um die Festzeit im ersten Monat, besonders aber am fünften Tag des ersten Monats, aus fremden Gärten und Äckern Gemüse zu stehlen, weil dieses Gemüse Glück bringt. Es durfte niemand einen Eindringling an diesem Tage, sofern er ortsansässig war, verjagen; die Besitzer selbst pflegten vorher alles wertvolle Gewächs beiseite zu stellen und zu überdecken.
Als Wang-lun auf solchem gesetzmäßigen Diebeszuge begriffen mit seinem Bruder und Vater sein Heil versuchte, erging es ihm schlecht; ein paar vertrocknete Erdnüsse klaubte er aus dem Boden. Er trottete wütend hinter den andern her; lief nach Hause, setzte sich still, an einem Salzkrebs lutschend, in die niedrige Stube neben seine Mutter, die ihn lobte, weil er Dummheiten nicht mitmachte.
Er aber saß still zu Hause aus einem anderen Grunde; er hatte eine sehr einfache kurze Überlegung angestellt: wenn man etwas Schönes stehlen will, so ist der fünfte Tag des ersten Monats der ungeeignetste Tag dazu; es ist lächerlich und absurd, gerade an einem Tage stehlen zu gehen, an dem alle stehlen und alle ihre Sachen verstecken.
Er versprach sich, den fünften Tag des ersten Monats ein andermal zu feiern, diesen Tag absatzweise über das Jahr zu verteilen, denn ein Tag hat vierundzwanzig Stunden, die er unterbringen mußte; er mußte das Jahr über die erlaubten vierundzwanzig Stunden stehlen.
Und so stahl der gewandte schlaue Bursche überschlagsweise vierundzwanzig Stunden im Jahr und jeder Diebstahl hatte den Schein des Erlaubten, und ihn begleitete das angenehme Gefühl, das Dorf übertölpelt zu haben; es war genußreich zu stehlen.
Ja einmal, im letzten Lebensjahre des Alten, richtete Wang-lun seine räuberische Logik gegen seinen Vater; er nahm ihm die dünne Bambustafel weg, die tiefbraun und unleserlich geworden war. Den weißbärtigen Wang-schen erfüllte tiefer Schmerz, als er Lun im Hof sitzen sah, die lange vermißte Tafel auf den Knien, sie nach allen Seiten drehend, sie mißtrauisch beschnüffelnd. Lun lief in großen Sätzen mit der Tafel weg; der Alte weinte, über die Tafel und über den Sohn.
Im Dorfe wagten wenige, mit dem rohen Patron anzubinden; seinen Bruder hatte er ganz in der Gewalt.
Man war sehr glücklich, als er, gelangweilt von dem Fischfangen, Dörren, Netzeflicken, unzufrieden mit der Ärmlichkeit seines Heimatortes, aus dem auch durch den raffiniertesten Betrug nicht mehr als dreißig bis vierzig Tiau zu holen waren, eines Tages mit ein paar Kupferkäsch an der Schnur aus Hun-kang-tsun losmarschierte, ziellos die große Straße nach Tsi-nan-fu.
Es war Frühling. Erst lief er allein. Dann, als die Säure ihm in den Mund stieg, schloß er sich den Karrenzügen an, die aus den Töpfereien Waren in die Dörfer schleppten, und verdiente ein paar Cent. Er stieg, grimmig über die geizige Bezahlung, aus dem grünen Tal des Wei-ho auf in die wilden Berge; hinter den einsamen Häusern lauerte er mit einem Beil, einem grünen Sandsteinstück an einem Sandelholz, den Bewohnern auf, entriß ihnen, was sie gerade bei sich trugen, und floh. Auf den furchtbaren Felswegen, die er kletterte, war nichts vom Frühling zu merken. Die Bäche rauschten in den eingeschnittenen Tälern, reißend nach der Schneeschmelze; der zerlumpte Strolch ging nicht zum Waschen herunter zu ihnen; er war feige. Tagelang trug er in seinem Kittel zwanzig kostbare Schnupftabakdosen aus feinstem Glase; aß die rotgelben Kakis, die süßen getrockneten Äpfel, rasierte sich nicht, band seine schmutzklebenden Haare nicht zusammen: er hatte auf der Flucht ein kleines Mädchen bei einer Karawanserei überrannt, das Kind war im Fallen über einen Hang gerollt, dann einen Grat abgestürzt. Wang wagte sich nicht ins Tal aus Furcht vor dem Geist des Kindes.
Auf den letzten westlichen Ausläufern des Tai-ngan-schans, angesichts der reichen blütenüberschwemmten Ebene des Ta-tsing-ho, blieb er fast einen Monat liegen, unter den Bettlern und Lumpen dieses Striches, die in kläglichen Hütten zusammenhockten. War abgemagert, fühlte sich elend; seinen Lebensunterhalt verschwieg er den faulen Gesellen, mit denen er abends Geduldspiele aus Quarzstückchen zurechtsetzte. Er stieg um Mittag einen Felspfad aufwärts, durchkletterte eine kahle Schlucht; dann kam er an die Rückwand eines verrufenen Wirtshauses, das drei mongolische Kühe besaß. Dem aufpassenden Burschen hatte er das erstemal einen Genickstoß gegeben und mit dem Beil gedroht, als er sich einen halben Eimer Milch nahm; jetzt erwartete ihn der Junge alle drei Tage, steckte ihm alten Reiskuchen zu, rohe Eier, ließ ihn melken, soviel er wollte.
Als der Junge eines Tages verschwunden war und zwei bissige Hunde um den Stall liefen, kletterte Wang langsam und hungrig den mühseligen Weg zurück, die Schlucht hindurch, den Felspfad herunter. Erst wollte er zu den Bettlern zurück und irgendeinen von ihnen erschlagen; dann sonnte er sich die letzten Tagesstunden, blieb schlafend auf dem Gneisschutt liegen und stieg mit dem ersten Morgenschimmer die Berge abwärts über die sanften Hügel, die flachen Kalksteinerhebungen. Die wasserreiche Ebene dehnte sich unabsehbar aus. In dem blendenden Abendlichte sah er vor sich die starke Mauer und die mächtige Stadt, Tsi-nan-fu.
DAS WAR ein unermeßliches Wachsen um Tsi-nan-fu.
Diesseits und jenseits des lehmfarbenen breiten Flusses standen die Hirsefelder schon übermannshoch, die starren Halme und Rohre mit ihren grünen scharfen Blattscheiden und braunen Kolben, die sich schwer umbogen und sanken wie Puschel von Kriegspferden und Helmwedel, überflockt von feinen Härchen. Wenn der warme Wind von den Bergen über sie fuhr, ging ein Scharren durch die Felder, als liefen die Halme davon, und alle warfen sich zum Anlauf vornüber. Ganz junge Pflanzen standen an den schmalen Fußpfaden, die Wang-lun am nächsten Morgen trottete; er riß ein paar aus, steckte die dünnen zarten Seidenwedel in den Mund und sog an ihnen. Drosseln und große Raben jagten sich schreiend über dem feuchten Boden, saßen auf den schlanken Sophorenbäumen, in deren breiten Kronen die Zwitterblättchen ein Schwanken und Schwirren begannen, als ob die Bäume ein krampfhaftes Lachen unterdrückten.
In einem fliegenden Barbierladen noch vor dem Tor ließ sich der verwahrloste Mann für seine Glasfläschchen waschen, rasieren und billig einkleiden. Dann spazierte er lächelnd und die feisten Torwächter vertraut grüßend in die Stadt hinein, in einem blauschwarzen Obergewand, auf neuen Filzsohlen, am grünen etwas faserigen Gürtel den leeren Tabaksbeutel, als käme er eben aus einem der vielen kleinen Teepavillons vor der Stadt, in denen sich Dichter und galante Jünglinge ergingen.
Groß und unübersehbar war das Gewirr der Straßen. Kaufladen stieß an Kaufladen, Garküchen, Herbergen, Teehäuser, überladene Tempel; an der Mauer klingelten die Glöckchen zweier schöner Pagoden, die den Weg der obdachlosen Geister ablenkten. Wang ließ sich willig von dem Menschenstrom tragen, spähte listig und vergnügt um sich, schob in einer engen Straße eine wartende Sänfte samt den beiden Trägern beiseite.
Und nachdem er die beiden an die Erde gelegt hatte, hatte er sich in ihnen die ersten Freunde in Tsi-nan-fu erworben, die ihn nach einer Stunde in ihr Logierhaus nebst Garküche führten, ein offnes luftiges Bretterhaus in der Einhornstraße. Ein Flügel des Hauses enthielt die ärmliche Garküche, deren Duft und Rauch aber auch den andern Flügel durchzogen, die nach der Straße offene Terrasse für Teetrinker und die Schlafkammern; das waren Verschläge im Hintergrund des Teeausschanks, niedrig, schmal, mit einer Bank zum Liegen und einem Schemel. Wang warf nur einen Blick in seine Kammer, dann strich er durch die Nachbarstraßen, erspähte Gelegenheiten. Er hatte keinen Käsch.
Hinter zwei Hökerfrauen, die zusammen einen Korb trugen, ging er in ein Haus, über einen weiten Hof, in einen halbdunklen Raum, den er erst an dem dicken süßlichen Geruch als Tempelhalle erkannte. An der rund ausgeschnittenen Tür saß ein alter kräftiger Mann in einem hellgrünen weitärmeligen Gewand, den Zopf auf dem Scheitel aufgebunden; er saß vor einem kleinen Tischchen mit Räucherkerzen, Papierfiguren und machte ein salbungsvolles Gesicht, indem er die Lippen schnauzenförmig abwärts zog, die Hände mit eigentümlicher Fingerkrümmung vor sich hinlegte und die Augen schloß. Die Frauen hatten von ihm sechs Kerzen gekauft, steckten sie vor einer bunten Holzstatue im Hintergrund an, vor einem sitzenden Gott, neben dem Trommeln, Mandolinen und Pansflöten an der leeren Wand hingen.
Wang ging an dem Korb der Frauen, der in der Mitte des Raums stand, vorbei, sah seitwärts, wie jetzt der Bonze die paar Käsch von Hand in Hand zählte und sie lautlos in einem Kasten an der Türwand verschwinden ließ, wieder die salbungsvolle Fischschnauze zog. Es war ein Tempel Hang-tsiang-tses, des Patrons der Musikanten.
Als Wang sich zu der Tür wandte, stand der Bonze auf, verneigte sich vor ihm, schwang die gefalteten Hände, pries die Frömmigkeit seines hohen Besuchers, mit einem durchgesiebten gleichmäßigen Schwall von Worten. Auch Wang verneigte sich höflich. Zum Schluß fragte der Priester, ob die Subskriptionsliste für eine Wassermesse schon in den Palast seines Gönners getragen sei; es seien fünf arme blinde Musikanten auf einem Boot ertrunken, als sie aus dem jenseitigen Dorf zurückkehrten. Die Messe für die Seelen der Ertrunkenen beginne in zwei Tagen. Wang gab einen falschen Namen und falsche Wohnung an, bat, seinen Namen schon jetzt in die Geberliste einzutragen, die an der Tempelwand angeschlagen war.
In der Dunkelheit brach er dann ohne Mühe in den Raum ein, erbeutete über siebenhundert Käsch.
Er lebte zufrieden über eine Woche in der Herberge, als ein Zufall ihm den Bonzen auf der sehr belebten Weißegräberstraße in den Weg führte. Es war schon zu spät sich zu verstecken, als er das hellgraue Priesterkleid sah. Zu seinem Erstaunen ging aber der Mann grinsend unter Winken an ihm vorüber.
In derselben Nacht brach er bei dem Bonzen ein. Der Geldkasten war verschlossen, aber leer. Wang tastete sich im Dunkeln an den Opfertisch; auch unter der Opferasche lag kein Geld. Erst als er das weiche Tuch des Achtgenientisches verzog, klirrte etwas: unter dem Tuch ausgebreitet lagen einige Handvoll Kupferpfennige.
Er arbeitete in den nächsten Tagen, als das Geld vertan war, bald hier, bald da als Kohlenträger, Läufer in einem Jamen; aber der niedrige Lohn reizte ihn zur Wut, auch vertrug er sich nirgends. Sein prahlerisches Wesen, seine Hitzigkeit zusammen mit seiner Riesenstärke rissen ihn überall zu Gewalttaten hin.
So brach er nach zwei Wochen wieder in den Tempel des Musikantengottes ein. Vorher sann er nach, wo der Bonze seine Tageseinnahme versteckt hielte. Daß er sie nicht in seinem Bette und Schlafraum hatte, war Wang klar; der Bonze wußte zweifellos, daß Wang es war, der ihn bestahl, und in seinem Schlafzimmer fürchtete er sicher für sein Leben. Fast eine Stunde suchte er vergeblich in dem Raum herum, beklopfte Wände und Boden. Schließlich stellte er den Schemel des Bonzen auf den Altaropfertisch, betastete die Statue des schweigenden Hang-tsiang-tses. Am Halse des Gottes klang es hohl; er klomm hoch und auf dem Schenkel des Musikfürsten stehend öffnete er das leicht zugängliche Kästchen; drei Hände voll Käsch glitten in den Beutel an seinem Gürtel.
Als er sich herunterlassen wollte wieder auf den Schemel, bemerkte er, daß jemand an seinem Zopf zog, nein, daß sein schön gebundener Zopf an der Decke und Rückwand des Zimmers festsaß. Er tapste mit der freien linken Hand nach oben und hinten; eine dicke teerartige Masse klebte da; mit Mühe bekam er seine Hand frei; er fürchtete mitsamt der schweren Bildsäule vornüber zu kippen. Schmerzvoll und unter Verlust vieler Haare rupfte er seinen Zopf aus der klebrigen Gallerte. Leise kläffend über den Bonzen schlich er auf die Straße. Der Stoff klebte harzig an seiner schön rasierten Kopfhaut; wohin er mit seiner linken Hand griff, blieb er hängen.
Seine Freunde in der Einhornstraße schabten ihn am Morgen unter großen Qualen sauber, mit scharfen Holzstäbchen; seine Haut blutete. Sie lachten nicht über ihn, sie fürchteten und liebten ihn, sie bewunderten seine Kühnheit. Auch teilte er den Gewinn mit ihnen.
Nach dieser Nacht hatte Wang-lun, der geschundene Dieb, nur einen Wunsch: sich an dem Bonzen zu rächen. Der Mann schien seine Wohnung zu kennen; wenige Tage nach dem Ereignis traf er den grauen Mantel langsam in der Einhornstraße spazieren. Das faltige Gesicht lächelte nur wenig, als Wang sich über die Balustrade der Teeterrasse herunterbeugte; es verzog sich zu einem schmerzlichen Bedauern vor dem bewickelten Schädel Wangs. Oft sah sich der Bonze um nach dem armen Dieb, der hinter ihm Grimassen schnitt.
Nun gab Wang seinen beiden Freunden nichts von der letzten Beute; er legte fast alles seinem Wirt hin, damit er selbst ungestört seine Pläne ausführen könnte. Es lief auf einen Wettstreit zwischen ihm und dem Bonzen hinaus.
Noch war sein Kopf bewickelt, da ging er an einem Nachmittag in das Haus des Bonzen. Der saß an seinem Platz in weihevoller Haltung; es waren Fremde aus Wu-ting-fu da, die seinen Tempel besichtigten. Als er den gleichgültig stolzierenden Wang erkannte, lief er entzückt herbei, dankte für die reichliche Gabe bei der jüngsten Wassermesse, fragte nach dem Befinden seines offenbar leidenden Gönners. Mit ernster Stirne fügte er hinzu, daß sein Tempel in vielen Sorgen schwebe. Ein schlaues Diebsgesindel mache sich in diesem ruhigen Stadtviertel breit und brandschatze den armen Hang-tsiang-tse und seinen bescheidenen Diener Toh-tsin; dies war sein Name. Wang hörte ihn von oben herab interessiert an und fragte nach einer nachsinnenden Pause, welche Vorsichtsmaßregeln der weise Toh-tsin getroffen habe gegen die Verbrecher.
Nun führte Toh, der lebhaft und wiederholt für sein grenzenloses Wohlwollen dankte, den ernsten Mann herum, der mit den prüfenden Augen eines Beamten alles betrachtete. Toh ließ ihn den alten leeren Wandkasten sehen, zeigte Fußangeln, die er abends an der Türe auslegte, wies auf die vertrocknete Teermasse an der Hinterwand der Bildsäule. Wang gab Ratschläge; ob es sich nicht empfehle, die Tageseinnahmen am eigenen Körper zu tragen. Toh replizierte mit dem Hinweis auf die Gefährlichkeit der Halunken, die sogar –. Wang brauste auf, wies den Ausdruck Halunke zurück, erklärte auf den lächelnd fragenden Blick des andern, daß seinen Ohren so heftige Ausdrücke böse klängen, daß er gerade dieser Feinhörigkeit wegen tiefe Verehrung für den Musikfürsten hege.
Sie gingen, sich gegenseitig musternd, einige Male zwischen den andächtigen Fremden aus Wu-ting-fu hin und her. Dann verabschiedete sich Wang herablassend von dem Priester, der hingerissen dankte für das Vertrauen des erleuchteten Gastes.
In dieser Nacht ging der Fischersohn aus Hun-kang-tsun ratlos vor dem Tempel auf und ab. Er wußte nicht, wie er es anfangen sollte. Er fürchtete, sich vor dem alten Spottvogel zu blamieren. Ihn ganz in Ruhe zu lassen war unmöglich nach dem letzten Triumph dieses hinterlistigen Betrügers. Manchen Augenblick dachte Wang ernstlich, er müßte den Toh-tsin wecken, verprügeln und der Polizei übergeben.
Dann fühlte er sich über den stockfinstern Hof. In einem Winkel des seitlichen Schuppens blieb er stehen, um seine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Da sah er dicht neben sich quer vor der Haupttür eine lange Leiter am Boden liegen.
Er rührte sie nicht an; er überlegte. Das war eine List Tohs; die Leiter stand sonst in einem Winkel des Hofes. Andererseits gab es im Innern des Tempels kaum noch einen Fleck, wo Toh seine Tageseinnahme unterbringen konnte. Wang umging vorsichtig die Leiter, versuchte mit einigen Sprüngen den niedrigen Dachfirst zu erwischen, aber langte nicht herauf und es gab zu viel Lärm. Dann hangelte er sich mühselig und immer wieder abgleitend an einem feuchten Pfeiler des Schuppens herauf, schwang sich auf das Dach. Es währte über eine Stunde, bis er auf das Tempeldach selbst herüberkam; er fürchtete, wenn er sich aufrichtete, von der Straße gesehen zu werden.
Und so kroch er geduckt und legte sich bei jedem Türenklappern, Trommelschlag der Nachtwächter platt auf den Bauch, immer in Gefahr abzurutschen von dem schrägfallenden Gebälk. Er schimpfte, daß er gezwungen sei, von dem Gelde eines solchen alten Schuftes zu leben. Dachrippe nach Dachrippe wurde abgetastet; langsam ließ sich Wang zu der Kriegerfigur an der Traufe herunter, die ein blankes Schild hob. Hinter dem Schild am Arm des Ritters hing etwas und baumelte schwarz, als die Traufe sich unter Wangs Gewicht bog. Es war der Geldbeutel. Seine klammen Finger knoteten ihn ab, eine schwere halbe Stunde folgte, bis Wang wieder auf der Straße stand, frierend und das schmutzige Gesicht zornverzerrt über die Hinterlist des Alten.
Um die Mittagszeit, als er nach dem Essen tabakkauend auf der Terrasse stand, kam der flinke Wirt angeschnattert, brachte ihm die lange Visitkarte Toh-tsins. Der erkundigte sich nach dem Befinden seines Wohltäters, zeigte sich erfreut, daß seine Kopfwunden zuheilten, besah sich gerührt die zerrissenen Hände Wangs: es gäbe so schwere Gewerbe in Tsi-nan-fu. Als sie ihre Tasse Tee ausgetrunken hatten, zahlte Wang offen aus dem Beutel seines Gastes, begleitete ihn in den Tempel, um festzustellen, was es mit der Leiter auf sich habe. Sie hegten große Sympathien füreinander, besonders Wang für Toh, weil er sich ihm überlegen fühlte und der andere dies zuzugeben schien. Toh hob auf den Wunsch seines Gastes die Leiter aus dem Winkel, legte sie an das Dach an, kletterte ein paar Sprossen hinauf. Wang, verblüfft, kletterte nach ihm bis auf das Dach.
Fest stand in Wang: die Sache, bei der er immer gleichzeitig gewann und verlor, sollte heute ausgetragen werden.
Mit lahmen Beinen, schwachem Rückgrat schlich er bei Anbruch der Nacht hungrig und aufgeregt in den Hof Tohs, hob die Leiter, die wieder quer lag, auf, legte sie an den Dachfirst und kletterte mit Herzklopfen hinauf. Ein Beutel hing richtig wieder an dem Arm des Kriegers. Besorgt blieb er bäuchlings auf dem Dach liegen; es schien sich etwas im Hofe zu regen, die Leiter schwankte einmal. Er kletterte rasch wieder herunter, ohne Zwischenfall.
Da blieb er angewurzelt unten vor der Leiter stehen. Er konnte nicht von der Stelle. Seine Filzschuhe waren in einen dicken Brei eingetreten, der bis über seine Knöchel quoll. Er ächzte; arbeitete sich, an der Leiter klimmend, hoch, indem er seine Schuhe stecken ließ. Seine Wut machte ihn zäh bei der Anstrengung und fast sinnlos. Als er in bloßen Füßen mit verklebten Hosen frei im Hofe stand, warf er den Beutel mit Gewalt an die Tür der Kammer des Bonzen. Er schrie durch die nächtliche Stille laut zu dem Klingeln der rollenden Käsch: »Da hast du deinen Dreck, du Sohn einer Schildkröte.« Trommelte gegen die dünne Holzwand des Hauses mit den Fäusten, bis sich eine sanfte Stimme drin vernehmen ließ: »Was will denn der Liebling? Womit beschenkt er den Sohn einer Schildkröte zur Nacht?«
»Heraus soll der Sohn einer Schildkröte, heraus soll er kommen. Ich will ihm zeigen, was Gemeinheit und Niedrigkeit ist. Du sollst mir meine Schuhe bezahlen und meine Hosen.«
»Aber der stürmische Liebling hat schon den Preis bekommen für seine Schuhe und seine Hosen.«
»Komm heraus, sage ich, du Schwätzer, du Dicker, du Gauner, ich will dir zeigen, was bezahlen heißt bei mir!«
Während noch der frierende Wang-lun im Hofe tobte, kleidete sich Toh-tsin feierlich an bei einer Öllampe, steckte den Teekessel an, öffnete die Tür nach dem Hof mit großer Ruhe. Wang wollte gegen ihn anstürmen, konnte wegen seiner verklebten Hosen nur in Schrittchen und unter Schmerz vorwärts. Toh leuchtete ihm mit der Lampe entgegen, verbeugte sich unaufhörlich. Dem großen Burschen, der die Lächerlichkeit seiner Lage fühlte, standen vor Wut und Schmerz die Tränen in den Augen. Toh wich vor ihm aus, wies auf das warme Ofenbett, auf das sich Wang wimmernd legte.
Eine Tasse heißen Tee, die ihm sein Wirt unter vielem Zeremoniell bot, soff er in zwei Zügen aus, während Toh seinen Priestermantel zurückschlug, einen Zeugbausch mit einer stark duftenden Flüssigkeit tränkte und langsam die Pechmasse von Wangs Beinen abrieb. Zwischendurch lief er auf den Hof mit der Lampe. »Es könnte doch ein Dieb kommen und uns unser Geld stehlen«, meinte er, als er mit dem Beutel zurückkam und wieder die Türe schloß. Er bot Wang ein paar Hosen und gute Filzschuh. Der Fischersohn aus Hun-kang-tsun saß am Tisch des freigebigen Mannes, hieb in Wassermelonen und schluckte Tasse auf Tasse. Es wogte in ihm auf und ab, aber der Tee war heiß und die Melonen saftig.
Toh-tsin entpuppte sich im Gespräch als eben so großer Menschenkenner wie Schelm. Sein besiegter Gegner legte den verpflasterten Kopf bald auf eine, bald auf die andere Seite in Bewunderung dieser mannigfaltigen Durchtriebenheit. Toh-tsin hatte sich wie berechnet einen zuverlässigen Gehilfen gefangen.
SO WAREN die merkwürdigen Beziehungen zwischen beiden in Freundschaft ausgeartet.
Das Geschäft Toh-tsins war sehr einfach. Er hatte zur Verwaltung den Tempel einer sehr armen Gesellschaft, der Musikanten. Sie bezahlten ihm für seine Dienste einen unbedeutenden Betrag und stellten ihm die Kammer zur Benutzung; er mußte sich im Grunde seinen Unterhalt durch Verkauf von Räucherwerk, Messenlesen selbst verdienen, und alles war auf seine Tüchtigkeit gestellt. In einem anderen Stadtteil Tsi-nan-fus befand sich noch eine Halle für den Musikfürsten; und wenn Tohs Gott den Leuten ihre Wünsche nicht erfüllte, so zogen sie schmähend und beschwerdeführend in die andere Halle und brachten Tohs Gott in Mißkredit.
Wang-lun und Toh-tsin trieben jetzt das Geschäft gemeinsam. Wang wurde Ausrufer und Zeuge des Bonzen. Wenn sie zusammen vormittags durch die Straßen und über die wimmelnden Märkte zogen, ging der riesige Wang im grünen Kittel dem Priester voran, trug die beiden meterlangen Posaunen an ihren Schlünden; in die Mundstücke blies von Zeit zu Zeit Toh-tsin hinter ihm; zwei brüllende tiefe Töne fuhren schrecklich aus den Schlünden unter die auseinanderweichenden Menschen. Vor den Börsen der Seidenhändler, der Porzellanverkäufer priesen sie laut die enormen besonderen Fähigkeiten ihres Gottes; die Lose in seiner Halle gaben die sichersten Rezepte bei allen Krankheiten; eine Messe vor ihm gelesen sei ebenso wirksam wie billig. Es galt den Heiligen von Zeit zu Zeit aufzufrischen, ihm neue sensationelle Fähigkeiten zuzuschieben; so riefen sie den Spürsinn des Musikfürsten bei der Aufdeckung von Verbrechen, Diebstählen aus. Wurden sie dann wirklich irgendwo hinzugezogen, so forschten sie beim Herumtragen einer kleinen Statue des Hang-tsiang-tses nur die Gelegenheit aus, stahlen etwas später und gruben mit Hilfe des Spürsinns Hang-tsiang-tses an einem entfernten Platze den größten Teil der Beute wieder aus. Es versteht sich, daß bei ertragreichen Diebstählen der Gott sie im Stich ließ.
Da Toh Wangs Neigung zu Narrenstreichen und Übermut kannte, schenkte er ihm eine schöne Hirschmaske mit prächtigem schönen Geweih, eine Maske, wie sie lamaistische Pfaffen bei ihrem Tsamtanze zu benutzen pflegen. Wang-lun freute sich kindisch über das Stück, tollte im Tempelhof und auf der Straße gemeinschaftlich mit den beiden Sänftenträgern herum, erschreckte, verjagte Besucher.
Von seinen Possenstreichen war die halbe Stadt erfüllt. Wie er sich irgendwo auf der Straße mitten in einen Rudel wilder Hunde setzte, den Hirschkopf überzog, die Hunde angrunzte, dann vor ihnen über belebte Plätze jagte: ein Gellen der Weiber und Kinder, ein Auseinanderstieben, ein Springen, Bellen, Umrennen, und die Hetze verschwand in einer Gasse, wo er die anjaulenden Hunde mit einem Fußtritt in irgendein Papierfenster, eine Sänfte beförderte, und ausrufend weiterzog.
Berüchtigt machte ihn eine Sache, die mit einem ernsten Hintergrund sich in ihren Folgen schwer an ihm auswirkte.
Es hatten sich chinesische Volksstämme in Kan-suh, die dem mohammedanischen Glauben anhingen, trotzig und aufsässig benommen. Sie nannten sich die Salarrh mit den weißen Turbanen, waren uneins unter sich; man hatte sie mit Gewalt beruhigt.
Es sollte jetzt alles, was mit ihnen in Verbindung und Verwandtschaft stand in den anderen Provinzen, festgestellt, verbannt oder ausgerottet werden, nachdem ihr Führer schon längst sein Leben gelassen hatte mitsamt seinem Anhang. Der Boden schwang schon unter den Füßen der Geheimbünde, die gegen den Kriegskaiser und die fremde Mandschudynastie wüteten, aber man achtete in der stolzen Roten Stadt nicht auf dies dumpfe Geräusch, das seine Stimme später mit dem Schwirren der Pfeile, dem Zischen der krummen Säbel, dem unheimlichen Gesang der rotweißen Feuersäulen, dem Knarren und Bersten der einstürzenden Giebel verstärken sollte.
In Tsi-nan-fu lebte unter andern mohammedanischen Familien die Familie eines gewissen Su. Dieser stellte aus Pflanzenmark Dochte her; er war ein angesehener würdevoller Mann, der den untersten literarischen Grad erreicht hatte. Das Familienhaus der Sus stand in der Einhornstraße, schräg gegenüber der Herberge Wang-luns, und Wang schätzte den klugen, wenn auch eingebildeten Mann sehr.
Der Tao-tai von Tsi-nan-fu ermittelte, daß Su-koh der Oheim eines Mannes war, welcher in Kan-suh die ersten Unruhen gestiftet hatte. Die Häscher nahmen den Dochtfabrikanten fest, brachten ihn samt den beiden Söhnen in das Stadtgefängnis, wo er täglich unter Foltern vernommen wurde.
Er saß über drei Wochen in Haft, als Wang in seinem Gasthof davon erfuhr. Dem fuhr der kalte Schreck durch die Knochen. Er stellte sich den ernsten teilnahmsvollen Su-koh vor, fragte einmal über das andere: »Warum denn? Warum denn aber?« kam nicht zur Ruhe, bis er selbst festgestellt hatte, daß Su-koh wirklich samt seinen beiden Söhnen im Gefängnis saß und unter Foltern täglich vernommen wurde. Und zwar, weil jener Aufrührer sein Neffe war, welcher in Kan-suh zuerst laut aus einem alten Buche vorgelesen hatte.
Wang setzte sich mittags mit seinen beiden Freunden und drei Bettlern in der Herberge zusammen und beriet mit ihnen, was geschehen sollte. Er schüttelte in der ihm eigenen Weise die beiden offenen Hände vor seinem Gesicht und sagte: »Su-koh ist ein tüchtiger Mann. Seine Freunde und Verwandten sind nicht hier und schon ohne Kopf. Su-koh darf nicht im Gefängnis bleiben.«
Der einäugige Bettler erzählte, er hätte am Jamen des Tao-tai gehört, daß in drei oder vier Tagen der Provinzialrichter aus Kwan-ping-fu eintreffen werde, um über Sus Familie rechtzusprechen. Wang forschte ihn mit erregten Worten aus, wer es gesagt habe, wieviele es gehört hätten, ob schon Vorbereitungen zum Empfang des Nieh-tai, des Richters, getroffen wären, wieviele den Nieh-tai herbegleiteten. Als er hörte, daß es ein alter, besonders für diesen Zweck ernannter, hier noch unbekannter Nieh-tai sei, leuchteten seine schmalen Augen höhnisch, dann grinste er, lachte nach einer Pause heraus, daß die Eßstäbchen vom Tisch fielen und die fünf mitlachten, sich anstießen und jeder melodisch das Lachen des andern nachsang. Ein Kopfzusammenstecken, rasches Hin- und Herreden folgte, ein häufiges wütendes Auftrumpfen Wangs. Jeder ging seiner Wege.
Nach zwei Tagen wußten alle Jamenläufer in Tsi-nan-fu und damit die ganze Stadt, daß der Nieh-tai zur Entscheidung der schwebenden politischen Prozesse morgen in Tsi-nan-fu eintreffen würde, rascher, als man erwartet hatte.
Wang-lun hatte mit zwanzig schnell aufgetriebenen Nichtstuern und Gaunern aus der Stadt nicht weniger als drei Brücken, die der Sendling passieren mußte, unbrauchbar gemacht, hatte sich und seinen Spießgesellen Festkleider aus einem Pfandhaus entliehen, das ihm und dem Toh wegen mancher billig erworbener Versatzstücke verpflichtet war, und rückte mit seinem sich übertrieben ernst gebärdenden Zuge am angegebenen Tage durch dasselbe Tor in die mächtige Stadt, durch das er wenige Monate vorher allein gependelt war, lächelnd, die feisten Torwächter vertraut grüßend, als käme er eben aus einem der vielen Teepavillons vor der Stadt, in denen sich Dichter und galante Jünglinge ergingen.
An diesem heißen Morgen des achten Monats schlugen ehrfurchtheischend Gong auf Gong vor ihm. Zwei der verbrüderten Lumpen ritten mit Hellebarden dem Zuge voraus auf klapprigen Braunen, auf denen sie unsicher saßen. Es folgten die beiden gongschlagenden Knaben mit drohenden Stirnen, vier Unterbeamte mit den frischlackierten Zeichen der oberrichterlichen Würde. Und in dem blauen Tragstuhl saß hinter geschlossenen Vorhängen ein träumender ehrwürdiger Greis mit einem weißen Bart, der rechts und links von Backen und Kinn in dichten Schwanzquasten herunterfiel auf das schwarze glatte Seidenkleid und fast das wunderschöne Brustschild bedeckte mit dem gestickten Silberfasan: Wang-lun selbst. Die runde schwarze Mandarinenmütze schmückte die Kugel aus Saphir.
Ein kleiner Trupp Soldaten hinter einem Offizier schloß den Zug, Soldaten der Provinzialarmee von der grünen Standarte. Über die Plätze und menschengestopften Märkte, die Stätten seiner ehemaligen Wirksamkeit, zog Wang zwischen Mauern von verstummenden Bürgersleuten; die Tore des Jamens standen weit offen.
Nur einen halben Tag hielt sich der Nieh-tai in der Präfektur auf. Er beschloß, die politischen Gefangenen aus der Su-Familie nicht gleich abzuurteilen, sondern sie mit sich nach Kwan-ping zu nehmen, dort die Antwort des Kaisers auf seinen Bericht abzuwarten.
Ohne in der Stadt zu übernachten, schon gegen Abend, verließ der hohe Blauknopf die aufgeregte Stadt; auf einem Karren unter den Soldaten seines Zuges stand ein schmaler Holzkäfig; in dem saßen, die Hälse durch einen einzigen Holzkragen gezogen, Su und seine beiden Söhne.
Am Abend des folgenden Tages kamen die Läufer des echten Nieh-tais an, die zugleich Beschwerden des Richters überbrachten über die schlechte Wegeverfassung und Polizei im Distrikt. Die ungeheuerliche Nachricht erfüllte dann, aufgedeckt, die ganze Stadt mit Entsetzen.
Es war mit dem Namen der höchsten juristischen Behörde gespielt worden. Der Tao-tai samt seinem Beamtenstab war verloren; die mohammedanischen Einwohner sahen einer summarischen Bestrafung entgegen; die Täter mußten aus ihren Kreisen stammen. Es war vorauszusehen, daß der Stadt das Recht, zu den Prüfungen zugelassen zu werden, kaiserlicherseits auf Jahre entzogen würde.
Wang hatte sich inzwischen mit seiner Gesellschaft demaskiert in einer der Schluchten des Gebirges. Su-koh und seine Söhne, die schon dem Tode verfallen waren, verbrüderten sich mit Wang; es war bei aller schreckhaften Freude kein lauter Jubel in der Schlucht; die drei waren unter den Foltern hinfällig geworden.
Wang kehrte am nächsten Tage in die Stadt zurück zu Toh-tsin, den er ins Vertrauen zog.
Der Nieh-tai blieb noch fünf Tage zur Untersuchung in Tsi-nan. Nach seiner Abreise bei Anbruch der Nacht wurde der Priester des Musikfürsten durch leises Pochen an der Kammertür geweckt. Die gesetzliche Frau des Su-koh schlüpfte in die Kammer, verhüllte weinend ihr Gesicht mit einem dicken weißen Schleier und setzte sich, ohne Worte zu finden, auf den Boden. Su-koh war mit seinen Söhnen bewaffnet nach Hause zurückgekehrt, weigerte sich, sich zu verstecken und gab an, daß er jeden, der in sein Haus eindringen würde, ihn zu fangen, niederschlagen würde mit Hilfe seiner Söhne und Sippengenossen. Sie beschwor auf der Diele den Bonzen und Wang-lun, sich mit ihr zusammenzutun, damit der Mann und die Kinder wieder ins Gebirge zurückgingen.
Die Frau blieb bei dem Bonzen, Wang lief in das Haus der Sus. Er fand den Vater gekräftigt, ruhig, würdevoll wie sonst, aber in einer entschlossenen Bitterkeit. Su-koh erklärte, er würde die Stadt und Provinz verlassen, aber erst in Ruhe seinen Besitz verkaufen, seine Schulden bezahlen, seinen Priester befragen, welchen Wohnsitz er wählen solle. Wang, indem er den Kopf zwischen die Schultern zog, bot ihm an, den Verkauf und die Lösung der Verbindlichkeiten zu leiten, auch den Verkehr mit dem mohammedanischen Priester zu vermitteln. Su-koh lehnte alles ab.
Da beschloß Wang-lun, sich an seine Fersen zu heften und ihm zu helfen.
Su-koh ging schon am frühen Morgen durch die entsetzten Häuser, verlangte seine Schulden und die, welche seine Frau in seiner Abwesenheit gemacht hatte, zu bezahlen. Er erkundigte sich, ob man wisse, wo er sein Haus zu einem angemessenen Preise verkaufen könnte. In der Menschenmenge, die dicht hinter ihm folgte, sprang der öffentliche Spaßmacher, der Gehilfe Toh-tsins, des Bonzen, der riesengroße Wang-lun, schwatzend und aufgeregt.
Nach kurzer Zeit kamen die Polizisten angerannt. Aber Wang und seine Helfer wußten es einzurichten, daß die Menschenmenge sich mit Kindern und Frauen vor den Su drängte und drohte. Der Alte hatte seine Geschäfte schon erledigt, ging, unbeirrt durch das Geschrei der Leute und Bekannten, die auf ihn einredeten, in sein kleines Haus. Dann erfolgte ein Trommeln und Blasen. Blaujackige Soldaten sperrten die Straße bis auf eine kleine Durchgangspassage, trieben Herumstehende in die Häuser. Ein hagerer Tou-ssee, ein Hauptmann, befehligte sie.
Barhäuptig trat Su-koh aus seinem Hause, verneigte sich höflich vor dem Offizier und wollte, ohne einen Blick auf die Soldaten zu werfen und ohne Erstaunen über die Umgebung, an der Hausmauer entlang gehen, um ein paar Häuser entfernt eine Besorgung zu machen. Der knochige Tou-ssee sprang hinter dem langsamen, wohlbeleibten Mann her, stieß ihn mit dem Säbelknauf ins Kreuz, riß ihn bei der Schulter herum, schreiend: ob er Su-koh, der entwichene Dochtfabrikant, wäre. Su verschränkte die Arme und sagte, er wäre das; aber wer er, der Tou-ssee, wäre; ob er ein Wegelagerer und Räuber wäre und wie er die Dreistigkeit so weit treibe, einen schuldlosen Mann am hellen Tag mit dem Degenknauf zu stoßen und ihm aufzulauern.
Noch ehe Su zu Ende gesprochen hatte, hatten der Offizier und zwei herbeigesprungene Soldaten ihn mit einigen Säbelhieben an der Mauer niedergemacht.
Wang schrie hell mit den andern auf, die von den Ecken der Straßen dies angesehen hatten. Er wollte zuspringen, aber er zitterte, konnte nicht von der Stelle, seine Glieder waren plötzlich von einer Schwäche und Lähmung befallen. Er trieb mit der Menschenflut im Zickzack über die Plätze, seiner nicht ganz bewußt. Seine Blicke liefen hilflos über die Gesichter, die Gänsekiele und die Ladenschilder, die goldbemalten. Er erkannte keine Farben. Eine immer wachsende Ängstlichkeit trieb ihn vorwärts. Fünf Säbel fuhren dicht nacheinander durch die Luft, zehn Schritte vor ihm, wohin er sah. Und dann ein graues Durcheinander, Übereinander.
Su-koh, sein ernster Bruder, lag ungerettet auf der Straße.
Su-koh war sein Bruder.
Su-koh war ungerettet geblieben.
Su-koh lag auf der Straße.
An der Mauer.
»Wo ist denn die Mauer?«
Es drängte ihn zu der getünchten kleinen Mauer. Su-koh wollte doch nur eine Besorgung machen. Das Haus war noch nicht verkauft; der Priester mußte befragt werden; wegen des neuen Wohnorts mußte der Priester befragt werden. Er mußte doch an der Mauer entlang gehen. Warum hatte man seinen Bruder Su-koh daran gehindert, an der Mauer entlang zu gehen. Oh, ihm war so heiß und ihn fror so.
Er trottete zitternd in die Kammer Toh-tsins, der ihn schon erwartete.
Als er Wang verfärbt ankommen sah, faßte er ihn, der sich willenlos führen ließ, gequält seufzte, mit den Fingern spielte, um den Leib, zog ihn in den Tempel. Da öffnete er neben dem Standbild des Musikfürsten eine klinkenlose Tür; sie kamen auf einen Platz mit Schutt und Backsteinen, saßen an der offenen Straße in einem Wegeschrank für obdachlose Geister, ein viereckiges steinernes Bauwerk, in dessen Inneren eine Höhlung ausgemauert war, so groß, daß zwei Menschen geduckt drin kauern konnten. Nach der Straße zu stand die breite Opferschale für Gaben; vom Bauplatz stiegen sie durch ein mit Brettern verstelltes Loch ein.
Im Finstern, in der stickigen Luft saßen sie lange, bis der Feuerstein Tohs gezündet hatte und das kleine Öllicht brannte. Toh war erregter als Wang, der mit sich tun ließ, den Bonzen umarmte, den Kopf an seiner Schulter hängen ließ. Der verstörte Mann erzählte dann von der Niedermetzelung Su-kohs, weinte wie ein störrisches Kind, sprach von den fünf Säbeln, und Su-koh sei totgeschlagen worden. Er beruhigte sich unter den Worten des andern, atmete tiefer und langsamer und schwieg nachsinnend eine geraume Weile.
Wo bekam man ein Mittel her, daß Su-koh, sein Bruder, wieder aufstand und herumging, und alles für seine Abreise richtete? Dieses Blitzen war dran schuld, daß es kein Mittel gab, daß er, der noch eben ernst die Arme verschränkte, an die Erde schoß und wie eine Katzenleiche herumgezogen wurde. Jetzt erschlug man wohl seine Söhne. Was tat man Su-koh an? Hätte er laut aus dem alten Buch gelesen wie sein Neffe, wäre es kein Verbrechen gewesen; man hatte aber nie etwas von ihm gehört. Darum wirft man seinen Bruder hin, läßt seinem Geiste keine Ruhe. Der Tou-ssee hat Unrecht an ihm getan. Der Tou-ssee hat ihn mit dem Säbel erschlagen.
Wang warf sich an der Seite des Bonzen halb herum, flüsterte, er würde fliehen jetzt; nur ab und zu würde er nachts kommen, sechsmal an seine Tür klopfen. Toh war glücklich.
Wang flossen, als er draußen das Tageslicht wieder sah, die Tränen über das Gesicht. Er weinte verzweifelt auf dem Platz zwischen den zerbrochenen Backsteinen und dem Schrein für obdachlose Seelen; er löste seinen Zopf auf, riß an seinem grünen dünnen Kittel, knabberte gedankenlos an den Knöcheln seiner eiskalten Hände herum. Den Beutel mit Kupfergeld, den Toh ihm gab, schob er zurück; klammerte sich an die Kanten des Schreins, schwang sich über die Latte, lief davon, ohne sich abzutrocknen.