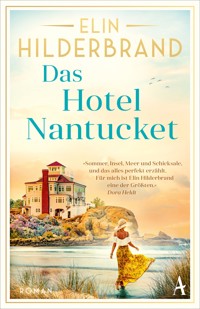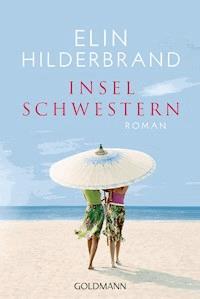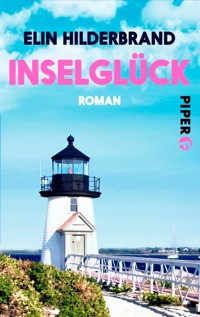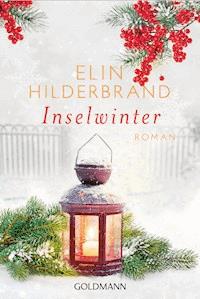8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schreibblockade erwischt Nantuckets Starautorin Madeline King zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt: Ihre Deadline rückt näher, die Rechnungen stapeln sich – nur von Inspiration fehlt jede Spur. Indessen ist Madelines verheiratete Freundin Grace mit der Neugestaltung ihres Gartens beschäftigt – mithilfe eines attraktiven Landschaftsarchitekten. Unwiderstehlich attraktiv ... Könnte Graces Tête-à-Tête die Lösung für Madelines Kreativitätsproblem sein? Liebesgeschichten funktionieren schließlich immer. Also bedient sich Madeline ein bisschen an der Realität – mit ungeahnten Folgen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Nantuckets Starautorin Madeline King hätte sich kaum einen schlechteren Zeitpunkt für ihre Schreibblockade aussuchen können: Ihre Deadline rückt näher, die Rechnungen stapeln sich – nur von Inspiration fehlt jede Spur. Währenddessen ist Madelines verheiratete Freundin Grace mit der Neugestaltung ihres Gartens beschäftigt – mit Hilfe eines attraktiven Landschaftsgärtners. Unwiderstehlich attraktiv … Könnte Graces Tête-à-Tête die Lösung von Madelines Kreativitätsproblem sein? Liebesgeschichten funktionieren doch immer!
Also bedient sich Madeline ein bisschen an der Realität – mit ungeahnten Folgen. Als die Gerüchteküche überzukochen droht, versucht Madeline, alles wieder geradezubiegen, aber Inselgeflüster mitten im Sommerloch ist nur schwer zu stoppen.
Mehr Informationen zur Autorin und ihren Werken
finden Sie am Ende des Buches.
ELIN HILDERBRAND
Das Licht
des Sommers
Übersetzt
von Almuth Carstens
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»The Rumor« bei Reagan Arthur Books/Little, Brown and Company in der Hachette Book Group, New York.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2016
Copyright © der Originalausgabe
2015 by Elin Hilderbrand
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: GettyImages/Tetra Images/Chris Hackett;
FinePic®, München
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
LT · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-18623-4V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Voller Demut und Dankbarkeit
widme ich dieses Buch
Dr. Michelle Specht, die mir das Leben erhielt,
und
Dr. Amy Colwell, die mir meinen Körper erhielt.
#mamastrong
NANTUCKET
Wir tratschten nicht nur gern, wir liebten das Tratschen.
Hast du schon gehört?
Meistens erschien uns das Leben auf Nantucket tröstlich; es fühlte sich an, als würden wir vom Meer gewiegt. Manchmal jedoch machte es uns rastlos und reizbar. Der Winter war schlimm, der Frühling noch schlimmer, denn bis auf ein paar kurze Wochen unterschied er sich nicht vom Winter.
Was hatte T. S. Eliot geschrieben? April ist der grausamste Monat.
Am üppigsten wucherte der Tratsch im Frühling. Er schwoll an wie das Schmelzwasser in einem Bach; er grassierte wie Blütenpollen. Wir konnten uns ebenso wenig beherrschen, Aufgeschnapptes weiterzuerzählen, wie wir davon ablassen konnten, uns die geschwollenen, juckenden Augen zu reiben.
Wir waren nicht gemein oder rachsüchtig oder bösartig, sondern einfach nur gelangweilt, und nach der langen Zeit ohne Sommergäste, Sommereinkünfte, Sommermagie saßen wir völlig auf dem Trockenen.
Außerdem waren wir menschliche Wesen mit der uns eigenen Neugier und den uns eigenen Unsicherheiten. Wir nahmen zur Kenntnis, was in der Welt vor sich ging – dass am MIT menschliches Erbgut entschlüsselt wurde, sich in Kalifornien tektonische Platten verschoben, Putin in der Ukraine Krieg führte –, doch keins dieser Ereignisse interessierte uns mehr als das, was auf den einhundertfünf Quadratmeilen unserer Heimatinsel geschah. Wir tratschten beim Zahnarzt, im Schönheitssalon, in der Obst- und Gemüseabteilung des Stop & Shop, an der Bar des Boarding House; wir tratschten am Freitagabend beim Aperitif im Anglers’ Club, vor der samstäglichen Fünf-Uhr-Messe zwischen den Bankreihen und in der Schlange im Hub, wenn wir sonntagmorgens für die New York Times anstanden.
Hast du schon gehört?
Man konnte nie vorhersehen, wer unser Gesprächsgegenstand sein würde. Aber wenn uns jemand mitten im kalten April mit seinem stahlgrauen Himmel erzählt hätte, dass wir den Großteil unseres Sommers damit verbringen würden, über Grace und Eddie Pancik zu tuscheln …
… und über Trevor Llewellyn und Madeline King …
… und den namhaften Landschaftsarchitekten Benton Coe …
… hätten wir wohl entsetzt den Mund aufgerissen.
Auf keinen Fall.
Unmöglich.
Die gehörten doch zu den reizendsten Leuten, die wir kannten.
APRIL
MADELINE
Die ersten beiden Anrufe stammten von Marlo, Angies Assistenten, der dritte dagegen war von Angie persönlich, und Madeline leitete ihn direkt auf ihre Mailbox weiter.
Sie wusste, was Angie von ihr wollte, weil Marlo ihr das überdeutlich klargemacht hatte: Sie brauchten bis Freitag oder allerspätestens Montag einen Text zu Madelines neuem Roman. Um diesen Termin ging es ihnen.
Zu dem neuen Roman, am Freitag. Allerspätestens Montag. Was du ja eigentlich schon weißt, Madeline.
Madeline stand an der Küchentheke, ihren leeren Notizblock vor sich. Insulaner, ihr letztes Buch, hatte sich aus ihr ergossen wie kalter Sirup aus einer Glasflasche. Es war langsam vorangegangen – Zeile für Zeile, Absatz für Absatz –, doch der Handlungsverlauf hatte sich für sie immer klar abgezeichnet. Insulaner war eine antiutopische Geschichte, die das Geschehen auf Nantucket in vierhundert Jahren schilderte; die Insel wurde infolge der globalen Erwärmung vom Atlantik verschlungen. Alle waren dem Verderben geweiht bis auf Madelines halbwüchsige Protagonisten Jack und Diane (benannt nach Madelines Lieblingssong in ihrer Jugend), Cousins zweiten Grades, die bis zum Ende des Romans in einem Dinghi überlebten.
Madeline schrieb ihre Inspiration für dieses Buch den sieben Monaten zu, die sie mit der Pflege von Big T, ihrem Schwiegervater, vor dessen Tod verbracht hatte. Sein Prostatakrebs hatte in sein Gehirn und dann in seine Leber gestreut, und obwohl sie dies psychisch schwer belastet hatte, hatte es gleichzeitig ihre Fantasie beflügelt. Ihre Gedanken kreisten ständig um das Thema Krankheit, um den Verfall des Körpers, den Untergang der Menschheit. Dann las sie im New Yorker (den sie, um sich zu bilden, mit neunzehn zu abonnieren begonnen hatte) einen faszinierenden Artikel über die Erderwärmung. Darin hieß es, dass Inseln wie Nantucket und Martha’s Vineyard in weniger als vier Jahrhunderten im Meer versinken würden, falls die Menschen ihr Konsumverhalten nicht änderten.
Insulaner wich ab von ihren autobiografisch gefärbten früheren beiden Romanen Die Küste der Sorglosigkeit und Hotel Springford. Madelines Verlag hatte es gern in sein Programm aufgenommen und für ein »bedeutenderes« Werk gehalten. Ihr Agent Redd Dreyfus hatte mit einem Vorschuss im niedrigen sechsstelligen Bereich für zwei Bücher einen brillanten Deal ausgehandelt. Dies war eine so aufregende und unerwartete Entwicklung gewesen, dass Madelines blonde Locken beinahe in Flammen aufgegangen wären.
Inzwischen steckte der größte Teil dieses Vorschusses allerdings in einer Investition bei Eddie, und Madeline hatte sich verpflichtet, zumindest die Idee für einen nächsten Roman zu präsentieren. Sie musste für den Prospekt, der an die Vertreter verschickt werden würde, ein hundert Wörter langes Exposé liefern.
Aber nicht einmal so viel hatte Madeline.
Sie hatte eine Schreibblockade.
Das Rumpeln eines UPS-Transporters und der Aufprall einer Sendung auf der vorderen Veranda rissen Madeline aus ihrer Beklommenheit. Sie eilte nach draußen in der Hoffnung, einen Karton vorzufinden, der die Idee zu einem großartigen neuen Roman barg, doch stattdessen fand sie dort die Schulfotos von ihrem Sohn Brick vor.
Wow, fantastisch.
Madeline hockte sich auf die oberste Treppenstufe, obwohl es eiskalt war und sie keine Jacke anhatte. Es faszinierte sie, dass das Porträt sowohl den kleinen Jungen zeigte, der Brick früher gewesen war – mit seinen dichten blonden Haaren und dem tiefen Grübchen in der rechten Wange –, als auch den Mann, zu dem er rasant heranwuchs. Er würde aussehen wie Trevor und Big T, nur mit Madelines blauen Augen und ihrem Lächeln (das ein bisschen zu viel Zahnfleisch entblößte, wie sie sich immer selbstkritisch vorhielt). Sie trug die Bilder ins Haus, holte sämtliche Schulfotos von Brick aus dem Sekretär und reihte sie auf dem Teppich nebeneinander auf, vom Kindergarten bis zur Highschool.
Attraktiver Junge, dachte sie. Sie hatte sich verzweifelt ein weiteres Kind gewünscht, nach drei Fehlgeburten aber aufgegeben.
Sie fragte sich, ob auch Grace die Porträts der Zwillinge erhalten hatte und jetzt in ihrem Haus an der Wauwinet Road genau dasselbe Ritual vollzog. Madeline dachte nur kurz an die grässliche Nachricht von Angie, dann wählte sie Graces Festnetznummer.
Es nahm keiner ab. Vielleicht war Grace draußen bei den Hühnern. Vielleicht war sie im Garten. Vielleicht hatte sie Migräne. Früher hatte Madeline Graces Migräneanfälle auf einem speziellen Kalender verfolgt, bis Trevor ihn gefunden und ihr erklärt hatte, einer der Gründe dafür, dass sie als Schriftstellerin nicht so produktiv sei, wie sie gern wäre, sei womöglich der, dass sie sich zu sehr mit Dingen wie Graces Migräne beschäftigte. Madeline hatte den Kalender weggeworfen.
Sollte sie Grace auf dem Handy anrufen? Grace ging nie dran, wenn es klingelte, und ihre SMS checkte sie alle zwei oder drei Wochen. Mit einem per Post geschickten Brief würde Madeline sie eher erreichen.
Sie legte auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, dann sammelte sie die Fotos von Brick wieder ein. Es war amtlich: In diesem Haus schaffte sie nichts. Die Geschirrspülmaschine rief nach ihr: Räum mich aus! Die Wäsche im Trockner schrie: Leg mich zusammen! Die Arbeitsflächen in der Küche forderten: Wisch uns ab! Immer war etwas – das Telefon schrillte, die Müllabfuhr kam, das Essen musste geplant, eingekauft, zubereitet werden – jeden Tag! Brick musste irgendwo hingefahren oder abgeholt werden; das Auto musste in die Inspektion, der Müll getrennt, ein Kontoauszug überprüft, eine Rechnung bezahlt werden. Andere Mütter meinten, es müsse doch schön sein, dass Madeline »zu Hause arbeiten« konnte. Dabei war das für sie ein ständiger Kampf zwischen Arbeit und Zuhause.
Freitag. Allerspätestens Montag.
Die Tür zum Vorraum ging auf und zu, und Madeline hörte jemanden pfeifen, irgendetwas aus Mary Poppins. War es schon so spät? Ihr Ehemann Trevor kam mit seiner sehr flotten Pilotenmütze auf dem Kopf hereinspaziert. »Chim-chiminey, chim-chiminey, chim-chim-cheroo!« Trevor sah sich gern als Wiedergeburt von Dick Van Dyke.
»Hey«, sagte er. Er nahm Madeline in die Arme, und sie drückte ihr Gesicht an sein Hemd und die Polyesterkrawatte der Fluggesellschaft. Trevor war Pilot bei Scout Airlines, die zwischen Nantucket und Hyannis, Boston und Providence verkehrte. »Wie war dein Tag?«
Madeline brach in Tränen aus. Sie konnte nicht glauben, dass es bereits fünf Uhr war. Wie ihr Tag gewesen war? Welcher Tag? Ihr Tag hatte sich in Luft aufgelöst. Sie hatte nicht das Mindeste vorzuweisen. »Ich habe eine Blockade«, sagte sie. »Mir fällt absolut nichts ein, und der Abgabetermin rückt immer näher.«
»Du weißt ja, wie ich das sehe«, sagte er. »Du solltest …«
Sie schüttelte den Kopf, um ihn zum Schweigen zu bringen. Sie wusste, was er vorschlagen wollte. Er würde ihr raten, eine Fortsetzung von Insulaner zu schreiben. Das war eine schlüssige Lösung ihres Problems, aber irgendwie hatte Madeline das Gefühl, es wäre Drückebergerei. Sie hatte Insulaner damit beendet, dass ihre Hauptfiguren sicher in eine unbekannte Zukunft unterwegs waren; das, fand sie, war das richtige Ende. Sie wollte den Lesern nicht erzählen, was danach geschah. Wenn sie eine Fortsetzung schriebe, dann nur deshalb, weil sie nicht imstande war, sich neue Personen und eine neue Handlung auszudenken.
Sie schaffte es nicht, sich neue Personen und eine neue Handlung auszudenken.
Also hatte Trevor vielleicht doch recht. Eine Fortsetzung. Konnte sie den Weltuntergang rückgängig machen?
Sie wischte sich die Augen und hob das Gesicht zu einem Kuss. »Was gibt’s zu essen?«, fragte Trevor.
»Pizza?«, schlug sie vor. »Was vom Thai?«
Er machte ein langes Gesicht. Sie hatte nicht nur nichts geschrieben, sondern auch nichts zu essen eingekauft oder vorbereitet. Wie sollte sie erklären, dass der Versuch, sich etwas auszudenken, über das sie schreiben konnte, noch zeitaufwändiger war als das Schreiben selbst?
»Es tut mir leid«, sagte sie.
Er küsste sie auf die Stirn. »Ist schon okay. Holen wir uns Pizza bei Sophie T. Fährt jemand Brick vom Training nach Hause?«
»Ja«, bestätigte Madeline. »Calgary.«
Trevor lockerte seinen Schlips und nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank. »Rate mal, wer heute Morgen mit im Flieger saß.«
»Wer?«, fragte Madeline.
»Benton Coe«, sagte Trevor.
»Wirklich?«, gab Madeline zurück.
Benton Coe war Eigentümer von Coe Designs, der angesehensten Firma für Landschaftsarchitektur auf der Insel. Und er war der Mann, der Graces zwölftausend Quadratmeter großes Grundstück in die fantastischste Gartenanlage von Nantucket Island, womöglich sogar von ganz Massachusetts, verwandeln sollte.
Benton Coe war zurück.
Na ja, das erklärte vielleicht, warum Grace nicht ans Telefon gegangen war.
GRACE
Mit ihrer Verwandlung hatte sie heimlich begonnen, gleich nach dem ersten Januar, und das in Erwartung genau dieses Tages.
Des Tages von Bentons Rückkehr.
Sie hatte angefangen, im Fitnessstudio an Spinning-Kursen teilzunehmen, und fast zehn Kilo abgenommen – das meiste davon Gewicht, das sie vor der Geburt der Zwillinge zugelegt hatte und nie so recht wieder losgeworden war. Jetzt war sie zwei Kleidergrößen schlanker. Außerdem hatte sie ihrer Friseurin Ann endlich erlaubt, das Grau aus ihrem Scheitel zu entfernen und ihre dunklen Haare vorn mit kastanienbraunen Strähnchen aufzufrischen. Und die viele Zeit, die sie draußen bei kleineren Gartenarbeiten und mit den Hühnern verbrachte, hatte ihrem Gesicht den Schimmer der ersten Frühlingssonne verliehen.
Sie hatte sich seit Jahren nicht so attraktiv gefühlt.
Madeline hatte am Samstagabend, als sie alle im American Seasons essen gewesen waren und sie im Waschraum neben Grace stand, bei ihrem Anblick im Spiegel gesagt: »Du siehst scharf aus, Süße. Richtig umwerfend.«
Eddie hatte den Gewichtsverlust bemerkt (»Du siehst gut aus, Gracie – dünn«), nicht aber die Haare, und den Mädchen waren die Haare aufgefallen (»Strähnchen«, hatte Allegra gesagt, »klasse Entscheidung«), nicht aber Graces neue, grazile Figur, was Grace nicht überraschte. Eddie war beschäftigt mit seinem Häuserprojekt, Hope mit der Schule und ihrer Flöte, Allegra mit ihrer Romanze mit Brick Llewellyn und ihrer potenziellen Model-Karriere. Für die drei war Grace Ehefrau, Mutter, Köchin, Haushälterin. Sie war Züchterin von Hühnern und Lieferantin von Bio-Eiern und mit ihrer »ständig wiederkehrenden Migräne« die ewig Kranke. An jedem Sonntagmorgen und manchmal auch an Abenden unter der Woche war sie Eddies Geliebte. Grace wusste, dass ihre Familie sie liebte, aber sie stand nicht mehr im Mittelpunkt ihres Lebens wie zu Beginn ihrer Ehe, als die Mädchen noch klein gewesen waren.
Hatte sie das Gefühl, für sie selbstverständlich geworden zu sein? Sicher, ein bisschen schon. Sie vermutete, dass sie wohl kaum die einzige Ehefrau und Mutter war, die so empfand.
Um Punkt zehn Uhr bog Bentons großer schwarzer Pick-up in die Einfahrt, und Graces Ohren fingen an zu kribbeln. Sie würden sich rosa verfärben, ein deutliches Zeichen dafür, dass sie nervös war. Sie hatte eine Schwäche für Benton Coe, eine harmlose Schwäche, die nie zu etwas führen würde, denn Benton hatte eine Freundin namens McGuvvy, und Grace war schließlich verheiratet.
Sie beobachtete, wie er aus dem Wagen stieg. Sah er verändert aus? Nein, er sah aus wie letztes Jahr. Groß, groß, groß – mindestens zwanzig Zentimeter größer als Eddie – und mit den Schultern eines Königs oder Eroberers. Er hatte rötlich braune Haare, die sich unter seiner roten Buckeyes-Kappe hervorkräuselten, und Lachfältchen um seine braunen Augen. Er trug seine übliche Frühjahrsuniform, ein marineblaues Kapuzensweatshirt mit einem vierblättrigen Kleeblatt – dem Logo von Coe Designs – darauf und Arbeitsstiefel. Er war leicht gebräunt, weil er den Winter in Marokko verbracht hatte.
Sie waren Freunde. Sie hatte ihn vermisst. Grace lief an die Tür, um ihn zu begrüßen.
»Benton!«, sagte sie.
Als er sie sah, schaute er so überrascht drein, dass Grace das Herz aufging.
»Meine Güte, Grace«, sagte er. »Wie du aussiehst … wow! Einfach wow. Ich bin sprachlos.«
Sie trat hinaus auf die Veranda und umarmte ihn fest. Er war so stark, dass er sie mit Schwung hochhob. Und dann lachten sie beide, und Benton setzte sie wieder ab.
»Schön, dich zu sehen«, sagte er.
»Gleichfalls«, sagte sie.
Sie starrten einander an. Grace wusste nicht, ob dies eine romantische oder eine peinliche Situation war. Peinlich, befand sie. Sie waren Freunde, da sollte doch ein unbeschwertes Gespräch möglich sein. Sie würde nicht den ganzen Sommer über mit diesem Mann zusammenarbeiten können, um ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen, wenn sie sich wie eine vom Blitz getroffene Dreizehnjährige benahm. Sie musste sich zusammenreißen!
»Danke für die Postkarten«, sagte sie.
»Du hast sie bekommen?«, fragte er. »Bei Post aus dem Ausland weiß man ja nie.«
»Vier oder fünf habe ich gekriegt«, sagte Grace in bemüht beiläufigem Ton. Diese Postkarten, fünf an der Zahl, sicher in ihrer Unterwäscheschublade verwahrt, hatten ihre kleine Schwäche den kalten, grauen Winter über verstärkt.
Benton Coe. Sein Ruf eilte ihm voraus: der talentierteste Landschaftsarchitekt auf Nantucket, obwohl er kaum vierzig war. Als Grace ihn für sich gewonnen hatte, war er seit fünf Jahren auf der Insel, ursprünglich im Dienste der Nantucket Historical Association NHA, um deren vierundzwanzig Liegenschaften auf Vordermann zu bringen. Davor hatte Benton Coe Gärten in Savannah, Georgia, und Oxford, Mississippi, gestaltet – Orte mit so üppigem Pflanzenwuchs, meinte er, dass man dort das Gras wachsen hören könne. Er hatte seine Kindheit in Youngstown, Ohio, verbracht und dann das College der Ohio State besucht, wo zahlreiche Jobs auf dem Campusgelände seine Liebe zur Natur gefördert hatten. Dann hatte er ein Semester in Surrey absolviert und schwärmte heute noch für englische Gärten. Unvergleichlich nannte er sie Grace gegenüber. Die Briten seien gut in der Beherrschung der Welt, aber noch besser, wenn es um Phlox, Fingerhut, Buchsbaum und Rosen gehe.
Als Benton Coe mit den NHA-Grundstücken fertig war – mit denen er bei jeder Gartenbau- und Landschaftspflegeorganisation in New England Preise gewann –, stand er hoch im Kurs. Er gestaltete Gärten für die Amsters draußen in Dionis und für die Kepplings in Shimmo – Arbeiten, die Grace dank ihres Engagements für den Nantucket Garden Club das Glück hatte zu bewundern.
Als Eddie das Haus in Wauwinet samt den umliegenden zwölftausend Quadratmetern kaufte, bekam Grace endlich ihre Chance. Sie heuerte Benton Coe an.
Sie waren von Anfang an auf einer Wellenlänge gewesen. Im letzten Sommer hatten sie Rasen gesät und Beete abgesteckt, sie hoben eine Grube für den Swimmingpool aus, fliesten und befüllten ihn, bauten einen Steg über den Bach. Benton überwachte die Errichtung des Gartenschuppens und des Hühnerstalls. Täglich waren fünfzig Beschlüsse zu treffen. Normalerweise wurde Benton von seinen Kunden freie Hand gelassen. Doch er gab zu, dass er die Zusammenarbeit mit Grace genoss. Das mache mehr Spaß, als alles allein zu entscheiden. Es sei stimulierend, mit jemandem Ideen umzusetzen, dessen Empfinden so gut mit seinem eigenen harmonierte.
Grace war bezaubert von Benton Coes Wortwahl. Empfinden. Hatte irgendjemand schon einmal Graces Empfinden zu würdigen gewusst? Ihren Sinn für Ästhetik? Ihren Geschmack? Ihre Instinkte? Nein, sie glaubte nicht. Sie war eine pflichtbewusste Tochter und Enkelin gewesen, eine duldsame Schwester, eine fleißige Schülerin, eine halbwegs annehmbare Kellnerin, eine ergebene Ehefrau und Mutter und eine außergewöhnlich gute Freundin. Aber hatte irgendjemand – einschließlich Eddie, einschließlich Madeline – schon einmal Graces Empfinden bewundert?
Harmonieren: Das war ein so treffendes Wort, ein so reizender und liebevoller Ausdruck dafür, wie gut Grace und Benton zueinander passten, sich verstanden und ergänzten, mühelos und ohne Missklänge, Streit oder Konflikte.
Der Begriff stimulierend war für Grace so stark sexuell besetzt, dass sie gar nicht richtig darüber nachdenken konnte.
Gegen Ende des letzten Sommers gestand Benton ihr, dass der Höhepunkt seiner Tage immer der Besuch bei Grace draußen in Wauwinet gewesen sei. Er sagte, der Grund dafür, dass er nie seinen Manager Donovan mitgebracht habe, sei der, dass er dieses Projekt für sich allein behalten wolle.
Grace hatte verstanden und begonnen, jedes Mal, wenn sein schwarzer Pick-up in die Einfahrt bog, ein Flattern in der Brust zu verspüren.
Benton schaute montags bis freitags jeden Morgen um zehn Uhr vorbei, auch wenn es nicht erforderlich war. Manchmal blieb er nur zehn Minuten, lange genug für ein schnelles Tête-à-Tête, auch so ein Wort, das Grace liebte. Sie stellte sich dabei vor, wie sich ihre Gesichter berührten, wie sie sich küssten.
Aber das geschah nur in ihrer Fantasie.
Der Herbst kam, wie immer, und sie brachten den Garten zu Bett. Dann war es Winter, und Benton brach zu seiner Reise auf. Die erste Postkarte traf aus Casablanca ein, abgestempelt am 4. Januar, dem Tag seiner Ankunft. Zwei Wochen später kam eine aus Essaouira an der Küste, eine Woche später eine aus Agdz in der Wüste, zwei Wochen später eine aus dem Ourika-Tal im Atlasgebirge. Auf allen stand dasselbe: Sieh dir das an! XO, Benton.
Zwanzig Tage verstrichen ohne Postkarte, und Grace nahm an, dass Benton sie vergessen hatte, oder womöglich war seine Freundin McGuvvy ihn besuchen gekommen. Doch dann traf eine Karte aus Marrakesch ein, auf der Mit Abstand mein Lieblingsort. Ich wünschte, du könntest sehen, was ich sehe. XO, B zu lesen war.
Diese Karte ließ Graces »Empfinden« voll entflammen; sie studierte sie tausendmal und benutzte sie als Lesezeichen in dem Roman, den sie gerade las, Himmel über der Wüste von Paul Bowles, den sie sich ausgesucht hatte, um dem Umherstreifen in Soukhs und dem Durchqueren der Sanddünen von Nordafrika möglichst nahe zu kommen.
Sie dachte endlos über Bentons veränderte Wortwahl nach. Ich wünschte, du könntest sehen, was ich sehe. Die Skeptikerin in Grace behauptete, dies sei nur eine Variante des altbekannten Ich wünschte, du wärst hier. Doch die in ihr erblühende Romantikerin stellte sich ein Tête-à-Tête vor, bei dem sich ihre Köpfe aneinanderschmiegten, ihre Augen dasselbe erblickten, ihr Empfinden miteinander harmonierte.
Es gefiel ihr sehr, dass er Benton zu B abgekürzt hatte.
Grace hatte die Postkarten alle in ihre oberste Kommodenschublade zu ihren Höschen, BHs und schwarzen Seidenpyjamas gelegt.
»Kann ich dir was zu trinken holen?«, fragte sie jetzt.
Benton schnippte mit den Fingern. »Verdammt, ich habe unterwegs was für dich gekauft, es aber heute zu Hause vergessen. Ich bringe es morgen mit.«
»Du musstest mir doch nichts mitbringen«, sagte Grace. Ein Geschenk aus Marokko! Ihre Gedanken rasten. Sie sah die hauchdünnen Haremshosen vor sich, die Bauchtänzerinnen tragen. Sie sah silberne Fingerzimbeln, mit Quasten verzierte Seidenkissen in satten, leuchtenden Farben, Kästchen aus astigem Holz mit Geheimfächern. Sie sah eine Wasserpfeife voller Erdbeertabak. Sie sah exotische Öle und duftende Gewürze – Safranfäden, Zimtstangen, Kardamomkapseln. Sie sah wieder die Bauchtänzerin vor sich. Benton hatte ihr ein Geschenk gekauft!
»Hast du all deinen Kunden Geschenke mitgebracht?«, fragte sie.
»Nein«, sagte er. »Nur dir.«
Nur ihr! Sie machte praktisch einen Rückwärtssalto in den Garten.
Sie verbrachten fast eine Stunde mit der Inspektion jedes Teils von Graces Grundstück, bei der sie mögliche Veränderungen und Verbesserungen erörterten. Sie fingen ganz hinten an, wo die Adirondack Chairs mit Blick auf den Polpis Harbour standen – dessen Wasseroberfläche jetzt noch einer kalten Stahlplatte ähnelte –, und spazierten dann über die Grashügel zum Swimmingpool und zum Whirlpool (beide noch abgedeckt, obwohl Grace und Eddie den Whirlpool eines späten Abends im Januar benutzt hatten, als das Häuserprojekt noch im Zeitplan lag und Eddie entspannter war). Sie verweilten beim Tulpenbeet – Bentons Baby – und bei den Rosensträuchern, aus denen im Laufe des Winters ein dorniges Wirrwarr geworden war.
»Es wird«, sagte Benton und berührte Grace leicht am Rücken, sodass es ihr wie elektrischer Strom die Wirbelsäule hinauf bis in den Nacken schoss. »Ich glaube, dieses Jahr ist unser Jahr.«
Sie hatten ein gemeinsames Ziel: Beide wünschten sich ein Fotoshooting für ein größeres Magazin. Benton bevorzugte Classic Garden, Grace dagegen schwebte eine Doppelseite in der Haus-und-Garten-Beilage der Sonntagsausgabe des Boston Globe vor. Sie hatte Eddie überredet, eine Pressefrau anzuheuern, Hester Phan, der er ein kleines Vermögen bezahlte – aber nur so konnte Grace der Öffentlichkeit ihre und Bentons Zusammenarbeit präsentieren.
»Lass uns noch mal in den Schuppen gucken«, sagte Benton. »Ich habe ihn vermisst.«
Grace entriegelte die Tür. Benton ließ sie vorgehen und folgte ihr. Der Raum war eng mit ihnen beiden darin; Grace fürchtete, Benton würde ihr Herz klopfen hören.
Der Gartenschuppen war nach dem Vorbild des traditionellen Wohnhauses auf Nantucket erbaut: graue Holzschindeln mit weißen Zierleisten. Innen war er mit einer Arbeitsfläche aus Speckstein und einem breiten kupfernen Ausgussbecken ausgestattet. An der Wand gegenüber hingen an Pflöcken Graces Harken, Hacken, Spaten, Pflanzenheber und Scheren. Es gab eine handgefertigte Umtopfbank aus Kiefernholz und Borde für Graces Sammlung von Gießkannen und Ziertöpfen. Über dem Ausguss stand auf einem Schild: Ein Garten ist keine Sache auf Leben und Tod. Er ist weitaus wichtiger. Der Schuppen hatte einen seitlichen Anbau, der den Aufsitzmäher und drei Rasentrimmer enthielt. Obwohl Grace Benton eingestellt hatte, erledigte sie alle regelmäßig anfallenden Gartenarbeiten selbst – das Mähen, das Jäten, das Mulchen, das Beschneiden und Ausputzen der Pflanzen. Zusammen mit der Versorgung der Hühner und dem Verkauf ihrer Bio-Eier war dies ein Vollzeitjob. Er war Graces Leidenschaft.
Der Schuppen war das Kronjuwel der ganzen Anlage. Ein Garten war ein Garten war ein Garten, aber Zeitschriftenredakteure liebten Ziegelsteine und Mörtel. Sie wünschten sich einen Raum, der klar strukturiert und aufgeräumt war und zugleich drollig wie die Werkstatt des Weihnachtsmanns.
Grace und Benton standen sich gegenüber, die Hüften an den Rand des Ausgussbeckens gelehnt. Benton war so groß, dass seine Haare die Deckenschräge streiften. Graces Ohren leuchteten rosa, das spürte sie.
Benton holte übertrieben tief Luft. »Ich liebe es, wie es hier riecht«, sagte er. »Nach gemähtem Gras und Blumenerde.«
Grace liebte es auch, wie der Gartenschuppen roch. Sie liebte es mehr als fast alles andere auf der Welt.
»Möchtest du zu den Hühnern?«, fragte sie. »Du weißt, dass sie sich für dich in Ekstase gackern.«
Benton lachte. Die Haut an seinen Augen kräuselte sich. Graces Ohren brannten wie glühende Kohlen. »Ich muss los, fürchte ich«, sagte er. »Sachen erledigen, Leute treffen.«
Leute treffen. Schon diese harmlose Wendung machte Grace eifersüchtig. Ihr Gesicht musste ihre Enttäuschung gezeigt haben, denn Benton sagte: »Keine Sorge, Grace. Wir haben den ganzen Sommer vor uns.«
Grace war immer noch ganz benommen – und hatte deshalb versehentlich zwei von Hillarys Eiern zerbrochen –, als die Zwillinge aus der Schule kamen.
Hope trat als Erste ins Haus, ihren Flötenkasten in der Hand. Dann folgte Allegra, die nur ihre tausendzweihundert Dollar teure Hobo Bag von Stella McCartney bei sich trug, die sie Eddie abgeschwatzt hatte, als sie anlässlich des Interviews bei der Model-Agentur zusammen in Manhattan gewesen waren. Kein Buch oder Heft in Sicht, weshalb Allegra auch nur Dreier im Zeugnis hatte. Eddie ließ ihr das durchgehen, weil er selbst die New Bedford High School mit Dreiern abgeschlossen hatte, und man schaue sich nur an, wie erfolgreich er heute war! Grace schüttelte den letzten Rest der unangemessenen Gefühle ab, die sie für Benton Coe gehegt haben mochte, und konzentrierte sich auf ihre Töchter, ihre Sonne und ihren Mond. Allegra war die Sonne – hell strahlend, heiß – und Hope der Mond – sanft, friedlich, unergründlich. Grace bewunderte Allegra ein bisschen mehr, weil … na ja, weil sie Allegra war. Und für Hope verspürte sie mehr Fürsorglichkeit, weil sie Hope bei der Geburt beinahe verloren hatten.
»Hallo, ihr Süßen«, sagte Grace und versuchte, beide Mädchen gleichzeitig zu umarmen, doch die vollführten einen perfekt synchronisierten Ausfallschritt – Allegra nach links, Hope nach rechts – und strebten auf ihre Zimmer zu, wo sie hinter geschlossenen Türen bis zum Essen bleiben würden.
Heute Abend würde es Quiche Lorraine und Spinatsalat geben. Eddie aß gern Fleisch und Kartoffeln, aber seit er mit dem Häuserprojekt beschäftigt war, wusste er auch bescheidenere Gerichte mit Eiern von ihren eigenen Hühnern zu schätzen.
Grace versuchte, nicht beleidigt zu sein über das Ausweichmanöver ihrer Töchter – kein Wort des Grußes, keine Frage danach, wie es ihr ging. Wenn sie ganz ehrlich war, musste sie zugeben, dass die beiden ihr Gefühl der Einsamkeit in letzter Zeit eher verstärkten, als es zu mildern.
»Wie war die Schule?«, rief sie ihnen hinterher, aber es kam keine Antwort.
»Es gibt Quiche zum Abendessen!«, sagte Grace. »Gegen sechs!« Keine Reaktion.
Im Winter hatte es mit Sicherheit Tage gegeben, an denen es Grace in tiefste Depressionen gestürzt hatte, so gründlich ignoriert zu werden. Sie sehnte sich danach, den Mädchen Tee zu machen und Schokoladenplätzchen zu backen und in Modezeitschriften zu blättern, während Allegra von ihren Wochenendplänen mit Brick erzählte und Hope ihre Flöte herausholte und ein paar Takte Mozart spielte. Doch sogar Grace wusste, wie unrealistisch das war. Ihre Töchter waren schließlich Teenager und dachten als solche nur an sich selbst.
Heute war Grace das egal. Heute ging Grace ins Badezimmer, um sich die Zehennägel zu lackieren.
Benton Coe war wieder da. Dieses Jahr war ihr Jahr. Sie hatten den ganzen Sommer vor sich.
HOPE
Manchmal wünschte sie sich, dass ihre Eltern ihr die Geschichte ihrer Geburt nie erzählt hätten, und doch war sie Teil ihrer Biografie, seit sie alt genug gewesen war, um sie zu verstehen. Hope – Baby Nummer zwei, dem kleineren, schwächeren Zwilling – hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt, eine Tatsache, die dem Geburtshelfer entging, weil Allegra heil und gesund zur Welt gekommen war und zum ersten Mal von Millionen Malen die Aufmerksamkeit des ganzen Raums auf sich gezogen hatte. Sobald der Arzt bemerkte, dass Baby Nummer zwei in Gefahr war, wurde Grace eiligst in den OP befördert und Hope vier Minuten später per Notkaiserschnitt entbunden. Allerdings war sie zu dem Zeitpunkt fast schon tot. Sie war, wie es ihr Vater gern drastisch formulierte, blau wie eine Zwetschge gewesen, und er hatte gedacht: Das geht nicht gut. Aber der Arzt hatte Hope wiederbelebt und mit einem Beatmungsgerät am Leben gehalten, und sie und Eddie waren per Hubschrauber nach Boston geflogen worden, während Grace und Allegra im Nantucket Cottage Hospital blieben.
Hope hatte erst nach einer Woche auf der neonatologischen Intensivstation einen Namen bekommen. Eigentlich hatten ihre Eltern sie Allison nennen wollen – Allegra und Allison, ekelhafte Zwillingssymmetrie –, doch nach allem, was geschehen war, änderten sie ihre Meinung und beschlossen, sie Hope – Hoffnung – zu nennen, was keiner weiteren Erklärung bedurfte.
Sie war eine Überlebenskünstlerin, eine Benachteiligte, die sich durchgekämpft hatte; sie war die kleinere, schwächere Schwester, fast ignoriert, während Allegra im Mittelpunkt stand; sie hatte Glück, überhaupt am Leben zu sein. Die Ärzte hatten ihren Eltern erklärt, es könne sein, dass Hope einen Hirnschaden erlitten oder eine andere Behinderung habe.
»Aber«, meinte ihre Mutter, »du bist völlig auf dem Damm.«
Hope hatte keine Ahnung, was das bedeutete, wünschte sich jedoch, ihre Eltern hätten die Geschichte ihrer Geburt für sich behalten. Wünschte sich, sie wäre ein Geheimnis, über das niemand redete, und nicht das Ereignis, das sie definierte.
Kleiner, schwächer, Glück, am Leben zu sein. Wohingegen Allegra größer und stärker und ihr unbeschwertes Leben anscheinend ein Geburtsrecht war. In der Schulaufführung der vierten Klasse war Allegra für Alice im Wunderland als Alice und Hope als Haselmaus besetzt worden. Damals wie heute kennzeichnete dies die Unterschiede zwischen ihnen recht deutlich.
Allegra war in Ordnung. Gelegentlich. Nicht so intelligent wie Hope, zumindest nicht so belesen; in der Schule gab sie sich nicht die geringste Mühe. Hope und Allegra hatten als gemeinsames Fach Gesundheit, unterrichtet von Ms Norman, der Sportlehrerin. Das war ein Kinderspiel, die leichteste Eins auf der Welt, weil es da um Ernährung ging und Leibesübungen und Körperhygiene, elementare Dinge, die jeder daher kannte, dass er ein Mensch war und von Menschen aufgezogen wurde. Und doch hatte Allegra nie ihre Hausaufgaben parat, und als Ms Norman sie einmal aufforderte, ihr den wichtigsten Nährstoff in Milch zu nennen, lachte Allegra spöttisch und sagte: »Hä? Keine Ahnung.« Sie klang wie eine Schwachsinnige, und Hope war es peinlich, sich eine Gebärmutter mit ihr geteilt zu haben. Jeder, der auch nur einmal einen Werbespot für Frühstücksflocken gesehen hatte, wusste, dass die Antwort »Kalzium« lautete.
Außerhalb des Klassenzimmers jedoch beherrschten Allegra und Hollis Brancato, ihre beste Freundin, die Schule. Sie waren die wahren Zwillinge mit ihren hübschen Gesichtern, den langen, glänzenden Haaren (obwohl Hollis blond und Allegra brünett war), ihrem aus Zeitschriften abgekupferten Make-up, ihren sorgfältig zusammengestellten Kleidungsstücken. Wer wusste schon, wie viele Tausende Dollar Allegra ihrem Vater aus der Tasche gezogen hatte, damit sie sich »Teile« von Parker und Alice + Olivia und Dolce Vita kaufen konnte? Ihr großer Triumph über Hollis bestand darin, dass sie zu einem Interview bei einer New Yorker Model-Agentur eingeladen worden war. Allegra hatte Hollis und allen anderen Mitschülern erzählt, sie würde »demnächst von denen hören«, was heißen sollte, sie würde vielleicht schon bald in den Rang einer Gisele oder Kate aufsteigen. Nur Hope war bekannt, dass die Frau in der Agentur gesagt hatte, Allegra sei sieben Zentimeter zu klein und ihre Schönheit zu »durchschnittlich«, um jemals Aufträge zu bekommen.
Etwas anderes, das nur Hope wusste, war, dass Allegra zwar seit zwei Jahren mit Brick Llewellyn ging, ihn aber mit Ian Coburn betrog, einem Jungen aus reichem Hause, der letztes Jahr die Nantucket High School abgeschlossen hatte und jetzt am Boston College studierte.
Allegra hatte sich von den letzten vier Wochenenden an dreien mit Ian getroffen. Eigentlich hätte sie jeden Samstag hinüber aufs Cape fliegen sollen, um dort einen teuren und angeblich garantiert zielführenden Kurs zu besuchen, der sie auf den College-Eignungstest vorbereiten sollte, aber Allegra hatte den Unterricht geschwänzt und sich von Ian in seinem roten Camaro abholen lassen, und die beiden waren »rumgefahren«, was immer das heißen mochte. Am vergangenen Wochenende waren sie in der Cape Cod Mall gewesen, wo Ian Allegra am Make-up-Stand von Macy’s drei Chanel-Lippenstifte gekauft hatte; danach gönnten sie sich in der Naked Oyster ein feuchtfröhliches Mittagessen, wofür Allegra einen gefälschten Ausweis vorzeigte, demzufolge sie siebenundzwanzig war und aus Grand Rapids, Michigan, kam. Sie hatte Hope gebeten, sie zu decken – sowohl Brick als auch ihren Eltern gegenüber –, und ihr angeboten, sie dafür zu bezahlen oder Hope den gefälschten Ausweis zu leihen, obwohl sie beide wussten, dass Hope den niemals brauchen würde.
Hope willigte ein, aber nicht, weil sie scharf auf den Ausweis oder das Geld war.
Sie war scharf auf Brick.
Zwei Jahre lang hatte Hope angenommen, Brick würde sich auf keinen Fall jemals von ihrer Schwester trennen. Sie würden eins jener Paare sein, die zusammen aufwuchsen, vier Jahre College in einer Fernbeziehung durchhielten (falls Allegra es aufs College schaffte, was momentan fragwürdig war), dann heirateten, Kinder bekamen und irgendwann ihren fünfzigsten Hochzeitstag feierten. Diese Vision hatte vielleicht auch Brick, aber weder er noch Hope hatten bedacht, dass Allegra eben Allegra war, was bedeutete, dass sie das Gute, das sie hatte, nicht als solches erkannte. Allegra war eine ewig Suchende, die immer höher hinaus wollte, und eine Opportunistin, und sie hatte eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Allegra würde mit Ian Coburn erwischt werden, und das wäre dann das Ende von ihr und Brick. Hope musste einfach nur warten.
Hope und Brick tauschten sich regelmäßig per SMS über ihre Hausaufgaben im Chemie-Talentkurs aus, was ihre Schwester nicht wusste. Allegra war nicht für die Talentklasse ausgewählt worden; sie nahm mit anderen Minderbemittelten wie Hollis und ihrem Freund Bluto nur am normalen Grundkurs teil.
Um halb sechs – Hope wusste, dass Brick jetzt von seinem Baseballtraining zu Hause sein würde – schickte sie ihm eine Nachricht: Heißes Glas sieht aus wie kaltes Glas. So begannen sie jedes »Gespräch« über ihre Chemie-Hausaufgaben, mit einem Insiderwitz, der sich auf das riesige Schild bezog, das in ihrem Klassenzimmer über dem interaktiven Whiteboard hing. Mr Hence lebte in ständiger Angst davor, dass einer seiner Schüler einen Becher anfasste, der kurz davor über dem Bunsenbrenner gewesen war.
Keine Antwort. Vielleicht war Brick noch nicht bereit, Chemie in Angriff zu nehmen. Vielleicht duschte er gerade oder hing mit seinen Eltern ab. Brick war gern in Gesellschaft seiner Eltern – eine Situation, die Hope und besonders Allegra mieden wie die Pest –, weil Trevor und Madeline wirklich cool waren und die drei wie Freunde miteinander umgingen.
Manchmal dachte Hope, sie wollte womöglich weniger Bricks Freundin sein als seine Adoptivschwester.
Hast du dir die Fragen auf Seite 242 angeguckt?, simste sie. Edelgase?
Keine Antwort. Hope konnte Brick zwei unbeantwortete Nachrichten schicken, nicht aber drei. Das würde sie verzweifelt und aufdringlich wirken lassen.
Eine Sekunde später zirpte ihr Handy.
War deine Schwester am Samstag wirklich beim Kurs?, schrieb Brick. Oder hat sie geschwänzt und war in der Mall?
Hope starrte auf den Bildschirm. Jetzt war es also so weit, zu einem Zeitpunkt, an dem sie am wenigsten damit gerechnet hatte. Brick war Allegra auf der Spur. Hope musste sich zusammenreißen, um nicht alles zu verraten.
Beim Kurs, glaube ich. Wieso?, schrieb sie.
Jemand hat gesagt, er hätte sie in der Mall gesehen, schrieb Brick.
Welcher Jemand?, schrieb Hope.
Jemand, schrieb Brick.
Komm schon. Wer?, schrieb Hope.
Parker Marz, schrieb Brick. Er hat gesagt, sie war mit jemandem in einem Boston-College-Sweatshirt zusammen. Geht euer Cousin nicht aufs BC?
Hope kaute auf ihrem Radiergummi herum. Ihre Cousins waren alle älter, obwohl einer von ihnen – der dickste, aufgeblasenste Blödmann der ganzen Sippe – tatsächlich aufs BC gegangen war, was Eddie dazu veranlasst hatte, seinen Lieblingswitz zu erzählen: Woran erkennst du, dass jemand aufs BC geht? Er erzählt es dir.
Einer von unseren Cousins war auf dem BC. Vor einer Weile, schrieb Hope.
Ach so, schrieb Brick. Okay.
Hast du Allegra danach gefragt?, schrieb Hope.
Nee, schrieb Brick. Nicht so wichtig. Egal.
Steckt den Kopf in den Sand, dachte Hope. Sie konnte es ihm nicht verübeln. Es war zu schrecklich, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.
Hope ging jede Woche mit ihrer Mutter in die Kirche. Sie war ein spiritueller Mensch, sie glaubte an Gott, sie akzeptierte die meisten Dogmen der katholischen Kirche, jedoch nicht alle. Sie glaubte an die Kraft des Gebets, und so sprach sie jetzt ein besonders inniges für Brick, und dann schlug sie Seite 242 auf und fing an, sich mit den Edelgasen zu befassen.
EDDIE
Er trug seinen glücksbringenden Panamahut, als er in seinem Porsche Cayenne über das Kopfsteinpflaster holperte und dabei jedem zuwinkte, den er sah. Grace beschuldigte ihn oft des »wahllosen Winkens«.
»Den kennst du doch gar nicht«, sagte sie dann. »Warum hast du gewinkt?«
In Wahrheit verhielt es sich so, dass Eddie ein bisschen kurzsichtig war, und der falschen Person nicht zuzuwinken fürchtete er mehr, als einen vollkommen Fremden zu grüßen. Ein Nicht-Winken konnte im Immobiliengewerbe einen geplatzten Verkauf oder eine entgangene Vermietung bedeuten und damit den Verlust von Tausenden von Dollars an potenziellen Einkünften.
Neben Eddie, auf dem Beifahrersitz, lagen vier Rechnungen aus der Eagle Wing Lane. Genauer gesagt, aus der Eagle Wing Lane 13, denn Eddie war gezwungen gewesen, den Bau von Nr. 9 und Nr. 11 einzustellen. Er hatte einfach kein Geld mehr.
Es sollte verboten sein, vier Rechnungen an einem Tag zu kriegen, dachte er. Drei müssten das Maximum sein. Aber die heutige Post hatte ihm vier beschert; seine Sekretärin Eloise hatte sie ihm mit spitzen Fingern gegeben, als ob sie ihm ein schmutziges Taschentuch reichte.
Die erste Rechnung für den Guss des Fundaments belief sich auf zweiundzwanzigtausend. Eddie blinzelte, dann spürte er Erleichterung in sich aufsteigen, als ihm klarwurde, dass er die bereits beglichen hatte. Doch ein Anruf bei Gerry, dem Fundamentbauer, offenbarte, dass Eddie die Fundamente für Nr. 9 und 11, nicht aber das von Nr. 13 bezahlt hatte.
Sein Panamahut brachte ihm kein Glück. Er hätte ihn gern abgenommen und auf den Rücksitz geworfen, aber er glaubte so sehr an seine Macht, dass er Angst hatte, er würde einen Unfall haben und sterben und Grace und die Mädchen mittellos zurücklassen, wenn er den Hut im Zorn absetzte.
Bevor er das Büro verlassen hatte, hatte er noch am Schreibtisch seiner Schwester Barbie vorbeigeschaut, die als einzige weitere Immobilienmaklerin bei ihm arbeitete, weil sie im Grunde der einzige Mensch auf Nantucket war, dem er außer seiner Frau und seinen Kindern vertraute.
»Was soll ich machen, um an Geld zu kommen?«, fragte er.
Barbie sah unter ihrem grau melierten Pony hervor zu ihm auf. Sie war nicht die schönste Frau auf der Insel, präsentierte das, was sie hatte, aber so vorteilhaft wie möglich. Sie trug immer Kleider – bevorzugt Wickelkleider von Diane von Furstenberg (was Eddie nur wusste, weil Allegra ihn über Tante Barbies Vorlieben unterrichtet hatte), immer hochhackige Schuhe (Manolo Blahniks), immer ihr Parfüm (dessen Namen er nicht kannte, doch es war so typisch für sie, dass es eigentlich auch Barbie hätte heißen können). Heute trug sie außerdem ihren Lieblingsschmuck: eine schwarze Perle, die genauso groß war wie die Zauberkugeln, die sie als Kinder im Supermarkt stibitzt hatten.
Sie waren in bitterer Armut in der Purchase Street in New Bedford aufgewachsen. Die Highschool hatte für Eddie zwei Paar Cordhosen bedeutet (grau und beige), zwei fusselnde Pullover (grau und beige), zwei Button-down-Hemden (weiß und rotkariert) und ein Paar rot-blaue Laufschuhe mit Reißverschluss, die seine Mutter im Secondhand-Laden gefunden hatte. Die Schuhe wurden sein Markenzeichen, als er sich daranmachte, jeden Sprintrekord an der New Bedford High School und anderen Highschools im ganzen Staat zu brechen und sich damit den Spitznamen Flinker Eddie zu erwerben.
Eddie hatte seinen Benachteiligungen wegrennen können, seine elf Monate jüngere Schwester Barbie dagegen war gezwungen gewesen, sich ihnen zu stellen. Sie war wegen ihrer Kleidung, ihrer Schuhe, ihrer Frisur, ihres Geruchs gnadenlos gehänselt worden – und in Handgreiflichkeiten geraten und bis zum Schulabschluss dreimal suspendiert worden. Für Barbie, das wusste er, konnte es nie genug Geld geben.
»Ich habe eine ganz revolutionäre Idee«, sagte sie. »Versuch doch, ein Haus zu verkaufen.«
»Sehr witzig«, sagte er. Der Markt war eine gefrorene Tundra.
»Na ja«, sagte Barbie und sah auf ihren Schreibtischkalender, »nächste Woche kommt doch dieser Typ mit seiner Gruppe in die Low Beach Road.«
»Welcher Typ?«
»Du weißt, welcher Typ«, sagte Barbie. »Der Typ, der gefragt hat.«
Der Typ, der gefragt hat. Eddie wünschte sich, er wüsste nicht, von wem seine Schwester redete, aber er wusste es. Sie meinte Ronan Nachname-Geheim.
Eins der Dauer-Asse in Eddies Ärmel war das Haus in der Low Beach Road 10, direkt am Atlantik, mit sechs – sechs! – Suiten, einem Infinity Pool, zwei Gourmetküchen (eine drinnen, eine draußen), einem Rasentennisplatz und einem vierhundertsechzig Quadratmeter großen Souterrain, das ein Kino enthielt, eine Spielhalle voller alter Flipper, ein Fitness-Studio genau wie das, in dem die New England Patriots außerhalb der Saison trainierten, eine Sauna, einen mahagonigetäfelten Billardraum und einen begehbaren Humidor. Außerdem gab es noch einen gemauerten Weinkeller mit einem Tisch, der ursprünglich für Wilhelm von Oranien gebaut worden war. Das Haus kostete fünftausend Dollar Miete pro Woche, und Eddie hatte das Exklusivrecht auf die Vermietung. Der Eigentümer war ein dreißigjähriger Absolvent der Nantucket High School, der dann auf die Cal Tech gegangen war, wo er einen Computerchip entwickelt hatte, der in jedem Geldautomaten in Amerika enthalten war. Er hatte ein Supermodel geheiratet und lebte drüben in L. A. Die beiden kamen jeden August für zwei Wochen nach Nantucket; die restliche Zeit über konnte Eddie das Haus vermieten.
ENDE DER LESEPROBE