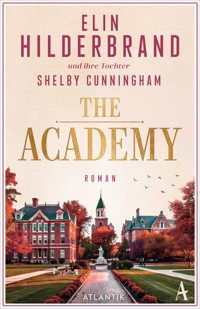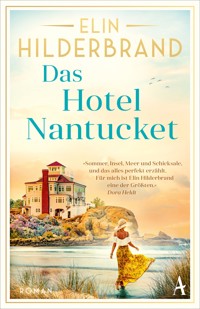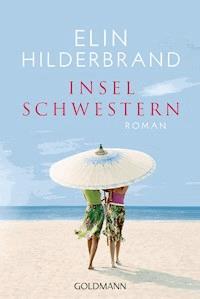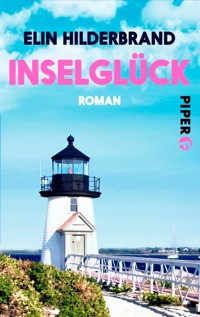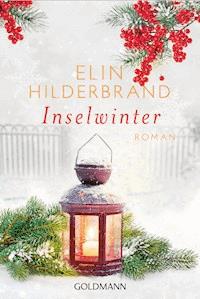13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Nr.1-Bestseller von der »Königin des Sommers« (New York Post)
Sommer 1969. Seit jeher verbringt die Familie Levin die schönste Zeit des Jahres auf der Insel Nantucket. Doch in diesem Sommer ist alles anders: Tochter Blair wartet zu Hause auf die Geburt ihres ersten Kindes, Sohn Tiger ist in Vietnam, und Tochter Kirby jobbt in einem Hotel auf der Nachbarinsel. Nur Jessie, die Jüngste, fährt wie immer mit den Eltern und der Großmutter auf die Insel. Ein öder Sommer voller Langeweile liegt vor ihr, befürchtet Jessie. Doch weit gefehlt! Noch ahnt keiner, wie turbulent dieser Sommer wird und welche Überraschungen er bereithält …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Die Familie Levin aus Boston verbringt die schönste Zeit des Jahres seit jeher im Haus der Großmutter auf der Insel Nantucket. Doch im denkwürdigen Sommer 1969 ist alles anders: Die älteste Tochter Blair wartet zu Hause auf die Geburt ihres ersten Kindes, Sohn Tiger ist als Soldat in Vietnam und Tochter Kirby jobbt in einem Hotel auf der Nachbarinsel Mary’s Vineyard. So fährt nur Jessie, die Jüngste, mit ihren Eltern und der Großmutter nach Nantucket. Noch ahnt keines der Familienmitglieder, welche Überraschungen dieser Sommer bereithält – und dass sie am Ende doch wieder alle auf der Insel landen …
Weitere Informationen zu Elin Hilderbrand
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Elin Hilderbrand
Der beste Sommer aller Zeiten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Thiesmeyer
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Summer of ’69« bei Little, Brown and Company,
Hachette Book Group, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2021
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Elin Hilderbrand
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Covermotiv: FinePic®, München; arcangel/Maria Heyens; arcangel/Marie Carr
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
LS · Herstellung: ik
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-26485-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Dieses Buch ist für die drei Menschen, die in den frühen Morgenstunden des 17. Juli 1969 bei mir waren:
meine Mutter, Sally Hilderbrand, bei der vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin die Wehen einsetzten;
meine Großmutter mütterlicherseits, Ruth Huling, die »bei Rot über sämtliche Ampeln gerast« ist, um meine Mutter noch rechtzeitig ins Boston Hospital for Women zu bringen;
meinen Zwillingsbruder Eric Hilderbrand, der sich, so stelle ich es mir zumindest vor, mir im Mutterleib zugewandt und gesagt hat: »Na, bist du so weit, kann’s losgehen?«
Prolog
Fortunate Son
Als für Tiger Post von der Regierung eintrifft, überlegt Kate spontan, ob sie den Umschlag wegwerfen soll. So geht es doch sicher allen amerikanischen Müttern, wenn der Einberufungsbescheid für ihren Sohn ins Haus flattert? Kate könnte einfach so tun, als wäre der Bescheid in der Post verloren gegangen, und Tiger damit noch ein paar Wochen Freiheit erkaufen, ehe die U.S. Army einen weiteren Brief schickt – und bis dahin ist dieser fürchterliche Krieg in Vietnam vielleicht schon vorbei. Nixon hat ja versprochen, ihn zu beenden. In Paris laufen zurzeit Friedensgespräche. Le Duan wird den Verlockungen des Kapitalismus nicht länger widerstehen können, oder Thieu fällt einem Attentat zum Opfer, und stattdessen kommt ein vernünftigerer Mann ans Ruder. Ob Vietnam kommunistisch wird, ist Kate eigentlich herzlich egal. Sie will bloß ihren Sohn beschützen.
»Auf dem Küchentisch liegt ein Brief für dich«, sagt Kate, als Tiger von seinem Fahrschuljob nach Hause kommt.
Tiger scheint darüber nicht weiter beunruhigt. Er pfeift vor sich hin, in seinem Fahrlehrerhemd aus Polyester von der Walden Pond Driving Academy mit seinem Namen, der über der Brusttasche eingestickt ist: Richard. Auch auf dem Brief steht dieser Vorname – er ist an Richard Foley adressiert –, aber so nennt ihn eigentlich niemand. Alle Welt kennt ihn nur als Tiger.
»Heute hatte ich eine echt süße Schülerin, Ma«, sagt Tiger. »Magee hieß sie, mit Vornamen, was ich echt abgefahren fand. Sie ist neunzehn wie ich, macht gerade eine Ausbildung zur Dentalhygienikerin. Ich habe mein Prachtgebiss blitzen lassen und dann gefragt, ob sie heute Abend mit mir essen gehen will, und sie hat Ja gesagt. Du wirst sie mögen, jede Wette.«
Kate tut geschäftig, sie steht an der Spüle, wo sie Narzissen in einer Vase arrangiert. Sie schließt die Augen und denkt: Das sind die letzten unbeschwerten Gedanken, die er je haben wird.
Und Tatsache, gleich darauf sagt er: »O Mensch, o wow …« Er räuspert sich. »Ma?«
Kate dreht sich zu ihm um, mit einer Handvoll Narzissen im Arm, die sie vor sich hält wie ein Kruzifix, um einen Vampir abzuwehren. Auf Tigers Gesicht liegt ein Ausdruck zwischen Schock, Aufregung und Schrecken.
»Ich bin einberufen worden«, sagt er. »Ich soll mich am einundzwanzigsten April beim Rekrutierungsbüro der Army in South Boston einfinden.«
Am 21. April hat Kate Geburtstag. Achtundvierzig wird sie dieses Jahr. In diesen achtundvierzig Jahren ist sie zweimal verheiratet gewesen und hat vier Kinder bekommen, drei Töchter und einen Sohn. Dass sie den Sohn am meisten liebt, würde sie nie sagen; nur, dass sie ihn anders liebt. Es ist die wilde, alles verzehrende Liebe, die jede Mutter für ihr Kind empfindet, aber mit einem Extraklecks Nachsicht angereichert. Ihr hübscher Sohn – seinem Vater äußerlich so ähnlich, aber liebenswert. Und gut.
Kate nimmt zwanzig Dollar aus ihrem Portemonnaie, die sie vor Tiger auf den Tisch legt. »Für deine Verabredung heute Abend«, sagt sie. »Geht irgendwohin, wo es nett ist.«
Am 21. April ist es Kate, die mit Tiger von Brookline nach South Boston fährt. David hatte angeboten, das Fahren zu übernehmen, aber Kate wollte ihn nicht dabeihaben. »Es ist mein Sohn«, erklärte sie. David sah sie verblüfft an, und ein schmerzlich-gekränkter Ausdruck huschte über sein Gesicht. Sonst reden sie nie in solchen Kategorien – ihre Kinder, also nicht seine. Kate bereute ihre Wortwahl umgehend, dachte aber gleichzeitig, dass David, um zu erfahren, was wirklicher Schmerz ist, gern mit ihr tauschen könne. Tiger verabschiedete sich in der Auffahrt von David und seinen drei Schwestern. Kate hatte den Mädchen eingeschärft, nicht zu weinen. »Er soll nicht denken, dass er nie zurückkommt«, sagte sie zur Begründung.
Und doch ist es genau diese Furcht, die Kate im Würgegriff hält: dass Tiger in einem fremden Land sterben wird. Er könnte einen Bauch- oder Kopfschuss erhalten, von einer Granate getötet werden. In einem Reisfeld ertrinken; bei einem Hubschrauberabsturz verbrennen. Kate sieht es seit Jahren in den Nachrichten, Abend für Abend. Amerikanische Jungen verlieren ihr Leben, und wie reagieren Kennedy und Johnson und jetzt Nixon darauf? Sie schicken weitere Jungen in den Krieg.
Am Rekrutierungsbüro macht Kate hinter einer Schlange anderer Autos Halt. Ein Stück vor ihnen umarmen Jungen ganz wie Tiger ihre Eltern, einige von ihnen zum letzten Mal. Nicht wahr? Ein gewisser Prozentsatz dieser Jungen hier in South Boston geht seinem Tod entgegen, das lässt sich nicht abstreiten.
Kate schaltet in die Parkstellung. Es wird nicht lange dauern, nach dem, was sich bei allen anderen beobachten lässt. Tiger schnappt sich seinen Rucksack von der Rückbank, und Kate steigt aus und eilt um den Wagen herum. Sie nimmt sich kurz die Zeit, sich Tiger noch einmal einzuprägen. Er ist neunzehn, misst einen Meter achtundachtzig und bringt achtzig Kilo auf die Waage. Sein blondes Haar hat er lang wachsen lassen, sehr zum Entsetzen von Kates Mutter Exalta, es reicht ihm bis über den Hemdkragen, aber darum wird sich in Kürze die Army kümmern. Er hat klare grüne Augen, und die eine Pupille ist länglich geformt, wie ein Tropfen Honig an einem Löffel. Es sehe aus wie ein Tigerauge, hat jemand mal gesagt, und daher hat er seinen Spitznamen.
Tiger hat die Highschool abgeschlossen und ein Semester an der Framingham State University hinter sich. Er hört gern Led Zeppelin und The Who; er liebt schnelle Autos. Es ist sein Traum, eines Tages als Rennfahrer am Indy 500 teilzunehmen.
Und dann gerät Kate ohne Vorwarnung in den Sog der Vergangenheit. Tiger ist eine Woche später auf die Welt gekommen als eigentlich errechnet und wog bei der Geburt stolze 4.420 Gramm. Seine ersten Schritte hat er mit zehn Monaten getan, was sehr früh ist, aber er wollte nun mal unbedingt Blair und Kirby nachlaufen. Mit sieben kannte er die Mannschaftsaufstellung der Red Sox in- und auswendig; Ted Williams war sein Lieblingsspieler. Mit zwölf erzielte er bei seinem letzten Spiel in der Baseball-Little-League drei Home Runs hintereinander. In der achten Klasse wurde er zum Jahrgangssprecher gewählt und war danach so gescheit, rasch jedes Interesse an Politik zu verlieren. Auf Nantucket fing er als Zeitvertreib für Regentage mit Bowling an und gewann schon bald darauf sein erstes Turnier. In der Highschool dann kam der Football hinzu. Tiger Foley hält sämtliche Receiver-Rekorde an der Brookline Highschool, darunter auch die Gesamtzahl von erzielten Yards, ein Rekord, der nach Einschätzung von Coach Bevilaqua niemals je übertroffen werden kann. Er wurde angeworben, um an der Penn State zu spielen, aber Tiger wollte nicht so weit von zu Hause weg, und die Mannschaft an der University of Massachusetts hier in Boston war nicht spannend genug – behauptete Tiger jedenfalls. Kate vermutet eher, dass Tiger die Begeisterung für den Football verloren hat oder dass er auf dem Gipfel seines Ruhms aufhören wollte oder dass er nach der Schule einfach so gar keine Lust auf vier weitere Jahre Studium hatte. Am liebsten würde Kate ihm an den Kopf knallen, dass er jetzt nicht in dieser Lage wäre, wenn er ein Studium begonnen hätte, egal an welchem College, oder als Teilzeitstudent an der Framingham State geblieben wäre.
»Denk dran, dich um Magee zu kümmern«, sagt Tiger. »Du hast es mir versprochen.«
Magee. Er sorgt sich um Magee. Tiger und Magee hatten an dem Tag, als Tigers Einberufung eintraf, ihr erstes Date, und seither sind sie unzertrennlich. Sich zwei Wochen ehe er in den Krieg musste, in eine Beziehung zu stürzen, hielt Kate insgeheim eher für unklug, aber vielleicht hatte er diese Art von Ablenkung gebraucht. Kate hat zugesagt, nach Magee zu sehen, die es Tiger zufolge sehr mitnehmen wird, dass er fort ist. Aber dass eine Freundin nach einer zweiwöchigen Beziehung ebensolche Trennungsqualen empfinden sollte wie die Mutter des Soldaten, dürfte wohl ausgeschlossen sein.
Ein Kampfeinsatz dauert dreizehn Monate, das ist kein Leben lang, und dennoch nehmen einige der Mütter hier vor dem Rekrutierungsbüro, ohne es zu ahnen, Abschied für immer, und Kate ist sich sicher, dass sie dazugehört. Die anderen Mütter haben nicht etwas so Schreckliches auf dem Gewissen wie sie. Sie hat eine Strafe verdient; sie hat jeden glücklichen Tag der vergangenen sechzehn Jahre genossen wie etwas, das sie nur geborgt hatte, und jetzt ist es wohl so weit: Jetzt ist Zahltag. Kate hatte im Stillen mit so etwas wie einer Krebsdiagnose gerechnet, mit einem Autounfall oder einem Hausbrand. Dass sie ihren Sohn verlieren würde, wäre ihr nie in den Sinn gekommen. Doch hier steht sie nun. Es ist allein ihre Schuld.
»Ich hab dich lieb, Ma«, sagt Tiger.
Ich dich auch wäre die naheliegende Antwort, doch Kate sagt stattdessen: »Es tut mir leid.« Sie umarmt Tiger so fest, dass sie seine Rippen unter der leichten Übergangsjacke spüren kann. »Es tut mir so leid, Baby.«
Tiger küsst sie auf die Stirn und lässt ihre Hand erst in allerletzter Sekunde los. Als er schließlich reingeht, steigt Kate hastig wieder ins Auto ein. Durchs Fenster sieht sie, wie Tiger auf die offene Tür zusteuert. Ein Herr in einer braunen Uniform bellt ihm etwas zu, worauf Tiger merklich Haltung annimmt und die Schultern strafft. Kate starrt auf ihre Finger, die das Lenkrad umklammern. Sie kann es nicht ertragen, ihn verschwinden zu sehen.
Erster Teil
Juni 1969
Both Sides Now
Sie reisen am dritten Montag im Juni nach Nantucket, so wie jedes Jahr. Jessies Großmutter mütterlicherseits, Exalta Nichols, hält sehr viel von Traditionen, und das gilt ganz besonders für die Routinen und Rituale des Sommers.
Jessies dreizehnter Geburtstag fällt dieses Jahr auf ebenjenen dritten Montag im Juni und wird daher übersehen werden. Das stört Jessie nicht weiter. Ohne Tiger könnten sie ohnehin nicht richtig feiern.
Jessica Levin (»Reimt sich auf Heaven«, so ihr Standardsatz, wenn Leute sich mit der Aussprache schwertun) ist das jüngste der vier Kinder ihrer Mutter. Jessies Schwester Blair ist vierundzwanzig und wohnt in der Commonwealth Avenue. Blair ist mit Angus Whalen verheiratet, einem Professor am Massachusetts Institute of Technology. Sie erwarten im August ihr erstes Baby, und das bedeutet, dass Kate, Jessies Mutter, in dieser Zeit nach Boston zurückkehren wird, um ihnen beizustehen, während Jessie mit ihrer Großmutter allein auf Nantucket zurückbleibt. Exalta ist keine warmherzige, treusorgende Großmama, die Plätzchen backt und einem in die Wangen zwickt. Jede Interaktion mit Exalta gleicht für Jessie einem Sturz in eine Dornenhecke: Ohne Blessuren geht das niemals ab, die Frage ist nur, wo und wie schlimm sie zerkratzt wird. Jessie hat angeboten, gemeinsam mit Kate nach Boston zurückzukehren, aber davon wollte ihre Mutter nichts hören. »Dein Sommer soll dadurch nicht vermasselt werden«, so ihre Begründung.
»Es würde ihn nicht vermasseln«, versicherte Jessie mit Nachdruck. Tatsache ist, es würde ihren Sommer eher retten, wenn sie früher zurückkönnte. Jessies Freundinnen Leslie und Doris verbringen die Ferien daheim in Brookline und gehen im Country Club schwimmen, dem Leslies Familie angehört. Letzten Sommer haben Leslie und Doris sich enger angefreundet, während Jessie fort war. Seither bildet die Freundschaft der beiden die stabilste Seite des Dreiecks, und Jessie fühlt sich ein bisschen außen vor. Leslie gibt in ihrem Trio den Ton an, weil sie blond und hübsch ist und ihre Eltern gelegentlich bei Teddy und Joan Kennedy zum Essen eingeladen werden. Sie scheint der Auffassung zu sein, sie würde Doris und Jessie einen Gefallen tun, indem sie mit ihnen befreundet bleibt, jedenfalls ist das der Eindruck, der sich ihnen mitunter aufdrängt. Sie verfügt über so viel Sozialprestige, dass sie auch mit Pammy Pope und den wirklich populären Mädchen abhängen könnte, wenn sie das wollte. Und wer weiß, vielleicht wird Leslie ja für immer aus ihrem Leben verschwinden, wenn Jessie den ganzen Sommer über fort ist.
Jessies nächstältere Schwester, Kirby, studiert im dritten Jahr am Simmons College. Kirbys Streitereien mit ihren Eltern sind nicht nur lautstark, sondern auch spannend. Da Jessie seit Jahren heimlich die Gespräche ihrer Eltern belauscht, versteht sie mittlerweile, was das Hauptproblem ist: Kirby ist ein »Freigeist«, sie »weiß nicht, was gut für sie ist«. Kirby hat am Simmons zweimal das Hauptfach gewechselt und dann versucht, sich ein Hauptfach nach eigenem Gusto maßzuschneidern, »Gender und Race«, aber das wurde vom Dekan abgelehnt. Und so traf Kirby den Entschluss, dass sie als erste Studentin am Simmons College überhaupt ihr Examen ohne Hauptfach machen würde. Was beim Dekan abermals auf Ablehnung stieß.
»Ein Examen ohne Hauptfach, hat er gesagt, das wäre in etwa so, als würde man zur Abschlussfeier splitternackt erscheinen«, berichtete Kirby Jessie. »Worauf ich gesagt habe, dass ich die Idee gar nicht so schlecht finde.«
Jessie kann sich ohne Weiteres vorstellen, wie ihre Schwester im Evaskostüm über die Bühne schreitet, um ihr Diplom in Empfang zu nehmen. Kirby hat sich schon zu Highschool-Zeiten an politischen Protesten beteiligt. Sie ist mit Dr. Martin Luther King Jr. von Roxbury durch die Slums und gefährlichen Stadtviertel bis zum Boston Common marschiert, wo Jessies Vater sie dann abgeholt und nach Hause gebracht hat. Dieses Jahr hat Kirby bereits an zwei Antikriegs-Demonstrationen teilgenommen und wurde beide Male verhaftet.
Verhaftet!
Jessies Eltern verlieren langsam die Geduld mit Kirby – Jessie hat ihre Mutter sagen hören: »Bis sie gelernt hat, sich vernünftig zu benehmen, bekommt dieses Mädchen von uns keinen einzigen Cent mehr!« –, doch Kirby ist inzwischen nicht mehr ihre Hauptsorge.
Ihre Hauptsorge ist Jessies Bruder Richard, aller Welt nur als Tiger bekannt, der im April in die U.S. Army eingezogen worden ist. Nach der Grundausbildung ist Tiger mit der Charlie Company des Zwölften Regiments der Dritten Brigade der Vierten Infanterie ins zentrale Hochland von Vietnam entsandt worden. Die Situation hat die Familie bis in ihre Grundfesten erschüttert. Bislang hatten sie alle angenommen, dass nur Jungen aus der Arbeiterklasse in den Krieg müssten, keine erfolgreichen Footballspieler von der Brookline Highschool.
Nach Tigers Entsendung fingen alle an der Schule an, anders mit Jessie umzugehen. Pammy Pope lud Jessie zum alljährlichen Memorial-Day-Picknick ihrer Familie ein – Jessie lehnte dankend ab, aus Loyalität Leslie und Doris gegenüber, die nicht gefragt worden waren –, und an einem Montagmorgen Anfang Juni holte Miss Flowers, die Vertrauenslehrerin, Jessie zu einem Gespräch aus dem Unterricht, um zu hören, wie es ihr ging. Es war die Hauswirtschaftsstunde, und die anderen Mädchen sahen Jessie neidvoll nach, weil sie sich nun nicht mehr an ihrer Nähmaschine abmühen musste, um ihre Weste aus dunkelblauem Cord bis Ende des Schuljahrs fertigzustellen. Miss Flowers ging mit Jessie in ihr Büro, schloss die Tür und bot ihr eine Tasse Tee an. Jessie trank sonst keinen Tee, wobei sie allerdings Kaffee gern mochte – Exalta erlaubte ihr einen Becher Milchkaffee zum Sonntagsbrunch, ungeachtet Kates Protesten, dass Jessies Wachstum dadurch gehemmt würde –, doch es war ihr sehr recht, hierher in Miss Flowers’ gemütliches Büro entkommen zu sein. Miss Flowers hatte eine Holzkiste voll exotischer Teesorten – Kamille, Chicorée, Jasmin –, und Jessie ließ sich Zeit bei der Auswahl, als würde ihr Leben davon abhängen, dass sie die richtige Sorte erwischte. Sie entschied sich für Hibiskus. Der Tee war und blieb blässlich orange, obwohl sie den Beutel ewig lang ziehen ließ. Jessie fügte drei Würfel Zucker hinzu, aus der Sorge heraus, dass der Tee sonst keinen Geschmack haben würde. Und sie hatte recht; das Gebräu schmeckte wie orangefarbenes Zuckerwasser.
»Also«, fing Miss Flowers an. »Wie ich höre, ist dein Bruder in Übersee. Hast du schon von ihm gehört?«
»Ja«, sagte Jessie. »Zwei Briefe.«
Der erste Brief war an die gesamte Familie gerichtet gewesen und enthielt Einzelheiten aus der Grundausbildung, die, wie Tiger schrieb, überhaupt nicht so hart ist, wie man überall liest; für mich ist das ein Kinderspiel. Der andere Brief war nur für Jessie gewesen. Ob Blair und Kirby auch eigene Briefe bekommen hatten, wusste sie nicht, doch irgendwie hatte sie ihre Zweifel daran. Blair, Kirby und Tiger waren Vollgeschwister – sie waren die Sprösslinge von Kate und ihrem ersten Ehemann, Lieutenant Wilder Foley, der am achtunddreißigsten Breitengrad in Korea Dienst getan und sich dann nach seiner Heimkehr versehentlich mit seiner Beretta in den Kopf geschossen hatte –, am innigsten aber fühlte Tiger sich Jessie verbunden, seiner Halbschwester. Tatsächlich durften sie die Begriffe Halbschwester, Halbbruder und Stiefvater nicht benutzen – das hatte Kate ihnen strikt verboten –, doch durch die Familie zog sich nun mal eine Bruchlinie, ob es zur Sprache gebracht wurde oder nicht. Sie waren zwei Familien, die zusammengenäht worden waren. Das Verhältnis zwischen Tiger und Jessie allerdings fühlte sich echt an, vollständig und gut, und was er in dem Brief geschrieben hatte, war der Beweis dafür. Schon bei der Anrede, Liebe Messie, kamen Jessie die Tränen.
»Briefe sind das Einzige, was es etwas einfacher macht«, sagte Miss Flowers, und dabei standen auch ihr die Tränen in den Augen. Miss Flowers’ Verlobter, Rex Rothman, war im Vorjahr bei der Tet-Offensive umgekommen. Miss Flowers hatte sich eine ganze Woche freigenommen, und Jessie hatte ein Foto von ihr in der Boston Globe gesehen, auf dem sie neben einem Sarg stand, der mit dem Sternenbanner verhüllt war. Im September darauf jedoch, zu Beginn des neuen Schuljahrs, schien es, als würde sich zwischen Miss Flowers und Eric Barstow, dem muskulösen Sportlehrer, eine Romanze anbahnen. Die Jungen hassten Mr Barstow und hatten zugleich Respekt vor ihm, während Jessie und die anderen Mädchen an der Schule ihm mit Misstrauen begegneten – bis er anfing, Miss Flowers zu umgarnen, und plötzlich zum romantischen Helden wurde. In jenem Frühjahr beobachteten sie einmal, wie er Miss Flowers ein zartes Sträußchen Maiglöckchen brachte, eingewickelt in ein feuchtes Papierhandtuch, und nach Schulschluss trug er ihr jeden Tag ihre Bücher und Akten auf den Parkplatz. Jessie hat die beiden zusammen bei Miss Flowers’ leuchtend orangerotem VW Käfer stehen sehen, ins Gespräch vertieft, während Mr Barstow einen Ellbogen aufs Autodach stützte. Und einmal hat sie vom gerade abfahrenden Schulbus aus sogar gesehen, wie sich die beiden küssten.
Manche Leute – Leslie beispielsweise – finden es nicht in Ordnung, dass Miss Flowers sich nach dem Tod ihres Verlobten schon vor Ablauf eines Trauerjahrs mit einem neuen Mann einlässt. Jessie aber versteht, was für ein Vakuum nach dem tragischen Verlust eines Menschen zurückbleibt, und die Natur, das haben sie in Bio gelernt, verabscheut ein Vakuum. Jessie weiß, dass ihre Mutter nach Wilders Tod einen Anwalt engagiert hatte, um gegen die Behauptung der Versicherung anzugehen, es habe sich um einen Selbstmord gehandelt; der Anwalt argumentierte, dass sich, als Wilder die Beretta in seiner Werkstatt in der Garage reinigte, versehentlich ein Schuss gelöst habe. Ein Unfall also. Eine Unterscheidung, die nicht nur der Lebensversicherung wegen von großer Bedeutung war, sondern auch für den Seelenfrieden von Kates drei kleinen Kindern – Blair war damals acht gewesen, Kirby fünf und Tiger gerade einmal drei.
Der Anwalt, den Kate engagierte – der das Gericht mit Erfolg davon überzeugen konnte, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte –, war kein anderer als David Levin gewesen. Sechs Monate nach Abschluss des Falls fingen Kate und David an, sich näher kennenzulernen. Schließlich heirateten sie, Exaltas heftigen Einwänden zum Trotz, und schon wenige Monate nach der Trauung wurde Kate mit Jessie schwanger.
Da Jessie keine Lust hatte, sich mit Miss Flowers über Tiger und Vietnam zu unterhalten, wechselte sie das Thema. »Der Tee ist ganz köstlich.«
Miss Flowers nickte abwesend, während sie sich an den Augen herumtupfte, mit dem Taschentuch, das stets griffbereit hinter dem Gürtel an ihrem Kleid steckte, um es Schülerinnen notfalls anbieten zu können (schließlich war sie als Vertrauenslehrerin für Heranwachsende zuständig, deren Hormone und Gefühle im Stundentakt Amok liefen). »Du sollst bloß wissen«, sagte sie, »dass du jederzeit zu mir kommen und reden kannst, falls dir im Lauf des Schultages mal dunkle Gedanken kommen sollten.«
Jessie starrte auf ihre Tasse. Sie wusste, dass sie Miss Flowers’ Angebot nie wahrnehmen würde. Wie sollte sie über ihre dunklen Gedanken reden, ihren Bruder betreffend – der noch am Leben war, ihres Wissens –, wo doch Miss Flowers selbst bereits den Verlust ihres Verlobten zu beklagen hatte?
Und obwohl sie nachts im Bett von allen möglichen Horrorvisionen gequält wurde – dass Tiger durch Mörserbeschuss oder Handgranaten getötet wurde oder in Gefangenschaft geriet und hundert Meilen durch den Dschungel marschieren musste, ohne Nahrung oder Wasser –, suchte sie Miss Flowers kein einziges Mal in ihrem Büro auf. Es gelang ihr mit Erfolg, einer Vieraugenbegegnung mit der Vertrauenslehrerin aus dem Weg zu gehen, bis zum letzten Tag vor den Ferien, an dem Miss Flowers Jessie auf ihrem Weg zum Ausgang an sich zog und ihr ins Ohr flüsterte: »Wenn ich dich im September wiedersehe, ist dein Bruder wohlbehalten wieder zu Hause, und ich werde mit Mr Barstow verlobt sein.«
Jessie nickte, den Kopf an das raue Leinen von Miss Flowers’ Pulli gedrückt, und als sie den Blick zu Miss Flowers’ Augen hob, sah sie, dass diese ihre Worte wahrhaftig glaubte – und einen gloriosen Moment lang glaubte auch Jessie daran.
7. Juni 1969
Liebe Messie,
ich schreibe jetzt schon einen Brief, um sicherzugehen, dass er Dich rechtzeitig zum Geburtstag erreicht. Es heißt zwar, dass die Post von hier in die Staaten nur eine Woche braucht, aber wenn ich an die Entfernung denke, die sie zurücklegen muss, sage ich mir: Lieber auf Nummer sicher gehen.
Alles Gute zum Geburtstag, Messie!
Dreizehn Jahre alt, kaum zu glauben. Ich weiß noch genau, wie Du geboren wurdest. Das heißt, ich erinnere mich nur daran, wie Opa mit uns bei Brigham’s Eis essen war. Ich bekam zwei Kugeln Karamell-Eis, und dann ist mir das verflixte Waffelhörnchen aus der Hand gefallen, und Opa sagte nur, Hoppala, und hat mir gleich ein neues besorgt. Ich weiß nicht, wie gut Du Dich an Opa erinnerst, Du warst ja noch ziemlich klein, als er den Löffel abgegeben hat. Jedenfalls, er war schon ein Teufelskerl. Vor der Einschiffung hierher hat Nonny mir seinen Klassenring aus Harvard gegeben, aber wir dürfen keine Ringe tragen, deshalb steckt er vorn in der Tasche an meiner Flakweste, was nicht so schlau ist, denn wenn ich in die Luft gesprengt werde, ist der Ring für alle Zeit verloren, aber ich trage ihn gerne nah an meinem Herzen. Ich fühle mich damit irgendwie sicher, was sich vielleicht blöd anhört, aber Messie, was hier so alles als Glücksbringer gilt, Du würdest es nicht glauben – manche Typen tragen Kreuze oder Davidsterne, andere haben Kaninchenpfoten dabei. Ein Typ hat immer den Schlüssel vom Fahrradschloss seiner Freundin bei sich, ein anderer eine Spielkarte, ein Pik Ass, mit dem er beim Poker groß abgeräumt hat, am Abend vor der Abreise hierher. Und ich habe eben Opas Klassenring aus Harvard dabei, womit ich aber nicht hausieren gehe, weil die Jungs denken könnten, ich will mit meiner Herkunft angeben. Aber was ich Dir, glaube ich, sagen will, ist, dass die Typen Sachen dabeihaben, denen sie magische Kräfte zuschreiben, oder Sachen, die sie daran erinnern, warum sie gern am Leben bleiben würden.
Es gibt einige von uns, die bewiesen haben, dass sie von Natur aus Überlebenslebenskünstler sind, was gut ist, weil unsere Kompanie mitten im Getümmel abgesetzt worden ist. Ich habe hier in der Charlie Company zwei echte Freunde gefunden – Frog und Puppy (eigentlich Francis und John). Die anderen Typen nennen uns den Zoo, weil wir alle Tier-Spitznamen haben, aber sie sind neidisch darauf, wie zäh wir sind. Wir drei liefern uns alberne Wettkämpfe, etwa, wer die meisten Klimmzüge an einem Ast schafft, wer die meisten Kraftausdrücke auf Vietnamesisch lernen und wer am schnellsten eine ganze Zigarette wegqualmen kann, ohne das verdammte Ding auch nur einmal aus dem Mund zu nehmen. Frog ist ein Schwarzer (Potzdonner! – was Nonny wohl davon hielte?) aus Mississippi, und Puppy ist so weißblond und blass, dass er fast als Albino durchginge. Wir hätten ihn Casper nennen sollen oder Gespenst, aber diese Spitznamen waren schon an andere Typen in unserem Regiment vergeben, und da er der Jüngste im Zug ist, heißt er nun eben Puppy. Puppy ist aus Lynden, Washington, ganz oben an der kanadischen Grenze – Himbeerland, sagt er, Sträucher, so weit das Auge reicht, an denen dicke, saftige Himbeeren wachsen. Puppy hat Sehnsucht nach diesen Himbeeren, und Frog hat Sehnsucht nach dem Essig-Krautsalat seiner Mama, und ich habe Sehnsucht nach Brigham’s Karamell-Eis.
Wir sind also eine bunte Mischung, ein Querschnitt unseres grandiosen Landes, wenn man so will. Ich liebe diese Jungs von ganzem Herzen, obwohl ich sie erst seit ein paar Wochen kenne. Wir drei fühlen uns zusammen unbesiegbar, wir fühlen uns stark – und Messie, ich sag’s ja wirklich ungern, aber ich weiß, dass ich von uns dreien der Stärkste bin. Erst dachte ich, das käme daher, dass Coach Bevilaqua die Mannschaft so viele Wiederholungssprints hat machen lassen und uns dazu verdonnert hat, alle Treppen im Stadium hochzutraben, aber das macht einen nur nach außen hin zäh, und um hier zu überleben, muss man auch innerlich zäh sein. Wenn man an der Reihe ist, beim Angriff auf eine Stellung die Spitze zu übernehmen, muss man mutig sein, und ich meine wirklich mutig, weil die Chancen gut stehen, dass man Charlie als Erster begegnet. Wenn man auf Feindbeschuss trifft, ist man der Kugelfang. Als ich meine Kompanie das erste Mal angeführt habe, waren wir auf diesem Dschungelpfad unterwegs, die Mücken lärmten wie brüllende Löwen, es war tiefste Nacht, und eine Gruppe Vietcong hat sich von hinten angeschlichen und Rizzi, der das Schlusslicht bildete, die Kehle durchgeschnitten. Wir lieferten uns ein Feuergefecht, und ein paar andere wurden angeschossen, Acosta und Keltz. Ich dagegen bin heil aus der Sache rausgekommen, bis auf zwei Dutzend Mückenstiche.
Andere Einheiten haben sogar Psychoklempner angefordert, die ihnen helfen sollen, mit solchen Erlebnissen klarzukommen, weil man davon leicht plemplem werden kann. Wenn wir zu einer Mission aufbrechen, steht so gut wie fest, dass einer von uns draufgehen wird. Welcher von uns, das ist nur eine Frage des Glücks, ungefähr so wie beim Entenschießen mit der Wasserpistole auf der Kirmes, wo man auch nie weiß, welche Enten man treffen wird. Als ich Fahrlehrer in Brookline war, wusste ich, dass es diesen Krieg gibt, ich habe es mit Dir und Mom und Dad im Fernsehen gesehen, hab die Todeszahlen gehört, aber es hat sich nicht real angefühlt. Jetzt bin ich hier, und es ist zu real. Jeder Tag erfordert innere Stärke. Tapferkeit. Was dieses Wort bedeutet, habe ich erst hier so richtig begriffen.
Nachts, wenn ich Wachdienst habe oder versuche, gleichzeitig einzuschlafen und ein Auge offen zu halten, denke ich darüber nach, wem in der Familie ich am meisten ähnele. WessenDNAwird mich am Leben erhalten? Erst dachte ich, es müsste Opa sein, weil er ein erfolgreicher Banker war, oder mein Vater, weil er Lieutenant in Korea war. Aber weißt Du, was mir dann klar geworden ist? Der zäheste Mensch in unserer Familie ist Nonny. Sie ist wahrscheinlich der zäheste Mensch auf Erden. Unsere Großmutter könnte es, glaube ich, mit jedem Vietcong aufnehmen, mit jedem meiner befehlshabenden Offiziere. Kennst Du das, wie sie einen ansieht, wenn man sie enttäuscht hat? Als wäre man nicht gut genug, um ihr die Schuhe zu lecken? Oder wenn sie diesen Tonfall anschlägt und sagt: »Was soll ich jetzt von dir halten, Richard?«
Ja, ich weiß, dass Du das kennst, und deswegen graut Dir davor, nach Nantucket zu fahren. Wenn es Dir also ein Trost ist, dann denk daran, dass die Eigenschaften von Nonny, die Dich unglücklich machen, auch die Eigenschaften sind, die Deinem Lieblingsbruder dabei helfen, am Leben zu bleiben.
Ich hab Dich lieb, Messie. Alles Gute zum Geburtstag.
Tiger
Am Abend vor der Abreise nach Nantucket sitzen Jessie und ihre Eltern am Küchentisch und teilen sich eine Pizza vom Lieferdienst – Kate ist vor lauter Packen nicht zum Kochen gekommen –, als es an der Haustür klopft. Jessie, Kate und David halten wie versteinert inne. Ein unvermutetes Klopfen an der Tür abends um halb acht, das bedeutet …
Jessie sieht nur eines vor sich, zwei Offiziere, die draußen mit der Mütze in der Hand auf der Treppe stehen und gekommen sind, um die Hiobsbotschaft zu überbringen, die die Familie zerstören wird. Kate wird sich davon nie wieder erholen; bei Blair könnten schlimmstenfalls vorzeitig die Wehen einsetzen; Kirby wird am meisten Theater machen, und sie wird lautstark der Politik die Schuld geben, Robert McNamara, Lyndon B. Johnson und ihrem besonderen Hassobjekt, Richard Milhouse Nixon. Und Jessie – was wird Jessie tun? Sie kann sich nur vorstellen, dass sie sich auflösen wird wie die Alka Seltzer, die ihr Vater abends in ein Glas Wasser fallen lässt, wenn er an einem stressigen Fall arbeitet. Sie wird zu einem feinen Staub zerfallen und dann davongeweht werden.
David steht auf, mit grimmig entschlossener Miene. Er ist zwar nicht Tigers leiblicher Vater, aber er hat diese Rolle ausgefüllt, seit Tiger klein war, und seine Sache, Jessies Ansicht nach, gut gemacht. David ist schmal und drahtig (er spielt Tennis, das ist das Einzige, was in Exaltas gestrengen Augen für ihn spricht), während Tiger groß und breitschultrig ist, ganz wie Lieutenant Wilder Foley. David ist Rechtsanwalt, aber nicht die Sorte, die in Gerichtssälen herumschreit. Er ist ruhig und bedächtig; er ermuntert Jessie immer, erst nachzudenken und dann zu reden. David und Tiger haben ein enges, fast zärtliches Verhältnis, und Jessie vermutet, dass ihm jetzt übel ist, als er sich auf den Weg zur Tür macht.
Kate greift über den Tisch nach Jessies Hand und drückt sie. Jessie starrt auf die halbe Pizza, die noch im Karton ist, und überlegt, dass keiner von ihnen je wieder wird Pizza essen können, falls Tiger tot ist, was übel wäre, weil Pizza Jessies Leibgericht ist. Dann kommt ihr ein sogar noch unpassenderer Gedanke: Falls Tiger tot ist, braucht sie nicht mit ihrer Mutter und Exalta nach Nantucket. Ihr Leben wird ruiniert sein, aber ihr Sommer wäre in gewisser Weise gerettet.
»Jessie!«, ruft ihr Vater. Er klingt leicht gereizt. Sie steht auf und huscht zur Haustür.
David hält die Fliegengittertür auf. Draußen stehen Leslie und Doris, beschienen vom Verandalicht.
»Ich habe deinen Freundinnen erklärt, dass wir gerade beim Essen sitzen«, sagt David. »Aber da wir morgen abreisen, gebe ich dir fünf Minuten. Sie sind gekommen, um sich von dir zu verabschieden.«
Jessie tritt auf die Veranda hinaus. »Fünf Minuten«, sagt David noch einmal, ehe er die Netzgittertür hinter ihr zufallen lässt.
Jessie wartet, bis sich ihr rasender Herzschlag etwas beruhigt hat. »Seid ihr zu Fuß gekommen?«, fragt sie. Leslie wohnt sechs Blocks entfernt, Doris sogar fast zehn.
Doris nickt. Sie macht ein mürrisches Gesicht, wie üblich. Ihre Brille mit den dicken Gläsern ist ihr bis zur Nasenspitze hinabgerutscht. Sie hat ihre Jeans-Schlaghose mit der Blümchenstickerei auf den Vordertaschen an – logo. Doris lebt geradezu in dieser Jeans. Immerhin, als Zugeständnis an die Hitze trägt sie dazu heute ein weißes Neckholder-Top mit Lochstickerei, das sehr hübsch aussähe, wenn da nicht der Ketchup-Fleck wäre, genau vorne drauf. Doris’ Vater betreibt als Franchisenehmer zwei McDonald’s-Filialen; sie isst also viele Hamburger.
Die Luft ist mild, und zwischen den Bäumen am Straßenrand sieht Jessie das Leuchten von Glühwürmchen aufblinken. Ach, wie gerne würde sie den Sommer in Brookline verbringen! Sie könnte mit Leslie und Doris zusammen zum Country Club rausradeln, und am späten Nachmittag würden sie sich am Eiswagen ihr Lieblings-Wassereis am Stiel kaufen. Sie könnten in den Geschäften in Coolidge Corner abhängen und so tun, als würden sie bestimmten Jungs von der Schule ganz zufällig über den Weg laufen. Kirby hat Jessie gesagt, dass dies der Sommer ist, in dem die Jungs in ihrem Alter endlich einen Wachstumsschub durchmachen.
»Wir sind hier, um dir bon voyage zu wünschen«, sagt Leslie. Sie überzeugt sich mit einem wachsamen Blick, dass niemand hinter der Fliegengittertür steht und lauscht, und fährt dann mit gedämpfter Stimme fort. »Außerdem habe ich Neuigkeiten.«
»Zwei Neuigkeiten sogar«, ergänzt Doris.
»Erstens«, sagt Leslie. »Sie sind gekommen.«
»Sie«, wiederholt Jessie, obwohl sie weiß, dass Leslie ihre Tage meint.
Doris legt sich ihrerseits einen Arm um den Leib. »Ich fühle mich auch irgendwie krampfig«, sagt sie. »Also werde ich wohl die Nächste sein.«
Jessie weiß nicht ganz, was sie sagen soll. Wie soll sie die Neuigkeit aufnehmen, dass eine ihrer besten Freundinnen den ersten Schritt auf dem Weg zum Frausein hinter sich hat, während sie, Jessie, ganz entschieden weiter ein Kind ist? Jessie beneidet sie, und zwar heftig, denn seit »dem Gespräch«, das die Schulschwester letzten Monat mit ihnen geführt hat, unterhalten sie und die beiden anderen sich fast nur über das Thema Menstruation. Jessie ist davon ausgegangen, dass Leslie als Erste von ihnen ihre Tage bekommen würde, weil sie schon recht weit entwickelt ist. Sie hat bereits kleine, feste Brüste und trägt einen Sport-BH, während Jessie und Doris noch so platt wie ein Bügelbrett sind. Jessies Neid und Sehnsucht und, an manchen Tagen, Angst – ihr ist Gerede über ein Mädchen zu Ohren gekommen, das ihre Tage überhaupt nie bekommen hat – sind blödsinnig, das weiß sie. Jessies ältere Schwestern jammern beide über ihre Periode; Kirby nennt sie »den Fluch«, was in ihrem Fall recht passend ist, denn bei ihr geht die Blutung jeden Monat mit Migräne und lähmenden Krämpfen einher und schlägt ihr übel auf die Stimmung. Blair drückt sich etwas gewählter aus, wenn es um ihre Periode geht, wobei die allerdings zurzeit auch gar kein Thema ist, da sie ja schwanger ist.
Leslie kann jetzt schwanger werden, denkt Jessie, eine Vorstellung, die beinahe zum Lachen ist. Und eigentlich würde sie am liebsten nicht länger über dieses Zeug reden; sie möchte gern wieder rein und ihre Pizza weiteressen.
»Und was ist die zweite Neuigkeit?«, fragt Jessie.
»Das hier.« Leslie hält ihr ein flaches, viereckiges Geschenk entgegen, das sie bisher hinterm Rücken versteckt hatte. »Alles Gute zum Geburtstag.«
»Oh.« Jessie ist ganz überrumpelt. Wie alle, die im Sommer Geburtstag haben, hat sie die Hoffnung aufgegeben, ihn jemals zünftig mit ihren Mitschülern feiern zu können. Sie nimmt das eingepackte Geschenk in Empfang; es handelt sich um eine LP, so viel ist klar. »Danke.« Sie strahlt erst Leslie an und dann Doris, die sich noch immer den Arm an den Leib presst, gegen eingebildete Krämpfe, und dann reißt sie das Geschenkpapier auf. Zum Vorschein kommt Clouds von Joni Mitchell, ganz wie von Jessie erhofft. Sie ist besessen von dem Song »Both Sides Now«. Es ist der schönste Song aller Zeiten. Jessie könnte ihn sich von früh bis spät anhören, ununterbrochen, von heute bis ans Ende ihrer Tage, und würde ihn trotzdem nie sattbekommen.
Sie umarmt Leslie, dann Doris, die sagt: »Wir haben uns die Kosten geteilt«, eine Aussage, die wohl auf ein weiteres Dankeschön abzielt, das Jessie dann auch pflichtschuldig abstattet, und zwar speziell Doris. Es freut sie zu hören, dass die beiden die Platte wirklich gekauft haben, denn in den zwei Wochen seit Ferienanfang haben sie sich sporadisch mit Ladendiebstahl beschäftigt, alle drei. Leslie hat bei Irving’s zwei rosa Radiergummis und eine Packung Buntstifte mitgehen lassen, Doris hat in der koscheren Bäckerei einen Bagel mit Ei vom Vortag eingesteckt, und Jessie hat, unter dem massiven Druck ihrer Freundinnen, bei Woolworth in Coolidge Corner ein Mascara von Maybelline geklaut, was sehr viel riskanter war als die beiden anderen Diebstähle, weil der Woolworth angeblich mit versteckten Kameras ausgerüstet ist. Diebstahl ist unrecht, das weiß Jessie, aber Leslie hat daraus eine Mutprobe gemacht, und da hatte sie das Gefühl, ihre Ehre stünde auf dem Spiel. Als Jessie an jenem Tag den Woolworth betrat, schlotterte sie förmlich vor Angst und legte sich bereits im Geist zurecht, wie sie sich bei ihren Eltern rechtfertigen würde, nämlich, indem sie ihr Fehlverhalten auf die Belastung durch den Militärdienst ihres Bruders zurückführen würde. Doch als sie den Laden dann kurz darauf wieder verließ, mit dem Mascara in der Tasche ihrer orangeroten Windjacke, spürte sie einen ungeheuren Adrenalinschub, so ähnlich, als wäre sie high; zumindest stellte sie sich das so ähnlich vor. Sie fühlte sich großartig! Sie fühlte sich mächtig! Im Überschwang ihrer Hochstimmung machte sie unterwegs an der Tankstelle an der Ecke Beacon und Harvard Station, wo sie die Wimperntusche gleich mal ausprobierte, vor dem fast blinden Spiegel der Damentoilette.
Der weniger berauschende Teil der Geschichte war, dass Kate die Wimperntusche sofort auffiel, als Jessie nach Hause kam, gefolgt von der spanischen Inquisition. Was hatte Jessie da bitteschön an den Augen? War das Wimperntusche? Wo hatte sie die denn her? Jessie hatte Kate die einzig glaubhafte Ausrede aufgetischt: es sei Leslies Wimperntusche. Jessie hoffte und betete, dass Kate nicht bei Leslies Mutter anrief, denn wenn Leslies Mutter ihre Tochter danach befragte, standen die Chancen, dass Leslie ihr ein Alibi liefern würde, höchstens fifty-fifty.
Kurz und gut, Jessie ist erleichtert, keine gestohlene LP geschenkt zu bekommen. Sollte ihre Mutter je hinter den Ladendiebstahl kommen, würde sie Jessie den Umgang mit Leslie wohl für alle Zeit verbieten, um sie ihrem schlechten Einfluss zu entziehen.
»Wann bist du wieder da?«, fragt Leslie.
»Anfang September. Am Labor Day.« Die Zeit bis dahin kommt Jessie wie eine halbe Ewigkeit vor. »Ihr könnt mir gern schreiben. Die Anschrift habt ihr noch, oder?«
»Ja«, sagt Doris. »Ich hab schon eine Postkarte an dich losgeschickt.«
»Echt jetzt?«, sagt Jessie. Dieser unvermutete Akt der Zuneigung rührt sie, zumal von der grummeligen alten Doris.
»Du wirst uns fehlen«, sagt Leslie.
Jessie drückt die LP an sich, während sie ihnen zum Abschied nachwinkt, und kehrt dann ins Haus zurück. Sie war nicht die Erste, die ihre Tage bekommen hat, vielleicht wird sie nicht mal die Zweite sein, aber das ist nicht weiter tragisch. Ihre Freundinnen haben sie gern – sie haben ihr etwas gekauft, wovon sie wussten, dass sie es sich wünscht – und, wichtiger noch, ihr Bruder lebt. Einen kurzen Moment lang am Ende ihres zwölften Lebensjahrs ist Jessica Levin glücklich.
In aller Frühe pocht es leise an Jessies Zimmertür. Dann steckt ihr Vater den Kopf herein.
»Bist du schon wach?«, fragt er.
»Nein«, brummt sie. Sie zieht sich die Bettdecke über den Kopf. Das Hochgefühl vom Vorabend hat sich verflüchtigt. Jessie will nicht nach Nantucket. Es kommt nicht mal in Betracht, jetzt beide Seiten zu berücksichtigen. Es gibt nur eine Seite, nämlich, dass es auf Nantucket ohne ihre Geschwister – und, später dann, ohne ihre Mutter – nicht zum Aushalten ist.
David lässt sich behutsam neben ihr auf der Bettkante nieder. Er trägt seinen leichten Sommeranzug, dunkelblau, dazu ein weißes Hemd und eine breite, orange-blau gestreifte Krawatte. Sein lockiges Haar ist gezähmt, und er duftet nach Arbeit, sprich, nach Aftershave, Old Spice.
»Hey.« Er zieht die Bettdecke zurück. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
»Kann ich nicht einfach hier bei dir bleiben und an den Wochenenden hinfahren?«, fragt Jessie.
»Süße.«
»Bitte?«
»Das überstehst du schon«, sagt er. »Ach was, es wird dir gefallen. Ein großer Sommer für dich. Dreizehn bist du nun. Endlich bist du ein Teenager, kannst dich aus dem Schatten deiner Geschwister lösen …«
»Ich mag ihren Schatten aber«, sagt Jessie. Letzten Sommer hatte Kate Jessies Geschwister dazu verdonnert, jeden dritten Tag etwas mit ihr zu unternehmen. Blair fuhr mit Jessie immer zum Cliffside Beach. Sie besorgten sich Hot Dogs und Schoko-Frappés in der Galley und kümmerten sich dann fleißig um ihre Sonnenbräune, während Blair in John Updikes Partnertausch-Roman Ehepaare schmökerte; die Skandalstellen las sie Jessie jeweils laut vor. Updike verwendete gern und oft das Wort Erektion, und als Blair es das erste Mal vorlas, blickte sie Jessie über die Buchseiten hinweg an und sagte: »Du weißt, was das ist, oder?«
»Klar«, erwiderte Jessie, obwohl sie keinen blassen Schimmer hatte.
Blair hatte das Buch sinken lassen. »Es gibt keinen Grund, Sex eklig zu finden. Er ist vollkommen natürlich. Angus und ich haben jeden Tag Sex, mitunter sogar zweimal.«
Jessie fand diese Information ebenso faszinierend wie abstoßend, und danach sah sie Angus mit ganz neuen Augen. Er war zehn Jahre älter als Blair und hatte dunkles, stets unordentlich wirkendes Haar, weil er vor lauter Denken nicht dazu kam, sich zu kämmen. Er war immerzu mit mathematischen Problemen beschäftigt, und Nonny mochte ihn so gern, dass er bei Besuchen bei ihr in All’s Fair sogar in Opas Ledersessel sitzen durfte, an Opas antikem Schreibtisch. Angus zog es selten an den Strand, weil er Sand nicht ausstehen konnte und leicht Sonnenbrand bekam. Den Gedanken an Angus’ unersättlichen Geschlechtstrieb fand Jessie eher unangenehm. Blair war bildhübsch und intelligent obendrein, sie hätte jeden Mann haben können, aber sie hatte Angus geheiratet und ihre Stelle als Englischlehrerin an der Winsor School aufgegeben, um ihm den Haushalt zu führen. Inzwischen schwor sie auf die Kochbücher von Julia Child und trug biedere Blümchenkleider von Lilly Pulitzer – am Strand allerdings wirkte sie kein bisschen wie eine matronenhaft-gesetzte große Schwester, sondern eher wie eine spritzig-freche Tante. Sie rauchte Kents, die sie mit einem silbernen Feuerzeug von Tiffany anzündete; in das Feuerzeug war eine Liebeserklärung eingraviert, von Angus’ jüngerem Bruder Joey, mit dem Blair liiert war, ehe sie mit Angus zusammenkam. Sie trug jedes Mal frischen Lippenstift auf, wenn sie aus dem Wasser kam, und flirtete ungeniert mit Marco, dem Rettungsschwimmer am Cliffside Beach, der aus Rio de Janeiro war. Blair beherrschte ein paar wenige Sätze auf Portugiesisch. Sie war glamourös.
Kirby fuhr mit Jessie ebenfalls an den Strand, wobei sie allerdings die Südküste der Insel bevorzugte, den Tummelplatz der Surfer und Hippies. Kirby ließ immer etwas Luft aus den Reifen des feuerroten Geländewagens, Typ International Harvester Scout, den ihre Großmutter für Fahrten auf der Insel gekauft hatte, und dann bretterten sie durch die Dünen los, direkt zum Madequecham Beach, wo jeder einzelne Sonnentag ein Grund zum Feiern war. Leute spielten Volleyball und tranken Dosenbier, Marke Schlitz, das in Zinkwannen voller Eis kühlte, und in der Luft hing der unverkennbare Geruch von Marihuana. Irgendwer hatte immer ein Transistorradio dabei, und so lauschten sie den Beatles, Creedence Clearwater Revival und Kirbys Lieblingsband, Steppenwolf.
Jessie fand, dass Kirby sogar noch hübscher war als Blair. Kirby hatte langes, glattes Haar, und im Gegensatz zu der eher fraulichen Blair war sie spindeldürr. Surfer in Neoprenanzügen, die ihnen nass vom Leib hingen wie eine abgestreifte Haut, warfen sich Kirby gern über die Schulter und schleuderten sie in hohem Bogen in die Wellen. Sie schrie und kreischte zwar dabei, aber insgeheim, das wusste Jessie, fand sie es toll, und anders als Blair war es Kirby egal, wie sie aussah, wenn sie aus dem Wasser stieg. Sie war immer ungeschminkt und ließ ihr blondes Haar von der Sonne trocknen, ohne es durchzukämmen. Sie rauchte Joints statt Zigaretten, aber immer nur zwei Züge, wenn sie auf Jessie aufpasste; das war ihre eiserne Regel. Nach zwei Zügen fühlte sie sich angenehm entspannt, sagte sie, und wenn sie wieder nach All’s Fair kamen, war die Wirkung längst abgeklungen.
Jessies Tage mit Tiger waren die reinsten Abenteuer. Sie fuhren mit ihren Fahrrädern zum Angeln an den Miacomet Pond; sie unternahmen Wanderungen zum Altar Rock, der höchsten Erhebung auf Nantucket, und feuerten Tigers Kartoffelkanone ab. Am liebsten aber gingen sie zum Bowling. Tiger war im Mid-Island Bowl, dem Bowlingcenter, eine lebende Legende, und das schon, seit er zwölf war. Alle Einheimischen kannten ihn, zählten für ihn beim Spiel mit und spendierten Jessie Kräuterlimos, die sie mit Genuss schlürfte, weil Exalta keinerlei Limonadengetränke duldete, mit Ausnahme von Ginger Ale mit Grenadine im Club. Und selbst davon durfte Jessie nur ein Glas trinken, mehr nicht.
Tigers Talent als Bowler war bemerkenswert, zumal, da sie diesem Hobby nur auf Nantucket nachgingen, und das nur bei Regenwetter. Exalta hielt nichts davon, dass Kinder an sonnigen Sommertagen zu Hause rumhockten. Als Tiger alt genug war, um selbst Auto fahren zu können, konnte er natürlich zum Bowling, wann immer er Lust hatte. An Tagen, wenn er sich um Jessie kümmerte, nahm er sie immer mit, aber das hielten sie vor Exalta geheim, was die Sache nur noch aufregender machte. Wenn Tiger erst mit der Kugel die Pins anvisierte und sie dann mit Schwung auf die Bahn schickte, wobei er das eine Bein hinter sich in die Höhe reckte, wirkte er dabei wie ein Tänzer. Er war anmutig, er war stark, und er war zielgenau. Meistens gelang ihm bei seinen Würfen auf Anhieb ein Strike, bei dem alle zehn Pins auf einmal fielen, als würde er einen Tisch abräumen. Jessie hat gehofft und gebetet, dass sich sein gottgegebenes Talent als genetisch bedingt erweisen würde und sie dieses Talent ebenfalls geerbt hatte, aber dem war leider nicht so; ihre Würfe hatten immer einen Drall nach links oder rechts, und bei über der Hälfte davon landete die Kugel gar seitlich in der Rinne.
Jessie versucht, sich einen Sommer auf Nantucket ohne ihre Geschwister vorzustellen. Sie wird einsam und allein in All’s Fair herumgeistern, mit ihrer Ferienlektüre, die sie fürs kommende Schuljahr lesen muss, Das Tagebuch der Anne Frank – na ja, wenn sie nicht gerade beim Tennisunterricht ist, den ihre Großmutter ihr mit Nachdruck verordnet hat, obwohl Jessie für diesen Sport überhaupt nichts übrighat. So undankbar, die Aussicht auf einen Sommer auf Nantucket als öde zu bezeichnen, ist sie natürlich nicht, aber trotzdem – warum nur, warum, darf sie nicht einfach zu Hause bleiben?
Ihr Vater, der neben ihr auf dem Bett sitzt, bringt aus seiner Jackentasche ein kleines Schmucketui zum Vorschein. »Wenn man dreizehn wird, ist das in der jüdischen Tradition ein wichtiger Einschnitt«, sagt er. »Ich hatte damals eine Bar Mitzwa, aber da wir dich nicht jüdisch erzogen haben, fällt eine solche Feier bei dir flach.« Er hält inne, wendet kurz den Blick ab. »Aber ich möchte dir dennoch zu verstehen geben, wie wichtig dieses Alter ist.«
Jessie setzt sich aufrecht hin und klappt das Etui auf. Es enthält ein Silberkettchen mit einem kleinen Medaillon, so groß wie eine Fünfundzwanzig-Cent-Münze. In das Medaillon ist ein Baum eingraviert.
»Der Lebensbaum«, erklärt David. »In der Kabbala ist der Lebensbaum ein Sinnbild für Reife und Verantwortungsbewusstsein.«
Es ist ein hübsches Kettchen. Und Jessie liebt ihren Vater mehr als jeden anderen Menschen, sogar mehr als Tiger, obwohl ihr bewusst ist, dass man Liebe nicht quantifizieren kann. Sie verspürt einen Beschützerinstinkt ihrem Vater gegenüber, denn während Jessie mit allen in der Familie verwandt ist, ist David nur mit einer Person blutsverwandt, mit ihr. Sie fragt sich, ob er je darüber nachdenkt und sich wie ein Außenseiter vorkommt. Dass ihr Vater sich entschieden hat, dieses Band zwischen ihnen durch sein Geschenk zu betonen, findet sie wundervoll. Sie hat gehört, dass man, um als »richtiger« Jude zu gelten, eine jüdische Mutter haben muss, und falls das stimmt, scheidet Jessie damit aus. Aber als sie den Verschluss des Kettchens zuhakt und das Medaillon kühl und schwer auf ihrem Brustbein ruht, fühlt sie eine Verbindung zu ihrem Vater – etwas Spirituelles, etwas Größeres als bloß normale Liebe. Ob Anne Frank wohl auch eine Kette mit einem Lebensbaum-Medaillon besessen hat? Nach kurzem Nachdenken kommt sie zu dem Schluss, dass Anne, falls sie ein solches Kleinod besaß, es vermutlich zusammen mit den restlichen Wertsachen ihrer Familie versteckt hat, damit es den Nazis nicht in die Hände fiel.
»Danke, Daddy«, sagt sie.
Er lächelt. »Du wirst mir fehlen, Kleine. Aber wir sehen uns ja an den Wochenenden.«
»Da ich von nun an reif und verantwortungsbewusst sein sollte, darf ich wohl nicht länger darüber jammern, dass ich wegfahren muss«, sagt Jessie.
»Ja. Bitte«, erwidert David. »Und ich mache dir einen Vorschlag. Wenn ich auf die Insel komme, bummeln wir zum Sweet Shoppe, kaufen dir zwei Kugeln Malachit-Eis mit Stückchen, und dann kannst du dich nach Herzenslust über deine Großmutter beklagen. Abgemacht?«
»Abgemacht«, sagt sie, und einen kurzen Moment lang zu Beginn ihres dreizehnten Lebensjahrs ist Jessica Levin glücklich.
Born to Be Wild
Das Gespräch verläuft ungünstig, aber das ist nicht weiter ungewöhnlich, wenn sich eine junge Frau von einundzwanzig im Sommer 1969 mit ihren Eltern unterhält.
»Ich brauche Raum zum Atmen«, erklärt Kirby. »Ich brauche Luft unter meinen Schwingen. Ich bin erwachsen. Da sollte ich meine eigenen Entscheidungen treffen können.«
»Du kannst dich erwachsen nennen und deine eigenen Entscheidungen treffen, sobald du für dich selbst aufkommst«, sagt David.
»Wie gesagt«, sagt Kirby. »Ich habe einen Job gefunden. Und ich werde nicht weit weg sein. Nur eine Insel weiter.«
»Kommt überhaupt nicht infrage«, sagt Kate. »Du bist schon zweimal verhaftet worden. Verhaftet, Katharine.«
Kirby zuckt zusammen. Ihren eigentlichen Vornamen bemüht ihre Mutter nur, wenn sie streng klingen will. »Aber ich war nicht im Gefängnis.«
»Aber man hat dir eine Geldstrafe aufgebrummt«, sagt David.
»Ohne jeden Grund!«, sagt Kirby. »Es ist, als ob die Bostoner Polizei noch nie was von Versammlungsfreiheit gehört hätte.«
»Du musst irgendwas getan haben, um den Polizisten zu provozieren«, sagt David. »Etwas, das du uns verheimlichst.«
Na klar, denkt Kirby. Liegt ja auf der Hand.
»Und wir mussten deiner Großmutter etwas vorlügen«, sagt Kate. »Wenn sie herausfindet, dass du verhaftet worden bist – zweimal – wird sie …«
»Mir meinen Treuhandfonds wegnehmen?«, fragt Kirby. »Das kann sie nicht, das ist uns doch wohl allen klar.« Die Kontrolle über ihren Treuhandfonds erhält Kirby bei Abschluss ihres Studiums oder an ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag, was auch immer eher eintritt. Nur deswegen bleibt sie weiter am Simmons College eingeschrieben, es ist ihre einzige Motivation.
David seufzt. »Was ist es denn für ein Job?«
Kirby setzt ein triumphierendes Lächeln auf. »Ich werde als Zimmermädchen arbeiten, im Shiretown Inn in Edgartown.«
»Als Zimmermädchen?«, sagt Kate.
»Du kannst doch nicht mal in deinem eigenen Zimmer Ordnung halten«, sagt David.
»Jetzt übertreibst du aber«, sagt Kirby. Sie beschließt, weiter auf Eifer und Enthusiasmus zu setzen, weil sie weiß, dass das überzeugender wirkt als Wut und Empörung. »Hört zu, mir ist klar, dass ich noch nie irgendwo gearbeitet habe. Aber auch nur, weil ich meine Freizeit komplett für meine politischen Anliegen geopfert habe.«
»Wir haben unsere Freizeit für deine politischen Anliegen geopfert«, sagt Kate und verdreht unverhohlen die Augen.
»Dad meinst du wohl«, sagt Kirby. »Weißt du noch, als ich an der Highschool war? Du wolltest ja nicht mal, dass ich mit Dr. King marschiere. Ich sei zu jung, hast du zu mir gesagt!«
»Du warst ja auch noch zu jung!«, erwidert Kate.
»In Wahrheit meintest du aber was anderes. Dass ich zu weiß war«, sagt Kirby.
»Leg mir keine Worte in den Mund, junge Dame.«
»Mit Dr. King wird niemand je wieder marschieren können«, sagt Kirby. »Diese Erinnerung ist jetzt also offiziell unbezahlbar, und du hättest mich fast daran gehindert. Ich bin Miss Carter die ganze Zeit nicht von der Seite gewichen, es konnte nichts Schlimmes passieren; es war ein gewaltloser Protest, genau darum ging es doch! Die Antikriegs-Demos dieses Frühjahr waren anders, weil sich das Land inzwischen geändert hat. Studierende wie ich sind der Feind des Establishments – aber ihr solltet froh sein, dass ich meinen Verstand gebrauche und mich nicht schnöde an alles anpasse!« Kirby legt eine Pause ein. David scheint mittlerweile etwas milder gestimmt, doch ihre Mutter bleibt weiter unnachgiebig. »Ich werde mir diesen Sommer einen Job suchen, und nach dem Examen will ich Karriere machen. Bloß Ehefrau und Mutter zu sein, das genügt mir nicht. Ich möchte nicht so enden wie … Blair.«
»Nimm dich in Acht«, sagt Kate. »Mutter zu sein ist ein Segen.«
»Aber du musst doch zugeben …« Kirby bremst sich, ehe ihr etwas nicht so Nettes über ihre ältere Schwester herausrutscht. Blair und Kirby werden schon lange als die Überfliegerin und die Versagerin bezeichnet. (Gut, laut ausgesprochen hat es noch niemand, aber Kirby weiß, dass es alle denken.) Blair war die gesamte Highschool über eine Einserschülerin und ging dann ans Wellesley College, wo sie es jedes Semester auf die Bestenliste schaffte. Man verlieh ihr den Preis für herausragende Leistungen im Fachbereich Englisch, und ihre Diplomarbeit über Edith Wharton wurde von einem Gremium, dem Professoren aller sieben maßgeblichen Frauencolleges angehörten, mit einer Art Sonderauszeichnung prämiert. Blair hatte eine Stelle als Oberstufenlehrerin einer Begabtenklasse an der elitären Winsor School ergattert, eine Chance, die sich nur alle fünfzig Jahre ergab. Von dort wäre es nur ein kurzer Sprung zu einem Promotionsstudium und einer anschließenden Professur gewesen. Was bitte aber hatte Blair gemacht? Angus geheiratet, ihre Stelle gekündigt, und dann war sie schwanger geworden.
»Was soll ich zugeben?«, fragt Kate.
Dass Blair eine Enttäuschung ist, denkt Kirby. Aber das stimmt nicht. Tatsächlich ist es eher Kirby, die hinter allen Erwartungen zurückbleibt.
Kirby würde mit ihren Eltern gern Klartext reden. Ihnen beichten, dass sie die schlimmsten drei Monate ihres Lebens hinter sich hat, körperlich ebenso wie seelisch. Sie muss die Erinnerung an die Proteste austilgen, an die Festnahmen, an ihre Liebesaffäre mit Officer Scott Turbo, den Trip an den Lake Winnipesaukee. Sie hatte ein Blatt voller Luschen erwischt, mit dem sie nur verlieren konnte, bestehend aus Angst, Unbehagen, Kummer und Scham.
Sie braucht einen Neuanfang.
Sie wendet sich an David, der schon immer ein mitfühlenderer Mensch war als ihre Mutter. »In meinen Kursen am Simmons schmiere ich ab, weil sie langweilig sind. Ich möchte keine Bibliothekswissenschaften studieren, und ich möchte auch keine Vorschullehrerin werden.«
»Du möchtest Hotelzimmer putzen?«, fragt David.
»Ich möchte arbeiten«, sagt Kirby mit Nachdruck. »Und das ist nun mal der Job, den ich gefunden habe.« Hier schlägt sie die Augen nieder, weil es nicht der vollen Wahrheit entspricht.
»Auf Martha’s Vineyard kennst du keine Menschenseele«, gibt Kate zu bedenken. »Wir sind Nantucket-Leute. Du, ich, Nonny, Nonnys Mutter, Nonnys Großmutter. Du bist in fünfter Generation Nantucketerin, Katharine.«
»Genau diese Einstellung, dieses Wir-gegen-die, ist dabei, unser Land kaputt zu machen«, sagt Kirby. Als David daraufhin in Gelächter ausbricht, weiß Kirby, dass sie ihren Willen durchsetzen wird. »Den Sommer mal woanders zu verbringen wird lehrreich für mich sein. Erinnert ihr euch noch an Rajani, meine Studienfreundin? Ihre Eltern haben ein Haus in Oak Bluffs, und sie haben gesagt, dass ich bei ihnen wohnen kann.«
»Du willst den ganzen Sommer bei Rajanis Familie wohnen?«, fragt David. »Das klingt ein wenig übertrieben.« Er sieht Kate an. »Nicht wahr? Rajanis Familie sollte unsere Tochter nicht den ganzen Sommer beherbergen und beköstigen müssen.«
»Ganz recht«, sagt Kate. »Unsere Tochter sollte nach Nantucket kommen, wo sie hingehört.«
»Es gibt noch eine andere Möglichkeit, eine Pension ein paar Blocks von Rajanis Eltern entfernt, auf die ich in den Kleinanzeigen gestoßen bin. Sechs Zimmer zu vermieten, Collegestudentinnen bevorzugt. Kostenpunkt hundertfünfzig Dollar, den ganzen Sommer über.«
»Schon viel vernünftiger«, sagt David. »Wir können die Miete übernehmen, aber für deine Lebenshaltungskosten musst du selbst aufkommen.«
»Oh, danke!«, sagt Kirby.
Kate winkt mit beiden Händen ab. Sie muss sich wohl oder übel geschlagen geben.
Kirby und Rajani Patel, ihre beste Freundin vom Simmons College, fahren in Rajanis weinrotem MG Cabrio nach Woods Hole, mit offenem Verdeck. Kirby hat sich für den Sommer ein Zimmer in der Pension an der Narragansett Avenue gesichert. Sie hat ihren Eltern die Telefonnummer und den Namen der Inhaberin gegeben, Miss Alice O’Rourke.
»Ah. Dürfte wohl irisch-katholisch sein«, hat David kommentiert. »Wollen wir hoffen, dass sie ihren Laden fest im Griff hat.«
Als Rajani und Kirby im MG an der Anlegestelle in Oak Bluffs von der Fähre rollen, legt Kirby die Hände vor ihrem Herzen flach zusammen, zum Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Sie beginnt ganz allein einen neuen Lebensabschnitt, an einem Ort, der ihr gänzlich fremd ist.
Gut, okay, vielleicht nicht gänzlich fremd. Sie befindet sich noch immer auf einer Insel vor der Südküste von Cape Cod; in Luftlinie ist sie gerade mal elf Meilen von Nantucket entfernt. Sie hätte auch in die Armenviertel von Philadelphia gehen können, um den Sommer über mit benachteiligten Jugendlichen zu arbeiten. Sie könnte durchs ländliche Alabama fahren, um Wähler zu registrieren. Das hier ist also bloß ein erster Schritt, aber er wird ihr guttun.
Rajani spielt für sie Reiseführerin, was ihr sichtlich Spaß macht. »Da ist der Ocean Park.« Sie deutet auf ein ausgedehntes Rasengelände mit einem filigranen weißen Aussichtspavillon in der Mitte. »Und hier links ist das Flying Horses Carousel und das Strand Theater, da laufen richtig gute Filme.«
Kirby dreht unentwegt den Kopf hin und her, um nichts zu verpassen. Es herrscht eine ausgelassene Atmosphäre, wie auf einem Jahrmarkt; das Stadtbild ist weit bunter und lebendiger, als Kirby erwartet hätte. Sie mustert das altmodische Karussell – Rajani zufolge das älteste noch in Betrieb befindliche Karussell der Vereinigten Staaten –, ehe sie ihr Augenmerk den Leuten zuwendet, die sich auf den Bürgersteigen frittierte Muscheln schmecken lassen, aus rot-weiß karierten Pappschälchen, oder genüsslich Softeis schlecken. Rajani hat nicht zu viel versprochen, die Stadt wirkt in der Tat erfrischend vielfältig. Auf einem Einrad rollt ein schwarzer Teenager vorbei. Irgendwo spielt ein Radio, gerade läuft der Hit von Fifth Dimension: This is the dawning of the age of Aquarius. Kirby wippt im Takt der Musik mit. Auch für sie dämmert hier etwas herauf. Aber was?
»Wir wohnen in Methodist Campground«, sagt Rajani, und Kirby verzieht unwillkürlich das Gesicht – auf einem Methodisten-Campingplatz …? Camping ist ja schon schlimm genug, aber dann noch unter religiöser Fuchtel? Doch der Campground entpuppt sich als Wohnviertel voller Häuser, so farbenfroh bemalt wie Ostereier und mit verschnörkelten Zierleisten. »Das da ist meins.« Rajani deutet auf ein violettes Haus mit einem kleinen Spitzgiebel über der Haustür; die weißen Zierleisten an den Dachtraufen erinnern an Zuckerguss auf einer edlen Torte. Es ist ein putziges Häuschen wie aus einem Märchen, besonders im Vergleich zu der Architektur in der Innenstadt von Nantucket, wo jedes Haus an eine Quäker-Witwe erinnert.
»Das Blaue da ist auch nicht schlecht«, sagt Kirby. Das blaue Haus ein Stück die Straße hinunter ist ein echter Hingucker. Es ist fast doppelt so groß wie Rajanis Heim, mit einer von zwei Giebeln gekrönten malerischen Veranda mit einer Schaukelbank und grünem Farn in Hängeampeln. Der Weg durch den Vorgarten wird von blauen Hortensien gesäumt, und die Zierleisten an den Dachtraufen ringsherum erinnern ein wenig an Eiszapfen – diesen Eindruck macht es zumindest auf Kirby.
»In dem Haus wohnt mein Freund Darren«, sagt Rajani. »Er fängt im Herbst sein letztes Studienjahr in Harvard an. Sollen wir mal nachsehen, ob er da ist?«
Kirby wehrt ab. »Das müssen wir nicht.«
»Komm schon«, sagt Rajani. »Du möchtest doch neue Leute kennenlernen, oder? Ich sehe sein Auto nicht, aber vielleicht steht es in der Garage. Seine Eltern sind echt nett. Seine Mutter ist Ärztin und der Vater Richter.«
Eine Ärztin und ein Richter. Harvard. Nonny und ihre Mutter wären hocherfreut, das ist das Einzige, was Kirby durch den Kopf schießt. Sie lernt die richtige Sorte Leute kennen, ganz wie auf Nantucket, wo auch alle Richter oder Ärzte sind oder einen Lehrstuhl in Müheloser Überlegenheit an der Universität Wohlerzogen innehaben.