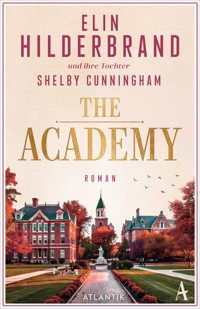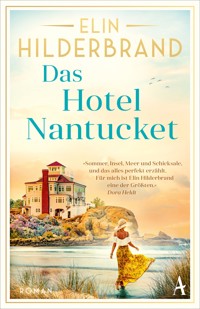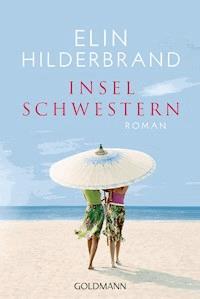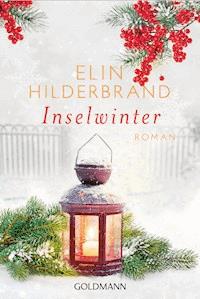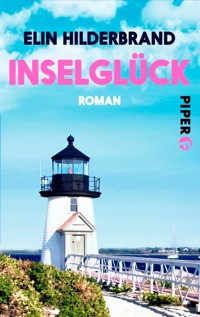
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Merediths Mann ist als größter Anlagebetrüger aller Zeiten überführt worden. Während er im Gefängnis sitzt, flüchtet sie, nur mit einer Badetasche als Gepäck, aus New York, um den Sommer mit ihrer alten Freundin Constance auf Nantucket zu verbringen. Ein paar Monate ganz ohne Männer. Doch dann steht ihre Jugendliebe Toby plötzlich vor der Tür....
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Für meine Tochter Shelby Katharine Cunningham
Mir fehlen die Attribute, dich zu beschreiben.
Anmutig? Lebhaft? Bezaubernd?
Sie alle passen, mein Liebes, und viele weitere.
Übersetzung aus dem Englischen von Almuth Carstens
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Silver Girl bei Reagan Arthur
Books/Little, Brown and Company, New York
ISBN 978-3-492-98230-6
Juli 2015
© Für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München / Berlin 2015
© 2011 Elin Hilderbrand
Für die deutsche Ausgabe
© Piper Verlag GmbH, München 2012
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: © Allan Wood Photography / Shutterstock.com
Datenkonvertierung: Greiner & Reichel, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
TEIL EINS
Meredith Martin Delinn
Sie hatten vereinbart, über nichts Bedeutsames zu sprechen, bevor Meredith sicher in dem Haus auf Nantucket angelangt war. Nun lag erst einmal der Highway vor ihnen. Meredith kannte ihn nur allzu gut. Es gab dreiundneunzig langweilige Ausfahrten in Connecticut, ehe sie Rhode Island und eine knappe Stunde später Massachusetts erreichten. Als sie die Sagamore Bridge überquerten, ging die Sonne auf und verlieh dem Cape Cod Canal einen fröhlichen rosa Schimmer, der Meredith in den Augen wehtat. Auf der Brücke herrschte kein Verkehr, obwohl heute der 1. Juli war; deshalb fuhr Connie auch so gern nachts.
Schließlich kamen sie in Hyannis an, einer Stadt, die Meredith Anfang der 1970er einmal mit ihren Eltern besucht hatte. Sie erinnerte sich, dass Deidre Martin, ihre Mutter, darauf bestanden hatte, am Grundstück der Kennedys vorbeizufahren. Es war bewacht gewesen; Bobbys Ermordung lag erst wenige Jahre zurück. Meredith erinnerte sich, dass Chick Martin, ihr Vater, sie ermuntert hatte, ein Hummersandwich zu kosten. Meredith war erst acht Jahre alt gewesen, aber Chick Martin hatte Vertrauen in ihre Kultiviertheit gehabt. Hochintelligent und begabt, pflegte Chick schamlos zu prahlen. Das Mädchen vertut sich nie. Meredith hatte den Hummersalat probiert und ausgespuckt, was ihr dann peinlich gewesen war. Ihr Vater hatte die Achseln gezuckt und das Sandwich selbst aufgegessen.
Noch nach so vielen Jahren erfüllte die Erinnerung an Hyannis Meredith mit einer Scham, die selbst jene Scham überlagerte, welche Meredith empfand, seit man Freddy Delinn, ihren Ehemann, angeklagt hatte. Hyannis war der Ort, wo Meredith ihren Vater enttäuscht hatte.
Gott sei Dank konnte er sie jetzt nicht sehen.
Obwohl sie vereinbart hatten, über nichts Bedeutsames zu sprechen, wandte sich Meredith Connie zu, die – gegen besseres Wissen – beschlossen hatte, Meredith Obdach zu gewähren, zumindest fürs Erste, und sagte: »Gott sei Dank sieht mein Vater mich jetzt nicht.«
Connie, die gerade auf den Parkplatz der Fähranlegestelle einbog, seufzte und entgegnete: »Oh, Meredith.«
Meredith konnte Connies Ton nicht deuten. Oh, Meredith, du hast recht, es ist ein Segen, dass Chick seit dreißig Jahren tot ist und deinen kometenhaften Aufstieg und noch spektakuläreren Absturz nicht miterleben musste? Oder: Oh, Meredith, hör auf, dir selbst leidzutun? Oder: Oh, Meredith, ich dachte, wir hätten vereinbart, nicht darüber zu reden, bevor wir in meinem Haus sind, wir haben Regeln aufgestellt, und du trittst sie mit Füßen?
Oder: Oh, Meredith, halt bitte den Mund?
Auf jeden Fall verbarg Connies Ton, seit sie Meredith um zwei Uhr morgens abgeholt hatte, kaum ihre … was? Wut? Angst? Bestürzung? Und konnte Meredith ihr das verübeln? Sie und Connie hatten fast drei Jahre lang nicht miteinander geredet, und in ihrem letzten Gespräch hatten sie sich abscheuliche Dinge gesagt; sie hatten das eiserne Band ihrer Freundschaft zum Schmelzen gebracht. Oder: Oh, Meredith, was habe ich getan? Warum bist du hier? Ich wollte einen ruhigen, friedlichen Sommer erleben. Und jetzt habe ich dich, Teil eines widerlichen internationalen Skandals, auf meinem Beifahrersitz.
Meredith beschloss, Connie nichts Böses zu unterstellen. »Oh, Meredith« war eine quasimitfühlende Nicht-Antwort. Connie fuhr vor zur Schranke und zeigte dem Angestellten ihr Fährticket; sie war abgelenkt. Die Sonne stand noch tief am Himmel, aber Meredith trug die Baseballkappe ihres Sohns Carver vom Choate-Internat und die einzige ihr verbliebene Sonnenbrille in ihrer Sehstärke, die zum Glück groß, rund und sehr dunkel war. Trotzdem wandte Meredith den Kopf ab. Keiner durfte sie erkennen.
Connie steuerte den Wagen die Rampe hinauf in den Laderaum der Fähre. Hier drängten sich schon Autos dicht aneinander wie Sardinen in einer Büchse. Heute, am 1. Juli, war die Stimmung an Bord selbst zu dieser frühen Stunde ausgelassen. Jeeps quollen über von Badelaken und Hibachi-Grills, der Wagen vor Connies war ein alter Wagoneer, dessen Stoßstange mindestens sechzehn Strandaufkleber in allen Farben des Regenbogens zierten. Merediths Herz war verletzt, angeknackst, gebrochen. Sie ermahnte sich, nicht an die Jungen zu denken, doch das führte erst recht dazu, dass sie an die Jungen dachte. Sie erinnerte sich, wie sie den Range Rover früher immer mit ihren Badesachen und Surftrikots und Flipflops beladen hatte, mit ihren Baseballhandschuhen und Sportschuhen, mit dem Aluminiumkoffer, der die Badmintonschläger enthielt, mit Kartenspielen und Batterien für die Taschenlampen. Meredith hatte den Hund in seinen Korb verfrachtet, Carvers Surfbrett aufs Wagendach geschnallt, und dann ging es los – tapfer hinein in den Verkehrsstau, der sich von Freeport bis nach Southampton zog. Ihr Timing war immer so schlecht, dass sie unweigerlich hinter dem städtischen Bus stecken blieben. Aber es hatte Spaß gemacht. Die Jungen wechselten sich am Radio mit der Musikauswahl ab – Leo mochte Folkrock, seine Lieblingsband waren die Counting Crows, und Carver wiederum gefiel der Krawall, bei dem der Hund zu jaulen anfing –, und Meredith hatte das Gefühl, je heißer es war und je langsamer es voranging, desto mehr steigerte sich ihre Vorfreude auf Southampton. Sonne, Sand und Meer. Schuhe aus, Fenster auf. An den Wochenenden kam Freddy, erst mit dem Wagen, später mit dem Helikopter.
Als Meredith jetzt auf die Sommergäste schaute, dachte sie: Leo! Carver! Leo. Armer Leo. All die Jahre hindurch, in denen die beiden heranwuchsen, hatte Leo sich um Carver gekümmert. Ihn beschützt, belehrt, einbezogen. Und nun war Carver derjenige, der Leo stützen, aufbauen musste. Meredith betete darum, dass er seine Aufgabe gut erledigte.
Aus dem Lautsprecher ertönte eine Stimme, die die Regeln und Vorschriften an Bord verkündete. Das Nebelhorn röhrte, und Meredith hörte fernes Händeklatschen. Die guten Seelen, die das Glück hatten, an diesem schönen Morgen nach Nantucket unterwegs zu sein, applaudierten dem Beginn ihres Sommers. Meredith indessen fühlte sich, als wäre sie noch drei Bundesstaaten von hier entfernt. Genau in diesem Moment würden Beamte des FBI Merediths Penthouse-Wohnung an der Park Avenue betreten und ihre Habe beschlagnahmen. Mit seltsamer Gleichgültigkeit fragte sie sich, wie das wohl ablaufen mochte. Für den Aufenthalt bei Connie hatte Meredith eine Reisetasche mit einfachen Sommersachen gepackt und einen Pappkarton mit persönlichen Dingen – Fotos, ihre Heiratsurkunde, die Geburtsurkunden der Jungen, ein paar ihrer Lieblingsromane, ein ganz spezielles Notizheft aus ihrem ersten Jahr in Princeton und eine Langspielplatte, die 1970er Originalpressung von Simon and Garfunkels Bridge Over Troubled Water, die sie wohl niemals wieder hören würde, doch sie hatte es nicht übers Herz gebracht, sie zurückzulassen.
Man hatte ihr erlaubt, ihre Brille mitzunehmen, eine Sonnenbrille in ihrer Sehstärke und ihren Verlobungsring, einen Vierkaräter. Der Ring war ein Erbstück von Annabeth Martin, ihrer Großmutter, also nicht mit schmutzigem Geld erworben. Dasselbe galt für die Perlenkette von Merediths Mutter, ein Geschenk zu ihrem Abschluss in Princeton, aber Meredith hatte keine Verwendung für sie. Im Gefängnis konnte sie keine Perlen tragen. Mit ein wenig Voraussicht hätte sie sie verpfänden und den Erlös der armseligen Summe hinzufügen können, die sie hinterlassen hatte.
Doch wie würde es ihrem sonstigen Besitz ergehen? Meredith stellte sich grimmige, stramme Männer in schwarzen Uniformen und mit Pistolen am Gürtel vor. Einer nahm vielleicht das zierliche Shalimar-Fläschchen von ihrer Kommode und konnte nicht anders, als den Duft einzuatmen. Einer würde das Bett abziehen. Die Bettwäsche war Tausende Dollar wert, aber was würden die Beamten damit tun? Sie waschen, bügeln, verkaufen? Sie würden ihre Hostettler-Skulptur und die Skizzen von Andrew Wyeth mitnehmen und das Calder-Mobile von der Decke im Wohnzimmer abschneiden. Sie würden ihre Schränke durchforsten und die Louboutins und Sergio Rossis einpacken sowie ihre Alltagskleider – Diane von Fürstenberg, Phillip Lim – und ihre Roben – Dior, Chanel, Carolina Herrara. Die Beamten hatten ihr erklärt, dass ihre Sachen versteigert werden und die Erträge einem Entschädigungsfonds für die geschröpften Investoren zugutekommen würden. Meredith dachte an ihr babyblaues Dior-Abendkleid, für das sie neunzehntausend Dollar bezahlt hatte – ein Gedanke, der jetzt vor Ekel einen Würgereiz in ihr auslöste –, und fragte sich, wer es als Nächste tragen würde. Eine sehr zierliche Frau – Meredith maß nur einen Meter dreiundfünfzig und wog fünfundvierzig Kilo. John Galliano persönlich hatte ihr die Robe geschneidert. Wer würde Merediths kupfernes All-Clad-Kochgeschirr bekommen (nie benutzt außer gelegentlich von Leos Freundin Anais, die es für eine Sünde hielt, dass Meredith in ihrer blitzblanken Gourmetküche nicht kochte)? Bei wem würde die Whiskeykaraffe aus geschliffenem Kristall landen, aus der Freddy sich nie einen Drink eingegossen hatte, nur an den letzten Tagen vor seiner Bloßstellung vor aller Welt? (Es war der Anblick von Freddy beim Herunterkippen von drei Gläsern eines 1926er Macallan gewesen, der Meredith alarmiert hatte. Im Geiste war eine ganze Büchse der Pandora voller Anschuldigungen vor ihr aufgesprungen. Keiner weiß, wie er es anstellt, er nennt es schwarze Magie, aber es kann nicht legal sein, er bricht das Gesetz, man wird ihn erwischen.)
Meredith wusste, dass es die Beamten am meisten interessieren würde, was sie in Freddys Arbeitszimmer finden würden. Die Tür dazu hatte Freddy immer abgeschlossen, eine Praxis, die er sich angewöhnte, als die Kinder klein waren und er sich von ihnen nicht beim Telefonieren stören lassen wollte, später jedoch fortsetzte. Die Tür war verschlossen geblieben – ob er sich im Arbeitszimmer aufhielt oder nicht –, sogar für Meredith. Wenn sie eintreten wollte, musste sie anklopfen. Das hatte sie auch bei ihrer Vernehmung ausgesagt, aber man glaubte ihr nicht. Ihre Fingerabdrücke befanden sich auf dem Türknauf. Und auch auf einer illegalen Transaktion wurden (im übertragenen Sinne) ihre Fingerabdrücke entdeckt. Zwei Tage vor dem Zusammenbruch von Delinn Enterprises hatte Meredith aus dem »Schmiergeldfonds« der Firma fünfzehn Millionen Dollar auf Freddys und ihr gemeinsames Privatkonto überwiesen.
Auch Freddys Bibliothek würden die Polizisten große Beachtung schenken. Hinter der »Herrenzimmer«-Optik mit Regalen voller Bücher über Finanzwirtschaft, den antiken Spardosen und Baseballkinkerlitzchen aus Babe Ruths Zeit bei den Yankees steckte Samantha Deuce, ihre Innenausstatterin. Freddy war nicht einmal Yankees-Fan, aber Samantha hatte ihn mit Babe Ruth verglichen und gesagt, beide seien männliche Ikonen ihrer Ära. Männliche Ikonen ihrer Ära. Meredith hatte Samantha damals für eine Meisterin der Übertreibung gehalten.
Freddy war in seiner Bibliothek fast immer allein gewesen. Meredith konnte sich kaum daran erinnern, dass sich jemand anders in den tiefen Wildlederclubsesseln entspannt oder vor dem Zweiundfünfzig-Zoll-Fernseher gesessen hatte. Die Jungen hatten sich nicht gern in dem Raum aufgehalten; sogar die Baseballspiele sahen sie lieber mit Meredith in der Küche. Auch eine versteckte Dartscheibe befand sich in der Bibliothek, die, da war Meredith sicher, nie benutzt worden war; die Pfeile steckten noch in der Luftpolsterfolie.
Die einzige Person außer Freddy, die Meredith jemals im Herrenzimmer gesehen hatte, war Samantha. Sie hatte die beiden vor ein paar Jahren dort angetroffen, als sie nebeneinanderstanden und eine Jagdszene bewunderten, die Samantha bei Christie’s erworben hatte. (Die Wahl dieses Bildes entbehrte nicht einer gewissen Ironie, denn Freddy jagte nicht und hasste Schusswaffen: Sein Bruder war bei einer Wehrübung der Armee durch eine verirrte Kugel zu Tode gekommen.) Freddys Hand lag auf Samanthas Kreuz. Als Meredith eintrat, riss Freddy seine Hand so schnell weg, dass er damit erst ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkte, Samantha überhaupt berührt zu haben. Meredith dachte oft an diesen Augenblick. Freddys Hand auf Samanthas Rücken: keine große Sache, oder? Samantha war seit Jahren ihre Innenausstatterin. Freddy und Samantha waren befreundet, mochten sich. Wenn er seine Hand einfach hätte liegen lassen, hätte Meredith sich nichts dabei gedacht. Es war sein Erschrecken, das sie nachdenklich machte. Freddy erschrak nie.
Die Fähre legte ab. Connie hatte ihren grünen Escalade zwischen einen Lieferwagen und einen schwarzen Range Rover geklemmt, nicht unähnlich jenem, mit dem Meredith immer in die Hamptons gefahren war. Connie stieg aus und knallte die Tür zu.
Meredith geriet in Panik. »Wo willst du hin?«, fragte sie.
Connie antwortete nicht. Sie öffnete die Heckklappe des Escalade, kletterte hinein, kramte nach einem Kissen und legte sich damit auf den Rücksitz.
»Ich bin müde«, sagte sie.
»Natürlich«, sagte Meredith. Connie hatte ihr Haus am Abend zuvor um acht Uhr verlassen, knappe vier Stunden nachdem Meredith angerufen hatte. Sie war sechs Stunden nach Manhattan gefahren und hatte in der dunklen Gasse hinter 824 Park Avenue im Auto auf Meredith gewartet. Hinter den Mülltonnen hatte ein Reporter gestanden, aber er rauchte eine Zigarette, und so war seine Kamera erst einsatzbereit, als Meredith schon im Wagen saß und Connie mit quietschenden Reifen auf die Straße zurücksetzte wie ein Bankräuber im Film. Meredith duckte sich unters Armaturenbrett.
»Mein Gott, Meredith«, sagte Connie. »Hast du die Meute vorm Haus gesehen?«
Meredith wusste, dass es dort von Reportern, Scheinwerfern und Übertragungswagen wimmelte. Sie waren an dem Tag gekommen, an dem Freddy mit Handschellen aus dem Apartment geleitet wurde, dann wieder an dem Morgen, an dem Meredith aufbrach, um Freddy im Gefängnis zu besuchen, und ein drittes Mal vor zwei Tagen, als sie darauf warteten, dass FBI-Beamte Meredith aus dem Gebäude wiesen. Was die Öffentlichkeit wissen wollte, war Folgendes: Wohin wendet sich die Ehefrau des größten Finanzverbrechers der Geschichte, wenn sie aus ihrem Penthouse an der Park Avenue vertrieben wird?
Meredith hatte zwei Anwälte. Der eine hieß Burton Penn und forderte sie auf, ihn Burt zu nennen. Er war neu. Freddy hatte ihren langjährigen Familienanwalt Richard Cassel für sich beansprucht. Verdammter Freddy, der sich den Besten schnappte und Meredith mit dem frühzeitig glatzköpfigen sechsunddreißigjährigen Burton Penn abspeiste. Obwohl er immerhin in Yale studiert hatte.
Der andere Anwalt war noch jünger und hatte dunkle, struppige Haare und spitze Schneidezähne wie einer von diesen Teenager-Vampiren. Er trug eine Brille und hatte Meredith beiläufig erzählt, er habe einen Astigmatismus. Ich auch, hatte Meredith gesagt, die eine Hornbrille trug, seit sie dreizehn war. Dieser zweite Anwalt war ihr sympathischer. Er hieß Devon Kasper und bat sie, ihn Dev zu nennen. Dev sagte Meredith die Wahrheit, klang dabei jedoch stets bekümmert. Er hatte bekümmert geklungen, als er ihr erklärt hatte, dass gegen sie ermittelt würde, weil sie die fünfzehn Millionen auf ihr Privatkonto überwiesen hatte, und dass sie möglicherweise der Mittäterschaft angeklagt werden und im Gefängnis landen würde. Er hatte bekümmert geklungen, als er Meredith erzählt hatte, gegen ihren Sohn Leo werde ebenfalls ermittelt, weil er mit Freddy bei Delinn Enterprises gearbeitet hatte.
Leo war sechsundzwanzig und für die legal operierende Wertpapierabteilung von Delinn Enterprises tätig gewesen.
Warum also ermittelte das FBI gegen ihn? Meredith verstand es nicht und versuchte, nicht in Panik zu geraten, denn Panik würde ihr nicht helfen, aber Leo war ihr Kind. Er war ihr verantwortungsbewusster Sohn, der es nach Dartmouth geschafft hatte und dort Kapitän des Lacrosse-Teams und Vizepräsident der lokalen Abteilung von Amnesty International gewesen war. Er war derjenige, der eine feste Freundin hatte, der, soweit Meredith wusste, noch nie das Gesetz übertreten, nie auch nur ein Päckchen Kaugummi geklaut, als Minderjähriger Alkohol getrunken, einen Strafzettel wegen Falschparkens bekommen hatte.
»Warum ermitteln sie gegen Leo?«, hatte Meredith gefragt, während ihr verletztes Herz raste. Sie spürte die Gefahr, als sei ihr Kind ein Dreijähriger, der einfach auf die Straße rannte.
Na ja, meinte Dev, gegen Leo werde ermittelt, weil ein anderer Broker – ein angesehener, seit zehn Jahren in der legal operierenden Etage ansässiger Kollege namens Deacon Rapp – der Börsenaufsicht und dem FBI erklärt hatte, Leo sei in das Schneeballsystem seines Vaters verstrickt gewesen. Deacon sagte aus, es habe »ständigen Kontakt« zwischen Leo und dem sechzehnten Stock, der Spitze dieses Schneeballsystems, gegeben. Freddy hatte dort ein kleines Büro sowie eine Sekretärin gehabt. Das war ein Schock für Meredith. Sie hatte von der Existenz des sechzehnten Stocks oder der Sekretärin, einer gewissen Edith Misurelli, nichts gewusst. Die Polizei konnte Mrs Misurelli nicht befragen, weil ihr anscheinend noch Monate Urlaub zustanden und sie am Vortag der Offenbarung des Skandals nach Italien abgereist war. Keiner wusste, wie man sie erreichen konnte.
Besonders bekümmert klang Dev, als er Meredith sagte, sie dürfe absolut keine Verbindung mit ihren Söhnen aufnehmen, bevor die Ermittlung abgeschlossen sei. Jedes Gespräch zwischen Leo und Meredith könne als Hinweis auf ihre beiderseitige Mittäterschaft gewertet werden. Und da Carver und Leo zusammen in einem alten viktorianischen Haus in Greenwich lebten, das Carver renovierte, durfte Meredith auch ihn nicht anrufen. Burt und Dev hatten sich mit Leos Anwalt getroffen, und alle drei hatten befunden, dass das Risiko einer gegenseitigen Kontamination zu groß sei. Meredith solle auf der einen Seite des Zauns bleiben, die Jungen auf der anderen. Jedenfalls fürs Erste.
»Es tut mir leid, Meredith.«
Das sagte Dev oft.
Meredith warf einen Blick auf Connie, die ihre lange, schlanke Figur auf den Rücksitz gezwängt hatte. Ihr Kopf war in das Kissen gedrückt, die rotblonden Haare fielen ihr ins Gesicht, und sie hatte die Augen geschlossen. Sie erschien Meredith älter und trauriger – Wolf, ihr Ehemann, war vor zwei Jahren an einem Gehirntumor gestorben –, aber sie war immer noch Connie, Constance Flute, geborene O’Brien, Merediths älteste und ehemals beste Freundin, ihre Freundin seit Ewigkeiten.
Meredith hatte Connie angerufen, um sie zu fragen, ob sie »eine Zeit lang« bei ihr in Bethesda wohnen könne. Connie war der Bitte kunstvoll ausgewichen, indem sie erklärte, sie werde den Sommer auf Nantucket verbringen. Natürlich, Nantucket. Der Juli stand vor der Tür – eine Tatsache, die Meredith, so gut wie eingesperrt in ihrem Apartment, tatsächlich entgangen war –, und ihre Hoffnung sank.
»Kannst du nicht jemand anderen anrufen?«, fragte Connie.
»Es gibt niemand anderen«, sagte Meredith, und zwar nicht, um Connies Mitleid zu erwecken, sondern weil es stimmte. Es erstaunte sie, wie allein sie war, wie verlassen von allen, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt hatten. Connie war ihr einziger Rettungsanker. Obwohl sie seit drei Jahren nicht miteinander gesprochen hatten, war sie für Meredith das, was einer Verwandten am nächsten kam.
»Du könntest dich an die Kirche wenden«, sagte Connie. »Geh in ein Kloster.«
Ein Kloster, ja. Das hatte Meredith auch schon erwogen, als sie nach Optionen suchte. Draußen auf Long Island, da war sie sich sicher, gab es Klöster; sie und die Jungen waren auf ihrem Weg in die Hamptons immer an einem vorbeigefahren, das abseits des Highways in der Hügellandschaft lag. Sie würde als Novizin anfangen und Fußböden schrubben, bis ihre Knie bluteten, doch irgendwann würde sie vielleicht unterrichten dürfen.
»Meredith«, sagte Connie. »Das war ein Witz.«
»Ach so«, sagte Meredith. Natürlich hatte Connie das nicht ernst gemeint. Sie und Meredith hatten ihre ganze Kindheit hindurch katholische Schulen besucht, doch Connie war nie sonderlich fromm gewesen.
»Ich könnte dich auf dem Weg abholen«, sagte Connie.
»Und was tun?«, fragte Meredith. »Mich nach Nantucket mitnehmen?«
»Du schuldest mir einen Besuch. Den schuldest du mir seit 1982.«
Meredith lachte. Es klang seltsam in ihren Ohren, dieses Lachen. So lange war es her.
»Du könntest ein paar Wochen bleiben«, sagte Connie. »Vielleicht länger. Mal sehen, wie es läuft. Ich kann nichts versprechen.«
»Danke«, flüsterte Meredith, schwach vor Erleichterung.
»Dir ist doch klar, dass du mich seit drei Jahren nicht angerufen hast«, sagte Connie.
Ja, das war Meredith klar. Was Connie eigentlich meinte, war: Du hast nie angerufen, um dich für das zu entschuldigen, was du über Wolf gesagt hast, oder um mir persönlich zu kondolieren. Aber jetzt rufst du an, wo du im Schlamassel steckst und sonst niemanden hast.
»Es tut mir leid«, sagte Meredith. Sie sagte nicht: Du hast mich auch nicht angerufen. Du hast dich nie dafür entschuldigt, dass du Freddy einen Verbrecher genannt hast. Jetzt bestand dafür natürlich keine Notwendigkeit mehr. Wie sich herausgestellt hatte, hatte Connie recht gehabt: Freddy war ein Verbrecher. »Holst du mich trotzdem ab?«
»Ich hole dich ab«, sagte Connie.
Jetzt hätte Meredith Connie am liebsten geweckt und sie gefragt: Kannst du mir bitte verzeihen, was ich gesagt habe? Können wir uns nicht wieder vertragen?
Meredith fragte sich, was die Polizisten wohl von dem Spiegel hielten, den sie im großen Badezimmer zerschlagen hatte. In einem Wutanfall hatte sie ihren Becher mit Pfefferminztee dagegengeworfen und das Krachen und Zerspringen des Glases genossen. Ihr Gesicht war vor ihren Augen zersplittert und auf die granitene Ablage und in Freddys Waschbecken gefallen. Verdammter Freddy, dachte Meredith zum eintausendsten Mal. Die Fähre schaukelte auf den Wellen, und ihr fielen die Augen zu. Wenn die Beamten unter ihren schwarzen Uniformen schlagende Herzen hatten, würden sie sie wohl verstehen.
Constance O’Brien Flute
Sie hatten vereinbart, über nichts Bedeutsames zu sprechen, bevor Meredith sicher in dem Haus auf Nantucket angelangt war. Connie brauchte Zeit, um zu verdauen, was sie getan hatte. Was habe ich getan? Auf dem Weg von Bethesda nach Manhattan hatte sie sechs Stunden Zeit, sich das wiederholt zu fragen. Es herrschte kaum Verkehr; Connie lauschte im Autoradio der Sendung von Delilah. Die herzzerreißenden Geschichten der Anrufer gaben ihr Auftrieb. Connie wusste, was Verlust war. Wolf war seit zweieinhalb Jahren tot, und sie wartete immer noch darauf, dass der Schmerz nachließ. Fast ebenso lange hatte sie nicht mehr mit ihrer Tochter Ashlyn gesprochen, obwohl Connie sie jeden Sonntag auf dem Handy anrief in der Hoffnung, sie würde sich irgendwann melden. Zum Geburtstag schickte Connie ihr Blumen und zu Weihnachten einen Geschenkgutschein von J. Crew. Zerriss Ashlyn ihn, warf sie die Blumen in den Mülleimer? Connie hatte keine Ahnung.
Und jetzt hatte sie eingewilligt, nach Manhattan zu fahren und Meredith Delinn abzuholen, ihre ehemalige beste Freundin. Connie nannte sie bei sich »ehemalig«, aber im tiefsten Innern wusste sie, dass die Verbindung zwischen ihr und Meredith nie abreißen würde. Sie waren beide im Speckgürtel von Philadelphia aufgewachsen, hatten in den 1960ern gemeinsam die Grundschule besucht und dann an der Merion Mercy Academy die Highschool absolviert. Sie hatten sich nahegestanden wie Schwestern. Als Teenager waren Meredith und Connies Bruder Toby zwei Jahre lang ein Paar gewesen.
Connie tastete nach ihrem Handy, das in einem Fach des Armaturenbretts lag. Sie erwog, Toby anzurufen und ihm zu erzählen, was sie vorhatte. Er war der einzige Mensch, der Meredith ebenso lange kannte wie sie; er war der Einzige, der sie vielleicht verstehen würde. Doch die Geschichte von Toby und Meredith war kompliziert. Toby hatte Meredith in ihrer Jugend das Herz gebrochen, und im Laufe der Jahre hatte Meredith Connie immer wieder nach ihm gefragt, wie es eine Frau tut, wenn es um ihre erste große Liebe geht. Connie war diejenige gewesen, die Meredith von Tobys Reisen um die Welt als Skipper von Luxusyachten erzählt hatte, von seinem unsoliden Lebenswandel, der ihn zweimal in Entzugskliniken brachte, von den Frauen, die er kennenlernte, heiratete und verließ, und von seinem zehnjährigen Sohn, der bestimmt genauso ein Prachtstück und Charmeur und Herzensbrecher werden würde wie sein Vater. Soweit Connie wusste, hatten Meredith und Toby sich seit Veronicas Beerdigung vor sechs Jahren nicht gesehen. Bei dieser Beerdigung war etwas zwischen ihnen vorgefallen, das dazu führte, dass Meredith noch vor dem Empfang in ihren Wagen stieg und abfuhr.
»Ich halte es nicht aus in seiner Gegenwart«, hatte Meredith später zu Connie gesagt. »Es tut zu weh.«
Connie hatte sich nicht getraut, sie zu fragen, was genau passiert war. Jetzt beschloss sie jedenfalls, Toby nicht anzurufen, so verlockend es auch war.
Connie hatte Meredith im April auf CNN gesehen, an dem Tag, an dem sie zu Freddy ins Gefängnis gefahren war. Meredith hatte verhärmt ausgesehen, grau, ganz anders als die blonde, Dior tragende Dame der Gesellschaft, die Connie noch vor kurzem aus den Klatschspalten der New York Times angelächelt hatte. Sie hatte Jeans und eine weiße Hemdbluse und einen Trenchcoat angehabt und sich in ein Taxi geduckt, aber ein Reporter erwischte sie, bevor sie die Tür schloss, und fragte: »Mrs Delinn, weinen Sie je über das, was sich ereignet hat?«
Meredith schaute auf, und Connie traf ein Blitz der Erinnerung. Dieser Gesichtsausdruck, der gereizte Munterkeit widerspiegelte, zeigte die Meredith, die Connie aus der Highschool kannte – die kampflustige Hockeyspielerin, die Turnierturmspringerin, die Stipendiatin.
»Nein«, sagte Meredith.
Und Connie dachte: Oh Meredith, falsche Antwort.
In den nächsten Tagen hatte sie Meredith anrufen wollen. Die Presse war brutal gewesen. (Die Schlagzeile der New York Post lautete: JESUS WEINTE, NICHT ABER MRS DELINN.) Connie hatte auf sie zugehen und ihr Unterstützung anbieten wollen, das Telefon jedoch nicht angerührt. Sie war immer noch verbittert, weil Meredith zugelassen hatte, dass Geld ihre Freundschaft zerstörte, und außerdem zu sehr in ihrer eigenen Melancholie gefangen, um sich der Probleme Merediths anzunehmen.
In People hatte Connie ein Foto gesehen, auf dem Meredith aus einem ihrer Penthouse-Fenster spähte. Die Bildunterschrift lautete: Bei Tagesanbruch schaut Meredith Delinn auf eine Welt, in der sie nicht mehr erwünscht ist.
Die Paparazzi hatten sie im Morgengrauen im Nachthemd erwischt. Arme Meredith! Wieder erwog Connie, anzurufen, tat es aber nicht.
Dann sah sie auf der ersten Seite des Teils »Lifestyle« der New York Times einen Artikel mit dem Titel »Die einsamste Frau von New York«. Er berichtete von Merediths Abfuhr im Salon Pascal Blanc, wo sie sich seit fünfzehn Jahren die Haare färben ließ. Meredith habe dort wochenlang telefonisch einen Termin vereinbaren wollen, sei aber immer wieder von der Rezeptionistin abgewimmelt worden. Schließlich habe Jean-Pierre, der Besitzer des Salons, Meredith zurückgerufen und erklärt, er könne es nicht riskieren, seine anderen Kunden, von denen viele ehemalige Delinn-Investoren seien, durch Merediths Anwesenheit vor den Kopf zu stoßen. In dem Artikel stand weiterhin, Meredith habe um einen Termin nach Geschäftsschluss gebeten, und er habe abgelehnt. Und als Meredith fragte, ob die Mitarbeiterin, die ihr normalerweise das Haar färbte, zu ihr in die Wohnung kommen könne – Meredith würde bar bezahlen –, habe Jean-Pierre verneint. Außerdem hieß es, auch im Rinaldo’s, dem italienischen Restaurant, wo sie und Freddy acht Jahre lang mindestens zweimal wöchentlich diniert hatten, sei Meredith nicht mehr willkommen. »Sie haben immer am selben Tisch gesessen«, wurde Dante Rinaldo zitiert. »Mrs Delinn bestellte ein Glas Chianti von Ruffino, Mr Delinn dagegen hat nie etwas getrunken. Jetzt kann ich Mrs Delinn nicht mehr bewirten, sonst bleiben meine anderen Gäste weg.« Der Bericht machte eines sonnenklar: Ganz New York hasste Meredith, und falls sie sich in der Öffentlichkeit zeigte, würde man sie schneiden.
Schrecklich, dachte Connie. Arme Meredith. Nach der Lektüre des Artikels griff sie zum Telefon und wählte mit tauben Fingern die Nummer von Merediths Apartment. Prompt wurde sie informiert, dass die Nummer geändert worden und jetzt geheim sei.
Natürlich.
Connie legte auf und dachte: Ich habe es versucht.
Und dann, gestern um ein Uhr, hatte Connie auf FOX Nachrichten gesehen, während sie ihre Koffer für Nantucket packte. Es war der Tag von Freddys Verurteilung. Die Sprecher sagten eine Haftstrafe von fünfundzwanzig bis dreißig Jahren voraus, obwohl Tucker Carlson erwähnte, wie clever und erfahren Freddys Anwalt sei.
»Richard Cassel, sein Verteidiger«, sagte er, »hat auf siebzehn Jahre plädiert, woraus bei guter Führung zwölf Jahre werden könnten.«
Und Connie dachte: Richard Cassel! Ha! Mit Richard Cassel hatte sie Bier getrunken, als sie in Princeton bei Meredith zu Besuch gewesen war. Richard, der in seinem Hemd mit dem durchgescheuerten Kragen und den abgetragenen Slippers den lässigen Aristokraten gab, hatte versucht, sie in seine Wohnung zu locken, aber vergeblich. Hatte Meredith Connie nicht erzählt, dass Richard bei einem Examen geschummelt hatte? Er war der passende Anwalt für Freddy.
Connies Erinnerungen an Richard Cassel wurden unterbrochen durch die Bekanntgabe, dass Frederick Xavier Delinn zu hundertfünfzig Jahren in einem Bundesgefängnis verurteilt worden war.
Connie musste sich setzen. Hundertfünfzig Jahre?, dachte sie. Der Richter statuiert ein Exempel an ihm. Nun ja, sie sagte es ungern, aber Freddy hatte es verdient. So viele Menschen waren durch ihn mittellos, Leben zerstört, Häuser, in denen Familien wohnten, zwangsversteigert worden, junge Leute gezwungen gewesen, das College zu verlassen. Achtzigjährige Frauen mussten sich seinetwegen jetzt mit Sozialhilfe durchschlagen und von Konserven ernähren. Hundertfünfzig Jahre, dachte Connie. Arme Meredith.
Connie war Meredith aus ihren ganz eigenen Gründen böse, doch im Gegensatz zu allen anderen gab sie ihr keine Mitschuld an Freddys Verbrechen. Meredith hatte bestimmt nichts von seinem Treiben gewusst. (Oder? Okay, Raum für Zweifel war immer.) Aber als Connie die Augen schloss und in ihrem Innern nach einer Antwort suchte, dachte sie: Unvorstellbar, dass Meredith Bescheid gewusst hat. Meredith würde Betrug nie akzeptieren. Sie war grundanständig. Connie konnte davon ein Lied singen: Es hatte sie früher wahnsinnig gemacht. Und trotzdem fragte sie sich wie der Rest der Welt: Wie konnte es sein, dass sie nichts bemerkt hatte? Meredith war eine intelligente Frau – sie hatte bei der Schulabschlussfeier an der renommierten Merion Mercy Academy die Begrüßungsrede gehalten, war in Princeton gewesen. Wie hatte sie blind sein können für die Verbrechen, die unter ihrem Dach geschahen? Also hatte sie Bescheid gewusst. Aber nein, das war unmöglich.
Connie hatte gerade noch rechtzeitig die Augen geöffnet, um zu sehen, wie Freddy, der ausgemergelt und kränklich wirkte und einen schlecht sitzenden Anzug trug, vom Gerichtsgebäude zurück in sein Verlies geführt wurde.
Du Mistkerl, dachte sie.
Und wenige Stunden später hatte das Telefon geklingelt. Das Display meldete UNBEKANNT, was immer Hoffnung in Connie weckte, weil hinter jeder unidentifizierten Nummer ein Anruf von Ashlyn stecken konnte.
Connie nahm ab. »Hallo?«
»Connie? Con?« Es war eine Frauenstimme, sehr vertraut, obwohl Connie sie zunächst nicht erkannte. Es war nicht ihre Tochter, nicht Ashlyn, deshalb verspürte sie erst einmal einen Stich der Enttäuschung, bevor ihr klar wurde … dass die Frau Meredith war.
»Meredith?«, fragte Connie.
»Gott sei Dank hast du abgenommen«, sagte Meredith.
Was hatte sie getan? Warum hatte sie eingewilligt? Die Wahrheit war, dass Connie sich seit Monaten in Gedanken mit Meredith beschäftigte, dass Meredith ihr leidtat, dass Meredith ihr nähergestanden hatte als jede andere Frau in ihrem Leben – ihre eigene Mutter, ihre eigene Tochter eingeschlossen. Die Wahrheit war, dass Connie sich einsam fühlte. Sie sehnte sich nach einem vertrauten Menschen in ihrer Nähe, nach jemandem, der sie kannte, sie verstand. Die Wahrheit war, dass Connie nicht wusste, wieso sie eingewilligt hatte, aber das hatte sie nun einmal.
Connie war erschrocken, als sie die Menge von Reportern vor Merediths Apartmentgebäude sah. Fast wäre sie weitergefahren, doch sie wusste, dass Meredith hinter dem Haus auf sie wartete, und sie im Stich zu lassen, wäre grausam gewesen.
Als Connie vorfuhr, kam Meredith von der Hintertür zum Wagen gerannt und sprang hinein. Sie trug dieselbe weiße Hemdbluse, dieselben Jeans und flachen Schuhe, in denen Connie sie vor Monaten vor ihrem Besuch bei Freddy auf der Mattscheibe gesehen hatte. Connie wartete kaum darauf, dass Meredith die Tür zuknallte, ehe sie zurücksetzte. Aus dem Nichts tauchte ein Fotograf auf und machte einen Schnappschuss von dem abfahrenden Auto, aber Meredith hatte den Kopf unten. Connie raste die Park Avenue hinauf, fühlte sich jedoch erst sicher, als sie den Franklin D. Roosevelt Drive hinter sich hatten und auf der I-95 waren. Jetzt war Meredith bereit zu sprechen, aber Connie hob die Hand und sagte: »Lass uns erst reden, wenn wir in meinem Haus auf Nantucket sind.«
Obwohl es natürlich einiges gab, das sie wissen wollte.
Als über den Lautsprecher verkündet wurde, die Fähre laufe jetzt in den Hafen von Nantucket ein, wurde Connie mit einem Ruck wach. Meredith saß vorn, und zwei dampfende Becher Kaffee – mild, mit Zucker – standen in der Konsole. Connie und Meredith tranken ihren Kaffee beide so, eine Vorliebe, die sie hegten, seit sie sechs waren, seit Merediths Großmutter Annabeth Martin den kleinen Mädchen aus einer silbernen Kanne unorthodoxerweise Kaffee serviert hatte.
Meredith trug Baseballkappe und Sonnenbrille. Als sie sah, dass Connie wach war, sagte sie: »Ich habe Kaffee geholt. Ein Typ in der Schlange hat mich angestarrt, aber er war Ausländer, glaube ich. Jedenfalls hat er Russisch gesprochen.«
»Ich will dir ja nicht deine Illusionen nehmen …«, sagte Connie.
»Glaub mir, ich habe keine Illusionen.«
»Du wirst sehr vorsichtig sein müssen. Keiner darf wissen, dass du bei mir bist. Kein Russe, kein Schwede, niemand.«
»Bis auf meine Anwälte.« Meredith trank einen Schluck von ihrem Kaffee. »Sie müssen wissen, wo ich bin. Weil noch gegen mich ermittelt wird. Gegen mich und Leo.«
»Oh, Meredith«, sagte Connie. Sie war sowohl besorgt als auch verärgert. Das hätte Meredith ihr erzählen müssen, ehe sie Connie bat, sie abzuholen, oder? Hätte das einen Sinneswandel bei Connie bewirkt? Und der arme Leo, ihr Patenkind, einer der großartigsten Jungen, die sie kannte – warum ermittelte man gegen ihn? Connie unterließ es, das Naheliegende zu fragen: Haben sie etwas gegen dich in der Hand? Werde ich damit auch zu einer Art Komplizin? Stattdessen sagte sie: »Ich hätte gestern Nacht fast Toby angerufen und ihm erzählt, dass ich dich hierher mitnehme.«
»Toby?«
»Ja, Toby.«
»Macht es dir was aus, wenn ich dich frage, wo er ist?«
Connie holte tief Luft. »Er ist in Annapolis«, sagte sie. »Er hat ein Segelboot, das er im Sommer sehr erfolgreich verchartert. Im Winter … na ja, da gondelt er durch die Karibik.«
»Und schläft auf Saint Barth mit Models, die halb so alt sind wie er.«
Connie wusste nicht recht, ob Meredith neckisch war oder verbittert. Sie entschied sich für neckisch. »Ich bin sicher, das stimmt«, sagte sie. »Er ist nie richtig erwachsen geworden. Aber das lieben wir ja auch so an ihm, oder?«
Meredith blökte. Ha. Connie verspürte wieder die Zwiespältigkeit, die die Beziehung zwischen Meredith und Toby früher in ihr ausgelöst hatte. Zum einen Eifersucht – sobald Meredith sich in Toby verliebt hatte, war er ihr weitaus wichtiger geworden, als Connie es ihr war; zum anderen Schuldbewusstsein, weil Toby Merediths Gefühle so gnadenlos verletzt hatte. Und sie konnte kaum fassen, dass Meredith sich nach all den Jahren immer noch für ihn interessierte. Selbst als sie schon längst mit Freddy verheiratet und mit ihren zwanzig Wohnsitzen und ihrer Rolls-Royce-Flotte und dem Privatjet absurd reich war, erkundigte sie sich noch: Wie geht es Toby? Ist er noch verheiratet? Hat er eine Freundin? Fragt er je nach mir?
»Pass auf«, sagte Connie. Es war seltsam, Meredith hier so neben sich zu haben. Es gab eine so lange gemeinsame Geschichte – Jahre und Jahre und Jahre, und in etlichen dieser Jahre waren sie jeden Tag zusammen gewesen –, und doch hatte sich so vieles verändert. »Ich weiß, dass du sonst nirgendwo hinkannst. Aber womöglich klappt unser Arrangement nicht. Vielleicht bin ich unglücklich, bist du unglücklich, schaffen wir es nicht, unsere Freundschaft zu reparieren. Dass gegen dich ermittelt wird, darf nicht heißen, dass ich da mit reingezogen werde. Verstehst du? Wenn irgendwas passiert, das mir gegen den Strich geht, musst du abreisen. Dann musst du deinen eigenen Weg finden.«
Meredith nickte feierlich, und Connie hasste sich für ihre schroffen Worte.
»Aber ich will es versuchen«, fuhr sie fort. »Ich möchte dir Gelegenheit geben, zur Ruhe zu kommen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, und das ist keine reine Selbstlosigkeit, Meredith. Ich bin auch einsam. Seit Wolfs Tod fühle ich mich nur noch einsam. Ashlyn hat sich von mir entfremdet. Wir sprechen nicht mehr miteinander. Auf seiner Beerdigung hat es ein Missverständnis gegeben.« Connie schüttelte den Kopf. Sie mochte gar nicht daran denken. »Sie hat keine Ahnung, wie grausam sie ist. Das wird sie erst begreifen, wenn sie selbst Kinder hat.«
»Tut mir leid«, sagte Meredith. »Falls es dir hilft: Ich darf zu beiden Jungs keinen Kontakt aufnehmen, solange die Ermittlungen laufen. Und Freddy ist zwar nicht gestorben, aber er könnte ebenso gut tot sein.«
Es gab also eine gewisse Symmetrie, doch Connie hatte keine Lust, ihre Situationen miteinander zu vergleichen und zu entscheiden, welche schlimmer war. Zum Glück setzten sich in diesem Moment die Autos vor ihr in Bewegung, und Connie folgte ihnen in ihrem Escalade an Land. Dabei wurde in der Morgensonne das Panorama von Nantucket sichtbar: blauer Himmel, graue Holzschindelhäuser, der Uhrenturm der unitarischen Kirche mit seiner goldenen Kuppel. Meredith war Eigentümerin von Häusern in den elegantesten Orten gewesen – vor ihrem Zerwürfnis hatte Connie sie in Palm Beach und am Cap d’Antibes besucht, doch für Connie blieb der Anblick von Nantucket Island der atemberaubendste der Welt.
»Wow«, flüsterte Meredith.
»Duck dich«, empfahl Connie. »Für alle Fälle.«
Es waren keine Kameras zu sehen, keine Übertragungswagen, keine Reporter – nur das für die Insel typische entspannte Treiben an einem Freitagmorgen Anfang Juli. Auf dem Steamship Wharf und am »Strip« liefen wie üblich Touristen und Einheimische herum, die sich Sandwiches für den Strand holten, Fahrräder mieteten oder ihre Surfbretter wachsen ließen. Connie fuhr am Nantucket Whaling Museum vorbei. Wolf hatte dieses Museum geliebt, sich generell für die Seefahrt interessiert und alle Bücher von Nathaniel Philbrick und Patrick O’Brian gelesen. Das Land auf Nantucket war seit Generationen im Besitz seiner Familie gewesen, und als Connie und Wolf das Geld dafür angespart hatten, ließen sie das einfache Cottage, das auf dem über zwölftausend Quadratmeter großen Strandgrundstück stand, abreißen und ein richtiges Haus bauen.
Es befand sich im Hinterland der Insel, in Tom Nevers. Wenn Wolf und Connie auf den Partys der reichen Sommergäste erwähnten, dass sie dort lebten, sagten die Leute: »Wirklich? So weit draußen?«
Es stimmte, dass Tom Nevers nach hiesigen Maßstäben »weit draußen« lag. Man erreichte es erst nach einer fast zehn Kilometer langen Fahrt über die Milestone Road, und es war weder so malerisch wie das Dörfchen Sconset noch so schick wie die Gegend am Hafen. Es gab hier keine Restaurants und keine Einkaufsmöglichkeiten; für Kaffee und die Zeitung musste Connie sich nach Sconset bemühen. Da Tom Nevers im Südosten lag, war es häufig in Nebel gehüllt, auch wenn über dem Rest der Insel die Sonne schien. Doch Connie liebte den Frieden und die Stille, den zerklüfteten, einsamen Strand und den zutraulichen Seehund, der vor der Küste schwamm. Sie liebte den weiten Horizont und die Schlichtheit der anderen Häuser. Tom Nevers war nicht glamourös, aber ein Zuhause für sie.
Sobald Connie in die lange Kieseinfahrt (markiert mit einem verwitterten Holzbrett, auf dem Flute stand) eingebogen war, sagte sie Meredith, sie könne sich jetzt aufrichten.
»Wow«, bemerkte Meredith erneut. Der Weg war auf beiden Seiten von Seegras und windzerzausten spanischen Olivenbäumen gesäumt. Connie fragte sich, was Meredith wohl dachte. Es war ein heikles Thema gewesen – lange vor der Sache mit Wolf und dem Geld –, dass Meredith und Freddy sich nie herabgelassen hatten, Wolf und Connie hier auf Nantucket zu besuchen. Meredith hatte versprochen, im Sommer nach ihrem Collegeabschluss zu kommen; sie war mit bereits gebuchten Bus- und Fährtickets praktisch schon unterwegs gewesen, hatte dann aber in letzter Minute wegen Freddy abgesagt. Und sobald Meredith Freddy geheiratet hatte, war sie ganz und gar von ihrem märchenhaften Leben in den Hamptons beansprucht gewesen.
Das Haus kam in Sicht und gleich dahinter das Meer.
»Mein Gott, Connie«, sagte Meredith, »es ist riesig. Es ist ein Prachtstück.«
Connie verspürte ein Aufwallen von Stolz, den sie sich, das war ihr klar, eigentlich verkneifen sollte. Schließlich hatten sie gelernt, dass Materielles vergänglich war. Meredith hatte einmal alles auf der Welt Erdenkliche besessen; jetzt hatte sie nichts mehr. Und doch konnte Connie nicht anders, als eine gewisse Genugtuung zu empfinden. Es war immer so gewesen, dass Connie als die Hübsche und Meredith als die Intelligente gegolten hatte. Connie war ein Leben voller Liebe zuteilgeworden, Meredith eins voller Reichtum: Geld, Orte, Dinge und Erfahrungen, von denen man nur träumen konnte. Ihr Haus in Palm Beach hatte früher den Pulitzers gehört. Meredith hatte Donald und Ivanka zum Abendessen empfangen, und an ihrem fünfundvierzigsten Geburtstag hatte Jimmy Buffet für sie gesungen. Es ging das Gerücht, dass sogar ein Stern am Himmel nach ihr benannt war.
War es angesichts dessen nicht okay, wenn Conny sich darüber freute, dass ihr Haus Meredith beeindruckte? Es war riesig, es war ein Prachtstück.
Leider war es aber auch leer.
Dieser Gedanke überfiel Connie, als sie die Tür aufschloss. Ihre Schritte hallten in dem zweistöckigen Foyer wider. Die Böden bestanden aus weißem, unregelmäßig geschliffenem Marmor, und rechts schwang sich eine Treppe die Wand hinauf. Wolf hatte das Gebäude entworfen.
Connie rang nach Luft. Meredith sah neben ihr sehr klein und geradezu überwältigt aus, und Connie dachte: Wir sind schon so ein Pärchen. Ich, als Teenager zur Hübschesten und Beliebtesten gewählt, Meredith zu der, die es wahrscheinlich am weitesten bringen würde.
»Komm, ich zeig dir alles«, sagte sie.
Sie führte Meredith durch die Halle in den großen Raum, der über die ganze Längsseite des Hauses verlief und im Morgengrauen in rosiges Licht getaucht war. Links lag die Küche: Schränke aus Ahornholz mit Glasfront, Arbeitsflächen aus blauem Granit. Sie war mit allem Drum und Dran ausgestattet, denn Connie war Gourmetköchin. Es gab einen Herd mit acht Flammen, einen Porzellanausguss, einen Weinkühlschrank, zwei Öfen, eine speziell angefertigte extrabreite Geschirrspülmaschine, einen Fliesenspiegel aus kobaltblauen und weißen italienischen Kacheln, die Connie und Wolf bei ihrer Wanderung durch die Cinque Terre entdeckt hatten. Die Küche ging in ein Esszimmer über, das mit einem Tisch aus glänzendem Kirschholz und zwölf Stühlen möbliert war. Jenseits der Doppeltür, die auf die Terrasse führte, folgte der ebenfalls in Weiß und Blau gehaltene Wohnbereich mit einem weißen gemauerten Kamin an der Rückseite, geziert von einem Sims aus massivem Treibholz, das Wolfs Großvater nach dem Hurrikan Donna 1960 an ihrem Strand gefunden hatte.
»Wunderschön«, sagte Meredith. »Wer hat das Haus eingerichtet?«
»Ich«, entgegnete Connie.
»Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getan«, gestand Meredith. »Wir hatten immer Samantha.« Sie wanderte zum anderen Ende des Wohnzimmers, wo Wolfs Barometersammlung die Regale zierte. »Es ist mir immer wie ein Privileg vorgekommen, weißt du, Samantha zu haben, die Sachen für uns aussucht und zusammenstellt und einen Stil für uns kreiert. Aber der war unecht, wie alles andere.« Sie strich über die Rücken von Wolfs Büchern. »Das hier gefällt mir viel besser. Dieser Raum, der ist du und Wolf und Ashlyn.«
»Ja«, sagte Connie. »Das ist er. Das war er. Es ist hart, weißt du.« Sie lächelte wehmütig. Sie war froh, nicht allein zu sein, trotzdem war es eine Qual, Meredith sagen zu hören, was für Connie unmöglich auszusprechen war. »Sollen wir runtergehen ans Wasser?«
Am Strand zu sein, war besonders hart, weil sie hier, in Anwesenheit von Wolfs Bruder Jake und seiner Frau Iris, Wolfs Asche verstreut hatte. Auch Toby war dabei gewesen, der die Trauerfeier auf Nantucket als Gelegenheit für ein letztes Besäufnis nutzte. Während Connie und Meredith im nassen Sand ihre Fußabdrücke hinterließen – es war Flut –, fragte Connie sich, wo die Überreste von Wolfgang Charles Flute sich jetzt befinden mochten. Er war ein ausgeglichener, warmherziger, liebevoller Mann von eindrucksvoller Größe – fast zwei Meter – gewesen, mit einer Baritonstimme, scharfem Verstand und einem ebenso scharfen Auge, Inhaber einer Architekturfirma, die in Washington Bürogebäude baute. Sie galten als innovativ, aber traditionell genug, um es mit den Denkmälern aufzunehmen. Er war ein vielbeschäftigter Mann gewesen, ein wichtiger Mann, wenn auch für Washingtoner Verhältnisse nicht sehr mächtig und nach den Maßstäben der Wall Street nicht besonders reich. Am meisten geschätzt hatte sie an Wolf die Ausgewogenheit, mit der er allen Aspekten seines Lebens Aufmerksamkeit schenkte. Er half Ashlyn bei den verzwicktesten Schulprojekten, er mixte die köstlichsten Martinis, er war ein Ass auf dem Einrad (das zu fahren er als Student gelernt hatte) sowie beim Paddleball, Tennis und Segeln. Er sammelte antike Sextanten und Barometer. Er hatte Astronomie studiert und glaubte, dass der Mensch aus der Anordnung der Sterne am Himmel etwas über irdisches Design lernen könne. Wolf war für Connie stets emotional präsent gewesen, auch wenn er unter Termindruck stand. An Tagen, an denen er sehr lange arbeiten musste – davon hatte es im Monat zwei, drei gegeben –, schickte er ihr Blumen oder lud sie in sein Büro zu einem Dinner mit Essen vom Inder und Kerzen ein. Wenn Connie mit ihren Freundinnen ins Restaurant ging, hatte er immer schon den besten Wein vorbestellt, und die anderen Frauen flöteten dann, was Connie doch für ein Glück habe.
Doch wo war Wolf jetzt? Er war an einem Gehirntumor gestorben, und Connie war seinem Wunsch nachgekommen, ihn einäschern zu lassen und seine Asche am Strand von Tom Nevers zu verstreuen. Die Ascheflocken hatten sich in Moleküle aufgelöst, die sich mit dem Meerwasser verbanden. Der Körper, den Wolf bewohnt hatte, war demnach verschwunden, in die Natur zurückgekehrt. Aber für Connie war er irgendwo hier, in diesen Wellen, die ihr um die Knöchel schwappten.
Meredith watete bis zu den Schienbeinen hinein. Connie fand das Wasser noch zu kalt, Meredith dagegen schien es zu genießen. Ihr Gesichtsausdruck spiegelte irgendetwas zwischen Entzücken und Verzweiflung. Sie sprach wie mit tränenerstickter Stimme, obwohl ihre Augen, wie die New York Post betont hatte, trocken blieben.
»Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Füße noch mal ins Meer strecke.«
Connie nickte.
»Wie kann ich dir dafür danken?«, sagte Meredith. »Ich habe nichts.«
Connie umarmte Meredith. Sie war winzig wie eine Puppe. In ihrer Highschoolzeit hatten sie sich bei einer Party einmal so betrunken, dass Connie Meredith huckepack nach Hause hatte tragen müssen. »Ich will nichts«, sagte sie.
Es war eine Situation wie aus Freundinnen hier unten am Wasser, dachte Connie, und sie fand es wirklich schön, dass sie Gesellschaft hatte und dass Meredith ihr jetzt ein Leben lang dankbar sein würde, aber zugleich wurde ihr auch die Ungeheuerlichkeit dessen klar, was sie getan hatte. Ihre beste Freundin aus Kindertagen war mit dem größten Ganoven verheiratet, den die Welt je gesehen hatte, und überall Persona non grata. Sie hatte Millionen Kritiker und Tausende von Feinden. Es wurde noch gegen sie ermittelt. Das »noch« ließ es klingen, als wäre dies ein vorübergehender Zustand, der sich zum Guten wenden würde, doch was, wenn das nicht zutraf? Wenn Meredith nun für schuldig befunden wurde? Wenn Meredith nun schuldig war?
Was habe ich getan?, dachte Connie. Was habe ich getan?
Meredith bezog ihr Zimmer – einen schlichten Raum mit weißer Täfelung und einem eigenen kleinen Bad. Schlafzimmer und Bad waren beide in Rosatönen gehalten, von Connie selbst mit Hilfe von Wolf und der Frau im Marine Home Center eingerichtet. Vom Schlafzimmer aus führte eine französische Tür auf einen schmalen Romeo-und-Julia-Balkon. Meredith war begeistert.
»Mein Zimmer liegt ein Stück den Flur entlang«, sagte Connie. Das »Zimmer« war in Wirklichkeit eine große Suite, die die westliche Hälfte der ersten Etage einnahm. Sie umfasste ein Schlafzimmer mit einem riesigen Bett und Meerblick, ein Bad mit tiefer Whirlpoolwanne, separater Rainfall-Dusche, zwei Waschbecken, Toilette, Fußbodenheizung, Spiegelwand und einer Waage, die großzügig ein, zwei Pfund unterschlug. Es gab zwei geräumige Kleiderschränke. (Connie hatte letztes Jahr endlich Wolfs Sommersachen in den Secondhandladen gebracht.) Und dann war da noch Wolfs Arbeitszimmer mit seinem Zeichentisch, den gerahmten ozeanografischen Karten und einem Teleskop, das auf die interessantesten Sternbilder während des Sommers gerichtet war. Connie fühlte sich emotional nicht stabil genug, um Meredith die Suite zu zeigen, und Tatsache war, dass sie seit Wolfs Tod keine einzige Nacht in ihrem Bett verbracht hatte. Mit Hilfe von zwei oder drei Chardonnays war sie hier auf Nantucket jeden Abend unten auf dem Sofa eingeschlafen – oder, wenn Gäste im Haus waren, in der unteren Koje des Etagenbetts in dem Schlafzimmer im zweiten Stock, das sie unsinnigerweise für künftige Enkelkinder reserviert hatte.
Sie mochte nicht ohne Wolf in dem großen Bett schlafen. In Bethesda ging es ihr genauso. Sie konnte es nicht erklären. Irgendwo hatte sie gelesen, dass der Verlust des Ehepartners die Nummer eins aller Dinge sei, die Stress verursachten – und was hatte sie heute anderes getan, als sich noch mehr Stress aufzuladen?
»Ich muss zum Supermarkt«, sagte Connie.
»Ist es okay, wenn ich mitkomme?«, fragte Meredith.
Connie sah, wie Meredith auf den Zehen wippte, wie sie es früher am Ende eines Sprungbretts getan hatte.
»Gut«, stimmte sie zu. »Aber du musst deine Kappe und die Sonnenbrille aufsetzen.« Connie hatte Angst aufzufliegen. Wenn nun jemand herausfand, dass Meredith Delinn hier war, bei Connie wohnte?
»Kappe und Brille«, sagte Meredith.
Connie fuhr die zehn Kilometer zum Stop & Shop, während Meredith auf einem Notizblock, der auf ihren Oberschenkeln lag, eine Einkaufsliste machte. Connies Furcht schwand, und ein wohliges Gefühl beschlich sie, das sie sonst nur nach einer sehr guten Massage und drei Gläsern Chardonnay verspürte. Sie öffnete das Verdeck, so dass frische Luft hereinströmte, und stellte das Radio an – Queen mit »We are the Champions«, dem Siegessong des Feldhockeyteams der Merion Mercy Academy, für das sie und Meredith vier Jahre lang gespielt hatten. Connie grinste, und Meredith hielt ihr Gesicht in die Sonne, und einen Moment lang waren sie beide glücklich.
Im Supermarkt ließ Connie Meredith Vollkorntortillas und griechischen Joghurt besorgen, während sie an der Feinkosttheke anstand. Sie schickte sie Waschmittel, Gummihandschuhe und Schwämme holen, doch dann blieb Meredith so lange weg, dass Connie in Panik geriet. Sie eilte mit ihrem Wagen durch die Regalreihen, den anderen Kunden und ihren kleinen Kindern ausweichend, die sich, benebelt von Salzwasser und Sonne, alle im Schneckentempo voranbewegten. Wo steckte Meredith? Connie zögerte, nach ihr zu rufen. Es war unwahrscheinlich, dass sie den Laden verlassen hatte, wovor also hatte Connie Angst? Sie hatte Angst davor, dass Meredith in Handschellen abgeführt worden war. Eigentlich müsste sie in dem Gang mit den Haushaltsartikeln sein, doch da war sie nicht, auch nicht im nächsten Gang oder im übernächsten. Connie hatte ihre alte Freundin erst seit Stunden zurück, und schon war sie wieder verschwunden. Und Connie war sich nicht einmal sicher, ob sie wollte, dass Meredith blieb – warum also diese Panik?
Connie fand Meredith in dem Gang mit den Backwaren, wo sie auf eine Tüte Brötchen starrte.
Erleichterung überschwemmte sie, dann dachte sie: Das ist ja lächerlich, immer mit der Ruhe. »Oh, gut«, sagte sie. »Ich dachte schon, ich hätte dich verloren.«
»Es ist schon eine Weile her, dass ich einkaufen war. Es gab einen USA-Today-Fotografen, der das Gristedes bei mir um die Ecke belagerte, und einen Typen vom National Enquirer, der immer bei D’Agostino rumhing. Ich konnte mir nicht mal Eier holen. Oder Zahnpasta.«
Connie nahm Meredith die Brötchen aus der Hand und ließ sie in den Wagen fallen. »Hier folgt dir keiner.«
»Noch nicht«, sagte Meredith und rückte ihre Sonnenbrille zurecht.
»Stimmt. Wir sollten es nicht darauf ankommen lassen.« Connie strebte auf die Kasse zu. Sie war dankbar dafür, dass sie hier niemanden kannte. Sie und Wolf hatten die bewusste Entscheidung getroffen, sich vom gesellschaftlichen Leben Nantuckets fernzuhalten. In Washington waren sie ständig zu Gast bei Partys und Galas und Abendessen; da bot Nantucket eine Verschnaufpause, obwohl Wolf aus den Jahren seiner Jugend nach wie vor ein paar Freunde auf der Insel hatte. Seine Eltern und Großeltern waren Mitglieder im Nantucket Yacht Club gewesen, und ein- oder zweimal pro Sommer wurde Wolf zum Segeln oder zusammen mit Connie zu einer Cocktailparty oder einem Barbecue eingeladen. Meistens aber waren die beiden für sich geblieben. Und so fühlte Connie sich jetzt, obwohl sie schon seit über zwanzig Jahren nach Nantucket kam, praktisch anonym. Sie kannte niemanden, und niemand kannte sie.
Als sie in der Schlange standen, reichte Meredith Connie drei Zwanzig-Dollar-Scheine. »Ich möchte mich an den Kosten beteiligen.«
Connie erwog, das Geld abzulehnen. Die Fernsehreporter hatten klargemacht, dass Meredith Delinn – falls nicht irgendwo ein Geheimkonto existierte – vollkommen pleite war. »Tu, was du kannst«, sagte Connie. »Aber fühl dich nicht unter Druck.«
»Okay«, flüsterte Meredith.
Auf dem Rückweg nach Tom Nevers bemerkte Connie im Kreisverkehr etwas Ungewöhnliches. Übertragungswagen drängten sich auf dem Parkplatz der Inselzeitung Inquirer and Mirror. Connie musste zweimal hinschauen. Waren das Übertragungswagen?
»Duck dich«, sagte sie. »Da sind Reporter.« Sie sah in den Rückspiegel. »CNN, ABC.«
Meredith beugte sich so weit nach vorn, wie es ihr Sicherheitsgurt erlaubte. »Du spinnst«, sagte sie.
»Ich spinne nicht.«
»Ich fasse es nicht. Ich kann nicht glauben, dass es sie interessiert, wo ich bin. Obwohl, natürlich interessiert sie das. Natürlich muss alle Welt wissen, dass ich auf Nantucket Sommerferien mache. Damit ich schlecht dastehe. Damit es aussieht, als ob ich immer noch ein Luxusleben führe.«
»Was du ja auch tust«, sagte Connie und versuchte zu lächeln.
»Warum kannst du nicht in irgendeinem grässlichen Ort wohnen? East St. Louis zum Beispiel. Dann könnten sie berichten, dass Mrs Delinn den Sommer im heißen und gefährlichen East St. Louis verbringt.«
»Das ist nicht witzig.« Connie schaute erneut in den Rückspiegel. Die Straße hinter ihnen war leer. »Stell dir vor, sie folgen uns gar nicht.«
»Nein?«
Connie fuhr weiter. Sie war ein winziges bisschen enttäuscht. »War wohl falscher Alarm.« Sie überlegte, warum Fernsehwagen am Kreisverkehr standen, dann fiel ihr ein Zeitungsartikel ein, der von den Berichten über Freddys Verurteilung in den Schatten gestellt worden war. »Ach, stimmt ja«, sagte sie. »Der Präsident ist dieses Wochenende hier!«
Meredith richtete sich auf. »Mein Gott, hast du mir einen Schrecken eingejagt.« Sie machte hörbare Atemübungen, um sich zu entspannen, und das erinnerte Connie daran, wie sie Meredith nach Leos Geburt mit der zweijährigen Ashlyn im Krankenhaus besucht hatte. Freddy war stolz gewesen wie ein Gockel und hatte (nicht nur teure, sondern zudem illegale) kubanische Zigarren herumgereicht, sogar Connie eine aufgedrängt und gesagt: »Gib sie Wolf. Er wird sie lieben.« Connie entsann sich, wie neidisch sie auf Meredith wegen der unproblematischen Entbindung gewesen war (sie selbst hatte sich dreiundzwanzig Stunden lang mit Wehen quälen müssen und einen Gebärmutterriss erlitten, infolge dessen sie keine weiteren Kinder bekommen konnte). »Gott sei Dank hat Freddy jetzt seinen Sohn, so dass der geheiligte Name Delinn fortbestehen kann«, hatte Meredith gesagt, und das hatte Connie verletzt, weil Ashlyn ein Mädchen war und sie keine Kinder haben würde, die den Namen Flute weitertragen konnten. Dieses Gefühl verstärkte den Groll darüber, dass sie, Connie, den weiten Weg von Bethesda nach New York auf sich genommen hatte, um Meredith und das Baby zu sehen, während Meredith sie zwei Jahre zuvor nach Ashlyns Geburt nicht im Krankenhaus besucht hatte. Es war erstaunlich, welche Erinnerungen Connie plötzlich überfielen. Erstaunlich, dass in ihrem Gedächtnis die guten und die schlechten Aspekte jeder Interaktion ineinander verwirbelt waren wie Farben auf einer Palette. Meredith erinnerte sich vielleicht nur an die Freude darüber, dass Connie gekommen war, oder an den niedlichen Strampelanzug, den sie mitgebracht hatte. Oder sie dachte bei dem Gedanken an Leos Geburt bloß: Gegen Leo wird ermittelt.
Connie bog in ihre Einfahrt ab und parkte vor dem Haus. Meredith griff nach den Einkaufstüten.
»Du gehst rein und entspannst dich«, sagte sie. »Um die kümmere ich mich.«
Connie lachte. »Du bist doch hier nicht das Dienstmädchen. Aber danke für die Hilfe.«
Wieder stand ihr der Tag im Krankenhaus vor Augen. Meredith hatte Ashlyn erlaubt, ihren wenige Stunden alten Säugling auf den Arm zu nehmen, obwohl die Oberschwester ausdrücklich abgeraten hatte. Das wird schon gut gehen!, hatte sie gesagt. Connie und ich sind ja dabei. Und dann hatte sie selbst Fotos gemacht, eins rahmen lassen und es Connie geschickt. Und dann hatte sie Connie natürlich gebeten, Leos Patin zu werden.
»Es ist schön, Gesellschaft zu haben«, sagte Connie.
»Auch, wenn ich es bin?«, fragte Meredith.
»Auch, wenn du es bist«, bestätigte Connie.
Meredith
Um zehn vor fünf befand Meredith, dass sie es nicht länger aufschieben konnte. Sie musste ihre Anwälte anrufen und ihnen ihren Aufenthaltsort durchgeben. Schließlich wurde gegen sie ermittelt. Sie durfte das Land nicht verlassen; das FBI hatte ihren Pass. Burt und Dev mussten wissen, wo sie war.
Sie setzte sich auf ihr Bett und schaltete ihr Handy ein. Das war zu einem spannenden Moment in ihrem Tagesablauf geworden. Hatte jemand angerufen? Ihr eine SMS geschickt? Hatten Carver oder Leo die Regeln übertreten und ihr das Ich hab dich lieb geschrieben, nach dem sie sich so verzweifelt sehnte? Hatte irgendeine von Merediths ehemaligen Freundinnen genügend Mitgefühl aufgebracht, um mit ihr Kontakt aufzunehmen? Würde sie von Samantha hören? Hatten Burt oder Dev sich gemeldet? Mit guten oder schlechten Nachrichten? Wie schlecht würden die schlechten Nachrichten sein? War dies der Augenblick, in dem Meredith das Schlimmste erfuhr? Tatsächlich ließ sie ihr Telefon nur ausgeschaltet, um die Qual der Ungewissheit auf diese eine Situation zu beschränken, statt sie den ganzen Tag lang zu erleben.
Es gab keine Nachrichten, weder auf der Mailbox noch als Text, was wiederum eine andere Form des Elends darstellte.
Sie wählte die Nummer der Anwaltskanzlei und sprach dabei das Ave Maria, das sie bei diesem Anruf immer aufsagte. Von unten hörte sie, wie Connie das Abendessen zubereitete.
Meredith hatte geglaubt, sie würde sich auf Nantucket vielleicht sicherer fühlen, doch jetzt plagte sie eine unterschwellige Angst. Nantucket war eine Insel, fast fünfzig Kilometer weit draußen im Meer gelegen. Wenn sie nun fliehen musste? Hier konnte sie nicht in ein Taxi springen und sich über eine Brücke oder durch einen Tunnel nach New Jersey retten. Hier bestand keine Möglichkeit, schnell nach Connecticut zu gelangen, falls Leo oder Carver sie brauchten. Sie fühlte sich sowohl ausgeschlossen als auch eingesperrt.
Meredith besaß sechsundvierzigtausend Dollar, selbst verdientes Geld, das sie während ihrer Lehrtätigkeit in den 1980ern gespart und auf einem Konto angelegt hatte, das anderthalb Prozent Zinsen abwarf. (Freddy hatte sie dafür ausgelacht. Lass es mich investieren, hatte er gesagt. Ich verdoppele es dir in sechs Monaten.) Aber Meredith hatte aus persönlichem Stolz an ihrem Sparkonto festgehalten, und wie war sie jetzt erleichtert darüber! Sie besaß etwas, von dem sie leben konnte, rechtmäßig verdientes und angelegtes Geld. Vielen Menschen würden sechsundvierzigtausend Dollar wie ein Vermögen vorkommen, das wusste sie, für sie dagegen war es ein jämmerlicher Betrag. So viel hatte sie an einem einzigen Nachmittag für Antiquitäten ausgegeben. Widerlich!, dachte sie, während das Telefon läutete. Wie bin ich zu so einem Menschen geworden?
Die Rezeptionistin nahm ab.
»Kann ich mit Burton Penn sprechen, bitte?«, fragte Meredith.
»Darf ich fragen, wer Sie sind?«, gab die Rezeptionistin zurück.
Meredith krümmte sich. Sie hasste es, ihren Namen zu nennen. »Meredith Delinn.«
Die Rezeptionistin antwortete nicht. Sie antwortete nie, obgleich Meredith schon Dutzende Male angerufen und mit eben dieser Rezeptionistin gesprochen hatte.
Das Telefon klingelte. Obwohl Meredith nach Burt gefragt hatte, war Dev am Apparat.
»Hi, Dev«, sagte sie. »Hier ist Meredith.«
»Gott sei Dank«, entgegnete Dev. »Ich wollte Sie gerade auf dem Handy anrufen. Wo sind Sie?«
»Ich bin auf Nantucket.«
»Auf Nantucket? Was machen Sie auf Nantucket?«
»Ich bin bei einer Freundin.«
Dev äußerte Überraschung. Er war eindeutig davon überzeugt gewesen, dass Meredith keine Freundinnen hatte. Und da irrte er sich nicht. Aber sie hatte Connie. War Connie ihre Freundin? Connie war undefinierbar; Meredith wusste nicht genau, was sie war.
»Wie ist die Adresse?«, fragte Dev.
»Ich habe keine Ahnung.«
»Telefonnummer? Bitte, Meredith, geben Sie mir irgendwas. Das FBI will, dass wir jederzeit Kontakt mit Ihnen aufnehmen können.«
Meredith hatte sich Connies Festnetznummer aufgeschrieben und las sie Dev vor.
»Eins nach dem anderen«, sagte er. »Ich bin froh, dass Sie in Sicherheit sind.« Meredith lächelte. Dev war außer ihren Söhnen der einzige Mensch, der nicht wollte, dass sie von der George Washington Bridge sprang. Burt, ihr zweiter Anwalt, hätte sich nie zu einer Gefühlsäußerung hinreißen lassen. Burt hatte nichts gegen Meredith, aber er wahrte Distanz. Sie war ein Fall für ihn, ein juristisches Problem. Sie war sein Job.
»Ich habe von Warden Carmell vom Metropolitan Correctional Center gehört, dass Mr Delinn heute Mittag in den Bus gesetzt wurde«, fügte Dev hinzu. »Es sind zehn Stunden bis nach Butner. Er kommt dort also am Abend an.«
Meredith schloss die Augen. Als ihre Anwälte ihr telefonisch mitgeteilt hatten, Freddy habe die Höchststrafe erhalten, war sie sich nicht sicher gewesen, was das bedeutete. Sie hatte den Fernseher angestellt und gesehen, wie Freddy in seinem hellgrauen Anzug, der ihm nicht mehr passte, aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Und auf dem Spruchbalken darunter stand: DELINN ZU 150 JAHREN VERURTEILT. Würgend beugte sie sich vor und rannte zur Küchenspüle, wo sie die halbe Tasse Tee von sich gab, die sie zuvor mühsam heruntergebracht hatte. Sie hörte ein Geräusch und dachte, es komme aus dem Fernseher, doch es war das Telefon. Sie hatte es zu Boden fallen lassen, und Burts Stimme drang daraus hervor: »Meredith, sind Sie noch da? Hallo? Hallo?« Meredith legte auf und stellte den Fernseher ab. Sie war vollkommen fertig.
Sie ging ins Schlafzimmer und ließ sich auf ihr riesiges Bett fallen. Sechzehn Stunden blieben ihr, bis Bundesbeamte sie abholen würden und sie sich von ihrer Bettwäsche trennen musste, die glatt war wie Papier, von der seidenen Steppdecke, von den üppig mit Daunen gefüllten Kissen.
Einhundertfünfzig Jahre.