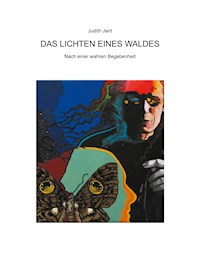
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Text des Buches entstand im Jahr 2018 in 36 Tagen und wurde großteils in der Psychiatrie geschrieben. Judith Jant bringt im Wiener Otto Wagner Spital das Aussen und das Innen zu Papier, schreibt sich die Seele aus dem Leib und informiert in Rückblenden über Gründe ihrer Erkrankung. Traumatisierungen führen zu einem brüchigen Wesen, das dennoch stark ist. Tabulos berichtet sie von einer Zeit als Telefonsex-Anbieterin und Prostituierte. Das Schreiben hält sie zusammen, während in ihr der Wahnsinn spukt. Eine Reise, ständig an Abgründen entlang. Judith Jant ist seit 24 Jahren Künstlerin, ihre Bilder, die eng mit ihrer Therapie zusammenhängen, begleiten die Worte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Text entstand in 36 Tagen und wurde großteils in der Psychiatrie geschrieben.
Im Jahr 2018 bringt Judith Jant im Wiener Otto Wagner Spital das Aussen und das Innen zu Papier, schreibt sich die Seele aus dem Leib und informiert in Rückblenden über Gründe ihrer Erkrankung.
Traumatisierungen führen zu einem brüchigen Wesen, das dennoch stark ist.
Therapiemethoden werden anschaulich beschrieben.
Tabulos berichtet sie von einer Zeit als Telefonsex-Anbieterin und Prostituierte.
Das Schreiben hält sie zusammen, während in ihr der Wahnsinn spukt.
Eine Reise, ständig an Abgründen entlang.
Judith Jant ist seit 24 Jahren Künstlerin, ihre Bilder, die eng mit ihrer Therapie zusammenhängen, begleiten die Worte.
Judith Jant, geb. 1979 in Graz, lebt und malt in Wien.
Dieses Buch ist all meinen MitstreiterInnen gewidmet.
Wien, Otto-Wagner-Spital, Pavillon 24
INHALT
Erde an Motorikzentrum
Wir sind der Fehler in der Matrix
Alpha-Sinus-Reaktor
Wir sind alle Kunst, gezeichnet vom Leben
Nothing offers more freedom than art
Sehet, wie der verfluchte Adler Richtung Süden fliegt und so verflucht leicht sinnig lebt
Mäusepumpvene
Wir sind nicht verrückt
„Es stimmt was nicht.“ Ich meinte mit der Welt. Er meinte natürlich mit mir.
Guten Morgen Subakut
Vorstoß ins All
Wenig ist schon zu viel
Wenn es nicht nur anders, sondern gar nicht kommt
Katastrophen und Krisen
Sturm und Flut
Dürre und Hungersnot
Unsichtbare Gegner
Zu laut, zu grell, zu voll von Menschen
Das Lichten eines Waldes
Zermürbungskrieg
Ein wahlloser Mörder
Das Meistern von Katastrophen
Warnung und Abwehr
Die Endlösung
Schichten
Flammender Widerstand
Lärmbelästigung
Der verheerendste Ausbruch
Wir schauen nur
Weltraummüll
Der Auszug
Wie zum Tode aufgebahrt
Das fängt ja sehr gut an, wenn Du Dich jetzt schon ausziehst
Nicht gegebene Selbst- oder Fremdgefährdung
Furcht, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit
Valium
Dass sich die Geschichte nicht wiederholt
ERDE AN MOTORIKZENTRUM
Ein Mittwoch. Nicht alle hier auf dieser Station sind sich darüber im Klaren, somit zähle ich zu den Glücklicheren. Nichtsdestotrotz bin ich hier. Ich fließe in die Fugen des Linoleumbodens, ich verliere mich in den Zimmern, in denen es viel Raum mit wenig drin gibt, ich werde besiedelt von den hier ansässigen Keimen, verbinde mich mit den Nikotinbelägen im Raucherraum.
Akut-Psychiatrie. In meinem unterirdischen Zustand fällt mir nichts anderes ein, als zu schreiben. Etwas, das mir ein wenig das Gefühl nimmt, mich aufzulösen, etwas, das all meine Teile an einem Punkt vereint. Seitdem ich hier bin, muss ich das Bild, mich im Badezimmer meiner schnuckeligen Wohnung erhängen zu müssen, nur noch halb so oft wegdrängen. Ein paar Stunden, in denen mich mein Gehirn in reduzierter Art quält, sind schon ein Gewinn. Wenn das Fernbleiben von etwas Erleichterung verschafft, dann wird man genügsam. Wenn man nicht mehr, sondern weniger will, dann rückt das einiges gerade. Und Geraderücken, das ist genau das, was ich im Moment brauche. Sowohl vertikal als auch horizontal.
Nach 5 Wochen an der Tagesklinik im Wiener Otto Wagner Spital, ein Krankenhaus, das auch eine große psychiatrische Abteilung besitzt und 1907 als Niederösterreichische Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke Am Steinhof gegründet wurde, fetzte es mir sämtliche Sicherungen. In eine Tagesklinik kommt man jeden Tag in der Früh und geht nach dem Therapieprogramm nachmittags wieder heim. Eine Maßnahme, dazu gedacht, mich wieder jobfit zu machen, destabilisierte mich dermaßen, dass etwas in mir nur noch sterben möchte.
Am vergangenen Freitag, dem Tag des Endes der fünften Woche der ambulanten klinischen Betreuung, die mich immer mehr auslaugte und mir das Letzte abverlangte, begann ich zu zittern wie noch nie. Abends war ich bei Freunden zum Essen eingeladen, zwei Menschen, die ich sehr schätze, auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen. In deren Wohnung traf ich in einem erbärmlichen Zustand ein, verließ sie in einem noch heftigeren. Panikattacken. Ich dachte, ich muss sterben. Mein Körper war ein Gefängnis, jede Zelle darauf erpicht, es zu verlassen. Ein Rasen, ein Dröhnen, ein Aufstand der Materie, ein Streik der Funktionen. Während des Essens legte ich alles beiseite, schlüpfte so stark zitternd in meinen Mantel, dass ich nur knapp einem Kinnhaken von mir selber entging, und fuhr heim. Als ein vibrierendes Etwas kam ich an, es legte sich nicht. Der Schlaf wollte sich trotz Erhöhung der Medikamente, die ich sowieso täglich nehme, lang nicht einstellen.
Als er sich endlich über mich legte dauerte es aber nicht lange, da katapultierte mich die Angst wieder aus dem Schwarz, alles in Aufruhr, blanke Panik. Ein Gang zur Toilette endete mit dem Fallen von der Schüssel. Die Ohnmacht war eine Erlösung, die Zellen verließen ihr Gefängnis, schwirrten im Raum, ich wäre nicht böse gewesen, wenn sie sich nicht mehr vereint hätten. Ich erwachte desorientiert, vernahm nur den kalten Boden. Er hielt mich. Ich war wie aus Staub. Eine große, doppelhügelige Beule am Kopf erzählte mir, dass ich gegen den Türstock gedonnert sein muss. Irgendwie setzte sich diese Nacht fort. Sie erschien mir ewig, aber sie verging. Zwangsgedanken ans mich Töten suchten mich heim. Mit Hilfe des Sozialpsychiatrischen Notdienstes und Benzodiazepinen, das sind Medikamente mit angstlösenden, beruhigenden, krampflösenden, und schlaffördernden Eigenschaften, überstand ich das Wochenende.
Und dann begann die neue Woche in der Tagesklinik. Ich schleppte mich hin, machte meine Therapien, rutschte in dissoziative Störungsbilder, die mir erscheinen, als wäre ich Alice im Wunderland. Dabei entgleitet mir eine normale Empfindung von mir und der Umwelt. Alles ist wie in Watte, weit weg oder viel zu nah.
Speziell im Zusammenhang mit Menschen ist das sehr unangenehm. Manchmal wirken sie meterweit weg und wie im Traum, dann wieder kleben sie empfunden an mir dran, obwohl sie einen normalen Abstand zu mir haben. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin und dieses Störungsbild auftritt, dann weiß ich nicht mehr, ob die Menschen tatsächlich zu nah an mir dran sind oder ich es nur so wahrnehme.
Die Größe von Gegenständen verändert sich auch oft. Meist kommen mir kleine Dinge groß vor und große klein. Auch meine eigene Größenwahrnehmung variiert stark, am angenehmsten ist es, wenn ich mir 3 Meter groß vorkomme. Und Zeit ist nicht mehr Zeit. Sie dehnt oder verkürzt sich, wie es ihr beliebt, sie bleibt stehen, sie rafft sich, nur rückwärts ging sie noch nie.
In so einem dissoziativen Zustand ging ich auch hier her. Alles war weit weg und die Zeit verlief sehr träge. Meine Therapeutin von der Tagesklinik, die auf dem Pavillon mit der Nummer 20 verortet ist, begleitete mich auf den Pavillon mit der Nummer 24. Die verschiedenen Stationen in einem Gebäude sind mit Nummern hinter Slashs näher definiert. 24/2 bedeutet im Erdgeschoss, 24/3 im ersten Stock.
Wir befinden uns im ersten Stock. Die morgendliche Therapiesitzung auf 20/3 heute dauert nur kurz, da ich meiner Therapeutin sage, dass ich seit rund 5 Tagen Zwangsgedanken an Suizid habe. Ich bitte um stationäre Obhut. Sie bestärkt mich und sagt mir, dass sie das gut findet, damit verschwinden mein schlechtes Gewissen und meine Selbstvorwürfe ihr gegenüber, dass ich es nicht schaffe.
Sie geht mit mir. Nach dem Erledigen einiger weniger Formalitäten sind wir unterwegs zum Pavillon 24. Ich liebe diese Gebäude und an jedem Tag hier singe ich innerlich ein Loblied auf Otto Wagner, den Architekten, der diese Gegend prägte.
Wir betreten ein Haus, das dunkler wirkt als der Pavillon, von dem wir kommen. Kurz sind wir nicht sicher, richtig zu sein, es ist düster, die Station wirkt vom Stiegenhaus aus unbelebt. Aber doch. Wir sind richtig. Wir treten durch die riesige, vierteilige Glaskassettentür. Große Gänge mit nichts drin. Viel Raum für wenig.
Kein Licht. Kahle, schmutzige Wände. Beige Fliesen mit schwarzen Blumen. An sich feindlich, doch auf mich übt so etwas eine ungeheure Faszination aus wenn es mir schlecht geht. Weil das Außen dann zum Innen passt. Wir werden ruppig begrüßt und irgendwie folgte ein Missverständnis auf das andere, ich sehe mir das unbeteiligt an, weil es mir viel zu tot geht, als dass ich mir noch Sorgen machen könnte. Zum Glück regelt meine Therapeutin alles und sie tut das mit einer ihr innewohnenden guten Laune, mit einem Humor, der mich oft ins Staunen versetzt. Sie ist ein Paradiesvogel in der Klapse, so bunt schillernd, dass der graueste Boden, auf dem sie geht, bunt zu pulsieren beginnt. Sie kichert und organisiert, ich sehe mich nur um.
In einer Ecke stehend verändert sich meine Körpergrößenwahrnehmung von 300 auf 90 Zentimeter. 4 Meter von mir entfernt, die sich wie 50 Zentimeter anfühlen, sitzen zwei Männer, die klapsisch sprechen, also wirr und unzusammenhängend, doch sie verstehen sich. Sie wirken, als würden sie auf einen Termin warten, es sind auch nur diese zwei Stühle am Gang, doch sie warten vermutlich bloß darauf, dass die Zeit vergeht.
Patienten und Pfleger kommen vorbei, ich meide jeden Blickkontakt. Gleich merke ich, dass man sich hier nicht grüßt. Welch Wohltat. Ich will nur hier sein, möglichst unbemerkt von anderen, so wenig Kontakt wie möglich, mich nur erholen. Die Abwicklung verläuft schnell, man bringt mich in ein Zimmer, in dem 4 Betten sind. 3 davon sind belegt und alle 3 Frauen liegen in ihnen. Keine Gespräche. Ruhe. Mein Bett ist beim Eingang gleich links.
Die im Bett neben mir würde gerne plappern glaube ich, nur plappert keiner mit ihr. Die im Bett gegenüber wirkt sehr depressiv und die Dritte im Bett quer gegenüber ist vermutlich auf Entzug. Sie geht schief, schläft beim Essen und in allen möglichen und unmöglichen Haltungen ein. Alle wirken nett.
Mir wird ein kleiner Kasten zugeteilt, ein Schlüssel mit dem Hinweis, gut auf meine Sachen aufzupassen, ausgehändigt, manchmal kämen Sachen weg. Ich beschließe meine wenigen Dinge zu behüten wie einen Schatz. Ich stelle meinen Rucksack in den Kasten und mich den anderen vor.
Zeitriss. Plötzlich bin ich allein im Zimmer. Wie angenehm. Ein Pfleger bringt mir Filzpantoffel. Er zeigt mir, in welchem der Kästen im Zimmer ich Kleidung finde. Ich habe das an und mit, was ich heute zur Tagesklinik mitbrachte. Obwohl die Therapiestunde, in der ich verkündete, dass ich gerne stationär aufgenommen werden möchte, schon um 9 Uhr 40 stattfand, war mir um 7 Uhr 20, als ich meine Wohnung verließ, nicht klar, dass ich heute nicht wiederkommen würde. Erstaunlich eigentlich. Immer wieder bin ich von meinem Optimismus geflasht. Und erschüttert bin ich davon, wie sehr sich mein Leben und seine Bewertung in ein wenig mehr als 2 Stunden verändern können. Es ist unfassbar eigentlich. Und wieder kommt sogleich dieser Optimismus zum Tragen, denn ich lasse mich durch das Wegfetzen aller vorher vorhandenen Pläne noch immer nicht in meinem Wesen so sehr verunsichern, wie man das vielleicht vermuten könnte. Es ist eine Art Blindheit, eine positive Dummheit.
Um nicht die einzige Garnitur Gewand frühzeitig einzustinken, gehe ich zu dem mir zuvor gezeigten Kasten mit Kleidung und orientiere mich. Alles da. Jogginganzüge in krankenhausmint, Pyjama in spitalshellblau, passend zur Bettwäsche, weiße Basics mit dunkelblauem OWS-Emblem. Zur Oma-Unterhose kann ich nicht greifen, doch ich nehme mir mal Socken. Ein weißes Paar ohne Fersenausnehmung, ein am Ende zugenähter Stoffschlauch, auf dessen unterem Drittel in einem Kreis um die stilisierte Kirche des Geländes „Otto Wagner Spital Baumgartner Höhe“ steht. Das Schlüpfen in diese Socken ist ein Moment der Assimilation, ein endgültiges Einfließen in die Patientenschaft dieser Anstalt, ein Einswerden mit der Klientel, eine kleidungsbezogene Bestätigung zum Aufnahmestempel meiner Papiere dieses Tages. Eine stoffliche Vereinigung mit den Begebenheiten. Die Zeit verlangsamt sich. Weiter. Ein Unterhemd. Sowas trug ich nicht mehr seitdem ich 12 war. Vorne eine Spitze, dezent aber neckisch. Am Rücken ein OWS-Aufdruck.
Weiter. Ein T-Shirt mit dem OWS-Emblem vorne am Hals. Die Zeit verläuft wieder halbwegs normal. Weiter. Eine Jogginghose und die Filzpatschen in rot, die der Pfleger mit „fröhlich“ kommentierte. Alle hier sind sehr, sehr nett zu mir. Und immer, wenn sie es sind, dann schießt mir Überraschung ein, dass ich nicht daheim im Bad erhängt bin, sondern lebe.
Als ich 2013 in diese Wohnung zog, da war sie todesgedankenrein. Ich kann mich noch gut an dieses Gefühl erinnern. An keinen Winkel, an kein Ding war Suizidales geheftet. Irgendwann ging es mir dann so lange so schlecht, dass sich wieder Suizidgedanken formten, die immer erst zur mentalen Erleichterung da sind.
Sie entstressen mich als eine Art Notausgangsoption, die anfangs hilfreich ist. Und solange sie nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind, erfüllen sie ihren Zweck und verschwinden dann wieder, sobald es mir besser geht. Im Laufe des Jahres 2017 entstand das Bild des Erhängens an der oberen Schiene der Duschtüre. Sie ist beidseitig in der Wand montiert und trägt mein Gewicht leicht. Ein Entleeren von Blase und Darm würde den Aufräumenden aufgrund des Fliesenbodens nicht viel Arbeit verschaffen. Die Badezimmertüre würde ich verschließen und außen eine Nachricht mit dem Inhalt „Feuerwehr rufen!“ anbringen, denn ein Freund von mir, Franz, hat meinen Schlüssel. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Freundeskreis mein Verschwinden zu der Handlung des Aufsperrens der Wohnung durch ihn führen würde, ist gegeben. Und das Bild, dass ich mich dort totstrangulierte, das möchte ich ihm tunlichst ersparen. Mein Tod allein würde schon genug anrichten bei den Menschen, die mich lieben, da muss ich nicht auch noch traumatisierende Abgangsbilder implantieren. Dass ich einige Menschen traurig zurücklassen würde, das ist der Hauptgrund dafür, dass ich noch hier bin. Aber mein Bad ist seit längerem suizidal besetzt.
Ich bin jetzt 38 und mit 16 versuchte ich ernsthaft mich zu killen. Eine Nacht zwischen Ohnmachtsanfällen und Wälzen in Blut, das in Unmengen aus meinem linken Handgelenk kam, endete mit einer Krankheitserkenntnis und einem mir Hilfe holen. Seitdem versuchte ich es nie – stimmt nicht, einmal hier in diesem Spital im Jahr 2010 versuchte ich es auch, es war aber eher lächerlich, das Klopapier, das da war, reichte nicht, um mir die Atemwege luftdicht zuzustopfen...
Nach dem Umziehen ist etwas anders. Es ist etwas leichter. Ich bin Patientin. Ich muss jetzt gar nichts. Ich bin in der niederschwelligsten Einrichtung der psychiatrischen Versorgung. Ich bin wieder in der Irrenanstalt, wo die ganz Argen sind.
Ich fiel von der obersten Stufe der psychiatrischen Therapie ungebremst auf die unterste. Das Außen stimmt mit dem Innen überein. Der Fall ist für mich immer das Schlimmste. Wenn ich endlich angekommen, aufgeschlagen bin, dann rückt es sich von allein ein Stück weit zurecht, dann gibt es wieder Boden. Und dieser Boden erfährt Verstärkung durch die Kleidung.
Schon beim Warten bei der Aufnahme entdeckte ich den Raucherraum. Wir müssen für unsere Nikotindosis nicht hinausgehen, das ist beruhigend. Kein draußen Rumstehen, ein drinnen Sitzen ist möglich. Logisch auch, manche dürfen die Station nicht verlassen und es gibt hier keinen Balkon, somit müssen sie uns die Möglichkeit geben, drinnen zu rauchen. Vor dem Mittagessen suche ich diesen Raum auf. Zirka 10 Quadratmeter. Nur die Toiletten sind kleiner. 4 Stühle, ein Standaschenbecher, ein Waschbecken ohne Spiegel und ein Fenster. Die Wände wurden von den Patienten teilweise beschriftet. Eine Hinterlassenschaft tut es mir besonders an. Es ist ein gezeichnetes Oval, zirka 40 Zentimeter hoch und 30 Zentimeter breit. Darüber steht „AM PLAN VORBEI“. In das Oval sind 15 Kreise gezeichnet, in jedem steht „Erde an..“ mit verschiedenen Endungen. „Erde an Motorikzentrum, Erde an Duschtag, Erde an Mentholtschick, Erde an Pumpernickel, Erde an Schwester Monika, Erde an Goji-Beeren“ und so weiter.
Die Zigarette schmeckt wie selten eine.
Einige Männer auf dieser Station machen mir Angst. Sie strahlen Aggressionen aus. Ich meide sogar sie anzusehen aus Sorge, dass ein Blick wie eine Nadel sein könnte, die sie zum Platzen bringt wie einen Luftballon. Ich bin nicht interessiert an ihren Geschichten oder Symptomen, ich versuche durch neutrale Körperhaltung durchzurutschen, nicht als angriffswürdig zu erscheinen, was sowohl Opferhaltung als auch zu große Selbstsicherheit bewirken könnte.
Wieder am Zimmer ertönt die Stimme einer Schwester durch einen Lautsprecher:
„Es gibt Mittagessen“. Ich bin zwar völlig am Arsch, aber so etwas vermag mich selbst dann noch zu unterhalten.
Ich benötige Sonderkost. Da neben anderem auch Gluten ein Problem darstellt fällt das Essen frugal aus. Es passt zu meinem Zustand. Weniger ist nicht mehr.
Weniger ist immer weniger. Aber es gibt Situationen, da ist weniger besser. Für mich gilt das momentan vor allem was Kommunikation angeht. Ein Russe mir gegenüber am Esstisch hat Mitleid und will mit mir darüber reden, weshalb nur Reis auf meinem Teller ist. In den letzten Jahren baute ich vor allem die Kommunikationsform der höflichen Ablehnung aus, eine Methode, die so manch redselige Menschen vor den Kopf stößt, weil sie sich nicht erklären können, weshalb das Gespräch endet. Beim Mittagessen wirkt es. Aber 20 Minuten später steht der Russe bei der Medikamentenausgabe vor mir. Es werden auch Blutdrücke gemessen, deswegen dauert alles ewig. Hätte ich das gewusst, ich hätte mich nicht hinter ihm eingereiht. Er plaudert ohne auf Antwort zu warten. Er erklärt mir, dass der Stützpunkt der Schwestern nun unser Stammlokal ist, und dass er versuchen wird, eine weiße Tablette pulverisiert zu bekommen, um sie sich in die Nase zu ziehen, ihm wäre nämlich langweilig. Ich lächle bemüht. Auch wir kommen mal dran, auch bei uns wird gemessen, auch wir bekommen unsere Chemie.
Eine Stunde später kommt eine Schwester zu mir, sie führt mit mir das pflegerische Aufnahmegespräch. Sie ist warmherzig und mitfühlend, sie zeigt Regung.
Kaum wen lässt meine Geschichte ungerührt, nur ich selbst habe noch immer nicht die passende Haltung dazu gefunden. Entweder ich dramatisiere oder ich staple tief, finde keine Anbindung, keine Emotion für mich selbst. Es sind eben verschiedene Anteile, die unterschiedlich zum Geschehenen stehen. Ich bin nicht rund.
Einer optimistischen Aussage von mir begegnet die Schwester mit einer schönen Äußerung:
„Ja, damit wir Sie wieder auf Vorderfrau bringen!“
Die Zeit nach dem Mittagessen verbringe ich schreibend und rauchend. Ich rauche hier viel. Ich brauche es, aber es ärgert mich, weil ich schon mehrmals aufhörte und froh damit war. Aber es ist wie ein Strohhalm. Ich halte mich fest an Altbekanntem. Und alles, was hilft, muss jetzt her.
Um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Im riesigen Aufenthaltsraum sitzt nur eine Frau, die auf einer mir unbekannten Sprache ins Telefon weint. Sie geht weinend raus, nachdem sie ihr Brandteiggebäck verputzte. Ich stürze mich auf eine Mangocreme, merke, wie hungrig ich bin.
Eine andere Patientin betritt den Raum.
„Was schreibst Du da, Deine Memoiren?“ fragt sie. Ich bejahe.
Ich hole Essensnachschub, sehe mir dabei zu, wie ich schnell werde vor Gier. Ich war am Verhungern.
Alle Flüssigkeiten außer Kaffee trinken wir aus grasgrünen oder magentaroten Plastikbechern, den Kaffee gibt es aber in normalen Tassen.
Vor mir am Tisch liegen meine Schreibunterlagen, eine zerknüllte Serviette, Traubenzucker, den ich brauche um Fruchtzucker verdauen zu können, Lactase-Tabletten, die ich benötige um Milchzucker verdauen zu können, meine Kaffeetasse und mein Spindschlüssel, ein kleiner, silberner mit lila Plastikanhängsel. Darauf steht Zimmer 4/8. Zusammengehalten werden die Teile durch ein dunkelblaues Band.
All diese Dinge wirken hyperreal. Wie plastisch mir immer alles erscheint, wenn ich das Gefühl habe, wieder mal knapp überlebt zu haben!
Der Aufenthaltsraum ist circa 50 Quadratmeter groß. Sein Fenster liegt mächtig an einer das Rechteck brechenden Schräge der rechten Seite wenn man den Raum vom Gang her betritt. Unter diesem Fenster befindet sich eine Kommode, auf der Getränke, Zeitungen und drei schrumpelige Kiwis dargeboten werden. Was die Kommode selbst angeht, so sind 2 der 3 verschlossenen Türen beschriftet mit
„Decken + Polster, Taschentücher, Hausschuhe“ und „Pflege-Utensilien“. Links von den Türen sind 4 Laden. Die oberen 3 sind nicht verschlossen, die erste ist leer, in den anderen beiden ist Lesestoff.
Im Raum stehen 6 Tische, die zu 3 Gruppen formiert sind. 15 Stühle gesellen sich um diese Tische, 4 weitere befinden sich an 2 Wänden. Da dies auch der Speisesaal ist kann man Rückschlüsse auf die Bettenzahl machen.
In der linken Ecke wenn man von Gang kommt ist klein und verloren wirkend ein Waschbecken mit Fliesenhintergrund. Die Wascheinheit wirkt wie von einem Puppenhaus geborgt und hingestellt. Zwei winzig wirkende, feuerfeste Mülleimer in Kirschholzoptik sind unter dem Waschbecken. Über der Keramik gibt es 4 silberne Häkchen, die einmal einen Spiegel trugen. Da ist nur keiner mehr. Genauso wie auf der Toilette und im Raucherraum, dort weisen einen die Eisen ohne Job ebenso auf das nicht vorhandene Glas hin. Kaputte Spiegel werden vermutlich einfach nicht nachbesetzt.
Es gibt einen Fernseher ohne Fernbedienung, es gibt einen Feuerlöscher, es gibt 11 ausgemalte Bilder in Din A4-Format an den Wänden, die wie Briefmarken wirken und mit Klebeband angebracht sind. An den Fenstern befinden sich österliche Bildchen, unauffällig, wie bunter, wegzuwaschender Dreck. Die Wände sind auch hier schmutzig, sie zeugen von den Gemütern mancher Patienten.
5 Türen gehen von diesem Raum aus. Im Uhrzeigersinn wenn man vom Gang kommt, die die erste Tür darstellt, gibt es eine abgesperrte Türe, die zu einem Behindertenklo führt, danach befindet sich der Eingang zu einem Patientenzimmer für Herren. Die Tür dem Gang gegenüber führt zu einem weiteren kleinen Gang, in dem Therapiezimmer sind, die Tür an der rechten Wand ist die Damentoilette, die automatisch von allen verwendet wird, da die Herrentoilette am anderen Ende der riesigen Station ist. Hinter dieser Tür befindet sich auch der Eingang zur Dusche.
Zur Einnahme der Nachmittagsmedikation werden wir auch via Lautsprecherdurchsage aufgefordert. Sie nennen uns sogar namentlich. Viele sind wir nicht, doch das Personal hat gut zu tun alle zusammenzutrommeln. Einige laufen ferngesteuert, einige sind bockig, ein kleiner Flohzirkus. Hat man den einen nach mühseligen Diskussionen mal dazu gebracht, seine Medikamente zu schlucken, ist der, der sich dahinter anstellte und schwer zum Anstehen zu bewegen war, schon längst wieder weg. Ist man so kooperativ wie ich, dann danken sie es einem mit unglaublicher Freundlichkeit.
Nachmittags und abends führe ich noch Gespräche. Ein 25–Jähriger spricht mich im Raucherraum an. Er ist auch seit heute da. Schnell sind wir beim Thema Suizid. Ich glaube er will Mitleid oder eine „Tu‘s nicht“-Konversation, doch ich gab ihm „Das können wir tun, ja.“ Er lamentierte, dass es aber etwas geben müsse, das dann schnell geht. Ich riet ihm zu einem Hochhaus. Das Gespräch verlief eigentlich recht lustig aus meiner Perspektive. Er bekam nicht was er suchte, aber er fühlte sich nicht unwohl und irgendwie verstanden. Er lächelte sogar mal.
Auch mit meiner plappernden Bettnachbarin rede ich noch. Sie fragt mich ob ich manisch sei, so viel wie ich schreibe. Ich glaube sie kennt die Manie. Sie ist schon Monate hier.
Zum Einschlafen versuche ich zu lesen, habe aber starke Konzentrationsschwierigkeiten.
Irgendwann schwinden mir die Sinne.
WIR SIND DER FEHLER IN DER MATRIX
Ein Erwachen mit Seelenschmerz. Ein Stich fährt in die Brust oder kommt aus ihr heraus, verwundet mich, quält mich. Der Stich ist wie ein Dolch aus Angst, der seine Energie wie einen Virus durch meinen Körper schickt, nachdem er in die Brust gedrungen ist. Ich lebe! Ich bedauere es zutiefst. Ich gehöre nicht hier her, bin fremd auf dieser Welt. Bin so lange schon fremd.
Das Frühstück wird gebracht. Zwei silberne Wägelchen werden in den Aufenthaltsraum geschoben. Der eine Wagen trägt Tassen, Kaffee in Thermoskannen, Milch in Krügen, Kakaopulver, Cornflakes, Müsli. Am anderen Wagen sind Teller, Brot, Wurst, Käse, Butter, Marmelade und Joghurt.
Ich esse nichts. Aber ich stürze mich auf den Kaffee, trinke hastig um schnell nachschenken zu können, denn wenn sie die Wägen wieder wegschieben, dann gibt es nichts mehr.
Unser dreckiges Geschirr stellen wir auf die zweite, sehr bodennahe Ebene dieser Wägen.
Wie lange sie jeweils stehen weiß ich nicht.
Ich schlürfe weiter die wohltuende Flüssigkeit. Der Fernseher läuft. Ein Urteil wird in den Nachrichten verkündet. Ein Sporttrainer missbrauchte x Mädchen. Ich bin nicht mehr erschüttert. Momentan sind fast täglich Meldungen wie diese in den Medien. Die #metoo-Aktion hat sehr viel ins Rollen gebracht. Früher war ich immer sehr zerstört und traurig, wenn ich solche Nachrichten vernahm. Manchmal verfolgten sie mich tagelang, lösten schwere Symptome aus und spukten in meinen Träumen rum, doch seit den Therapien der letzten Jahre mit einem speziellen Therapeuten ist alles anders. Und seit #metoo veränderte sich generell etwas. Davor kam hie und da eine Meldung, alle waren kurz fassungslos und dann verebbte das Thema wieder, ging unter und alle konnten so tun, als wären es Einzelfälle. Nun ist es anders. Es wird gerade das Geschwür des Missbrauchs freigelegt. Viele wagen es zu sprechen, es wird deutlich, was da geschieht, es ist nicht mehr so, dass ich mit meinen Erfahrungen und mit meinen Opferfreundinnen und -bekannten in einer gefühlten Parallelrealität lebe, in der ich mich martere und quäle, weil ich einfach nicht verstehen kann, dass das alles nicht häufiger Thema ist. Nun ist es Thema. Für mich rückt sich was gerade. Etwas Vertikales. Es wird aufgestanden und gesprochen, angeklagt und verraten, erzwungene Schwüre werden endlich gebrochen. Ein umfassender Befreiungsschlag in Zeitlupe geht vor sich. Es wird entdeckt.
Ich bekomme genügend Kaffee ab und die Wägen stehen immer noch da. Wie beruhigend.
Anschließend gehe ich zum Stammlokal, hole meine Medikamente und lasse mir den Blutdruck messen.
Plötzlich steht die Diätologin vor mir. Wir kennen uns von der Tagesklinik, trotzdem kommt sie zu mir, nun esse ich ja auch abends hier. Meine Wünsche können alle erfüllt werden. Ich ventiliere, dass ich mittags lieber Gemüse als Reis hätte, da recht oft ein Risotto dabei war. Im Gegensatz zu Reis ist Gemüse basisch. Es ist verrückt. Ich bedauere es am Leben zu sein, dennoch will ich mich so gesund wie möglich versorgen. Es sind riesige Therapiefortschritte. Ich kümmere mich gut um mich und will dennoch tot sein. Ich kann mir das wieder nur mit verschiedenen Anteilen erklären. Manche Anteile wollen sterben, andere fragen nach Zahnseide und basischem Essen.
Um 8 Uhr 30 werden wir zur Morgenrunde gebeten. 5 Patienten sind fit genug, um daran teilzunehmen. Eine freundliche Schwester geht mit uns in einen Raum, der an dem kleinen Gang liegt, der vom Aufenthaltsraum wegführt. Wir nehmen uns Sesseln und bilden einen Kreis. Als Neue stelle ich mich kurz vor und dann spricht die Schwester über die Arztvisite. Sie motiviert uns mit den Ärzten ausführlich zu sprechen, nicht nur kümmerliche Auskunft zu geben. Sie fordert die Depressive vom Bett mir gegenüber dazu auf, zu äußern, was sie heute dem Arzt sagen wird, wenn er sie fragt, wie es ihr geht.
„Durchwachsen“ antwortet sie.
„Sehen Sie, das ist ein gutes Beispiel. Was heißt das, was meinen Sie damit?“ fragt sie weiter. „Nicht gut und nicht schlecht.“ kommt als Antwort. Die Schwester bohrt weiter, will wissen, was das bedeutet und kitzelt der Kollegin greifbare Aussagen heraus.
„Gut ist, dass ich keine Panikattacken mehr habe, schlecht ist, dass ich sehr traurig bin.“
Die Schwester motiviert sie, das dem Arzt heute genau so zu sagen. Ein Abschlusssatz zu diesem Thema von ihr:
„Wir sind da, weil Sie da sind!“
Sie fährt fort mit einem Motivationsvortrag, der sich auf das bevorstehende Wochenende bezieht. Wir sollen spazieren gehen, raus aus dem Haus, um Ausgänge bitten wenn der Arzt heute kommt, uns bewegen, nicht nur im Bett liegen und auf das Essen warten. Sie macht das in sehr therapeutischer, positiver Manier, es ist ein fröhlicher, anstachelnder und wohlwollender Vortrag.
Dann machen wir Körperübungen. Jeder zeigt zwei Übungen vor und die anderen machen sie nach. Zu meiner Überraschung sind alle mit Einsatz dabei. Wir kreisen mit Füßen und Schultern, klopfen uns ab, dehnen und laufen im Kreis.
Beim Hüpfen am Ende passiert etwas mit mir. Ich bekomme heftige Angst. Was ist da los? Zum Glück ist es die letzte Übung. Sessel wegräumen, raus. Die Angst flacht ab, aber es bleibt etwas davon im Körper stecken. Es ist etwas heiß Bleiernes, das im ganzen Leib, meist zentral, vorhanden bleibt. Im Rumpf in den mittigen Organen, in den Extremitäten in den Knochen. Heiße Bleipartikel zischen abwechselnd herum und kommen zur schweren Ruhe, um beim nächsten beunruhigenden Gedanken wieder zu flitzen zu beginnen. Schwere Angst, die brennt und lähmt zugleich.
Visite. Eine Schwester holt mich aus dem Zimmer. Sie führt mich in das Besprechungszimmer rechts neben dem Stammlokal. Es sind viele Menschen drinnen, alle in freundlicher Stimmung. Ich werde gebeten zu erzählen, weshalb ich hier bin.
Ich kann flüssig reden, vielleicht zu schnell, so wie mir das nun oft passiert wenn ich vor mehreren Menschen reden muss. Ich rase verbal, plappere vor Nervosität, sage viel, oder mir steht das Hirn und ich kann nicht denken und reden. Einmal frieren meine Gedanken ein, ich greife zu meinem Notizzettel, den ich nun sicherheitshalber immer bei Befindlichkeitsrunden oder Gelegenheiten wie diesen wohlweislich dabeihabe.
Danach gehe ich aufs Klo. Per Bewegungssensor geht eine Lüftung los. Ich kann erst pinkeln nachdem sie wieder aus ist, weil ich mich nicht rühre. Die Toiletten sind kalt, dreckig und wären eine gute Kulisse für einen Horrorfilm. Beim Händewaschen blicke ich gegen die Wand, an der mal ein Spiegel hing. Links neben dem Waschbecken ist eine verbeulte Metallabdeckung, circa 20 mal 20 Zentimeter groß. Ich verwende sie als Spiegelersatz. Ein verbeultes Ich sieht mich an. Passt.
Der Tag ist hell. Um mich wird es enger. Die weggeschobenen Gedanken an den Tod erkämpfen sich tapfer die Oberhand. Ich entwerte alle Umstände um mich rum, entwerte mein Leben, fühle mich so klein. Dass es endet wird zum Wunsch. Ein gezielter Abgang, um dem Schmerz des Lebens zu entgehen, den meine Gehirnchemie verursacht. Im Gegensatz zu früher weiß ich nun über meine psychischen Erkrankungen bestens Bescheid, es hilft mir nur gerade nicht. Es kehrt alles immer wieder. Es holt mich ein wie eine Löwin die Antilope, wie ein Tornado rasch zusammengezimmerte Baracken. Die Größe des Bedürfnisses nach einem Ende wiegt mich in seiner Endgültigkeit und macht mir zugleich Angst. Ich wähne mich bereits tot, erwürgt mit meinem gelben Schal im Bad. Ich stelle mir die erlösende Ohnmacht vor, das Ersticken an sich, mache mir Gedanken darüber, ob ich vor dem finalen Zuziehen ein- oder ausatme, ob ich mir die Kehle oder das Zungenbein dabei breche und ob es sehr weh tun wird. Diese Gedanken schließen sich um mich, hüllen mich ein und wabern um meinen Kopf, unaufhörlich.
Eine Zigarette. Ich bin allein im Raucherraum, erfasse das Zimmer ganz anders als gestern. Die 10 Quadratmeter waren früher offenbar ein Überwachungszimmer.
Es ist das einzige Zimmer mit einem Holzboden, soweit ich das bisher mitbekam.
Die Tür hat ein Fenster, das circa 30 mal 40 Zentimeter im Querformat misst. Dicke Wände formen einen monströsen Türrahmen. Rechts vom Eingang sind teilweise geflieste Wände um das Waschbecken, beige gesprenkelt, sichtlich aus dem Jahre Schnee und farblich passend zum nikotingelben Raum. An der rechten Wand befindet sich ein vergittertes Fenster, an der hinteren stehen 3 Sessel, dahinter prangt an der rechten Seite das Erde an – Oval. An der linken Wand steht noch ein Sessel, ansonsten befindet sich dort nichts. Nur ein Lautsprecher mit Schwesternruf ist in Türnähe montiert. Die linke Wand trägt die meisten Inschriften. Ein INRI gibt es dort. Der hervorstechendste Schriftzug ist in grüner Farbe gehalten: „Wir sind der Fehler in der Matrix.“ Er wirkt selbstbewusst.
Es folgt das Warten auf einen angekündigten Spaziergang um 11 Uhr. Zur Trafik.
Gut so. Mir gehen Tabak und Filter aus. Ich drehe selber. Nur wenn ich viel Geld hatte kaufte ich mir fertige Zigaretten. Nun wuzle ich seit Jahren. Mein Tabakbeutel ist in einem Täschchen, das aus dem Material ehemaliger Fischfutterbeutel gefertigt ist.
Der Spaziergang zur Trafik heißt „Versorgungsausgang“ und führt auch zum Buffet am Gelände. Ich nehme mir Schokolade mit.
Als wir zurückkommen riecht es auf der Station blumig-ätzend und nach Plastik.
Der grau-blaue Linoleumboden des Aufenthaltsraumes wurde abgeschliffen und gereinigt. Das wird ein ungesundes Mittagessen.
Am Klo roch es gestern nach Zigaretten, heute riecht es nach Cannabis. Ich glaube ich kann zuordnen wer dort kifft. Es ist einer der Männer, dem ich aus dem Weg gehe.
Das Mittagessen kommt. Die Essensausgabe verläuft hier so, dass eine Abteilungshelferin mit ihrem Wagen in den Aufenthaltsraum kommt und an die austeilt, die erscheinen. Wir stehen vor dem Wagen an, was auch Probleme mit sich bringt, weil sich unhygienische Menschen über die Speisen beugen oder spuckend sprechen. Beides habe ich jetzt schon erlebt. Einfach nicht weiter darüber nachdenken.
Nach dem Mittagessen schlafe ich ein und erwache erst um 15 Uhr 37 in recht schlechtem Zustand. Angst. Und ich verpennte den Kaffee. Es schmerzt tief, macht mich völlig fertig. Es gibt keinen Automaten, ich habe nicht die Möglichkeit an eine Koffeineinheit zu gelangen. Eine rauchen. Die, die auf Entzug ist, sitzt im Raucherraum, Füße auf einem Sessel und sie schläft. Eine erloschene Zigarette in ihrer Hand. Ich drehe mir eine. Als ich sie anzünde kommt der Kerl, mit dem ich gestern das Suizidgespräch führte.
„Schöne Hose.“ meint er. Ich trage die Spitalsjogginghose in mint.
„Ich möchte mich gerade nicht unterhalten.“ sage ich.
„Okay.“ Er öffnet eine Packung Zigaretten und lässt Plastik- und Alufolie auf den Boden fallen. „Heb das auf!“ sage ich reflexartig und ärgere mich sofort über meine Reaktion.
„Ich mag jetzt niemandem was aufheben.“ meint er. Ich füge ein genauso intoniertes „Okay“ an wie seines. Ich rauche.
„Da wäre das Hochhaus besser gewesen, was?“ stichelt er. Ich sage:
„Nein.“ Er meint:
„Doch. Freiheit.“
„Das muss anders gehen.“ sage ich ruhig. Er zischelt:
„Betrüger.“ Ich antworte:
„Nein.“ und lache ein verzweifeltes Lachen um ihm die Macht nicht zu überlassen.
„Betrüger.“ flüstert er. Es wird gruselig und ich reagiere nicht. Meine Zigarette ist zu Ende. Ich gehe.
Mit meinen Zimmerkolleginnen komme ich inzwischen ins Gespräch.
Das Plappermäulchen redet gerne und schnell, es endet dann aber auch wieder.
Sie ist sehr nett und ist schon lange hier. Seit Anfang Dezember. Sie ist wohnungslos und das Spital wird sie nicht einfach auf die Straße setzen. Sie war auch schon auf einer anderen Station, auf der Subakut-Station, dort ist alles ein wenig freier als hier und es gibt mehr Therapie, doch sie hat dort etwas gemacht, das sie nicht erzählen will, und wurde wieder hierher verlegt. Sie ist 30 Jahre alt und wirkt auf alle wie 17.
Die, die meiner Meinung nach auf Entzug ist sagt, dass sie es nicht ist, das glaube ich ihr aber nicht. Sie wurde in jungen Jahren pensioniert, weil sie magersüchtig war. Das ist sie heute nicht mehr, weshalb sie sich natürlich fett findet.
Sie ist normalgewichtig. Sie fing irgendwann an mit Drogen zu experimentieren und nahm regelmäßig Substitol, das sie daraufhin vom Arzt verordnet bekam. Sie ist völlig kaputt. Ihr Körper ist übersät von Selbstverletzungsnarben. Sowohl die Spuren von tiefen Schnitten als auch von unzähligen Brandwunden, die mit Zigaretten verursacht wurden, finden sich auf ihrer Haut. Letztere vornehmlich auf der rechten Körperhälfte. Sie muss von enormem Selbsthass getrieben sein. Allein das Hinsehen tut weh. Sie dämmert ständig dahin. Beim Rauchen müssen die anderen Sorge tragen, dass sie sich nicht abfackelt, weil ihr dauernd die Zigarette aus der Hand fällt. Oder sie sitzt ewig im Raucherraum und kommt vor dauerndem Wegnicken nicht dazu, sich ihre Zigarette anzuzünden. Sie ist personifizierter Schlaf, macht alle Bewegungen in Zeitlupe. Ihr Gesicht ist tätowiert, ein Muster auf der Wange in der Nähe des Ohres, ein kleines Symbol beim 3. Auge und auch sonst trägt ihr Körper so einiges an Tätowierungen. Sie ist gepierct und hat einen ausgerissenen Tunnel an einem Ohr.
Ihr Gang wirkt mörderisch, so als ob sie bei jedem zweiten Schritt umfallen müsste, sie steht ihre Schlenkerer aber immer. Sie ist hier, weil sie daheim in einen argen Zustand rutschte, alles in der Wohnung vollkotzte und ihre Ausscheidungen nicht mehr halten konnte. Sie aß tagelang nichts und trank nicht richtig. Sie möchte noch ein paar Tage bleiben um eine Aufräumfirma organisieren zu können, die ihr ekeliges Chaos beseitigt. Sie ist sanft und freundlich, obwohl wir ihr mit unseren Hilfsmaßnahmen beim Essen auf die Nerven gehen.
Da sie während der Bewegung des Gabel-an-den-Mund-Führens permanent einschläft wecken wir andere sie laufend auf. Wir motivieren sie zu trinken, wollen sie bewahren vor dem vom Sessel Fallen und so weiter. Sie fühlt sich wie ein Kind behandelt und wehrt sich manchmal mit kleinlauten Worten dagegen. Sie hat keine Kraft.
Die dritte Kollegin, die im Bett mir gegenüber, ist eine klassische ängstliche Depressive. Sie hatte Probleme mit der Hausverwaltung und fühlt sich von den Vermietern verfolgt. Niemand glaubt ihr und somit wurden ihr Wahnvorstellungen diagnostiziert. Sie ist immer nett, bemüht nicht anzuecken, sich oft entschuldigend, leise.
Und ich, wie wirke ich wohl gerade? Vermutlich am ehesten wie die zuletzt Beschriebene. Ich bin kleinlaut, wirke verstört und bin zutiefst verunsichert. Doch das Personal sieht meine Kompetenzen, meine Reflektiertheit, meine Fähigkeiten. Bei der Visite meinte ein Arzt, dass er mit meinem behandelnden Psychiater draußen telefonierte und dass dieser sich über meine Kunst sehr positiv äußerte. Ich bin nämlich Malerin. Das ist das, was ich am längsten mache und am besten kann.
Ich male meine Zustände, meine Dämonen, meine Retter, ich male meist Inneres.
Manchmal Äußeres. Meine tote Mutter zum Beispiel. Wenn ich etwas Äußeres male, dann muss es etwas Morbides sein oder etwas, zu dem ich einen starken Bezug habe, beziehungsweise um etwas auszudrücken. Zum Beispiel ein Insekt. Ein Käfer. Er soll das Gefühl von krabbelnden Beinen vermitteln, den harten Panzer und das schleimige Innere. Oder wenn es ein aasfressender Käfer ist, so steht er für Verderben und Leben aufgrund von Tod. Wenn ich eine Mauer male, dann sind innere Mauern gemeint, wenn ich Stufen male, dann geht es um zu Erklimmendes und um Hürden oder um die 10 Stufen, die ich in der Therapie vor der Hypnose hinabgehe, um in Trance zu gelangen. Wenn ich einen sezierten und präparierten Frosch male, dann steht er für das innere Sezieren und das Festhalten dieser Ergebnisse. Wenn eine Puppe vorkommt, dann steht das für eine verlorene Kindheit, Kindesmissbrauch und Vernachlässigung. Wenn ich auf einer Leinwand nur einen Körper male, so ist es immer ein Ausdruck eines Zustandes. So, wie der Körper dargestellt ist, so fühle ich mich dann gerade. Und dann gibt es in den letzten Jahren die Bilder der Ego States. Dazu muss ich etwas ausholen.
In einer schweren Krise, ähnlich der momentanen, bat ich um eine Aufnahme im Therapiezentrum Ybbs an der Donau. Das war am Ende des Jahres 2014. Im Jahr 2010 und 2012 war ich schon dort und verließ das Spital, das stationäre Psychotherapie anbietet, jeweils nach der dreimonatigen Therapiezeit mit der Empfehlung, in einem Jahr wiederzukommen, was ich beide male ignorierte. Es ist auch nicht leicht eine Arbeit zu behalten, wenn man pro Jahr 3 Monate fehlt. In Ybbs gibt es verschiedene Stationen, die einen beschäftigen sich mit Suchtpatienten, die anderen mit Borderline-Patienten, anderen Persönlichkeitsstörungen oder Traumapatienten. Ich wurde auf einer Trauma-Station behandelt. Die Therapie besteht, wie in all solchen Einrichtungen, aus einem Mix aus Ergotherapie, Entspannungsübungen, Gruppentherapie und Einzeltherapie. Außerdem werden Dinge wie Aromatherapie, Qi Gong und Sport angeboten.
Da ich im Haus bekannt war, erhielt ich 2014 schnell einen Platz zur Stabilisierung und blieb 7 Wochen. Zum ersten Mal traute ich mir zu, mit dem Therapeuten der Station zu arbeiten, davor wurde ich auf meinen Wunsch hin immer von Frauen betreut. Er wendet unter anderem Ego State Therapie an, eine Methode, bei der man unter Hypnose verschiedene Anteile des Patienten sprechen lässt. Jeder hat Ego States, man kann das auch mit Anteilen, Rollen, Mustern, neuronalen Netzwerken übersetzen. Eltern haben zum Beispiel ein Eltern-Ego State, das sie mitunter das Kind auch noch wie ein Kind behandeln lässt, obwohl es selbst schon Kinder hat. Es gibt Schüler-Ego States, das Menschen bisweilen in der Erwachsenenbildung einholt und sie Dinge tun und sagen lässt, die einem 13-Jährigen entsprechen, es gibt berufliche Ego States und partnerschaftliche und so weiter.
Eine ganz normale Sache. Bei Traumatisierten wird es dann etwas spezieller, denn während dem Erleben einer traumatisierenden Situation kann es sein, dass blitzartig oder nach und nach ein Ego State entsteht, das dazu dient, das Erlebte gut zu überstehen. Wenn man zum Beispiel als Kind geschlagen wird, dann kann sich ein Anteil bilden, der einem sagt, dass man schlecht ist und es nicht besser verdient hat. Das Innen stimmt mit dem Außen überein und man kann sich erklären, weshalb die Menschen, von denen man abhängig ist, so zu einem sind. Das Problem ist, dass dieser Anteil nicht verschwindet, wenn die Schläge vorüber sind. Man hat einen Einflüsterer im Kopf, der einen niedermacht, der einem nach wie vor erklärt, dass man Schläge verdient und dass man ein furchtbarer Mensch ist. Durch diese Einflüsterer schafft man oftmals Realitäten, die den Botschaften entsprechen und zu ewigen Wiederholungen führen. Findet man zu einem Ego State-Therapeuten, so nimmt dieser mit diesen Anteilen Kontakt auf und versucht das Verhalten abzuändern.
Unter Hypnose geschehen da die erstaunlichsten Dinge. Mein Therapeut führt mich zuerst über die 10-stufige Stiege hinab. Dann leitet er mich an meinen sicheren Ort, ein in mir entstandener Platz, an den niemand sonst kann, außer ich erlaube es. Dort bleibe ich kurz und rutsche noch tiefer in Trance. Danach gehe ich an den Begegnungsort, ein Raum, in dem der Therapeut meine Ego States trifft.
Er äußert dann mit welchem Anteil er sprechen möchte. Bleiben wir beim Beispiel des geschlagenen Kindes. Es wird nach dem Anteil gefragt, der einen niedermacht und meint, man dürfe geschlagen werden. Im Idealfall betritt etwas den Raum oder eine Stimme meldet sich. Bei mir sind es meist konkrete Bilder. Dieses Etwas hat großteils einen Namen, der ganz plötzlich auftaucht, es weiß um seinen Entstehungszeitpunkt und kennt den Grund seines Hierseins. All das wird erfragt, und der Therapeut bedankt sich für seine Existenz und die wichtige Arbeit, die es vollbrachte, erklärt dem Ego State, dass diese Situation nun aber vorbei ist und die gewohnten Handlungen nicht mehr notwendig sind. In weiterer Folge wird eine andere, eine konstruktive Tätigkeit für diesen nicht verschwindenden Anteil gesucht.
Wenn das klappt, dann ist das Problem gelöst. So der Idealfall. Ziemlich bald nach Beginn dieser Therapieform versuchte ich meine Ego States zu malen. Die meisten haben menschliche Gestalt, es gibt aber auch einen Sturm zum Beispiel, er ist eine berstende Wolke, ein rumorender Haufen. Anfangs misslangen die Versuche sie abzubilden, doch nach und nach funktionierte es immer besser. Seit dem ich diese Therapie mache sind sie der Hauptinhalt meiner Bilder.
Vor diesem Stabilisierungsaufenthalt im Winter 2014/15 gelobte ich, mich diesmal an die Empfehlungen des Hauses zu halten, was weitere Aufenthalte anging.
Ob ich das auch getan hätte, wenn ich gewusst hätte, was folgt, das bezweifle ich.
Es wurden 3 Langzeittherapien im Umfang von jeweils 12 Wochen. Dazwischen war ich immer 6 Monate daheim. In diesen Wartezeiten erging es mir meist recht gut, nur waren die Aufenthalte oft die Hölle. Das Bohren in der Scheiße ist nichts Angenehmes und ich verfluchte oft die Ego State-Arbeit. Wenn wir einen destruktiven Anteil bearbeiteten, so war das wie das Stochern in einem Wespennest. Die Gefühle, die diese Anteile auslösten, waren allumfassend und stark. Die körperlichen Empfindungen der Entstehungserlebnisse schwappten mit hoch, die Einflüsterungen dieses Ego States wurden lauter, präsenter und dichter. Oft verfluchte ich diese Methode, hatte Angst vor jeder Therapieeinheit und konnte förmlich spüren, wie sich diese Anteile wehren gegen eine Bearbeitung, sie fühlten sich nämlich in ihrer Existenz bedroht und konnten das Ändern ihrer Aufgabe nicht als Erlösung betrachten, sondern nur als Identitätsraub.
Dieser Mann, der mit den Ego States spricht, arbeitet auch noch mit anderen Methoden, die die Problematik der im Körper abgespeicherten Traumata beinhaltet. Er vertritt die Meinung, dass man über viele Begebenheiten bis zum Nimmerleinstag sprechen kann, wenn es im Körper verankert ist, dann wird einem das aber nicht helfen. Er ist nicht an der Linderung von Symptomen durch das Aussprechen interessiert, sondern am Ausmerzen der Ursache des immer wieder Hochkommenden.
Die eine Methode ist ein Nachstellen. Sie geht davon aus, dass, wenn man sich gedanklich in das Traumatische begibt oder gewisse Handlungen, wie zum Beispiel ein Festgehaltenwerden, nachahmt, der Körper automatisch mit erlösenden Bewegungen reagiert, die ihn dann, langsam wiederholt, von diesem Abgespeicherten befreit. Ein an den Händen Fixiertsein zum Beispiel, beantwortete ich, bevor ich meine Hände in die des Therapeuten legen konnte, mit dem Angreifen meines Handgelenk und einer rotierenden Bewegung. Diese führte ich dann an beiden Unterarmen in Zeitlupe aus, somit konnten die belastenden Empfindungen minimiert werden. Ein andermal saß ich auf einem Stuhl und ich lief, meine Beine schnell bewegend, mit geschlossenen Augen und die damalige Situation imaginierend, weg. Diese Vorgehensweise beruht darauf, dass sich auch vieles in den Muskeln speichert und ein körperliches Abreagieren, wie es Tiere zum Beispiel instinktiv tun, bei uns abtrainiert wurde. Je westlicher der Kulturkreis, umso weniger körperlich ist eine Reaktion auf etwas Schlimmes.
Die weitere von ihm durchgeführte Methode ist eine psychokinesiologische, die davon ausgeht, dass Traumata in Organen abgespeichert werden, die man von diesen Erlebnissen entkoppeln kann. Man liegt auf einer Liege und streckt einen Arm in die Höhe, mit dem man Widerstand gegen den Druck der Hand des Therapeuten ausübt. Wenn man an ein belastendes Erlebnis denkt, so kann man dem Druck nicht standhalten, weil diese Gedanken den Körper schwächen. Mit der zweiten Hand des Therapeuten wird der Körper gescannt, Organe werden abgetastet und der Muskeltest, mit dem der Arm hinuntergedrückt wird, wird laufend wiederholt. Es kristallisiert sich ein Organ heraus, in dem das Erlebte sitzt, zum Beispiel die Schilddrüse. Diese steht für Erniedrigung und wurde bei mir oft das sich herausstellende Organ. Sie fand auch Einzug in meine Bilder.
Mittels der Methode des EMDR, einer Behandlung, die in der Traumarbeit oft zum Einsatz kommt, wird das Organ von dem Körperspeicher erlöst. Erinnerungen werden normalerweise, nachdem sie durch den Hippocampus wandern, in einer der Gehirnhälften abgespeichert. Wenn das Geschehene nicht zugeordnet werden kann oder zu belastend ist, um weiter zu wandern, so bleibt es im Hippocampus stecken. Das ermöglicht das Erleben von Flashbacks und das ständige Präsentsein des Geschehnisses. Es wird nicht verarbeitet und fühlt sich dadurch so an, als würde es soeben geschehen oder als wäre es vor kurzem geschehen. Ein Distanzieren vom Erlebnis wird nicht erreicht. Um die Verarbeitung zu ermöglichen wird also mittels EMDR eine REM-Phase nachgestellt, indem der Therapeut seine ausgestreckten Fingern vor dem Gesichtsfeld des Patienten hin und her schwenkt, während man an dieses Ereignis denkt und den Fingern mit den Augen folgt.
Die Psychokinesiologie verwendet diese Methode im Zusammenhang mit dem Halten des Organs, in dem das Ereignis abgespeichert wurde. Alle unsere Zellen strahlen eine Bioluminiszenz ab. In den von Traumata belasteten Organen ist diese und die Durchblutung eingeschränkt und die Entkoppelung stellt beide Einschränkungen wieder her. Diese Wiederherstellungen spüre ich meist intensiv, eine erhöhte Aktivität in diesen Organen oder eine Veränderung der Empfindung ist beinahe ein wundersames Erleben. Am Ende reagiert der Körper idealerweise nicht mehr mit Schwäche, wenn der Arm hinuntergedrückt wird.
Diese Methoden eignete sich mein Therapeut an, weil er früher an der Bearbeitung von Belastendem scheiterte. Er ist kein Esoteriker, er ist Wissenschaftler, doch er bedient sich dieser esoterisch anmutenden Methode, weil sie einfach funktioniert. Flashbacks, Bilder und Körperempfindungen sind rasch abänderbar und bietet in Kombination mit der Ego State-Arbeit, die nur mit dem Gehirn zu tun hat, eine praktikable Ergänzung. Beinahe alle meine Therapiekollegen erleben diese Methoden genauso heilsam wie ich.
"Ego-State-Tummelplatz", 2017, 80x60cm, Acryl auf Leinwand
"EgosDate", 2015, 80x60cm, Acryl auf Leinwand
"Therapy fairground", 2015, 18x24cm, Acryl auf Leinwand
"Der Lärm des Alleingelassenwordenseins", 2015, 18x24cm, Acryl auf Leinwand
Das faszinierendste Ergebnis der Hypnose-Arbeit erzählte mir eine Mitpatientin, die jahrelang Stimmen hörte. Sie waren medikamentös nicht in den Griff zu bekommen. Ein paar Ego States-Sitzungen später und die Stimmen verstummten. Dieser Zustand hält nun schon seit Jahren an.
Bei mir führten die Behandlungen zu großen Erleichterungen, doch machten sie mich offenbar nicht belastbarer, was eine Arbeitsfähigkeit angeht. Unter Belastung treten allerlei Symptome auf, aber es ist ganz anders als früher. Viele Körperempfindungen sind weg, Flashbacks treten kaum auf und die Distanz zu Erlebtem ist gegeben. Die Krise ist frei von ganz vielen früher immer auftretenden Symptomen.
Dennoch bin ich wieder hier.
Nur durch das Rauchen komme ich in Kontakt mit den Menschen außerhalb meines Zimmers.
Der Kerl, der mich Betrügerin nannte, weil ich mich nicht umbringe, wird stündlich allen gegenüber immer unguter. Am ersten Tag erschien er mir auch nicht ganz koscher, doch nun spitzt es sich zu. Er ist provokant, er nennt den Russen Fettsack, er redet dauernd über „den Ausweg“, stachelt die anderen an sich umzubringen und verhält sich so, dass er es darauf anlegt von jemandem geschlagen zu werden, es schlägt nur keiner hin. Ein Neuer erscheint im Raucherraum, der von ihm blöd angemacht wird.
„Das ist Dein Gesicht? Beileid. Schöne Scheiße, mit dem durchs Leben zu gehen.“
Nur solche Sprüche entfleuchen seinem Mund. Frauen provoziert er weniger, aber jede Zigarette ist begleitet von seinem dauernden Gelaber über Suizid und den Beleidigungen der anderen Patienten. Niemand bricht ihm die Nase und ich wundere mich darüber.
ALPHA-SINUS-REAKTOR
Ich erwache mit Angst. Ein Blick auf die Uhr. 4. Blöd. Eine Zigarette rauchen. Ich muss mich so sehr zwingen nicht über meine Situation nachzudenken. Wenn ich es tue, dann jagt ein Schmerz den anderen. Meine Gedanken sind in einer Schmerzspirale gefangen. Ich denke weg von der aktuellen Lage, versuche Positives zu denken, aber alles ist überzogen von Schmerz. Ein Gelee aus Angst und Pein liegt über allem Gedachten, es ist kaum auszuhalten. Ich denke an Erfolge und reagiere mit hochgradigem Stress. Egal wohin ich mich wende in meinen Gedanken, überall das gleiche Ergebnis. Wieder ins Bett. Ich schließe die Augen und begebe mich an meinen sicheren Ort. Das klappt. Dort finde ich etwas Ruhe und schlafe wieder ein.
Um 7 Uhr erwache ich wieder, natürlich mit Angst. Ich weiß nicht mehr ein oder aus. Das Zentrum dieser Angst ist abwechselnd der Magen und die Mitte des Brustkorbes. Dort ist etwas Schweres, von dort strahlt es aus, Wellen und Vibrationen von Qual, nervösem Schmerz, angstvolle Auflösung. Dieses Auflösungsgefühl nimmt an der Peripherie des Körpers zu. So ist das Grundgefühl. Dazu kommen dann Einschläge von Panik, die mir Schwindel verursachen, meinen Tinnitus aktivieren und mir den Atem rauben. Einen Kaffee trinken. Ich habe keinen zeitlichen Überblick, wann genau das Frühstück kommt. Ich sehe aus dem Zimmer und sehe keine Essens- und Kaffeewägen. Warten. Ich stinke vor Angstschweiß. Hinsetzen, geradeaus schauen. Ich schau nochmal. Wenn ich die Zimmertüre öffne und geradeaus sehe, dann ist da die Küche, wenn ich nach links blicke der Aufenthaltsraum. Wenn ich nach rechts blicke, dann ist dort an der gegenüberliegenden Gangseite von meiner Zimmertüre das Stammlokal, danach das Besprechungszimmer in dem die Visiten stattfinden und danach kommt der Raucherraum. Dahinter geht es weiter mit einem zweiten Aufenthaltsraum und weiteren Patientenzimmern.
Dort ist auch das Herrenklo. Gegenüber vom Stammlokal führt ein für hiesige Verhältnisse kleiner Durchgang zu weiteren Räumen. Einer ist ein Untersuchungszimmer, in dem ich bei der Aufnahme war.
Zwei weitere Zimmer dienen als Überwachungszimmer für Patienten.
Gestern sah ich im Stammlokal einen Monitor, auf dem vier Felder waren. Zwei davon waren schwarz, zwei davon zeigten Krankenzimmersituationen. Im Stammlokal gleich beim Eingang links sind ein Sessel und alle Gerätschaften zum Blutdruckmessen und zur Sauerstoffsättigungsüberprüfung, über diesen Geräten hängt dieser Monitor. Circa 2 Meter von der Eingangstüre entfernt ist eine Theke, die mit der rechten Wand verbunden ist. Dort bekommen wir unsere Medikamente. Wir nehmen einen Plastikbecher, füllen aus einer Plastikkanne Wasser ein und stellen ihn nach der Einnahme auf ein Waschbecken, das an der rechten Wand montiert ist. Immer das gleiche Prozedere. Links zum Messen, geradeaus zum Schlucken, rechts zum Abstellen und hinaus. Ein 6 Quadratmeter-Rundgang. Hinter der Theke sind die ganzen Patientenkurven, Arbeitstische mit viel Papier und die Anlage für die Durchsagen über den Lautsprecher.
Im Zimmer wartend höre ich die Wägen mit dem Frühstück fahren. Mein schwarzes Gold. Ich halte mich wieder an meiner Tasse fest. Der Kaffee ist dünn und besteht zur Hälfte aus entkoffeinierten Zutaten, aber egal. Etwas Angenehmes.
Das erste Angenehme heute. Beim Kaffee sitzend kommt eine Frau auf mich zu, sie wirkt offen, gut gelaunt und stark. Sie stellt sich vor als die Sozialarbeiterin des Hauses und möchte sich heute mit mir zusammensetzen. Ich teile ihr mit, dass ich um 11 Uhr ein psychologisches Gespräch habe.
„Dann am besten davor!“ sagt sie fröhlich und energisch. Es tut so gut auf Menschen zu treffen, die ihre Arbeit gerne machen. Sie geben mir Kraft und Hoffnung, ja, sogar Trost. Ich habe dann weniger das Gefühl eine Last zu sein für die anderen. Weniger. Weg ist das nie ganz. Mir wurde so früh und vehement vermittelt, dass ich eine Last bin, dass dieses Gefühl trotz häufigem Thematisieren und Therapieren nicht weggeht. Selbst bei Kleinigkeiten, die ich von jemandem brauche, habe ich Angst zu fragen. Habe ich dann gefragt, dann überkommt mich häufig ein schlechtes Gewissen. Je besser ich jemanden kenne, umso weniger tritt das auf, aber das bezieht sich auch bloß auf das Privatleben. Beruflich ist es sehr schwierig und als Patientin ist es am stärksten. Vollständig auf Personal angewiesen zu sein, das verursacht mir ein schlechtes Grundgewissen, das mehr als übel ist. Ich bin eine Last, ich bin zu blöd für mich selbst zu sorgen, ich bin zu schwach, um in dieser Welt zu bestehen, bin zu krank um gut zu leben. Dabei male ich mir im Vorfeld immer alles so schön aus. Weißmalen quasi. Mein unendlicher Optimismus ist ja immer wieder da, wenn es mir gut geht. Er zaubert mir Vorstellungen von Unerreichbarem in mein gedankliches Erleben. Dabei wäre es ja nur die Vorstellung von einem normalen Leben, von einer Arbeit, die mir Sinn verleiht, ohne mich zu überfordern und der zeitgleichen Möglichkeit Freundschaften zu pflegen. Hie und da ausstellen, abends und wochenends malen. Das ist weißgemalt. Doch sobald ich in einer Überforderung lande fetzt es mir den Boden weg. Das Weißgemalte verschwindet, es wird dunkel. Keine der Vorstellungen realisiert sich langfristig.
Keines der Bilder erwacht zum Leben, sie werden von der Realität zermalmt und an ihre Stelle tritt angstvolles Erleben. Es fühlt sich so an, als würde die Kulisse wechseln. Die Kulisse Welt verändert sich. Von weiß auf schwarz. Und in diesem Schwarz male ich meine besten Bilder. Schwarzmalen. In diesem Schwarz kann ich nicht jede Minute des Wachseins gegen meine Gedanken kämpfen, dafür reicht die Energie nicht. Ich lasse dann locker, lasse es reinbrettern, spiele mit der Schwarzmalerei, bin am Abgrund. Das Leben entgleitet mir regelmäßig, und trotzdem bin ich noch hier. Es fühlt sich aber so an, als wäre ich dann nicht mehr hier, wäre ein anderes Ich. Wie wir alle bin ich abhängig von der Wahrnehmung der Umwelt. Da die Umweltkulisse bei mir aber keine stetige ist, habe ich nie ein stetiges Ich entwickelt. Ändert sich meine Kulisse, so ändere ich mich. Ich bin viele. Ich bin niemand. Ich habe keinen Umriss.
Als ich klein war, war schon klar, dass nicht wichtig ist, dass ich ein Ich werde. Es war nur wichtig meine Eltern richtig zu interpretieren, um mich so verhalten zu können, dass ich ihnen keine Mühe mache oder sie gar zu verärgern um den Konsequenzen wie Demütigung und Liebesentzug zu entgehen. Ich entwickelte kein Ich, ich entwickelte ein „Um die anderen rum“.
Aus dem Gespräch mit der Sozialarbeiterin wird nichts, doch das mit der hiesigen Psychologin findet statt. Ich schildere ihr die Umstände, sie ist aber grob informiert, weil sie gestern bei der Visite dabei war. Die Angst, die mich im Griff hat, wird Thema. Sie schlägt eine Fokussierungstechnik vor, ich stimme zu. Sie nimmt ein Metallstäbchen mit Teleskoprohrfunktion zur Hand und fährt es aus. An der Spitze ist ein kleiner, weißer Zylinder, unten ein wenig breiter als oben und kantig abschließend, oben rund. Sie bittet mich nur auf diesen Zylinder zu sehen und diesen angstvollen Schmerz herzuholen. Sie fragt nach der Lokalisierung im Körper, nach Form, Konsistenz und Farbe und sie bewegt das Stäbchen langsam nach links und rechts. Wir suchen so eine Augenstellung, in der der Schmerz kleiner ist. Wir finden eine. Meine Angst ist eine silbergraue, sich drehende Kugel, die im Rumpf ihr Unwesen treibt. Die Konsistenz ist wie leicht zähes Blei. Es verändert sich etwas, sie rutscht tiefer, teilt sich in zwei Kugeln, womit sich die Wucht halbiert, die zwei Kugeln wandern in die Beine, eine rechts und eine links und sie zerteilen sich weiter, lösen sich auf.
Ähnlich ist es dann mit einer zweiten, weißen, kristallenen Kugel. Sie wandert in die Arme, diffundiert nach immer weiterer Zerlegung in den Blutkreislauf und wird im Anschluss an die Stunde per Urin ausgeschieden werden. Etwas wird leichter, ich entspanne. Wir konzentrieren uns noch auf eine Schutzwand für mich. Ich soll sie oft imaginieren. Noch in Halbtrance gibt mir die Therapeutin einen kleinen Jonglierball, er soll für die nun empfundene Entspannung stehen. Mein Körper erfährt seit Tagen das erste Mal Lockerheit und Erholung. Es geht mir viel besser als vorher.
Nach dem Mittagessen - der Aufenthaltsraum stinkt noch immer von der chemischen Reinigung - darf ich kurz nach Hause fahren, um mich um ein paar wichtige Dinge zu kümmern, die mich sehr beunruhigen. Um meine futterlosen Fische zum Beispiel. Mit dem Bus 48A fahre ich von der Haltestelle vorm Haupteingang des Spitals zur Lugner City, einem großen Einkaufszentrum, in dem es auch eine Zoofachhandlung gibt. In dieser kaufe ich Ferienfutter, Blöcke von fest gepresster Fischnahrung, die sich nur langsam löst und somit eine längerfristige Versorgung sichert. Von dort fahre ich weiter mit der U-Bahn nach Meidling, das ist der 12.
Wiener Gemeindebezirk, in dem ich wohne. Daheim regle ich alles, um die Gebühren für meine Website zu begleichen, gehe den Biomüll entsorgen, checke im Kühlschrank, ob da die nächste Woche eh nichts zu laufen beginnt und packe einige Sachen. Toiletttasche, Mal- und Zeichenutensilien, Ladegerät fürs Handy, Spielkarten und Lesestoff sind die Hauptpunkte. Meine Plappermäulchen-Zimmerkollegin hört übers Handy gerne Musik. Ihren Musikgeschmack finde ich jetzt nicht mal so schlecht, trotzdem zehrt es oft an meinen Nerven. Sie hat nur keine Kopfhörer, wie ich beim Nachfragen erfuhr, also packe ich welche ein, die ich nicht mehr brauche. Alles klappt. Das Einzige, das mich wirklich beunruhigt, ist, dass ich mich in meiner Wohnung nicht sicher fühle. Die Unruhe der Anreise wandelte sich in meiner Wohnung in Angst. Zu viel Furcht an einem Ort besetzt diesen mit den empfundenen Gefühlen, webt sich in die Materie, bis sie diese Gefühle ausstrahlt.
Es macht mich sehr verzweifelt. Ich müsste erst um 18 Uhr wieder im Spital sein, doch ich fahre so schnell wie möglich wieder hin. Und ich bin froh wieder hierher zu kommen. Das ist ein aussagekräftiges Beispiel für meinen Zustand. Vor Überanstrengung zittere ich mir mein Nachtmahlkäsebrot in den Mund. Mir kommt es so vor als wäre ich 2 Tage weg gewesen.
Im Raucherraum fällt mein Blick auf einen kleinen Schriftzug in der Ecke der rechten Wand. Alpha-Sinus-Reaktor steht da in lauter Großbuchstaben. Ich nehme ihn wahr, mache mir aber weiter keine Gedanken darüber. Zurück am Zimmer packe ich meine Sachen aus. Die Kopfhörer werden dankend angenommen. Die Spielkarten kommen gleich zum Einsatz, ich lege 2 Patiencen vor dem Schlafengehen. Es macht deutlich, wie gering gerade mein Konzentrationsvermögen ist. Ich übersehe viel und bin danach völlig erschöpft. Beim Lesen ergeht es mir ähnlich, doch ich bin voller Dankbarkeit was die Ruhe in unserem Zimmer angeht, dass ich überhaupt lesen kann. In dem Zimmer, in dem die ins Telefon Weinende schläft, herrscht ständige Unruhe. Sie jammert laut, zündet sich Zigaretten im Bett an und läuft permanent hin und her. Dass ein einziger Mensch so viel Wirbel machen kann erstaunt mich. Bei uns herrscht selige Stille, trotzdem strengt mich das Lesen ungemein an und ich verlese mich häufig. Aber ich bin froh, meinen T.C. Boyle bei mir zu haben. Vor allem bei den Einschlafschwierigkeiten dieser Nacht erweist er mir gute Dienste. Und das Lesen hindert am Denken. Nur nicht denken.
WIR SIND ALLE KUNST, GEZEICHNET VOM LEBEN
Ein Erwachen ohne Angst. Wow. Zeigt die Fokussierungsmethode von gestern Wirkung? So richtig eingelassen hatte ich mich in dieser Therapiestunde. So sehr, dass sich die Therapeutin am Ende dafür und für mein Vertrauen bedankte.





























