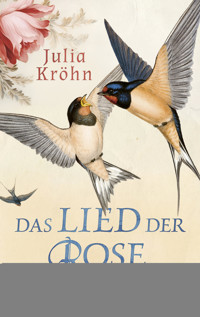
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das große Mittelalter-Epos über die Entstehung des Liebeslieds
Regensburg, 1096: Der junge Novize Marian träumt davon, mit gregorianischen Chorälen Gott zu preisen. Doch als er einen Juden vor der Zwangstaufe rettet, nutzt dies ein Rivale, um ihm ein schweres Verbrechen vorzuwerfen. Reinwaschen kann Marian sich davon nur, wenn er sich auf eine Pilgerfahrt begibt. Auf der abenteuerlichen Reise verschlägt es ihn an den Hof von Herzog Guillaume IX. von Aquitanien und dessen Frau Philippa. Hier lernt er die maurische Sängerin Sahar kennen. Marian verfällt ihrer Art der Musik sofort - ebenso wie der jungen Frau selbst. Doch bis die beiden die Liebe, von der sie singen, auch leben können, gilt es Kreuzzüge und Kirchenbann, Intrigen und Machtkämpfe zu überwinden.
Für alle Leser:innen von Ken Follett, Rebecca Gablé, Juliane Stadler und Daniel Wolf
Eine Mut machende Botschaft zu allen Zeiten: Gräben und Mauern lassen sich überwinden - durch die Macht der Musik und der Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 933
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Personae dramatis
Zitat
Prolog
ERSTER TEIL
1
2
3
4
5
6
ZWEITER TEIL
7
8
9
10
11
DRITTER TEIL
12
13
14
15
16
17
18
19
VIERTER TEIL
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FÜNFTER TEIL
29
30
Epilog
ANHANG
Zeittafel
Historische Anmerkung
Über das Buch
Regensburg, 1096: Der junge Novize Marian träumt davon, mit gregorianischen Chorälen Gott zu preisen. Doch als er einen Juden vor der Zwangstaufe rettet, nutzt dies ein Rivale, um ihm ein schweres Verbrechen vorzuwerfen. Reinwaschen kann Marian sich davon nur, wenn er sich auf eine Pilgerfahrt begibt. Auf der abenteuerlichen Reise verschlägt es ihn an den schillernden Hof von Herzog Guillaume IX. von Aquitanien und dessen Frau Philippa, wo er die maurische Sängerin Sahar kennenlernt. Marian verfällt ihrer Art der Musik sofort – ebenso wie der jungen Frau selbst. Doch bis die beiden die Liebe, von der sie singen, auch leben können, gilt es Kreuzzüge und Kirchenbann, Intrigen und Machtkämpfe zu überstehen.
Über die Autorin
Julia Kröhn wurde 1975 in Linz (Österreich) geboren und lebt in Frankfurt am Main. Die große Leidenschaft der studierten Historikerin ist nicht nur das Erzählen von Geschichten, sondern die Beschäftigung mit der Geschichte: Wenn sie nicht gerade an einem neuen Historischen Roman schreibt oder sich auf Recherchereisen Inspiration holt, gibt sie ihr Wissen als Guide im Historischen Museum weiter. Besuchen Sie die Autorin unter www.juliakroehn.at im Internet.
Julia Kröhn
DAS LIED DER ROSE
Historischer Roman
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2025 by Julia KröhnCopyright Deutsche Originalausgabe Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zumTraining künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: René Stein, KusterdingenUmschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, MünchenKartenillustration: Markus Weber, Guter Punkt | Agentur für Gestaltung, MünchenEinband-/Umschlagmotiv: © Olex Runda – stock.adobe.com; Mockup Lab – stock.adobe.com; Mannaggia – stock.adobe.com; Johannes WiebeleBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-7479-6
luebbe.delesejury.de
Personae dramatis
(die historischen Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet)
IN BARBASTRO
Tarana, eine qayna
Ferida, ihre Herrin
Ramnulf de Villiers, ein Ritter aus Aquitanien
Adémar, sein Sohn
Loic, ein Sänger
IN AQUITANIEN
Herrscherhaus
Guillaume (*), Graf von Poitou und Herzog von Aquitanien
Philippa von Toulouse (*), seine Frau
Hildegard von Burgund (*), seine Mutter
Hugo (*), sein Bruder
Agnès, Mahaut, Gui und Raimon (*), Guillaumes und Philippas Kinder
Sibille (*), Guillaumes uneheliche Tochter
Violante, Philippas Hofdame
Sahar, Philippas Schützling
Guillaume de Montmoreau (*), Raimons Erzieher
Angelus, Sahars Sohn
Adel
Hugues le Diable (*), Hugues Le Brun (*), Ebbon und Simon de Parthenay (*), Fulko IV. und Fulko V. d’Anjou (*), allesamt Guillaumes mächtige Gegenspieler
Aimery I. (*), Graf von Châtellerault
Dangerosa (*), Aimerys Frau und Guillaumes langjährige Mätresse
Aénor (*), Dangerosas Tochter
Guillaume Taillefer von Angoulême (*), ein enger Verbündeter von Guillaume und in dessen Abwesenheit Statthalter von Aquitanien
Odo von Mauzé (*), der Seneschall von Aquitanien
Hugues de Doué (*), Odos Nachfolger
Eble II. de Ventadour (*), ein Gefährte von Guillaume und begeisterter Sänger
Kirche
Petrus (*), Erzbischof von Poitiers
Girard (*), päpstlicher Legat und Bischof von Angoulême
Der Abt von Montierneuf (*)
Schwester Odilia, Nonne in Talmont-sur-Gironde
Sonstige
Bernard, ein Ritter
Daniel Quatre Os (*) und Hercule, zwei Kämpfer
Constance, Guis Amme
Geneviève und Blandina, zwei Bauernmädchen
Gerard le Roux (*), Cercamon (*) und Marcbrun (*), Sänger an Guillaumes Hof
IN REGENSBURG
Marian, ein Novize
Bruder Romuald, der Kantor des Klosters
Vater Theodulf, der Abt
Bruder Thomas und Bruder Cölestin, weitere Mönche
Bruder Gerwin, der Verantwortliche für die Krankenstube
Akiba, ein jüdischer Medicus
IN TOULOUSE
Herrscherhaus
Raimon de Saint-Gilles (*), Graf von Toulouse
Elvira (*), seine Frau
Bertrand (*), sein älterer Sohn
Alphonse-Jourdain (*), sein jüngerer Sohn
Adel
Guilhelm Jourdain (*), Graf von Cerdagne
Adhémar de Bruniquel (*), Vizegraf von Toulouse
Ermengarde und Bernard-Aton (*), Vizegräfin von Bézier und Carcassonne und ihr Sohn
Centulle de Bigorre (*), ein Landbesitzer und Ritter
Pons de Montpezat (*), sein Knappe
Kirche
Munion (*), Propst von Saint-Sernin
Didier (*), Bischof von Cahors
Pierre d’Andouque (*), Bischof von Pampelune
Jüdische Gemeinde
Salomon ben Ezra, ein jüdischer Medicus
Jochebeth, seine Tochter
Schlomo, Jochebeths und Akibas Sohn
Sonstige
Yussuf, ein Gärtner
Esteve, ein Ritter
AUF KREUZZUG
Ida (*), Markgräfin von Österreich
Bruder Ludger, ein Mönch und Idas Vertrauter
Alexios Komnenos (*), Kaiser von Byzanz
Welf IV. (*), Herzog von Bayern
Corba von Thorigné (*), eine französische Adelige
Erzbischof Thiemo von Salzburg (*), Erzbischof Ulrich von Passau (*) und Gerald, Abt von Admont (*), Kleriker
IN FONTEVRAUD
Robert d’Arbrissel (*), Wanderprediger, Kirchenreformer und Klostergründer
Bruder Hilaire, Mönch in Fontevraud
Petronilla (*), Witwe des Grafen von Chemillé, zeitweilig Äbtissin
Hersendis (*), Witwe des Grafen von Montsoreau, zeitweilig Äbtissin
Wenn jemals eine Freude erblühen könnte,sollte die Freude der Liebe Wurzeln schlagenund über allen anderen glänzen,wenn der Tag heller wird.
GUILLAUME VON AQUITANIEN
Prolog
BARBASTRO, AL-ANDALUS · 1064
»Mit der Nacht kommt der Tod. Ein letztes Mal werde ich im sanften Wind tanzen, ein letztes Mal den Mund für ein beglücktes Lachen öffnen, ein letztes Mal mein Gesicht zur rot glühenden Sonne heben. Und dann, dann werde ich sterben.«
Nachdem sie ihr trauriges Lied beendet hatte, rannen Tarana Tränen über die Wangen. Nicht nur sie war zutiefst ergriffen, auch Ferida, die Gattin ihres Herrn. Sie wachte über die Ausbildung der jungen Sklavinnen, die dieser im Kindesalter kaufte und mit denen er später, wenn sich ihre Begabungen entfaltet hatten, ein Vermögen verdiente. Doch das tat sie nie mit unbarmherziger Strenge, sondern immer voll Wärme, wie sie eine Frau, an der alles üppig war – Rundungen wie Appetit –, überreich zu verschenken hatte.
»Jetzt … jetzt bist du eine qayna«, erklärte Ferida, nachdem sie ihre Fassung wiedergefunden hatte.
Tarana riss überrascht die Augen auf. Mit sechzehn Jahren galt sie zwar längst als Frau, doch als Ferida sie vorhin gebeten hatte, ein Lied zu singen, hatte sie nicht damit gerechnet, der entscheidenden letzten Prüfung unterzogen zu werden. »Aber … aber eine qayna bin ich doch erst, wenn ich auch bewiesen habe, dass ich sämtliche Männer in der Dichtkunst schlage, aus jedem Wortgefecht als Siegerin hervorgehe und eigene Lieder hervorbringen kann!«
»Ich bezweifle nicht, dass du es in all diesen Disziplinen zur Meisterschaft gebracht hast. Und ich weiß, dass du in Logik, Geometrie und Astronomie ebenso geschult bist wie darin, den Koran zu rezitieren. Du verfügst ferner über ungewöhnliches Wissen und kannst deswegen erklären, wie man Schwerter herstellt, deren scharfe Klinge ein einzelnes Haar mühelos durchtrennt. Aber das ist nicht das Wichtigste.« Ferida erhob sich etwas schwerfällig vom Diwan, neben dem in einem Räuchergefäß gerade betörend duftende Krümel Ambra verbrannten, trat zu Tarana und strich ihr über das Haar. Es war von rotgoldenem Glanz, ohne dass sie mit Henna nachhelfen musste, so wie die Haut von einem Weiß war, für das andere sie mit Kalkpaste und einen Bimsstein hätten bearbeiten müssen. Ihre grünen Augen wiederum stellten den Glanz eines Topases in den Schatten. »Das Wichtigste sind deine Schönheit und deine Stimme. Wem immer du dienen wirst – dein Gesang wird wie ein Balsam in dunklen Stunden sein und wie prickelnder Wein in Augenblicken großer Triumphe. Nicht nur, dass du über dreitausend Lieder beherrschst. Auch vermagst du die Stimmung deines Herrn vorherzusehen, als wärst du das Herz in seiner Brust.«
Das war zweifellos übertrieben. Aber in diesem Moment wusste Tarana zumindest ganz genau, was Ferida fühlte – unendliche Trauer, die junge Frau zu verlieren, die ihr so nah wie eine Tochter stand. Auch ihr selbst wurde die Kehle eng bei dem Gedanken, bald Abschied nehmen zu müssen. »Eben habe ich etwas falsch gemacht. Ich hätte kein trauriges Lied singen sollen, das vom Tode handelt, sondern eines, das dich aufheitert«, sagte sie bestürzt.
»Es ging ja nicht um den Tod eines Menschen – nur um den verblühenden Tag, der ein letztes Mal von den Sonnenstrahlen geküsst wird, ehe er sich den schwarzen Armen der Nacht ergibt. Aber der Moment wird kommen, da die hauchdünnen Fäden der Morgenröte einen neuen Tag ankündigen, was bedeutet, dass dieser Tod nicht endgültig ist.«
Aber ihr Abschied voneinander würde endgültig sein, und deswegen perlten noch mehr Tränen über Feridas Wangen, selbst wenn sie sie energisch abwischte. »Dass ich auch so rührselig bin!«, schalt sie sich selbst.
»Warum kann ich nicht hier in Barbastro einem Herrn dienen und in deiner Nähe leben, sodass wir uns immer wieder sehen können?«, fragte Tarana.
Der kummervolle Ausdruck wich einem strengen. »Barbastro ist eine reiche Stadt. Eine stolze ebenso, und das nicht unverdient. Niemand in Lérida und Saragossa könnte sich sicher fühlen, wenn nicht unsere Mauern anrückende Feinde fernhielten. Und hier am Fluss Vero bringt der fruchtbare Boden güldeneres Getreide hervor als anderswo, süßere Weintrauben und saftigere Oliven. Ja, eine gute qayna könnte hier ein rechtes Leben finden. Aber du bist nicht einfach nur gut, du bist die Allerbeste. Einer wie dir hätte früher ganz Córdoba zu Füßen gelegen, und auch wenn unser prächtiges Kalifat zerfallen ist und in al-Andalus nur winzige Fürstentümer zurückgeblieben sind, soll zumindest das reichste unter ihnen deine Wirkstätte sein. Und das ist Sevilla. Vom dortigen Emir weiß man, dass er die Dichtkunst liebt. Er höchstselbst wäre ein würdiger Herr für dich.«
Die Begeisterung vertrieb die letzten Reste der Trauer, und Tarana versuchte, sich davon anstecken zu lassen. Sie war mit dem Wissen aufgewachsen, dass einzig ihr Herr über ihr Schicksal bestimmte und ihr Wille nicht zählte. Doch obwohl fast alle qiyan, wie die kunstsinnigen Sängerinnen bezeichnet wurden, Sklavinnen waren – sie wurden nicht in Fesseln auf dem Marktplatz verschachert, sondern von aller Welt wie Königinnen behandelt; nicht wenige stiegen zur Ehefrau auf und gebaren ihrem Herrn einen Sohn – was einen noch höheren Rang verhieß.
»Ich hoffe, dass ich mich deinen Erwartungen würdig erweise.«
»Nein, du musst dich einzig deiner Stimme würdig erweisen. Es genügt, so schön wie keine andere von Liebe und Tod zu singen.« Ferida atmete tief durch. »Aber genug jetzt von diesen schwermütigen Themen. Darüber kann man sich nicht fortwährend den Kopf zerbrechen.«
Schon griff sie in ein Kästchen aus gelacktem Holz mit Elfenbeinintarsien, das auf dem Tischchen neben dem Diwan stand. Es war mit ihrem Lieblingskonfekt gefüllt – feines Gebäck mit klein gehackten Pistazien und Mandeln, von dem Mirabellenmarmelade troff, auch hauchdünne Teigrollen, in Zimt, Ingwer und Nelken gewälzt und mit Sesamöl übergossen. Bald klebten Hände und Mund davon, und sie in einer Schale mit Rosenwasser zu reinigen, genügte Ferida nicht.
»Ich werde den restlichen Tag im Hamam verbringen«, verkündete sie, »und du wirst mich begleiten.«
Tarana unterdrückte ein Seufzen. Sie wusste, dass diese Einladung eine Auszeichnung war. Aber sie hatte nie recht verstanden, was so beglückend daran war, auf einer mit granatroten Baumwolltüchern bedeckten Marmorbank zu schwitzen und inmitten der dicken Weihrauchwolke kaum noch etwas zu sehen. Ein viel größeres Vergnügen war es für sie, Zeit im Innenhof zu verbringen, den Goldfischen im Brunnen zuzusehen, wie sie über das blau-goldene Mosaik flitzten, und sich am Duft von Hyazinthen, Schwertlilien und Anemonen zu laben, die sich an gestutzte Buchshecken schmiegten. Allerdings wusste sie, wie sehr Ferida nach Ablenkung lechzte, wenn ihr Gemahl wie eben jetzt auf Handelsreise war. Und da sie nicht sicher war, wie viel Zeit ihr noch an der Seite jener Frau blieb, die sie wie eine Mutter liebte, wollte sie jeden Augenblick auskosten.
Wenig später hatte sie den dünnen Gazeschleier, durch den ihre zahlreichen Zöpfe schimmerten, durch ein schweres Tuch aus Brokat ersetzt, den weiten, spitzenbesetzten Rock durch bauschige Atlashosen und die bunten, gestrickten Socken durch Pantoffel. Deren hohe Absätze verhinderten, dass die Füße mit Dreck und Unrat in Berührung kamen.
Für gewöhnlich ließ sich Ferida mit der Sänfte zum Bad bringen, das außerhalb der Stadtmauern und am anderen Ufer des Flusses Vero lag, aber um die Frühlingssonne auszukosten, hatte sie heute beschlossen, den Weg zu Fuß zurückzulegen.
Die zwei Eunuchen, die ihr dienten, bahnten ihnen einen Weg durch das übliche Gedränge. Auf dem Boden kauernde Händlerinnen priesen Granatäpfel aus Granada und Kirschen aus Almunécar an, während die reicheren Kaufleute in hölzernen Buden kristallene Trinkschalen und Keramikkrüge in Grün- und Brauntönen feilboten, auch Sandelholz und Rosenblätter, schließlich zahme Tauben und sogar schrill kreischende Pfauen.
Wenn Wasserträger oder Bettler ihren Weg kreuzten, scheuchten die Eunuchen sie weg. Willkommener waren die Dienste eines Parfümeurs, der ein nach Moschus duftendes Öl auf ihre Hände träufelte. Das Gedränge wurde noch dichter, als sie sich durch eines der fünf Stadttore zwängten; erst als die Straße, die von dort wegführte, breiter wurde, konnte Tarana freier atmen und den Ausblick genießen – auf die kleinen Anhöhen im Süden und Norden der Stadt und die vielen Felder, die Mühlen, die den Vero säumten, und das Aquädukt, das Barbastro mit frischem Wasser versorgte, schließlich die Almunias – Landvillen der Reichen, die im Sommer gern der heißen Stadt entflohen – und das Bad, dessen Eingang von steinernen Löwenköpfen bewacht wurde.
Am meisten erfreuten sie die Zypressen mit der schlanken, anmutigen Gestalt, die sanft im Frühlingswind wogten, und die Orangenbäume gleich daneben, wo faustgroße Früchte überreich zwischen sattgrünen Blättern hervorragten. Tarana wusste, dass Ferida dem süßsauren Saft nicht abgeneigt war, und schon eilte sie auf einen der Bäume zu, um eine Orange zu pflücken. Sie hatte gedacht, sie müsste fester daran ziehen, doch die Frucht sprang ihr förmlich entgegen, sodass sie ihr aus der Hand rutschte, auf die Straße plumpste und aufplatzte.
»Oh nein«, entfuhr es ihr. Sie konnte ihren Blick zunächst nicht von dem Fruchtfleisch lösen, das auf den staubigen Boden quoll. Erst als sie hochsah, nahm sie wahr, dass Ferida ebenfalls wie angewurzelt verharrt hatte. »Oh nein!«, rief auch sie.
Ihr Teint war eben noch leicht gerötet gewesen, nun schien ihr alles Blut aus dem Gesicht zu weichen. Tarana wagte kaum, ihrem panischen Blick zu folgen. Als sie sich doch überwand, erschien ihr die aufgeplatzte Orange wie ein übles Omen.
Ein Ungetüm wälzte sich auf die Stadt zu, einer riesigen Schlange mit grauen Schuppen gleich, die den staubigen Boden aufwühlte und darum in einer so dicken Wolke eingehüllt war, dass es unmöglich war, Anfang und Ende auszumachen. Wer in Barbastro aufwuchs, fand sich stets in einem Gewimmel von Menschen wieder, denn die Stadt zählte fünf mal tausend Einwohner. Doch die Menschenmenge, die sich da auf sie zubewegte, machte sicher die doppelte Zahl aus.
»Wer … wer ist das?«, entfuhr es ihr.
Erst formten Feridas Lippen das Wort nur. Dann presste sie hervor: »Kuffar.«
Zigfach hatte Tarana diesen Begriff gehört und konnte die Bedeutung in diesem Moment doch nicht erfassen. Sie war zwar mit Geschichten von den Ungläubigen aufgewachsen, die an den Marken von al-Andalus lebten, neidisch auf den dortigen Reichtum waren und dann und wann Raubzüge unternahmen. Doch undenkbar war ihr immer erschienen, dass sie so tief vorstoßen könnten. Und dann diese gewaltige Schar!
Begreifen musste sie das aber gar nicht. Nur fühlen, wie sich diese glühende Spitze der Panik in ihre Brust bohrte.
»Zurück«, schrie sie so laut, wie sie noch nie geschrien hatte, weil es die kostbare Stimme stets zu schonen galt.
Als sie kehrtmachte und Richtung Stadttor eilte, war die Stimme wertlos – zu retten galt es einzig das nackte Leben. Schon verrieten laute Rufe, trampelnde Schritte und das Knirschen von Holz, dass sie nicht die Einzigen waren, die das heranrückende Heer erblickt hatten. Das Tor, es wurde geschlossen!
»Schneller!«, keuchte sie.
Ferida stöhnte. »Ich … ich schaffe es nicht. Bring wenigstens du dich in Sicherheit.«
Die Panik vermochte viel, wie jenen Knoten zwischen Brust und Magen anschwellen zu lassen oder auch kalte Schauder über ihren Rücken zu jagen. Aber nie konnte sie vergessen machen, dass sie Ferida liebte. »Wir schaffen es beide oder keine.«
Sie hängte sich bei der Älteren unter und zog sie auf diese Weise mit sich. Als sie ihren ersten Pantoffel verlor, spürte sie das kaum. Als der zweite vom Fuß rutschte, schnitten sich Steinchen schmerzhaft in die Sohle. Obwohl ihr innerlich so kalt war, troff ihr der Schweiß von der Stirn in die Augen und brannte schlimmer als Tränen. Doch sie sah deutlich, dass das Tor noch nicht geschlossen war, noch ein winziger Spalt blieb.
Fünf Schritte, vier Schritte, drei …
Ihre Brust drohte zu zerspringen, ihre Knie wurden wachsweich. Doch als sie beide endgültig die Kraft verloren und sie zu Boden gingen, lag das Tor bereits hinter ihnen. Sie waren gerettet!
Eine Weile konnten sie beide nichts sagen, kämpften sie doch um ihren Atem.
»Der Allerbarmer war uns gnädig«, presste Ferida irgendwann über ihre Lippen, »hier sind wir sicher, die Mauer schützt uns. Die Ungläubigen – sie können nicht in die Stadt.«
Tarana sah, dass der Atlasstoff ihrer Hose zerrissen war und ihr rechtes Knie blutete. »Aber wir …«, sagte sie düster, »wir können nicht länger hinaus.«
Ferida brachte kein Wort hervor. Doch in ihrem Kopf echoten die Verse des Lieds, das sie vorhin gesungen hatte.
Mit der Nacht kommt der Tod. Ein letztes Mal werde ich im sanften Wind tanzen, ein letztes Mal den Mund für ein beglücktes Lachen öffnen, ein letztes Mal mein Gesicht zur rot glühenden Sonne heben. Und dann, dann werde ich sterben.
~
»Soll ich dir einen geheimen Schatz zeigen?«
Eben noch hatte Adémar auf dem staubigen Boden gelungert, doch er gierte so sehr nach einer Abwechslung, dass es ihm gar nicht schnell genug gehen konnte aufzuspringen. Wie dumm zu glauben, ein Krieg wäre aufregend, ruhmreich und abenteuerlich! In Wahrheit – so hatte er in jenen zähen Wochen festgestellt, die die Belagerung von Barbastro nun schon währte – war ein Feldzug zutiefst langweilig.
Ebenso dumm war es zu glauben, der Krieg wäre bunt. Als das Heer von Gui-Geoffroi, dem Herzog von Aquitanien, in dessen Diensten Adémars Vater Ramnulf stand, Richtung al-Andalus aufgebrochen war, hatten die Reiter zwar nicht nur zahlreiche Standarten gen Himmel gereckt, sondern überdies Gonfanons, kleine Fahnen in sämtlichen Farben des Regenbogens, an ihren Lanzen befestigt. Doch als sie gemeinsam mit den normannischen und französischen Truppen die Pyrenäen überquert hatten, waren ihre Blicke einzig auf den kargen Boden gerichtet gewesen, all das Geröll und das stachelige Gebüsch, das das Fortkommen so erschwerte. Die Standarten hatten zwar stolz im Wind geknattert, als sie sich danach mit weiteren Truppen vereint hatten – Burgundern, Aragonesen und Katalanen –, aber da waren die bereits über und über mit Staub bedeckt gewesen. Und sein Gesicht erst! Zigmal hatte er sich im Fluss Vero gewaschen, doch über seine Augen schien sich ein grauer Schleier gelegt zu haben. Das Grün der nahen Weinberge verblasste darunter ebenso wie das silbrige Funkeln der Olivenbäume oder das satte Rot der rissigen Erde. Selbst die Schuppen der Eidechsen schillerten in der Sonne nicht mehr prächtig.
Diese Eidechsen zu beobachten war zu einem Zeitvertreib geworden. Die vielen Sprachen zu lernen, die vom größten christlichen Heer, das jemals gegen die Heiden ausgezogen war, gesprochen wurden, seine Passion. Aber das änderte nichts daran, dass die Tage quälend lang waren.
»Einen geheimen Schatz willst du mir zeigen?«, fragte Adémar zurück. »Was meinst du damit?«
Vor ihm stand Loic, und dessen Beinkleider in unterschiedlichen Farben und rissigen Stoffen verrieten, dass er kein Knappe oder Ritter war. Er selbst bezeichnete sich als Barde, doch Adémar fand, dass er vor allem ein Quälgeist war. Denn wenn Loic ein Lied anstimmte, klang es, als würde man einer Ratte auf den Schwanz treten. Die anderen warfen oft abgenagte Knochen auf ihn, aber sie konnte er mit zotigen Sprüchen gnädig stimmen. Adémar wiederum hatte er damit eingenommen, weil er ihn davor bewahrte, sich im Sprachendickicht zu verirren. Auch Loic beherrschte nicht alle Sprachen, die hier zu hören waren, aber neben dem Poitevinischen, mit dem Adémar aufgewachsen war, immerhin auch die Langue d’oc und Nordfranzösisch.
»Na los, komm mit, dort hinten ist der Schatz.«
Die Zelte des christlichen Heers, das Barbastro belagerte, befanden sich in ausreichender Entfernung zur Stadtmauer und somit außerhalb der Reichweite der Pfeile, die regelmäßig dahinter abgefeuert wurden. Die höheren von ihnen waren mithilfe von Lanzen errichtet worden, die niedrigeren, in denen man nur liegen konnte, mit Bündeln aus Binsen. Dazwischen standen Wägen voller Proviant, Kochgeschirr und mittlerweile auch Kostbarkeiten, die man aus Landgütern außerhalb der Stadtmauer geraubt hatte. Ein paar von ihnen waren besonders flach und mit Planen aus brüchigem Leder bedeckt, und zu einem davon trat Loic.
Adémar wusste, welchem Zweck diese Wägen dienten, und seine Neugierde wich Überdruss. »Du willst mir Waffen zeigen?«
Fast alle Ritter trugen ein Schwert an ihrem Gürtel, die meisten auch einen Dolch, und wer es sich leisten konnte, stellte seinen Rang mit silbernen Sporen an den Reitstiefeln, Helmen, die das halbe Gesicht bedeckten, und glänzenden Kettenhemden zur Schau. Schilder, Lanzen und Streitäxte aber würden erst bei der Schlacht zum Einsatz kommen, und Adémar hatte keine Lust, sie in Augenschein zu nehmen. Er hätte sich zwar lieber die Zunge abgebissen, als es offen zuzugeben, aber das Klirren von Schwertern hatte in seinen Ohren immer unangenehmer geklungen als selbst die kehligste Sprache.
Schon wollte er wieder zu seiner Eidechse zurückkehren, als Loic das Leder wegzog. Verblüfft sog Adémar den Atem ein. Da lagen keine Waffen, nur unzählige Weinschläuche, von denen Loic rasch einen nahm und aufband. Den ersten Schluck machte er so gierig, dass ihm der Wein über das Kinn troff.
»Lieber Himmel, warum nimmt man auf einen Feldzug so viel Wein mit?«, rief Adémar verdutzt. »In einen Kampf zieht man doch nicht besoffen!«
»Der Wein ist ja nicht für die Männer bestimmt.« Nach drei Schluck zwang sich Loic, mit dem Trinken aufzuhören, und verknotete den Schlauch wieder. »Aber wenn wir Barbastro einnehmen, werden wir als Erstes das Gebäude erstürmen, das den Heiden so heilig ist wie uns eine Kirche. Moschee nennen sie es. Und dort werden wir den Wein vergießen.«
»Das ist doch pure Verschwendung!«
»Das ist ein Zeichen, was wir von ihnen halten. Der Wein verunreinigt ihr Gotteshaus. Es ist ein wenig so, als würde jemand einen großen Hundehaufen vor unseren Altar legen.«
Das drastische Bild stand ihm so deutlich vor Augen, dass ihn ein Schauder überlief. »Ich dachte, es ginge darum, die Sarazenen zu besiegen, nicht, sie zu demütigen.«
»Es geht vor allem darum, Rache zu nehmen!«, rief Loic. »Alle sollen wissen, was passiert, wenn sie einen der Unseren töten.«
Adémar wusste, dass nicht zuletzt der Tod von König Ramiro von Aragon das christliche Heer dazu bewogen hatte, derart tief in das Reichsgebiet von al-Andalus vorzudringen. Als dieser ebenfalls zu einem Kriegszug aufgebrochen und kurz davor gewesen war, die Truppen des Emirs von Saragossa zu schlagen, war ein muslimischer Krieger in das christliche Lager eingedrungen und hatte den König enthauptet. Nicht nur der Nachfolger von Ramiro, Sancho, und die Nachbarn Aragons – die Könige von Leon und Kastilien, desgleichen die Grafen von Barcelona – hatten die schändliche Tat als ruchlosen Mord verteufelt. Auch der Herzog von Aquitanien hatte Vergeltung angedroht, weil Ramiro mit einer Verwandten verheiratet gewesen war.
»Einen Krieger zu töten ist das eine«, wandte Adémar ein, »aber etwas Heiliges zu beschmutzen …«
»Bei den Ungläubigen kann nichts heilig sein. Und bedenke: Der Papst selbst hat uns seinen Segen für diese Schlacht gegeben.«
Dies war der Grund, warum sich auch etliche Normannen aus Sizilien, Franzosen und Burgunder dem Feldzug angeschlossen hatten. Es gälte schließlich den Beweis anzutreten, dass das Abendland den Mauren bei Weitem überlegen war und diese nicht nur Feinde der angrenzenden Reiche, sondern sämtlicher Christen waren. Papst Alexander hatte die Kämpfer als Militia Christi – als Heer Christi – bezeichnet, ihnen den apostolischen Segen erteilt und ihnen in Aussicht gestellt, dass sie von allen Sünden, die sie jemals auf sich geladen hatten, losgesprochen wurden.
Adémar wusste sehr wohl, welches die eigene schlimmste Sünde war: Dass er seinen Vater zu wenig achtete, erst recht nicht liebte. Der Alte hatte ihm von Kindheit an schließlich immer die Schreibfeder entrissen und ihn in den Hof geprügelt, wo er stundenlang Schwertkampf üben musste. Und jetzt hatte er ihn gezwungen, nach al-Andalus mitzukommen, damit er mit seinen siebzehn Jahren endlich beweisen konnte, kein schwächlicher Gelehrter, sondern ein tapferer Krieger zu sein. Aber er fand, dass man diese Sünde besser mit ein paar Gebeten abbüßte, nicht mit dem Vergießen von Wein und erst recht nicht dem Blut von Heiden. Er hatte noch nicht mal Lust, einen Schluck von dem Wein zu kosten, und so schüttelte er den Kopf, als Loic den Schlauch vor sein Gesicht hielt.
»Na, dann bleibt mehr für mich!«, sagte Loic, knotete den Schlauch wieder auf und setzte ihn an.
Gerade als Adémar sich abwandte, ertönte lautes Gejohle. Nein, niemand hatte entdeckt, wie Loic sich heimlich am Weinvorrat zu schaffen gemacht hatte. Sämtliche Blicke gingen in eine andere Richtung. Erst vermutete er, dass es eine jener Prügeleien anzufeuern galt, die ständig im Lager losbrachen und in denen sich die Gereiztheit ob des langen Wartens und Nichtstuns entlud. Doch dann stellte er fest, dass etwas anderes die Aufmerksamkeit der Ritter auf sich gezogen hatte.
In den letzten Tagen hatte sich der Strick um Barbastros Hals enger gezogen, schienen doch die Pfeile der Belagerten langsam zur Neige zu gehen. Immer häufiger lugten hinter den Zinnen der Mauer Frauen hervor, nicht selten ein kleines Kind an die Brust gepresst. Flehentlich baten sie um etwas Wasser und zeigten sich dafür mit Kostbarkeiten erkenntlich.
Schon manches Mal war eine an einem Seil befestige Vase hochgezogen worden, während ein Ring oder Armband nach unten fielen, um das sich dann eine Traube Soldaten balgte wie Hunde um einen Knochen. Adémar hatte nie einen Blick für den Schmuck übriggehabt, immer nur zugesehen, wenn Mutter und Kind gierig tranken. Und wenn er sich noch so oft sagte, dass beide als Heiden unrettbar der Hölle anheimgegeben waren – er konnte ihnen den Genuss nachfühlen, die trockenen Lippen zu benetzen.
Mittlerweile machten sich die Soldaten längst nicht mehr die Mühe, für die Belagerten Wasser zu schöpfen. Was immer die anbieten konnten – bald würde die Stadt fallen und sie es ohnehin an sich raffen können. Viel lieber spielten sie das falsche Spiel, den flehenden Frauen etwas ganz ohne Gegenleistung abzuluchsen. Und wenn ihnen irgendwann statt verzweifelter Bitten zischende Flüche an den Kopf geworfen wurden, klopften sie sich hämisch lachend auf die Schenkel.
Adémar hatte dieses entwürdigende Schauspiel so oft mit angesehen, dass prompt Überdruss hochstieg. Doch als er die Augen gegen die Sonne abschirmte und hoch zur Stadtmauer blickte, erkannte er, wer da nicht bloß den Kopf durch die Zinnen streckte, sondern hinaufgeklettert war, um auf jenem schmalen Rand die Balance zu halten. Es war keine Mutter mit ihrem Kind. Es war eine junge Frau, die nicht in die Tiefe blickte, nur hoch zum Himmel, die auch nicht um Wasser bettelte, nein, die den Mund öffnete und ein Lied anstimmte.
Adémar trat näher, als würde er unweigerlich in eine bestimmte Richtung gezwungen werden. Nie hatte er so etwas gehört, nie hatte er so etwas gesehen.
Dunkle Töne, die aus der Tiefe der Erde zu kommen schienen, verwoben sich auf wohltönende Weise mit hohen, die geradewegs vom Himmel fielen. Und so kraftvoll die Stimme war, so zart war das Geschöpf, dem diese innewohnte. Unweigerlich musste er beim Anblick dieser schlanken Gestalt mit den gemeißelten Zügen, der hellen Haut, den rotgoldenen Haaren, die unter dem wehenden Schleier zu erahnen waren, an einen Engel denken, der nichts Profanes an sich hat und an dessen Macht doch niemand zweifelt.
Auch an etwas anderem bestand kein Zweifel: Dass sie sich nach dem Lied in die Tiefe stürzen wollte, geradewegs in den Fluss Vero, dessen Wasser nicht hoch genug stand, um zu verhindern, dass ihr Leib auf dem Grund zerschmettert werden würde.
Ein Nein stieg in ihm hoch. Es war undenkbar, dass diese Frau so grausam wie sinnlos starb! Es war undenkbar, dass die anderen Männer noch lauter johlten und grölten, als wäre das für sie das Lustigste, was sie je gesehen hatten, während es für ihn zugleich das Schönste und Traurigste war!
»Nein.« Er flüsterte es nur. »Nein!« Jetzt schrie er.
Befremdete Blicke richteten sich auf ihn, nur ihrer nicht. Erst als er sich so nahe an die Stadtmauer herangewagt hatte wie nie zuvor, entdeckte sie ihn. Selbst der Fluss war ihm keine Grenze. Schon stand er knietief in der Brühe, streckte die Hände aus, als hätten sie die Kraft, sie notfalls aufzufangen. Natürlich vermochten sie es nicht. Und doch setzte er ein machtvolles Zeichen. Mir ist dein Tod nicht gleich.
Aus einem Abstand von etwa zwanzig Fuß starrte die Frau auf ihn herab, und aus dem maskenhaften Gesicht wurde ein menschliches. Erstaunen breitete sich erst in ihren Zügen aus, dann Dankbarkeit und schließlich – Todesangst. Denn je länger sie auf ihn starrte, desto bedrohlicher schien der Abgrund unter ihr zu werden. Ein Zittern überkam sie, und während er kurz fürchtete, sie würde darüber die Balance verlieren, bewog es sie am Ende, den rettenden Schritt zurückzutreten.
Gott sei Dank.
So erleichtert er war, ihr Leben gerettet zu haben, verschwendete er ans eigene keinen Gedanken. Und sein Lachen übertönte kurz dieses Zischen. Doch dann erkannte er: Den Bogenschützen von Barbastro waren die Pfeile noch nicht gänzlich ausgegangen, und so nah er sich an die Stadtmauer herangewagt hatte, bedeutete er ein leichtes Ziel. Haarscharf schoss ein Pfeil an ihm vorbei und streifte seine Wange. Der brennende Schmerz ließ ihn zusammenzucken, erst recht der Anblick seines Blutes, dass in den grauen Fluss tropfte. Während er noch darauf starrte, wusste er: Der zweite Pfeil würde ihn womöglich nicht verfehlen. Und es blieb keine Zeit zur Flucht.
Er fuhr herum, rannte los, verharrte. Vernahm wieder die Stimme der Schönen, nur dass sie diesmal nicht sang. Sie redete auf den Bogenschützen ein, vielleicht packte sie ihn auch. Lange würde er sich nicht von ihr aufhalten lassen, da war sich Adémar sicher. Aber die Zeitspanne reichte, um sechs Schritte zu machen. Oder sieben. Genug jedenfalls, um plötzlich von rauen, gegerbten Händen gepackt zu werden. Erst legten sie sich um seine Gelenke, um ihn mit sich zu ziehen, dann um seine Schultern, um ihn zu schütteln.
Sein Vater Ramnulf stand vor ihm, das Gesicht von der Mittagssonne gerötet. Kurz wappnete sich Adémar gegen einen wütenden Tadel, wie er ihn so oft über sich ergehen lassen musste. Doch was aus dem verzerrten Mund hervorbrach, war Gelächter. »Ich dachte schon, du wärst durch und durch ein Feigling. Und nun zeigst du, dass es nicht bloß Tapferkeit braucht, sondern Tollkühnheit, um dem Feind zu trotzen. Gleichwohl«, er schüttelte ihn noch heftiger, seine Art der Zuneigung, »wir müssen nicht mehr lange hoch zur Mauer starren und uns mit Mutproben beweisen. Der Geruch nach Verwesung, der gen Himmel steigt, beweist, dass die Vorräte der Heiden langsam, aber sicher zur Neige gehen. Bald … bald werden wir die Stadt erobern.«
Ramnulf tätschelte seine Wange, wo der Pfeil ihn gestreift hatte. Ein weiterer Tropfen Blut perlte von seinem Gesicht, versickerte im gräulichen Boden wie vorhin im gräulichen Fluss. »Der Kampf ist nah«, verkündete sein Vater, ehe er ihn losließ.
Doch Adémar wusste, er würde kämpfen. Nicht um die Stadt, nicht um deren Reichtümer, nicht für den Papst.
Nur, um diese schöne Sängerin zu retten.
~
Ferida schälte die Feige ganz vorsichtig, presste auf das rote Fruchtfleisch, sodass es ihr förmlich entgegenquoll, und nahm es in winzigen Bissen zu sich. Bei jedem einzelnen schmatzte sie genießerisch.
Tarana, die ihre süße Frucht viel schneller verschlungen hatte, starrte sie verwundert von der Seite an. »Wie kannst du etwas so langsam essen, wenn wir doch vor Hunger vergehen? Und mit so viel Genuss?«
»Dies war meine letzte Feige aus Málaga, und sie schmeckte besser als jeder Kuss. Daran werde ich denken, wenn ich sterbe.«
Der Inhalt der Vorratskammer war unaufhaltsam zur Neige gegangen. Selbst der Krug mit dem Olivenöl, das sie mit Resten des Mehls vermengt hatten, um daraus dünne Fladen zu backen, war mittlerweile leer.
»Ich hätte mich von der Stadtmauer in die Tiefe stürzen sollen, dann hätte ich es hinter mir«, sagte Tarana leise.
Obwohl auch Ferida beteuert hatte, dass dies der einzige Weg wäre, einem elenden Tod zu entgehen, hatte sie sie erleichtert in die Arme geschlossen, als sie dort runtergeklettert war. Und jetzt rief sie: »Der Allerbarmer sei gepriesen, weil der Prinz der Ungläubigen dich davon abgehalten hat.«
»Wie kommst du darauf, dass er ein Prinz war?«
In der Tat hatte nichts auf eine edle Geburt hingedeutet. Der junge Mann hatte grobe, graue Stoffe getragen, weil die Ungläubigen keine Ahnung hatten, wie man Seide herstellte, und sein Haar und Bart wuchsen viel länger, als man es hierzulande sah, auch struppiger. Wahrscheinlich reinigte er nie seine Fingernägel und nutzte keine Salben, um die Haut geschmeidig zu machen. Doch sie konnte nicht leugnen, dass etwas an seinem beschwörenden Blick sie zutiefst gerührt hatte.
»Nun«, sagte Ferida, »es ist doch besser, sich vorzustellen, er wäre ein Prinz als ein gemeiner Tagelöhner. So wie es besser ist, sich vorzustellen, dass dort hinten eine Katze durch den Raum huscht und keine Ratte. Und dass unsere Zungen am Gaumen klebten, weil wir fasten, nicht weil wir bald verdursten werden. Mir wär es auch lieber, wenn wir nicht ständig vom Tod sprechen, sondern du von der Liebe singst. So wie auf der Mauer.«
Die Töne echoten noch in ihr. Es war eines ihrer Lieblingslieder gewesen, das sie an diesem Tag gesungen hatte.
»Wer nie geliebt, hat nie gefühlt,des Lebens Elend und des Lebens Segendenn wer an Liebe glaubt, die Liebe lebt,kennt all die bitter’n und all die süßen Wege.Der Schöpfung Zweck und Streben ist die Liebe,Die Kraft im Saft der Reben ist die Liebe,Sie ist der Reim im Lied der Jugendzeit,Merke dir mein Wort, das Leben ist die Liebe.«
Schon als sie die Strophen gesungen hatte, hatte es sie unendlich traurig gemacht, dass sie die Liebe niemals kennenlernen würde. Doch die Trauer war immerhin noch ein starkes, einnehmendes Gefühl gewesen, jetzt herrschte nur noch Lethargie und Erschöpfung. Auch eine dumpfe Gleichgültigkeit.
»Ich kann nicht mehr singen«, erklärte sie gepresst. »Meine Zunge ist zu trocken. Und mein Gesang – er ist ja doch sinnlos.«
Ferida seufzte, aber sie widersprach nicht. Was für den Gesang galt, galt erst recht für den frommen Wunsch, der Albtraum wäre bald ausgestanden.
Zu Beginn der Belagerung hatten sie noch Hoffnung gehegt. Barbastro war schließlich kein Dorf, sondern eine wichtige Grenzstadt, seit vierhundert Jahren ein Fanal für die muslimische Macht auf der iberischen Halbinsel. So eine Stadt würde selbst dem größten Heer trotzen und bald Hilfe von ihren Nachbarn erhalten.
Doch so wohlhabend und reich Barbastro auch war – mächtig war es nicht. Überdies war al-Andalus nicht länger ein glatter, weicher Teppich wie einst. Zu oft waren innere wie äußere Feinde darauf herumgetrampelt, sodass die Fäden spröde und immer mehr Löcher sichtbar geworden waren. Der Herr einer Taifa dachte nur an seine, nicht auch an die angrenzenden Kleinkönigreiche. Und im Zweifel auch bloß ans eigene Leben, nicht an das seines Volks, das nur dazu da war, um Steuern zu zahlen. Yussuf Ibn Sulayman, der Herr von Barbastro, war schon in den ersten Tagen der Belagerung clandestin geflohen. Und selbst wenn er die Stadt zuvor zwei fähigen Männern wie dem Kommandanten Ibn al-Tawil und dem Richter Ibn Issa anvertraut hatte – Wunder konnten sie beide nicht bewirken.
In jenen vierzig Tagen, die die Belagerung mittlerweile währte, waren die mitreißenden Reden, die Zuversicht schürten und Allahs Wunder ankündigten, immer kleinlauter ausgefallen. Die einzigen Geräusche, die von draußen hereindrangen, waren Stöhnen, Seufzen und Wehklagen. Umso erstaunter war Tarana darum, als plötzlich lauter Lärm ertönte. Nicht nur Schreie vernahm sie, auch das Klirren von Waffen, Trampeln, militärische Befehle.
So resigniert Ferida auf dem Diwan gekauert war, hob sie nun doch den Kopf. »Kann es sein, dass Prinz Yussuf Ibn Sulayman mit einem Heer zurückgekehrt ist, um uns zu befreien?«
Wie gerne Tarana das glauben wollte! Aber der Magen, der sich zusammenzog, das Herz, das unrhythmisch zu pochen begann, die enger werdende Kehle wussten es besser. Hier war etwas anderes im Gange … etwas Gefährlicheres.
Am liebsten hätte sie sich verkrochen, aber sie konnte Ferida nicht allein ins Freie treten lassen.
Sobald sie die Tür aufstießen, schwollen die Laute an. Am ohrenbetäubendsten war das Geschrei. Und als Tarana sich einem der vielen Menschen, die vorbeistürmten, in den Weg stellte, wurde sie von der Masse mitgerissen, ob sie nun wollte oder nicht. Ihr blieb einzig, Ferida an der Hand zu packen, damit sie einander nicht verlören. »Was … was ist geschehen?«
Die eigene Frage hörte sie nicht – nur die Fetzen einer Antwort. »In den vorderen Teil der Stadt … Reiter der Ungläubigen eingedrungen … nicht mit Gewalt, sondern weil sich ihnen jemand ergeben hat … nicht alle sind so feige, der Rest will kämpfen … hat sich zurückgezogen … in die Qasaba …«
Die Qasaba war eine Festung in der Sudda, dem oberen Teil der Stadt.
So dicht das Gedränge war, sosehr es ihr den Atem raubte, irgendwie gelang es Tarana doch, sich der Menschentraube zu entziehen und sich gegen die Wand eines Hauses zu pressen. Nun aber war es Ferida, die an ihrer Hand zog. »In der Qasaba sind wir sicher.«
»Vor den ungläubigen Kriegern, ja. Nicht vor Hunger, nicht vor Durst.«
»Die Ungläubigen machen mir jetzt Angst, der Durst wird das erst morgen wieder tun.«
Tarana leistete nicht länger Widerstand. Erleichtert stellte sie fest, dass die Kampfeslaute abzuebben schienen; doch plötzlich war auch von der Festung her das Klirren von Schwertern zu vernehmen, jenes schreckliche Ächzen, wenn jemand tödlich getroffen wurde, jenes dumpfe Poltern, wenn ein lebloser Leib zu Boden ging.
»Sind die Ungläubigen etwa auch dort eingedrungen?«
Wie angewurzelt blieben sie stehen, schmiegten sich unwillkürlich aneinander. Tarana machte sich so klein wie möglich, Ferida aber stellte sich auf ihre Zehenspitzen, um etwas mehr zu erspähen.
»Unsere Soldaten töten ihresgleichen und auch das eigene Volk, damit keine weiteren zu Verräter werden und die Vorräte länger ausreichen, bis doch noch Rettung kommt!«
Tarana schloss unwillkürlich die Augen, aber die Bilder, die diese Worte beschworen, blieben mächtig. Ferida indes gab sich einen Ruck, löste sich von ihr und machte weitere Schritte auf die Qasaba zu.
»Bist du verrückt?«, rief Tarana.
»Wir können nur noch zwischen Tod und Tod wählen. Einem quälend langsamen und einem gnädig kurzen.«
Nichts an dem, was sich da oben in der Festung zutrug, erschien ihr gnädig, nur kalt und roh und blutig und erbarmungslos. Und so entschieden sie selbst noch vor ein paar Tagen gewesen war, sich in die Tiefe zu stürzen, um dem Elend ein Ende zu setzen, erwachte nun in ihr eine blindwütige Gier. Nicht nach Schönheit oder Glück. Einfach nur nach dem nächsten Atemzug, dem nächsten Herzschlag, dem nächsten Morgen.
»Wenn jemand eines der Tore geöffnet hat, um die Ungläubigen einzulassen, steht es doch offen, sodass man auch irgendwie hinauskommen kann.«
Feridas skeptische Miene verriet, wie viele Hindernisse es hierfür zu überwinden gälte. Sie ließ sich zwar von Tarana mitziehen, doch bald zeigte sich, dass sie nicht die Einzigen waren, die vor dem grausigen Spektakel in der Qasaba flohen. Dass ihnen wiederum zugleich von der anderen Seite Flüchtende entgegenkamen, denen ihrerseits die ungläubigen Krieger nachsetzten, machte das Chaos nur größer.
Nein, der Tod kam nicht nur durch Schwert und Durst. Er kam auch durch eine Menschenmenge, die jene, die stolperten und zu Boden gingen, zu Brei zertrampelte. Mehr als einmal drohte auch Tarana das Gleichgewicht zu verlieren. Irgendwie hielten sie sich aufrecht, rammten sich auch noch so viele Ellbogen in Brust und Bauch, nur um dann, als sie endlich das Tor erreichten, zu erkennen: Es stand tatsächlich offen, aber es strömten so viele Menschen darauf zu, dass es wie ein winziges Nadelöhr erschien, durch das man ein dickes Seil fädeln wollte.
»Es ist hoffnungslos«, presste Ferida keuchend hervor.
Taranas Verstand fügte sich, nicht jedoch die Gier. Sie sah sich um, erblickte ein halbes Dutzend Menschen, die sich mithilfe von Stricken von den Zinnen der Mauern abzuseilen versuchten. Wie sehr sie glauben wollte, das könnte gelingen! Doch die Schreie, die ertönten, verkündeten etwas anderes – dass nämlich die Kraft nicht reichte. Und selbst wenn es anders gewesen wäre – zur Stadtmauer war kein Durchkommen mehr. Zu viele dieser Kreaturen schienen nun wie ein todbringender Strom die Stadt zu fluten. Unter Kettenhemden, Helmen und Nasenschutz machte sie keine Menschen aus Fleisch und Blut aus, nur dämonische Wesen gleich den Dschinn, die aus rauchlosem Feuer erschaffen wurden.
Während Tarana zutiefst erschrocken war, lachte Ferida auf. So wie ein Fuß taub wird, wenn man ihn zu lange in eiskaltes Wasser taucht, schien auch ihre Seele ob zu viel Furcht gefühllos geworden zu sein. »Gut, dass ich die letzte Feige gegessen habe. Wie schade, hätte ich auf diesen Genuss verzichtet«, meinte sie trocken.
Es darf nicht die letzte Feige gewesen sein, dachte Tarana. Es darf auch nicht das Lied gewesen sein, das ich damals auf der Stadtmauer gesungen hatte. Es muss ein Schlupfloch geben, durch das wir entkommen können.
Und tatsächlich, die feindlichen Krieger zogen zwar einen immer engeren Kreis um sie, doch sie kämpften nicht durchweg Schulter an Schulter. Hier brach einer aus den Reihen aus, weil er einem Flüchtenden nachsetzte, der reich mit Schmuck behängt war, dort war ein anderer beschäftigt, einen Leichnam im Blutrausch bis zur Unkenntlichkeit zu zerstückeln. Und so machte Tarana eine winzige Gasse aus, durch die sie vor dem Gemetzel fliehen konnten. Allerdings brauchte sie alle Kraft zum Laufen und sich rechtzeitig zu ducken, um den Klingen zu entgehen. Erst als sie in eine stille Gasse abgebogen war, erkannte sie, dass sie Ferida verloren hatte.
»Ferida?«
So erbittert sie um ihr nacktes Überleben gekämpft hatte, ohne Ferida schien alles sinnlos zu sein.
»Ferida!«, rief sie wieder, und es klang kläglich. Sie wollte kehrtmachen, selbst wenn auch sie der Tod erwartete. Schon roch sie ihn, sie fühlte nur etwas anderes. Einen warmen, festen Druck. Es konnte nicht Feridas Hand sein, die sich um ihre schloss, denn die war schweißnass gewesen. Auch steckte diese hier in Lederhandschuhen. Doch das änderte nichts daran, dass sie ihre Rettung war.
Es war der christliche Prinz. Die Hand zog sie weiter durch die Gasse, sie folgte ihm blindlings. Nachdem sie abgebogen waren, ertönte kein Schlachtenlärm mehr, auch der Tod wartete nicht auf sie. Da war nur der christliche Prinz. Nein, kein Prinz. Er musste keiner sein. Es genügte, dass er ein Mensch war. Schmutzig, nicht blutbesudelt, aufgewühlt, nicht verroht, überfordert, nicht hilflos.
»Hier bist du in Sicherheit.«
Hatte er das wirklich gesagt, oder wollte sie das nur hören?
Ihr Körper reagierte jedenfalls vor ihrem Verstand. Der Herzschlag beschwichtigte sich, ihr Hals fühlte sich nicht länger an, als hätte sie Scherben geschluckt. Bei ihm, ja, bei ihm war sie in Sicherheit. Um das Fleckchen Erde, auf dem sie beide standen, sich anstarrten, schien ein Bannkreis gezogen.
Allerdings hatte auch die mächtige Stadtmauer ihre Bewohner nicht geschützt. Schon bekam der Bannkreis Risse. Schon merkte sie, dass das Haus, zu dem er sie gebracht hatte, von Männern … von Dschinn geplündert wurde. Alles schleppten sie heraus, dessen sie habhaft wurden: winzige Tischchen aus Silber und Onyx, Lampen aus Kupfer, mit Schwanendaunen gefüllte Kissen und Schaffelle, kleine Truhen, die mit bunt gefärbtem Saffianleder überzogen waren, zahlreiche Stoffballen und so weiter.
Wie konnte er glauben, dass sie ausgerechnet hier sicher war? Weil die Kreaturen keine Hände mehr frei hatten, um zu töten und zu schänden?
Einer schaffte es nicht mal, sein Raubgut an sich zu raffen. Eine Vase aus Keramik mit schlankem Hals und grünlicher Glasur rutschte ihm aus den Händen. Blitzschnell fing der Prinz sie auf, ehe sie zu Bruch ging.
»Das ist die Truppe meines Vaters.«
Jetzt zumindest zweifelte sie nicht länger, dass sie ihn richtig verstanden hatte.
»Sprichst du meine Sprache?«
»Nur ein paar Brocken.«
Immer mehr Männer stürmten aus dem Haus, das ihr nicht länger wie ein solches erschien, eher wie ein Kadaver, von dessen Knochen noch die letzte Faser Fleisch geschabt wurde. Aber in dem Gerippe, das übrig blieb, konnten sie sich verkriechen. Wenn sie es denn schafften, es überhaupt zu betreten.
Just als alle Männer mit ihrer Beute davongestoben waren, kam ein letzter heraus; er hielt kein Raubgut in den Armen und blieb in der Tür stehen.
Obwohl sie den Prinzen nur kurz gemustert hatte, hatte sie genug aufgesogen, um ihn im anderen wiederzuerkennen, nur dass dieser älter war. Und dass es sich beim Alten nicht im Geringsten tröstlich anfühlte, als sein Blick über sie glitt. Erst glichen die Augen leeren Löchern, dann platzten sie vor Gier. Sie fühlte sich von ihm betatscht, noch ehe er seine Hände nach ihr ausstreckte. Er ließ sich Zeit, auf sie zuzutreten, endlich etwas zu sagen. Sie begriff sofort, was er meinte, obwohl er eine ihr fremde Sprache nutzte. Der Prinz hingegen starrte ihn verständnislos an. Noch stellte er sich schützend vor sie, um nicht sie, sondern die Vase seinem Erzeuger auszuhändigen.
Der Vater nahm sie entgegen, tat so, als würde er sie mustern. Doch dass er sie hochhielt, hatte nur einen Zweck – den Abstand zum Boden vergrößern. Als er sie fallen ließ, zerbrach sie mit einem lauten Klirren.
Ganz dicht an ihrem Ohr stieß der Prinz einen Schrei aus, ehe er vor den Scherben auf die Knie sank.
Als gäbe es noch etwas zu retten. Als könnte man sie noch zusammenkleben. Tarana erkannte auf den ersten Blick, dass die Vase zerstört war. Und wusste, dass auch sie nicht wieder heilen würde, wenn sein Vater mit ihr fertig war.
~
In den drei Tagen seit dem Fall Barbastros hatte Adémar noch mehr über den Krieg gelernt.
Von wegen, er wäre eine Sache der Männer, mit Mut und Disziplin und der Waffe in der Hand zu führen! Der Krieg, das waren gemeuchelte Alte, geschändete Frauen und entführte Kinder, Eisenketten, die sich tief in geschundenes Fleisch schnitten, und geraubte Kostbarkeiten, die sich auf Wägen türmten und doch nicht reichten, um die Habsucht zu befriedigen. Und von wegen, man bräuchte für den Krieg ein kaltes Herz und einen wachen Verstand. Ganz und gar herzlos war er und dumm. Vergab der Papst denn wirklich Sünden dafür, wenn man künftig Halsschmuck aus taubeneigroßen Perlen trug, die man einem Toten vom Leib gerissen hatte? Statuen aus schwarzem Bernstein in der eigenen finsteren Burg aufstellte, die doch nur in einem blühenden, duftenden Garten zur Geltung kamen?
Niemand konnte das glauben!
Und wie sie dieses wunderliche Tier, das man Affe nannte und Seidenkleider trug, ebenfalls in Ketten gelegt, mit Flammen bedroht und sich an seinem Kreischen erfreut hatten! Zumindest diesen Affen hatte Adémar vorhin retten können. Als jemand Loic den Strick aus Schilf und Espartogras überreichte, riss Adémar ihn aus dessen Hand und ließ ihn los, worauf das Tier ein letztes Kreischen ausstieß und vom Lagerfeuer weg in die Finsternis stürmte. Und als Loic ihn empört anblaffte, erwiderte er kühl: »Was ist? Du kannst doch hässlicher singen als diese Kreatur, das hast du schon mehrfach bewiesen!«
Loic sang nicht, er trug ein holpriges Gedicht vor und trampelte auf den Boden, um zu veranschaulichen, wovon es handelte. Dass nämlich die Erde gebebt hätte, als Barbastro fiel.
Die anderen klatschten und zogen wieder und wieder in die Stadt, um noch mehr zu plündern und im Gotteshaus der Heiden wie geplant den Wein zu vergießen. Dessen Verlust machten sie rasch wett, indem sie zahlreiche Fässer aus der Stadt hierher rollten und sich betranken. Allein beim Anblick wurde Adémar übel. Er stahl sich von der johlenden Schar fort, und weil sich just eine weitere Nacht über das Land gesenkt hatte, sah er den Weg vor seinen Füßen nicht und trat plötzlich auf etwas anderes als nur sandigen Boden oder Stein.
Eine Weile musste er es ins Mondlicht halten, um es als Laute zu erkennen. Nur dass dieses Instrument nicht bloß fünf Saiten hatte, wie er es kannte, sondern viel mehr, und nicht bloß so lang wie sein Unterarm war, nein, mindestens wie sein Oberschenkel. Und dass es nicht die Form eines Bogens hatte, sondern eines Trapezes. Eine Saite war gerissen, aber als er mit der Hand über die restlichen fuhr, ertönte ein sanfter Ton, als würde die Träne einer Fee auf ein Rosenblatt fallen.
Unsinn, es gab keine Feen, und selbst wenn, verursachte eine Träne keinen Laut. Etwas anderes war deutlich zu hören, ein raues Schluchzen. Er folgte ihm und erreichte bald das Zelt seines Vaters, das er in den letzten Tagen eisern gemieden hatte.
Zu unerträglich war die Erinnerung, wie sein Vater ihn für seine Beute gerühmt hatte. Wie Ramnulfs Stolz der Verachtung gewichen war, als Adémar sich geweigert hatte, die schöne Sängerin mit Gewalt zu unterwerfen. Als der Vater geprahlt hatte, er würde ihm vormachen, wie es ginge, und mit dem Schwert auf Adémar losgegangen war, als er die junge Frau zu schützen versucht hatte. Mit dem Schwertknauf hatte Ramnulf ihm erst einen Schlag in den Bauch verpasst, sodass ihm der Atem wegblieb, und dann auf dem Hinterkopf, sodass sein Haupt zu bersten schien. Doch es hatte ihn keine gnädige Ohnmacht umfangen, eine Weile noch hatte er sich als Weichling beschimpfen lassen müssen.
Als Ramnulf jetzt aus dem Zelt trat, wich er instinktiv zurück, erwartete er doch eine neue Tirade. Doch der Vater grinste bloß überheblich. »Na, hast du es dir endlich anders überlegt? Willst du sie doch noch haben, jetzt, da sie zugeritten ist?«
Adémar widerstand, noch einen weiteren Schritt zurück zu machen. Wenn er zeigte, was in ihm vorging, würde er nicht nur neue Prügel beziehen, sein Vater würde ihn nicht zu der jungen Frau ins Zelt lassen. Also nickte er, barg das Instrument hinter seinem Rücken und trat ins Zelt, während Ramnulfs Grinsen breiter wurde.
Nur eine winzige Öllampe spendete im Inneren ihr fahles Licht. Obwohl ihn ihr Schluchzen hierher gelotst hatte, war jetzt nicht einmal ein Atmen zu hören. Er nahm auch keine Bewegung wahr. Die junge Frau, von der er nur Umrisse sah, kauerte reglos auf dem Boden. Erst als er einen Schritt auf sie zu machte, zuckte sie zusammen und stieß gegen die Wand aus Stoff, wodurch das ganze Zelt erbebte. Er brauchte kein Licht, um zu wissen, dass ihre Miene vom Ausdruck der Panik verzerrt wurde, von Schmerz, Scham, Verzweiflung.
»Keine Angst!«, sagte er hastig. »Ich tu dir nichts.« Er zögerte, rang nach Worten. »Es tut mir leid«, presste er schließlich hervor und wiederholte den Satz in sämtlichen Sprachen, die er kannte. Doch selbst wenn er aller dieser Welt mächtig gewesen wäre, er wäre bedeutungslos geblieben.
All die anderen Männer würden behaupten, dass sie es besser als viele andere Frauen von Barbastro getroffen hätte – weil man sie nur geschändet, nicht getötet hatte. Und weil ihr nur ein Mann Gewalt angetan hatte, keine ganze Horde. Doch er konnte nur daran denken, wie schmählich er gescheitert war, ihr dieses Unrecht zu ersparen. Er hatte sie in Sicherheit bringen wollen – und sie geradewegs in die Arme des schlimmsten Feindes gestoßen, seines Vaters.
Immerhin, als er auf die Knie ging und behutsam heranrutschte, wich sie nicht weiter zurück, und als der Schein der Lampe auf sie fiel, sah er, dass ihr Ausdruck gequält wirkte, aber sie nicht länger vor Furcht verging. Ihre Lippen waren zusammengepresst – ein Zeichen, dass sie nicht reden konnte. Oder nicht reden wollte. Doch es gab eine Sprache, die keiner Worte bedurfte: die Sprache der Musik. Er zog das Instrument hervor, und ein Leuchten in ihren Augen verriet ihm, dass nicht alles in ihr tot war. Behutsam nahm sie es entgegen, stellte es auf ihre Knie und fuhr über die Saiten. Die Töne waren noch sanfter, als er sie dem Instrument entlockt hatte, noch melodischer.
So klingt es, wenn das Mondlicht aufs dunkle Meer fällt und die gekräuselten Wellen versilbert, dachte er.
Unsinn, auch das würde man nicht hören können. Ein Lied, das sie sang, würde er hören und sich über alle Kerben und Risse und Kratzer seiner Seele wie Balsam legen. Aber sie konnte oder wollte auch nicht singen.
»Ich weiß, du wähnst dich in schwärzester Nacht gefangen, aus der es kein Erwachen gibt«, versuchte er sie zu trösten. »Aber irgendwann … irgendwann beginnt der sachte Schein der Morgenröte in die Dunkelheit zu dringen.«
Auch diesen Satz wiederholte er in sämtlichen Sprachen, derer er mehr oder weniger mächtig war. In ihrer kam er nicht weit. Er kannte das Wort für Morgenröte nicht.
Doch plötzlich zwängte sich aus ihren schmalen Lippen ein Laut. Es war nicht der Gesang, nach dem er sich gesehnt hatte, nur ein Krächzen.
»Sahar.«
Adémar verstand. Es war das Wort für Morgenröte.
ERSTER TEIL
~ 1096 ~
1
POITIERS · WINTER 1096
Sahar wusste genau, was sich am 17. Oktober 1083 in Poitiers zugetragen hatte: Ein schweres Erdbeben hatte die Stadt erschüttert und die Kirche Sainte-Radegonde schwer zerstört. Im Anschluss daran hatte ein Feuer in der Stadt gewütet.
Sie wusste bloß nicht, wie sie dieses Ereignis in ihrem Schattenspiel darstellen sollte. So geübt sie darin war, die Figuren, die auf Holzstäben steckten, hinter einem durchsichtigen Vorhang aus Seide zum Leben zu erwecken – unmöglich konnte sie die ganze Szenerie erbeben lassen.
Sie streckte den Kopf hinter dem Vorhang hervor und bat um Vorschläge von Anna und Vincens, zwei Kindern von Dienstmägden, die sie heute zu ihren Zuschauern auserkoren hatte.
Ein Schulterzucken blieb zunächst die einzige Antwort. Dann sagte Vincens: »Ich will eine Geschichte sehen, in der ein Drache vorkommt.«
Gewiss war es ebenfalls eine interessante Herausforderung, einen solchen Feuer spucken zu lassen. Mithilfe glühender Kohlen könnte es vielleicht gelingen, allerdings wäre es angesichts des Seidenvorhangs sehr riskant, also schüttelte Sahar den Kopf. »Das große Erdbeben von Poitiers hat kein Drache verschuldet.«
»Dann ist die Geschichte doch langweilig.« Vincens erhob sich und suchte das Weite, ehe sie reagieren und ihn zurückhalten konnte. Bis vor Kurzem hatte er noch begierig an ihren Lippen gehangen, aber mittlerweile zog er die Gesellschaft von anderen Jungs vor.
»Gibt es in der Geschichte wenigstens eine Königin?«, fragte Anna.
»Das nicht, aber einen … Säugling.«
Sahar begab sich wieder hinter den Vorhang. An jenem denkwürdigen 17. Oktober 1083 hatte nicht nur dieses Erdbeben gewütet, sie war geboren worden, und weil das just in der Stunde, da Tag und Nacht sich trafen, geschehen war, hieß sie Sahar – in der Sprache ihrer Mutter »Morgenröte«.
Damit einher waren gleich zwei Wunder gegangen. Ihre Mutter, die zwei Jahrzehnte zuvor verstummt war, begann bei ihrem Anblick zwar nicht zu sprechen, jedoch wieder zu singen. Und sie hatte damit nicht wieder aufgehört, weil sie die jüngste Tochter – anders als die zahlreichen anderen Kinder, die man ihr immer gleich nach der Geburt entriss und ins Kloster verbannte – hatte behalten dürfen.
Grund dafür war etwas, was Sahar, als sie das erste Mal davon gehört hatte, als drittes Wunder bezeichnete: Ihr Vater Ramnulf war beim Erdbeben vom Giebel eines einstürzenden Hauses erschlagen worden. Allerdings hatte ihr großer Halbbruder Adémar erklärt, dass man den Tod eines Menschen niemals als Wunder bezeichnen durfte, selbst wenn er für andere gute Folgen zeitigte.
Es geschah nicht oft, dass er, der sie meist verwöhnte, mit strenger Stimme zu ihr sprach. Deswegen hatte sie sich gefügt und den Namen ihres Vaters lieber gar nicht mehr in den Mund genommen, zumal ihre Mutter stets ein entsetztes Gesicht machte, wenn er fiel. Wahrscheinlich war er zu Lebzeiten eine so gefährliche, unberechenbare Kreatur wie ein Drache gewesen.
Ob sie vielleicht doch einen solchen in ihre Geschichte einbauen sollte?
Sie hatte noch keine Entscheidung getroffen, als sie feststellte, dass auch Anna nicht mehr zugegen war.
Sahar seufzte. Adémar hätte geduldig gewartet, bis das Stück zu Ende war; er sah sich immer begeistert alle ihre Aufführungen an. So wie er sich gerne alles anhörte, was ihr durch den Kopf ging. Und am liebsten lauschte er den Liedern, die sie von ihrer Mutter gelernt hatte, obwohl Sahar in letzter Zeit nicht mehr singen wollte.
Doch Adémar musste immer mal wieder das Haus verlassen, so auch heute. Und das hielt ihr einmal mehr schmerzlich vor Augen, dass sie hier keine echten, schon gar keine verlässlichen Gefährten hatte, und dass es zugleich keine Möglichkeit gab, der Einsamkeit zu entfliehen. Schließlich hatte der Bruder ihr selbst von klein auf streng untersagt, auch nur einen Schritt vor die Tür zu setzen. So selbstverständlich sie sich diesem Verbot früher gefügt hatte – mit ihren dreizehn Jahren wurde ihre Neugierde immer größer, während ihr der Garten im Innenhof mit seinen zwei Apfelbäumen, den Rosen- und Weinstöcken und dem Beet, in das Salbei und Majoran gepflanzt wurden, immer kleiner erschien.
»Anna! Vincens!«
Sie rief die Namen nur lustlos, verließ aber alsbald ihre Kammer und betrat den Gang. Er war ebenso leer wie der Speisesaal, wo sie die Kinder erst vergeblich unter den mit Samt bezogenen Stühlen suchte, dann unter dem langen schweren Tisch, der am Boden festgenagelt war.
Zumindest die Küche nebenan war nicht gänzlich verwaist. Aus der Richtung des dreifüßigen Schemels neben dem Herd ertönte zwar kein Kindergelächter, aber ein Schnarchen.
Niemand schnarchte so laut wie Ferida. Für sie bräuchte sie auch noch eine Puppe. Ferida hatte ihr schließlich auf die Welt geholfen, war sie doch ständig an der Seite ihrer Mutter geblieben, seit sie beide damals aus ihrer Heimat verschleppt worden waren.
Sahar trat auf die uralte Frau zu und stupste sie sachte an. Ein seltsames gurgelndes Geräusch ertönte, dann schreckte sie hoch.
»Oh, Tarana, was …«
»Tarana ist seit zwei Jahren tot, ich bin ihre Tochter.«
Ferida rieb sich die Augen und schnaubte abfällig. »Das weiß ich doch, das musst du mir nicht sagen. Im Alter wird man nun mal in allem langsamer, im Gehen wie im Denken. Darauf musst du nicht herumreiten wie auf meinem krummen Rücken.«
Als Kind war das ihr größtes Vergnügen gewesen. Während ihre Mutter ihr nur manchmal vorsang, war Ferida diejenige gewesen, die sie liebkoste, mit ihr spielte und ihr die wichtigsten Dinge beibrachte. So auch, wie man mit einem Faden alle Haare bis auf die Augenbrauen aus dem Gesicht entfernte. Nur dass es bei Sahar keine störenden Haare gab. Und seit geraumer Zeit ließ auch Ferida die ihren sprießen, waren ihre Falten doch tief genug, dass die Bartstoppel darin versanken.
Anders als die Lust auf Schönheitspflege hatte sie sich ihren guten Appetit bewahrt, und den unterstellte sie allen anderen Menschen.
»Willst du etwas essen? Ich habe eine Pastete mit Datteln und Zimt gebacken.« Sie schmatzte genießerisch.
»Ich will wissen, wo die anderen Kinder stecken.«
»Wahrscheinlich sind sie wie alle anderen ausgeschwirrt, um den Papst zu sehen.«
»Den Papst?«
»Er weilt doch in Poitiers. Heute weiht er die Kirche Sankt-Hilarius ein.«
Richtig, dies war der Grund, warum auch Adémar am Morgen das Haus verlassen hatte – und ein so trauriges Gesicht gemacht hatte. Nicht, weil die Kirche Sankt-Hilarius eingeweiht wurde, sondern weil der Papst seit Langem beklagte, dass so viele Pilger im Heiligen Land von Heiden erschlagen wurden. Das Morden fand auch Adémar schlimm, noch entsetzter war er aber über die Ankündigung gewesen, die der Papst beim Konzil von Clermont im letzten November gemacht hatte: dass es Gottes Wille wäre, wenn so viele Ritter wie möglich zu einem Feldzug nach Jerusalem aufbrechen würden, um die Heimstätte Jesu auf Erden von den Heiden zu befreien. Viele Adelige hatten begeistert das Kreuz genommen, Guillaume, der Herzog von Aquitanien, allerdings nicht. Der Fürst hatte seine Frömmigkeit nur damit unter Beweis gestellt, dass er den Papst eingeladen hatte, Weihnachten in seinem Reich zu verbringen; und obwohl es mittlerweile Januar geworden war, hielt sich der Heilige Vater immer noch in Poitiers auf.
Sahar konnte sich nicht vorstellen, was am Papst interessanter sein konnte als an der Geschichte des großen Erdbebens und ihrer Geburt.
»Anna und Vincens glauben wohl, dass sie in seiner Nähe von sämtlichen Sünden befreit werden«, erklärte Ferida, und ein spöttischer Tonfall schlich sich in ihre Stimme. »Ich habe beide erst heute Morgen erwischt, wie sie am Honigtopf naschten.«
»Ich dachte, um seine Sünden loszuwerden, muss man im Heiligen Land Heiden erschlagen.«





























