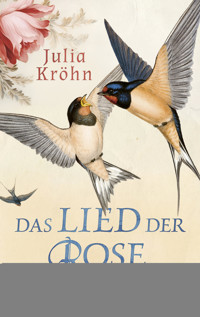12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lehrerin von Hamburg
- Sprache: Deutsch
Eine dunkle Zeit, in der Widerstand die Menschen das Leben kostet. Eine engagierte Lehrerin, die für das Gute kämpft. Und zwei junge Studenten aus München, die neue Hoffnung machen ...
Hamburg im Zweiten Weltkrieg: Das Heulen der Sirenen liegt über der Stadt, Hamburger Juden werden scharenweise deportiert und Abiturienten möglichst schnell an die Front geschickt. Wo gerade noch anschaulicher, lebendiger Unterricht gehalten wurde, ist wieder Zucht und Ordnung eingekehrt. Die einstigen Bildungsideale scheinen verloren. Doch während sich Emil und Anneliese dem NS-Regime andienen, bleibt Felicitas ihren Werten unverrückbar verbunden. Als sie ehemaligen Schülern wiederbegegnet, aus denen mittlerweile Studenten geworden sind, kommt ihr ein Flugblatt aus München in die Hände, das neue Hoffnung macht. Und eine radikale Entscheidung verlangt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Hamburg im Zweiten Weltkrieg: Das Heulen der Sirenen liegt über der Stadt, Hamburger Juden werden scharenweise deportiert und Abiturienten möglichst schnell an die Front geschickt. Wo gerade noch anschaulicher, lebendiger Unterricht gehalten wurde, ist wieder Zucht und Ordnung eingekehrt. Die einstigen Bildungsideale scheinen verloren. Doch während sich Emil und Anneliese dem NS-Regime andienen, bleibt Felicitas ihren Werten unverrückbar verbunden. Als sie ehemaligen Schülern wiederbegegnet, aus denen mittlerweile Studenten geworden sind, kommt ihr ein Flugblatt aus München in die Hände, das neue Hoffnung macht. Und eine radikale Entscheidung verlangt …
Autorin
Die große Leidenschaft von Julia Kröhn ist nicht nur das Erzählen von Geschichten, sondern auch die Beschäftigung mit Geschichte: Die studierte Historikerin veröffentlichte – teils unter Pseudonym – bereits zahlreiche Romane. Nach ihrem großen Erfolg, »Das Modehaus«, ein Top-20-SPIEGEL-Bestseller, und ihrem hochgelobten Riviera-Zweiteiler folgt nun die nächste opulente Saga vor schillernder Kulisse. Darin lässt die Tochter zweier Lehrer, die selbst auch Lehramt studiert hat, viele ihrer eigenen Schulerfahrungen mit einfließen.
Weitere Informationen unter: www.juliakroehn.at
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
JULIA Kröhn
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Julia Kröhn
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
© 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Everett Collection; portumen; peter jesche; Valentin Agapov) und Richard Jenkins PhotographyFlugblätter Nr.3 und 6 der Weißen Rose: BArch, R 3018/18431
Mit freundlicher Genehmigung des Bundesarchivs
KW · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26393-5V001
www.blanvalet.de
Was bisher geschah
Als Dr. Felicitas Marquardt 1930 als junge Studienrätin für Latein und Geschichte an der Hamburger Alsterschule ihren Dienst antritt, befindet sich nicht nur die Welt im Umbruch – auch die Gestaltung des Unterrichts. Bis kurz zuvor hat dieser vor allem einem Zweck gedient: Tugenden wie Gehorsam, Opferbereitschaft und Selbstüberwindung notfalls mit dem Rohrstock einzubläuen. Doch die Stimmen, die sich der »schwarzen Pädagogik« entgegensetzen, werden immer lauter, und Felicitas ist glühende Verfechterin der sogenannten Reformpädagogik, die mit Namen wie Montessori, Pestalozzi und Steiner verbunden ist. Hier steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt, das mit all seinen Neigungen und Begabungen gefördert werden soll und sich frei entfalten darf. Prügelstrafe und Sitzenbleiben werden abgeschafft, Mädchen und Jungen gemeinsam unterrichtet.
Einen Bruder im Geiste findet Felicitas in ihrem Kollegen Levi Cohn, den seine gute Beobachtungsgabe und die große Liebe zur Literatur auszeichnen und der für jede Situation das passende Zitat parat hat. Und auch Emil, der an der Alsterschule Turnen und Englisch unterrichtet, scheint ein Verbündeter zu sein. Die selbstbewusste Felicitas hat es ihm schon in Berliner Studienzeiten angetan, offen bekennen konnte er seine Gefühle dennoch nicht. Bei einem ausgelassenen Tanzabend kommen sich die beiden erstmals näher, doch das, was Emil instinktiv anzieht, ist zugleich das, was ihn, beherrscht wie er ist, zutiefst verschreckt – Felicitas’ unkonventionelle Art. Während er ein bürgerliches Leben anstrebt, ist für sie, die ihre Freiheit und Unabhängigkeit nicht riskieren will, eine Ehe undenkbar. Männer spielen in ihrem Leben nur als unverbindliche Affären eine Rolle. Felicitas kann sich vorstellen, auch mit Emil eine Affäre zu beginnen, aber der ist schockiert von ihrem Lebenswandel und ihrer freizügigen Sichtweise auf die Sexualität und wendet sich von ihr ab.
Als Emil wenig später Anneliese kennenlernt, Felicitas’ Freundin aus Kindertagen, die nach Hamburg kommt, um dort eine Stelle als Hauswirtschaftslehrerin anzutreten, scheint er eine Frau ganz nach seinem Geschmack zu finden – sanft, weiblich, anpassungsfähig. Doch auch in den folgenden Jahren kann er sich der Faszination, die von Felicitas ausgeht, nie ganz entziehen, selbst wenn er das hinter vermeintlicher Gleichgültigkeit und Verachtung gut zu verbergen weiß.
Anneliese und Felicitas sind einander sehr verbunden. Allerdings treiben sowohl Annelieses Beziehung zu Emil als auch ihr unterschiedliches Weltbild einen Keil in ihre Freundschaft. Für Anneliese ist der Lehrberuf nur eine vorübergehende Station, eigentlich hofft sie auf Heirat und Kinder, und sie wartet ungeduldig auf Emils Antrag.
Felicitas kann das nicht verstehen, sie empfindet Annelieses Verhalten als Verrat an der Sache der Frau. Die Entfremdung von Anneliese führt dazu, dass sich Felicitas noch enger Levi anschließt. Da sie ihn nie als potenziellen Liebhaber, nur als Vertrauten betrachtet, dem sie alles über ihr wildes Leben berichtet, entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen. Außerdem findet sie Erfüllung in ihrem Beruf: Dank ihrer fortschrittlichen Unterrichtsmethoden fliegen ihr die Herzen der Schüler zu, insbesondere jenes von Paul Löwenhagen, einem besonders aufrührerischen Jungen.
Das freie Leben endet abrupt, als die Nazis 1933 die Macht ergreifen und nicht nur die Welt, auch das Schulsystem auf den Kopf stellen. Auf dem Schulhof weht nun die Hakenkreuzfahne, regimekritische und jüdische Lehrer werden entlassen. Während der Konferenzen dürfen sich Lehrerinnen und Lehrer nicht länger zu Wort melden, stattdessen halten Gauleiter stundenlange Vorträge. Klassensprecher, Elternvertreter und Koedukation werden abgeschafft, die Prügelstrafe wird wieder eingeführt. Jüdische Schüler müssen mit schlechten Noten bedacht werden, eine HJ-Mitgliedschaft bewahrt vor dem Sitzenbleiben.
Und nicht nur der Schulalltag ändert sich – auch die Unterrichtsinhalte werden zensiert. Etliche Schriftsteller, die im Fach Deutsch behandelt werden, stehen auf dem Index, in Geschichte gilt es den Fokus auf den »Freiheitskampf der Germanen« zu legen, in Physik ist Albert Einsteins Relativitätstheorie von nun an verpönt, stattdessen wird Rassenlehre ein wichtiges Fach.
Felicitas muss nicht nur all das fassungslos hinnehmen, sondern auch, dass Levi, er ist Halbjude, entlassen wird und künftig nur an der jüdischen Talmud-Tora-Schule unterrichten darf. Umso mehr empört es sie, dass sich Emil als Opportunist erweist und Oscar Freese, den sozialdemokratischen Schulleiter der Alsterschule, ablöst. Dass ihr einstiger Kommilitone sein Amt letztlich nutzt, um sie, die aufgrund ihrer hartnäckigen Weigerung, der NSDAP beizutreten, immer wieder kurz vor ihrer Entlassung steht, zu schützen, macht das nicht wieder gut. Nicht minder setzt es ihr zu, dass Anneliese an nichts anderes denkt als an ihre baldige Eheschließung. Emil hat ihr endlich den ersehnten Antrag gemacht – allerdings nicht aus Liebe zu ihr, sondern um sich Felicitas endgültig aus dem Kopf zu schlagen.
Nach Emils und Annelieses Hochzeit meidet Felicitas die Freundin für lange Zeit. Erst 1935 kommt es zu einer Wiederannäherung der beiden, wenn auch aus traurigem Anlass. Oscar Freese wird verhaftet, nachdem er sich in der Hilfsschule, wo er mittlerweile unterrichtet, geweigert hat, dem neuen Gesetz zur Erbgesundheit Folge zu leisten und vermeintlich erbkranke Kinder anzuzeigen. Im KZ Fuhlsbüttel verliert er unter dubiosen Umständen sein Leben, seine Frau versinkt daraufhin in eine Depression, die gemeinsame Tochter Elly braucht dringend Fürsorge. Obwohl die Kleine Vierteljüdin ist, sind Anneliese und Emil bereit, sie bei sich aufzunehmen – Emil, weil er Felicitas diesen Gefallen nicht verweigern kann, Anneliese, weil sie seit Jahren unter ihrer ungewollten Kinderlosigkeit leidet.
Anneliese bekommt endlich, was sie sich so sehr gewünscht hat – eine kleine Familie –, und ist so glücklich wie nie zuvor, Felicitas dagegen fühlt sich schrecklich einsam. Schon lange zieht sie keinen Trost mehr aus ihren Affären, und auch ihre Freundschaft mit Levi droht zu zerbrechen, weil dieser nach der Verkündigung der Nürnberger Gesetze auf Distanz zu ihr geht, um sie vor dem Verdacht der Rassenschande zu schützen.
Für kurze Zeit findet Felicitas Ablenkung, als sie sich gemeinsam mit ihrem ehemaligen Schüler Paul Löwenhagen, der seit Langem für sie schwärmt, den Swing Kids anschließt – tanzhungrigen Jugendlichen, die das Verbot von amerikanischer Musik nicht hinnehmen. Doch auch diese haben unter immer stärkeren Repressionen zu leiden, und ein Tanzabend findet ein abruptes Ende, als die HJ mit der Gestapo auftaucht. Paul wird verhaftet, nach einem mehrwöchigen Aufenthalt im Konzentrationslager Fuhlsbüttel scheint er gebrochen.
Felicitas ergibt sich ganz der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit – doch Pauls Schwester Helene vermag ihr einen Weg aus der Dunkelheit zu weisen. Erna Stahl, eine den Nazis offen kritisch gegenüberstehende Lehrerin, lädt nach ihrer Entlassung von der Hamburger Lichtwarkschule, einem Zentrum der Reformpädagogik, regelmäßig eine Gruppe Schüler zu einem Lesekreis in ihre Wohnung ein, wo sie die humanistischen Bildungsideale hochhält und den jungen Leuten vermeintlich entartete Kunst und von den Nazis verbotene Bücher näherbringt. In dieser Runde erfährt auch Felicitas Rückhalt und Geborgenheit. Vor allem spürt sie, dass hier ein Geist der Freiheit weht und dass ihr die Nazis zwar viel, aber nicht alles genommen haben: nämlich nicht die tiefe Überzeugung, dass Bildung der Weg ist, der Diktatur zu trotzen.
Aufgrund der neu gewonnenen Stärke kann sie auf Levi zugehen, seine Ängste, ihr zu schaden, ausräumen, und ihn sogar dazu überreden, in ihre Wohnung zu ziehen, nachdem sein Vermieter ihm gekündigt hat. Auch diese ist nun ein Ort, wo der Liebe zur deutschen Literatur gefrönt und die immer düsterere Welt nach draußen verbannt wird.
Der Friede währt allerdings nicht lange. Als im Oktober 1938 alle polnischen Juden aus Hamburg deportiert werden, verstecken Felicitas und Levi ein Kind – die zehnjährige Charlotte. Emil deckt Felicitas, Anneliese dagegen wird massiv von ihrer Freundin Carin Grotjahn, einer glühenden Nationalsozialistin und Gattin des Schulsenators Dr. Waldemar Grotjahn, unter Druck gesetzt. Sie stellt einen Ariernachweis für Elly, die Anneliese wie eine eigene Tochter ans Herz gewachsen ist, in Aussicht – doch dafür muss Anneliese ihre Gesinnungstreue beweisen.
Felicitas ahnt nichts davon. Über die gemeinsame Rettungsaktion von Charlotte erkennt sie allerdings, dass Levi nicht einfach nur ein guter Freund ist, sondern ihr Seelenverwandter, den sie seit Langem liebt. Leider können sie ihr Glück nur wenige Tage genießen. Sie verbringen eine Liebesnacht, als sich am 9. November 1938 die SA zusammenrottet und die Hamburger Synagogen und Kaufhäuser zu zerstören beginnt …
Bald stehen die braunen Horden auch vor ihrer Tür und bezichtigen Levi der Rassenschande. In letzter Sekunde kann er aus dem Fenster fliehen, und obwohl Felicitas eisern an ihrer Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft festhält, fühlt sie doch, dass dies ein Abschied für lange Zeit, wenn nicht sogar für immer ist …
»Um eines bitte ich: Ihr, die Ihr diese Zeit überlebt, vergesst nicht. Vergesst die Guten nicht und nicht die Schlechten. Sammelt geduldig die Zeugnisse über die Gefallenen. Eines Tages wird das Heute Vergangenheit sein, wird man von der großen Zeit und von den namenlosen Helden sprechen, die Geschichte gemacht haben.
Ich möchte, dass man weiß, dass es keine namenlosen Helden gegeben hat, dass es Menschen waren, die ihren Namen, ihr Gesicht, ihre Sehnsucht und ihre Hoffnungen hatten, und dass deshalb der Schmerz auch des Letzten unter ihnen nicht kleiner war als der Schmerz des Ersten, dessen Name erhalten bleibt. Ich möchte, dass sie Euch alle immer nahe bleiben, wie Bekannte, wie Verwandte, wie Ihr selbst.«
Julius Fučík, tschechischer Widerstandskämpfer
1938
November
Ich bin Deutschlehrer, ich habe kein Unrecht getan.«
Seit seiner Verhaftung hatte Levi diese Worte ständig wiederholt, immer war er auf taube Ohren gestoßen. Diesmal ignorierte ihn sein Gegenüber nicht, doch in dem Blick, der sich auf ihn richtete, stand Verachtung.
»Ein Deutschlehrer willst du sein? Ein Saujude, das bist du!« Levi wollte einwenden, dass das eine das andere nicht ausschloss, aber dazu kam er nicht. »Los!«, brüllte der SA-Mann ihn an, der Stahlhelm und Gewehr trug. »Du gibst alles ab, was du bei dir hast: Uhr, Geld, persönliche Gegenstände!«
»Ich habe keine Uhr … kein Geld … ich habe nur …«
Sein Buch! Er hatte doch ein Buch bei sich getragen, als er vor der wütenden SA-Truppe geflohen war, als man ihn schließlich gestellt und verhaftet hatte. Doch als er erklären wollte, dass er das unmöglich abgeben könne, prasselten Hiebe auf ihn ein.
Ein Schlag traf seine Nase, einer sein Kinn. Er rieb es benommen, während fremde Hände ihn betasteten, ihm nicht nur das Buch abnahmen, auch seinen Bleistift. Hilflos streckte er seine Hände danach aus, doch was der SA-Mann in diese drückte, war nicht sein Eigentum.
»Los, lies!« Er hielt einen Zettel. Schwarze Punkte tanzten darauf, die Punkte waren offenbar … Buchstaben. »Los, lies!«, brüllte der Mann wieder.
Levi konnte nicht lesen, obwohl man ihm die Brille gelassen hatte. Buchstabe fügte sich an Buchstabe. Aber es wurden keine Worte daraus, keine, die Sinn machten.
Schutzhaftbefehl.
Rassenschande.
Die Buchstaben wurden größer, das Gesicht in seinen Erinnerungen wurde größer. Er lächelte das Gesicht an. Das, was Felicitas und ich haben, ist doch keine Rassenschande. Was wir haben, ist etwas Besonderes … etwas Einzigartiges … etwas …
Jemand riss ihm den Schutzhaftbefehl aus der Hand und das Lächeln aus dem Gesicht.
Bis jetzt hatten ihn Faustschläge getroffen, doch dabei blieb es nicht. Levi hatte kaum hochgeblickt, als ein Schulterriemen, der Teil der SA-Uniform war, in sein Gesicht schnalzte. Er spürte, wie seine Unterlippe platzte, hatte auch das Gefühl, sein Auge würde platzen. Der dritte Schlag wurde ihm auf die Stirn versetzt, der vierte auf den Hinterkopf. Aus dem roten Bild wurde ein schwarzes. Nicht nur er versank in der Schwärze, auch Felicitas’ Gesicht.
Die Welt lag in Scherben, aber irgendwann konnte er Konturen sehen, von Bettgestellen, etwa einem Dutzend, von Garderobenhaken, Bänken, einer Toilette. Und da war ein Wasserhahn, aus dem es tropfte. Plitsch, platsch. Erst als er sich aufrichtete, bemerkte er, dass er auf einer stinkenden Matratze lag. Blut tropfte auch. Plitsch, platsch.
Wie von weither nahm er einen schrillen Ton wahr, dem endlosen Echo einer Trillerpfeife gleichend. Nach einer Weile wurden Stimmen daraus. Auch seine Stimme war zu hören.
»Deutschlehrer …«
Es blieb das einzige Wort, mehr brachten seine verkümmerten Gedanken nicht zustande. Ehe er ihm eine Bedeutung geben konnte, wurde es zerrissen – von Schmerzen, die von seinem Kopf in den ganzen Leib jagten, von Erinnerungsblitzen.
Die schreckliche Nacht vom 9. auf den 10. November, als das jüdische Hamburg in Scherben zerfallen war … die Tage danach, als er auf der Flucht gewesen war … der Moment, als man ihn verhaftet hatte …
Auf dem Polizeiwachtlokal in der Humboldtstraße hatte er zum ersten Mal beteuert, dass er nichts Unrechtes getan hatte. Im Alten Stadthaus, dem Präsidium der Hamburger Polizei, hatte er es wiederholt. Er war nicht der Einzige, den man dorthin gebracht hatte, so viele Männer mit verstörten Blicken, Schrammen und blauen Flecken hatten auf ihr Verhör gewartet. Levi hatte nicht verstanden, warum der Strom der Inhaftierten nicht abriss, man offenbar alle Juden der Stadt eines Verbrechens anklagte.
Die Frage schwebte immer noch über ihm, doch die Antwort war unerreichbar. Er sah nach oben, wo ein Lichtpunkt hin und her schaukelte. Seit wann bebt die Sonne?, fragte er sich. Allerdings: Wie sollte die Sonne auch über dem neuen Deutschland scheinen, ohne zu beben?
Er presste die Augen ganz fest zusammen, versuchte, sie wieder zu öffnen. Es war nicht die Sonne, sondern eine Glühbirne, die über ihm schaukelte, vor allem, wenn sich die Tür öffnete und weitere Gefangene in das Verlies gestoßen wurden.
Einer von ihnen trug nur einen Schlafanzug, man hatte ihn wohl aus dem Bett heraus verhaftet.
Als er begann, die Menschen zu zählen, schien die Glühbirne auf seinen Kopf zu fallen, dort zu zerspringen. Etwas stieg ihm säuerlich die Kehle hoch, trat über seine Lippen, brannte. Nur das Wort, das er ausstieß, brannte nicht, es war die einzige Labsal.
»Deutschlehrer …«
Schemenhaft wie die Glühbirne war das Gesicht, das sich vor seines schob. Er nahm den Geruch von Angst wahr.
»Sag das nicht zu laut. Auf die Intelligenten haben sie es besonders abgesehen. Wer eine Brille trägt, wird nicht nur mit Schlägen malträtiert, auch mit Peitsche, Stock und Rundschläger. Einen haben sie drei Tage lang in einen Spind gesperrt, gerade mal einen Meter breit, weil er ein Gesetzesbuch dabeihatte und daraus zitierte.«
Levi fühlte sich auch wie in einem Spind gefangen. »Sie können doch nicht allen Hamburger Juden Rassenschande vorwerfen.«
»Sie müssen uns gar nichts vorwerfen. Schon seit Jahren wird Schutzhaft ohne richterliche Mitwirkung verhängt. Es genügt, dass sie uns hassen, und nach dem Attentat tun sie das noch mehr als früher.«
Richtig, das Attentat. Ein polnischer Jude hatte es auf einen deutschen Botschaftsmitarbeiter verübt, hatte sich rächen wollen für die Vertreibung der polnischen Juden aus Deutschland. Die Deutschen hatten es nicht nur ihm heimgezahlt, hatten Synagogen und jüdische Geschäfte verwüstet und alles kurz und klein geschlagen … Menschen.
Wieder schaukelte die Glühbirne.
»Wo sind wir hier eigentlich?«
»Im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel.«
»Und was passiert mit uns?«
Der Mann gab ihm keine Antwort, nur noch mehr Ratschläge.
»Verhalte dich unauffällig, sieh ihnen nicht ins Gesicht, befolge jeden Befehl, auch den lächerlichsten. Wenn sie uns Essen bringen, iss es so schnell wie möglich, leck den Napf blitzblank, vor allem den Löffelstiel, wenn wir Glück haben, gibt es nicht nur Brot, manchmal auch Salzhering und Eier.«
Levi konnte sich nicht vorstellen, dass er Salziges noch schmecken konnte. Und um satt zu werden, wirklich satt, brauchte er etwas anderes als Salzhering und Eier.
Er sah das Gesicht des Mannes, der zu ihm gesprochen hatte, nun etwas deutlicher.
»Schreiben …«, brachte er mühsam hervor, »dürfen wir schreiben?«
»Einmal haben sie uns vermeintlich erlaubt, Briefe zu verfassen. Aber hinterher haben sie sie zerrissen und erklärt, sie hätten keine Lust, Judenschweine zu zensieren.«
Levi richtete sich ein wenig auf, und inmitten von all dem Grauen nahm er plötzlich etwas Weißes wahr – ein Stück Toilettenpapier, auf dem ein Häftling die schwarzen Linien eines Damespiels gezeichnet hatte. Kleine Steine aus der Mauer dienten als Spielsteine und Würfel.
»Womit … womit hast du diese Linien eingezeichnet?«
Der Häftling holte hinter seinem Ohr einen Bleistiftstummel hervor. Sein Lächeln war triumphierend, das von Levi auch. Mit diesem Bleistift konnte man nicht mehr viele Linien malen, erst recht nicht viele Worte aufschreiben, aber einige wenige doch. Sie würden für einen Satz reichen, den Satz, den er auf die Rückseite des Toilettenpapiers zu schreiben gedachte.
»›Darin besteht die Liebe: dass sich zwei Einsame beschützen und berühren und miteinander reden‹«, murmelte er.
Der andere starrte ihn stirnrunzelnd an. »Vielleicht kann man einen Brief hinausschmuggeln, ein paar der Aufseher sind bestechlich, aber willst du nicht lieber schreiben, was dir widerfahren ist?«
Levi schüttelte den Kopf. Wenn es eine Chance gäbe, Felicitas eine Nachricht zukommen zu lassen, hatte er nichts hinzuzufügen.
Sie hatten das, was sie füreinander waren, immer mit den Worten von Rilke ausgedrückt. Alles, was sie wissen musste, war, dass er noch immer Deutschlehrer war. Und ein Liebender.
Felicitas ging mit gesenktem Kopf durch das Grindelviertel. Knapp drei Wochen waren seit jener Nacht vergangen, in der die mageren Reste eines weltoffenen, liberalen Deutschland zertrümmert worden waren oder sich in Rauch aufgelöst hatten. Es tat immer noch weh, die Spuren der Verwüstungen zu sehen, zerstörte Geschäfte und Wohnungen, mit Hakenkreuzen beschmierte Bürgersteige. Es tat immer noch weh, dass die gegrölten Lieder in ihr widerhallten. Halli, die Synagoge brennt, das Judenvolk, es flieht und rennt. Es tat immer noch weh, an den Orten vorbeizukommen, wo sie sich einst mit Levi aufgehalten hatte, schon damals oft in Sorge um die Zukunft, aber zumindest mit ihm vereint.
Ein Hupen ließ sie zusammenschrecken, Abgase drangen ihr in Kehle und Nase. Wurde das Automobil, das eben von seinem Stellplatz im Innenhof an ihr vorbei auf die Straße fuhr, noch von seinem rechtmäßigen Besitzer gelenkt? Oder gehörte es eigentlich einem Juden, dem man es geraubt hatte? Erst am Tag zuvor hatte sie erfahren, dass nicht nur deren Führerscheine sämtlich für ungültig erklärt worden waren, sondern man ihre Kraftfahrzeuge eingezogen hatte.
Und das war nicht einmal der größte Diebstahl. Als Entschädigungssumme für den Mord an Eduard vom Rath war insgesamt eine Milliarde Reichsmark angesetzt worden. Jeder einzelne Jude hatte das, was er an Edelmetallen, Juwelen und Kunstwerten besaß, zu verkaufen und den Erlös auf ein Sperrkonto einzuzahlen.
Wer hatte sich wohl diese Milliarde ausgedacht? Jene monströse Zahl mit den unzähligen Nullen ließ sie an den Mob denken, auch Nullen, die nur an Wert gewonnen hatten, weil sie sich an eine Eins hefteten.
Gut, dass ich nicht reich bin, hätte Levi gescherzt, und gut, dass ich nie einen Führerschein gemacht habe und kein Auto besitze. Aber es hätte ihn getroffen, dass Juden nun auch der Besuch von Theatern und Konzerten verboten worden war – und auch der Anblick der Synagoge am Bornplatz hätte ihm zugesetzt oder das, was von ihr geblieben war: verkohlte Wände, die nicht stolz gen Himmel wuchsen, sondern sich unter den grauen Wolken duckten. Die Talmud-Tora-Schule gleich gegenüber hatte man zwar nicht angezündet, aber Felicitas sah, dass fast sämtliche Fenster eingeschlagen worden waren. Auch im Inneren erwartete sie der Gestank von Rauch – und Stimmen, vor allem Kinderstimmen.
Als Felicitas wenige Tage zuvor die Schule betreten hatte, hatte sie noch gähnende Leere empfangen, jetzt tummelten sich im Eingangsbereich nicht nur Knaben, auch Mädchen, obwohl diese die Talmud-Tora-Schule bislang nicht besucht hatten.
Das erste Kind, das sie fragte, was sie hier machten, gab ihr keine Antwort. Das zweite bekundete knapp, dass der Unterricht wieder aufgenommen worden sei.
Als sie unter der Kinderschar eine junge Frau entdeckte, konnte sie sich vage daran erinnern, dass Levi diese einmal als seine Kollegin Rahel vorgestellt hatte.
»Ist es wahr?«, fragte Felicitas.
Die Lehrerin hielt eine Liste in der Hand. Eine Weile rief sie die Namen von Kindern auf und notierte sie, ehe sie hochblickte. Die Erleichterung, die Felicitas kurz gefühlt hatte, schwand unter ihrem düsteren Blick.
»Ja«, sagte sie traurig, »die Schule hat so viele Schüler verloren, etliche haben Deutschland fluchtartig verlassen. Deshalb ist geplant, die Israelitische Töchterschule aufzulösen und die verbliebenen Schülerinnen künftig in der Talmud-Tora-Schule zu unterrichten.« Sie unterdrückte ein Seufzen. »Da zugleich sämtliche jüdischen Schüler aus den allgemeinen und höheren Schulen ausgeschlossen wurden, müssen wir nun etwas Ordnung ins Chaos bringen.«
Wieder wandte sie sich an die Kinder, ließ sich Namen und Alter nennen.
»Aber dass der Unterricht wieder aufgenommen wurde, bedeutet doch, dass ein Großteil des verhafteten Lehrerkollegiums freigelassen wurde«, rief Felicitas.
Diesmal verharrte Rahels Blick etwas länger auf ihr, sie nickte zögerlich. »Die meisten, das stimmt … aber nicht Levi. Er wurde ja auch nicht hier an der Schule verhaftet.«
»Ich weiß«, sagte Felicitas knapp und kaute auf ihrer Unterlippe.
Ob Rahel wusste, dass man Levi verhaftet hatte, weil man ihn der Rassenschande bezichtigte?
Schon richtete sich die Lehrerin wieder an die Kinder, und Felicitas musste allein mit ihren Erinnerungen fertigwerden.
Nach jener schrecklichen Nacht hatte es tagelang gedauert, bis sie einen von Levis Vettern, Friedrich Pohlmann, ausfindig gemacht hatte. Er war der Sohn eines Bruders von Levis nichtjüdischer Mutter, der – wie alle seine Angehörigen – schon seit Jahren vermieden hatte, Kontakt zu Levi zu halten. Die jüdische Verwandtschaft war ihm peinlich. Nicht peinlich war es dem Vetter dagegen, vor Felicitas zuzugeben, dass Levi tatsächlich versucht hatte, bei ihm Unterschlupf zu finden, er ihn aber der Gestapo ausgeliefert hatte. Der deutschen Volksgemeinschaft fühle sich ein aufrechter Deutscher nun mal mehr verpflichtet als einem Vetter, den es nicht geben würde, hätte sich dessen Mutter nicht aus reiner Geldgier von einem buckligen Juden verführen lassen.
Levis Vater war ein angesehener Kaufmann!, hatte Felicitas ihm ins Gesicht schreien wollen. Wie konnten Sie einen feinen Mann wie Levi verraten?
Aber die Worte waren wie Scherben. Sie würde sich den Mund daran blutig schneiden, während sie eine stumpfe Waffe blieben, wenn sie sie gegen diesen selbstgefälligen Mann richtete.
»Auch wenn Levi bislang noch nicht entlassen wurde«, wandte sie sich jetzt an Rahel, »hat denn irgendjemand vom Kollegium etwas von ihm gehört?«
Rahel zuckte mit den Schultern. »Ich … ich weiß es nicht, fragen Sie am besten Direktor Spier.«
Felicitas stieg die Treppe hoch zu den Verwaltungsräumen.
Als sie Arthur Spier einige Jahre zuvor kennengelernt hatte, hatte sie einige Ähnlichkeiten mit Levi festgestellt. Auch er trug eine runde Brille, in seinem Blick stand ebenso viel Wachheit wie Klugheit. Sein dunkles Haar war allerdings viel strenger zurückgekämmt gewesen und von grauen Strähnen durchzogen. Als sie ihn jetzt hinter seinem Schreibtisch sitzen sah, hätte sie ihn fast nicht wiedererkannt. Sein Haar war nicht nur gänzlich grau, es stand ihm regelrecht zu Berge, das Gesicht war zerschunden, und er hielt sich die Hand schützend vor die Augen, als gälte es, sie vor dem grellen Licht einer Verhörlampe zu schützen. Nur seine Stimme war noch die alte. Er sprach unaufhörlich in einen Telefonhörer, allerdings nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Felicitas beherrschte diese Sprache nicht gut genug, um viel zu verstehen, doch sie musste keine Vokabeln kennen, um zu spüren, dass er sein Anliegen ebenso verzweifelt wie hilflos hervorbrachte.
Irgendwann ließ er den Telefonhörer sinken. Sie stand schon vor seinem Tisch, als er endlich ihrer gewahr wurde, kaum merklich zusammenzuckte.
»Ich habe mit dem Movement for the Care of Children from Germany telefoniert«, murmelte er. »Sie … sie nehmen Kinder auf, aber … aber viel zu wenige.« Felicitas starrte ihn verständnislos an. »Eine Londoner Organisation«, erklärte er, »sie sorgt dafür, dass jüdische Kinder aus Deutschland nach England reisen können und dort bei Pflegefamilien unterkommen.«
»Ohne ihre Eltern?«, rief Felicitas entsetzt.
Er nickte. »Aber mit der Hoffnung auf ein normales Leben … auf Bildung … auf eine Zukunft.« Seiner Stimme war der Zweifel anzuhören, wie man eine solch unmenschliche Entscheidung treffen konnte, ohne daran zu zerbrechen. »Entschuldigen Sie«, sagte Arthur Spier, »Sie denken gewiss, ich hätte keinerlei Manieren, eigentlich müsste ich aufstehen, aber …«
Die nächsten Worte, die er murmelte, waren kaum hörbar. »Polizeigefängnis … Treppe … gestolpert … Bein nicht belasten.«
Felicitas vermutete, dass er nicht gestolpert, sondern gestoßen worden war. Sie vermutete auch, dass er nicht darüber sprechen würde. Viele Inhaftierte wurden erst entlassen, wenn sie eine Erklärung unterschrieben, über alles, was ihnen widerfahren war, zu schweigen.
»Ich bin Felicitas Marquardt, Levi Cohn hat uns vor einiger Zeit einander vorgestellt. Haben Sie irgendetwas von ihm gehört? Ist ein anderer Ihrer Lehrer ihm jüngst begegnet? Er ist einfach … verschwunden.«
»Ich weiß, wer Sie sind. Sie versorgen unsere Schule seit Jahren mit Büchern und Unterrichtsmaterialien.«
Verletztes Bein hin oder her, plötzlich stützte er sich mit beiden Händen am Schreibtisch ab, kämpfte sich hoch.
»Um Himmels willen!«, entfuhr es Felicitas. »Sie sollten sich nicht so anstrengen!«
Ein schmerzliches Lächeln verzog seinen Mund. Er ließ sich zwar wieder auf den Stuhl fallen, erklärte dennoch entschlossen: »Ohne Anstrengung wird es aber nicht möglich sein, die Kinder aus Deutschland herauszubringen. Und ohne Anstrengung wird es nicht möglich sein, die Hoffnung zu bewahren, dass sie bald wieder zurückkehren werden.«
Sie kannte diesen Kampf um die Hoffnung. Auch das Gefühl, diese unaufhörlich schrumpfen zu sehen.
Direktor Spier seufzte. »Die meisten Lehrer der Talmud-Tora-Schule, die verhaftet wurden, auch die älteren Schüler, wurden ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht. Ich vermute, Levi Cohn befindet sich ebenfalls dort. Die Frage ist nur, wie lange noch …«
»Sie denken, er wird bald freigelassen?«, rief Felicitas.
Der Schulleiter nahm die Hände von der Tischplatte, faltete sie auf seinem Schoß. »Es gibt verschiedene Gerüchte. Die Juden, denen man nichts anderes vorwirft, als dass sie Juden sind, hat man bald wieder entlassen. Aber die, denen man obendrein eine falsche politische Gesinnung vorwirft oder gar ein Verbrechen, bringt man in Konzentrationslager – sei es Oranienburg, Neuengamme oder Sachsenhausen. Dort sollen sie für diverse Arbeitskommandos eingesetzt werden. Ich vermute, es ist weitaus schwerer, von dort jemanden freizubekommen als von Fuhlsbüttel. Aber wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Und ich weiß nicht, ob dieses Schicksal auch Levi Cohn droht.«
»Ich verstehe«, murmelte Felicitas wie betäubt, obwohl sie nichts verstand. Wie war es möglich, jahrelang nicht zu bemerken, dass Levi mehr war als ein Freund, als ein Vertrauter? Wie war es möglich, dass sie ausgerechnet, als sie endlich zueinandergefunden hatten, auseinandergerissen worden waren wie in einem düsteren Märchen, wo Flüsse oder gar Ozeane und meistens sieben Jahre zwischen Prinz und Prinzessin standen?
Nun, Levi war kein Prinz, Levi war ein Deutschlehrer.
Plötzlich griff auch sie nach der Tischplatte, plötzlich klammerte auch sie sich daran, weil sie sonst gewankt wäre. Sie hatte keine Hand frei, um ihr Gesicht zu verbergen, als ihr Tränen in die Augen schossen.
Arthur Spier kämpfte sich wieder hoch. So schwer es ihm fiel, er schaffte es nicht nur, stehen zu bleiben, sondern sogar, ein paar humpelnde Schritte zu machen. Felicitas sah, dass sein rechter Fuß unnatürlich nach außen verdreht war.
»Ich … ich brauche kein Taschentuch«, beeilte sie sich zu sagen, weil sie vermutete, dass er ihr eins anbieten würde.
Doch was er ihr im nächsten Augenblick in die Hände drückte, war kein Taschentuch, sondern ein Notizbüchlein. Sie erkannte die Schrift sofort. Die eleganten Buchstaben waren sehr klein, schmal, als dürften sie einander nicht zu viel Platz wegnehmen, zugleich gestochen scharf.
»Das … das hat sich bei den Unterlagen von Levi Cohn befunden«, murmelte er. »Sie können es gern haben.«
Sie blätterte es durch. Zitate bedeckten die Seiten, so viele Zitate. Die meisten von ihnen kannte Levi auswendig, aber er musste sie aufgeschrieben haben, weil sie ihm so gut gefielen.
»Darin besteht die Liebe: dass sich zwei Einsame beschützen und berühren und miteinander reden«, stand auf der letzten Seite.
Sie hatte diese Worte von Rilke oft aus seinem Mund gehört, und sie sagten mehr als jedes »Ich liebe dich«, drückten sie ihre Geschichte doch perfekt aus – die Geschichte von zwei einsamen, verlorenen Menschen, die sich übers Reden gefunden hatten.
Sie schloss das Büchlein, drückte es an sich. »Danke …«
»Nichts zu danken.« Der Schulleiter ließ sich wieder auf den Stuhl fallen. »Besser, Sie kommen künftig nicht mehr her. Ich weiß nicht, wie lange unsere Schule überhaupt noch bestehen wird.«
»Solange es sie gibt, werde ich weiter Bücher bringen, Papier, Stifte, was immer Sie brauchen. Ich kann nicht nichts tun. Viel zwar auch nicht, aber immerhin ein bisschen. Levi wollte nie etwas anderes als ein Deutschlehrer sein. Und wenn er schon nicht unterrichten kann, will ich dafür sorgen, dass die Kinder auf andere Weise Zugang zum Stoff erhalten. Sie können mich nicht davon abhalten. Sie müssen mich auch nicht zur Tür geleiten. Schonen Sie Ihr Bein.«
Der Schweißfilm auf Spiers Stirn verriet, wie viel es ihn gekostet hatte aufzustehen.
»Wenn ich etwas von Levi höre …«, setzte er an.
»Ich werde alles tun, um ihn freizubekommen, ehe er in einem dieser Lager landet.« Ihr entging der Zweifel in seinem Blick nicht, und entschlossen fügte sie hinzu: »Es ist schließlich nicht so, dass ich keine Beziehungen habe!«
Nach einem knappen Abschiedsgruß verließ sie das Bureau. Die Gänge waren leerer, Rahel war verschwunden. Felicitas umklammerte das Büchlein. Sie ging zumindest nicht mit leeren Händen.
Dezember
Es schneite unaufhörlich. Der Schnee rieselte von den dürren Ästen der Ulme, die gleich vor der Alsterschule stand, blieb auf dem Dach der Turnhalle und auf dem Schulhof liegen, verfing sich in den Haaren der Schüler, die dort ihre Kreise zogen, halb nackten Schülern – nur ihre Unterwäsche hatten sie anbehalten dürfen.
Emil hatte das Fenster geöffnet, um in der frischen Luft ein paar Turnübungen durchzuführen. Nun konnte er seinen Blick nicht von dieser Klasse lösen und erst recht nicht von Walther Domnitz, seinem jungen Kollegen, der den heutigen Turnunterricht ins Freie verlegt hatte. Wie er es nur schaffte, seinen Schülern diese Disziplin abzuringen! Früher waren sie schon nach wenigen Laufrunden im Turnsaal außer Atem geraten, nun marschierten sie durch den Schnee. Aber vierzehn-, fünfzehnjährige Burschen, die vertrugen schon was. Immer schneller mussten sie laufen, dann rennen, eine Runde folgte der nächsten, und sie wurden nicht mit aufmunternden Worten angespornt, sondern mit Warnungen.
»Der Letzte wird ein Bad in der Alster nehmen!« Graue Wolken stiegen vor den geröteten Gesichtern hoch. »Kein Schwächeln!«, brüllte Kollege Domnitz. »So ist die Natur. Jedes erwachsene Leben ringt um sein Bestehen, und niemand hilft ihm dabei. Das ganze Leben ist ein Kampf.«
Emil erlebte nicht zum ersten Mal, wie Kollege Domnitz, der auch Biologie unterrichtete, die Turnstunde nutzte, um Inhalte seines anderen Faches zu veranschaulichen. Kuh und Ziege tragen ihre Hörner nicht zum Vergnügen. Werden sie belästigt und beim Fressen gestört, setzen sie sich zur Wehr. Die Pflanzen müssen Erde zum Wachsen haben, ebenso Licht, und sie rauben es sich gegenseitig. Damit das Dasein eines Volkes möglich wird, braucht es ebenfalls Erde und Licht, und es muss jene zurückdrängen, die es knapphalten wollen. Das gelingt wiederum nur, wenn die Gemeinschaft zusammenhält. Die Familie der Wiesenblumen rückt auch zusammen, um das Austrocknen des Bodens zu verhindern.
Was Emil dort unten auf dem Schulhof sah, war allerdings keine Familie, keine Gemeinschaft. Bemerkte Domnitz nicht, wie sich die entkräfteten, durchgefrorenen Schüler gegenseitig ein Bein stellten? Keiner wollte der Letzte sein.
Es entging dem jungen Kollegen jedenfalls nicht, dass einer der Schüler stolperte und hinfiel. So dick die Schneeflocken auch fielen, auf dem Boden war nur Matsch, und der Junge schrammte sich am nassen Asphalt die Knie blutig. Das Blut war von so kräftigem Rot, die übrige Welt schien in bläulich-gräulichen Schlieren zu zerlaufen.
Domnitz trat zu seinem Schüler, ließ seine Faust auf dessen Nacken sausen.
Er drosch nicht zum ersten Mal zu, einmal hatte Emil erlebt, wie er einem Schüler fast die Nase gebrochen hätte, und ihn daraufhin zur Rede gestellt. Natürlich, er sei sich im Klaren darüber, dass der Turnunterricht einem übergeordneten Zweck diene, dass die Methodik darauf abziele, die Jugend zum Wagnis zu erziehen, dass man kleine Unfälle, Blessuren und Schmerzen zu akzeptieren habe. Aber es gälten doch gewisse Regeln. Auf einen wehrlosen Jungen schlage man nicht ein. Domnitz hatte seinem Blick getrotzt und erwidert: »Nimmt der Feind etwa Rücksicht auf den wehrlosen Soldaten, der vor ihm auf dem Boden liegt?«
Emil hatte nichts dagegen zu sagen gewusst. Der geschundene Schüler hatte gleichfalls nichts zu sagen, brauchte alle Kraft, um sich aufzurappeln, hinkend weiterzulaufen, während Domnitz ihm und den anderen nachbrüllte: »Durch die moderne Medizin konnten sich leider auch Minderwertige und Kranke fortpflanzen. Umso wichtiger sind die Prinzipien des Auslesens und Ausmerzens. Wer nicht mitkommt, hat es nicht verdient, auf diesem Boden zu stehen, auf deutschem Boden. Wer nicht Sinnbild deutscher Kraft ist wie die Eiche oder die Edelkastanie, hat das Schicksal von Maulbeere und Weinstock zu teilen – beides Fremdlinge, die samt ihren kläglichen Wurzeln ausgerissen werden müssen.«
Emil gab sich einen Ruck und zwang sich wegzusehen. Domnitz war der Turnlehrer, er wusste schon, was zu tun war. Er selbst wiederum war Schulleiter, er wusste auch, was zu tun war. Er setzte sich wieder an den Schreibtisch, betrachtete die Liste, die er erst am Morgen mit seiner Sekretärin zusammengestellt hatte, glich sie mit der vom vergangenen Jahr ab. Die Liste erfasste alle nichtarischen Schüler, und die diesjährige war zwar deutlich übersichtlicher, aber immer noch nicht leer. Bis jetzt hatten die Kinder von jüdischen Frontkämpfern im großen Krieg noch die Alsterschule besuchen dürfen, doch nun war die Anweisung erfolgt, sämtliche verbliebenen jüdischen Schüler mit sofortiger Wirkung vom Unterricht an den deutschen Schulen auszuschließen.
Er war gerade dabei, die Liste ein letztes Mal zu überprüfen – er durfte keinen einzigen Namen übersehen –, als es klopfte. Entgegen seiner Erwartung stürmte nicht die Sekretärin herein, sondern seine Frau Anneliese.
Jedes Mal, wenn sie sich an seinem Arbeitsplatz begegneten, musste er sich wieder mühsam in Erinnerung rufen, dass sie seit einiger Zeit an der Alsterschule als Hauswirtschaftslehrerin arbeitete. Da sich die Mädchenklassen – ebenso wie das Lehrerinnenzimmer – in einem gesonderten Trakt befanden, liefen sie sich nicht oft über den Weg, und Anneliese hatte von Anfang an erklärt, dass sie keine Begünstigungen erwarte und von ihm wie ihre Kolleginnen behandelt werden wolle.
Ihre Kolleginnen würden es allerdings nicht wagen, mit gehetztem Blick auf ihn zuzustürzen und ihn am Oberarm zu packen.
»Wir müssen sofort nach Hause gehen!«
»Was ist denn los?«
»Bitte …«, ihr Blick war nun ebenso panisch wie flehentlich, »wir müssen sofort nach Hause gehen.«
»Ist etwas passiert? Mit Elly?«
Sie senkte den Blick. »Es hat tatsächlich mit Elly zu tun, aber … aber ich kann das nicht hier erklären.«
Als sie versuchte, ihn hochzuzerren, versteifte er sich kurz, befremdet von einer Nähe, die sie seit langer Zeit nicht mehr eingefordert hatte. Dann spürte er, wie dringlich ihr Anliegen war, löste sich energisch aus ihrem Griff, langte dennoch hastig nach Mantel und Hut und beschied die Sekretärin, die Briefe an die Eltern der jüdischen Schüler, die auf der Liste standen, zu verschicken.
Als sie ins Freie traten, hatte das Schneetreiben etwas nachgelassen. Die Flocken waren kleiner, schienen auf der Haut nicht zu schmelzen, sondern zu platzen. Auf halbem Weg nach Hause hörte es ganz auf zu schneien, doch für Anneliese war das kein Grund, den Kopf zu heben. Sie hatte ein Tuch über die dunklen Zöpfe gezogen, umklammerte es mit vor Kälte roten Fingern, hielt den Blick beharrlich auf den Bürgersteig gerichtet. Erst war sie zügig vorangegangen, nun überließ sie ihm die Führung. Nicht nur er drehte sich mehrmals um – auch sie blickte immerzu hinter sich, als hätte sie Angst, dass jemand sie verfolgen könnte.
Emil war das Gefühl, dass jeder seiner Schritte überwacht wurde, nicht fremd – nicht seit jener unruhigen Novembernacht, als die SA plündernd und zerstörend durch die Straßen gezogen war. Kurz nach Mitternacht hatte damals plötzlich Schulsenator Dr. Grotjahn vor seiner Wohnungstür gestanden, sein Förderer, mehr noch, sein väterlicher Freund. In diesem Augenblick war er allerdings eher der strenge Lehrer von früher gewesen, der ihn am Gymnasium in Deutsch unterrichtet hatte und der keinen Fehler hatte durchgehen lassen. Mit schneidender Stimme hatte er ihn dafür zur Rede gestellt, gemeinsam mit Felicitas Marquardt ein polnisches Judenkind an seiner Schule versteckt zu haben, hatte mit einer Untersuchungskommission gedroht, schlimmer noch, mit seiner Entlassung.
Bis eben hatte Emil vermutet, dass Anneliese nichts davon mitbekommen hatte, doch als ihm nun aufging, dass sie ihm seit Wochen nicht mehr richtig in die Augen sah, war er plötzlich sicher, dass sie das Gespräch belauscht, auch seine Lügen vernommen hatte: Nein, nein, er habe keine Ahnung von der Abstammung dieses Kindes gehabt und Felicitas Marquardt ebenso wenig.
Grotjahn hatte diese Worte nicht angezweifelt, jedoch auch nicht bekundet, dass er ihm glaubte. Und erst recht hatte er nicht versprochen, die Sache aus der Welt zu schaffen, Emil vielmehr mit dem Gefühl zurückgelassen, dass von nun an ein Damoklesschwert über ihm schwebte.
Als sie eben die Bieberstraße erreichten, fühlte er einmal mehr dessen kalten Hauch.
»Sag mir endlich, was los ist!«
Anneliese drängte sich schweigend an ihm vorbei, nahm die Stufen in den zweiten Stock im Laufschritt. Auch nachdem sie die Wohnung betreten hatten, wollte sie ihr Tuch nicht loslassen.
»Sie kommen jetzt schon nach Hause?«
Frau Anke betrachtete sie verwirrt, doch auch ihr gegenüber brachte Anneliese kein Wort hervor. Emil beschied die Haushälterin knapp, dass sie gehen könne, und ignorierte die Fragen in ihrem Blick. Frau Anke wunderte sich ja über so vieles – vor allem darüber, dass Anneliese der kleinen Elly fast alles durchgehen ließ, sogar mit ihrer Puppe unter dem Esszimmertisch zu spielen, weswegen man dann dort nicht kehren konnte.
Anneliese stürzte zum Esszimmertisch, nachdem Frau Anke gegangen war, und als Elly von dort hervorgekrochen kam, ließ sie endlich das Tuch los, um das Kind zu umarmen.
Das Tuch flatterte auf den Boden. Anneliese sank auf die Knie und zog das Mädchen an sich, als hätte sie es monatelang nicht gesehen.
»Kannst du mir jetzt endlich erklären …«, begann Emil.
Eine Weile hielt Anneliese Elly an sich gedrückt, forderte sie dann jedoch auf, in ihr Zimmer zu gehen und etwas zu häkeln.
»Und später holen wir gemeinsam den Weihnachtsschmuck aus dem Keller, ja?«
Elly fügte sich, in Emil erwachte Ungeduld. »Was soll das alles?«, fuhr er sie an.
Anneliese atmete schwer. Ihre Hände verkrampften sich ineinander, die Fingerknöchel färbten sich nunmehr weiß.
»Ich … ich musste Elly erst sehen, bevor ich es dir sagen kann.«
»Was sagen?«
»Felicitas glaubt mittlerweile zu wissen, wo Levi steckt. Offenbar wurde er ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht. Viele Lehrer der Talmud-Tora-Schule kamen dorthin, aber man hat sie wieder entlassen. Nur ihn nicht, und …«
»Was haben denn Levi und Felicitas mit Elly zu tun? Wenn wieder einmal das Gerücht aufkommt, die beiden wären ein Paar, musst du das bestreiten, es als gemeine Verleumdung abtun und …«
Er biss sich auf die Lippen, bereute es augenblicklich, so viel Eifer in die Stimme gelegt und solcherart verraten zu haben, dass es ihm nie nur darum ging, den eigenen Ruf zu schützen, auch den Felicitas’.
Aber Anneliese hatte gar nicht richtig zugehört, begann nun unruhig, Kreise im Wohnzimmer zu ziehen. »Felicitas hat mich vorhin um Hilfe angefleht. Es könnte sein, dass Levi von Fuhlsbüttel in ein Konzentrationslager verlegt wird. Die Zeit drängt, ihn freizubekommen. Sie selbst kann natürlich nichts erreichen, du kannst es vielleicht schon. Du könntest dich bei Grotjahn für ihn starkmachen, als Schulsenator hat er durchaus Beziehungen, und diese Beziehungen könnte er nutzen, um …«
Sie brach ab, rang hilflos die Hände.
Emil begriff, weshalb die Sache so dringlich war, nicht dass sie ausschließlich in der eigenen Wohnung darüber reden konnte.
»Wenn du willst, suche ich Grotjahn sofort auf.«
Er hatte Hut und Mantel noch nicht abgelegt, wandte sich zum Gehen. Doch Anneliese stellte sich ihm in den Weg, und ihre Hände krallten sich jäh an seinen Mantelkragen. Als wollte sie sich daran festhalten. Nein, als wollte sie ihn festhalten.
»Ich will es aber nicht.«
»Anneliese …«
»Weißt du, warum ich es dir nur hier sagen konnte? Warum ich erst Elly sehen musste? Ich wäre mir sonst so schäbig vorgekommen, weil ich … weil ich …«
»Weil du was?«
»Weil ich dich anflehen werde, nichts zu tun. Rein gar nichts. Weil ich dich bitten werde, Levi seinem Schicksal zu überlassen.«
Mit jedem Wort wurde ihre Stimme leiser. Nur ihr Blick schrie ihn an. Er las Schuldgefühle darin, auch Angst.
»Carin …«, brach es plötzlich aus ihr hervor, »Carin Grotjahn hat mir erzählt, dass du und Felicitas, dass ihr eurer Entlassung nur knapp entgangen seid. Wenn ihr Mann dich nicht beschützt hätte, hättest du womöglich nicht nur deine Stelle verloren, vielleicht hätte man uns auch die Vormundschaft für Elly entzogen.«
»Und das hast du Felicitas so gesagt?«, fragte er wie betäubt.
»Natürlich nicht. Ihr habe ich beteuert, dass wir alles tun werden, damit Levi freikommt.«
»Du hast also deine Freundin belogen.«
Der Griff um den Kragen wurde fester. »Ich habe sie nicht nur belogen, ich … ich habe sie verraten.«
»An wen verraten?«
So wie sie ihn unerbittlich hielt, packte er nun auch sie an der Schulter, schüttelte sie. Selten waren sie sich so nah gekommen, selten hatte er den warmen, stoßweisen Atem so intensiv gespürt. Sie war die Erste, die aufgab. Die Hände lösten sich von seinem Kragen, blieben schlaff hängen, und plötzlich lag ihr Gesicht auf seiner Brust. Sein Griff lockerte sich, als sie ihm unter Schluchzen gestand, was sie getan hatte, damals, in jener Nacht im November, als alles auf dem Spiel gestanden hatte. Er ahnte, dass er sie trösten sollte, über ihren Rücken streicheln, ihr vergewissern, dass es nicht so schlimm war. Er konnte es nicht – sie wegschieben allerdings ebenso wenig.
Ihre Tränen versiegten erst, als sich die Tür öffnete und Elly zurück ins Wohnzimmer kam.
»Guck mal, wie weit ich gekommen bin.« Sie hielt eine Häkelnadel in der einen Hand und ein kleines Deckchen in der anderen. Es war nicht sehr groß, aber sauber gearbeitet.
Anneliese verharrte kurz mit dem Gesicht an Emils Brust, ehe sie sich von ihm löste, verstohlen über ihre Wangen wischte. Ihre Augen waren gerötet; als sie zu Elly trat und das gehäkelte Deckchen bestaunte, kämpfte sie trotzdem um ein Lächeln.
»Das ist ja wunderschön geworden.« Sie wandte sich an Emil. »Findest du das nicht auch?« Reglos stand er da, trug immer noch Hut und Jacke. Er hatte keine Ahnung, ob dieses gehäkelte Ding schön war. Er hatte keine Ahnung, ob er Levi seinem Schicksal überlassen konnte … Felicitas … »Findest du nicht auch, dass es schön geworden ist?«, fragte Anneliese wieder, ihre Stimme klang schrill.
Er brachte weiterhin kein Wort hervor, nickte nicht einmal. Aber er nahm den Hut vom Kopf und zog seinen Mantel aus.
Felicitas ging unruhig in ihrer Wohnung auf und ab. Der Glockenschlag der angrenzenden Kirche St. Johannis war immer laut, doch diesmal dröhnte er noch in ihr nach, als er längst verstummt war. Die letzten Tage hatte sie sich am liebsten im Bett verkrochen, sich die Decke über den Kopf gezogen und den Erinnerungen an die Stunden hingegeben, die sie mit Levi gemeinsam in ihrer Wohnung verbracht hatte, an diesem Abend war die Unrast zu groß.
Ob Anneliese schon mit Emil geredet hatte, Emil mit Grotjahn, Grotjahn mit …? Ach, sie hatte keine Ahnung, mit wem dieser reden konnte. Hauptsache, er bekam Levi frei, Hauptsache, er konnte verhindern, dass Levi in ein Konzentrationslager verlegt wurde, Hauptsache, Levi würde bald vor ihrer Tür stehen und …
Es klopfte tatsächlich, sie stürzte zur Tür. Mit Levi rechnete sie nicht, so weit verstieg sich ihre Hoffnung nicht, aber mit Emil. Emil würde Neuigkeiten bringen, gute Neuigkeiten!
Vor ihr stand nicht Emil, sondern eine fremde Frau. Der Kragen ihres zerknitterten Wintermantels war hochgeschlagen, bedeckte fast den Mund, die Pelzmütze war tief ins Gesicht geschoben, bedeckte fast die Augen. Sobald Felicitas geöffnet hatte, drehte sie sich um und vergewisserte sich, dass niemand ihr gefolgt war. Erst danach wagte sie gehetzt zu fragen: »Sind Sie Fräulein Dr. Felicitas Marquardt?«
Kragen und Mütze verrutschten etwas. Felicitas hätte schwören können, dieser Frau noch nie begegnet zu sein, aber ihre Züge kamen ihr plötzlich dennoch vage bekannt vor. Schon drängte sie sich an ihr vorbei in die Wohnung und schloss an ihrer statt die Tür hinter sich.
»Ich bin tatsächlich Felicitas Marquardt, aber …«
»Ich will Sie nicht in Schwierigkeiten bringen, wirklich nicht, ich muss nur unbedingt mit Ihnen sprechen«, nuschelte die Fremde in den Mantelkragen.
So entschlossen sie eben noch über die Schwelle getreten war – als Felicitas sie mit einer Handbewegung aufforderte, ins Wohnzimmer zu kommen, verharrte sie zögerlich im Flur.
Felicitas ging indes die Bedeutung ihrer Worte auf.
Schwierigkeiten! Natürlich!
»Sind Sie Jüdin?«, rief sie. »Kennen Sie Levi Cohn? Wissen Sie etwas über ihn? Hat er Ihnen eine Botschaft zukommen lassen können?«
Die andere schien mit dem Namen tatsächlich etwas anfangen zu können. Doch umso bitterer schmeckte die Enttäuschung, als sie erklärte: »Levi Cohn wollte ich noch vor Ihnen um Hilfe bitten. An der Talmud-Tora-Schule sagte man mir allerdings … sagte man mir allerdings …«
Sie kaute auf ihrer Unterlippe.
Man kann es nicht sagen, ging es Felicitas durch den Kopf. Es nicht aussprechen … es nicht in Wort fassen … dieses Unrecht, diese Schande, diese …
Sie verdrängte den Gedanken. »Wofür brauchen Sie Levis Hilfe?«
»Er hat sich damals doch um meine Schwester gekümmert, nicht wahr? Und Sie haben das auch getan.«
»Ihre Schwester?«
»Mein Name ist Henriette Goldenthal.«
Felicitas hatte diesen Namen nie gehört, aber die rotblonden Locken, die unter der Mütze hervorlugten, sagten ihr, an wen die Frau sie erinnerte. An Elly. Emils und Annelieses kleine Ziehtochter.
»Sie sind die Schwester von Elise Freese?«
Henriette nickte, nahm die Mütze ab, knetete sie in ihren Händen.
»Wie geht es Elise?«, rief Felicitas. »Sie wohnt doch noch bei Ihnen, oder? Sie haben sie bei sich aufgenommen … damals.«
Ein so kurzes Wort. Aber aufgeladen mit so vielen Erinnerungen. Daran, dass ihr einstiger Schulleiter Oscar Freese in Fuhlsbüttel inhaftiert worden und dort unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen war. Dass seine Frau Elise darüber in eine schwere Depression verfallen und unfähig gewesen war, sich um die kleine Tochter zu kümmern. Dass sie das völlig verwahrloste Kind in ihrer Not Anneliese anvertraut hatte.
Henriette blickte sie zögerlich an.
»Ich bin nicht wegen meiner Schwester hier, sondern wegen … Elly.«
»Elly geht es gut. Sie wissen doch, dass das Ehepaar Tiedemann die Vormundschaft für sie übernommen hat. Sie ist sehr glücklich in der Familie, auch … sicher.«
Henriette ließ ihre Mütze zu Boden fallen und legte ihre Hände auf Felicitas’ Schultern. Der Griff war fest, fast schmerzhaft.
»Niemand ist sicher, nicht jetzt … nicht … nach dieser Novembernacht.«
Henriette holte tief Luft, sagte noch mehr, sagte es immer schneller. Felicitas kam kaum nach mit dem Begreifen. Doch noch ehe sie das Gesagte verarbeitet hatte, breitete sich Entsetzen in ihr aus.
»Aber … aber das ist unmöglich!«, platzte es aus ihr heraus. »Das kann ich nicht tun. Niemals!«
Kurz rechnete sie damit, dass sich Henriettes Finger noch schmerzhafter in ihre Schultern bohren würden. Stattdessen ließ sie sie abrupt los. Als sie auf die Knie sank, dachte Felicitas, ihre Kräfte wären geschwunden, doch sie war nicht gefallen, sie bückte sich nur nach der Mütze, konnte sich danach wieder erheben, mit fester Stimme sagen: »Bitte! Denken Sie wenigstens darüber nach.«
Sie richtete einen beschwörenden Blick auf sie, ehe ihre Lider zu zucken begannen und sie sich rasch abwandte, um die Wohnung zu verlassen. Ihre Schritte wurden von neuerlichen Glockenschlägen übertönt. Wieder dröhnten sie in Felicitas nach. Auch Henriette Goldenthals Worte dröhnten in ihr nach, die eigene abschlägige Antwort.
Am Ende verkroch sie sich doch noch im Bett, zog die Decke über den Kopf, konnte die Welt dennoch nicht aussperren, nicht Henriettes Bitte, nicht die bange Frage, ob Anneliese schon mit Emil gesprochen hatte, Emil mit Grotjahn, Grotjahn mit …
Sie schlug die Decke zurück, schnappte nach Luft, griff wahllos nach einem Buch. Einmal mehr verschwammen die Buchstaben hinter einem Tränenschleier, aber sie wusste ja, was dort stand, Levi hatte es ihr oft vorgelesen, und sie glaubte seine Stimme zu hören.
»Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!«
Sie war nicht sicher, ob Schillers Worte ein Trost waren oder ein Hohn.
1939
Februar
Levi trug den Bleistiftstummel immer noch bei sich. Damit niemand ihn fand, steckte er ihn sich oft zwischen die Zehen. Es fühlte sich an wie ein zusätzliches Körperglied, manchmal sogar wie das, in dem das meiste Blut zirkulierte. Allerdings gab es da noch etwas anderes, das nicht aufhörte, in ihm zu pochen. Das ihn dazu zwang, den Stummel immer wieder hervorzuziehen und wenn auch nicht auf Papier – das besaß er nicht –, so doch auf den staubigen Boden Worte zu schreiben. Die Buchstaben glichen den zerbrechlichen Körpergliedern alter Menschen, zitterten beim ersten Lufthauch, wurden beim zweiten davongeweht wie Asche. Aber er hörte nicht damit auf.
»Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!«
Er schrieb die Worte nicht einfach nur auf. Er setzte sie den schwarzen Zahlen, die auf den Rücken seiner Häftlingsuniform genäht worden waren, entgegen. Die Zahlen behaupteten, dass er keinen Namen mehr trug, nur eine Nummer war. Und obwohl er sich meldete, wenn diese Nummer gerufen wurde, und nicht mehr darauf bestand, ein Deutschlehrer zu sein – er wusste noch, dass er einer war und wie er wirklich hieß. Er hatte sich ja auch Schillers Worte gemerkt, hatte sie noch im Kopf, als eines Tages seine Nummer aufgerufen wurde, er aufgefordert wurde mitzukommen.
Eine Frage hatte er ebenfalls im Kopf, und er war so leichtsinnig, sie laut zu stellen: »Wohin bringen Sie mich?«
Die Antwort war ein Schlag auf den Mund. Er schmeckte Blut, er schmeckte Angst. Die Angst wuchs, als er in einen Wagen gestoßen wurde, wo er dicht gedrängt mit anderen Häftlingen zu sitzen kam. Die Luke war zu weit entfernt, um zu sehen, wohin die Fahrt ging, zumal es bald finster wurde.
In dieser ewigen Nacht sieht man nicht einmal mehr Staub, nicht einmal mehr Asche, dachte er kurz. Aber dann fühlte er den Bleistiftstummel zwischen den Zehen und mit ihm die Hoffnung, dass keine Nacht ewig währte. Manchmal musste man sich in die Finsternis fallen lassen, irgendwann sank man doch auf festen Grund.
Die Fahrt war nach einigen Minuten zu Ende. Oder nach Stunden. Oder nach Tagen. Draußen war es immer noch dunkel, aber die schwarze Nacht wurde vom grellen Licht einiger Scheinwerfer zerrissen. Sie blendeten ihn, sodass er die SS-Männer, die sie empfingen, kaum sehen konnte. Er konnte sie nur hören, ihre Fußtritte spüren, die Kolbenstöße.
Levi hob ein einziges Mal kurz den Kopf, sah Stacheldrahtzaun, ein großes Tor. Stapfte er auf Sand oder auf Schnee? Sie wurden auf den Lagerplatz getrieben, wieder von Scheinwerfern geblendet, in seine Ohren schnitt sich eine Stimme.
»Ihr seid hier als Sühne für die feige Mordtat eures polnischen Rassengenossen Grynszpan«, brüllte ein Mann, offenbar der Lagerkommandant. »Ihr seid hier als Geiseln, damit das Weltjudentum nicht weitere Morde plant. Denkt nicht, ihr seid in einem Sanatorium gelandet, eher ist es ein Krematorium. Jedem Befehl der SS ist augenblicklich Folge zu leisten, bei einem Fluchtversuch wird sofort geschossen. Eure Verpflegung müsst ihr abarbeiten. Wir werden schon dafür sorgen, dass eure dicken Bäuche verschwinden.«
Als das Brüllen endlich ein Ende gefunden hatte, war Levis Blick immer noch starr auf den Boden gerichtet, der so schwarz war, als wäre der Nachhimmel auf die Welt gefallen, hätte sie unter sich vergraben.
Irgendwann wurden sie in eine Baracke geführt, wo sie sich vollkommen ausziehen mussten. Er kniff die Zehen zusammen, um den Bleistiftstummel nicht zu verlieren. Im nächsten Raum wurden ihnen die Köpfe geschoren. Im dritten händigte man ihnen primitive Unterwäsche und blau-weiß gestreifte Häftlingsuniformen aus.
Erst als er wenig später mit den Mithäftlingen in einen anderen Block getrieben wurde, wagte Levi es, wieder eine Frage zu stellen. »Wo sind wir hier?«
Etwas verspätet murmelte ein Häftling eine Antwort. »Man muss der Hölle keinen Namen geben, um wissen, dass man in ihr gelandet ist.«
Die Luft wurde stickiger, es wurden nicht nur immer mehr Männer gebracht, auch Essen. Nein, es war kein Essen, es war lediglich ein Blechnapf mit Spülwasser, in dem Schalen von Gemüse schwammen. Auf das Essen folgte der Befehl zu schlafen. Betten gab es nicht, sie lagen zusammengepfercht auf dem hölzernen Fußboden. Als er einnickte, fühlte er den warmen Atem seines Hintermannes im Nacken, als er mitten in der Nacht aufwachte, war aus dem Atem ein Röcheln geworden. Mit jeder Minute klang es gequälter, trockener, bald wurde ein verzweifeltes Japsen daraus.
Levi musste sich anstrengen, um sich aufzurichten, erhielt prompt einen unwilligen Stoß von seinem Vordermann, drehte sich dennoch weit genug um, um dem Hintermann ins Gesicht zu sehen. Mondlicht fiel durch Ritzen, ließ den kalten Schweiß auf dessen fahler Haut silbrig schimmern. Die Lippen waren bläulich, die Augen riesengroße Löcher, in denen Todesangst und Verzweiflung längst ertrunken waren. Immer gleichgültiger wurde der Blick – nur Levi war es nicht.
»Er … er stirbt!«, rief er. »Wir müssen ihm helfen! Er braucht einen Arzt.«
Jener, der ihm zuvor den Stoß versetzt hatte, richtete sich nun auch auf, warf einen kurzen Blick über seine Schultern. »Der Lagerarzt hat gesagt, dass er für Juden nur Totenscheine ausstellt.« Schon rollte er sich zusammen, machte sich ganz klein, legte die Hände über den Kopf, schlief weiter.
Levi konnte nicht schlafen, Levi konnte dem Kranken auch die Hand nicht entziehen, als der sie nach seiner ausstreckte, er konnte nicht aufhören, ihm in die Augen zu sehen. Das Schwarz der Pupille schien sich nach und nach über die Iris auszubreiten, dann über das Weiße. Ob der andere ihn sehen konnte, wusste er nicht. Aber er sah den anderen – nicht als röchelndes, japsendes, keuchendes Etwas, sondern als Mensch.
»›Nichts ist quälender als die Kränkung menschlicher Würde‹«, flüsterte er gegen das Röcheln und Japsen und Keuchen an, »›nichts erniedrigender als die Knechtschaft. Die menschliche Würde und Freiheit sind uns natürlich. Also wahren wir sie, oder sterben wir mit Würde.‹«
Wer genau diese Worte aufgeschrieben hatte, fiel ihm nicht ein. Der Name verlor sich im Schwarz der erlöschenden Augen, im Schwarz der sterbenden Nacht. Erst als sie zum Morgengrau gerann, wusste er es wieder. Es war ein Zitat von Marcus Tullius Cicero.
Der Atem des anderen verstummte endgültig, die Augen waren weit aufgerissen. Sie waren gar nicht schwarz, sondern grau wie Nebel. Levi versuchte, sie zuzudrücken, es gelang ihm nicht.
»Komm mit zum Morgenappell!«, schrie ihn jemand an.
Er ließ den Toten liegen, warf einen letzten Blick auf die Häftlingsnummer. Wenigstens die wollte er sich merken, wenn er auch nie den Namen des Mannes erfahren würde.
Im Laufe des Tages schrumpften die Zahlen. Er konnte sie zwar noch wiederholen, aber er war nicht sicher, ob eine Acht mehr wert war als eine Eins, eine Fünf mehr wert war als eine Drei.
Sie alle waren ja nichts wert, nicht die Toten, nicht die Lebenden.
Ein paar der Häftlinge trieb man nach dem Morgenappell auf Wagen. Sie waren angeblich zur Arbeit im Klinkerwerk bestimmt worden, was immer das war.
»Wir Glückspilze«, hörte Levi irgendjemanden murmeln, »wir müssen keine Baumstämme schleppen.«
Sie mussten etwas anderes schleppen … Schnee … mussten ihn mit bloßen Händen zusammenschieben, ihn auf Tragen laden.
Der Schnee war leichter als Bäume, der Schnee war aber auch kälter. Levi spürte die Hände bald nicht mehr, nicht seine Füße, er spürte auch den Bleistiftstummel nicht, er spürte nichts von seinem Körper. Nur das klägliche Weinen eines anderen spürte er, es ging ihm durch und durch.
»Ich bin doch Violinist … Wenn meine Hände erfrieren … wenn man mir die Finger abschneidet … dann kann ich nie wieder ein Instrument halten.«
Levi wollte etwas Tröstliches sagen, konnte es nicht. Mit Worten verhielt es sich wie mit Zahlen. Sie glichen Schneeflocken, die im Wind trieben. Wenn er versuchte, eine zu schnappen, schmolz sie.
»Der Mensch mag tun und leiden, was es auch sei, er besitzt immer und unveräußerlich die göttliche Würde.«
Es war ein Zitat von Christian Morgenstern. Die Buchstaben schmolzen nicht, sie tanzten an ihm vorbei, stiegen hoch in den Himmel. Der Himmel war so fern, er selbst fiel in ein schwarzes Loch.
Am dritten Tag – oder war es der dreizehnte, der dreißigste, der dreihundertste? – war kein Schnee gefallen, den sie zusammenschieben mussten.
Nach dem Morgenappell wurde eine Gruppe Häftlinge über den Hof getrieben. Levi gewahrte erst, dass er zu ihnen gehörte, als jemand in sein Ohr bellte: »Nun lauf schon!«
In einer Baracke erwarteten sie nicht nur SS-Männer, auch ein Mann mit einem Fotoapparat.
»Alle Welt soll sehen, wie ihr Untermenschen ausseht.« Levi blickte die anderen an, die man hergeholt hatte. Ihre Köpfe waren sämtlich kahlgeschoren, die zu große, zerknitterte Kleidung schlackerte an dürren Leibern, in den Blicken standen Angst, Panik. »Keine Menschen seid ihr, sondern Läuse, und Läuse zerdrückt man.«
Niemand wurde zerdrückt, jedoch ein Mann vor den Fotoapparat gestoßen. Es setzte Schläge, damit sein Gesichtsausdruck noch gequälter wurde … er noch erbärmlicher wirkte … hässlicher …
Ein flüchtiger Gedanke streifte Levi, ein Satz, den Dostojewski geschrieben hatte – über die Freiheit des Menschen, über den Unterschied zwischen Mensch und Laus. Die Worte verhakten sich in seinem Kopf, und als es ihm gelang, sie zu entwirren, waren es keine ganzen Worte mehr, nur noch halbe.
Was hier geschah, war nicht recht.
Er konnte das nicht laut sagen. Aber er konnte etwas tun. Als er vor den Fotoapparat gestoßen wurde, als auch er Schläge erhielt, verzog er nicht sein ganzes Gesicht, nur seinen Mund. Sein Mund lächelte. Solange Untermenschen lächelten, auch an einem Ort wie diesem, waren sie vielleicht Übermenschen.
»Was gibt es da zu lachen?«, brüllte jemand.
Seine Mundwinkel zuckten, selbst wenn er es nicht gewollt hätte, sie ließen sich nicht hinunterziehen, sie strebten hoch. Alles in ihm strebte hoch, selbst als wieder Schläge auf ihn einprasselten, weil er nunmehr regelrecht lachte, als er auf den Boden gezerrt wurde, man auf ihn eintrat.
»Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.«
Immanuel Kant.
Die Worte flohen aus seinem Kopf, blieben eine Weile im Raum hängen, verflüchtigten sich dann. Hatten sie den Weg durch die Ritzen der Holzwände ins Freie genommen, oder waren sie auf den Boden gerieselt wie Regen?
Sein Lächeln wirbelte zur Decke, verlor sich in unerreichbarer Höhe. Er hörte das Klicken des Fotoapparats, hörte das Gelächter der SS-Leute, die ihn dort hatten, wo sie ihn haben wollten. Es stimmte nicht, dass Untermenschen nicht lachen konnten. Es stimmte nicht, dass sich die Mühseligkeiten des Lebens irgendwie tragen ließen.
Jemand zerrte ihn auf die Füße.
»Wer bist du?«
Ein Deutschlehrer … Levi Cohn … 7842.
Nichts davon überstand den Weg vom Kopf in den Mund, vom Herzen in den Mund.
Er erbrach Blut, aber keine vernünftigen Silben.