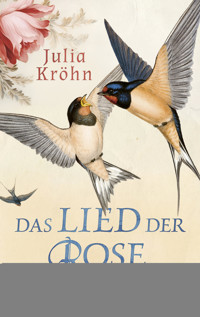4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Schicksal war es, Königin zu werden
Northumbria im Jahr 647: Als Wikinger in ihr Land einfallen und sie entführen, ändert sich das Schicksal der Fürstentochter Bathildis drastisch. Die junge Frau wird an den französischen Hof verkauft und muss dort als Sklavin hart arbeiten. Doch schließlich gelingt es ihr, die Aufmerksamkeit des Merowinger-Königs Chlodwig II. auf sich zu ziehen und ihn für sich zu gewinnen. Auch wenn sie nun von der Sklavin zur Königin aufgestiegen ist: Bathildis vergisst ihre Herkunft nicht und setzt sich leidenschaftlich für die Abschaffung der Sklaverei ein. Doch dann holt sie ihre Vergangenheit ein, denn ein mächtiger Feind sinnt auf Rache...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Zitat
Prolog
Erstes Buch Die Fürstentochter
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
Zweites Buch Die Sklavin
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
Drittes Buch Die Königin
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
XXIII. Kapitel
XXIV. Kapitel
XXV. Kapitel
XXVI. Kapitel
Viertes Buch Die Regentin
XXVII. Kapitel
XXVIII. Kapitel
XXIX. Kapitel
XXX. Kapitel
XXXI. Kapitel
XXXII. Kapitel
XXXIII. Kapitel
XXXIV. Kapitel
XXXV. Kapitel
Epilog
Zeittafel
Verzeichnis der handelnden Personen
Historische Anmerkung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ihr Schicksal war es, Königin zu werden
Northumbria im Jahr 647: Als Wikinger in ihr Land einfallen und sie entführen, ändert sich das Schicksal der Fürstentochter Bathildis drastisch. Die junge Frau wird an den französischen Hof verkauft und muss dort als Sklavin hart arbeiten. Doch schließlich gelingt es ihr, die Aufmerksamkeit des Merowinger-Königs Chlodwig II. auf sich zu ziehen und ihn für sich zu gewinnen. Auch wenn sie nun von der Sklavin zur Königin aufgestiegen ist: Bathildis vergisst ihre Herkunft nicht und setzt sich leidenschaftlich für die Abschaffung der Sklaverei ein. Doch dann holt sie ihre Vergangenheit ein, denn ein mächtiger Feind sinnt auf Rache ...
Julia Kröhn
Die Regentin
Historischer Roman
»Der Gütige ist frei, auch wenn er ein Sklave ist. Der Böse ist ein Sklave, auch wenn er ein König ist.«
AURELIUS AUGUSTINUS
Prolog
Chelles-sur-Marne, A. D. 664
Das Tor des Klosters war nur zur Hälfte geöffnet, einem Augenlid gleichend, welches sich zögernd über die Pupille hebt. Vorsichtig fielen auch die Bewegungen der grau verschleierten Nonnen aus, die sich hinter dem Eingang drängten. Wiewohl sie dem hohen Besuch mit unverhohlen neugierigen Blicken und aufgeregtem Flüstern entgegenstrebten, wagte keine von ihnen, zu den Gästen zu treten, die eben dem Wagen entstiegen waren.
Es waren zwei Frauen – die eine hochgewachsen, mit langen rotbraunen Zöpfen, das Gesicht unter dem feinen, seidigen Schleier bereits verblüht, aber noch nicht von einem Runzelnetz gefangen; die andere kaum größer als ein kleines Mädchen, obgleich auch sie der Jugend entwachsen. Ihr Blick aus dunklen großen Augen war der einer Greisin. Er schien zu viel gesehen zu haben, um je wieder berührt zu werden, weder von den abgründigen Tiefen noch den wilden Höhenflügen des Lebens.
Einige Schritte vom Tor entfernt verharrten die beiden Frauen, als wären sie sich – gleich den unruhigen Nonnen – nicht gewiss, welcher Abfolge sich ihr Tun zu unterwerfen hatte.
Ob dieses Zögerns fasste die Äbtissin Mut, löste sich aus dem Kreis ihrer Schwestern und ging auf die beiden Frauen zu. Den Blick hielt sie gesenkt – als Zeichen ihrer Ehrfurcht, und jene zeigte sie noch deutlicher, als sie vor der groß gewachsenen Frau eine tiefe Verbeugung vollführte.
»Es ist für uns alle eine Ehre, meine Königin, eine überaus große Ehre, dich hier zu empfangen, und ...«
Die groß gewachsene Frau schnitt ihre Worte mit einer Handbewegung ab, die heftig ausfiel, jedoch kontrolliert, und so fielen auch sämtliche andere Gesten aus, als sie nun die Äbtissin aufrichtete, noch näher an das Tor heranschritt, schließlich den Kopf hob, wie um die Luft zu erschnuppern.
Von den Wirtschaftsräumen neben dem Refektorium wehte der Geruch von frischem Wildfleisch, denn es war Sonntag heute, und selbst die Tafel eines strengen Klosters war reich gedeckt. Er vermischte sich mit den duftenden Kräutern des Gartens, aber auch mit dem süßlich-beißenden Gestank der Latrinen, der sich, gerade im drückenden Sommer, nie gänzlich verflüchtigte.
Die Lippen der Königin zitterten kaum merklich, wiewohl sie den Anflug des Ekels rasch schluckte. Gar manche Nonne hatte sie in ihrem Leben kennen gelernt, auch Äbtissinnen darunter, die ihre Demut bewiesen, indem sie selbst die Latrinen regelmäßig reinigten und leerten, wie sie sich auch für die Küchenarbeit nicht zu schade waren.
Die jüngere, kleinere Frau war ihr gefolgt, berührte sie sachte am Arm. »Bathildis«, sprach sie ihren Namen anstelle des Titels aus, den all die anderen gebrauchten. »Bathildis ... ist dein Entschluss tatsächlich unumstößlich?«
Bathildis’ Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das zugleich wehmütig und trotzig war, versonnen und stolz.
Mit gleichem Lächeln hatte sie den Entschluss gefällt, von dem Rigunth, ihre treueste Begleiterin, eben sprach, hatte sie in den letzten Tagen ihr Leben überdacht, das sie nun an diesen Ort hier geführt: ein Leben, das in einem fernen Land als Tochter eines Fürsten begonnen, das sie in den Abgrund der Sklaverei gestoßen und sie schließlich zur höchsten weltlichen Würde erhoben hatte.
»Ja«, sagte sie leise, fast flüsternd. »Ja, ich weiß, was ich tue ... Ebroin lässt mir keine andere Wahl.«
Die Äbtissin hielt ausreichend Abstand ein, ungehörig wäre es, den beiden Frauen zu offensichtlich zu lauschen. Freilich war ihr Gesicht angestrengt verzogen, auf dass ihr kein Wort entginge, und auch die Nonnen, immer noch um das Tor geschart, unterließen das Flüstern und hörten aufmerksam zu.
»Noch hast du die Macht umzukehren«, sprach die schwarzäugige Rigunth, »noch bist du die Regentin dieses Landes.«
Bathildis schüttelte den Kopf. Ihr wehmütiges Lächeln wich einem entschlossenen Ausdruck, als sie das Tor durchschritt.
»Nein«, erwiderte sie, »nein, jetzt nicht mehr.«
Erstes BuchDie Fürstentochter
A.D. 632 – 647
I. Kapitel
Die Geburt des Kindes war für die Wöchnerin schmerzhaft, für die Mägde ermüdend und für seine Großmutter Acha unendlich langweilig. Beinahe in gleichem Takt, in dem die Gebärende ächzte, verzog sich Achas Mund zu einem Gähnen. Sie war nicht müde, aber sie haderte mit dem Umstand, dass die Geburt Frauensache war und zudem eine äußerst langwierige Angelegenheit, die zu Warten und Stillstand nötigte.
Letzteres lag Acha nicht. Obwohl ihre Knochen manchmal knackten wie morsches Holz und ihr einstmals kräftiges, aber nun lichtes Haar eine Farbe angenommen hatte, als hätte sie es in Staub gebadet, hatte das Alter ihr doch nicht die Lust genommen, wendig durch die Welt zu jagen, sich vom beschwingten Tagesgeschäft auf Trab halten zu lassen und nur dann widerwillig innezuhalten, wenn die Müdigkeit ihre Lider niederpresste.
Heute freilich hätte sie einiges darum gegeben, einschlafen zu können und erst dann wieder aufzuwachen, wenn das Kind geboren wäre. Sie hasste es schon jetzt nicht minder als das Warten darauf. Gerne könnte es auf ewig im aufgedunsenen, blau geäderten Leib stecken bleiben.
Nachkommenschaft war zwar das Wertvollste auf Erden und dafür zu sorgen die Pflicht eines jeden ihrer Bewohner, aber gerade deshalb wollte Acha der Schwiegertochter nicht gönnen, solcherart ihren Wert für den Haushalt zu steigern. War es nicht schlimm genug, dass ihr maulfauler Sohn diesem Weibe mehr Respekt entgegenbrachte als seiner Mutter? Hatte Estrith nicht jene widerwärtigen Sitten eingebürgert, die die alten Götter vergraulen sollten?
Oh, gerne hätte sie gesehen, wie diese Götter die junge Aufmüpfige bestraften, indem sie ihr Kinder verweigerten! Doch nun lag Estrith allem heimtückischen Hoffen zum Trotz von Wehen geschüttelt da und mühte sich ab, das Köpfchen durch die rote schmierige Scham zu pressen.
»Es scheint mir gar sehr lange zu dauern«, murmelte eben eine der kuhäugigen Mägde, »’s geht nun schon seit Stunden nicht weiter.«
»Vielleicht liegt das Kleine falsch herum«, stimmte eine andere zu, nicht minder gleichgültig glotzend. Sie hielt den Gürtel in der Hand, den Estrith für gewöhnlich als Hausherrin trug, jedoch für die Geburt abgenommen hatte. An Spangen befestigt waren Nadeln und ein Messer, desgleichen eine Kordel mit allen wichtigen Schlüsseln.
Missmutig starrte Acha auf dieses Insignium der Macht, das zugleich Zankapfel zwischen den Frauen war, denn diesen Gürtel, so befand Acha, sollte sie als Älteste tragen, wohingegen Estrith befand, dass er allein ihr zustünde – war sie es doch gewesen, die den christlichen Glauben in dieses Haus gebracht und solcherart für jene Zeitenwende gesorgt hatte, der sich alleine Acha hartnäckig verweigerte.
Estrith stöhnte und griff nach der Hand einer der Mägde. Jene entriss sie ihr, auf dass sie nicht schmerzhaft zudrücken konnte.
»Ha!«, lachte Acha, genauso wenig gewillt, der Schwiegertochter nahe zu treten, um ihr den Schweiß abzuwischen. »Bist also nichts weiter als ein Schwächling, so wie dein Christengott! Als ich geboren habe, entfuhr kein Laut meinen Lippen. Was soll dein Mann denken, der da draußen wartet? Nicht allein, so wie mir zugetragen wurde. Eben habe ich erfahren, dass Ricbert eingetroffen ist.«
Freilich, dachte Acha, wenngleich sie sich hütete, das laut auszusprechen, freilich waren beide Männer gewiss längst mit Met gefüllt, sodass sie nicht mehr hörten, was sich hier im Langhaus zutrug.
Die Gebärende ächzte wieder, vielleicht aber war es auch Hohngelächter, das da über die aufgesprungenen Lippen kam.
»Nun«, murrte sie mit gepresster Stimme, »dies kann dich kaum freuen, du alte, bösartige Vettel! Hasst du doch Ricbert nicht weniger als mich und ...«
Sie schrie auf, als eine neue Wehe sie erfasste. Die beiden Mägde glotzten träge auf den Blutschwall, der sich zwischen den Beinen ergoss, »’s kann sein, dass das Köpfchen jetzt doch kommt«, murmelte eine gleichgültig, anstatt daran zu denken, Estriths Scham mit Schmalz einzureiben, auf dass sie geschmeidiger würde.
Oh, soll das Balg doch in diesem roten Leib ersticken!, schimpfte Acha innerlich. Soll Estrith mitsamt dem Kind verrecken!
Ja, wegen Ricberts Einfluss auf ihren Sohn Thorgil haderte sie so sehr wie wegen jenem Estriths. Auch er – ein Christ. Nach Northumbrien (von Acha stets Saxonia genannt) war er gekommen, als König Edwin die Schwester Eadbalds von Kent heiratete. Das war sieben Jahre her, und in dieser Zeit hatte ein gewisser Paulinus, der das Brautpaar begleitet hatte, den man »Bischof« hieß und der sich – wie Acha trocken befand – gerne reden hörte, vor allem in Gegenwart möglichst vieler Menschen, die Lande vergiftet. Den König hatte er zuerst getauft, dann dessen Getreue, schließlich alle Fürsten, zu denen auch Achas Sohn Thorgil zählte. Damit begann der Niedergang des alten Glaubens. Nicht nur, dass die Häupter der Bekehrten mit gar sonderlichem Wasser beträufelt wurden, welches die Männer der Kirche »geweiht« nannten – obendrein wurden auch alle Heiligtümer der alten Götter entwürdigt, nämlich durch den Bau von Kirchen.
Ein blutiger Klumpen trat zwischen Estriths Schenkeln hervor, indessen Fliegen im roten Dunst summten. Es roch nicht nach neuem Leben, sondern süßlich wie Verwesung.
»’s ist tatsächlich das Köpfchen«, meinte eine der Mägde, zwar endlich mit wachsendem Interesse, aber weiterhin tatenlos.
»Dann zieht es doch heraus!«, brüllte Estrith sich windend.
»Ha!«, lachte Acha. »Ich helfe dir gewiss nicht! Soll dir halt dein Priester dein Kind holen!«
»Es ist auch von deinem Blute, Acha!«
»Eben darum«, sagte die Alte, nun nicht nur höhnisch, sondern ehrfurchtsvoll, »eben darum ist es meine Pflicht, die Götter nach seiner Zukunft zu befragen.«
Sprach’s, drehte sich um und marschierte – an der hölzernen Trennwand vorbei, die den Schlafbereich vom Hauptraum abtrennte – zur Feuerstelle.
»Nein!«, gellte Estrith ihr hinterher. »Nein, das wirst du nicht tun!«
Ihr Atem kam stoßartig. Acha hingegen grinste vor sich hin, nahm einen Haken von der Wand, durch deren Gerüst von Weidengeflecht frische Luft von draußen strömte – und kniete sich nieder, um damit in der rotäugigen Glut zu stochern. Das Feuer war am Verlöschen, längst viel zu schwach, um mit seinen flackernden Schatten die Wände zu bemalen.
»Ich tu, was ich für richtig halte«, erklärte sie entschlossen.
»Wage nicht, deine heidnischen Götter nach der Zukunft des Kindes zu befragen!«, schrie Estrith, wiewohl die Worte in einem Würgen und Ächzen untergingen. »Das ist Gotteslästerung! Sobald es geboren ist, wird’s getauft!«
»Nun«, lachte Acha, »dann musst du ja keine Furcht haben, dass der Götter Fluch es treffen könnte. Dann ist es vom Gekreuzigten ja bestens geschützt. Oder denkst du vielleicht dasselbe wie ich, dass nämlich dein Christengott im Zweifelsfalle doch zu nichts taugt?«
Estrith konnte nicht mehr reden. Auch ihr Schreien verstummte, als sie nun hechelnd ihr Kind aus dem Leib presste. Acha indessen schrieb magische Zeichen in die Asche, zu der die Feuerglut verfiel.
»Nicht gut«, murmelte sie, um Estrith zu ärgern. »Gar nicht gut ist, was ich sehe.«
Thorgil beglotzte seine neugeborene Tochter schweigend, was nicht verwunderlich war, schließlich sollte ein Mann andere Begabungen haben als die des Redens. Zumindest war er nicht betrunken, wie Acha angenommen hatte, sondern sah sich die kleinen, rot verschmierten Gliedmaßen erstaunlich wach an.
»Es ist nur ein Mädchen!«, lästerte Acha, erleichtert, dass sie der Schwiegertochter zumindest nicht die Geburt eines Sohnes gönnen musste.
Estrith war so bleich, als hätte ihr Leib während der Geburt alles Blut aus den Adern gespien. Vielleicht stirbt sie noch, dachte Acha schadenfroh.
»Sie hat einen Zauber gesprochen«, murmelte Estrith tonlos. »Deine Mutter hat einen bösen Zauber über das Kind gesprochen ...«
Thorgil blickte stirnrunzelnd auf. Im Hauptraum erschienen grobschlächtige Mägde und Knechte, um das Neugeborene zu beschauen. Sie kamen aus den Ställen für das Vieh, die rund um das Langhaus gebaut waren, den Speicherhäusern, in denen Getreide gelagert wurde, und aus den Werkstätten, wo Holz und kostbares Eisen verarbeitet wurde – zu Booten und Pflügen, Karren und Fischereigerät.
»Das habe ich nicht!«, verteidigte sich Acha. »Doch wer das zweite Gesicht hat, der vermag in der Feuerglut die Zukunft des Menschen zu sehen!«
Das Kindlein quietschte wie ein Kätzchen.
»Und«, fragte Thorgil, vom Streit der Frauen mürrisch gestimmt, »was hast du gesehen?«
Acha zögerte.
Die Wahrheit war, dass sie weder das zweite Gesicht hatte noch mit den Göttern sonderlich gut stand. Nie hatte sie große Stücke auf sie gehalten, ihre Namen vielmehr erst dann heraufbeschworen, als Estrith den schwachen Christengott ins Haus holte. Das allein hätte Acha ihr noch verzeihen können – nicht jedoch, dass sie aus dem maulfaulen, schlichten Sohn einen lebhaften Mann machte, der ständig dem hübschen Leib der Gattin hinterherrannte und dessen Stöhnen bis in den Hauptraum drang, wenn er auf ihr lag und sie begattete. Acha hatte den eigenen Mann nie zu irgendeiner Regung veranlassen können. Was immer er auf ihr liegend tat – es hatte niemals ein Geräusch erzeugt, weder aus seinem noch aus ihrem Mund. Genauso wenig an der Lust interessiert schien lange Zeit auch ihr Sohn. Doch Estrith hatte sie eines Besseren belehrt.
»Also, was hast du gesehen?«, drängte Thorgil.
Wie war es möglich, so hatte Acha oft gedacht, dass Estrith solche Macht über Thorgil hatte, wo der Christengott doch keine Frauen mochte und seine Mönche noch viel weniger? Wie konnte es sein, dass sich sein Geschlecht oft lange vor der Schlafenszeit unsittlich wölbte, wo doch die neue Religion laut verkündete, dass Lust stets Sünde sei? Ja, wie konnte es sein, dass sie selbst, Acha, den eigenen Mann nie zu jenem feuchten Schafsblick bewegen konnte, wiewohl doch manche ihrer Götter weibliche Namen trugen und auch Frauen Priesterinnen waren?
»Ich habe nichts Gutes gesehen«, sagte sie keuchend. »Dem Mädchen steht ein hartes Leben bevor ...«
»Lügnerin!«, stöhnte Estrith. »Du bist eine widerwärtige Lügnerin!«
Thorgil übergab das Kind einer Magd. »Ist das wahr, Mutter?«, fragte er misstrauisch.
Acha zuckte mit den Schultern. Es war leichter, Estrith etwas vorzumachen als ihm.
»Asche«, murmelte sie schließlich, um zumindest teilweise bei der Wahrheit zu bleiben. »Ich habe nichts als graue Asche gesehen. Das kann doch kein schönes Leben verheißen, oder?«
Weitere Menschen strömten ins Langhaus. Ricbert zählte dazu, Thorgils engster Freund, und Sigwulf, der Sachse war – und Mönch.
Es war nicht gewiss, wie lange er dem Streit zugehört hatte, doch nun trat er vor, um ihn zu beschwichtigen. Er versuchte, es auf eine kluge Art zu tun, indem er keine der beiden Frauen vor den Kopf stieß.
»Das Leben hier auf Erden ist für uns alle beschwerlich«, sprach er in die dumpfe Schwüle hinein, die nach Schweiß und Blut roch. »Dem neuen Menschenkind wird’s nicht anders ergehen. Darum ist es wichtig, dass es einen Namen erhält, der es stark macht für diese Welt.«
Thorgil schien erleichtert, dass nicht er derjenige war, der schlichtend eingreifen musste, sich entweder mit dem Weibe oder der Mutter anzulegen hatte.
»Dann bestimme du einen solchen Namen, Mönch!«, befahl er.
Acha knurrte leise, indes Sigwulf auf das quietschende Neugeborene zutrat. »Sie soll Bathildis heißen«, beschloss er. »In diesem Namen sind die sächsischen Wörter für Mut und Kampf enthalten – und es kann gewiss nicht schaden, wenn sie eine mutige Kämpferin wird!«
Acha verbiss sich die Worte, aber wieder stürmte alt vertraute Verbitterung durch ihre Gedanken. Ha! Als ob der feige, geschundene Christengott nach mutigen Kämpferinnen verlangte! Als ob er den Weibern jene Macht überließe, die Acha gerne dem eigenen Geschlecht zugedacht hätte – nur eben nicht der aufmüpfigen Schwiegertochter, die diese Macht als Einzige zu besitzen schien!
»Wird das reichen, sie zu beschützen?« Estrith blickte hilfesuchend in die Runde.
»Ach, werte Estrith«, tröstete Ricbert, der an der Seite des werdenden Vaters die Geburt erwartet hatte. »Bang nicht um das kleine Mädchen hier. Sehr kräftig scheint’s mir, und auch die Laute, die es von sich gibt, verheißen Gesundheit. Als mein Sohn Aidan geboren wurde – er kam vor drei Monaten auf die Welt, und wir haben ihm den Namen jenes irischen Mönchs gegeben, der ihn auch zur Taufe hob –, so war er ganz blau im Gesicht, nicht lebhaft rot wie deine Tochter.«
»Und wenn doch ein Fluch auf ihr lastet?«, murmelte Estrith zweifelnd.
Trotz ihrer Verbitterung grinste Acha hämisch. So viel Macht hatte sie an die Schwiegertochter abgeben müssen, dass sie dies Fünkchen Furcht als Wiedergutmachung nicht missen wollte! Wiewohl vom stummen Blick des Sohns dazu gedrängt, versuchte sie nicht, Estrith zu beschwichtigen. Auch dem sächsischen Mönch fiel nichts mehr ein, um die Ängste der Mutter zu entkräften.
Da sprach Estrith selbst, nach einer Lösung trachtend, um das Bedrohliche, das von Achas Botschaft verheißen ward, vom neugeborenen Töchterlein zu wenden.
»Ach, guter Ricbert«, seufzte sie, »da du von deinem Sohne sprichst ... ist’s nicht ein Zeichen Gottes, dass meine Tochter so bald nach ihm geboren wurde? Ich will dem Ratschluss von euch Männern nicht vorgreifen. Und doch erlaubt mir diesen Vorschlag zu bekunden: Wär’s nicht der beste Beweis für eure Freundschaft, wenn meine Bathildis dereinst deinen Aidan zum Gatten bekommt? Ich weiß, wie nahe du dem Königshofe stehst ... dein Sohn könnte meinem Mädchen gewiss ein vorzügliches Leben bieten. Nicht länger hätte ich um ihr Geschick zu bangen!«
Ihre Stimme wurde schwächer ob der Anstrengungen der Geburt. Matt sank ihr Kopf zurück auf das Kissen. Thorgil blickte ratlos, bislang bereit, sich jedem Wunsch von der so begehrten Gattin zu fügen, doch jetzo dem Verdacht erliegend, dass ein Entschluss von solcher Tragweite von ihm getroffen werden müsste – nicht von ihr.
Ricbert freilich nahm die Worte freundlich auf. »Das nenn ich einen guten Plan!«, rief er aus, ehe Thorgil widersprechen konnte. »Schon vorhin hatte ich eben diesen Gedanken – für den Fall, dass dir ein Mädchen geschenkt sein sollte. Nun hat Gott es so gefügt, und wenn sie gesund und kräftig bleibt, dann sehe ich sie dereinst gern als Aidans Braut!«
Er lächelte ehrlich erfreut, Estrith seufzte erleichtert, weil sie das böse Omen nicht länger ohnmächtig ertragen musste, und auch Thorgil nickte schließlich zögernd. Sein Weib hätte nicht ohne sein Einverständnis sprechen dürfen – doch was sie gesagt hatte, ergab Sinn.
»Auf Aidan und Bathildis!«
Alle stimmten in diesen Ruf ein.
Nur Acha wandte sich missmutig ab, von den verheißungsvollen Plänen der Möglichkeit beraubt, Estrith weiter zuzusetzen. Ob ihrer heftigen Bewegungen wirbelte die Asche in der Feuerstelle hoch und verwischte langsam zu Boden tänzelnd die Zeichen, die sie gemalt hatte.
»Bring Holz!«, knurrte Acha eine der Mägde an, die eben die säuerlich riechende Nachgeburt nach draußen tragen und dort verscharren wollte, so tief, dass kein wildes Tier sie ausgraben und fressen konnte. »Siehst du nicht, dass das Feuer erloschen ist?«
II. Kapitel
15 Jahre später
Die Schiffe kamen in der Nacht; mit eingezogenen Segeln glichen sie dunklen Augen und ihre Ruder, die fast lautlos durch das Wasser glitten, deren Wimpernschlägen. Das Plätschern, das sie erzeugten, ein wenig ächzend wie der feuchte Atem eines Sterbenden, war leiser als die Brandung, die am zerklüfteten Ufer aufschlug.
Bathildis sah die Schiffe zuerst. Schon Stunden zuvor hatte sie in die Nacht gestarrt, nicht als willentliche Späherin, sondern weil der Schlaf sie vor sich hertrieb, anstatt sie mit seinen schweren Flügeln einzulullen. Seit Wochen ging es so, dass Finsternis und Ruhe sie nicht beschwichtigten, sondern aufwühlten, ihr Gedanken in den Kopf träufelten, die bei Tag keine Macht über sie hatten und die aus dem Kloster an der Küste von Kent, bislang sichere Heimstatt, ein Gefängnis machten. Der einzig erträgliche Ort war die Kammer über dem Schlafsaal, wo Fensterluken einen eingeengten Blick nach draußen erlaubten.
Die Schiffe sah sie nur zufällig; eigentlich starrte sie zum Mond hinauf, der – hinter Wolken liegend – ein unregelmäßiges Licht warf und aus dem dunklen Tuch der See ein Flickwerk aus tiefschwarzen Löchern, weißen, sich kräuselnden Spitzen und grün-blauen Falten machte. Ehe die schreckliche Gefahr zu erahnen war, hatte sie geseufzt, hatte sich gefragt, wie viele Stunden sie noch vom fremden künftigen Leben trennten. Nicht mehr im Kloster sollte sie dieses zubringen, wo sie zu lesen und zu schreiben gelernt hatte, zu singen und zu beten, zu spinnen und zu weben, vor allem aber: demütig zu sein und fromm (wiewohl dies nicht immer gelang; das Verbotene reizte sie, und dazu zählte auch, nachts nicht im Schlafsaal zu liegen, sondern ins Freie zu schauen). Stattdessen sollte sie den Bund der Ehe eingehen – mit einem Mann, der getauft war (was, wie die Äbtissin erklärt hatte, gewiss das Wichtigste war und was jedwede andere Schwäche – sei es eine, die Statur, Gesichtszüge oder Charakter betreffe – ausgleiche) und mit dem sie das letzte Mal zusammengetroffen war, als ihre stämmigen Beinchen sie kaum tragen konnten, die Augen noch kindlich blau und die Haare noch blond gewesen waren. Im Laufe der letzten fünfzehn Jahre waren sie gedunkelt (ein wenig rötlich wie das Haar der Mutter und ein wenig bräunlich wie das Haar des Vaters), und um die Pupille war aus einem kleinen dunklen Pünktchen ein haselnussbrauner Reif entstanden. Doch die Zeit hatte aus dem hellen, farblosen Kind nicht nur ein ansehnliches junges Mädchen gemacht, sondern hatte auch die Erinnerung an Aidan verblassen lassen. Sie wusste nichts weiter von ihm, als dass ihre beiden Väter Thorgil und Ricbert die Verlobung schon kurz nach ihrer Geburt beschlossen, hernach mehrfach bekräftigt hatten und dass sie ihm vor Ablauf des Jahres zugeführt werden sollte. Genau genommen wusste sie auch von ihrem Vater nicht viel mehr als von ihrem Verlobten – nur, dass er sie schon früh von Northumbrien nach Kent geschickt hatte, um dort zum einen den Kriegen in der Heimat zu entgehen und zum anderen eine angemessene Erziehung zu erhalten. Sein Antlitz jedoch war genauso vage wie das von Aidan oder auch das ihrer Mutter Estrith, wenngleich jene schon seit langem tot war und es ihr stets verzeihlich erschienen war, eine Tote vergessen zu haben.
So stand sie oft frierend an der Fensterluke, erhaschte durch die schmalen Ritzen der Holzbalken einen Ausschnitt der fremden Welt und suchte daraus etwas abzulesen, was das künftige Geschick entschlüsseln, in ihr eine Neugierde entfachen würde, ein Sehnen und ein Hoffen.
Meist blieb es merkwürdig still in ihr, denn sie konnte sich ein Leben außerhalb der Klostermauern nicht ausdenken. Und auch der lebendige Schrecken, der sie in jener Nacht ganz ohne Vorwarnung durchzuckte, war gesichtslos. Die Bedrohung, die in Form der augenförmigen Schiffe auf sie zusteuerte, erzeugte in ihrem Kopf keine Bilder – nur den Zwang, sogleich aus der Kammer zu stürzen und sich im nachtschwarzen Kloster zu jener Tür vorzutasten, hinter der die Äbtissin Eadhild schlief.
Bathildis hämmerte an die Tür. Zugleich schrie sie ein ums andere Mal – viel lauter, als sie in den letzten Jahren jemals hatte ihre Stimme benutzen dürfen – »Schiffe! Schiffe! Es kommen fremde Schiffe!«
Bathildis hatte erwartet, dass eine Bedrohung wie diese sämtliche Nonnen in unglaubliche Hast versetzen würde, dass sie alsbald in ein Tempo verfallen würden, das die Beschaulichkeit eines gottgeweihten Lebens ansonsten strikt verbat. Stattdessen konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in dem Augenblick, da sie der Äbtissin von der Gefahr berichtete, jene ihren so regsamen Geist aushauchte und nur mehr Hülle war, die auf fremde Hilfe wartete.
Nie zuvor hatte Bathildis deren Zelle betreten. Die Äbtissin Eadhild war die Einzige, die einen Raum ganz für sich allein hatte, und wenngleich sie darum von manchen der älteren Nonnen beneidet wurde, deuchte es Bathildis und die gleichaltrigen Mädchen stets unheimlich, alleine zu schlafen – ganz ohne das Seufzen und Räuspern und Schnarchen der Gemeinschaft.
Selbst jetzt konnte sie nicht umhin, einen neugierigen Blick in diese Zelle zu werfen, um hier freilich nichts weiter zu erschauen als einen Strohsack, von dem die Äbtissin hochgefahren war, und einen Holzschemel. Eadhild trug die gleiche Leinenkutte wie des Tags, nur ihre Haare waren von keiner Haube bedeckt, sondern hingen schwer über den Rücken – strähnig und talgig und einen unangenehmen Geruch verbreitend, jenem gleichend, der drückend im Schafstall hing.
»Was sagst du da? Was sagst du da?«, stotterte sie ein ums andere Mal, schritt ziellos auf und ab.
Zuerst war Bathildis erleichtert, dass ihr die Frage erspart blieb, warum sie sich aus dem Schlafsaal geschlichen hatte. Doch zunehmend verstörte es sie, dass die Frau, die das Kloster leitete – stets ein wenig nörgelnd, das schon, aber mit jener Würde, die nur vom Leben erprobte Menschen ausstrahlen können –, nicht klärte, was zu tun war, die Zeit nicht nutzte, die verblieb, bis die Schiffe am Ufer anlegten und deren Insassen das Kloster erreichten. Es lag nicht direkt am Strand, aber auch nicht weit genug im Landesinneren, um vor den Blicken Fremder geschützt zu sein – zumindest nicht mehr, seitdem die Mönche den Wald gerodet hatten.
Diese Mönche lebten im gleichen Kloster wie sie, jedoch durch eine Tür getrennt, die zu öffnen streng verboten war und die nur von der Äbtissin durchschritten wurde, wenn sie mit dem Abt etwas zu klären hatte. Einzig beim Messbesuch trafen Männer und Frauen zusammen, doch jener war in den letzten Tagen ausgefallen, weil die Mönche zum Grab des Paulinus gepilgert waren, um das Andenken dieses großen Mannes zu ehren. Jener hatte das Christentum nach Northumbrien gebracht, war von dort jedoch schmählich vertrieben worden, als der heidnische Penda die Macht erlangt hatte, und schließlich vor drei Jahren in Kent gestorben.
Die Abwesenheit der Brüder bedeutete, dass die Nonnen auf sich gestellt waren und die Äbtissin allein eine Entscheidung zu treffen hatte.
Kopflos auf und ab irrend erweckte sie freilich nicht den Eindruck, dass sie dazu bereit wäre.
»Mutter Äbtissin!«, rief Bathildis. »Die Schiffe kommen aus dem Norden! Sie haben keine Segel gespannt, was heißt, dass sie nicht erkannt werden wollen!«
Erstmals blieb die Frau stehen.
»Du meinst doch nicht, dass ...«, hob sie entsetzt an.
Bathildis wusste gar nicht, was sie meinen sollte. Lieber wäre ihr gewesen, die andere würde etwas sagen, ihr erklären, was vorging. Stattdessen musste sie selbst mühselig nach dem schürfen, was sie in den letzten Wochen und Jahren über ihre Heimat gehört hatte, niemals offen ausgesprochen, weil unnütze Worte im Kloster streng verboten waren. Gewissheiten gab es wenige – aber manches Gerücht, manche Ahnung, meist zu schrecklich, um ernsthaft daran zu glauben.
Von Kriegen im Norden Britanniens war die Rede, desgleichen von darob entvölkerten Landstrichen und Vertriebenen, die den Verlust ihrer Heimat rächten, indem sie raubten und mordeten ... und schändeten. Von all den möglichen Verbrechen war dies gewiss das Schlimmste, denn es war nicht sicher, ob eine solcherart entehrte Frau jemals den Himmel erschauen dürfte.
Die Gesetzlosen im eigenen Land waren jedoch nicht die einzige Bedrohung. Erst kürzlich hatte ein Reisender, den man entsprechend dem Gebot der Gastfreundschaft aufgenommen hatte, berichtet, mehrere Schiffe seien an den Küsten Kents aufgetaucht. Von einem Land stammten sie, das auf der anderen Seite des Meeres lag und aus dem keine gesitteten Christenmenschen kamen, sondern Barbaren, schrecklich gottlos und grausam und stets auf der Suche nach Reichtümern, um ihre unermessliche Gier zu stillen.
Wiewohl Bathildis solcherlei Gedanken, die sich schon beim ersten Anblick der Schiffe aufgedrängt hatten, nicht laut aussprach, schien der Äbtissin nun Ähnliches zu dämmern. Endlich blieb sie stehen, stieß einen Schrei aus, so laut, dass er bis in den Schlafsaal drang und dort Unruhe stiftete. Alsbald erschien die Nonne Godiva auf der Schwelle, deren farblose Lippen sich nie gänzlich über die spitz vorstehenden Zähne schlossen und deren Gesicht dem einer Ziege glich.
Mit ihr, der engsten Vertrauten der Äbtissin, die auch diejenige war, die am schönsten zu schreiben vermochte, strömten andere herbei – die einen mit offenem Haar, die anderen mit in der Eile verkehrt gebundener Haube. Ihre Stimmen gingen durcheinander.
Sie sollen still sein, dachte Bathildis; die Männer aus dem Norden dürfen uns nicht hören! Und Licht ... kein Licht, so wie es jetzt die Kerzen aus Talg verbreiteten!
Sie hoffte, die Äbtissin würde das ebenso bedenken und zur Ruhe mahnen.
Stattdessen schrie jene ein ums andere Mal – und das war es, was aus Bathildis’ Sorge und Aufgewühltheit eine klamme, kalte Furcht machte, die sich wie ein Wurm in ihrem Bauch zu winden begann – »Gott straft uns! Gott geißelt uns!« Wieder fiel Bathildis auf, dass Langsamkeit und Erstarrung das Geschehen bestimmten, nicht Hast und Eile.
Die Nonnen verstummten, lauschten auf das, was die Äbtissin und Bathildis zu berichten hatten – wobei genau betrachtet nur Bathildis in ganzen Sätzen sprach, die andere in panischen, unnützen Silben; dann rangen sie merkwürdig lahm die Hände. Godiva, die Ziegengesichtige, ansonsten streng mit sich und anderen, wenn es um laute, nutzlose Geräusche ging, schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Das Klatschen ließ alle zusammenfahren.
»Wir sind verloren! Ohne unsere Brüder sind wir gewiss verloren! Allein Gott kann uns jetzt noch retten! Schnell, schnell, lasst uns in der Kapelle Zuflucht suchen! Holt alle zusammen – vielleicht hat der Allmächtige doch noch Erbarmen mit uns!«
Bathildis konnte sich nicht erinnern, Godiva jemals offen ins Antlitz geschaut zu haben, desgleichen wie sie in ihrer Gegenwart niemals ungefragt das Wort erhoben hatte. Die fromme, pflichtversessene Godiva neigte dazu, jede Frechheit zu bestrafen – nicht mit den üblichen Schlägen, sondern mit schmerzhaften Kniffen in die Brüste, selbst in die flachen der Kinder. Nicht nur, dass es schmerzhaft war – eine jede, der solches geschah, ahnte, dass es auch verboten, weil unkeusch war. Freilich war es schwer, von der Ziegengesichtigen zu denken, dass sie willentlich sündigte. Und ebenso wenig konnte man mit der Äbtissin darüber sprechen, die sich auf Godiva verließ wie auf keine andere. Selbst jetzt nickte sie. An ihrer Stelle erhob Bathildis Einwand.
»Nein, nicht die Kapelle!«, stieß sie aus. Sie wusste in diesem Augenblick nicht, vor wem sie sich mehr ängstigte – vor den nahenden Schiffen oder dem Ziegengesicht, das sich missmutig verzog.
»Seit wann führen in unserem Haus Kinder das Wort?«, zischte sie in Bathildis’ Richtung und fuchtelte obendrein mit der Kerze.
Vor den anderen kann sie mich nicht in die Brüste kneifen, dachte Bathildis’ trotzig.
»Ich habe die Schiffe entdeckt!«, entgegnete sie mit sich überschlagender Stimme. »So nah sind sie schon an der Küste. Und deswegen müssen wir uns eilen und uns verstecken, aber nicht in der Kapelle, denn ...«
Dass sie an Macht verlieren könnte, deuchte Godiva wohl die größere Gefahr zu sein als die fremden Schiffe. Sie schritt auf Bathildis zu, musterte sie streng und wortlos, als hätten sie alle Zeit der Welt für diesen Streit, und meinte dann verächtlich – über Bathildis’ Kopf hinwegsprechend: »Sie ist nicht einmal Novizin. Irgendwann wird sie das Kloster verlassen, um zu heiraten ... Und so eine will uns sagen, was wir zu tun haben?«
Bathildis wusste nicht genau, was sich am lautesten aus der Stimme der anderen herausschälte: Neid, dass sie selbst ihr Leben im Kloster beschließen würde, oder Geringschätzung, weil der Stand der Nonnen weit mehr Heil versprach als jener der Ehefrauen, die die Scham der Zeugung und den Schmerz der Kindesgeburt zu ertragen hatten ...
Nun, beides würde Bathildis nicht erleben, wenn sie sich nicht baldigst retteten.
»In ... in der Kapelle werden sie zuerst nachsehen, wenn es tatsächlich Räuber sind, die nach Reichtümern suchen«, stotterte sie – mühsam die Zunge befehligend, die die Furcht anständig aus dem Takt tanzen ließ. »Wenn wir hingegen an einem Ort Zuflucht suchen, der unauffällig ist, dann ...«
»Bis zum Wald schaffen wir es niemals!«, schaltete sich eine der anderen ein. »Die ersten Bäume stehen viel zu weit entfernt von uns!«
»Auch der Getreidespeicher ist zu klein – und wer sagt, dass sie nicht auch der Hunger treibt und sie an diesem Ort früher suchen als in der Kapelle?«
Bathildis atmete schwer. Ob ihrer Furcht dachte sie, keinen klaren Gedanken fassen zu können. Doch gerade aus der Leere in ihrem Kopf vermochte sich ein Befehl klar und deutlich zu erheben: »Der Taubenturm!«
Die Äbtissin starrte sie verständnislos an. Jetzt erst entdeckte Bathildis, dass Falten ihr Gesicht überwucherten wie kleine Sprünge den Boden einer Schüssel. So zerknittert sah sie aus, dass Bathildis sich kurz fragte, wie sie jemals Furcht vor der gestrengen Klostervorsteherin hatte haben können, die die Mädchen sämtliche lateinischen Psalmen und die Worte der großen Kirchenlehrer hatte lernen lassen. Auch sie war kaum milder als Godiva und strafte gern auf ihre Weise. Wer nicht rechtzeitig begriff – Bathildis gehörte meist nicht dazu, umso mehr aber ihre Freundin Hereswith – der musste seine Hände ausstrecken; dann ließ sie den Hanfstrick, der das raue Leinengewand zusammenhielt, in der Luft kreisen wie eine Peitsche und schlug rote Striemen in die Hände.
Von jener Strenge war heute nichts zu spüren.
»Ja«, sagte sie langsam. »Der Taubenturm.«
Godiva schnaufte, wieder klang es verächtlich. »Und das Haus Gottes sollen wir im Stich lassen? Erlauben, dass man den Leib Christi schändet? Wer immer da kommt und uns bedroht: Wir sollten ihnen das Brot entgegenhalten, auf dass ihnen Gott selbst befiehlt, von dannen zu ziehen!«
»Sollen sie lieber uns schänden anstelle des Allerheiligsten?«, rief Bathildis laut.
»Bathildis!«, rief die Äbtissin entsetzt, um alsbald kleinlaut hinzuzufügen: »Godiva hat recht. Wenn es tatsächlich Barbaren aus dem fremden Land sind, die da kommen, dürfen wir ihnen nicht erlauben, dass sie das Allerheiligste verunreinigen ...« Sie hielt kurz inne, dachte nach, suchte im Kreise der anderen unruhigen Nonnen nach einem bestimmten Gesicht. »Freilich ist es auch ratsam, Schutz vor ihnen zu suchen. Wir dürfen ihnen nicht in die Hände fallen, und das würde in der Kapelle wohl geschehen. Also gut, Schwester Messnerin, ich befehle dir: Geh in das Haus Gottes und folge uns nach mit sämtlichem Gefäß, das jemals den Leib oder Blut Christi hielt! Wickle es in die Altartücher ein, auf dass es nicht verunreinigt werde!«
Die Schwester Messnerin war bislang still gewesen. Nun schrie sie spitz und hoch: »Das wag ich nie und nimmer!«
»Nun, mach schon!«, rief die Äbtissin, mehr ratlos als streng, aber immerhin endlich bereit, das Ruder wieder zu übernehmen. »Wir haben keine Zeit für Mutlosigkeit!«
Die Nonne erbleichte, japste nach Luft – und fand eine Ausrede. »Aber es verhält sich so, dass ich ... in diesen Tagen blute ... so wie’s jeden Monat bei Vollmond geschieht. Ich bin unrein! Ich darf die Kapelle nicht betreten, und den Altarraum noch weniger. O gebe der Herr, unsere Brüder in Christus kämen zurück, um uns zu beschützen!«
Was ihnen gewiss nicht gelänge, ging Bathildis durch den Kopf, wiewohl sie wusste, dass sie nicht schlecht von den Mönchen denken durfte, wo doch jeder Mann mehr wert war als die Frau. Dennoch: Die Mönche waren keine kräftigen Helden, sondern bis auf Bruder Alchfrid steinalt und gebrechlich, und jener wiederum war von Geburt an blind. Erstaunlich, dass man ihm die Ewigen Gelübde gestattet hatte, wo doch jeder wusste, dass solche Behinderung die Strafe Gottes für die Sünden seiner Eltern war.
»Bathildis«, sprach die Äbtissin indessen, »du bist flink auf den Beinen. Geh du in die Kapelle und tue, was ich die Schwester Messnerin geheißen habe.«
»Aber, Mutter Äbtissin, es ...«, widersprach Godiva heftig.
»Ich weiß, sie ist nicht einmal Novizin, doch was zählt das in Zeiten der Bedrängnis? Ich brauche dich hier, Schwester Godiva, damit du mir hilfst, die anderen aufzuwecken, ohne dass sie in Geschrei ausbrechen. Der Taubenturm ist ein gutes Versteck. Wir müssen alle dorthin führen ... und du, Bathildis, kommst nach.«
Bathildis nickte tonlos; kurz nur währte der Triumph über ihre Auszeichnung, die ihr entgegen Godivas Willen zugesprochen ward. Dann wurde ihre Kehle wieder rau, und in ihrem Leib wand sich der dunkle Wurm aus Angst und Schrecken. Durch die Schlitze des Fensterbalkens erspähte sie, dass die Schiffe, anfangs nur Punkte in der Weite des Horizonts, zur Größe einer Faust gewachsen waren. Wenn es ihr nicht rechtzeitig gelänge, ihre Aufgabe zu erledigen und wieder aus der Kapelle zu huschen, so würde sie den nächtlichen Angreifern ganz alleine gegenüberstehen – wer immer sie auch waren.
Bathildis schlich auf ihren Zehenspitzen. Sie hatte erwartet, dass ihre Furcht in der leeren Kapelle weiter wachsen und ihr Leib noch unkontrollierter zittern würde als zuvor, nicht zuletzt, weil in den Gemäuern die modrig-frostige Luft vom Winter hing, wiewohl selbst der launige Frühling bereits zur Neige schritt. Aber dennoch verbreitete das niedrige Gewölbe ein heimeliges Gefühl, zumindest in solcher Weise, dass es der gebotenen Ehrfurcht nicht widersprach.
Es war, als hätte Weltliches in den geweihten Hallen nichts zu suchen – was gleichsam hieß, dass die bedrohlichen Schiffe und die Angst, die sie erzeugten, hier keinen Zutritt hatten.
Vielleicht sollte ich mich hier verstecken, ging es Bathildis durch den Kopf, obwohl sie vor wenigen Augenblicken noch den anderen Schwestern davon abgeraten hatte.
Nun glaubte sie plötzlich Godivas Hoffen, dass kein Angreifer diese Schwelle überschreiten könnte, sondern von unsichtbarer Macht zurückgehalten werde, gleich so, als würde ein kräftiger Krieger ihm entgegentreten und ihn schlagen. Ein Krieger, wie ihr Vater einer war, der gewiss alles zu ihrer Rettung tun würde, wüsste er seine Tochter in Gefahr.
Es war nicht das erste Mal, dass sie an Thorgil dachte. Wohingegen ihn ansonsten ihre Fantasie nur blass und unscharf zeichnete, ward er nun ob der Furcht zum mächtigen Riesen gewachsen.
»Oh, Vater«, seufzte sie unwillkürlich – und sie wusste nicht, ob sie den irdischen meinte oder den himmlischen, dem man an keinem Ort so nah kommen konnte wie hier.
Gleichwohl es übermächtig schien, widersetzte sie sich dem Begehren, sich irgendwo zu verkriechen, sondern erfüllte ihre Pflicht, indem sie zum Altar vortrat, dort sämtliche Gerätschaften zusammentrug und sie hernach in der bestickten Decke einwickelte: Kelche aus Bronze (die Klostergemeinschaft war zu arm, um solche aus Gold zu besitzen), zwei Kandelaber, Wein- und Siebgefäß mit farbig blitzenden Steinen und die Hostienschalen für die heiligen Eulogienbrote.
Einer wie ihr wäre solch Handeln niemals gestattet gewesen, wäre ein Mann zugegen gewesen und hätte sich die Gemeinschaft nicht in einem Zustand höchster Not befunden. Wissend, dass sie eine Unwürdige war, hielt sie darum den Kopf gesenkt – gleich so, als stünde sie einer Person gegenüber, der man nicht offen ins Angesicht schauen durfte. Sie versuchte, sämtliche Gefäße nur mit den Fingerspitzen anzufassen, sodass sie mit möglichst wenig beschmutzender Haut in Berührung gerieten.
Ob die Nonnen schon den Taubenturm erreicht hatten? Ob die Schiffe schon angelegt hatten und ihnen die fremden Männer entstiegen? Waren jene vielleicht gar nicht auf einen Raubzug aus, sondern wollten nur sicher in Ufernähe ankern, um hier die Nacht zu verbringen?
Obzwar sie ihre Aufgabe besonnen hatte erfüllen wollen, machten die Gedanken sie fahrig. So geschah es, dass sie über einen kleinen Vorsprung im unebenen Boden stolperte. Japsend hielt sie sich gerade noch aufrecht, doch sie konnte nicht verhindern, dass eine jener Schalen, die ansonsten das zum Leib Christi gewandelte Brot hielt, aus ihren Händen rutschte und scheppernd auf den Boden kullerte. Er war nicht schmutzig, auch nicht aus bloßem Holz, sondern aus Lehm gestampft, doch verglichen mit jenen kunstvollen Mosaiken, von denen jene Brüder erzählen, die schon Kirchen in Rom erblickt hatten – sehr ärmlich und keinesfalls heilig.
Bathildis wusste nicht, was sie mehr erschreckte – das laute Geräusch (wusste Gott, wer es gehört haben könnte) oder die sträfliche Verunreinigung eines heiligen Gefäßes. Dies, so ahnte sie, war noch schlimmer, als ein böses Wort zu sprechen und sich solcherart die Lippen schmutzig zu machen oder den eigenen Leib an verbotener Stelle zu berühren.
Entsetzt schrie sie auf, stand dann wie starr und blickte auf die Schale, die sich mehrmals um die eigene Achse drehte, ehe sie endlich stillstand. Einen Augenblick war sie sicher, dass die Strafe Gottes augenblicklich über sie hereinbrechen müsste. Manche Menschen waren wegen eines geringeren Vergehens vom Blitz getroffen worden.
Unwillkürlich duckte sie sich, lauschte in die Stille. Doch entgegen ihrer Erwartung tat sich der Himmel nicht auf, um das Zeichen seiner Rache auf die Erde zu senden, sodass sie sich schließlich wieder aufrichtete und sich zögernd umblickte.
Die Zeit drängte. Niemand hatte gesehen, was geschehen war – nur Gott allein, aber wäre es für Gott nicht noch viel schlimmer, wenn böse, habgierige Räuber, womöglich sogar Heiden darunter, die geheiligten Gegenstände in die Hand bekommen hätten?
Die Heiden!
Die Angst vor den Schiffen, eben noch vom Entsetzen über die eigene Untat verdrängt, durchzuckte sie wieder, löste den Körper aus seiner Starre. Sie dachte nicht länger daran, dass sie noch Schlimmeres getan hatte als die Schwester Messnerin, wäre jene zum Zeitpunkt ihrer monatlichen Blutung dem Altarraum zu nahe gekommen, sondern bückte sich rasch, um die Schale aufzuheben, zum restlichen Geschirr zu legen und dieses hastig einzuhüllen.
Wenn Gott uns seine Geißel schickt, dachte sie – zu sehr in fiebrige Aufregung versetzt, um zu erkennen, welch frevlerischer Gedanke sich da in ihr festbiss –, so darf Er sich nicht wundern, wenn unser Tun nicht den rechten Gang nimmt ...
Sie schlich wieder lautlos, nur die heiligen Schalen schepperten in dem Bündel, zu dem sie das Altartuch gerollt hatte. Draußen im Freien war es freilich kaum hörbar, wurde von den teils kreischenden, teils sehnsuchtsvollen Stimmen des Waldes übertönt, der dunkel dort hinten lag, ein sicheres Versteck, nur viel zu weit entfernt.
Ihr Herz hämmerte, als sie sich zum Meer umdrehte. Es schien völlig glatt zu sein, wie die nackte Haut eines sehr jungen Menschen, nicht aufgewühlt von Schiffen und deren Ruderschlägen. Doch dass von ihnen nichts zu sehen war, beunruhigte Bathildis noch viel mehr. Nichts anderes konnte es bedeuten, als dass sie längst am Ufer – von ihrem Standpunkt nicht auszuspähen – angelegt hatten.
Und dort vorne – waren da nicht Schatten? Bewegten sich nicht Büsche?
Lauf!, dachte sie hektisch. Lauf!
Und zugleich: Wenn ich laufe, so werde ich auffallen.
Unentschieden verharrend, erwachten wieder Gedanken an den bislang fremden, gesichtslosen Vater; erneut begann sie, das Bild von ihm zu malen: groß und stark und dunkelhäutig; ein Rächer und Beschützer, ein Helfer in der Not. Solcherart wähnte sie sich genug gestärkt, um eine Entscheidung darüber zu treffen, wie sie sich am besten fortbewegen sollte.
Als sie erneut vermeinte, in der Ferne schattenhafte Bewegung zu erspähen, folgte sie nicht der ersten Regung aufrecht laufen, sondern bückte sich, um – vom Gestrüpp geschützt – zu kriechen. Sie kam zwar langsamer voran als gehend, doch näherte sich stetig dem Taubenturm, die eine Hand als Stütze nutzend, während sie mit der andern noch immer fest das Bündel umgriffen hatte. Sie vermied es, Zeit zu verschwenden, sich umzudrehen, wiewohl das Gefühl von Bedrohung ihr im Nacken saß und sie mehr als einmal sicher glaubte, dass das gelbe Mondlicht den Schatten eines Riesen auf sie werfen würde.
Wenn ich jetzt sterbe, ging ihr durch den Kopf, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich keine Erinnerung an mein Leben, dann werde ich meinen Vater niemals wiedersehen ...
Der Gedanke an solch Versäumnis spornte sie an. Mit wunden Knien und aufgescheuerten Händen – dort, wo das Bündel in ihre Haut schnitt – erreichte sie endlich den Taubenturm, der auf dünnen Holzpfosten stehend in die Höhe ragte.
Bruder Desiderius hatte ihn errichten lassen – jener Bruder, der einst mit dem großen Paulinus in Rom gelebt, das dortige Sankt-Andreas-Kloster aber verlassen und auf Wunsch des Papstes Gregor Paulinus nach Britannien begleitet hatte, um hier den christlichen Glauben zu verkünden. Desiderius hatte sich gefügt, obwohl ihm der Eifer von Paulinus fehlte und er nach zwei aufreibenden Jahrzehnten, da er gepredigt und getauft hatte, seinen morschen Gliedern und den Schmerzen, die diese bedingten, überaus dankbar war. So war ihm nämlich weiteres Reisen unmöglich, und er fand hier im Kloster eine sichere Zuflucht. Seinen Lebensabend verbrachte er nicht in Gedanken an die vielen von ihm bekehrten Heiden von Northumbrien, sondern mit der Erinnerung an Rom und an die naturwissenschaftlichen Studien, die er dort betrieben hatte. Dazu gehörte auch das Wissen, dass man jene grauen Vögel, welche Tauben hießen, eindrucksvoll dazu erziehen konnte, als Boten Briefe zu überbringen. Was im alten Imperium noch üblich war und geholfen hatte, manchen Krieg zu gewinnen, stieß hierzulande auf Misstrauen. Doch man gönnte dem alten Mann die Marotte, einen Taubenturm zu bauen und die Vögel zu züchten, und wiewohl es ihm nie gelungen war, eines der grauen Tiere, die dort droben in den Verschlägen nisteten, zum eigentlichen Zwecke zu erziehen, lohnte sich das seltsame Konstrukt zumindest in dieser Nacht.
Als Bathildis es erreichte, richtete sie sich vorsichtig auf und griff nach einem der Holzpfosten. Wenigstens waren die Nonnen so klug gewesen, sämtliche Kerzen und Kienspäne zu löschen – auch wenn dies bedeutete, dass sie sich mehrmals den Kopf anschlug und nicht erkennen konnte, wie sie hochsteigen sollte. Etwas Klebriges rann ihr von der Stirne. Sie konnte es nicht sehen, aber es musste wohl der weiße Kot des Vogelviehs sein.
»Bathildis!«, raunte eine Stimme. Sie wusste nicht, wer es war. »Bathildis! Komm herauf zu uns!«
Endlich ertastete sie im Finstern eine Holzleiter.
Sie kletterte vorsichtig, Stufe für Stufe; es gelang ihr sogar, für einen Augenblick die Bedrohung in ihrem Rücken zu vergessen, weil sie sich ausschließlich darauf konzentrierte, das Bündel mit den Altargegenständen festzuhalten. Kaum auszudenken, es hätte sich geöffnet und sämtlicher Inhalt wäre in den Taubenkot gefallen – und das vor den Augen der Nonnen.
In der Mitte angekommen, wurde es ihr gottlob abgenommen. Suchende Hände griffen auch nach ihrem Leib, zogen sie hoch, und schnaufend konnte sie sich nach weiterem Klettern endlich auf die knirschenden Holzbalken fallen lassen. Eng war die Fläche, auf der sich die Nonnen zusammengerottet hatten; man konnte kaum hocken, eigentlich nur liegen. Keine wagte, sich zu regen, aus Angst, der klapprige Verschlag könnte in sich zusammenbrechen.
Waren die Angreifer schon auf dem Weg zu ihnen? Klangen Geräusche herauf? War es nur die Brandung, die in der Ferne raunte, oder Boote, die gegen den Grund schlugen, Schritte, die über das Geröll des Strandes stiegen?
Bathildis fühlte, wie eine Hand nach ihr fasste, die ihre umklammerte und nicht mehr losließ. Hereswith. Ihre gleichaltrige Gefährtin, die wie sie aus Northumbrien stammte. Bis auf die gemeinsame Herkunft gab es wenig, worin sich die Mädchen ähnlich waren, doch weil sie im Dormitorium nebeneinander schliefen, wie sie auch nebeneinander aßen, beteten und ihre Aufgaben erfüllten, hatten sie sich so aneinander gewöhnt, dass sie zu Freundinnen geworden waren.
Hereswith war auch an gewöhnlichen Tagen viel sanfter, mutloser, schweigsamer als Bathildis, in dieser Nacht wurde sie jedoch fast wahnsinnig vor Furcht.
Bathildis spürte Hereswiths Fingernägel, wie sie sich in ihr Fleisch krallten, hörte in der Stille nichts als ihren keuchenden Atem, dann wurde jene plötzlich unterbrochen – von einem deutlich artikulierten Gebet.
»Exaudi Deus orationem meam et ne despexeris deprecationem meam. Conturbatus sum a voce inimici et a tribulatione peccatoris ...« Gott, erhöre mein Gebet, verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Das Geschrei der Feinde verstört mich; mir ist angst, weil mich die Frevler bedrängen.
Bathildis’ Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, und sie rappelte sich auf, um zu sehen, wer diese Worte sagte. Manche der Nonnen starrten mit aufgerissenen Augen wie Tote; andere hatten diese zusammengepresst, als könnten sie sich solcherart von der Welt fortstehlen, in der Raub und Schändung und Ermordung drohten. Ein paar wenige nickten im Takt der Silben – ausgesprochen von der ziegengesichtigen Godiva, die als Einzige kniete und die Hände zum Gebet verschränkt hielt. Bathildis ahnte, dass es ein Psalm war, mit dem jene den himmlischen Beistand herbeirufen wollte, doch in jenem Augenblick deuchten die Worte sie das Dümmlichste, was sie je vernommen hatte. Jedes einzelne war zu viel gesprochen. Jedes einzelne konnte dazu führen, dass sie aufgestöbert wurden.
»Hör zu beten auf!«, zischte sie, erstaunt über die schneidende Stimme und auch darüber, dass sich zu der bodenlosen Angst auch ein Gefühl von Wut mengte.
Überrascht hob Godiva ihr längliches Gesicht.
»Wer kann uns jetzt noch helfen, wenn nicht der Allmächtige?«, fragte sie, ohne daran zu denken, dass sie sich vor einer wie Bathildis nicht zu rechtfertigen hatte.
»Der Allmächtige hat mir die Eingebung geschenkt, dass wir hier Zuflucht finden können! Also verrate uns nicht mit lauten Worten!«
Einen Augenblick schwieg Godiva, schien sich der Forderung zu beugen, um freilich schon im nächsten fortzufahren; diesmal war ihre Stimme nicht zitternd und bangend, sondern klar und laut.
»Exaudi Deus orationem meam et ne despexeris ...«
»Still!«, fiel Bathildis ihr ins Wort.
Es war nicht das Einzige, was sie tat, um die andere zum Schweigen zu bringen. Sie wusste kaum, was geschah, da ertönte schon ein leises Aufklatschen, mit dem sie Godiva einfach die Hand auf den Mund geschlagen hatte und ihn zuhielt.
Die andere wand sich ärgerlich, jedoch nicht lange. Denn just in diesem Augenblick ertönte ein lautes Hämmern und Krachen und Getrampel, gleich so, als würde ein ganzes Heer aus dem Nichts einfallen. Der Boden erzitterte unter Schritten und gab das Beben auch an die Holzwände weiter, die ihnen Schutz gewährten.
Die Kapelle, das Männerkloster, das Frauenkloster.
Verschlossen einzig von Holztoren.
Schon war ihr Knirschen zu hören, als sie gewaltsam aufgebrochen wurden und die fremden Angreifer mit lautem Gejohle in die Gebäude stürmten.
Während die Nonnen entsetzt aufstöhnten, störte sich Bathildis nicht an diesem Laut. Jeder war ihr recht, wenn er nur weit genug von ihnen entfernt war!
Nur – lösten sich da nicht einzelne Schritte aus dem allgemeinen Getrampel? Näherten sie sich dem Taubenturm, langsam, vorsichtig spähend – aber unausweichlich?
III. Kapitel
Die Nacht währte endlos. Sie färbte jedes Geräusch dunkler, das bei Tageslicht erlauscht zwar nicht weniger erschreckend, aber doch weniger unheimlich in ihrer aller Ohren geklungen hätte.
Aus welchem Höllenkrater die Horde dort unten auch immer erstanden war – ihr Handeln war nicht ohne Ordnung. Wahrscheinlich waren sie nicht zufällig an jenem Punkt der Küste gestrandet, sondern angelockt von dem Gerücht, dass jenes Doppelkloster über all die Jahre seines Bestehens manche Schätze zusammengetragen hatte. So planmäßig, wie sie lautlos näher gekommen und die Heilige Stätte umkreist hatten, um dann zu einem jähen, überraschenden Angriff überzugehen, war denn auch ihr weiteres Tun. Erkennend, dass sie auf leere Mauern trafen, nutzten sie nicht nur die dunkle Nacht, sondern auch das verräterische Morgengrauen, um Stein um Stein zu wenden und nach allem zu suchen, was für sie Wert besaß.
Es waren nicht die heftigen Laute, die den lauschenden Nonnen am meisten zusetzten, sondern die leisen. Mehr als einmal kam einer der Angreifer dem Taubenturm gefährlich nahe. Noch Tage später brannte das Geräusch der forschen Schritte in Bathildis’ Ohren wie ein steter Schmerz. Allesamt wagten sie es nicht, durch die Luken zu spähen oder sich gar hinunterzubeugen, sondern duckten sich im engen Raum. Und doch war Bathildis später, sie hätte ihn selbst gesehen – jenen Mann, aus einem Land im Norden jenseits des Meeres stammend, der den Taubenturm als Einziger betrat und der prüfend die Holzleiter ertastete, auf der sie kurze Zeit zuvor nach oben geflohen war. Selbst Godiva, die sich ob Bathildis’ unbotmäßigem Betragen noch nicht wieder beruhigt hatte, hockte in diesem Augenblicke bebend. Angstschweiß perlte von ihrem länglichen Gesicht. Bathildis konnte ihn riechen – desgleichen die Ausdünstungen des Mannes, salzig wie das Meer und verdorben wie dessen Schlamm.
Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ging ihr ein ums andere Mal durch den Kopf. Ich will mein künftiges Leben noch kennen lernen ... meinen Vater ... o, wärst du hier und würdest mich beschützen!
Hereswith, die ängstliche Gleichaltrige, hielt wieder ihre Hand und drückte sie so fest, dass Bathildis vermeinte, alle Knochen müssten ihr brechen. Sie ertrug den Schmerz gerne; er lenkte sie ein wenig von der Furcht ab, und Hereswiths Körper, der sich an sie presste, schenkte die Gewissheit, dass sie nicht alleine war in ihrer Not.
Dann – wieder ein Geräusch. Das Gebälk erzitterte.
Wer immer sich dort unten genähert hatte, schien bereits auf der untersten Stufe der Leiter zu stehen, vorsichtig sein Gewicht zu verlagern, um zu prüfen, ob sie denn stabil genug sei, ihn zu halten.
Und jetzt – setzte der Fremde nicht schon seinen Fuß auf die zweite Stufe?
Der Augenblick schien ewig zu dauern, und das quietschende Geräusch, das nun ertönte, war laut wie ein Knall.
Schon vermeinten die Nonnen, dass sich der Kopf eines Angreifers sogleich nach oben schieben und sie entdecken müsste, doch was nun folgte, war kein neuerliches Knacken der Leiter, sondern ... Schritte. Diesmal leiser werdend. Ein Knirschen auf einem Boden, dessen Gras oft von dicken Schichten weißen Sandes bedeckt war. Der Mann hatte der Leiter nicht getraut.
Er geht weg, durchfuhr es Bathildis, und sie lauschte so angestrengt, bis ihr der Schädel zu platzen drohte, gleich so, als wäre der Wurm vom Magen in den Kopf gekrochen, um dort zu wüten.
Irgendwann gab es nichts mehr zu erlauschen, weder Schritte noch Gegröle noch Bersten noch Brechen – nur die Vögel schrien pfeifend und hoch, im fernen Wald und vom Meer.
Bathildis hielt die Augen geschlossen, um die Stille – bar sämtlicher anderer Eindrücke – genauer zu erforschen. Konnte es sein, dass die wilden Räuber fort waren? Dass sie das Wenige, was das Kloster besaß, genommen hatten und nun enttäuscht und immer noch hungrig nach Reichtümern weitersegelten?
Sie wagte nicht, diese Frage laut zu stellen. Keiner wagte das – auch als die Sonne hoch am Himmel stand, später die Himmelsleiter wieder herabkletterte und es dunkelte. Auch als das Morgengrauen die zweite Nacht beendete, die sie im Taubenturm zubrachten, wagten sie keine Geräusche zu machen. Niemand beklagte seinen Hunger und den Durst, wiewohl beides Stunde um Stunde unerträglicher wurde. Mit der Zeit roch es scharf nach Urin.
Godiva war die Erste, die in der Mittagszeit des zweiten Tages schließlich das Wort erhob. Fast trotzig begann sie wieder, in die ächzende Stille zu beten: »Redimet in pace animam meam ab his qui adpropinquant mihi quoniam inter multos erant mecum.«
Er befreit mich, bringt mein Leben in Sicherheit vor denen, die gegen mich kämpfen, und wenn es auch viele sind.
Niemanden gab es diesmal, der sie zum Schweigen bringen wollte. Die Anspannung löste sich; manche Träne kullerte, und schließlich stimmten zwei oder drei der anderen in das Gebet ein.
Als verhießen die gemurmelten Worte genaue Befehle, was nun zu tun wäre, begann die Äbtissin, den gekrümmten Rücken zu strecken und schließlich als Erste die Holzleiter hinabzusteigen. Vielleicht wäre es klüger gewesen, hernach zu warten, ob sie denn ein Zeichen gäbe, dass alles friedlich wäre. Aber nach dem langen Ausharren war kein Halten mehr.
Kaum hatte Eadhild wieder sicheren Boden unter den Füßen, stürmten auch die Nonnen hinab, eine nach der anderen, und was Bathildis, die als eine der Letzten ins Freie trat, dann erschaute, war ein gar merkwürdiger Tanz, wie von armen Geistern, die keine Ruhe finden.
Keiner konnte hernach sagen, wer angefangen hatte. Aber eine der Nonnen, ansonsten gewiss still und demütig, begann zu kreischen, die Hände wie irr über den Kopf zu recken und – sich im Kreise drehend – auf den Boden zu stampfen. Die anderen folgten mit nicht minder seltsamen Verrenkungen, mit Geheule oder mit Gelächter, indem sie liefen oder sich auf die Erde warfen. Manche hob gar ihre graue Kutte, sodass man die dunklen Haare ihrer Scham sehen konnte – und niemand verbot es, als wäre in diesem einen köstlichen Augenblick sämtliche Ordnung der Welt aufgehoben, jedes göttliche Gebot und alle überlieferten Sitten.
Die meisten hatten nie zuvor in ihrem Leben so laute Geräusche gemacht, so wilde Bewegungen vollzogen – und auch später würden sie es nie wieder tun. Später galt es, den schrecklichen Überfall zu betrauern, die entweihte Kirche entsetzt zu mustern und schließlich das Zerstörte wiederaufzubauen. Aber in diesem einen Augenblick gab nichts anderes den Takt vor als eine wilde, ungezähmte Lebensfreude.
Nur Bathildis stand steif. Der dunkle Wurm der Angst war weg – doch mit ihm schienen alle Glieder eingeschlafen zu sein und alle Gedanken abzusterben. Der Vater, den sie so eindringlich beschworen hatte, wurde wieder eine nebelige Gestalt, und die Taten der vergangenen Nacht schienen so befremdlich, dass eine Doppelgängerin sie ausgeführt haben musste.
Sie kam erst wieder zu sich, als Hereswith wieder ihre Hand packte und sie drückte, diesmal nicht ängstlich, sondern freudig.
»Du hast uns gerettet«, stammelte sie. »Wenn du nicht gewesen wärst ... wenn du die Schiffe nicht gesehen hättest, Gott allein weiß, was dann mit uns geschehen wäre. Ja, du hast uns gerettet!«
Der Stolz, der Bathildis befiel, war gemächlicher als die Lebensgier der anderen. Er reichte jedoch, dass sie den Hals reckte.
»Ja«, sagte sie, ohne Scheu vor der Sünde des Hochmuts, »ja, das habe ich wohl.«
Einen kurzen, trügerischen Moment lang dachte sie, dass sie in den letzten zwei Tagen das Schrecklichste in ihrem ganzen Leben erlebt hatte und dass sie – es solcherart hinter sich gebracht – keine Angst mehr haben müsste vor der vagen Zukunft. Das stimmte sie unendlich erleichtert. Und irgendwie enttäuscht.
In den Tagen nach dem Überfall war Bathildis seltsam träge. Zuerst schien es ihr, als hätten sich sämtliche Kräfte in ihrem mutigen Handeln erschöpft und müssten erst wieder neu gesammelt werden, ehe sie in den alten Takt zurückfände. Doch irgendwie, so deuchte es sie nach einer gewissen Zeit, gab es diesen Takt nicht mehr.
Was früher Ruhe und Sicherheit verheißen hatte – das gemeinsame Gebet oder das Feiern der Messe, die Lektüre der Kirchenväter und der Bibel, das Mahl im Refektorium oder das Ruhen im Dormitorium –, schien ins Leere zu lenken, was da plötzlich in ihr steckte oder auf den Schultern hockte: etwas Ungebärdiges, Machtvolles, Starkes. Etwas, das ihr den Mut gegeben hatte, die leere Kapelle zu räumen, allein zum Taubenturm zu schleichen und Godiva den Mund zuzuhalten. Etwas, das sich immer noch zu entladen suchte, in ähnlich grotesker Weise, wie die Nonnen nach den schrecklichen beiden Nächten getanzt hatten – und das sich im neuerlichen Alltag doch keinen Weg zu bahnen vermochte.
Der Überfall wurde ausgiebig den Mönchen berichtet, als jene am nächsten Tag von ihrer Wallfahrt heimkehrten, und jene vergingen eine Weile in dem Zwiespalt, Gott für die Rettung der Schwestern zu danken und zugleich die Spuren der Verwüstung zu beklagen, die alsbald beseitigt werden sollten: Sämtliche Tore waren eingeschlagen, die Vorratskammern geplündert, die Kirche verwüstet, die Ställe leergeraubt. Einzig die Schlafsäle waren heil geblieben, weil es dort nichts zu holen gab ... und auch das Skriptorium mit den Büchern hatte das Interesse der Angreifer nicht auf sich gezogen.
Ja, es wurde eifrig geklagt. Sobald der erste Schrecken aber ausgestanden war, so befand die Äbtissin Eadhild und teilte es ihren Nonnen mit, sollte nie wieder von dem Ereignis gesprochen werden.