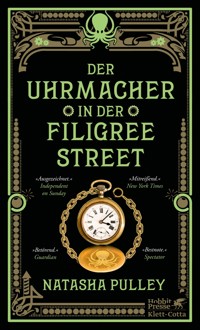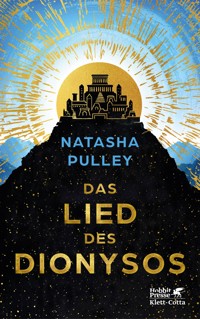
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Natasha Pulleys phantastischer wilder Dionysos wird Sie völlig in seinen Bann ziehen!« Luna McNamara Der junge Krieger Phaidros rettet in Theben ein ausgesetztes Baby, von dem eine ganz eigenartige Faszination ausgeht, vor dem sicheren Tod und bringt es zum Tempel der Artemis, in dem verwaiste Kinder aufgezogen werden. Wer kann schon ahnen, dass mit dem kleinen Jungen unvergleichliches Unheil über ganz Theben, ja über der ganzen Welt aufzieht. Was hat es mit dem Findlingskind auf sich? Ist es ein Bastard oder vielleicht gar von Zeus gezeugt? Jahre später, Troja ist gefallen und die Soldaten um Phaidros rüsten die Schiffe zur Heimfahrt. Da begegnen sie auf einer Insel einem seltsam schönen Jüngling und nehmen ihn gefangen. Ihm droht nun das Los als, Sklave verkauft zu werden, - was für ein Frevel! Das Kentern des Schiffs ist erst der Beginn einer verheerenden Rache, des gedemütigten Dionysos. Über Theben breitet sich eine nie dagewesene Dürre aus. Aber noch schlimmer: Eine seltsame Macht ergreift Gemüt und Verstand der Menschen, der Wahnsinn geht um. Und doch hängt das Herz von Phaidros an dem Gott, der ihm in vielerlei Gestalt begegnet. Natasha Pulley erzählt so spannend und lebendig von der Antike, als wäre es es gestern gewesen. »Ein schillerndes Labyrinth von einem Buch, das einen nicht loslässt. Pulleys phantastischer wilder Dionysos die Leserinnen völlig in seinen Bann ziehen, und Phaidros sprühender Geist und Humor schlägt einen auf jeder Seite. Eine überwältigende Hommage an den Gott des göttlichen Wahnsinns.« –Luna McNamara, Autorin von PSYCHE AND EROS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Natasha Pulley
Das Lied des Dionysos
Aus dem Englischen von Michael Pfingstl
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Hymn to Dionysus. A Novel« in Great Britain im Verlag Gollancz an imprint of the Orion Publishing Group, London, Ireland, Hachette Dublin
© 2025 by Natasha Pulley
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Klett-Cotta Verlag, Stuttgart unter Verwendung der Daten des Originalverlags, Cover-Design: © Rachael Lancaster/The Orion Publishing Group, Cover-Abbildungen: © Shutterstock
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96684-8
E-Book ISBN 978-3-608-12471-2
Für alle, die sich nach etwas mehr Dionysos in ihrem Leben sehnen.
Prolog
μῆνιν ἄειδε θεὰ
»Sing mir von Zorn, Göttin«
ILIAS, Zeile 1
Unsere Barden rufen immer die Muse an, um den Anfang zu finden, aber der große Witz daran ist – und ich meine Witz hier im weitesten Wortsinn –, dass sie nie mit dem Anfang beginnen. Finde den Anfang, Muse, sagen sie, doch dann heißt es plötzlich, Nach sieben Jahren aufregender Abenteuer, von denen ich euch leider nichts erzählt habe, waren da diese Hexe und ein Mann …, und sie sehen dich mit schlau funkelnden Augen an.
Aber das ist nicht schlau. Es ist ärgerlich.
Ich werde am Anfang beginnen, denn ich bin ein Krieger und mir wurde beigebracht, ordnungsgemäß zu berichten, in der richtigen Reihenfolge und ohne lange um den heißen Brei herumzureden. Ich werde keine Details kunstvoll weglassen, um sie dann später selbstgefällig nachzureichen. Ich werde auch nicht in Gedichtform vortragen, denn das tut man nur bei Dingen, die erfunden sind. Ich werde einfach erzählen, wie es war.
Eines jedoch verspreche ich euch. Ich werde das Gleiche tun wie die Barden, wenn sie ihre dämliche Einleitung endlich hinter sich haben:
Ich werde euch von Zorn erzählen und von einem komplizierten Mann.
1
Mein Name ist Phaidros. Ich wurde in die Furien hineingeboren, die vorderste Legion des thebanischen Heers. Mein Kommandant war der fröhliche Fabulant Helios, und seine Kommandantin wiederum war Artemis, die berühmte Dame, die zehn Jahre in Folge den Bogenschießwettbewerb bei den Orakelspielen gewann. Ich weiß, dass die Leute normalerweise immer dazusagen, wer ihre Eltern und Großeltern waren, aber so funktioniert das bei den thebanischen Legionen nicht. Ich habe keine Ahnung, wer meine Eltern waren. Ich kam auch erst darauf, mir diese Frage überhaupt zu stellen, als ich schon älter war. Helios erzählte mir jedes Mal etwas anderes – je nachdem, welcher Stimmung er gerade war. Vielleicht war ich der Sohn einer Prinzessin, vielleicht hat er mich auch auf einem Misthaufen hinter einer geplünderten Stadt gefunden. Oder er war mit meiner Mutter befreundet, die ebenfalls Kriegerin war und mich mit einem kauzigen Sklaven bekommen hatte, den niemand mochte, weil er unbedingt seinen eigenen Käse herstellen musste. Helios wollte mich damit nicht ärgern, sondern mir etwas vermitteln: Wo und von wem thebanische Krieger geboren werden, spielt keine Rolle.
Wir waren gar nicht mal so wenige – ein Haufen kleiner Krieger, die zwischen den Zelten aufwuchsen. Es war fantastisch. Andere erzählen mir davon, dass sie in Häusern aufgewachsen sind und bei Lehrern in die Schule gingen, die ihnen Rechnen beibrachten und wie man die Menschen belügt. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Wir sind viel herumgerannt, haben im Meer gespielt, haben beim Rüstungenpolieren und Pfeilemachen geholfen, und unsere Kommandanten haben nach dem Kampf immer Honigkuchen und Spielzeug in den Trümmern versteckt. Deshalb habe ich große Schlachten schon immer so geliebt. Und ich habe jede Menge interessante Leute kennengelernt. Wenn man fünf Jahre alt ist, gibt es nichts Besseres auf der Welt als ein buchstäblich gefesseltes Publikum, das an einen Ruderriemen gekettet vor dir sitzt und keine Möglichkeit hat, all deinen Fragen darüber zu entkommen, wie es ist, an einem Ort aus Stein zu leben.
Die älteren Krieger sagten, wir kämen auch von so einem Ort: Theben. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Theben lag irgendwo im Westen, es war die Stadt, wohin all die Sklaven, das Getreide und Silber geschickt wurden, doch wir kamen nie weiter als bis zu den Häfen, wo wir alles auf Karren verluden und dann wieder in See stachen. Ich fand Städte beängstigend. Städte waren zum Plündern und Anzünden da. Ich konnte mir nicht ausmalen, warum man freiwillig in einer leben sollte. Ich stellte mir vor, dass es eine Mischung aus Zufall und Dummheit sein musste, die Leute dazu brachte, sich an einem Ort voller Silber und Lagerhäuser und schöner Menschen niederzulassen, die eine Menge Gold einbrachten, wenn man sie in Ägypten an die richtigen Leute verkaufte.
Dionysos begegnete ich zum ersten Mal, als ich das erste Mal in Theben war.
Ich war ungefähr vier, als unsere Legion schließlich die Erlaubnis erhielt, nach Theben zurückzukehren. Wir hatten schon davor viel Landgang gehabt, aber jedes Mal an einem anderen Ort und meistens in der Nähe unseres letzten Raubzugs. Doch das hier war ein richtiger Urlaub und das erste Mal seit meiner Geburt, dass die Krieger nach Hause gehen und ihre Familien sehen konnten. Das mag hart klingen, doch fünf Jahre sind eine ganz normale Zeitspanne dafür. Die Welt ist groß und Poseidon ist nachtragend. Man konnte nicht damit rechnen, früher wieder zurück zu sein.
Die allgemeine Stimmung war eine Mischung aus Vorfreude und Angst. Kriegerinnen machten sich Sorgen, ihre Männer könnten es satt gehabt und eine andere geheiratet haben, oder dass die ehemalige Kommandantin vielleicht zornig wäre, weil sie so lange nichts von sich hatten hören lassen. Ehrbare Krieger zerbrachen sich den Kopf darüber, welches Geschenk sie ihrem Kind mitbringen sollten, das sie noch nie gesehen hatten. Um dir eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie groß das Ereignis war: Ich habe buchstäblich keine Erinnerung an irgendetwas davor. Ich habe immer zu Helios gesagt, er hätte mich während dieser ersten fünf Jahre ebenso gut in eine Kiste stecken und sich eine Menge Ärger ersparen können. Ich weiß absolut nichts mehr aus dieser Zeit. Theben überstrahlt alles andere.
Versteh mich nicht falsch: Theben mag meine erste Erinnerung sein, aber niemand kann zuverlässig von Dingen berichten, die ihm widerfahren sind, als er fünf war. Der einzige Grund, warum ich es doch kann, ist, dass Helios mir in den Jahren darauf immer wieder davon erzählt hat. Es wurde gleichsam zu einer Gutenachtgeschichte, genauso etabliert wie die Geschichte vom Tod und dem Mädchen, die, wie Hermes zum Gott wurde, oder die von Artemis und dem arroganten Jäger. Helios wollte absolut sichergehen, dass ich es nicht vergaß, und meißelte es in meine Seele, damit ich mich immer erinnern würde, warum wir nicht zurückkonnten.
Helios war in der eigenartigen Lage, eine Zwillingsschwester zu haben, die keine Kriegerin war. Sie lebte in Theben, und wir wollten sie besuchen. Es schien mir absurd, dass die beiden getrennt worden waren, doch Helios neigte nur den Kopf und sagte, andere Leute hätten eben andere Aufgaben im Leben. Dann eilten wir vom Schiff, um vor all den Menschenmassen in der Stadt zu sein. Wir mieteten ein Pferd von einem Mann, der kein gewöhnliches Eisengeld akzeptierte, nur Silber oder Gold, obwohl uns verboten war, welches zu besitzen. Das hatte damit zu tun, dass er in verschiedenen Städten Handel trieb, und mit etwas Kompliziertem, das Helios »Wechselkurs« nannte und mir erfolglos zu erklären versuchte, nachdem er völlig illegale Silberklumpen auf die winzige Waage des Mannes gelegt hatte. Damals verstand ich nicht, warum er so viel Mühe darauf verwendete, es jemandem zu erklären, der nichts anderes wollte, als nervös herumzuzappeln. Aber ich verstehe es jetzt. Hätte ich irgendjemandem gegenüber erwähnt, dass er Silber bei sich trug, wäre er verhaftet worden. Doch ich war abgelenkt von einem kleinen grünen Vogel, und Geld war langweilig.
Das erste Mal, dass ich Theben sah, war von der Kuppe des steilen Hügels vor dem Bernsteintor aus.
Theben ist ein seltsamer Ort. Es liegt in einem Tal am Fuß des Harfnerbergs mit seinen heiligen Hainen und wird aus irgendeinem Grund trotzdem immer von der Sonne beschienen. Ich glaube, selbst ein Fremder merkt, dass die Stadt nicht auf die übliche Weise entstanden ist – weil die Menschen zum Bauen geeignete Steine oder fruchtbare Böden vorgefunden hätten. Es fühlt sich anders an.
Einst legte ein Krieger aus Asien, König Kadmos, an den hiesigen Quellen eine Pause ein. Dort war ein Drache, der ihn nicht ans Wasser lassen wollte. Nachdem Kadmos den Drachen getötet hatte, sagte Athene zu ihm, er solle dessen Zähne nehmen und sie aussäen. Es wuchsen Menschen daraus, Krieger von einer Kraft und Gewandtheit, wie man sie nie zuvor gesehen hatte. Auf sie geht unser Kriegergeschlecht zurück, was auch der Grund ist, warum wir »die Gesäten« genannt werden. Helios erzählte mir die Geschichte, während wir den Hügel hinunterritten.
Theben ist also eine heilige Stadt, erwachsen aus Drachenzähnen, die auf Geheiß der Göttin des gerechten Kriegs ausgesät worden waren. Es gibt prächtigere Orte – alle sagen, die Welt drehe sich um Memphis und dass sich mächtige neue Königreiche aus dem Sand in Kanaan erhöben – aber es gibt mit Sicherheit keinen seltsameren. In keiner anderen Stadt gibt es so viele Tempel wie Streitwagen, und in keiner ist die Luft so von Wundern aufgeladen. Es ist das gleiche Prickeln, wie du es verspürst, wenn du zwei Bernsteine aneinander reibst und sie dann über die Härchen an deinem Arm hältst.
Und obwohl ich noch so klein war, spürte ich es. Vielleicht lag es zum Teil daran, dass alles so fremd war. Ich war damit aufgewachsen, Teile des Hatti-Reichs zu plündern oder auch die goldgetränkten Orte an den Ufern des Nil. Ich war an den Anblick ägyptischer Gottheiten und den hattischer Kriegerstatuen gewöhnt, die in schweren Kettenhemden die Stadttore bewachten. Ich wusste nicht, dass es ähnliche Orte gab, die uns gehörten. Ich hatte unsere Götter nie in Marmor oder Bronze gesehen. Für mich waren sie Wesen, die man manchmal kurz in der Ferne als Hitzeflimmern in der Wüste sah, oder in einem Blitz. Wilde Wesen.
Aber da waren sie: Eine Bronzestatue von einem riesigen Reiter auf einem riesigen Pferd stand vor dem Stadttor. Die Straße führte unter dem Hals des Pferdes hindurch.
»Das ist Herakles«, erläuterte Helios. »Möchtest du was Lustiges sehen?«
»Was denn?«
Er dirigierte unser Pferd näher an Herakles heran, woraufhin die Bronzestatue ganz langsam den Kopf in unsere Richtung neigte, ein freundlicher und höflicher Gruß.
Ich wäre beinahe aus dem Sattel gefallen. »Er lebt!«
»Das nennt man ein Wunderwerk«, erwiderte Helios. »In der Statue gibt es spezielle Vorrichtungen, die Wasser in Bewegung setzen, das wiederum Räder antreibt, die die Statue bewegen. Sie sind sehr heilig. Wenn du eine davon siehst, musst du aufpassen, sie nicht zu berühren, verstanden? Machst du sie kaputt, lädst du einen Fluch auf dich.«
Ich starrte die Statue an, sicher, dass Herakles uns verfolgen würde. Helios drückte mich, dann ritten wir durchs Stadttor. Herakles zum Glück nicht.
Später, als wir wieder entlang der Küste auf Raubzug gingen und er mir die Geschichte wieder und wieder erzählte, gehörte das Wunderwerk Herakles zu meinen Lieblingsstellen. Wenn man an seinen Kommandanten gekuschelt im Bett liegt und die Wachen draußen groß und stark an den Feuern stehen, können gruselige Geschichten über Riesen sehr gemütlich sein.
Die Städte in Achaia bestehen meist aus zwei Teilen. Zum einen gibt es die Unterstadt, in der die meisten Menschen leben. Die Unterstadt von Theben kam mir vor wie ein Labyrinth aus steinernen Pfaden, ganz ähnlich wie die Tunnel im Inneren eines Knochens. Sie war voller Leute, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Überall waren alte Menschen mit grauen Haaren. Sie waren weder getötet worden, noch hungerten sie. Sie sahen sogar recht gesund aus, manche davon trugen feine Gewänder und Goldschmuck. Männer und Frauen kleideten sich unterschiedlich und trugen keinerlei Rüstung, was mir riskant erschien. In den Brunnen spielten Kinder, die keinen Kommandanten zu haben schienen. Auf den Stufen eines großen Tempels saß eine Gruppe Priesterinnen in strahlend roten Roben in eine Partie Mikado vertieft. Nichts brannte, und niemand rannte vor uns weg. Jungen in dunkler Kleidung und mit Eisenringen um den Hals verneigten sich vor uns. Sie waren unglaublich blass, wie Schaum auf den Wellen, und sie hatten helles Haar, das unecht aussah. Ich reckte den Kopf und schaute ihnen hinterher, während ich herauszufinden versuchte, ob sie normal waren oder so etwas wie Ungeheuer.
»Sie kommen von den Zinninseln«, sagte Helios zu mir. Ich muss wohl besorgt ausgesehen haben. »Dort leben seltsame Leute. Ihre Haare sind weiß, wenn sie klein sind, und werden mit dem Alter dunkler.«
Manchmal erfand er einfach Dinge, doch diese Jungen hatten wirklich entsetzlich farblose Haare und entsetzlich farblose Augen. »Igitt«, erwiderte ich.
Und über alldem ragt die Oberstadt mit dem Palast und manchmal auch dem größten Tempel auf. In Theben steht der Palast auf einem hundert Meter hohen Felsvorsprung über der Stadt. Helios dirigierte unser Pferd darauf zu, denn seine Schwester war die Königin. Als Vierjähriger fand ich das ganz normal.
Der Palast war nach König Kadmos benannt, der den Drachen getötet hatte, und hieß Kadmeia. Alles war aus kühlem, hellem Marmor. Ich drückte mich so fest an Helios, wie ich konnte. Das Einzige aus Marmor, was ich bisher gesehen hatte, waren Grabkammern. Außerdem lief ich nicht gerne über Stein. Er fühlte sich tot an. Aber es war gut, drinnen zu sein, denn es begann zu regnen, die Tropfen fielen glitzernd und klimpernd auf Helios’ Rüstung. Er schlug seinen Mantel um mich, dann schauten wir von der Treppe aus hinunter auf die Stadt und warteten auf seine Schwester. Er erklärte mir, was was war: der Tempel des Ares, ganz in weiß. Im Westen der Harfnerberg. Dort der heilige Wald, den nur Frauen betreten durften.
»Warum dürfen nur Frauen hinein?«
»Damit sie von uns getrennt sind. Andernfalls würden sie uns ins Gemüsebeet pflanzen.«
»Warum denn das?«, fragte ich verwirrt.
Helios lachte und entschuldigte sich, sagte, ich hätte ja recht, aber lästige Männer würden eben manchmal mit Gemüse verwechselt. Noch Monate danach ließ ich ihn meinen Körper beim Waschen nach verdächtig aussehenden Trieben absuchen, die darauf hindeuteten, dass ich möglicherweise etwas Böses getan hatte und dabei war, mich in eine Zwiebel zu verwandeln.
Ich war noch nie einer Dame begegnet. Alle Frauen, die ich kannte, waren ganz normale Frauen. Sie trugen Rüstung und verbrachten die meiste Zeit damit, Schiffe zu reparieren oder zu trainieren. Manchmal traf ich auch welche, die Sklavinnen waren und sehr viel arbeiteten. Als die Königin die Stufen zu uns herunterkam, begriff ich nicht gleich, dass auch sie ein Mensch war. Sie sah so anders aus. Sie war so sauber, wie ich noch nie jemanden gesehen hatte, und sie war atemberaubend gekleidet. Ihr Kleid war purpurn – echtes Purpurrot, ein Farbstoff, der so teuer ist, dass ich von Glück reden könnte, irgendwo eine purpurne Socke zu ergattern. Es wurde von einer goldenen Kordel und goldenen Nadeln zusammengehalten. Auch in ihren Haaren und an ihren Fingern war Gold. Ich presste mich an Helios’ Schulter. Das purpurne Gewand kam mir viel bedrohlicher vor als eine Rüstung, denn es schien mir für Dinge gemacht, die weit schwerer zu durchschauen waren.
»Das muss dein neues Mündel sein«, sagte sie zu Helios. Sie klang genauso wie er. »Ich kann nicht fassen, dass sie dir tatsächlich die Verantwortung für einen Menschen anvertraut haben.«
»Er ist noch ein sehr kleiner Mensch«, erwiderte Helios lachend und schloss sie in die Arme. Ich hasste es, zwischen den beiden eingeklemmt zu sein, denn seine Schwester roch nicht nach normalen Dingen wie Rüstungspolitur oder Schweiß, sondern nach Blumen und eigenartig rauchig – Räucherwerk, wie mir später klar wurde. Wenn Helios mir in den folgenden Jahren davon erzählte, entzündete er manchmal welches, damit ich mich an den Geruch erinnerte. »Das ist Phaidros. Phaidros, das ist Königin Agaue.«
Sie verbeugte sich vor mir, und ich erwiderte die Verbeugung, so gut es eben geht, wenn man vier ist und sich ängstlich an jemandes Brustharnisch festhält. Helios zerzauste mir die Haare, was seine Art war, mir zu sagen, dass ich meine Sache gut gemacht hatte.
»Phaidros. Bist du es auch?«, fragte sie. Phaidros bedeutet klug. »Bist du gut im Rätsellösen?«
Diesen Scherz bekam ich oft zu hören. »Nein, ich bin sogar ziemlich dumm«, antwortete ich, weil es so schneller ging und mir außerdem die Erniedrigung erspart blieb, wenn ich die richtige Antwort nicht wusste.
Sie lachte, und Helios gab mir einen leichten Klaps. »Ich bin sogar ziemlich dumm, Herrin.«
»Herrin«, fügte ich beschämt hinzu.
Das Seltsame an Erinnerungen ist, dass sie sich genau wie die Dinge in der echten Welt mit der Perspektive verändern. So kann ich mich erinnern, dass mir damals beide unfassbar erwachsen und glanzvoll vorkamen. Jetzt jedoch, in der Rückschau, waren auch sie damals nur Kinder. Sie müssen ungefähr fünfzehn gewesen sein.
Helios trug mich durch die schier unendlich großen Hallen hinaus in den Garten, wo es Gras und einen Brunnen gab, und er setzte mich erst ab, als der Boden unter unseren Füßen nicht mehr aus Stein war. Ich blieb in seiner Nähe, denn der Brunnen war mir nicht geheuer. Das Wasser darin bewegte sich von selbst, und ich verstand nicht, wie. Außerdem war eine Statue des Poseidon darin. Während ich hinsah, drehte sie den Kopf.
Ich zupfte an Helios’ Mantel.
»Ja, kleiner Krieger?«
Ich deutete. »Da ist ein Monster«, sagte ich so knapp und eindeutig, wie mir beigebracht worden war, auf gefährliche Dinge hinzuweisen. Einen heranjagenden Streitwagen zum Beispiel oder eine Wolke aus Pfeilen.
»Aber nein. Das ist ein Wunderwerk, genau wie Herakles. Komm, wir bringen Ihm ein Opfer dar. Es ist gut, die Priester haben Ihn gemacht. Er passt auf, dass …«
Ich versteckte mich in einer Hecke. Ehrbare Krieger schworen einen Eid, stets ehrlich zu sein, doch Helios’ Auffassung von Ehrlichkeit war fast genauso biegsam, wie es die von Dionysos später war. Ich war gerade alt genug, um zu begreifen, dass er manchmal aus taktischen Gründen log, damit er sich nicht in Momenten, in denen er keine Zeit dafür hatte, mit einem kleinen verängstigten Jungen herumschlagen musste. So war ich bis vor Kurzem der felsenfesten Überzeugung, dass feindliche Soldaten gerne mit dem Gesicht nach unten im Meer schwammen, um den Fischen Hallo zu sagen. Das konnten sie, weil sie nämlich Kiemen hatten. Nachdem ich mich dank meines immer besser werdenden Hattisch mit vielen fremdländischen Sklaven unterhalten hatte, kam ich jedoch zu dem Schluss, dass das mit den Kiemen nicht ganz so war, wie Helios behauptet hatte.
Er musste sich hinlegen, um mich sehen zu können. »Das ist kein Monster, ehrlich.«
»Du lügst, Herr.«
Er ließ den Kopf hängen. »Stimmt. Das tue ich manchmal.«
Die Königin hinter ihm überlegte kurz, und dann, ohne sich Gedanken über ihr purpurnes Gewand zu machen oder darüber, dass sie albern aussehen könnte, kletterte sie in den Brunnen, setzte sich auf Poseidons Schoß und legte Ihm ihren purpurnen Schleier um. Ich kicherte, und Helios auch. Dann spielten wir alle gemeinsam im Brunnen, und Poseidon schien es überhaupt nichts auszumachen. Helios gab mir eine kleine Holzperle, damit ich sie dem Wunderwerk in die Hand legen konnte, und erklärte mir, welches Gebet ich aufsagen sollte. Poseidon neigte höflich den Kopf, und ich war verzückt.
Der Regen wurde stärker, aber es war nicht kalt. Der Sommer war glühend heiß gewesen, selbst auf dem Meer, und der Regen war von der Art, wie er fällt, wenn er sich wochenlang am heißen Himmel und im sengenden Wind aufgestaut hat. Über der Stadt zogen sich dunkle Wolken zusammen – so dunkel, dass es auf dem Meer jetzt gefährlich würde. Wären wir auf dem Schiff gewesen, hätten wir jetzt die Küste angesteuert und uns eine seichte Bucht gesucht, wo der Sturm dem Rumpf nichts anhaben konnte. Ich warf einen ängstlichen Blick zu Poseidon hinauf und fragte mich, ob Er verärgert war.
Vom anderen Ende des Kreuzgangs kam eine Frau in unsere Richtung. Zuerst dachte ich, sie würde uns sagen, wir sollten aufhören, herumzualbern, und nach drinnen gehen, aber das tat sie nicht. Auch sie war eine Dame, ebenfalls in Purpur, und sie hatte ein Baby dabei. Sie setzte sich ein ganzes Stück von uns entfernt auf eine Bank. Helios schien gerade in einem Streit mit der Königin den Kürzeren zu ziehen, doch sie verstummten plötzlich. Ich schaute zwischen den beiden hin und her, unsicher, was vorging, und hätte zu gerne gefragt, ob ich mit dem Baby spielen dürfe.
»Sie hat es also behalten«, flüsterte Helios.
Um etwas zu tun zu haben, tätschelte ich inzwischen das Wasser. Es waren keine Fische darin, was ich schade fand. Ich schaute verstohlen hinüber und fand, dass das Baby toll aussah. Es war einigermaßen groß und nicht mehr ganz so zerbrechlich, aber immer noch klein genug, um alles und jeden interessant zu finden. Leider konnte ich nicht einfach rüberlaufen. Beim letzten Mal, als ich das tat, geriet ich unter einen Streitwagen, was genau das ist, was mit dummen Kindern passiert. Hier schien es keine Streitwagen zu geben, aber das hatte ich beim letzten Mal auch gedacht.
»Tja, so lautet das Gesetz«, flüsterte die Königin zurück. »Wenn der Vater ein Gott ist, kannst du es behalten.«
»Ich meine, ich erzähle den Kindern allen möglichen Blödsinn, aber ich glaube, selbst Phaidros ist alt genug, um das zu durchschauen.«
»Wozu bin ich alt genug?«, fragte ich, immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, mit dem Baby zu spielen, das mich jetzt anlächelte.
Helios saß auf dem Brunnenrand und hob mich mit einer für ihn völlig untypischen Unruhe auf seinen Schoß. Ich hatte das deutliche Gefühl, dass er am liebsten eine Mauer zwischen sich und der Dame mit dem Baby gehabt hätte. Ich wollte ihn gerne beschützen. Manchmal machte er sich grundlos Sorgen. Nach großen Schlachten mochte er keine lauten Geräusche, auch die Lagerfeuer mochte er dann nicht, und wenn es noch so kalt am Strand war.
»Das ist unsere Schwester«, erklärte er mir leise. »Sie sagt, das Baby wäre von Zeus.«
»Stimmt das?«, fragte ich.
»Wahrscheinlich nicht.«
»Ganz bestimmt nicht«, ergänzte die Königin fast ein bisschen schroff. »Sie terrorisiert die Sklaven seit Jahren.«
Ich schaute hinüber und stellte mir vor, wie die Dame aus dem Gebüsch gesprungen kam und die Gärtner schimpfte. Ich fragte mich, wie das damit zusammenhängen könnte, ein Baby zu bekommen. Dann fragte ich mich, warum Helios und die Königin so besorgt aussahen. Damen waren beängstigend. Babys nicht.
»Kann ich zu ihr und – «
»Nein. Auf keinen Fall.« Helios zog mich noch fester an sich und war plötzlich ganz angespannt. Ich würde zwar nicht mit dem Baby spielen können, aber ich war froh, mich wieder erwünscht und nützlich zu fühlen.
»Warum hast du Angst vor einem Baby?«, fragte ich.
Helios war nie von etwas überrascht, doch aus irgendeinem Grund nahm sein Gesicht einen eigenartigen Ausdruck an.
Der Regen wurde jetzt stärker. In der Ferne leuchteten Blitze, und es dauerte ein paar Sekunden, bis der Donner kam. Helios zuckte zusammen. Ich streichelte seine Hand. Er kam nicht gut mit Donner zurecht, obwohl er genau wusste, dass das nur Zeus war, der gerade tanzte.
Die Königin legte einen Arm um uns beide. »Keine Sorge«, sagte sie. »Bevor sie mir was tut, tue ich ihr was.«
Inzwischen war auch ein Mann nach draußen gekommen und hatte sich zu der Dame gesetzt. Er beugte sich über das Baby, begrüßte es und ließ es mit seinen Fingern spielen. Ich hasste ihn sofort, wie man jemanden hasst, der etwas tut, das man selber nicht darf. Erwachsene durften mit Babys spielen, wann immer sie wollten – sie konnten sogar eines machen, wenn sie wollten –, aber ich musste dasitzen, im Regen, festgeklemmt auf Helios’ Schoß, und durfte das nicht. Niemandem schien aufzufallen, wie unfair das war.
Es waren nicht mal Streitwagen in der Nähe.
Helios versteifte sich noch mehr. Normalerweise tat er das nur, kurz bevor er jemanden erschoss.
»Ist das ihr Ehemann?«, fragte ich und versuchte, möglichst alt zu klingen. In der Theorie wusste ich, was Ehemänner sind und dass möglicherweise von mir erwartet wurde, eines Tages selbst einer zu werden. Soweit ich es verstanden hatte, ging es darum, immer still und höflich zu sein und zu tun, was mir gesagt wurde, was ich in Ordnung fand, schließlich wurde von einem ehrbaren Krieger genau das Gleiche erwartet.
»Nein«, antwortete die Königin grimmig. »Das ist mein Mann.«
Ihre Antwort klang, als ginge es um etwas Wichtiges, aber ich wusste nicht, warum, und keiner der beiden erklärte es mir. Ich hielt den Mund und spürte Trotz in mir aufsteigen. Mich nicht mit dem Baby spielen zu lassen und gleichzeitig über Dinge zu sprechen, die ich nicht verstand, war ein bisschen viel verlangt.
»Agaue«, sagte Helios leise. »Lass uns nach drinnen gehen. Ich sitze hier in voller Rüstung und werde noch vom Blitz getroffen.«
Sie warf ihm einen seltsamen Blick zu, wie Leute es tun, wenn jemand das eine sagt und etwas völlig anderes meint. Aber alles, was sie erwiderte, war: »Du hast recht. Gehen wir.«
Ich hatte das starke Gefühl, dass die Worte der beiden nichts mit dem zu tun hatten, was sie tatsächlich meinten.
Verärgert über meine erfolglosen Versuche, ihre Unterhaltung zu begreifen, sah ich mich ein letztes Mal nach Streitwagen um – weit und breit keine Spur –, dann rannte ich zu der Dame und sagte: »Hallo, ich bin Phaidros und kann ich bitte dein Baby halten, weil Babys sind das Tollste überhaupt und ich bin sehr vertrauenswürdig und habe viel Erfahrung. Ehrlich.«
Helios würde es bald merken und sauer auf mich sein, aber bis dahin hätte ich mir zumindest eine Umarmung von dem Kleinen abgeholt.
Die Dame lachte, und selbst wenn Helios mir nicht gesagt hätte, dass sie die Schwester der beiden war, hätte ich es in diesem Moment erraten. Sie hatte genau die gleichen Zähne wie er und Agaue. »Aber natürlich, kleiner Krieger. Setz dich.«
»Das ist eine große Narbe für einen so kleinen Jungen«, sagte der Mann – der König –, so freundlich, dass ich darüber nachdachte, ihn vielleicht doch nicht mehr zu hassen. »Wie ist das passiert?«
»Da war ein Streitwagen und ich habe nicht aufgepasst«, antwortete ich abgelenkt, weil die Dame gerade ihr Baby auf meine Arme gelegt hatte, und es war ein tolles Baby. Der Kleine war schön schwer und fest, hatte schwarze Locken und unglaublich blaue Augen. Er war groß genug, um selber sitzen zu können und eine eigene Meinung über die Dinge zu haben. Vielleicht konnte er sogar schon laufen. »Hallo. Wie heißt du?«
Der Kleine kaute versuchsweise auf meinen Knöcheln herum und sah mich neugierig an. Ich drückte ihn, so fest ich mich traute, denn ich wusste, dass ich möglichst viel aus der Gelegenheit machen musste, bevor Helios mein Verschwinden bemerkte.
»Er hat noch keinen Namen. Hast du eine Idee?«
»Nein. Ich kenne mich mit Zelten aus, aber ich habe keine Fantasie.«
Beide lachten. Das Baby quiekte und tätschelte meine Hände. Ich grinste verliebt und verzweifelt zugleich. Das einzige Problem mit dem Kriegersein ist, dass Kommandanten immer nur ein Mündel haben dürfen. Ich würde nie Geschwister haben, obwohl das mein sehnlichster Wunsch war.
Helios entdeckte mich und kam angerannt, als wären der König, die Prinzessin und das Baby genauso gefährlich wie rasende Streitwagen.
»Phaidros!«, schrie er. »Bei Zeus … Verzeih, Semele. Er ist noch nie weggelaufen.«
»Aber das Baby …«, begann ich.
»A«, sagte der Kleine hilfsbereit, und ich drückte ihn an mich, damit niemand ihn mir wegnehmen könnte. Er grub die Finger in meine Haare.
»Ab mit dir, Krieger«, sagte Helios ungläubig.
»Ich darf dein Baby wahrscheinlich nicht behalten, oder?«, fragte ich die Dame. Manchmal wollten die Leute ihre Babys nicht. Vor den Mauern einer belagerten Stadt fand ich oft welche in Körben, und es schien mir den Versuch wert.
Sie lächelte. »Ich fürchte, nein. Du wirst Helios dazu bringen müssen, eines für dich zu machen.«
»Das dauert doch ewig«, antwortete ich traurig und gab den Kleinen zurück. Helios schubste mich vor sich her, und das Baby winkte.
»Schön, dich zu sehen!«, rief Semele uns in so sarkastischem Ton hinterher, dass sogar ich verstand.
»Warum freust du dich nicht?«, fragte ich ihn.
Helios nahm mich auf die Arme, damit wir schneller vorwärtskamen. »Wie wär’s mit, Es tut mir leid, dass ich nicht gehorcht habe und weggelaufen bin, Helios. Es geschah in einem Moment des Wahnsinns und ich werde es nie wieder tun, weil ich nicht möchte, dass du mich einen unnötigen Tod sterben siehst?«
»Ich habe sehr genau auf Streitwagen geachtet«, erwiderte ich kleinlaut. Meine Arme fühlten sich leer an ohne das Baby.
»Ach, richtig! Dann ist es also kein Problem, wenn du nachlässig bist, solange wir uns in Theben aufhalten, denn du wirst definitiv daran denken, wieder vernünftig zu sein, sobald wir wieder auf einem Schlachtfeld sind, wo dein kleiner Verstand sich selbstverständlich von nichts und niemandem mehr ablenken lassen wird?«
Die Erkenntnis brach über mich herein, dass mir wahrscheinlich nicht erlaubt werden würde, das Baby wiederzusehen. Es gab viele Dinge, die ich wollte, aber nicht durfte. Meistens, weil sie entweder teuer oder gefährlich oder unpraktisch waren. Das machte mir nichts aus, denn diese Dinge waren nicht wichtig. Aber das Baby war wichtig. Ich schaute niedergeschlagen zurück und presste mir die Hände auf die Augen. Ehrbare Krieger dürfen weinen, man darf nur kein Geräusch dabei machen, schließlich könnten Feinde in der Nähe sein.
»Ach, kleiner Krieger.« Helios hielt mich noch ein Stückchen höher und legte seine Stirn an meine. »Es tut mir leid. Zu Hause gibt es noch andere Babys, mit denen du spielen kannst. Du kennst doch Achill, meinen Freund aus der anderen Einheit. Er hat sich um ein Mündel beworben. Vielleicht hat er sogar schon eins, wenn wir zurückkommen. Das wird doch bestimmt toll, oder?«
»Ja«, antwortete ich und legte meinen Kopf von Trauer erfüllt an seine Schulter.
»Du und Babys«, sagte er und piekste mich, bis ich lachen musste.
Ich vergaß die Dame und das Baby und den Mann der Königin, denn im Inneren des Palastes war eine riesige Hündin, der es nichts ausmachte, wenn ich auf ihr ritt. Unter dem Einfluss dieser tollen Hündin und der Königin, die ihm lustige Geschichten erzählte, kehrte Helios’ normales, unbeschwertes Selbst zurück. Allerdings nicht so schnell, dass ich aufgehört hätte zu überlegen, was vorhin losgewesen war. Als er mich schlafen legte – direkt neben ihm und in einem echten Bett mit Beinen, die uns ein Stück über dem Boden liegen ließen, was aufregend war –, fragte ich noch einmal.
Helios gehörte nicht zu den Menschen, die meine Fragen einfach ignorierten, nur weil ich klein war, selbst wenn es sich um schwierige Fragen handelte. »Der Palast ist ein gefährlicher Ort«, antwortete er schließlich. »Ich vergesse immer, wie gefährlich, wenn ich weg bin.«
»Gefährlich?«, wiederholte ich verwirrt, denn das einzig potenziell Gefährliche, das ich gesehen hatte, war die Hündin, die ihre Schnauze gerade in einen Schuh gesteckt hatte und dabei nicht sehr bedrohlich aussah. »Werden Leute versuchen, uns in der Nacht zu töten?« Das kam manchmal vor. Es machte mir nichts aus. Meistens durfte ich mich wieder hinlegen, nachdem ich beim Saubermachen geholfen hatte.
»Aber nein«, antwortete Helios und rettete damit die Hündin. »Du hast recht. So schlimm ist es auch wieder nicht.«
Worin genau er mir recht gab, konnte ich nicht sagen.
»Ich bin nicht müde«, sagte ich. »Erzähl mir die Geschichte vom Tod und dem Mädchen.«
Er streckte sich aus, das Bett ächzte unter ihm. »Es ist schon spät …«
Ich kroch unter die Decke und kam auf seinem Schoß wieder hoch. »Buh!«
Helios lachte. »Na gut, du hast ja recht.« Er rückte sich ein Kissen zurecht und lehnte sich dagegen. Ich rollte mich auf seinem Schoß zusammen. Mir war vollauf bewusst, dass ich mich benahm wie ein Baby, aber ich liebte es, ihn ganz für mich zu haben. Keine Freunde, Befehle oder Arbeiten, die zwischen uns standen.
»Es lebte einmal ein Mädchen, das hieß Persephone. Sie war arm und ihre Mutter wollte, dass sie immer bei ihr blieb und nie Abenteuer erlebte. Doch Persephone war zu klug, um ihr ganzes Leben auf einem Bauernhof zu versauern. Eines Tages begegnete sie auf der Straße dem Tod. Niemand wollte mit dem Tod befreundet sein, weshalb er sehr einsam war. Er war eine höfliche Person und verneigte sich vor ihr, und Persephone verneigte sich vor ihm. Das überraschte den Tod, denn normalerweise liefen die Menschen immer vor ihm weg. Noch überraschter war er allerdings, als sie sagte, Hör zu, ich habe da eine Idee …«
Ich schlief ein und träumte, wie ich mit dem Fährmann über den Hades fuhr, um fortan mit all den anderen Seelen in der Unterwelt zu leben. Gleichzeitig wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Prinzessin und das Baby Helios mehr Sorgen bereiteten, als wenn wir auf der Straße dem Tod begegneten.
2
Ich hatte nicht das Gefühl, viel Schlaf bekommen zu haben, als jemand mich weckte. Es war die Königin, sie hatte eine Laterne dabei. Sie wollte mich nicht wecken, nur Helios, aber da ich mich an ihn gekuschelt hatte, schüttelte sie mich genauso wie ihn.
»Helios. Ich brauche Hilfe. Ich traue den Sklaven nicht.«
»Ich, äh – Was?«, fragte er traumtrunken. »Agaue. Was ist los?«
»Ich brauche Hilfe«, wiederholte sie leise und gemessen. »Und ich traue den Sklaven nicht.«
Helios starrte sie an, als hätte sie ihm gerade gestanden, dass sie jemanden von einer Klippe gestoßen hatte, dann sah er mich an. »Ich – in Ordnung. Phaidros, schlaf weiter. Ich bin … bald wieder da.«
»Was?«, flüsterte ich entsetzt. Ich hatte noch nie allein geschlafen. Kein einziges Mal. Es war zu gefährlich. Wenn du alleine schläfst, kann ein Feind kommen und dich töten, weil niemand da ist, der dich beschützt. »Nein, du …«
Er streichelte meinen Kopf. »Komm schon, du bist groß genug, um für eine Stunde allein zu bleiben. Schau, die Hündin ist da und leistet dir Gesellschaft.«
»Nein, nein, ich bin nicht …«
»Gehorsam ist Stärke«, flüsterte Helios.
Wie immer waren die Worte wie eine Mauer in meinem Kopf. Ich konnte gar nicht nicht gehorchen, selbst wenn das Zimmer gebrannt hätte. Ehrbare Krieger gehorchen. Wenn sie es nicht tun, sind sie keine echten Krieger und haben keine Ehre, und Ehre ist das Einzige im Leben, das einem wirklich gehört. »Gehorsam ist Stärke«, wiederholte ich leise, wie es erwartet wurde, ob man nun Angst hatte oder nicht. Vor allem, wenn man Angst hatte.
»Ich liebe dich, kleiner Krieger. Ich bin bald wieder da.«
Beide verschwanden hinaus auf den dunklen Korridor, und ich blieb, wo ich war. Zu einem Häufchen Elend zusammengerollt starrte ich die unbekannten Schatten in den Ecken an. Die harmlose Hündin schlief und kümmerte sich kein bisschen um die nächtlichen Palastgeräusche. Ich hörte jemanden in der Ferne über den Steinboden laufen. Es war schwer, mir nicht vorzustellen, dass es sich dabei um einen Feind handelte, der mich töten wollte, während Helios fort war. Ich nahm meine Decke mit und versteckte mich unter dem Bett.
Es half nichts.
Er blieb jahrelang weg.
Es war gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Das Wort hallte genauso laut in meinem Kopf wider wie mein Herzschlag. Allein an einem fremden Ort zu kauern, ist der sichere Weg in den Tod. Das war die wichtigste Regel in unserem Lager: Niemand geht je irgendwo allein hin. Helios hätte mich nicht allein lassen sollen. Das war gefährlich. Gehorsam ist Stärke, aber Stärke nützt dir nichts, wenn du tot bist.
Ich schlich mich hinaus auf den Korridor.
Es war nicht allzu dunkel dort. Hier und da brannten Kerzenleuchter, gerade hell genug, dass ich den Boden vor mir erkennen konnte. Eine Sklavin in einem einfachen Kittel schnitt gerade die Kerzendochte und warf mir einen verdutzten Blick zu, als ich an ihr vorbeilief. Ich fürchtete schon, dass sie mich aufhalten würde, aber sie schien der Meinung, dass das Ganze sie nichts anging. Ich drehte mich erstaunt zu ihr um. Erwachsene ließen einen nie in Ruhe, wenn man nachts allein unterwegs war. Schließlich konnten Feinde in der Nähe sein.
Vielleicht dachte sie auch, ich sei groß genug, um auf mich selbst aufzupassen.
Ich schluckte. »Ähm, Verzeihung. Hast du Helios gesehen?«
»Ich glaube, die Königin ist mit ihm dort entlanggegangen, Herr.«
Das brachte mich aus dem Konzept. »Ich bin kein Herr«, widersprach ich. »Ich bin vier.«
»Du bist ein Gesäter«, erwiderte sie und lachte ein bisschen.
»Da entlang also«, sagte ich und schaute in die Richtung, in die sie gedeutet hatte. Ich fragte mich, wie man in diesem Palast irgendjemanden finden sollte, aber die Sklavin musterte mich, als überlegte sie gerade, ob sie mich nicht doch irgendwohin bringen sollte. Also lief ich schnell los, ohne zu wissen, was mich hinter der nächsten Ecke erwarten mochte. Ich stürzte prompt, denn dort stand eine Statue des Apoll, die unglaublich menschenähnlich aussah. Ich rappelte mich wieder auf und lief weiter. Ich wusste, was Statuen waren, aber es war dunkel und ich hatte Angst. Ich rannte und wurde erst langsamer, als ich Helios’ Stimme hörte.
Er war auf dem Hof mit dem Poseidonbrunnen und trug etwas, das in einen Teppich gerollt war. Es sah schwer aus. Schließlich setzte er es ab. Obwohl der Regen und die Gewitterwolken die Nacht sehr dunkel machten, hatte er keine Laterne dabei. Ich konnte ihn gerade so sehen. Da kam ein gequälter Schrei von unten. Helios bückte sich und hob ein Baby vom Boden auf.
»Leg ihn wieder hin«, sagte die Königin. Zu meinem großen Erstaunen war sie mit einem Drachen beschäftigt. Sie versuchte, ihn so zu halten, dass der Wind ihn in die Luft tragen würde. Ich runzelte die Stirn. Uns beide zu wecken, nur damit sie mit ihrem Drachen spielen konnte, war bescheuert.
Helios legte das Baby nicht ab. »Wir könnten ihn zum Tempel der Artemis bringen. Dort werden sie eine neue Familie für ihn finden.«
»Und was, wenn er genauso aussieht wie wir, wenn er groß ist?«, fragte sie. Der Drachen fing endlich den Wind ein und flog auf. Agaue ließ die Schnur abrollen, der Drachen schoss davon und verschwand im Regen. Statt die glitzernde Schnur weiter in der Hand zu halten, band Agaue sie an der Teppichrolle fest, die Helios geschleppt hatte.
»Dann werden die Leute sagen, ist ja lustig, du siehst ein bisschen aus wie die Königin, und dann gehen sie wieder ihren Geschäften nach. So sind die Menschen nun mal!«
»Komm jetzt, bevor noch ein Blitz … Leg ihn ab, Helios!«
»Agaue, bitte.«
»Wir töten ihn nicht. Zeus soll entscheiden.«
Sie nahm ihm das Baby aus den Armen und legte es neben den Teppich, obwohl der Regen jetzt immer stärker wurde. »Ich sagte: Komm.« Sie zog Helios mit sich, weg vom Brunnen, während der Drachen im Wind einen verrückten Tanz aufführte. Ich beobachtete entsetzt, wie die beiden gingen, und wartete darauf, dass Helios kehrtmachte, um das Baby zu holen, aber er tat es nicht. Die beiden verschwanden im Kreuzgang, während das Baby weinte. Wahrscheinlich war es nass und fror. Der Drachen zerrte wie wild an seiner Schnur. Falls die Königin geglaubt haben sollte, dass er den Kleinen ablenken würde, hatte sie sich getäuscht: Es war nichts Friedliches oder Schönes daran, der Wind blies aus allen Richtungen gleichzeitig und ließ den Drachen wie wild hin und her springen. Ich schaute ein letztes Mal zum Kreuzgang hinüber, nach links und rechts (keine Streitwagen), dann rannte ich los, nahm das Baby – der Regen fiel jetzt so stark, dass ich sofort klatschnass war – und stellte mich mit ihm unter.
Der Kleine weinte immer noch, aber eher in einem vorwurfsvollen Ton, der mir sagte, dass er schlecht behandelt worden war, nicht, dass er immer noch so behandelt wurde. Seine purpurfarbene Decke war völlig durchnässt, also wickelte ich ihn aus, breitete die Decke zum Trocknen auf dem Sockel einer Säule aus und wickelte ihn stattdessen in meine. Sie war zwar nicht so schön wie seine, aber sie war warm. Er schniefte und schaute mich an, als wollte er sagen, und was jetzt?
Das wusste ich auch nicht. Ich drehte mich zweimal im Kreis, während ich überlegte, was zu tun sei, und sah bestimmt albern dabei aus. Neuerliche Panik stieg in mir auf und drohte mich zu ertränken. Agaue hatte ihn absichtlich hier draußen gelassen. Wenn ich jemanden um Hilfe bat, würde die Person den Kleinen nur wieder zurücktragen, aus den gleichen Erwachsenen-Gründen wie die Königin zuvor.
Die Drachenschnur surrte im Wind, ganz ähnlich wie eine Bogensehne summt, wenn man den Bogen am Boden liegen lässt und draußen Soldaten vorbeimarschieren.
Das Baby hatte sich wieder beruhigt. Für den Fall, dass der Kleine sich Sorgen machte, er könnte gerade entführt werden, versicherte ich ihm, dass er lediglich ein Abenteuer erlebe.
Nur dass die Leute in den Abenteuern immer wissen, was zu tun ist. Persephone druckste auch nicht lange herum, als sie dem Tod begegnete, sondern packte ihn mehr oder weniger am Kragen und sagte, So, du kommst mit mir.
Mit einem entsetzlich drückenden Gefühl wurde mir klar, dass ich nie wie Persephone sein würde. Ich war nur Phaidros. Ich war nicht der Richtige für das hier. Bis vor Kurzem hatte ich mich noch unter einem Bett versteckt.
Ein Sklave lief zu dem Drachen und dem aufgerollten Teppich und blieb ruckartig stehen. Ich sah, was er dort machte, und zog mich zurück in die Dunkelheit: Er suchte nach dem Baby.
»Herrin?«, rief er in den Korridor hinter ihm. »Herrin! Es ist weg, das Kind ist …« Er lief Richtung Korridor.
Ich wusste immer noch nicht, was ich tun sollte.
Die Luft füllte sich mit einem eigenartigen Geruch, stechend und bitter, und der Drachen zerrte immer wilder an seiner Schnur. Aber die Schnur war aus Bronze und würde bestimmt nicht reißen.
Das Baby begann zu schniefen, und da wurde mir klar – viel später, als jeder andere es gemerkt hätte, erst recht Persephone –, dass es seine Mutter brauchte und ich mich schon längst auf die Suche nach ihr hätte machen sollen. Eine Mutter kann ihr Baby beschützen, selbst wenn es von einer Königin entführt wurde. Ich hatte Mütter in belagerten Städten Unglaubliches vollbringen sehen. Sie konnten stärker sein als selbst Herakles. Das war eine sehr alte Magie, wie Helios mir erklärt hatte.
Ich wusste nicht, wo die Gemächer der Mutter waren. Aber wenn ich jemanden fragte und mich beeilte, würde ich es vielleicht schaffen, bevor jemand mich aufhielt. Dann hätte der Kleine seine Mutter wieder, nicht nur den dummen Phaidros.
Ein Blitz schlug in den Drachen.
Ich hatte schon öfter einen Blitz einschlagen sehen. So was passiert ab und zu, wenn man die meiste Zeit in einem Zelt am Strand wohnt und die Leute um einen herum jede Menge Bronze am Leib tragen. Aber nicht so.
Er zitterte grazil die Drachenschnur entlang, um dann in einem so gewaltigen Lichtblitz zu explodieren, dass ich hintenüberfiel. Ich spürte, wie sich der Boden unter mir hob, als hätte ein Titan sich von seinen Ketten losgerissen und auf die Erde eingeschlagen. Und dann war überall Feuer. Dinge, die eigentlich nicht brennen durften, gingen in Flammen auf – der Brunnen, die Marmorfliesen auf dem Boden – und die Luft flimmerte so stark von der Hitze, dass alles in meiner Umgebung verschwamm, als wäre ich unter Wasser.
Teile des brennenden Kreuzgangs stürzten ein, während das Feuer von Gebäude zu Gebäude sprang, als wäre es lebendig. Dachziegel barsten und Stützbalken brachen, bis der halbe Palast in Flammen stand. Und, schlimmer noch, das Feuer war jetzt kein normales Feuer mehr, sondern wirbelte wie der Wind, wie ein wildes Tier wütete es und machte ein schwirrendes Geräusch dabei, das ich noch nie gehört hatte und hoffte, auch nie wieder hören zu müssen.
Ich hatte Städte fallen sehen, wusste, was das bedeutete, aber ich hatte noch nie Zerstörung wie diese gesehen. Ich konnte nicht einmal beschreiben, was ich da sah. Später, sehr viel später, wurde mir klar, dass der flackernde Höllenschein vom Sand auf dem Hof kam, der zu blubberndem Glas schmolz. Zischende Dampfwolken erhoben sich aus dem Brunnen, kondensierten, sobald sie auf kühlere Luft trafen, und regneten klatschend wieder herab. Die Enden meiner noch zu einem Schlafzopf geflochtenen Haare begannen zu rauchen. Ich musste sie unter meine Tunika stecken, während sich das Baby mit aller Kraft an mir festhielt. Noch ging es ihm gut.
Im Palast strömten die Leute auf die Korridore und brüllten so laut durcheinander, dass ich kein einziges Wort verstand. Plötzlich war ich wieder wie gelähmt. Ich würde seine Mutter niemals finden. Helios suchte bestimmt schon verzweifelt nach mir, und ich konnte mich nicht mehr an den Rückweg erinnern. Auf dem Hof konnte ich nicht bleiben, gleichzeitig wusste ich nicht, wohin.
Was ich aber von den Belagerungen wusste, war, dass man fliehen musste, wenn etwas brannte, ganz gleich ob es ein Zelt war oder die Zitadelle. Und das schnell, bevor alle anderen es ebenfalls merkten und dich zertrampelten.
Also rannte ich los, irgendwohin, nur weg von den Flammen, hinein in den Palast und zwischen den Menschen hindurch, immer schützend über das Baby gebeugt, immer weiter und weiter, bis ich wieder im Freien war. Dort musste ich anhalten, denn das Feuer schien die Stallungen aufgebrochen zu haben. Dutzende Pferde flohen über den Vorplatz, orange erleuchtet vom Feuerschein, mit funkenschlagenden Hufen und schwelenden Mähnen.
Eines davon blieb direkt neben uns stehen. Ich zuckte zurück, denn mir war beigebracht worden, vor Pferden auf der Hut zu sein. Unsere bissen jeden, den sie nicht kannten, und alle anderen trampelten sie gerne nieder. Doch die Stute streckte mir nur ihre Schnauze entgegen und beschnupperte das Baby vorsichtig. Dem Kleinen schien es nichts auszumachen. Dann setzte sie sich und sah mich erwartungsvoll an.
»Ähm«, sagte ich nervös, denn ich hatte noch nie gesehen, dass ein Pferd so etwas machte. Ich war mir ziemlich sicher, dass sein Verhalten praktisch gegen jedes Pferdeprinzip verstieß.
Das Baby streckte zuerst die Arme und dann seinen ganzen kleinen Körper nach der Stute.
Die Idee schien mir nicht schlecht. Ich kletterte vorsichtig auf den Rücken des Pferdes, und kaum dass ich saß, stand es auf und jagte den anderen hinterher.
Es war das Beängstigendste, was ich je getan hatte – von einem Streitwagen überfahren zu werden, mit eingeschlossen. Ich musste mit einer Hand das Baby halten, während ich mich mit der anderen an der Mähne festkrallte, ständig besorgt, dass ich der Stute wehtun und sie mich beißen würde. Ich schaffte es gerade so, auf ihrem Rücken zu bleiben, während ihre riesigen Schulterblätter unter uns auf und ab hüpften. Dann wurde alles noch schlimmer, als der Boden plötzlich abfiel und sie die steile Treppe zur Unterstadt hinuntergaloppierte. Ich hielt mich mit aller Kraft fest und glaubte, jeden Moment abgeworfen zu werden, während hinter uns eine Wolke aus wallendem schwarzem Rauch in den Himmel über dem Palast stieg.
Schließlich hielten wir vor etwas, das wie ein Tempel aussah. Priesterinnen in grellroten Gewändern standen davor, beobachteten die Flammen und raunten einander etwas zu, wie die Leute es immer tun, wenn etwas Großes passiert und niemand etwas dagegen tun kann.
Ich ließ zögernd von der Mähne der Stute ab und streichelte sie am Hals.
Der Kleine auf meinen Armen gurrte, als würde ich ihn streicheln.
Ich überlegte kurz, dann blies ich dem Pferd sanft ins Ohr.
Der Kleine presste sich quiekend eine Hand aufs Ohr.
Ich fragte mich, was man mit einem Baby machte, das gleichzeitig ein Pferd war.
»Hallo«, sagte eine der Priesterinnen zu mir. »Du siehst aus, als hättest du eine ereignisreiche Nacht hinter dir.«
»Ich … ich …« Ich verstummte und versuchte mir vorzustellen, was Persephone jetzt sagen würde, oder wenigstens ein erwachsener Krieger, oder ob ich besser weglaufen sollte. Ich hatte noch nie mit einer Priesterin gesprochen. Ich hatte welche gesehen, aber nur aus der Ferne, wenn die Stadttore gefallen waren und sie von den Türmen sprangen. Mit ihren leuchtenden Roben sehen sie aus wie vom Himmel geschossene Vögel, wenn sie stürzen. Aber jetzt, aus der Nähe, war sie ziemlich groß, viel größer als ich. Und was, wenn sie mit mir von einem Turm springen wollte? Helios hatte mir nie genau erklärt, warum sie das taten, und ich fürchtete, es könnte sich um einen angeborenen Instinkt handeln, der sich ihrer jeden Moment bemächtigen würde. »Ich habe dieses Baby gefunden«, antwortete ich schließlich niedergeschlagen, »und ich weiß nicht, wo mein Kommandant ist.«
»Ach ja«, erwiderte die Priesterin, als wäre das alles ganz normal, und hob mich von dem Pferd herunter. »Du hast das ganz toll gemacht, weißt du, und bist genau zum richtigen Ort gekommen. Das hier ist der Tempel der Artemis. Alle verirrten Kinder kommen hierher.«
»Ist das so?«, sagte ich halb zu ihr, halb zu der Stute.
Aber die trabte bereits davon und schüttelte den Kopf, als hätte sich etwas Unangenehmes darin festgesetzt, das sie nun loswerden wollte.
Das Baby lachte.
»Er ist ein fröhliches kleines Kerlchen, wie?«, sagte die Priesterin und kitzelte ihn. Er lachte glücklich. »Du hast ihn gefunden, sagtest du?«
»Ich – ja – Ich weiß nicht, wo seine Mutter ist.«
»Das macht nichts. Sie weiß, wo sie ihn finden kann. Komm rein, dann machen wir dich erst mal sauber.« Sie streckte mir die Hand hin und führte mich nach drinnen.
Im Tempel war es ruhig, doch während ich dort saß und den heißen Honig trank, den eine andere freundliche Priesterin für mich gemacht hatte, kamen noch mehr Leute mit Kindern herein. Es waren noch weitere Babys dabei, ein paar Mädchen in meinem Alter und dann noch ein Junge von ungefähr neun Jahren, sein Gesicht war tränenverschmiert und grau vom Rauch. Ich gab ihm den Rest meines Honigs zu trinken, während eine Priesterin auch für ihn einen machte. So beängstigend die Flucht hierher für mich gewesen war, so war ich zumindest damit aufgewachsen und wusste mehr oder weniger, was zu tun war. Und ich hatte Hilfe von einem Baby, das möglicherweise zaubern konnte, und einem Pferd gehabt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn nicht. Ich zeigte dem Jungen das Baby, und seine Stimmung besserte sich bald. Der Kleine schien sich unterdessen gut zu amüsieren. Darauf konzentrierte ich mich, nicht auf die finstere Grube, die sich in meinem Innern auftat und fragte, Was, wenn Helios den Tempel der Artemis nicht kennt, wenn er dich nicht findet und du jetzt für immer hierbleiben musst?
In der Mitte des Innenhofs stand ein großes Wunderwerk der Artemis. Sie hielt einen Bogen in der Hand, manchmal bewegte Sie den Kopf, blickte zum Himmel hinauf oder hinunter zu den Türen des Tempels. Das beruhigte mich. Nicht einmal Königin Agaue würde sich mit Artemis anlegen.
Ich hatte den Kleinen kaum abgesetzt, da krabbelte er schon los, inspizierte ein Blumenbeet und setzte sich mit einem triumphierenden Lächeln mitten hinein. Ich lief zu ihm, um zu verhindern, dass er etwas Verrücktes in sich hineinstopfte, aber er tat es nicht. Er gab mir eine Blume.
»Danke.« Ich streichelte sein Köpfchen. »Hast du … dem Pferd gesagt, wohin es laufen soll?«
Die Frage klang dumm, kaum dass ich sie ausgesprochen hatte, und der Kleine interessierte sich ohnehin mehr für einen Zitronenbaum.
»Phaidros.«
Ich blickte auf, traute mich kaum, es zu glauben, dachte, ich hätte mich bestimmt getäuscht – aber es war Helios, der neben dem Blumenbeet kniete und mir die Arme entgegenstreckte. Ich stürzte mich hinein, und er umarmte mich so fest, dass ich keine Luft mehr bekam und sich das fein gearbeitete Abbild des Ares auf seinem Harnisch in meine Wange drückte, sodass ich danach aussah, als hätte ich eine Ares-Tätowierung an der Stelle, aber das war mir egal.
»Woher in aller Welt wusstest du, dass du zum Tempel der Artemis gehen musst, kleiner Krieger?«, fragte er halb lachend, halb weinend. Er strich mir übers Gesicht und wischte die Asche weg. Seine Hand fühlte sich rau an vom Schwert- und Zügelhalten, nach Sicherheit. »Die Priesterin hat gesagt, du wärst auf einem Pferd hergeritten?«
»Das war nicht meine Idee, sondern die von dem Baby. Ich glaube, es hat dem Pferd befohlen …«
»A«, sagte der Kleine und gab Helios ebenfalls eine Blume.
Helios nahm sie vorsichtig und strich ihm mit den Knöcheln über die Wange. »Wen haben wir denn hier?«
Ich wollte schon sagen, Das ist Semeles Sohn, ich habe ihn mitgenommen, nachdem ihr ihn auf dem Hof zurückgelassen hattet, denn was, wenn er verbrannt wäre, dann wäre es deine Schuld gewesen, und wie kann es sein, dass du ihn jetzt nicht mehr erkennst, nur weil er in eine andere Decke gewickelt ist?, aber etwas hielt mich zurück. Ich spürte einen eigenartigen Druck im Kopf, wie es oft passierte, wenn ich eine Staubwolke vor den Mauern einer belagerten Stadt sah oder der Boden unter den Rädern der Streitwagen erzitterte.
Mit einem Erkenntnisblitz, der mir heute viel zu erwachsen erscheint, als dass ein Vierjähriger von selbst darauf kommen könnte – und vielleicht bin ich auch gar nicht von selbst darauf gekommen –, wurde mir klar, dass Helios das Baby durchaus wiedererkannte und wollte, dass ich log.
»Das weiß ich nicht«, antwortete ich. »Ich habe es gefunden.«
»Nun, dann wird seine Mutter sicher bald hier sein, falls sie noch lebt.«
Und da verstand ich, dass sie es nicht tat. Und ich verstand, was in den Teppich eingerollt gewesen war. »Was, wenn nicht? Können wir es mit zur Legion nehmen?«
»Nein. Die Priesterinnen werden eine neue Familie für den Kleinen suchen.«
»Aber warum können wir nicht …«
»Krieger.«
Ich schloss den Mund. Ich war in dieser Nacht schon einmal ungehorsam gewesen und fühlte mich nicht zu einem zweiten Mal imstande. Selbst als ich schon viel älter war, war jeder Versuch, auch nur daran zu denken, so zermürbend, dass mir kalt wurde und ich in Tränen ausbrach. Das hinderte mich zwar nicht daran, zu erkennen, wenn Helios einmal falsch lag, aber das spielte keine Rolle.
Er blies langsam die Luft aus. »Gut. Wir müssen los, bevor Agaue … Bevor die Schiffe ohne uns losfahren. Zeit, uns zu verabschieden.«
»Wiedersehen«, sagte ich unwillig zu dem Baby.
Aber das hatte inzwischen einen kleinen Fuchs entdeckt, der – ganz anders als jeder Fuchs, den ich je gesehen hatte – nicht versuchte, es zu beißen. Er saß lediglich neugierig auf seinem Schoß.
Der Kleine nieste, und der Fuchs ebenfalls.
»Seltsam«, kommentierte Helios verwirrt.
»Er kann zaubern«, erläuterte ich leise, als würde er mir sowieso nicht glauben.
Doch Helios sagte nicht, ich solle nicht albern sein, sondern strich mir lediglich über den Kopf. »Vielleicht«, erwiderte er in einem seltsamen Ton.
Das Baby war abgelenkt, weil der Fuchs gerade versuchte, in seine Tunika zu krabbeln. Der Kleine lachte, und ich war erleichtert. Es würde ihm gutgehen, er würde uns nicht vermissen.
Dann machten alle einen Satz in die Luft, als Hörner erschallten. Es waren Schlachthörner. Ich spähte an Helios vorbei und erwartete, jeden Moment Streitwagen durch die Tore des Tempels hereindonnern zu sehen.
Helios jedoch schaute hinauf zum Palast, in die Richtung, aus der wir gekommen waren, und sein Gesicht erstarrte auf eine Art, wie ich es noch nie gesehen hatte. Ich folgte seinem Blick. Reiter kamen die Treppen zur Unterstadt heruntergeprescht. Sie waren gänzlich schwarz: schwarze Pferde, schwarze Rüstung, schwarzer Helmbusch und dazu ein schwarzes Banner.
»Wer sind die?«, flüsterte ich.
»Die Verborgenen.« Helios’ Stimme klang … falsch. Als wären das keine Reiter, die er da anstarrte, sondern Geister.
»Was …«
Er packte mich an den Schultern. »Phaidros. Sie suchen das Baby. Ich muss es woanders hinbringen, wo es in Sicherheit ist. Ich könnte behaupten, dass es mein neues Mündel ist, aber nicht, solange du bei mir bist, denn ein Krieger darf immer nur eines haben. Du musst so lange hierbleiben. Die Priesterinnen werden sich um dich kümmern. Ich komme zurück und hole dich. Ich liebe dich, kleiner Krieger.« Er küsste mich auf die Stirn und schnappte sich das Baby. Der Kleine winkte mir zu, dann waren sie auch schon weg.
Helios war jemand, der seine Versprechen hielt. Also beschloss ich, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte, setzte mich zu dem Fuchs und spielte mit ihm.
»Und dann«, sagte ich später immer, wenn Helios mir die Geschichte in der Sicherheit unseres Zeltes erzählte, denn das war meine Lieblingsstelle, »bist du zurückgekommen! Und hier bin ich, buh!«
Helios nahm mich, schloss mich in die Arme und drehte mich herum, sodass ich mit dem Rücken zu ihm auf seinem Schoß saß und wir gemeinsam meine Spielsachen bewundern konnten. Er hatte mir das unförmigste Nilpferd geschnitzt, dass je hergestellt worden war, aber ich liebte es, und es hieß Ramses. »Ja«, sagte er dann mit dem Kinn auf meinem Scheitel, »hier bist du, kleiner Krieger. Und was sagen wir immer?«
»Nicht ein Wort über das Baby«, antwortete ich treuherzig. Ich hatte mir Helios’ Helm geschnappt, den er gerade polieren wollte, und setzte ihn auf. Es war der schönste Gegenstand der Welt. Aus Bronze und mit silbernen Einlegearbeiten und innen mit Leder ausgepolstert. Das Beste aber war das Visier: Es sah aus wie eine Maske, man konnte es hoch- und runterklappen. Die meisten anderen Offiziere hatten welche, die sie aussehen ließen wie Ares oder Athene oder andere Helden, aber Helios war der bescheidenste Prinz, den es je gegeben hatte, und die Maske war lediglich ein Abdruck seines eigenen Gesichts. Er sagte, er wollte nicht in die Schlacht ziehen und dabei so tun, als wäre er jemand anderes. »Wir haben den Kleinen nie gesehen und wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Echo, Echo, Echo«, fügte ich hinzu, weil meine Stimme in dem Helm so lustig klang.
»Genau«, sagte er dann immer angespannt, und wenn ich ihn ansah, waren seine Wimpern schwärzer als schwarz. Ich habe ihn nie gefragt, warum. Ich hatte mich schon immer über die Dinge gewundert, die ihn aus der Fassung brachten: Donner und plötzliche Geräusche. Und, wie es schien, eben auch Babys.
3
Das nächste Mal begegnete ich Dionysos auf dem Meer.
Es war in dem Jahr, als ich von einem Stern der Legion zum Stiefelabstreifer wurde.
Mit neunzehn kämpfte ich das erste Mal in vorderster Linie neben Helios. Ich hatte den Tag jahrelang herbeigesehnt, denn neunzehn ist schon recht alt dafür. So gut wie alle, die ich kannte, taten es schon, seit sie sechzehn waren, aber ich war immer eher klein gewesen für mein Alter und begann erst spät zu wachsen. Ich hatte schon Angst, dass es nie passieren würde, aber dann war es irgendwann doch so weit, und eines Sommers war ich plötzlich größer als Helios.
Ich weiß nicht, wie die Krieger es da machen, wo du herkommst, aber ich möchte fast wetten, ähnlich wie wir, denn es funktioniert:
Unsere vorderste Schlachtlinie ist mindestens drei Reihen tief, immer zwei aufeinander eingeschworene Krieger nebeneinander. Der Grund dafür ist nicht nur, dass beide ihr Leben füreinander geben würden, sondern dass wir eher sterben würden, als unserem Partner Schande zu bereiten. Schande ist eine starke Triebfeder. Wenn ich Mist baute, wäre es Helios, der den Zorn der anderen abbekäme.
Thebanische Legionen sind berühmt dafür, dass sie ihre Reihen niemals aufbrechen. Der Grund dafür ist ebendiese Schlachtordnung. Die Spartaner machen es genauso, eigentlich jedes Heer, das sich hauptsächlich auf seine schwere Infanterie verlässt. Ich mache nicht oft Voraussagen über die Zukunft – Dionysos ist ein wandelndes Beispiel dafür, wie sie meistens gerade dann über den Haufen geworfen werden, wenn man es am wenigsten erwartet –, trotzdem würde ich ohne Zögern behaupten, dass die kampfstärksten Legionen es auch in tausend Jahren noch so machen werden.
Wie ich bereits sagte, neunzehn ist ein beträchtliches Alter, und ein paar unserer Offiziere dachten schon, ich würde es nie in die Vorhut schaffen. Doch dann änderten sie ihre Meinung, als ich einen Streitwagen samt Pferden und Lenker zu Fall brachte. Ich war stark, schnell und wild. Nach all den Jahren des Wartens hatte ich viel zu beweisen, und ich liebte Helios auf genau die wahnsinnige, alles verschlingende Art, wie die Legion es gerne sieht.