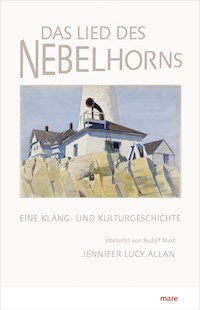
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein dröhnendes, einsames Geräusch, das in die Weiten des Meeres hinaushallt: Als Jennifer Lucy Allan zum ersten Mal bewusst das kolossale Gebrüll des Nebelhorns hört, ist dies der Beginn einer Obsession und einer Reise tief in die Geschichte eines Klangs, der die Identität von Küstenlandschaften auf der ganzen Welt von Schottland bis San Francisco geprägt hat. Der unvergleichliche Sound des Nebelhorns erzählt von Schiffswracks und Leuchtturmwärtern, von der Industrialisierung und von fantasievollen Beschallungssystemen für Küsten-Raves. In diesem mitreißenden, so poetischen wie sachlich fundierten Buch verknüpft die Autorin ihr musikalisches Expertinnenwissen mit ihrer persönlichen Faszination für das Nebelhorn als Maschine, als Instrument und als Symbol einer vergangenen Ära.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jennifer Lucy Allan
DAS LIEDDES NEBELHORNS
Eine Klang- und Kulturgeschichte
Aus dem Englischen von Rudolf Mast
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel
The Foghorn’s Lament: The Disappearing Music of the Coast
bei White Rabbit / Orion Publishing Group Ltd., London.
Copyright © Jennifer Lucy Allan 2021
© 2022 by mareverlag, Hamburg
Lektorat Lisa Fabian, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Edward Hopper, »Rocky Pedestal, 1927« © Heirs of Josephine N. Hopper / VAGA at ARS, NY/VG Bild-Kunst, Bonn 2021
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-803-8
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-689-8
www.mare.de
Wenn
Wir es waren, die diesem Schrei die Stimme verliehen haben
Was sagt er dann über uns, indem er wieder
Und wieder Dinge anspricht
Die wir nie sagen wollten?
M. S. Merwin: Foghorn
Inhalt
Prolog
Teil 1
ATTACKEUrsprünge – Obsession – Begegnungen
Der erste Aufschrei
Schwerwetter
Unterwasserglocken
Schiffbruch
Testen und noch mal testen
Der Klang der Sirenen
Teil 2
VERFALLLärm – Beschwerden – Vergleiche
Musikalische Offenbarungen
Das größte Ärgernis
Bullen. Eine Reprise
Neue Mythen, alte Mächte
Gehirnwäsche
Teil 3
NACHHALLSammlung – Bedeutung – Erinnerung
Die Brücke
Im Pelagial
Auch kleine Schiffe haben Radar
Hafensymphonien
Die Sammler
Himmelstrompeten
Trümmer
Teil 4
BEFREIUNGRückkehr – Relikte – Reminiszenzen
Piepsen statt Dröhnen
Etwas so Abstraktes wie Klang
Epilog
Dank
Anmerkungen
Prolog
22. Juni 2013
Dann setzt das Nebelhorn ein.
Sein unvermittelter und furchterregender Zwischenruf dringt aus zwei rechteckigen schwarzen Mäulern, ein ungeheurer metallischer Aufschrei, der ohrenbetäubend laut ist. Er flutet meine Ohren und erschüttert meine Eingeweide. Ich bin überwältigt. Ich erstarre. Unter den Ärmeln stellen sich auf meinen Armen kleinste Härchen auf. Der klagende Trompetenstoß erstirbt in einem unwirschen Grunzen, das mich aus meiner Schockstarre reißt. Es folgt eine endlose Sekunde allumfassender und vollständiger Stille, bis die mich umstehende Menge in jenes aufgekratzte Lachen verfällt, das für Momente des ehrfürchtigen Schauderns reserviert ist. Was wir erleben, ist aurale Auslöschung.
Im Juni 2013 fuhr ich gemeinsam mit Freunden von London in den Nordosten Englands, um das Foghorn Requiem zu verfolgen, eine gigantische Aufführung unter freiem Himmel, an der drei Blechbläserensembles mit insgesamt 65 Musikern beteiligt waren, die auf den Klippen am Leuchtturm von Souter Point in South Shields Aufstellung bezogen hatten. Verstärkung erhielten sie durch eine bunt gemischte Flottille aus mehr als fünfzig Schiffen, die auf der Nordsee dümpelten, darunter eine Fähre und Fischerboote, Segel- und Rettungsboote, Jachten mit einem und mit zwei Masten sowie Schlepper. Das Zentrum bildete das allmächtige Nebelhorn von Souter Point, das aus einer Menschenmenge heraus ertönte und seine Stimme über die Köpfe der Bläser hinweg zu den Schiffen und von dort weiter bis zum Horizont erklingen ließ, eine Stimme, für die komprimierte Luft aus von einem massigen Dieselmotor betriebenen Lungenflügeln gepresst wurde.
Es war ein sonniger und windiger Tag, der das Publikum unter einem blauen Himmel frösteln ließ. Das hatte sich rund um den weiß getünchten Leuchtturm und das angrenzende Gebäude aufgestellt, auf dem das Nebelhorn stand – quadratisch wie ein Transformatorenhäuschen, trug es zwei übergroße Schalltrichter, die wie klaffende schwarze Schlünde aussahen, die sich zu schmalen Hälsen verschlankten. Eltern, die ihren Nachwuchs auf den Schultern trugen, Menschen in leuchtender Regenkleidung, die Thermoskannen mit Tee kreisen ließen, Pärchen mit Hunden, Großeltern auf Campingstühlen, Kinder, die auf dem Mäuerchen hockten, das den Leuchtturm umgab, und Menschen wie ich, mit Jeans und dünner Jacke für den kaum elf Grad warmen Sommertag in South Shields gänzlich unpassend gekleidet, warteten zitternd und vom Wind zerzaust darauf, dass die Vorstellung begann.
Als die Blechbläser Aufstellung nahmen, verstummten die Menschen. Die ehrfürchtige Stille wurde durch einen einzelnen klaren und hohen Ton durchschnitten, der von einem Trompeter auf dem Dach des Leuchtturms stammte. Dann setzten die anderen Instrumente ein, und die düstere Phrase wurde von einer leichten Brise ergriffen und aufs Meer hinausgetragen. Die Schiffe und Boote antworteten darauf im Gleichklang und abgestimmt auf die Töne der Bläser, als sei es ein Echo, das die unendliche Weite der Umgebung zurückwarf. Ihr jeweiliger Beitrag traf versetzt und im charakteristischen Tonfall ein, die Fähre laut und näselnd, die kleinen Schiffe weinerlich und gequält. Das Zwiegespräch zwischen Blech und Booten, Erdverhaftetem und Maritimem, erfüllte die blaugraue Wasserfläche von den Klippen, auf denen wir standen, bis zum weit entfernten Horizont, eine schwermütige Unterredung, als hätten die beiden dazugehörigen Industrien – der Maschinen- und der Schiffsbau – Stimmen bekommen, um erörtern zu können, wessen Unglück das größere sei.
Dann, in die Wehklage hinein, begann das Nebelhorn zu brüllen, ein Klang, der Nebel und schlechtem Wetter trotzen und zwanzig Meilen weit hinaus auf See dringen soll. Über die Köpfe des Publikums hinweg brüllte es ein zweites Mal. Meine Ohren wurden gesandstrahlt, und das mit einer Macht und Gewalt, die die Bläser und Schiffe nahezu verstummen und ihren eben noch kolossalen Klang wie eine Maus neben einem Elefanten wirken ließ. Mit jedem Ton, der aus dem Nebelhorn kam, stieg meine Erregung, fühlte ich mich lebendiger. Seine Gestalt verliehen ihm die Klippen und das Meer – vom ersten verhaltenen Aufbegehren bis hin zu jenem infernalischen Lärm, der eine ungeheure emotionale Wucht annahm, als er über die Landschaft strich.
Das Ende des Requiems kündigte sich an, als die letzte Luft dem Druckbehälter entwich und der Ton mit nachlassendem Druck auch seine Härte verlor. Er geriet zu einem Summen, stimmte mit brüchiger Stimme eine Totenklage an, und als auch dafür die Kraft nicht mehr reichte, blieb ein Stammeln und Röcheln, bis der letzte Atemzug zischend entwich wie die Luft aus einem undichten Ballon.
Als es wieder still war, stand ich starr und verfroren da. In meiner Kehle steckte ein Kloß, meine Augen wurden feucht. Ich sah mich um und erblickte in den Gesichtern Tränen und glasige Blicke. Etwas hatte uns verlassen, und wir waren allein. In seinem letzten Atemzug hatte das Nebelhorn nicht nur von seinem eigenen Tod berichtet, sondern vom Tod einer ganzen Branche, einer Industrie und allem, was sie einst ausgemacht hatte. Der Klang des Nebelhorns war die Musik zu diesem Tod, und diese Musik wollte mir etwas sagen – das aber auf eine Weise, mit der ich nicht vertraut war.
Ein paar Jahre zuvor arbeitete ich für ein Musikmagazin, das sich mit Underground und experimenteller Musik befasste, und erhielt den Auftrag, ein Album zu besprechen, dem ich den unverhofften Beginn meiner Leidenschaft für Nebelhörner verdanke. Die Platte heißt Audience of One und stammt von dem australischen Perkussionisten und Komponisten Oren Ambarchi. Auf ihr sind ein zischelndes Becken und nervöse Streicher zu hören, die wie Wind, der über eine Takelage streicht, und das Dümpeln großer Schiffsrümpfe klingen. In diese Mischung bricht ohne Vorwarnung der vibrierende Aufschrei eines Blechblasinstrumentes ein, eines Waldhorns, das hier tiefer und sonorer erklingt, als wir es gewohnt sind. Als ich es zum ersten Mal hörte, stellte ich mir einen Hafen vor und verglich den Klang in meiner Besprechung instinktiv mit dem eines Nebelhorns. Dann aber besann ich mich und begann, den Vergleich zu hinterfragen: Was genau ist ein Nebelhorn, und wie klingt es?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, verabschiedete ich mich von der Musikjournalistin, die ich gewesen war, und nahm eine neue Identität an: die der vom Nebelhorn Besessenen, der Historikerin des Klanges und der Zielscheibe des Spotts vieler Freunde (»Ein Buch über Nebelhörner …?«). Und ich entdeckte etwas, das ungleich größer war als das Waldhorn auf besagtem Album, ein Horn, das dazu bestimmt war, sich mit den Weltmeeren und dem Wetter zu messen, ein Horn, das furzen und seufzen konnte, brüllen und heulen, das lauter war als irgendetwas sonst an der Küste und voluminös genug, um den Tod niederzubrüllen.
Im Laufe der Jahre haben sich viele Musikerinnen und Musiker der Lautstärke ihrer Musik gerühmt, viele haben mich mit Klangerlebnissen angelockt, die den Brustkorb in Schwingungen versetzten. Die Spanne reicht von Dub über Doom Metal und Noise bis Hardcore, dargeboten über Soundsysteme, die wie Teile von Flugzeugturbinen aussahen und in höhlengleichen Räumen standen, die vor allem wegen ihrer Akustik ausgewählt worden waren. Diese vibrierenden Ekstasen, bei denen der Klang körperlich wurde und der Lärm mich verstummen ließ, habe ich seit jeher geliebt. Ich stamme aus dem ländlichen Nordwesten Englands, weit von jeder Küste entfernt, aber das Nebelhorn war gewaltiger und aufregender als jede Band, die ich gehört, jede Party, die ich durchgetanzt, und jeder Lautsprecherturm, den ich gesehen hatte – ein Soundsystem, das das Meer beschallen soll und deshalb eine Lautstärke erreicht, die für die endlosen Ozeane angemessen ist. Nun hatte es mich in den Bann geschlagen, und zwar mit Haut und Haaren.
Auf der Suche nach Nebelhörnern trieb ich mich stundenlang auf YouTube herum, sichtete Fotos und suchte verstaubte Archivseiten auf, die langatmige Texte in veralteten HTML-Dokumenten präsentierten. Ich fand Aufnahmen vom Innenleben der Nebelhörner, das in kuppelförmigen Betonhüllen oder gedrungenen Backsteinbauten steckte. Riesige Schalltrichter ragten surreal aus Löchern in den Wänden hervor oder thronten auf Dächern, die unter der Last einzustürzen drohten. Ich scrollte mich durch Bilder von quadratischen Hörnern und ihren glockenförmigen Mündern, von Trichtern, die sich in Form eines Schwanenhalses dem Horizont entgegenstreckten. Ich spürte das einzige Buch auf, das je über Nebelhörner geschrieben wurde. Es stammt von dem Historiker und Dozenten Alan Renton, dessen Tonaufnahmen von Nebelhörnern in der British Library aufbewahrt werden. Ja, ich trat sogar der Vereinigung der Leuchtturmwärter bei, einem Zusammenschluss von aktiven und ehemaligen Leuchtturmwärtern und anderen Enthusiasten, die sich der Pflege dieses kulturellen Erbes verschrieben haben.
Mit der Zeit erfuhren andere von meiner zunehmenden Besessenheit und erzählten mir ihre Geschichten. Ich begann, mit meinen Mitmenschen – wer immer es auch sein mochte – über Nebelhörner zu sprechen. Mir kamen Berichte und Erinnerungen zu Ohren, mir bislang unbekannte Gleichgesinnte versorgten mich mit Fotos, ich erhielt E-Mails von Fremden aus British Columbia, Belfast und von den Orkneyinseln. Sie enthielten Mythen, Histörchen, zeitgenössische Folklore und nicht belegte Anekdoten. Ein Absender versuchte mich davon zu überzeugen, dass wir in der Sphäre des Übersinnlichen zusammengearbeitet hätten. Eine Bekannte schickte eine Mail mit der Frage, ob Nebelhörner im Zweiten Weltkrieg zur Irreführung feindlicher U-Boote eingesetzt worden seien. Und jemand anderes berichtete mir, dass aus Anlass der Befreiung Jerseys von den Deutschen Tag und Nacht die Nebelhörner geheult hätten – eine großartige Geschichte. Als moderner Mythos einzuordnen ist hingegen der Bericht, dass jamaikanische Musiker in Sheffield ein ausrangiertes Nebelhorn in eine Tonanlage integrierten, um im Wettstreit um den lautesten Dub einen Rivalen auszustechen. Mit den ausgewachsenen Nebelhörnern, die mich interessierten, wäre jede Tonanlage überfordert gewesen, aber die Vorstellung, dass aus Hoch- und Tieftönern ein gigantischer Schalltrichter aufragt, hat durchaus seinen Reiz. In ihr findet das Nebelhorn seinen rechtmäßigen Platz in der Musik, weil die Kontrolle, die Kolonialisten des 19. Jahrhunderts mit ihm über die Küsten ausübten, an die ethnische Minderheit übergeht, die einst an diesen Küsten lebte. Diese Vorstellung war derart einnehmend, dass ich die Hälfte aller britischen Experten und Praktiker kontaktiert habe, um einen Faden zu finden, der mich zu einer überzeugenden Verbindung von Klang, Meer und Musik führen würde.
Auf dem Weg dorthin schnappte ich Berichte über andere Maschinen des Industriezeitalters auf, die wegen ihres spezifischen Klanges zweckentfremdet wurden. Ich hörte von einer Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die ein Dampfpfeifen-Orchester gegründet hatten, erfuhr von kakofonischen Kompositionen für Häfen und Symphonien, die russische Küstenstädte zu Orchestern verwandelt hatten.
Da ich mich für Musik und Technik gleichermaßen interessiere, traten derlei Geschichten etwas in mir los. Sie handelten nicht allein von neuen Instrumenten oder neuen Arten der Aufführung von Musik, sondern davon, wie sich Maschinen mit vermeintlich definierten Funktionen überraschenderweise in andere Bereiche der Kultur überführen lassen. Zudem waren die meisten dieser Geschichten allenfalls zur Hälfte wahr, was die spannende Frage aufwarf, was sie am Leben hielt. Was mochte an einer überholten Technologie der jüngeren Vergangenheit so anziehend sein, dass sie dem Vergessen entrissen, zu neuem Leben erweckt und für eine nachwachsende Generation mit einer neuen Funktion und einer neuen kulturellen Bedeutung ausgestattet wurde?
Wenn von der Küste ein melancholischer Klang zu uns dringt, denken die meisten an ein Nebelhorn. Dabei ist das Nebelhorn nur eines von mehreren Nebelsignalen. Es gibt ein ganzes Arsenal an Instrumenten, die an der Küste als Navigationshilfe Einsatz finden – Glocken, Pyrotechnik, Hupen und Sirenen unterschiedlichster Bauart –, doch eines davon interessierte mich mehr als die anderen. Der Klang dieser gähnenden Schlünde, die ich am Souter Point gehört hatte, wird von einem besonders großen technischen Gerät erzeugt, das mir als Motiv aus Filmen, Literatur und Musik vertraut war. Was landläufig Nebelhorn genannt wird, kann tatsächlich ein Schiffshorn sein, eine elektrisch betriebene Sirene oder, wie in South Shields, ein großes hupendes Diaphon, bei dem Druckluft durch einen Kolben geleitet wird. Ein Nebelhorn im strengen Sinne ist nur Letzteres, und Letzteres war es auch, das mich in die Abhängigkeit trieb. Mir diesen »Stoff« zu beschaffen erwies sich als schwierig, denn wenn ich mich endlich zu einem dieser Nebelhörner vorgearbeitet hatte, war es vielfach bereits verstummt; andere, die sich noch vernehmlich machen konnten, wurden nicht mehr von und für Seeleute betrieben, sondern im Sommer für Touristen angeworfen, die sich von der schieren Kraft einschüchtern ließen.
Das Nebelhorn am Souter Point wurde von Kompressoren betrieben, die ihre Kraft aus Dieselmotoren schöpften. Die Motoren füllten Druckbehälter, aus denen komprimierte Luft durch eine Leitung zu einem Ventil geführt wurde, das am Hals des eigentlichen Horns saß. Wurde es geöffnet, gelangte der gewaltige Klang des Horns in die Welt. Auch Schiffe, klein wie groß, sind mit Nebelsignalen bestückt. Die Palette reicht von Hörnern, die es mit ihren Kollegen an Land aufnehmen können, über elektrisch betriebene Tröten bis hin zu mit Druckluft gefüllten Kartuschen, wie man sie auf kleineren Booten antrifft, aber auch auf Technopartys und Karnevalsveranstaltungen. In Sachen Klang und Lautstärke können es große Schiffe durchaus mit kleineren Nebelhörnern aufnehmen, aber nichts reicht an jene Bestien heran, die an Leuchttürmen und in Häfen installiert sind.
Der Klang eines Nebelhorns gehört zum akustischen Inventar einer Küstenlandschaft, vor allem im britischen Königreich und in Nordamerika. Aber versuchen wir einen Moment lang, den vertrauten Klang auszublenden und den Blick neu auszurichten. Dann haben wir eine kühne, unwirkliche Maschine vor uns, die mit 120 Dezibel so laut ist wie eine Rockgruppe, die ihre Verstärker bis zum Anschlag aufdreht, allerdings an einem abgelegenen und schwer zugänglichen Fleckchen Erde steht und aus riesigen Schalltrichtern aufs Meer hinausschreit. Die Lautstärke ist ohrenbetäubend, die Architektur der markanten Wachposten bizarr. Zugegeben: Auch Flutwarn- und Zivilschutzsysteme sowie Luftschutzsirenen sind durchaus beeindruckend, aber nichts macht sich so nachhaltig bemerkbar wie das Nebelhorn, wenn es das Meer anbrüllt, nichts vermag eine Warnung so tröstlich vorzubringen, und nichts ist so bedeutungsschwer aufgeladen mit Leben und Tod, Erinnerung und Melancholie wie der Klang, den ich an jenem Junitag auf den Klippen von South Shields hörte.
Diese Verbindung von Klang, Ort und Menschen nahm mich gefangen, weil mir nichts von dem, was ich hörte oder las, das Erlebte erklären konnte. Es gibt keinen Klang, der so sehr an ein bestimmtes Wetter geknüpft ist, und keine andere Maschine klingt derartig gewaltig. Der metallene Schalltrichter des Nebelhorns kann so groß geraten, dass man hineinkrabbeln kann, die Maschinen, mit denen sie betrieben werden, sind Giganten mit einem gigantischen Verbrauch an fossilen Brennstoffen. Ausgelöst worden war meine Begeisterung von der schieren Größe des Nebelhorns ebenso wie durch die Gefühle, die sich in jenem Moment eingestellt hatten, in dem ich es zum ersten Mal erlebte, aber ich wollte auch die Geschichte dieses Klanges verstehen. Wer hatte beschlossen, dass dieses grauenhafte Gerät ein gutes Werk verrichten könnte? Wie war ein derartig obszöner Apparat entstanden? Wo hätte ich die Möglichkeit, es zu hören? Wie konnte es sein, dass derart viele Menschen davon zu Tränen gerührt wurden? Und funktionierte es eigentlich noch? Diese Fragen verlangten nach Antworten, und um Antworten zu finden, musste ich tiefer graben.
Dieses Buch beschäftigt sich mit Nebelhörnern – eine Art Stimmführer im Konzert an unseren Küsten und Ursprung einer Musik, die für alle, die sie kennen, selbstverständlich geworden ist, weshalb sie keinen Gedanken mehr daran verschwenden, wie absurd sie eigentlich ist. Dieses Buch beschäftigt sich aber auch mit der Frage, ob wir, wenn wir über die Klänge, die wir kennen, und die Art und Weise, wie wir sie hören, nachdenken, etwas darüber erfahren, wo unser Platz in dieser Welt ist, weil wir dabei bislang unbekannten Details und Geschichten auf die Spur kommen, die komplexer sind, als es zunächst den Anschein hat. Klänge und Musik sind so wichtig wie das, was wir sehen können, die unsichtbaren Luftschwingungen, die uns umgeben, können uns in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft entführen. Was ich im Klang des Nebelhorns gehört habe, war nicht nur ohrenbetäubende Musik, sondern das Potenzial, Geschichte, Kultur, Industrie, Landschaft und, dies vor allem, Menschen miteinander zu verbinden.
Teil 1
ATTACKE
Ursprünge – Obsessionen – Begegnungen
Der erste Aufschrei
Der Legende nach wurde das Nebelhorn um 1850 von einem Mann namens Robert Foulis in Kanada erfunden. Er hatte in Schottland ein Ingenieurstudium absolviert und anschließend in Belfast als Anstreicher gearbeitet. Dort lernte er seine erste Frau Elizabeth Leatham kennen, die 1817 kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Euphemia starb, woraufhin Foulis beschloss, auf der anderen Seite des Ozeans ein neues Leben zu beginnen. Sein Ziel war Ohio, aber das Schiff geriet in schweres Wetter und musste Nova Scotia anlaufen, wo schottische Freunde Foulis überredeten, mit ihnen auszusteigen.1 Euphemia, die bei ihrer Tante in Edinburgh geblieben war, ließ er nachkommen, und beide siedelten sich in Saint John, New Brunswick, an, wo Foulis ein zweites Mal heiratete. Beruflich befasste er sich mit technischen Aspekten der Bekohlung und der Dampfschifffahrt, war wechselweise als Maler oder Ingenieur angestellt und gründete sowohl eine Kunstschule als auch eine Gießerei. 1928 wurde ihm zu Ehren auf einem Friedhof von Saint John ein Denkmal errichtet.
So weit die gesicherten Fakten aus seinem Leben, doch aus denen wird nicht ersichtlich, dass oder warum er ein Gerät wie das Nebelhorn erfunden haben sollte. Das übernimmt eine andere Geschichte, eine Mischung aus Folklore und Tatsachen unbestimmten Ursprungs. In ihrer verbreitetsten Version bildet sie ein Narrativ, das zu glauben leicht, zu beweisen hingegen unmöglich ist, aber dafür dem Nebelhorn von seinem ersten Aufschrei an eine hohe Emotionalität beilegt. Diese Geschichte geht so: An einem Abend in Saint John ging Foulis bei dichtem Nebel am Strand spazieren. Noch von dort konnte er hören, wie seine Tochter Klavier spielte, und dabei fiel ihm auf, dass die tieferen Töne lauter klangen als die hohen und besser durch den Nebel drangen. In Nebel eingehüllt, ließ er sich vom Klavierspiel seiner Tochter nach Hause leiten. Dieses Erlebnis brachte ihn auf die Idee, eine Maschine zu konstruieren, die tiefe und laute Töne von sich geben konnte, um so von Land aus Schiffe zu warnen, die wegen des Nebels das Licht des Leuchtturms nicht sehen konnten. Und so baute er ein Nebelhorn, das 1859 auf Partridge Island aufgestellt wurde. Foulis unterließ es, seine Erfindung zu patentieren, weshalb er 1866 als armer Mann starb.2
Diese Geschichte findet sich in Büchern und im Internet, sie wird in Fernsehsendungen und Enzyklopädien weitergetragen. Lange Zeit habe ich sie akzeptiert, ohne sie zu hinterfragen. Doch je mehr ich mich mit der Materie beschäftigte, desto größer wurden die Zweifel, desto mehr Fragen stellten sich mir. Tatsächlich ist die Geschichte allenfalls im Kern wahr, der Rest ein ans Herz gehender Mythos über einen industriellen Klang. Es gab tatsächlich einen Erfinder namens Foulis, der ein dampfbetriebenes Horn auf Partridge Island aufstellte, aber wer will sagen, ob es diesen Spaziergang im Nebel wirklich gab oder ob seine Tochter je Klavier gespielt hat? Für diesen Teil der Geschichte gibt es nicht einmal Indizien, und auch die Frage, wie ihn ausgerechnet der Klang eines Klaviers im Nebel auf die Idee gebracht haben könnte, ein dampfbetriebenes Nebelhorn zu konstruieren, muss unbeantwortet bleiben. Wer denkt bei einem Klavier an ein Nebelhorn? Und wie muss ein Mensch gestrickt sein, der sich von den Klavierübungen eines Kindes dazu inspirieren lässt, zur drastischen Verbesserung der Sicherheit auf See eine brüllende Maschine zu erfinden?
Die Suche nach der Quelle dieser Geschichte führte mich in düstere Archive und in prunkvolle Lesesäle in London und in Schottland, zu Onlinedatenbanken und auf genealogische Websites. Ich fand Aufzeichnungen eines Mannes mit identischem Namen, der von Boston nach Kanada umziehen wollte und unterwegs einen Abstecher zu Verwandten machte, die in der Druckindustrie arbeiteten. Er überlegte, für das Leben in der neuen Umgebung wie so viele zu jener Zeit die Schreibweise seines Nachnamens zu ändern, um seine gesellschaftliche Stellung zu verbessern. Ich hatte angenommen, dem Gesuchten mit wenigen Klicks näher zu kommen, doch auch wenn ich recht bald eine Biografie zusammenhatte, fand ich nichts, was mich zum Ursprung der Geschichte hätte führen können. Statt der Herkunft des Nebelhorns durch meine Recherche auf den Grund zu kommen, versank sie immer weiter im Nebel.
Ich grub alternative Versionen aus, von denen einige plausibel, andere an den Haaren herbeigezogen waren. In einer Quelle wurde behauptet, der Ehrgeiz, sein Wissen als Ingenieur in die Weiterentwicklung von Nebelsignalen zu stecken, habe seinen Ursprung in der Lektüre eines Zeitungsberichts über die Kollision der SS Arctis und der SS Vesta. 1854 – Foulis arbeitete zu dieser Zeit im Leuchtturm von Partridge Island – waren die beiden Schiffe vor der Küste Neufundlands bei dichtem Nebel zusammengestoßen und gesunken. Dabei kamen mehr als dreihundert Menschen ums Leben, darunter alle Frauen und Kinder, die sich an Bord befunden hatten. Ein Techniker, der an der Restaurierung eines Nebelhorns mitgewirkt hatte, schwor Stein und Bein, dass Foulis bei Nebel am Strand auf einem Klavier gespielt habe, aber dann stellte sich heraus, dass er etwas durcheinandergebracht hatte und sich lediglich an eine Episode aus der BBC-Serie Coast erinnerte, die der Geschichte von der Erfindung des Nebelhorns nachgegangen war. Um herauszufinden, wie weit der Klang trägt, hatten sie ein Klavier an den Strand geschleppt und darauf gespielt. Einen Auftritt hatte das Nebelhorn auch in der surrealistischen Eingangsszene der Comedy-Show The Smell of Reeves & Mortimer. Dort wird seine Erfindung John Betjemann zugeschrieben und auf das Jahr 1961 datiert. Ein Grund ist nicht erkennbar.
Dass Foulis das Nebelhorn erfunden hat, diese Erklärung ist mir mit allenfalls geringfügigen Abweichungen begegnet, seit ich mich ernsthaft mit dem Thema befasst habe. Erst nach einigen Jahren habe ich mit dem Versuch begonnen, den Ursprung dieser Geschichte ausfindig zu machen. Dort angekommen, hätte ich auch den Ursprung des Nebelhorns gefunden, so meine Überlegung. Doch wie sich zeigte, gibt es ein ganzes Netz an Verbindungen zwischen Foulis, der am Meer spazieren geht, und dem Moment, in dem auf den Klippen am South Shields das Nebelhorn von Souter Point aufgestellt wird.3
In Geschichten gerät ein Leben oft komplizierter, als es in Wirklichkeit war. Die Geschichte von Foulis ist eine elegante, geradlinige Geschichte – ein Mann von der kanadischen Küste verbindet eine Dampfmaschine mit einem großen Horn, und ein neuer Klang ist in der Welt. Gut möglich, dass dies der erste Einsatz einer Dampfmaschine als Nebelsignal war. Tatsächlich ist der Weg, der zu einer Erfindung führt, aber selten so klar auszumachen wie die Wirkung, die sie erzeugt. Hört man sich die Geschichte von Foulis unter diesem Aspekt noch einmal an, dann entdeckt man eine Ballade, die von anrührenden Irrtümern und dichtem Nebel durchdrungen ist.
Nebel stellt die Zeit und die sichtbare Welt still, und im grauen Licht einer konturlosen Umgebung werden wir mit uns selbst und unseren Erinnerungen konfrontiert. So wird es auch Foulis ergangen sein. Als er sich auf den Heimweg machte, ließ er da mit dem Strand auch das Gefühl des Verlustes hinter sich, das mit dem Nebel verbunden ist? Orientierung bot ihm der Klang, der aus seinem neuen Heim stammte, in dem seine neue Familie lebte. In dieser Geschichte übernimmt das Klavier die Rolle des Nebelhorns, denn es weist ihm den Weg in die Sicherheit. Sein Spaziergang im Nebel handelt also bestenfalls zum Teil davon, dass er das Nebelhorn erfindet. Sie berichtet auch von der Trauer, die aus seiner Biografie rührt.
So betrachtet, wandelt sich die Geschichte von einer historischen Wahrheit zu einer volkstümlichen Überlieferung des Industriezeitalters. Als Foulis am Strand von New Brunswick spazieren ging und sich der Nebel senkte, so schnell und dicht, wie es an dieser Küste geschieht, woran dachte er in diesem Augenblick? Warum war er allein? Dachte er, vom Nebel wie in Watte gehüllt, an die Frau, die er verloren hatte? An das neue Leben, das in Form von Klavierakkorden durch den Nebel zu ihm drang? Die Geschichte von der Erfindung des Nebelhorns handelt von mehr als einem Einfall. Foulis’ Spaziergang am Strand berichtet vor allem von der emotionalen Kraft des Nebelhorns, und in dessen Klageton sind diese melancholischen Schwingungen bis heute zu erleben, gleich ob man danebensteht oder eine Aufnahme hört, gleich ob in der Erinnerung oder im Tonstudio.
Mein Interesse gilt seit jeher der Frage nach den Ursprüngen der Musik – wer hat sie warum gemacht? Das Nebelhorn bot mir zum ersten Mal Anlass, statt über eine bestimmte Gruppe oder eine konkrete Komposition über einen spezifischen Klang nachzudenken. Wenn wir im Zusammenhang mit Musik über Ursprünge reden, neigen wir dazu, die Dinge zu vereinfachen und zu verklären. So geschah es auch in diesem Fall. Die überlieferten Fakten gehören zu komplexen Narrativen, von denen manche zu zufälligen Entdeckungen geschrumpft sind. Irrtümer schleichen sich ein, Einzelheiten werden vertauscht, in ihrer Bedeutung vermindert oder verstärkt. Dann kommen wir und verleiben uns diese Schöpfungsmythen ein wie Hostien. Foulis’ Geschichte hat mich dazu angeregt, darüber nachzudenken, wie andere Klänge in die Welt gekommen sind, wie fehlbar die Überlieferung ist und wie unglaubwürdig viele unserer Geschichten sind. Wenn Foulis’ Nebelhorn eine singuläre Erscheinung war – er hat die Erfindung nie patentieren lassen –, stellt sich die Frage, wo der Klang dann seinen Ursprung hatte. Woran macht man historisch fest, dass ein Klang in der Welt ist? An der Technik? Der akustischen Charakteristik? Der Verbreitung des Geräts, das ihn erzeugt? Und wenn Foulis’ Nebelhorn tatsächlich an einer einsamen Küste ertönte, konnte man dann von einem Klang sprechen, wenn niemand da war, der es hören konnte?
Exotica, diese nach lauen Tropennächten klingende Spielart des Jazz, die in den 1950er-Jahren in den USA populär wurde, soll durch die zufällige Begegnung von Martin Denny und seiner Band mit einigen Fröschen entstanden sein. Bei einem Konzert in der Shell Bar in Honolulu sollen sich die Amphibien quakend in ein Konzert Dennys eingebracht haben, und das nicht nur synchron mit der Musik, sondern auch unter Beachtung der Pausen. Wie die Geschichte von Foulis reduziert auch diese die Entstehung eines Klanges auf einen einzelnen, schlaglichtartig hervortretenden Moment, schreibt sie einem gewöhnlichen Ereignis zu, das durch einen außerordentlichen Klang geadelt wird. Die Wahrheit hingegen lautet, dass Denny in seiner Zeit als Soldat der US-Streitkräfte über viele Jahre Instrumente und Klänge aus aller Welt für sein Orchester zusammengetragen hat.
Unter Minimal Music, dieser bedeutenden musikalischen Neuerung, die ihren Anfang in den USA genommen hat, wird oft nur das Werk einer knappen Handvoll Komponisten – Terry Riley, La Monte Young, Steve Reich und Philip Glass – verstanden, obwohl diese Leute in ein Netz von Musikern und Komponisten eingebunden waren, von denen viele – von Julius Eastman bis Joan La Barbara – denselben Überzeugungen und Prinzipien folgten. Dennis Johnson, der mit Riley und Young befreundet war, schuf nur ein Werk, eine minimalistische Komposition für Klavier mit dem Titel November. 1959 geschrieben, wurde sie erst in diesem Jahrtausend einem größeren Publikum bekannt. Interessanterweise nimmt diese Komposition Terry Rileys In C von 1964, die als »Stunde null« der Minimal Music gilt, in vielen Elementen vorweg. Doch damals kannte noch niemand Johnsons Komposition. Wann also entstand dieser spezifische Klang? Mit seinem ersten öffentlichen »Auftritt«? Oder schon mit der ersten Niederschrift, auch wenn die erst Jahrzehnte später zur Kenntnis genommen wurde?
Über Acid House heißt es gelegentlich herablassend, es sei vom Phuture-Mitglied Earl Smith jr. (besser bekannt als der unvergleichliche DJ Spank-Spank) »zufällig« entdeckt worden, als der eines Nachts zusammen mit DJ Pierre an einem neuen Roland-303-Synthesizer herumgespielt habe, um herauszufinden, was man mit dem Gerät alles anstellen konnte. Dabei sei »aus heiterem Himmel« der charakteristische Sound entstanden. Tatsächlich hat Phuture den neuen Klang namens Acid House aus der gründlichen und systematischen Beschäftigung mit der Musikszene Chicagos heraus entwickelt. So wie die Dampfmaschine benutzt wurde, um die Mechanisierung auf eine neue, ungeahnte Stufe zu heben, so wurden Synthesizer dazu verwendet, der Clubmusik neue Dimensionen zu verleihen. Beide Phänomene in einem Atemzug zu nennen mag willkürlich wirken, aber unstrittig ist, dass sich die Entwicklung beider Klänge einem technologischen Fortschritt verdankte, der wiederum weitere Entwicklungen anstieß. Clubmusik und industrielle Revolution sind zwar durch Jahrhunderte voneinander getrennt, gleichzeitig aber durch die forcierte Suche nach technischer Neuerung und Modernität, die ihr eigentlicher Antrieb ist, eng miteinander verbunden. Beide kommen in ihrem Klang überein, der hier wie dort durch Experimentieren entstanden ist. In beiden Fällen bringt eine neue Technologie einen neuen und charakteristischen Klang hervor, der aber nicht durch die Technologie definiert ist, die ihm zugrunde liegt, sondern durch die Art und Weise, wie die Menschen, die ihn hören, ihn einsetzen. Anders gesagt, lässt sich der Klang des Nebelhorns nicht auf seine technische Funktion reduzieren. Kulturelle und soziale Faktoren sowie willkürliche Entscheidungen haben den Klang zu dem gemacht, als das wir ihn heute wahrnehmen.
Musikalische Genres und weltbewegende Erfindungen – egal ob es sich um Nebelhörner oder Acid House handelt – sind so gut wie nie das Werk eines einzelnen Genies. »Helden«-Geschichten, die anderes behaupten, halten einer genaueren Überprüfung nur ausgesprochen selten stand. Und so erweist sich in unserem Fall, dass Foulis nicht der Einzige war, der an einem Signalhorn arbeitete, und das Gerät, das schließlich an unseren Küsten Verbreitung fand, nicht seines war. Parallel zu Foulis entwickelten gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Ingenieure vergleichbare Apparaturen. Ein Amerikaner namens Celadon Leeds Daboll ließ sich 1860 mit Druckluft betriebene Hörner patentieren, zunächst in seiner Heimat, drei Jahre später auch in Großbritannien.4
Der Chemieprofessor Frederick Hale Holmes entwickelte 1863 ein Horn mit einem Rohrblatt als Tonerzeuger, und wenige Jahre später wurde das erste Drucklufthorn patentiert. In den 1880er-Jahren folgten ein handbetätigtes diaphonähnliches Nebelhorn, ein von einem Kolben betriebenes Nebelhorn sowie weitere Varianten. Robert Hope-Jones – der Erfinder der Wurlitzer-Orgel – reichte 1896 ein Patent für eine Weiterentwicklung des Diaphons ein, in dem als Anwendungsgebiet neben der Verwendung in der Orgel ausdrücklich auch Schallsignale genannt werden. Ein weiteres, später eingereichtes Patent hat ausschließlich ein Nebelhorn zum Inhalt.
Nichtsdestotrotz wird die Erfindung des Nebelhorns allein Foulis zugeschrieben. So wie die singenden Frösche der Geschichte von der Erfindung des Exotica erst die richtige Würze verleihen, so ist es in Foulis’ Geschichte das Klavier. In beiden Fällen handelt es sich um eine Zutat, die unabhängig von ihrer historischen Wahrheit den Reiz der Geschichte erhöht. Und in beiden Fällen sagt diese Zutat weniger über den Klang als vor allem darüber aus, welche Gefühle mit ihm verbunden sind. Was Foulis’ Geschichte so fesselnd macht – dass er ein Außenseiter war, ein Einzelgänger, der verarmt starb, obwohl er die gewaltige Maschine erfunden hat, der ich verfallen war –, kann nicht einmal ansatzweise erklären, warum Nebelhörner, auch wenn sie auf seine Erfindung zurückgehen mögen, einen derartigen Einfluss auf eine Musikjournalistin haben können, die ein Jahrhundert später fernab jeder Küste geboren wurde.
Das Patent von Celadon Leeds Daboll aus dem Jahr 1860
Foulis’ Geschichte ist fantastisch und zugleich romantisch. Ich ließ mich von den Stimmungen und Motiven mitreißen, die darin anklingen und mir aus dem Kino vertraut sind, von dem Leid und Verderben, die durch die Geschichte wabern wie der Nebel, in dem sie sich zutrug. Ich begriff, dass dieser Nebel, der vor fast 170 Jahren einen Strand einhüllte, die Tür war, die zu tiefer liegenden Schichten und zu belastbaren Fakten führte, weil er einer der wenigen belastbaren Fakten war, die in der Geschichte steckten. Der Nebel stand für Stimmungen, war Gleichnis und bedeutete Gefahr, aber, wichtiger noch, im Nebel lagen auch Ursache und Wirkung. Nicht nur Foulis’ Geschichte war ohne ihn undenkbar, sondern auch die Existenz des Nebelhorns. Wenn ich das Nebelhorn verstehen wollte, musste ich erst einmal den Nebel verstehen.
Schwerwetter
An einem frostigen Novembermorgen mache ich mich auf den Weg zu meinem Büro. Es liegt an der Themsemündung, und aus dem Fenster kann ich die Salzmarschen von Leigh Marsh sehen. Wenn ich dort bin, arbeite ich im Rhythmus der Gezeiten. Ist das Wasser bei meiner Ankunft weg, gehe ich erst, wenn es wieder zurück ist, ist es da, bleibe ich, bis ich wieder den feuchten Sand der Salzwiesen sehen kann, die im Sommer sattgrün und im Winter schmutzig braun sind. Ich fahre mit dem Fahrrad und komme dabei durch jene Landschaft, in der auch Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis beginnt. Von London kommend, ankert Marlow mit seiner Segeljacht im Mündungsgebiet der Themse. »In der Ferne verschmolzen das Meer und der Himmel.«5 Über den Marschen von Essex hängt Dunst, »der einem Gewebe aus leuchtender Gaze« gleicht.6 Doch als ich eine Pause einlege, um etwas zu verschnaufen, ist kein Horizont zu sehen, kein Himmel und kein Meer und auch keine in Dunst gehüllte Salzmarsch, weil ich von dem hellen Grau eines dichten Morgennebels umfangen bin.
Die Luft ist nass und schwer, die Feuchtigkeit schlägt sich auf meiner Kleidung nieder. Mein Blick ist eigentümlich unscharf und müht sich vergeblich, die klamme und dumpfe Luft zu durchdringen. Der Nebel kriecht in die Manschetten meiner Ärmel, und obwohl ich das Haar zusammengebunden habe, ziehen sich einzelne Strähnen durch die Feuchtigkeit zu Locken zusammen. Wo der Nebel auf das kalte Metall meines Fahrrads trifft, etwa am Lenker, bildet sich Kondenswasser. Laternenmasten und Poller sind allenfalls schemenhaft zu erkennen. Und wie im Dunkeln glaube ich, meinen Atem, der vom Fahrradfahren leicht beschleunigt ist, lauter zu hören als gewöhnlich. Doch auch wenn der Nebel alles vor meinem Blick verbirgt, fühle ich mich anders als im Dunkeln. Ich bin umgeben von Licht, dem die Tiefe fehlt. Die Welt ist zusammengeschrumpft auf die Größe dessen, was ich hören kann, und was ich hören kann, reicht weiter als das, was ich sehen kann. Der Nebel dämpft Geräusche, verbannt den Sehsinn vom Spitzenplatz und schärft meinen Geruchs- und meinen Tastsinn. Wenn ich tief einatme, kann ich sogar die Luft schmecken; ich spüre das salzige Seegras auf meiner Zunge und die öligen Abgase in meinem Hals.
Ich halte inne und lausche.
Leuchtende Scheinwerfer ziehen vorbei wie motorisierte Himmelskörper, die im vom Nebel verlangsamten Straßenverkehr mitschwimmen. Am Ende des zwei Kilometer langen Southend Pier hupt das moderne Nebelsignal, das vom Geräusch der Autos und dem Krächzen der nahezu unsichtbar herumschwebenden Möwen fast übertönt wird. Es soll Kajaks und kleineren Sportbooten den Weg weisen und ist ungleich leiser als die Hörner der Containerschiffe, die in dem ausgebaggerten Teil der Themsemündung Richtung Londoner Hafen ziehen. Wenn der Nebel so dicht ist wie heute, stoppen die großen Schiffe mitunter im Hauptfahrwasser oder fahren sehr langsam und geben mithilfe des Nebelhorns ihre Position kund. Um das Piepsen am Ende des Piers auch nur wahrzunehmen, sind sie viel zu groß, Kapitän und Besatzung stecken in geschlossenen Ruderhäusern und Kabinen hoch über der Wasserlinie.
Ich, die ich auf festem Boden stehe, aale mich derweil im Nebel und genieße die Stille um mich herum. In Eugene O’Neills Drama Eines langen Tages Reise in die Nacht, in dem der Nebel als Versinnbildlichung für die Eintrübung des Verstandes durch die Alkoholsucht steht, findet Edmund für seine Weltflucht folgende Worte:
Gerade den Nebel wollte ich. Wenn man halb den Weg herunter ist, kann man das Haus schon nicht mehr sehen. Man weiß nicht mehr genau, wo es war. Auch nicht die anderen Häuser, den ganzen Weg entlang. Ich konnte nur ein paar Schritt weit sehen. Keine Menschenseele weit und breit. Alles um mich herum sah und hörte sich unwirklich an. Nichts war so, wie es ist. Das wollte ich gerade – mit mir selbst allein sein in einer anderen Welt, wo Wahrheit unwahr wird und das Leben sich vor sich selbst verbergen kann. Hinter dem Hafen, wo die Straße am Ufer entlanggeht, habe ich sogar das Gefühl verloren, auf festem Boden zu sein. Nebel und Wasser gingen ineinander über. Es war, wie wenn man auf dem Meer ginge, über das Wasser. Als ob ich vor langer Zeit ertrunken wäre. Als wäre ich ein Geist, dem Nebel zugehörig, und der Nebel war der Geist des Meeres.7
Nebel ist Materie gewordenes Wetter, zugleich greifbar und unbegreiflich. Ein Nebelhorn erklingt im Nebel und wegen des Nebels, Klang und Wetter sind dadurch verbunden, dass sie auf unsere Sinne einwirken. Nebel löscht das Sichtbare aus, während das Brüllen des Nebelhorns in der Undurchsichtigkeit als akustischer Anker fungiert. Nebel wirkt anders als Dunkelheit – die Nacht lässt sich künstlich aufhellen, aber wie vertreibt man Nebel? Kennen Sie einen anderen Klang, der so fest mit einem bestimmten Wetter verbunden ist? Die Glocke eines Eisverkaufswagens? Die Sirenen der Gezeitenwarnung von Venedig? Das Heulen der Zivilschutzsignale? Keiner dieser Klänge gleicht dem des Nebelhorns. Der Eiswagen bimmelt bei jedem Wetter. Zivilschutzwarnungen gehen dem Ereignis voraus, ihr Warnruf fordert die Menschen zum Handeln auf. Das Nebelhorn unterscheidet sich diametral davon, nicht nur hinsichtlich der Technik, sondern auch funktional. Offiziell handelt es sich um eine Navigationshilfe. Es wurde nicht nur erfunden, um Schiffe vor gefährlichen Küstenabschnitten und Sandbänken zu warnen, sondern vor allem, um ihnen mitzuteilen, wo sie sich befinden.8
Sind wir dem Wetter ausgesetzt, werden alle unsere Sinne angesprochen, in jedem Falle aber der Sehsinn, der Hörsinn und der Geruchssinn, mitunter auch der Tastsinn. Ein Sommerregen bewirkt eine Veränderung der Lichtstimmung, weil sich der Himmel verdunkelt und Regenwolken aufziehen. In Städten ist der Geruch des Staubes, der vom heißen Beton aufsteigt, ein Vorbote der ersten Regentropfen, die wir auf unserer Haut und in unseren Handflächen spüren. Auf dem Land steigt uns der Duft von Erde und Laub in die Nase.9
Um verschiedene Arten von Nebel zu unterscheiden, wird zunächst danach geschaut, wie und wo er sich bildet. Strahlungsnebel entsteht, wenn die Erde nach Sonnenuntergang auskühlt; er legt sich im Morgengrauen über Marschen und Senken und löst sich mit steigenden Temperaturen in Wohlgefallen auf. Advektionsnebel bewegt sich horizontal fort und rollt heran, wenn sich feuchte Luft über eine kältere Fläche wie das Meer oder ein Schneegebiet legt. Es gibt Talnebel und Bergnebel, auch orografischer Nebel genannt, Verdunstungsnebel und Eisnebel. Es gibt sogar Nebelbögen – farblose Lichtbögen aus leuchtendem weißem Dunst.
Nebel, Dunst und Wolken sind Variationen ein und desselben Prinzips: Kondensation. Die Definition von Nebel ist dabei ausgesprochen anthropozentrisch geraten, weil sie einen Beobachter voraussetzt. Der einzige Unterschied, den der britische meteorologische Dienst zwischen Nebel und Dunst macht, ist die Sichtweite. Nebel unter wissenschaftlichen Aspekten in den Blick zu nehmen bedeutet daher, den Menschen als Beobachter aus der Definition zu entfernen.
Waren Sie je auf einem Konzert oder in einem Club, wo so viel Kunsteis zum Einsatz kam, dass Sie sogar von Ihrer Begleitung separiert wurden? Wie hat sich das angefühlt? Haben Sie sich desorientiert gefühlt, verloren? Nehmen Sie dieses Gefühl, nicht sehen zu können, was sich unmittelbar neben Ihnen befindet, und versetzen Sie sich auf ein Schiff auf hoher See. Sie haben keine Ahnung, in welche Richtung Sie fahren, und die Situation wird allmählich gefährlich. Ursache ist ein Verlust, das Fehlen von Orientierungspunkten, die gewöhnlich für die Navigation benutzt werden – gleich ob Sie in Ihre Stammkneipe oder in einen sicheren Hafen wollen, wenn auch mit unterschiedlichen Folgen.
Musiker, die in ihren Konzerten große Mengen Trockeneis einsetzen, nutzen den Nebel als Kulisse für die Musik, die zu hören das Publikum gekommen ist. Die mit langen Mänteln und Kapuzen angetane Gruppe Sunn O))), prominente Vertreter des Doom Metal, deren dröhnende Gitarren aus monumentalen Verstärkertürmen dringen, setzt Nebel ein, um die Intensität des Klanges zu erhöhen. In ihren Konzerten machen sie davon derart massiv Gebrauch, dass in angrenzenden Gebäuden die Rauchmelder ausgelöst wurden. In dem einen Zusammenhang kann Nebel, selbst wenn er aus der Maschine stammt, also Nervenkitzel bewirken, weil er die Welt im Handumdrehen verändert. In einem anderen Zusammenhang, etwa auf See und ohne festen Boden unter den Füßen, verbreitet er Angst und Schrecken.
Nebel, der sich über das Meer und die Küste senkt, ist lebensbedrohlich, weil sich in seinem Gefolge der Tod anschleichen und ganze Schiffe verschlingen kann. Jeder Seemann weiß, wie schnell Nebel aufziehen kann und was das für den Orientierungssinn bedeutet. Chris Williams, der als Hausmeister und Teilzeit-Wärter auf dem Leuchtturm von Nash Point in Südwales gearbeitet und zahllose Ausfahrten auf dem Bristolkanal unternommen hat, erinnert sich daran, dass sich sein Boot einmal bei dichtem Nebel um 180 Grad gedreht hat, während er sich einen Handschuh überzog.
Nebel beschreibt eine Grenze, Nebel beschreibt eine Stimmung. Wenn Ella Fitzgerald A Foggy Day von George Gershwin singt, geht es nicht um das Wetter, sondern um den Nebel als Gleichnis für ein persönliches Leid. Wenn der Angebetete schließlich auftaucht, lichtet sich der symbolische Nebel. Doch der Nebel ist nicht nur der sichtbare Ausdruck für Ellas Gefühle, sondern zugleich etwas, das diese Gefühle erst hervorruft. Wenn Bob »The Bear« Hite von der Gruppe Canned Heat auf der Platte Live at Topanga Corral10 murmelt »I’m already in a fog. I don’t need the machine«, dann zielt er auf eine gänzlich andere Form des Nebels ab, die ihn einhüllt – einen Nebel, der chemikalischen Ursprungs ist.
Der Nebel zieht sich durch die westliche Kultur wie eine Rauchschwade, angefangen von Aphrodite, die in der Ilias Paris mithilfe einer Wolke in Sicherheit bringt, bis hin zu John Carpenter, der in seinem Film Nebel des Grauens eine Nebelbank über eine verschlafene Kleinstadt an der kalifornischen Küste hereinbrechen lässt, in der von Lepra gezeichnete Zombie-Piraten stecken. Stephen King lässt in seinem Buch Der Nebel ebenfalls Monster auftreten; in James Herberts Roman Der Nebel bringt er Wahnsinn unter die Menschen. Eine besondere Rolle spielt der Nebel im Genre des Schauerromans, wo er als Sinnbild der menschlichen Irrtümer und als Schwelle zur Geisterwelt dient. Nebel spielt eine tragende Rolle in Susan Hills Die Frau in Schwarz, in den Büchern mit Sherlock Holmes und bei H. G. Wells. Robert Louis Stevensons Figur Dr. Jekyll biegt in eine neblige Gasse ein und verlässt sie als Mr. Hyde.11 Am meisten beeindruckt mich jedoch der Nebel, der Dracula an die Küste von Whitby verschlägt (der dortige Leuchtturm erhielt übrigens erst 1903 ein Nebelhorn, also einige Jahre nach Draculas Ankunft). Das Schiff erreicht die Küste bei dichtem Nebel, der selbst nach britischem Maß gemessen beklemmend ist:
Dann kam wieder der Nebel vom Meer, dichter als zuvor, eine feuchte Dunstmasse, die alles wie ein graues Leichentuch einhüllte, so dass die Menschen ganz auf ihr Gehör angewiesen waren, denn das Brüllen des Sturms und das Krachen des Donners und das Dröhnen der mächtigen Böen drangen noch lauter als zuvor durch die nasskalten Schleier.12
In San Francisco gehört der Nebel zur Stadt und die Stadt zum Nebel. Und zu diesem Nebel gehören die Nebelhörner. Rund um die Bucht von San Francisco ertönen sie durchschnittlich zweieinhalb Stunden pro Tag, und in den Brauereien im Umland wird Bier gebraut, das Verloren im Nebel, Nebelbrecher oder Stadt des Nebels heißt. Wenn die Einwohner von San Francisco über Wolken reden, sprechen sie von »hohem Nebel«, und wenn dieser hohe Nebel in die Straßen der Stadt Einzug hält, fühlen sie sich »eingenebelt«. In einem Buch von Edwin Rosskam von 1930 heißt es, dass der Nebel nicht zum Wetter gehört, sondern »wie eine Insel im Wetter treibt«. Der Nebel ist so allgegenwärtig, dass er in Gestalt eines sarkastischen Charakters namens Karl der Nebel (benannt in Anlehnung an die Figur Karl der Riese aus dem Film Big Fish) einen eigenen Twitter-Account unterhält. Karl brüstet sich damit, das Feuerwerk zum Nationalfeiertag verhindert zu haben, ärgert Touristen, indem er sich vor die Linsen ihrer Fotoapparate schleicht, und schießt Selfies – graue Rechtecke in unterschiedlichsten Schattierungen. Besonders Letzteres entbehrt nicht einer gewissen Komik, weil Nebel selbst nicht fotografiert werden kann, sondern allenfalls seine Wirkung, etwa wenn er ein Motiv ganz oder teilweise verhüllt. 1966 behauptete ein gewisser Gareld M. Corman, er habe eine Linse erfunden, mit der er durch den Nebel von San Francisco hindurchsehen könne. Er gab ihr den Namen »Ohmichlescope«.13
In seinem Buch über das Wetter in der Bucht von San Francisco – das in Wahrheit ein Buch über den Nebel in der Bucht von San Francisco ist – führt Harold Gilliam aus, dass pro Stunde bis zu einer Million Tonnen Wasser in Form von Dunst und Nebel durch die Meerenge Golden Gate wabert. Im späten Frühling und im Sommer kann die Nebelwalze zwischen hundert Metern und mehreren Hundert Kilometern breit und zwischen hundert Metern und einem knappen Kilometer hoch sein – Ausmaße, die ihn zugleich fester und stofflicher wirken lassen, als er tatsächlich ist. Der Schriftsteller George Sterling, der San Francisco als »kühle, graue Stadt der Liebe« bezeichnete, war davon überzeugt, dass der Nebel eines schönen Tages als Energiequelle genutzt werden könnte, weil er mit bis zu sechzig Stundenkilometern durch das Golden Gate strömt.
Solch beeindruckende Zahlen verschlinge ich regelrecht, aber so aussagekräftig sie auch sind, verlieren sie ihre Bedeutung, wenn man sie auf eine Masse bezieht, bei der es sich letztlich um bewegte schwere Luft handelt. Nebel kann ich weder greifen noch fotografieren – seine Anwesenheit erschließt sich allein aus der Relation zu anderen Dingen.
Geschwindigkeit, Dichte und Häufigkeit des Nebels in der Bucht sind zurückzuführen auf Verschiebungen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Platte, die sich vor 650 000 Jahren zugetragen haben. Die Bucht ist genau genommen ein Durchbruch, den der Pazifische Ozean auf Meereshöhe in die kalifornischen Küstengebirge geschnitten hat, und weil sich dieser Durchbruch am Golden Gate stark verjüngt, wird die Luft, gleich ob heiß oder kalt, stark beschleunigt, wenn sie hindurchmuss, weshalb der Sonne zehn Minuten und weniger genügen, um sie in Nebel zu verwandeln. Würde man den Nebel von San Francisco mitsamt der aus den geografischen Besonderheiten resultierenden Energie an die Themsemündung verfrachten, könnte ich ihm mit dem Fahrrad nicht folgen.
Die Frühjahrs- und Sommernebel von San Francisco sind Advektionsnebel, der entsteht, wenn feuchte Luft auf die Wasseroberfläche in der Bucht trifft oder, bei warmem Wetter, warme Luft an den umgebenden Hängen aufsteigt und abkühlt. Winter- oder Tule-Nebel sind Strahlungsnebel; verantwortlich ist das Zusammentreffen von kaltem Land und warmer Luft, die darüber hinwegstreicht. Der Ausdruck »Tule« ist eine Ableitung aus dem Aztekischen und meint die Binsen, an denen sich der Nebel sammelt. Für die meisten Schiffsunglücke, die sich in der Bucht ereignen, sind diese Winter- oder Tule-Nebel ursächlich.
Auch für andere Nebelformen, die sich einer besonderen Geografie verdanken, gibt es dialektale Bezeichnungen. Manche ziehen besonders schnell auf, andere sind besonders kalt, und wieder andere zeichnen Trugbilder in die Luft. In Südamerika heißen besonders dichte Nebel, die nicht von Regen begleitet werden, camanchaca, in Chile und Peru steht das Wort garúa für kalte Winternebel; die im Westen der USA lebenden Schoschonen nennen Nebel, der in den tiefen Gebirgstälern gefriert, pogonip. Das Niederländische kennt den Ausdruck witte Wieven, womit in Nebelschwaden gehüllte Frauen gemeint sind, die im Herbst erscheinen. In Schottland und Nordengland heißt Meeresnebel kurz haar oder fret.
Nebel spielt im Volksglauben und in der Mythologie eine wesentliche Rolle. Mal ist er der Bote, der etwas bringt, mal der, der Dinge enthüllt, dann wieder jemand, der eine Brücke zwischen der diesseitigen Welt und anderen Sphären schlägt. An der britischen Küste kursiert eine Geschichte aus dem Cornwall des 16. Jahrhunderts, die von einem großen Nebel berichtet, aus dem eine Burg hervorsteigt, gefolgt von einer Flotte aus größeren und kleineren Schiffen. Der Legende nach lag die Isle of Man einst unter der Wasseroberfläche, und als sie sich schließlich erhob, blieb sie unter einem magischen Nebelschleier verborgen. Auch Avalon war laut manchen Überlieferungen auf magische Weise verhüllt. In außereuropäischen Kulturen sind solche mythischen Erscheinungsformen des Nebels ebenfalls anzutreffen. Im Popol Vuh – der Schöpfungsgeschichte der Mayas – bewirkt das Aussprechen des Wortes »Welt«, dass sich das Land »wie eine Wolke, wie Nebel« aus dem Wasser erhebt. Seinen Ursprung mag dieses Bild in der Art und Weise haben, in der Wolken und Nebel die Berge ver- und enthüllen, von denen die Region geprägt ist.
Doch wo oder wann auch immer, in all diesen Geschichten, erst recht in der Wirklichkeit, ist der Nebel so gut wie nie harmlos oder ungefährlich. Im Zweiten Weltkrieg verhinderte Nebel über den Flugplätzen, dass Flugzeuge der Alliierten sicher landen konnten, wenn sie von ihren Einsätzen zurückkamen. Aus diesem Grund wurde FIDO entwickelt, ein System aus zwei langen, mit Treibstoff gefüllten Röhren, die parallel zur Landebahn ausgelegt und in der Hoffnung angezündet wurden, dass sich so der Nebel vertreiben ließe. Auf diese Weise wurden pro Stunde 450 000 Liter Treibstoff vernichtet. Piloten, die sich im Anflug befanden, bot sich mit der brennenden Landebahn ein wahrlich infernalisches Bild. Doch das war sicherlich immer noch besser als die bis dahin verwendete Praxis, im Fall, dass der Flugplatz im Nebel lag, mit dem Fallschirm abzuspringen und das Flugzeug ins Meer stürzen zu lassen.
Auf meinem Weg entlang dem Themseufer fällt mir das Läuten einer Glocke auf, die an einer Tonne befestigt ist und von den Wellenbewegungen zum Klingen gebracht wird. Ich kann die Umrisse der Landschaft förmlich hören, wissend, dass die Flut noch bevorsteht. Bei uns Sehenden wird der Orientierungssinn durch Nebel empfindlich gestört, ohne dass er dadurch greifbarer würde. Wir können ihn nicht in die Hände nehmen, und doch legt er sich um uns, vereinzelt uns, schneidet uns von der Außenwelt ab.
Künstlerinnen und Künstler wie Ólafur Elíasson, Antony Gormley und Fujiko Nakaya – eine Bildhauerin, die für ihre Nebelinstallationen bekannt ist, die sie wie flüchtige Skulpturen für den öffentlichen Raum entwirft – haben diese Eigenschaften des Nebels in ihrer Arbeit aufgegriffen. Alle drei haben mit teils überwältigendem Erfolg Ausstellungen veranstaltet, die die Frage thematisierten, was es bedeutet, in künstlichen Nebel einzutauchen und sich so von der Außenwelt abzukapseln. Solcherlei Kunst ist auf keinerlei Vorwissen angewiesen, weil sie eine unmittelbare sinnliche Erfahrung ermöglicht. Auch das kann Nebel.
Auch Menschen mit eingeschränkten sinnlichen Fähigkeiten kennen eine solche Neuordnung der Wahrnehmung unter dem Einfluss von Nebel. Blinde nennen Schnee gelegentlich auch »Nebel der Nichtsehenden«, weil er die Informationen über die Welt unterdrückt, die sie sonst über das Gehör aufnehmen. Während Sehende Ecken und Flächen, Wege, Straßen und Hindernisse über die Augen wahrnehmen, orientieren sich Blinde anhand des Echos, das auf ihre Ohren trifft. Schnee aber löscht diese Informationen aus. Wenn ein Blinder bei Starkregen die Haustür öffnet, dann ist das, so John M. Hull in seinem Buch Im Dunkeln sehen, als würde ein Sehender die Vorhänge seines Fensters öffnen. Beide verschaffen sich ein Bild von der Welt, der eine über die Augen, der andere über das Gehör.14
Zurück nach Essex, wo ich noch immer am Ufer der Themse entlangradele, das Kollern der Gänse und den Klang der Fallen höre, die im Jachthafen an metallene Masten schlagen. Diese Geräusche sagen mir, wo ich mich befinde, setzen meinem wenig verlässlichen Raumgefühl willkommene Grenzen. In dichtem Nebel auf meine Umwelt zu hören hat mir dabei geholfen, für die Geschichte, der ich auf der Spur war, einen Rahmen zu finden und so etwas über die Rolle herauszufinden, die das Nebelhorn in der Klanglandschaft unserer Küsten einnimmt.





























