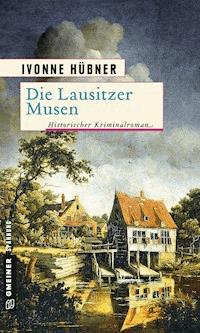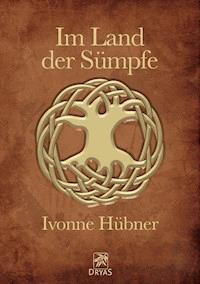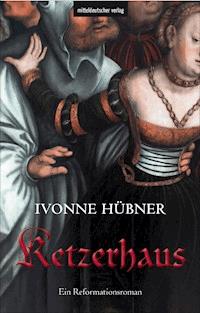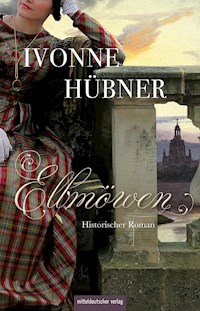Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Cornelius Waldeck
- Sprache: Deutsch
Das Zigeunermädchen Rosana und ihren Clan verschlägt es 1813 in die Nähe von Weißenberg in der Oberlausitz. Nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters, der zu Unrecht in einem Weißenberger Gefängnis saß, verbannt die Stadt den Clan aus der Gegend. Genau drei Jahre später findet der Jungköhler Lorenz einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichnam in seinem Kohlenmeiler. In der Nähe wurden Rosana und ihre Familie gesichtet. Fasziniert von den Zigeunern versucht Dr. Cornelius Waldeck, Licht in die Verbrechen zu bringen. Hat sich der Clan für den Tod von Rosanas Vater gerächt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ivonne Hübner
Das Mädchen im schwarzen Nebel
Historischer Kriminalroman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Die Lausitzer Musen (2016)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Константин_Е._Маковский_-_Цыганка.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SI_Netphen-Walpersdorf_Kohlenmeiler_01.jpg
ISBN 978-3-8392-5494-3
Teil 1
in dem von einem Zigeunermädchen,
dem Beelzebub im Wald und
einer Toten im Holzkohlemeiler
berichtet wird.
Königreich Sachsen
Markgraftum Oberlausitz, sächsischer TeilOktober 1816
Lorenz hätte nicht sagen können, was mehr schmerzte: sein Brummschädel oder sein Knie, das er sich gestoßen hatte, als er aus der Köte gestolpert war. In seinem Traum hatte es nach verkohltem Holz gerochen. Ein Albtraum. Der Geruch nach brennendem feuchtem Holz war in seiner Welt ein Vorbote dafür, dass ihm Übles bevorstand. Lorenz war nicht von der zimperlichen Sorte, aber noch zu betrunken, um das, was er sah, logisch zu verknüpfen. Das Knistern und Fauchen hatte ihn wahrscheinlich nur noch mehr eingelullt. Es hatte eine Weile gedauert, bis ihm ein Gefühl oder eine Ahnung, ein Schutzengel womöglich, klarmachte, dass die Geräusche nicht aus seinem Traum, sondern vom Platz vor der Köte kamen.
Nun bot sich ihm ein Anblick, der unter seinesgleichen für Spott sorgen würde. Die Kälte war vergessen. Lorenz, ohnehin ein schweigsamer Charakter, verschlug es statt der Sprache den Atem. Alles, was seiner Kehle entwich, war ein nervöses Auflachen, das in schrilles, fassungsloses Gelächter umschlug. Dessen Echo glitt über geperlte Moose zum Rand der Kuppe, um dann mit der Wucht einer Lawine hinab ins Bett des Löbauer Wassers zu rollen und auf der anderen Seite der Senke an den steilen Klippenfelsen wie das Krächzen Hunderter Rabenvögel emporzuschnellen. Irgendwo dort auf der anderen Seite des Flusses verfing es sich im Kieferngeäst und der Dunkelheit des Dickichts.
Sein Vater würde ihn umbringen!
Lorenz – verkrampft wie eines dieser Holzgesichter, die der Harzer Hinze in seine angezapften Bäume schnitzte – starrte unverwandt auf die Katastrophe. Der Qualm entfuhr dem gestern noch stolz und bildschön konisch geschichteten, zu ebener Erde gebetteten und von trockenem Moos gewandeten Meiler. Rauch stieg auf. Er war nicht weiß, wie er sein sollte. Schwarzer, dichter Brandatem. Die Wolke musste bis ins Dorf und weiter hinüber in die Wälder jenseits der Via Regia bis zur Hütte seines Vaters zu sehen sein.
Lorenz wusste, sein Vater saß zur Stunde über einem Becher heißen Bieres und würde bald den Fuß vor die Hütte setzen, den Kopf in den Nacken legen und durchs Fenster nach dem Odem des Tagwerks seines ältesten Sohnes Ausschau halten. Er würde mit stolzgeschwellter Brust den reinen weißen Rauch über dem tagelang erschaffenen Gebilde erwarten, so vollkommen, als handele es sich um Lorenz’ Meisterstück. Ein Meisterstück, das den Umtrunk verdient machen würde. So jedoch waberte der Qualm unheilvoll, blauschwarz und träge in die Gegend.
Obwohl Lorenz so dicht am noch rauchenden Scheiterhaufen stand, fröstelte er, nicht fähig, sich vom Fleck zu rühren. Schließlich zur Köhlerhütte umgewandt, brach es aus ihm heraus: »Knut!«
Lorenz bückte sich durch die von Moos und Gras abgedichtete Luke in die kegelige Köte. »Hannes!«
Doch seine Gesellen schnarchten. Er trat gegen das Bettgestell des einen und knuffte die Hüfte des anderen. »Ihr Ochsen, wacht auf!« Zwei Bären, während des Winterschlafs gestört, hätten nicht träger sein können. Knut war der Erste, der sich aufsetzte. Er rieb seine Augen und schaute dümmlich drein.
»Wieso habt ihr ihn angesteckt?«, schrie Lorenz so inbrünstig, dass ihm der Hals wehtat. Der Kopf, das Knie, der Hals.
»Angesteckt?«, rappelte sich auch Hannes auf.
»Ja, angesteckt, angezündet, unter Feuer gesetzt! Wieso?«
Beide Gehilfen begriffen nicht, was er ihnen versuchte zu sagen. »Los jetzt, raus mit euch! Wir müssen retten, was zu retten ist!« Lorenz war den Tränen näher als dem Schimpfen. Das verriet auch seine Stimme, die jetzt weich wie die eines vernunftbegabten Erwachsenen gewesen war. Er hatte lange Jahre Zeit gehabt, sich an den Gedanken zu gewöhnen, die Arbeit ohne seinen Vater zu verrichten. Solange alles glatt lief, hatte ihm die Verantwortung nichts ausgemacht. Aber jetzt fühlte es sich anders an.
Lorenz gab beiden einen Klaps auf die Schulter, den sie als Schwung brauchten, um aufzustehen. Im Hinausgehen schnappte er sich den Reißhaken und stand wieder ratlos vor dem qualmenden Haufen, der gestern so wohlgeformt ausgesehen hatte.
Seine beiden Gesellen taten es ihm gleich und blieben, nachdem sie sich durch die niedrige Luke gequält und aufgerichtet hatten, ratlos vor dem Meiler stehen.
»Bei allen Heiligen!«, stammelte Hannes, der Katholik war, und wandte sich an Knut: »Wieso hast du ihn angesteckt, du Idiot?«
»Hab ich gar nicht.«
»Mein Vater bringt mich um!«, murmelte Lorenz und schüttelte den Kopf starr vor Kälte und vor Angst wie gelähmt.
»Ich bin nach der letzten Partie eingeschlafen.«
»Gar nicht wahr, pissen warst du noch, genau wie der Meister … Meister … ich war das nicht, der Hannes war’s.«
»Der bringt mich um.«
»Ich war überhaupt nicht pinkeln. Wie willst du das wissen?«
»Der wird mich vierteilen!«
»Waren wir nicht gemeinsam am Baum?«
»Oder er zieht mir das Fell über die Ohren.«
»Waren wir gemeinsam pinkeln? Ich weiß das gar nicht. Du, Lorenz, waren Hanni und ich pi…«
»Halt endlich das Maul!«, brüllte Lorenz, atmete jetzt verzweifelt tief die stinkende Luft ein und drückte Knut den Reißhaken vor die Brust. Knut mochte ein Schwätzer sein, ein Faulpelz war er nicht. So riss er den ersten Grasplacken heraus. Hannes besann sich, schnappte sich seinen Reißhaken, um die Holzkohle herauszuziehen, falls überhaupt welche da war.
Lorenz fuhr sich verzweifelt durchs Haar. »So ein verfluchter Mist!« Das war gelinde ausgesprochen, und die Verzweiflung wuchs stetig. Aber der junge Mann fasste den Mut, um den Meiler herum zu gehen, damit er das ganze Ausmaß in Augenschein nehmen konnte. Es war so, wie er befürchtet hatte: Die der Köte zugewandte Seite war noch die unbeschadetere. Auf der anderen Seite, wo der Wind reingeblasen hatte, gähnte das Loch, das die Feuersbrunst hineingefressen hatte. Wie zu erwarten, hatte das offene Feuer nur sehr wenig und obendrein minderwertige Holzkohle fabriziert. Damit ließ sich nicht ein einziger Sack füllen und kein Schilling verdienen. Lorenz tat sich leid.
Auf nüchternen Magen war der Gestank, der mit jedem Hieb, den sie taten, intensiver und aufdringlicher wurde, kaum zu ertragen. Sie tränkten ihre Halstücher in Bier, damit der Brandgeruch sie nicht allzu sehr peinigte. Knut und Hannes schafften es, auf ihrer Seite bis zum Quandelschacht vorzudringen. Die drei Quandelstangen waren so gut wie unversehrt, lediglich ein paar Flammen hatten an ihnen geleckt. Die Streben waren so trocken geworden, dass Lorenz sie kein zweites Mal würde verwenden können. Im Innern des Schachtes waren überraschenderweise das trockene Reisig, die zum Anfachen benötigte alte Holzkohle und das fein gespante Holz nicht vom Feuer berührt worden. Lorenz stutzte.
Weil weder Hannes noch Knut sich regten, hob Lorenz den Blick über die Reste des Kegels hinweg. Hannes stand da, bleich um die Nase, die Augen entsetzt geweitet, und presste sich die Hand vor den Mund. Knut wirbelte plötzlich herum und erbrach sich an der nächsten Kiefer.
»Ich sag doch immer, du verträgst nicht einen Tropfen«, murrte Lorenz.
»Nee, Meister, das kommt nicht vom Bier«, ließ Hannes die Hand sinken. Und weil der Geselle nicht weitersprach und so entsetzt einen Punkt fixierte, umrundete Lorenz den Meiler.
»Was ist los?«
Hannes antwortete nicht, und von Knut war lediglich ein Würgen zu hören. Der Anblick dessen, was Knuts Magen in Wallungen gebracht hatte, ließ nun auch Lorenz’ Säfte schäumen.
Im Königreich Sachsen zwischen Elbe und Spree
Herbstmonat1813
Rosana interessierte es nicht, wer schuld am Krieg war. Es interessierte sie nicht, was zwischen diesem Napoleon Bonna-Dings und dem Preußen, dem Russen und dem Schweden passiert war. Sie interessierte einzig, dass ihr Clan immer weiter nach Osten gedrängt wurde.
Wenn sie die Älteren am Feuer belauschte, hörte sie immer wieder zwei Worte heraus: »nicht willkommen.« Rosana war alt genug, um zu wissen, was das bedeutete, aber zu jung, um den Grund dafür zu kennen oder zu wissen, was man dagegen tun konnte, nicht willkommen zu sein. Sie und ihre Sippe blieben nirgends so lange, um genug Geld einzunehmen und sorgenlos leben zu können.
Dass die Seiltanznummer ausfiel, machte es ihnen nicht gerade einfacher.
Rosana interessierte nicht das Geld. Sie interessierte, ob ihre Mutter, Olivia, sich von dem Sturz wieder erholen würde. Ihre Mutter tat so, als habe sie keine Schmerzen, aber Rosana wusste es besser. Sie beobachtete Olivia, wenn diese sich unbeobachtet wähnte. Als ihre Mutter das schwarze, leicht gewellte, seidenweiche Haar bürstete, klimperten ihre Ohrgehänge, und als sie das teure, mit Silberfäden durchwirkte Fransentuch über die Schultern legte, bildete Rosana sich ein, das Metall der gestickten Rosen im Tuch knistern zu hören. Sie erkannte genau, dass es ihrer Mutter Schmerzen bereitete, sich aus dem Sitzen aufzurichten.
Rosana war nicht dabei gewesen, als Olivia in die Tiefe gestürzt war. Sie hatte ihren ältesten Bruder Danino darüber ausgefragt. »Du fragst so viel«, hatte er zu ihr gesagt, »so viel wie Kiesel im Flussbett liegen. Und hast du erlebt, dass der Fluss deshalb schneller fließt?«
Durch das kleine rot gerahmte Fenster an der Wagenseite tastete Rosana mit den Augen den Ausschnitt des Wagenplatzes ab. Sie erspähte ihren Bruder, der sich von Vetter Emilio die frisch gewetzten Messer aushändigen ließ. Rosana beobachtete die beiden jungen Männer, die sich mit ihren Messern darin übten, aus fünfzehn Fuß Entfernung ein an eine Kiefer geheftetes Ahornblatt zu treffen.
»Die im Dickicht sammelst du allein wieder ein«, hörte sie Emilio lachen. Er war der Ältere von beiden und freute sich über Daninos Fehlversuche. Dieser grummelte missvergnügt und suchte im angrenzenden dichten Wald nach den Klingen, die das Ziel nicht getroffen hatten. Es handelte sich um einen so dichten Mischwald, dass er die Kinder einschüchterte und selbst Rosana, die fernab menschlicher Siedlungen aufgewachsen war, verängstigte.
Zumindest eines von Daninos Messern hatte den Stamm getroffen, wenn auch nicht das Laubblatt. Er war Artist und kein Messerwerfer. Er war ein Sohn der Lüfte, nicht des Metalls. Messerwerfen und Schwertschlucken war Sache von Emilios Familie. Vorerst schienen die Messerwerfer Daninos Interesse an den Klingen als Spinnerei abzutun.
Rosana wich der Tür aus, die knarzend aufschwang, und machte der Schwester ihrer Mutter Platz, die ein Tiegelchen aus weißem Porzellan in der Hand hielt. Die Worte, die die beiden Schwestern wechselten, verstand Rosana nicht. Dem gedämpften Tonfall entnahm sie jedoch, dass sowohl ihre Mutter als auch ihre Tante in Sorge wegen der Hüftprellung waren. Ein Schaudern fuhr Rosana durch Mark und Bein, als ihre Mutter den Rock aufband. Ein Schaudern, das vor ihrer Mutter nicht verborgen blieb. Olivia schlug das glitzernde schwarze Tuch mit den roten Rosen über die blau unterlaufene Stelle und wechselte mit Esmeralda einen Blick, den Rosana nicht deuten konnte.
»Wieso hängst du die Wäsche nicht in die Sonne?«, fuhr Olivia ihre Tochter strenger an als gewöhnlich.
»Hast du große Schmerzen?« Der süßliche Geruch der Salbe, den ihre Mutter aus dem Töpfchen nahm, strömte in Rosanas Nase.
»Nu, mica printesa.« Kleine Prinzessin, so nannten sie Rosana, obwohl sie nicht die Jüngste der verzweigten vica, der Sippe, war.
Aber auch die liebevolle Verneinung beruhigte Rosana nicht. Im Gegenteil, sie schürte die Besorgnis. Rosana nahm die drei Schritte bis zu den Frauen, streckte die Hand aus und fasste den Mut, das Tuch, das Olivia eben über die Hüfte gelegt hatte, anzuheben.
»Es wird schon wieder gut«, hörte sie Tante Esmeraldas sanfte Stimme und spürte deren Finger, die den Zipfel ihres Kopftuches über ihre Schultern strichen. Esmeralda musste es wissen: Sie war immerhin Wahrsagerin.
»Wird sie wieder auf das Seil können?«, wollte die Jüngere wissen, als wäre ihre Mutter nicht da. Beide Frauen schenkten ihr nur ein müdes Lächeln. Weder ein Ja noch ein Nein. Olivia mahnte Rosana, die kein Kind mehr, aber auch noch keine verheiratete Frau war, endlich die Wäsche aufzuhängen, bevor die Sonne hinter den Wipfeln verschwunden sein würde.
Rosana stieß die grün lackierte Wagentür hinter sich zu und nahm den Wäschekorb, der vor dem Wagen stand. Die Tage waren noch lange hell und warm. In Ermangelung einer Bleichwiese spannte Rosana die Schnur zwischen zwei dünnen Birken und beobachtete die Kinder, die im Wagenkreis Fangen spielten, obwohl ihnen die Erwachsenen das untersagt hatten. Matéo war das selbst ernannte Oberhaupt der Gruppe. Er forderte, im Zirkel sollen Ruhe und Wärme herrschen. Wärme durch das Feuer und Ruhe durch gedämpfte Unterhaltungen und dem Spiel auf der Fiedel. Rosana mochte die Lieder. Die traurigen lieber als die für den Tanz. In den traurigen wurde von vergangenen Zeiten gesungen. Von Zeiten, als die Trosse der Fahrenden noch lang waren und respektiert wurden.
Matéo behauptete, dass es Zeiten, in denen die Zigani geachtete Leute gewesen waren, nie gegeben hatte. Er meinte, jemand habe sich das nur ausgedacht, weil er seine Nachwelt glauben machen wollte, vor Zeiten seien die Umherziehenden etwas anderes gewesen als ungewaschene Diebe.
Matéo führte sich wie ein König auf. Jedes Familienoberhaupt war gleichermaßen Oberhaupt der Gruppe, aber Matéo hielt seine Nase besonders hoch in die Luft und spielte sich gern auf. Das hatte Rosana längst begriffen, und sie hatte bemerkt, dass das Lager noch durch etwas anderes gespalten war: Die Löffelschnitzer und Korbmacher grenzten sich insgeheim von den Schaustellern ab. Die Handwerker profitierten davon, dass die Gaukler das Publikum anlockten und nach den Aufführungen bei ihnen kauften, aber sie waren auch Neider. Wenn von Bier und Honigwein zu viel floss, konnten sich Handwerker und Künstler in der Frage darüber, wer nutzbringender war, in die Wolle kriegen. Es endete meist damit, dass man einander schwor, sich am nächsten Morgen auf Nimmerwiedersehen zu trennen, um sich dann, ausgenüchtert, doch wieder zusammenzuraufen.
»Komm mit zum Weiher!«, rief Luciana, Rosanas allerliebste Freundin, und winkte sie zu sich.
Rosana deutete auf den Wäschekorb zu ihren Füßen und Luciana hüpfte über die Baumstämme am Feuer, um ihr beim Aufhängen zu helfen. Während Luft das Element von Rosanas Familie war und Metall jenes von Emilios Leuten, war Feuer das Element von Lucianas Sippe.
Rosana bewunderte Luciana für ihre Furchtlosigkeit, wenn sie mit den beiden an den Enden einer Kette entzündeten Öltiegeln tanzte, flankiert von ihrem Vater, der die Flammen in hohen Bogen über das Mädchen hinweg spuckte und das Feuer dann in seiner Kehle erstickte.
»Ich hab euch gleich«, brüllte Matéo zu den Kindern, »und dann steck ich euch in den Suppenkessel.« Er machte einen Ausfallschritt, bevor er das Feuerholz neben der Feuerstelle fallen ließ. »Wenn ihr nicht auf der Stelle den Zirkel verlasst!«
Die Kinder quiekten, lachten und sprangen wild durcheinander, um vom Bären, wie Matéo genannt wurde, fortzukommen. Nur die speckigen Beinchen des kleinen Mekele, Rosanas jüngstem Bruder – sie hatte derer vier –, trugen den Zweijährigen nicht schnell genug davon. Obwohl er am lautesten quiekte, wurde er von Matéo eingefangen, hoch gehoben und mit dem Kopf nach unten baumeln gelassen. Mekele lachte, bis sich sein großer Bruder für ihn einsetzte. Danino gelobte Matéo, ein Auge auf die Kleinen zu haben, damit sie nicht wieder störten.
Matéo brummte etwas wie ein Bär und schichtete das Holz für das Lagerfeuer übereinander.
Rosana entging der Blick nicht, den ihr Bruder zu Luciana herüber schickte. Sie schnalzte mit der Zunge, was nur ihre Freundin hören konnte. »Danino starrt«, raunte sie und kicherte. Dafür wurde sie von Luciana in die Hüfte geknufft.
»Hast du deinen Papa was sagen hören?«
»Ja«, nickte Rosana und holte tief Luft. »Das Wetter wird sich schlagartig ändern. Er spürt es in den Knochen, sagt er. Wenn wir zum Kälteeinbruch nicht bis an die Böhmische Grenze gelangen, kommen wir nicht über das riesige Gebirge. Und dass der Tross sich bald trennen wird.« Rosana verschluckte die letzte Silbe. Unleugbar waren Lucianas Züge eingefroren. Kein gutes Thema für sie.
»Das meine ich nicht. Das weißt du auch«, murmelte jene.
Rosana war nicht gern Überbringerin schlechter Nachrichten. Sie schüttelte den Kopf. »Aber dass Papa noch nicht erwogen hat, mit deinem Vater über dich und Danino zu sprechen, bedeutet nicht, dass das mit euch nichts wird.«
Lucianas Miene hellte sich nicht auf. »Verstehe.« Sie seufzte und blickte sich nach Danino um. Feuer zog Luft an. Das wusste jeder. Aber Feuer und Luft gebären nichts Gutes, sondern stellen eine zerstörerische Kombination dar.
»Üben!«, rief Olivia aus dem Wagen und Rosana zuckte beim Schwatzen ertappt zusammen.
»Wir sprechen später weiter«, drückte sie Lucianas Hand. Das Feuermädchen machte kaum einen entflammten Eindruck.
Rosana stieg in den himmelblau lackierten Wagen mit der aufgemalten feuerroten Feder, dem Wagen ihrer Tante. Von ihr wurde sie bereits erwartet. Esmeraldas lange Finger mit den funkelnden Ringen spielten ungeduldig mit einem Stoß Karten.
»Wollen wir mal sehen«, sagte die Ältere und hob eine beliebige Karte aus dem Stapel, ehe Rosana auf dem Hocker ihr gegenüber Platz genommen hatte.
»Das Schicksalsrad«, sagte Rosana eher gelangweilt als euphorisch, weil die Abbildung von Fortunas Rad die Gedanken an Luciana wachhielt. Rosana starrte die Schicksalskarte an und hätte nicht sagen können, ob sie ihrer Tante absichtlich die falsche Kartendeutung präsentierte, als sie sagte: »Alte Werte und Überzeugungen brechen in sich zusammen. Mag das Äußere noch so ruhig sein, das Innere ist aufgewühlt …«
»Nein. Was du sagst, ist turnul, der Turm. Mica printesa, wenn du nicht fleißig lernst, stricke ich dir einen Mantikor, mit dem du hausieren gehen kannst.«
Was als Scherz gemeint war, ließ Esmeraldas Augen funkeln. Der Mantikor – die Bestie mit den giftigen Stacheln, dem Löwenkörper mit dem Menschengesicht und den drei Reihen Zähnen – stand für die Angst der Weißen vor ihnen, vor »den Schwarzen«, wie man Rosanas Leute gemeinhin nannte, obschon ihre Haut nur unwesentlich dunkler war als die so manch einer Bäuerin.
»Nein, danke.«
Esmeralda lächelte.
»Wird Mama wirklich wieder gesund?« Rosana hob den Blick von der Karte, die Esmeralda an die Seite gelegt hatte, um sie abschließend noch einmal abzufragen. Rosana kannte alle Blätter auswendig, das musste Esmeralda wissen. Aber heute war Rosana aufgewühlt und unkonzentriert. »Oder sagst du das nur. Ich bin schon zu alt für eure Lügen zum Trost, weißt du?«
Auf der makellos glatten Stirn ihrer Tante zeigte sich einen flüchtigen Moment lang eine feine Sorgenfalte. Rosana fand, Esmeralda und ihre Schwester Olivia waren die schönsten Frauen, die Gott erschaffen hatte. Ihr Haar glich dem Blauschwarz des Moores in der Mark der Brandenburger, die Rosana auf ihren Zügen durchs Reich kennen gelernt hatte. Die Haut war zartbraun und glatt wie der Marmor von Carrara. Den hatte Rosana zwar nicht im Italienlande besichtigt, aber im Magdeburger Dom. Aus diesem war sie sofort wieder herausgeflogen, weil sie barfüßig und mit im Nacken geschnürten Fransentuch die Sandsteinstatuetten angeschaut hatte.
Die Augen der beiden Schwestern funkelten wie Esmeraldas Kristallkugel. Aus mit Öl zerriebener Holzkohle zog sie jeden Tag den Strich auf ihren Augenlidern nach. Und ihre Lippen waren so rosarot wie der Wein, den Esmeralda vom Bischof zu Mainz einmal ausgeschenkt bekommen haben wollte. Sie behauptete, dass der Mainzer sie zum Wein eingeladen habe, weil der sie ihrer berauschenden Geschichten und Schönheit wegen bei sich haben wollte. Diese Anekdote glaubte ihr niemand so recht, aber die Worte einer Wahrsagerin infrage zu stellen, wagte keiner.
»Was sagt dir dein drittes Auge?«
Rosana legte den Kopf ein wenig schräg. Immer wenn Esmeralda eine Begabung ansprach, deren Kräfte Rosana noch nie gespürt zu haben meinte, wuchs ihr Zweifel. »Ja«, nickte sie und wusste nicht, woher sie die Gewissheit hatte. »Ja, sie wird schon wieder gesund.«
»Na siehst du«, lächelte ihre Tante und zog die nächste Karte aus dem Stapel.
»Die Welt … und wenn nicht? Muss ich dann bei einem anderen lernen?«
Esmeralda lachte auf. »Nein. Dafür ist es zu spät. Du bist zu alt, um aufs Seil zurückzukehren.« Sie tippte auf das abgegriffene Bild der Karte, doch Rosana taxierte ihre Tante. Rosana kannte die Erzählungen. Wenn Esmeralda in der Stunde der Geburt ihrer Nichte nicht jenes Talent und eine gewisse Gabe gespürt hätte, wäre Rosana Seiltänzerin geworden wie ihre Mutter.
»Glaub mir«, gab Esmeralda zu, bevor sie auf die Deutung der Karte bestand, »seit diesem Sturz ist deine Mutter dankbar und froh darüber, dass ich mich gegen sie durchgesetzt und dich unter meine Fittiche genommen hab.«
Rosana wusste auch von diesem Dilemma: Es fanden sich viele Mädchen, die die Kunst des Seiltanzes erlernen wollten. Doch bislang hatte Olivia keine geeignete Nachfolgerin gefunden. Ein jedes Mädchen, das sie bis zum ungefähren Alter zweier voller Hände unterrichtet hatte, erwies sich als untauglich und mit dem Körper nicht in der notwendigen vollkommenen Harmonie. Aber es würden weitere folgen, und eines würde dabei sein, das Olivia besser ausbildete, als sie selbst ausgebildet worden war. All das wusste Rosana.
»Die Welt«, nickte sie zur Karte hin, die Esmeralda aufgedeckt hatte. »Wir erreichen ein wichtiges Ziel und Erfüllung im Leben, nichts als Zufriedenheit …« Die Stimme der Jüngeren verlor sich, und Rosana spürte, wie sie von ihrer Tante gemustert wurde. Sie schüttelte leicht den Kopf, um ihre Gedanken zu sortieren. Zufriedenheit und Erfüllung, Einssein mit sich. Solange Rosana aus einem sechs Fuß langen und drei Fuß breiten Wagen die Welt an sich vorbeiziehen sah, würde sie absolute Zufriedenheit wahrscheinlich nie erfahren. »Ich möchte viel lieber die Handlinien lesen.«
Esmeralda schnalzte mit der Zunge. »Bis du nicht alle Karten fehlerfrei kennst, sehe ich schwarz.« Weil Rosana das Gesicht verzog, schob Esmeralda hinterher. »Das Lernen der Handlinien braucht drei lange Sommer, mica printesa.«
»Dann hab ich an Jahren vier Hände voll, bevor ich damit fertig sein werde!« Trotzig zog Rosana Esmeraldas rechte Hand heran, sodass ihre Tante auflachte. »Mal sehen«, sagte die Jüngere. Sie klang genauso wie Esmeralda, wenn die Frauen den Mut aufgebracht hatten, das gelb-weiß gestreifte Spitzzelt zu betreten. »Mmh. Ich sehe …«, strich sie verheißungsvoll über die Handfläche, um Vertrauen zur Kundin aufzubauen, wie es Esmeralda immer tat. Sie spürte damit die Dichte der Hornhaut und die Schwielen, um Genaueres über die tägliche Arbeit ihrer Kundin zu erfahren. Diesen Trick hatte ihr ihre Mutter verraten. »Ein Leben mit schwerem Kopf führst du.« Ein Leben also fern der harten Arbeit einer Bäuerin oder Handwerkerfrau.
Esmeralda lächelte erwartungsvoll.
»Aber ohne Müßiggang!« Ein Blick auf die kurzen und sauberen Fingernägel einer Frau, die sich um ihr tägliches Brot selbst kümmern musste. »Und zuweilen wenig Schlaf.« Rosana, die auf die trockene Haut Esmeraldas anspielte, ließ sich von deren hoch gezogenen Augenbrauen nicht beirren. »Es treiben dich schwere Gedanken umher.« Abgeknabberte Haut um die Nägel.
Esmeralda legte den Kopf zur Seite und verfolgte, wie Rosana, die ihre Tante in- und auswendig kannte, die Handform nachzog.
»Quadratische Fläche und lange Finger.« Es war nicht schwer zu erraten, dass die Luftfamilie vorwiegend Handformen in ihrem Element besaßen. Windige, leichte und lebhafte Menschen. Leider war den Luftleuten eigen, dass sie ungeduldig und schnell gelangweilt auf der Suche nach neuen Herausforderungen lebten.
Rosana widmete sich als Nächstes Esmeraldas Handlinien. Beide Frauen wussten, dass Rosana mit ihrem Zigani bald am Ende sein würde. »Eine lange Lebenslinie«, das war einfach, »du weißt mit Bestimmtheit, was du willst und wie du deine Ziele erreichen kannst. Und sieh sich einer diesen Venusring an!« Rosana hielt die Hand fest, die aus der ihren gleiten wollte. »Von sehr ausgeprägter Körperlichkeit zeugt er, wohingegen deine Liebeslinie«, Rosana schnalzte mit der Zunge wie eine Alte, »zerfurcht … mmh… und kurz.« Rosana tippte auf Esmeraldas rechte äußere Handkante, wo die genannte Linie zu sehen war. »In jedem Städtele ein anderer …« Ruckartig wart ihr von Esmeralda die Hand entwunden und ein Klaps gegen das Kopftuch gegeben, das ein bisschen verrutschte.
»Hättest du mit der linken Hand angefangen, hätte ich dir durchaus Recht geben können.«
Rosana stieß die Luft hörbar aus. Immer wieder der gleiche Fehler. Man begann nie mit der Rechten! Das musste sie sich endlich merken. In der Linken ruhte das, was der Mensch als Veranlagung mitbekommen hatte und seine Zukunft. In der Rechten das, was seine Lebenswege aus der Veranlagung machten.
»Luciana«, nahm Esmeralda das Gespräch wieder auf und deutete auf die Welt, die immer noch vor ihnen lag. »Macht einen unglücklichen Eindruck.«
Rosana nickte. »Danino.«
Es tat Rosana leid, dass ihr Vater so schwerfällig war, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens ging. Sie sah nicht, was gegen ein Verlöbnis zwischen Luciana und Danino sprach.
Dieses Rätsel löste sich so bald nicht.
Nedjo, Rosanas Vater, hatte es prophezeit, und er sollte recht behalten: Die wenigen sonnigen Tage, die folgten, ließen sich an einer Hand abzählen. Ein hartnäckiger Niesel, der sich nicht entscheiden konnte, in einen ergiebigen Regen überzugehen oder aufzuhören, legte sich nicht nur klamm auf die Wagen und Vorzelte, sondern auch auf die Gemüter der Sippe.
Wenn die Pferde vor den Wagen müde wurden, campierte das fahrende Volk und bildete mit den Hütten auf Rädern einen Zirkel. Doch bei Regen blieb das Rondell verwaist, weil sich alle unter den vor den Wagen gespannten Wachstuchplanen aufhielten. Rosana mochte es nicht, wenn jede Familie ihr eigenes Süppchen kochte. In der Nässe war es jedoch zwecklos, ein Feuer in der Mitte zu entfachen und den großen Kessel anzuheizen. Freilich trafen sich Freunde in einem Wagen, um die Zeit kurz werden zu lassen. Die Fiedel und die siebensaitige Gitarre wurden gestreichelt, aber es war nicht dasselbe wie in der warmen Jahreszeit. Die Luft schmeckte nach Abschied.
Üblicherweise zerfiel der Tross im Oktober, um sich im März wieder zusammenzufinden. Rosana machte das stets sehr traurig. Nein, mehr noch: Sie hasste es. Sie hasste die kalte Jahreszeit und die Suche nach einem Winterquartier und das Winterquartier selbst.
Seit den Zigeunerregulativen war man gezwungen, zumindest über den Winter, ein festes Quartier zu beziehen. Keiner von ihnen hatte ein festes Zuhause. Also suchte man Zuflucht bei Fremden. Matéo hatte dieses Gesetz auf Geheiß des Bürgermeisters der Ortschaft, in der man gerade gastierte hatte, verlautet. Dieses Gesetz forderte die Sesshaftmachung der Fahrenden. »Wir lassen uns nicht unterkriegen!«, hatte Matéo damals gerufen. »Wir sind die Fahrenden!« Jahr um Jahr wurde wieder entschieden, sich nach der Winterruhe zu sammeln und gemeinsam durchs Land zu ziehen, um mit Körperbeherrschung, Geschick und Einfühlungsvermögen zu zeigen, dass man etwas Besonderes war; mehr wert als Zigeuner. Zigeunerpack, Lumpensack, Säuferwrack und Dämelack. Rosana war ein Zigeuner, aber ein Kreuzneuner. Ein Glückskind. Nur nicht im Winter.
Schlimmer noch als der auseinanderfallende Tross war das Warten auf den Tag, an dem es so weit sein würde. Eine qualvolle Ungewissheit, denn Matéo, Nedjo und all die anderen Männer versuchten, die Gemeinschaft so lange als möglich beieinanderzuhalten. Und schlimmer als die Trennung auf Zeit und das Warten auf den Zeitpunkt waren jene Tage, an denen man sich der Tatsache bewusst wurde, dass gestern der Zeitpunkt gewesen war, an dem man sich hätte trennen müssen. Allerdings sprach das niemand aus, und so klammerte man sich morgen weiterhin aneinander. Das waren auch die Tage, an denen man, wenn überhaupt, nur schleppend vorankam. Keiner dieser mitgeschleiften Tage verging, ohne dass nicht ein Missgeschick geschah und ein Wagen, ein Tier oder ein Mensch zu Schaden kam. War es gestern Matéos Wagen, dessen Rad in einem Schlammloch stecken blieb, brach heute eine Achse bei einem anderen, und morgen würde einer der Männer beim Versuch, den nächsten Wagenbruch zu beheben, verletzt werden.
Rosanas Mutter litt unter starken Schmerzen. Das Gehen fiel schwer, das Sitzen auf den durch den Matsch holpernden Kutschbock war eine Qual. Die Farbe ihrer Hüfte war von Dunkelviolett zu hellem Lila mit gelben und grünen Sprengseln gewechselt. Aber mithin machte Olivia nicht mehr nur die Hüfte, sondern auch der untere Rücken Probleme. Rosana bemerkte, wie ihre Eltern sich flüsternd und mit weit ausholenden Gesten unterhielten. Wenn Nedjo vom Kutschbock sorgenvolle Blicke über seine Schulter durch das Wagenfenster schickte, um nach Olivia zu schauen, dann schob sich eine tiefe Falte zwischen seine Augenbrauen. Sein beim Sprechen lustig tanzender Schnurrbart wurde ein schwarzer, nach unten gebogener Balken.
»Mama wird doch wieder ganz gesund, oder?«
Ihr Vater, in seiner Sorge ertappt, hellte so abrupt seine Miene auf, dass Rosana ihm nicht glauben konnte. »Aber ja … Magst du?« Er hielt ihr die Kutschriemen hin, und Rosana nahm die Zügel gern, ließ sie sacht auf der Deichsel schnalzen, was die zwei treuen Kaltblüter kaum beeindruckte. Sie konnten ohnehin nicht an Lucianas blau-grün gestreiften Wagen vorüber.
»Ist Danino bei Emilio?«, fragte Rosana wie beiläufig, obwohl sie wusste, dass ihr Bruder nicht auf Emilios Wagen mitfuhr.
Ihr Vater schob seinen Krempenhut zurecht und seufzte. »Er trottet mit Luciana hinterdrein.«
»Das ist doch schön, nicht?«
Ihr Vater rang sich ein unbestimmtes »Mmh« ab.
»Sie haben sich gern, weißt du?«
»Mmh.«
»Sie könnten doch …«
»Rosana … schau nach vorn.« Nedjo griff in die Zügel, weil Rosana sie so schlaff gehalten hatte, dass die Kaltblüter immer langsamer geworden waren. »Wenn du dereinst deinen eigenen Wagen führen möchtest, darfst du den Blick nie von den Pferden lassen. Urug …«, welcher den Wagen hinter ihnen führte und ins Stocken geriet, als Rosana unachtsam war, »… kommt nicht so schnell in Schwung, wenn er einmal an Fahrt verloren hat.« Letzteres rang ihrem Vater ein Grinsen ab, und Rosana lachte auf, denn Urug war der beleibteste Bader, den die Welt je gesehen hatte. Sein Element war das Wasser. Rosanas Vater meinte, Urug wäre so kugelrund, weil seine Frau die allerbeste Soljanka machte. Das stimmte. Seine Frau war ebenso rund wie Urug und der Soljankakessel.
»Ob die Pferde auch von der Soljanka naschen?«, fragte Rosana ihren Vater, der schallend auflachte.
»Was ist nun mit Danino und Luciana?« Rosana gab die Zügel an den jüngeren Leolo neben sich weiter. Der machte sich auf dem Bock ganz gerade und steckte die Zunge zwischen seine Lippen.
»Das besprechen wir im Frühjahr, wenn wir wieder beisammen sind … und dann nicht mit dir, junge Dame.« Letzteres untermalte Nedjo mit einem Stups gegen Rosanas Nase.
Rosana mochte es, sich auf das Trittbrett am hinteren Ende des Wagens zu setzen. Am liebsten dann, wenn ihr Wagen der letzte im Tross war. Jeder Wagen war einmal an der Reihe, der letzte zu sein. Matéo beharrte darauf, dass es gerecht zuging unter den Zigani. Der erste Wagen hatte es an Regentagen leichter als der letzte, der in den Spurrinnen aller anderen schwamm. Der letzte Wagen hatte es an windigen Tagen am besten, wenn er im Windschatten der anderen fahren durfte.
Die Welt vom schaukelnden Heck des Wagens zu betrachten, verleitete Rosana zum Träumen. So sehr sie sich für den Gedanken schämte, stellte sie sich manchmal vor, in einem gemauerten Haus zu wohnen: einem mit Türen zwischen abgetrennten Räumen und einem Bett, das nicht an der Decke hing, vielleicht sogar für sich allein.
Am Abend fand Rosana ihre Freundin Luciana in Tränen aufgelöst. Es war gar nicht so einfach, ein klares Wort aus ihr herauszubekommen. Trotz des Nieselregens hatten sie sich vom Wagenplatz entfernt und sich hinter den tief hängenden Ruten einer Weide verborgen. Luciana quälte den armen Baum, indem sie die länglichen Blätter wütend von den Wedeln streifte, bis sie entblößt waren. Wenn sie das noch eine Weile so trieb, überlegte Rosana und nahm die Hände ihrer Freundin in die ihren, dann stünden sie bald für jedermann sichtbar unter einem nackten Baum.
»Morgen, Rosana«, schniefte Luciana, die sich ein wenig beruhigte. »Morgen teilt sich der Zug.« Weil Lucianas Vater Matéos Bruder war, konnte man Lucianas Neuigkeiten Glauben schenken.
Rosana atmete tief durch und nickte. »Aber nach fünf Monden sehen wir uns schon wieder!«
»Das ist so lange.« Es brauchte einen Moment, bis sie sich vom neuerlichen Schluchzen erholt hatte. Dann fesselte sie Rosanas Blick. »Ich glaube, sie haben nicht vor, Danino und mich zu verheiraten. Sonst hätten sie das schon längst gemacht.« Luciana umarmte heulend den Baumstamm. »Ich bin uralt!« Sie zählte drei Hände und zwei Finger, das war zwar älter als das übliche Heiratsalter, aber uralt nun auch wieder nicht. Rosana konnte sich schlecht in ihre Freundin hineinfühlen. Sie sah das Heiraten eher kritisch. Emilio, der für sie bestimmt war, gefiel ihr nicht. Er war beleibt, teigig und seine Züge erinnerten an die eines Karpfens. Außerdem war er ein Angeber und Aufschneider. Rosana hoffte, dass ein Wunder geschah und sich an Matéos und Nedjos Entschluss noch etwas änderte. Von Zuneigung zu Emilio war sie weit entfernt.
Luciana und Rosana drehten sich nach den Schritten um, die im feuchten Laub schmatzten. Danino strich die Wedel beiseite und betrat die Weidenlaube. Rosana begriff, dass sie hier nicht länger vonnöten war. Ein Blick über ihre Schulter, als sie sich schon ein Stück entfernt hatte, zeigte, wie ihr Bruder ihre Freundin fest in die Arme nahm. Lediglich Daninos Ohrring glitzerte in der einbrechenden Dunkelheit unter der Weide.
Die Nacht auf dem Wagenplatz war von aufgesetzter Heiterkeit erhellt. Die Leute saßen um das Feuer, das mit nassem Holz entzündet worden war. Es war Zeit, sich ewige Freundschaft und Treue zu schwören. Selbst die schwierigen Kameraden, welche die eigenen Bedürfnisse zuweilen über die der Gruppe zu stellen versuchten, gaben sich in dieser Nacht kleinlaut. Die Männer besprachen, in welcher Himmelsrichtung sie ein Winterquartier suchen wollten, erinnerten sich an die Zinken, die an die Weggabelungen zu schlagen wären und die niemand vergessen durfte. Jede Familie hatte ihr Zeichen. Das von Nedjo waren drei übereinanderliegende Querbalken. Paúlos und Lucianas Zeichen war ein linker Halbkreis mit einem Balken parallel zum Durchmesser.
Die Frauen unterhielten sich über das Vergangene: den beschwerlichen Sommer auf der Flucht vor den Freiheitskriegen, das ständige Sich-bedeckt-Halten und die Not, die daraus resultierte, wenn sie in Feldlagern ihre Kunststücke und Talente zum Besten gaben und dann keinen Heller klimpern hörten. Soldaten waren ein leichtlebiges, dankbares Publikum. Mit den Trossen gen Osten zu ziehen, hatte etwas Gutes gehabt: Man hungerte ebenso viel wie die anderen, und sie waren spendabel, gaben viel von dem, was sie aus den Ortschaften stahlen.
Die Familienoberhäupter, Matéo allen voran, missbilligte Diebstahl, predigte Ehrlichkeit, verurteilte ihn aber nicht, sollte er bei dem ein oder anderen offenkundig werden. Stopfte der Diebstahl die vielen Mäuler, wurde nicht darüber gesprochen. Allein von den Gaukeleien und Artistenvorführungen, von der Wahrsagerei und den Geschichten bekam man die Geldsäckel und Mäuler in solch schweren Zeiten nicht voll. Es wollten die Pferde versorgt, die Wagen geflickt, die Kleider mit Pailletten und Glitzerfäden durchzogen, der Ohr- und Halsschmuck hergestellt und repariert werden.
Rosana wusste, weil Luciana es ihr gesagt hatte, dass Matéo sich die ganze Saison über mit dem Gedanken schlug, die Gruppe so zu trennen, dass sie im kommenden Jahr nicht mehr alle zusammenkamen und somit leichter zu versorgen wären. Sie waren einfach zu viele geworden. Sieben Familien machten beinahe jedes Jahr sieben zusätzliche Kinder. Die Alten entschieden sich immer früher, in den Wald zu gehen, obwohl ihre Zeit noch nicht gekommen war. Das bedrückte Rosana. Sehr sogar.
Am Morgen gelangten sie an jenes Wegekreuz, das den Tross trennen sollte. Rosana setzte sich auf dem Bock so zurecht, dass sie um die grün getünchte Ecke schauen konnte. Daninos leerer, auf den matschigen Weg gehefteter Blick stach in ihrem Herzen. Er und zwei ihrer Brüder trotteten lustlos hinter dem Wagen her. Danino machte nicht den Eindruck, als würde jemand oder irgendetwas seine Stimmung bis zum März aufhellen können. Rosana schaute durch das kleine, rot gerahmte Fenster. Olivia lag auf ihrem Bett, Mekele am Busen.
»Papa?« Sie wandte sich wieder nach vorn. »Habt ihr je vor, Danino und Luciana zu verheiraten?« Eine lange unheilvolle Stille hängte sich zwischen sie und ihren Vater. »Und warum nicht?«, schlussfolgerte sie treffsicher.
Dieses Mal hielt der starr nach vorn blickende Mann den bohrenden Augen seiner Tochter nicht stand. »Weil Paúlo und ich uns so sehr verabscheuen, dass es das Letzte für uns wäre, unsere Familien durch die Heirat unserer Kinder zu vereinen.«
Rosana schluckte. Jeder wusste, dass Nedjo und Paúlo nicht die besten Freunde waren, aber den vor Jahren wegen eines unterschlagenen Geldbeutels entfachten Groll bis in jede Faser aufrechtzuhalten, fand sie recht unerwachsen. Das sagte sie ihrem Vater auch. Aber er zeigte lediglich ein bitteres Lächeln und nickte.
»An mir lag es nicht, glaub mir.« Er spuckte in weitem Bogen neben den Wagen in die Böschung. »Ich habe ihm die Hand geboten. Er wollte nicht einschlagen.« Nach einer Weile, in der sie beide starr geradeaus geschaut hatten, fügte er hinzu, sie möge Schweigen darüber bewahren, denn vielleicht besann sich Palo über den Winter und würde sich für die Kinder entscheiden.
Markgraftum Oberlausitz, sächsischer Teil
Weißenberg, an der Löbau gelegenOktober1816
Dr. Cornelius Waldeck hatte von Clementine das gute Porzellan aufdecken lassen. Doch das braune Wasser, ob nun heiß oder nicht, schmeckte aus geblümten Tassen ebenso bitter wie aus einem Steinzeugpott.
Charlotte Luise Henriette Amalie von Reichenbach-Goschütz, blaublütig und blassgesichtig, spreizte den Finger ab, wenn sie den zierlichen Henkel der Tasse aufnahm, um die Plörre, die Clementine »Tee« genannt hatte, zu schlürfen. Ein Aufguss aus Pflanzenteilen. Das heiße, bittere Wasser hatte in Cornelius’ Dafürhalten nichts mit einem Aufguss zu tun. Ein Aufguss war, wenn man Melisse oder Minze mit Salbei und Thymian brühte und es einem an Husten und innerer Unruhe Leidenden verabreichte.
»Da hat dieses Kraut die beschwerliche Reise über den Himalaya, Meere und Ströme auf sich genommen, um seine ganze Bitternis hier in meiner bescheidenen Praxis zu entfalten«, versuchte es Cornelius mit einem neuerlichen Scherz. Doch von Reichenbach-Goschütz verzog weder darüber noch wegen des bitteren Tees eine Miene. Cornelius’ Blick streifte den Stoß Briefe, den er noch durchsehen und in manchen Fällen sogar würde beantworten müssen.
Die Pendeluhr auf dem Kaminsims zeigte zehn vor halb neun. Cornelius’ Praxis hatte, so stand es auf dem Messingschild neben der Haustür, seit zwanzig Minuten geöffnet. Doch jede Unternehmung, seinem hochgeborenen Besuch die beste Gesundheit und ein – auf absehbare Zeit – gesundes Leben zu bescheinigen, verfing sich im monotonen Ticken des Zeitmessers.
Fräulein Charlottes Kopf war breit. Nicht allein weil sie eine flächige Wangenpartie besaß, was ihr etwas Matronenhaftes verlieh, sondern weil dort, wo die Stirnpartie in die Schläfen überging, das Organ der Zeit saß. Cornelius war noch nie von Franz Joseph Galls Lehre der Gehirnorgane enttäuscht worden. Er war nahezu besessen von der Vorstellung, an der Form und Größe der einzelnen Schädelpartien des Menschen dessen Charakter, seine Stärken und sogar die Schwächen und tiefsten Abgründe herleiten zu können. Charlotte von Reichenbach-Goschütz’ Stärke war die Geduld und ein gedehnter Begriff von Zeit, wie es schien. Bisher hatte Cornelius stets Recht behalten bei jedem Menschen, den er seiner geheimen Analyse unterzog … Nun ja, bei fast jedem. In einer Person hatte er sich getäuscht. Bei der Erinnerung an diese stieß er unabsichtlich sein Porzellantässchen gegen die Untertasse, die er seit einer guten Viertelstunde umklammert hielt. Er räusperte sich entschuldigend.
Das Fräulein schaute ihn stumm, aber erwartungsvoll an. Cornelius hatte dem Mädchen seine Leidenschaft für Spaziergänge, die die Lungen reinigten, unterbreitet, hatte sie aber trotzdem nicht aus der Stube bekommen. Er hatte ihr seine Vorliebe für das Briefeschreiben erörtert und erklärt, dass es auf dem Postamt eine kleine hübsche Postkarte mit einer Ansicht des Städtchens Weißenberg gab. Dennoch war das Fräulein nicht für einen Ausflug zu erwärmen gewesen, um eine solche in ihre Heimat im Thüringer Wald zu schicken. Da war nichts zu machen.
Cornelius hatte es nie verstanden, vor dem Adel eine passable Erscheinung abzugeben, und er war sich noch immer nicht sicher, ob er es überhaupt wollte. »Wenn, meine Teuerste, ich Euch nun in der Obhut meiner Haushälterin lassen dürfte, um mich meiner Patientenschar zu widmen?« Und plötzlich, womit er nicht mehr gerechnet hatte, regte sich das Fräulein und nickte. »Ich werde warten …«
Cornelius’ versteinertes Lächeln hielt auch noch, als er Clementine heranklingelte, die an einem herrlichen Donnerstagmorgen sicherlich Wichtigeres zu tun hatte, als auf dem Kanapee neben einer Adeligen zu sitzen, der auf ihrer Reise langweilig geworden war. Cornelius’ Lächeln zerbröckelte, als er aus seiner Wohnung trat und im Korridor, an den sich seine Praxis anschloss, das Wartezimmer bis auf den letzten Platz gefüllt sah. Was hätte er zu seiner Verteidigung, die Sprechstunde nicht pünktlich geöffnet zu haben, hervorbringen können? Dass er mit einer Adeligen Tee getrunken habe? Wohl kaum.
Als er die Tür zu seinem Untersuchungsraum öffnete, schlug ihm ein beißender fischiger Geruch entgegen, der ihn prompt an eine Wasserleiche erinnerte. Eine unschöne, zum Glück vergangene Geschichte. Ein Blick hinter die Tür, wo neben seinem Schreibtisch der Patientenstuhl stand, versicherte ihm, dass der Besucher weder aufgequollen noch elfenbeinfarben angelaufen war. Er war eher ein langes Elend und machte mit seinem hageren, doch puterroten Gesicht einen lebendigen Eindruck.
»Fischer Merten«, wurde Cornelius’ Lächeln zum ersten Mal an diesem Morgen aufrichtig und herzlich. Mit einem »Oh« fror seine Bewegung ein, als er dem Patienten gegenüber Platz nahm. Es sah ein bisschen grotesk aus, wie die Barteln – als Köder um den Angelhaken gewunden – einer Perücke gleich auf der großen Zehe des Fischers zitterten. Cornelius kauerte sich vor den Patienten, sodass er dessen Fuß in Augenschein nehmen konnte.
»Ein Riesenvieh von Wels!«, war das Erste, was der Mann zu dem Haken in seinem Zeh zu sagen hatte. »… hat jetzt bestimmt der Idiot von Köhler gekriegt, weil er genau in seine Richtung unterwegs war.«
»Der Köhler oder der Wels?«
Fischer Merten überging den scherzhaft gemeinten Einwand des Arztes und öffnete die rechte Hand eine Spanne weit: »So ein Schmiss am Maul hat der jetzt.«
»Ich bin sicher, der Wels wartet auf Sie«, lachte Cornelius verlegen. »Wir verknoten das Ende der Schnur an der Türklinke und läuten dann nach Clementine«, schlug er vor. Der lange Merten verzog angesichts des verfehlten Späßchens keine Miene. Cornelius beschloss, das Scherzen für heute sein zu lassen und hieß den Patienten, den Fuß auf den Hocker aufzulegen, den er zu diesem Zwecke heranzog.
Es stellte sich als komplizierter heraus, als es auf den ersten Blick ausgesehen hatte, diesen Haken aus dem Fleisch des Fischers zu bekommen. Der lange Merten umklammerte die Armlehne seines Stuhls und brüllte mit geschlossenem Mund. Nur wenn Cornelius’ Schnippelei gar nicht auszuhalten war, verfluchte er Gott und die Welt und schimpfte auf die mistigen Köhler mit ihrem Gestank und Dreck.
»Alle guten Fische holen die raus, und unsereins muss so was passieren! Und die Herrschaften tun nichts dagegen, dass die Köhler Reusen benutzen: übermäßig und prall voll, Herr Doktor!« Mit den Herrschaften meinte der Fischer die Gutsbesitzer der umliegenden Grafschaften. Cornelius kannte sie und deren Willkür. Wenn in einer Sache die Befreiung von Napoleon und der Kongress in Wien versagt hatte, dann darin, dass die Adeligen weitermachten wie früher, sich in manchem Winkel sogar noch mit Leibeigenschaft schmückten. Als wäre nichts gewesen!
»Unsereinem wird Strafe aufgebrummt, wenn wir mit übermäßigen Reusen erwischt werden! Und abgeben müssen wir zwei von drei Fischen an die Feinen …«
»Ich weiß«, seufzte Cornelius, dem die feudalen Zustände der Grafenhäuser zuwider waren. Aber er war nicht der König von Sachsen. Er konnte daran nichts ändern.
»Die von Gerßdorffs und die von Bresslers lassen die schwarzen Männer machen, weil es Winter wird«, blaffte Merten. »Damit sie nicht zwei von drei, sondern drei von drei Kohlesäcken abkriegen, und die Köhler gehen denen jedes Jahr auf den Leim. Idioten! Daheim frieren denen in den langen Wintern die Arschlöcher zu.«
Cornelius verkniff sich ein Grinsen, nickte aber. Insbesondere Letztgenannte – die von Bresslers – hatten es geschafft, das während der Kriegswirren ausgebrannte Schloss zu Nostitz durch ein neues Schloss mit achteckiger Begrenzung zu ersetzen.
Cornelius konzentrierte sich auf sein Instrument, das den Haken in einer vorsichtigen Drehbewegung aus dem Zeh zu lösen suchte, aber immer wieder abrutschte. »Ganz stillhalten jetzt … Geschafft.«
Der Fischer knurrte, obwohl Cornelius den herausoperierten Haken triumphierend in die Höhe hob. Auch dieses Lächeln wurde vom Patienten nicht erwidert. »Und wenn Sie die Köhler bitten, den Wels, wenn sie ihn aus der Löbau fischen, Ihnen zu überlassen, weil Sie doch die meiste Vorarbeit geleistet …«
»Ääääh«, machte der Mann wie ein Ganter, dem man zu nahe gekommen war. »Die schwarzen Gesellen teilen nicht. Schwarze Seelen, allesamt … Oder sehen Sie die in der Kirche sonntags?«
»Nun …« Cornelius überlegte, ob er einen Köhler im sauberen Sonntagsstaat erkennen würde, wenn einer vor ihm stünde. Er zuckte die Achseln.
»Na also.« Fischer Merten, kaum dass der Zeh mit Belladonna, einer dunkelbraunen Tollkirschentinktur, eingeschmiert und verbunden war, erhob sich, straffte seine Haltung. Er zog aus der rechten Hosentasche ein längliches Päckchen und klatschte es auf Cornelius’ Schreibtisch. Der saure, wässrige Geruch wurde intensiver. Ein zweites schmales Päckchen landete daneben. »Guten Tag«, verabschiedete sich der Fischer nach geleisteter Bezahlung.
Cornelius, den Blick auf die beiden länglichen, durchgeweichten Leinenpäckchen gerichtet, schellte nach Clementine. Nicht aber jene, sondern ein junges Mädchen mit blütenreiner Schürze und Haube, aber gekrümmter Gestalt schlich in das Untersuchungszimmer und rümpfte ob des Geruchs die Nase. Der Bäckersmagd den Platz weisend, öffnete Cornelius das Fenster zum Markt hin, von wo her fröhliches Spätsommerlachen drang. Clementine erschien in der Tür und verzog das Gesicht, wie es das Mädchen soeben getan hatte.
»Zum Mittag gibt es heut wohl Forelle«, wies Cornelius auf den Tisch, von dem es zu tropfen begann. Clementine verdrehte die Augen, weil sie den donnerstäglichen Knödel schon geknetet und die Pilzsauce vorbereitet hatte.
Wie sich herausstellte, hatte sich die Bäckersmagd an einem Mehlsack verhoben, von dem der Bäcker überzeugt gewesen war, dass er nur halb voll wäre. Es benötigte etwas Überredungskunst das Mädchen zumindest zum Ablegen der Schürze, wenn auch nicht des Kleides, zu bewegen. Cornelius, eben in der Überlegung vertieft, ob der jungen Frau die Kühle von Quarkwickeln oder die Wärme eines Kernkissens Linderung verschaffen könnte, wurde beim Nachdenken von Gepolter und Stimmengewirr gestört.
Die Tür zum Sprechzimmer flog auf. Das Mädchen stöhnte bei der ruckartigen Bewegung Richtung Tür.
Im Rahmen erschien ein geschwärzter Mann, der um Atem rang. Mit ihm war eine säuerliche Woge ins Arztzimmer geweht. Der Anblick des rußschwarzen Jungen neben dem blütenweißen Mädchen hätte belustigend wirken können. Der Schweiß hatte feine Rinnsale in den Kohlenstaub auf dem Gesicht des Burschen gegraben. Angesichts des Mädchens wischte er sich die Mütze vom Kopf, sodass seinem dunkelbraunen Haar eine schwarze Staubwolke entwich.
»Lorenz?« Cornelius war sich nicht sicher, ob er beim Namen des jungen Mannes richtig lag, atmete aber erleichtert auf, als jener nickte.
»Ihr müsst ganz schnell mitkommen, Herr Doktor …«
Es stand außer Frage, dass Cornelius seine Patienten und das Fräulein Charlotte ihrem Schicksal überlassen würde. Der junge Mann jedoch, angesichts des Mädchens nervös von einem Bein aufs andere tretend, knetete seine Schirmmütze und schien sich in arger Bedrängnis zu befinden. Ernst zu nehmende Bedrängnis, meinte Cornelius zu erkennen. Jetzt nämlich fiel ihm auf, dass die Regionen von Lorenz’ Kopf, wo oben das Organ des Instinktes, gefolgt von dem des Wohlwollens und Mitgefühls zu finden waren, eine ebenmäßige Wölbung beschrieben. Keine Dellen, keine Höcker, ein ehrlicher, wohlgeformter Bogen ehrlichen Instinktbewusstseins.
»Nun …« Cornelius wandte sich an das Mädchen. »Das Kernkissen oder einen flachen Stein aufwärmen, vorsichtig auf die schmerzende Partie legen, drei Tage ruhen und niemals mehr Mehlsäcke schleppen. Verlangt das dein Meister wieder von dir, schicke ihn ruhig zu mir!« Das Mädchen war bemüht, sich auf die Stuhllehne gestützt zu erheben, und wehrte resolut Lorenz’ pechschwarze Hände ab, die helfend nach dem weißen Ärmel ihres Bäckerstaates hatten greifen wollen. Cornelius übernahm die Aufgabe, versäumte jedoch nicht, dem ob seiner hoffnungslos düsteren Erscheinung betrübt dreinblickenden Köhler ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Doch was immer den Burschen hatte hierher hasten lassen, verhinderte eine Aufheiterung. Das Mädchen wies auf die Schürze, die der Arzt ihr umzubinden erbot, und förderte alsdann ein Säckel Backwaren zutage. Sie legte es neben die feuchte Stelle auf den Tisch.
Cornelius schenkte dem Mädchen trotzdem eine dankende Geste. »Soll ich mit Wecken und Fisch die Kamine heizen?«, rutschte es ganz und gar nicht dankbar aus ihm heraus, als er die Tür hinter dem Mädchen geschlossen hatte. Sein Blick fiel prompt auf den Köhler.
Dieser schüttelte den Kopf. »Gewiss nicht. Ihr erhaltet einen Sack bester Kohle, aber bitte, bitte begleitet mich hinaus.«
»Bestechung?«
Der Bursche schaute aus seinen nachtblauen Augen unter den fransig in die Stirn fallenden, schwarz bestäubten Haaren hervor, als überlegte er, dieses Wort im medizinischen Zusammenhang jemals gehört zu haben. So hängte sich eine kleine Stille zwischen die beiden Männer; eine Gelegenheit, in der Cornelius das ebenmäßige Gesicht des Jüngeren betrachten konnte, den er zuletzt als Burschen gesehen zu haben glaubte. Damals konnte er nicht älter als siebzehn gewesen sein: halbstark und vorlaut. Er erinnerte sich nicht, in welcher Angelegenheit der Bursche damals von sich hatte reden machen.
»Ich weiß nicht recht, was Ihr mit Bestechung meint, Herr Doktor …«
»Schon gut«, winkte Cornelius ab. Auch der Köhler schien kein Empfänger seiner Pointen an diesem Tag zu sein. Und dann erzählte der junge Mann eine Geschichte, die geradewegs hätte ausgedacht sein müssen, wenn er nicht dermaßen todernst berichtet hätte.
»Ein menschlicher Körper, sagst du?«, fragte Cornelius nach. »Im Meiler? Und ich dachte, du eilst hierher, weil deine Schwester vorzeitig entbindet.« Cornelius hatte die junge Korbmacherein neulich auf dem Markt gesehen, wie sie hochschwanger die Waren feilbot.
Er entschied, der Bitte des Jungen nachzugeben, um sich die Sache genauer anzusehen. Cornelius erwog, den Wachtmeister Spoerri in der Angelegenheit, deren Gewicht er nicht ermessen konnte, hinzuzuziehen. Das war eine Überlegung, die den Köhler aufhorchen ließ, und er protestierte gegen diese Idee.
»Wenn es so ist, wie du sagst, Lorenz, dann sollten wir den Wachtmeister dazu holen.«
Erst vorsichtig, dann energischer schüttelte der Bursche den Kopf. Cornelius massierte seine allzu überbeanspruchten Partien der Kalkulation. Diese lagen zwischen Augen und Ohren. »Spoerri wird mit uns beiden hadern und die folgenschwersten Schlüsse ziehen, wenn wir ihn außen vor lassen, verstehst du?«
Lorenz war zwar nur ein Köhler, aber kein Dummkopf, fand Cornelius. Jener nickte und ging dem Arzt voraus, um das Sprechzimmer zu verlassen.
Cornelius entledigte sich der Adligen mittels einer Ausrede eines dringenden auswärtigen Falles. Die schaute aus weit auseinanderstehenden Augen und zeugte ein weiteres Mal von Engelsgeduld. »Ich werde auf Euch warten, Herr Doktor.«
Der Arzt, um ein Lächeln verlegen, stammelte einen Gruß und verließ den Salon. Um seine anderen Patienten, die seit geraumer Zeit in seinem Vorzimmer verharrten, tat es ihm aufrichtig leid.
Erst als Cornelius in der Wagnerei seinen leichten Einspänner richten ließ, fiel ihm auf, dass Lorenz unter Schock stand. Ins Leere starrend lehnte er an der Stalltür, während seine Kiefer mahlten.
Cornelius musste ihn mehrmals anrufen, bis der Jüngere zu ihm auf den Bock stieg. Vergeblich löcherte er den Burschen bezüglich des leblosen Körpers im Meiler. Lorenz wiederholte nur immer wieder dieselben Worte. »Ein Toter in meinem Meiler.«
Armer Kerl, dachte Cornelius, grüßte die aus ihrem Ladenfenster winkende Pfefferkuchenbäckerin und den an ihnen vorbeirennenden Kesselflicker. Weil der Einspänner auf der Gasse nicht so einfach zu wenden war, lenkte Cornelius ihn einmal um den gesamten Markt, um dann den Wagen gen Westen Richtung Spoerris Wachstube zu chauffieren.
»Ich hatte heute den Fischer Merten bei mir«, versuchte Cornelius während der Fahrt ein leichtes Gespräch zu beginnen, um den Jungen aufzutauen. Er erwiderte nichts, sondern starrte vor sich hin. »Der sagte, ihr fischt mit großen Reusen …«
Der Blick des jungen Mannes füllte sich mit Abscheu, und zwischen seinen leicht geschwungenen Augenbrauen vertieften sich zwei kleine Trotzfalten. »Er lässt uns kaum was übrig. Das Wasser kommt so klar wie aus dem Brunnen bei uns an. Sogar den Tang holt der Lange raus! Der soll bloß das Maul halten.«
Cornelius biss sich auf die Unterlippe und konzentrierte sich auf den Rappen. Er nahm meistens den Rappen, wenn er frei war, und kam stets gut mit ihm zurecht, aber auf dem Weg zum Wachtmeister schien das Pferd irgendwas zu stören.
Spoerri verwunderte die Geschichte, mit der Cornelius ihn begrüßte ebenso, wie sie es mit dem Arzt zuvor getan hatte. Dennoch froh über die Abwechslung gab der redselige Wachtmeister das Regiment in der Wache an den rangnächsten Neugebauer ab.
Lorenz rutschte auf den Rücksitz und wurde von Spoerri genauso bestürmt, Einzelheiten preiszugeben wie von Cornelius zuvor, schwieg aber beharrlich.
»Ah, der junge Mann schmollt«, betonte Spoerri. »Er redet nicht mit dem Kommissar! Na schön«, sagte er affektiert in Cornelius’ Richtung. »Aber höre …«, drehte er sich noch einmal zum Jüngeren um und klang jetzt schroff. »Ich bin das Gesetz! Und wenn es kein blöder Witz ist, was du da in die Stadt gebracht hast, dann wirst du früher oder später mit mir reden und dich vor dem Gesetz, also mir, verantworten müssen.«
»Was reden Sie da!«, rümpfte der Bursche die Nase. »Drohen Sie mir?«, neigte sich der Junge mutig zum Wachtmeister vor.
»Für dich immer noch Ihr, Bürschchen.«
»Herr Doktor, das ist genau der Grund, warum ich den nicht mit dabeihaben wollte und zu Euch kam!«
Während sich Spoerri ausstreckte, um dem Burschen eine zu verpassen, bekam Cornelius dessen Arm zu fassen. »Herr Wachtmeister, der Junge steht unter Schock, Herrgott! Fassen Sie sich!«
»Schock!«, blaffte Spoerri. »Vermutlich ist das alles gar nicht wahr, was der Kerl erzählt, und wir laufen einer Lächerlichkeit auf! Ich mag die nicht, die Köhler, die Eigenbrötler, die unter sich bleiben. Haben Sie mal einen von denen in der Kirche gesehen?« Wieso beriefen sich an diesem Morgen alle aufs Gotteshaus? »Die kochen mehr als nur Wasser!«
Cornelius beschloss, nicht in der Gerüchteküche mitzurühren. Welchen Grund hätte ein Köhler, den weiten Weg zu Fuß durch den Wald und dann die Via Regia entlang zu hetzen, nur um dann ein Lügenmärchen zu erzählen?
Es frischte auf. Stille herrschte unter den dreien, Vogelstimmengewirr über ihnen. Sie waren in südlicher Richtung unterwegs, wo das Maltitzer Gut lag. Kaum dass der Weg in den dichten Wald mündete, wurde es finster dort, wohin die Sonne in dieser Jahreszeit nicht mehr kam.
Nach einer ganzen Weile versuchte Cornelius abermals ein Gespräch in Gang zu bringen: »War das euer letzter Meiler für dieses Jahr?« Cornelius bekam keine Antwort.
»Eigenwillige Schwarzmänner!«, knurrte Spoerri und verschränkte die Arme vor der Brust. »Sie wissen, was man über diese Leute sagt, Herr Doktor: Das sind Dummköpfe und Saufbolde, die gern Geschichten erzählen.«
»Lassen Sie’s gut sein«, seufzte Cornelius, der sich abermals zum Fahrgast umgedreht hatte. Lorenz war eingenickt. Der Fahrtwind warf ihm das fransige Haar ins Gesicht. Cornelius fiel jetzt erst auf, wie furchtbar schwarz alles an dem Jungen war, wenn er die strahlenden Augen geschlossen hielt. Selbst das Halstuch, das die Waldburschen sich vor Mund und Nase banden, wenn sie die Kohle rissen, schien den feinen Staub nicht abhalten zu können. Wie wohlig das Bad in der Löbau wohl nach so einem schmutzigen Tagwerk sein musste, ganz gleich wie kalt es war.
Weil Cornelius nicht wusste, wo die Köte der Köhler stand, musste er den Jüngeren wecken. Lorenz rappelte sich auf, atmete tief durch und rieb seine Augen. Er fand sofort die Orientierung in dem für Cornelius undurchdringlichen Wald. »An der Weggabelung, die zum Gerßdorff’schen Gut hochführt, halt. Dann müssen wir zu Fuß links rein.«
Cornelius erschauerte beim Blick in die Grabesschwärze, die zwischen den in der Ferne dunkler werdenden Baumstämmen lauerte. Selbst jetzt, da die Büsche zu Füßen der Kiefern und Fichten bunt gefärbtes Laub trugen, war der Wald düster und versprach ungeahnte Abhänge und Steilklippen zur Löbau hinunter. Cornelius ärgerte sich, kein besseres Schuhwerk angezogen zu haben. Und so wie Spoerri schaute, ärgerte sich dieser über dasselbe.
Sie spannten den Rappen aus. Cornelius war nicht wohl bei dem Gedanken, das Pferd allein zurückzulassen. Falls der Rappe gestohlen würde, gäbe es nicht genug Bäcker und Fischer in der Gegend, um das Pferd mit Forellen und Wecken abzuzahlen. Das Pferd musste also mit. Cornelius, weil er hier als Mediziner, nicht als Richter oder Wachtmeister aufwartete, bot dem erschöpften Köhler an, zu Ross den Weg fortzusetzen. Dieser hatte lediglich ein Kopfschütteln für den Vorschlag übrig.
»Sehen Sie? Undank ist der Welten Lohn.«
Spoerris Murren wollte Cornelius überhören. Auf dem rutschigen Boden musste er sich auf seine Füße konzentrieren.
»Wenn es Ihnen guttut, können Sie ja auf das Pferd steigen«, gab Lorenz angriffslustig in Spoerris Richtung zurück, was Cornelius amüsierte. Er hieß es gut, wenn die kleinen Leute, von denen die schwarzen Männer wohl die niedrigsten waren, ihren Eigensinn bewahrten. Und diesem Gedanken schloss sich ein weiterer an, ein viel schwererer, kaum zu greifender Gedanke. Den Blick nicht von dem vor ihm her tappenden Burschen wendend, wurde Cornelius zum allerersten Mal mit der Bedeutung dessen konfrontiert, was der Köhler erzählt hatte: Wartete wirklich ein toter Mensch ein paar Schritte weiter?