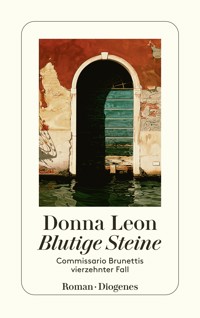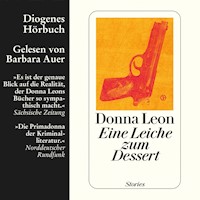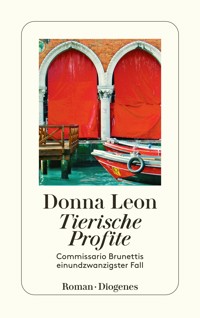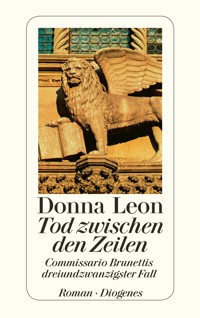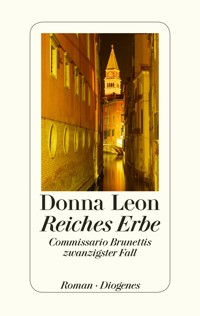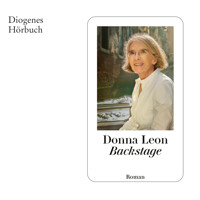10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen treibt tot im Canal Grande und wird von niemandem vermisst. Brunetti aber geht die Elfjährige bis in die Träume nach. Aus einem venezianischen Palazzo kommt sie nicht, wohl aber aus einer Roma-Wagenburg auf dem Festland …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donna Leon
Das Mädchen seiner Träume
Commissario Brunettis siebzehnter Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel des Originals:
›The Girl of His Dreams‹
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2009 im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Mozart, Die Zauberflöte
Text von Emanuel Schikaneder,
hrsg. von Kurt Soldan. Leipzig: Peters 1932
Umschlagfoto von Christine Stemmermann
Für Leonhard Tönz
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24057 3 (3. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60077 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Der Tod macht mich nicht beben; Nur meine Mutter dauert mich,
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
[7] 1
Brunetti zählte im Stillen bis vier, wieder und immer wieder. Auf die Weise, so hatte er herausgefunden, ließen sich fast alle anderen Gedanken abschalten. Die Szene vor ihm konnte er damit zwar nicht ausblenden, aber es war ein verheißungsvoller Frühlingstag, und solange er den Blick über die Umstehenden nach oben lenkte, konnte er die Zypressenwipfel und den leicht bewölkten Himmel betrachten, und was er sah, gefiel ihm. Wenn er den Kopf nur ein klein wenig drehte, sah er aus den Augenwinkeln die hohe Ziegelmauer, hinter der der Turm von San Marco aufragen musste. Das Zählen wirkte als geistige Übung so ähnlich, als ob man, wenn es einen fror, die Schultern einzog. Hoffte man damit, der Kälte weniger Angriffsfläche zu bieten, so mochte es hier den Schmerz verringern, wenn er sich dem Geschehen mit seinen Gedanken nicht aussetzte.
Paola, die rechts neben ihm stand, hakte sich bei ihm unter, und sie setzten sich gemeinsam in Bewegung. Zu seiner Linken hatte er seinen Bruder Sergio, dessen Frau und zwei ihrer Kinder. Raffi und Chiara folgten hinter ihm und Paola. Mit einem matten Lächeln, das sich im Nu in der Morgenluft verflüchtigte, wandte er sich nach den beiden um. Während Chiara zurücklächelte, senkte Raffi den Blick.
Brunetti presste seinen Arm gegen Paolas; sein Blick ruhte auf ihrem Scheitel. Links hatte sie sich das Haar hinters Ohr gestrichen, und er sah, dass sie die goldgefassten [8] Lapislazuliohrringe trug, die er ihr vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt hatte. Das Blau des Ohrschmucks war etwas heller als das ihres Mantels: Sie hatte den dunkelblauen gewählt. Wann, fragte er sich, war die ungeschriebene Regel abgeschafft worden, dass man bei Beerdigungen schwarz zu tragen habe? Das Begräbnis seines Großvaters fiel ihm ein, wo die ganze schwarz verhüllte Familie, allen voran die Frauen, ausgesehen hatten wie gemietete Trauergäste im viktorianischen Roman, den er zu der Zeit freilich noch nicht kannte.
Damals hatte der ältere Bruder seines Großvaters noch gelebt und war auf ebendiesem Friedhof unter ebendiesen Bäumen hinter dem Sarg hergegangen, über den ein Priester vermutlich die gleichen Gebete gesprochen hatte wie der heute. Brunetti erinnerte sich, dass der alte Mann einen Klumpen Erde von seinem Hof unweit von Dolo bei sich trug – den Hof gab es schon lange nicht mehr, er hatte der Autostrada und den Fabriken weichen müssen. Während sie stumm das offene Grab umstanden, in das der Sarg hinabgelassen wurde, hatte der Großonkel – er war mindestens neunzig – sein Taschentuch hervorgeholt, es auseinandergefaltet, einen kleinen Brocken Erde herausgeklaubt und auf den Sargdeckel geworfen.
Diese Geste zählte zu den quälenden Erinnerungen aus Brunettis Kindheit, denn er begriff nicht und keiner aus der Familie hatte ihm erklären können, wieso der alte Mann seine eigene Erde mitgebracht hatte. Jetzt, in der Rückschau, beschlichen ihn allerdings Zweifel, ob die ganze Szene womöglich bloß der Phantasie eines überreizten Sechsjährigen entsprungen war, den all die vielen schwarz verhüllten [9] Menschen ebenso verwirrten wie die hilflosen Bemühungen seiner Mutter, ihm, ihrem kleinen Sohn, den Tod zu erklären.
Jetzt wusste sie wohl Bescheid. Oder auch nicht. Für Brunetti lag der Schrecken des Todes gerade darin, dass jede Gewissheit erlosch, die Toten also aufhörten zu wissen, zu verstehen, ja, dass für sie einfach alles zu Ende war. Dabei waren seine frühen Jahre durchaus von religiösen Mythen geprägt gewesen: das schlafende Jesuskind in seiner Krippe, die Auferstehung des Fleisches und die Verheißung einer besseren Welt für alle guten und frommen Menschen.
Lauter Dinge, an die sein Vater nie geglaubt hatte: Auch das gehörte zu den Konstanten aus Brunettis Kindheit. Ein verschlossener Nihilist, der seine offenbar tiefgläubige Frau stillschweigend gewähren ließ, selbst aber nie zur Kirche ging, ja sich, wenn der Priester das Haus segnen kam, jedesmal verdrückte und weder an Taufe, Erstkommunion noch Firmung seiner Kinder teilnahm. Darauf angesprochen, murmelte Brunetti senior etwas von »sciocchezze« oder »roba da donne«, ohne sich weiter auf das Thema einzulassen. Seinen beiden Söhnen ließ er die Wahl, ob sie ihm in der Überzeugung folgen wollten, Religionsausübung sei dummer Weiberkram oder etwas für dumme Frauen. Am Ende aber, dachte Brunetti, hatten sie ihn doch noch gekriegt. Ein Priester hatte dem sterbenden Vater im Ospedale Civile die Letzte Ölung erteilt, und über seinem Leichnam wurde eine Messe gelesen.
Vielleicht war all das seiner Frau zuliebe geschehen. Brunetti hatte genug Erfahrung mit dem Tod, um zu wissen, wie viel Trost der Glaube den Hinterbliebenen zu spenden vermag. Womöglich hatte er selbst das bei einem der letzten [10] Gespräche mit seiner Mutter – oder jedenfalls einem der letzten, solange sie noch geistig klar war – im Hinterkopf gehabt. Sie wohnte damals noch zu Hause, aber ihre Söhne hatten bereits eine Nachbarstochter zu ihrer Betreuung engagiert, die sich erst tagsüber und dann auch nachts um sie kümmerte.
Im letzten Jahr, bevor die Mutter ihnen endgültig entglitten und in jene Welt abgedriftet war, in der sie ihre letzten Lebensjahre zubrachte, hatte sie aufgehört zu beten. Ihr einst so heißgeliebter Rosenkranz war ebenso verschwunden wie das Kreuz auf dem Nachtkasten; und sie ging auch nicht mehr zur Messe, obwohl die junge Frau, die unter ihr wohnte, oft genug ihre Begleitung anbot.
»Heute nicht«, entgegnete die Mutter jedes Mal, wie um sich die Möglichkeit offenzulassen, morgen oder am übernächsten Tag doch mitzugehen. Sie blieb so lange bei dieser Antwort, bis erst die junge Frau und dann die Familie Brunetti ihre Fragen einstellten. Was nicht hieß, dass ihnen ihr Zustand gleichgültig geworden wäre; sie resignierten nur vor den Begleiterscheinungen. Mit der Zeit bot ihr Verhalten immer mehr Anlass zur Besorgnis: An manchen Tagen erkannte sie ihre Söhne nicht, an anderen sehr wohl, und dann plauderte sie ganz unbefangen mit ihnen über ihre Nachbarn und deren Kinder. Allmählich aber verschob sich das Verhältnis, und die Tage, an denen sie ihre Söhne erkannte oder sich erinnerte, dass sie Nachbarn hatte, wurden immer seltener. An einem dieser letzten Tage, einem bitterkalten Wintertag vor sechs Jahren, hatte Brunetti sie am Spätnachmittag besucht. Es gab Tee und die Plätzchen, die sie am selben Morgen gebacken hatte, was allerdings purer [11] Zufall war: Zwar hatte man ihr dreimal gesagt, dass er komme, aber es war ihr längst wieder entfallen.
Während sie beisammensaßen und an ihrem Tee nippten, beschrieb sie ein Paar Schuhe, das sie am Vortag in einem Schaufenster gesehen und gern gekauft hätte. Und obwohl Brunetti wusste, dass sie das Haus seit sechs Monaten nicht mehr verlassen hatte, bot er an, ihr die Schuhe zu besorgen, wenn sie ihm den Weg zu dem Laden beschreibe. Darauf warf sie ihm einen gequälten Blick zu, fing sich jedoch gleich wieder und antwortete, sie wolle lieber selbst hingehen und die Schuhe anprobieren, um sich zu vergewissern, ob sie auch passten.
Nach diesen Worten sah sie geflissentlich in ihre Teetasse, wie um ihre Gedächtnisschwäche zu überspielen. Und Brunetti hatte, um die Spannung zu lösen, aufs Geratewohl gefragt: »Sag mal, mamma, glaubst du eigentlich an den Himmel und das Leben nach dem Tod?«
Als sie die Augen zu ihrem jüngeren Sohn hob, fiel ihm auf, wie trüb die Iris geworden war. »Den Himmel?«, fragte sie zurück.
»Ja. Und Gott«, versetzte Brunetti. »Die ganzen Geschichten.«
Sie trank einen kleinen Schluck, beugte sich vor, um die Teetasse abzustellen, und straffte sich gleich darauf wieder. Sie saß immer kerzengerade, bis ganz zum Schluss. Dann lächelte sie, jenes Lächeln, das sie immer aufsetzte, wenn Guido eine seiner Fragen stellte, die so schwer zu beantworten waren. »Schön wäre es schon, meinst du nicht?«, entgegnete sie und bat ihn, ihr Tee nachzuschenken.
[12] Brunetti spürte, wie Paola neben ihm den Schritt verhielt, und blieb ebenfalls stehen. Er tauchte aus seiner Erinnerung auf und war plötzlich hellwach für seine Umgebung. Dort in der Ecke, in Richtung Murano, stand ein blühender Obstbaum. Rosa Blüten. Kirsche? Pfirsich? Er war nicht sicher, kannte sich nur wenig aus mit Bäumen, aber er war doch froh um das Rosa, eine Farbe, die seine Mutter immer gemocht hatte, obwohl sie ihr nicht stand. Das Kleid, das sie im Sarg trug, war grau, aus leichter Sommerwolle; ein Kleid, das sie seit vielen Jahren besessen, aber nur selten getragen hatte, weil sie es, wie sie scherzhaft zu sagen pflegte, für ihr Begräbnis aufheben wolle. Nun denn.
Ein plötzlicher Windstoß wirbelte die Enden der violetten Stola des Priesters in die Luft. Der Geistliche blieb am Grab stehen und wartete, bis die Trauernden aufschlossen und um die ausgehobene Grube ein leicht verzerrtes Oval bildeten. Es war nicht der Gemeindepfarrer, der zuvor die Messe gelesen hatte, sondern ein ehemaliger Klassenkamerad von Sergio, früher in engem Kontakt mit der Familie, heute Kaplan im Ospedale Civile. Neben ihm hielt ein Mann, der mindestens so alt war wie Brunettis Mutter, ein Messinggefäß in die Höhe, dem der Priester den tropfenden Weihwasserwedel entnahm. Unter leisen Gebeten, die nur die unmittelbar neben ihm Stehenden hören konnten, umschritt er den Sarg und besprengte ihn mit dem geweihten Wasser. Dabei musste er bei jedem Schritt darauf achten, nicht auf einen der Kränze zu treten, die zu beiden Seiten des Grabes an Holzgestellen lehnten und deren sorgfältig drapierte Schleifen in goldenen Lettern liebendes Gedenken versprachen.
[13] Als Brunetti am Priester vorbei wieder nach dem Baum sah, fegte abermals ein Windstoß über die Mauer und riß die rosa Blüten ab, die in einer Wolke durch die Luft tanzten und sich, langsam zur Erde niedersinkend, wie ein rosafarbener Kranz um den Stamm legten. Irgendwo zwischen den letzten Blüten in der Krone begann ein Vogel zu singen.
Brunetti machte sich von Paola los und wischte sich mit dem Ärmelfutter seiner Jacke die Augen. Als er die Lider öffnete, stieg abermals eine Blütenwolke aus dem Baum empor, die im Spiegel seiner Tränen wuchs und wuchs, bis der Horizont in rosafarbenem Dunst verschwamm.
Paola ergriff seine Hand, drückte sie und hinterließ ein hellblaues Taschentuch. Brunetti schneuzte sich, betupfte seine Augen, zerknüllte das Taschentuch in der Rechten und stopfte es in die Jackentasche. Chiara kam an seine andere Seite, nahm seine Hand und hielt sie fest, während die Bibelworte gesprochen wurden, der Wind die Gebete mit sich forttrug und die Träger vortraten, um den Sarg an Tauen in die ausgehobene Grube hinabzulassen. Für einen Moment verlor Brunetti völlig die Orientierung und sah sich nach dem alten Mann aus Dolo um, aber nicht er, sondern die Totengräber ließen die ersten Schaufeln Erde auf den Sarg niederprasseln. Anfangs vernahm man ein hohles Echo, doch das legte sich, sobald eine dünne Schicht das Holz bedeckte. Da es in den letzten Wochen viel geregnet hatte, war die Erde schwer vor Nässe; dumpf polterten die Klumpen in die Tiefe. Wieder und wieder.
Und dann warf auf der anderen Seite jemand – vielleicht Sergios Sohn – einen Strauß Narzissen auf das Erdreich unten in der Grube und wandte sich zum Gehen. Auf ihre [14] Schaufeln gestützt, hielten die Männer in ihrer Arbeit inne, was die Leute am Grab als Anlass zum Aufbruch nahmen. Während man sich über den frischen grünen Rasen zurück zum Ausgang und dem Vaporetto-Anleger begab, geriet die Unterhaltung immer wieder ins Stocken, da jeder sich bemühte, das Richtige, und wenn er das nicht traf, wenigstens irgendetwas zu sagen.
Ein Vaporetto der Linie 42 kam, und alle gingen an Bord. Brunetti und Paola blieben an Deck. Doch im Schatten des Bootsdachs wurde es rasch empfindlich kühl. Der leichte Wind, der innerhalb der Friedhofsmauern geweht hatte, frischte hier draußen so kräftig auf, dass Brunetti den Kopf einzog und die Lider zusammenkniff. Paola schmiegte sich an ihn, und er legte ihr mit geschlossenen Augen den Arm um die Schultern.
Ein leicht verändertes Motorengeräusch zeigte an, dass das Boot sein Tempo drosselte. Sie näherten sich den Fondamenta Nuove, und während das Vaporetto in weitem Bogen den Anlegeplatz ansteuerte, schien die Sonne auf Brunettis Rücken und wärmte ihn. Er hob den Kopf, öffnete die Augen und blickte auf die geschlossene Häuserfront, hinter der hie und da ein Glockenturm aufragte.
»Jetzt ist es bald überstanden«, hörte er Paola sagen. »Nur noch zu Sergio, dann das Mittagessen, und danach können wir einen Spaziergang machen.«
Er nickte. Ein kleiner Empfang im Haus seines Bruders, um den engsten Freunden für ihr Kommen zu danken, und dann würde die Familie miteinander zum Essen gehen. Anschließend konnten sie zu zweit – oder, falls die Kinder mitwollten, zu viert – spazierengehen: vielleicht entlang der [15] Zattere oder in den Giardini, wo die Sonne schien? Hauptsache, es wurde ein langer Spaziergang, der ihm Gelegenheit gab, die Orte aufzusuchen, die ihn an seine Mutter erinnerten, in einem ihrer Lieblingsläden eine Kleinigkeit zu kaufen und vielleicht in der Frari-Kirche eine Kerze vor der Himmelfahrt Mariens anzuzünden, einem Gemälde, das ihr immer besonders lieb gewesen war.
Das Boot erreichte den Anleger. »Was bleibt, sind nur…«, begann er und stockte, weil er nicht weiterwusste.
»Was bleibt, sind die guten Erinnerungen an sie«, ergänzte Paola. Ja, genauso war es.
[16] 2
Freunde und Verwandte umringten sie, während das Boot am imbarcadero anlegte, doch Brunetti konzentrierte sich auf das nahende Ufer und dachte, um sich abzulenken, an Sergios Haus, das komplett renoviert und erst vor einem halben Jahr fertig geworden war. Wenn alte Menschen sich am liebsten über ihre Gesundheit austauschten und die Männer beim Thema Sport zueinanderfanden, dann waren Immobiliengespräche der soziale Kitt, der die Venezianer aller Schichten zusammenhielt. Nichts faszinierte sie mehr als die Gerüchte über Preise, die verlangt und gezahlt, große Geschäfte, die gemacht oder in den Sand gesetzt wurden; stundenlang konnten sie Wohnflächen berechnen und über Vorbesitzer oder jene unfähigen Bürokraten herziehen, die über Renovierungen und Modernisierungen zu entscheiden hatten. Brunetti glaubte, dass an venezianischen Abendbrottischen nur über Speisen und Getränke noch ausgiebiger debattiert wurde. Sollte dies der Ersatz für die einstigen Kriegsgeschichten sein? Waren Raffinesse und Geschäftstüchtigkeit beim An- und Verkauf von Häusern und Wohnungen an die Stelle von Mut, Tapferkeit und Patriotismus getreten? So schmachvoll, wie der einzige Krieg, an dem sich das Land seit Jahrzehnten beteiligt hatte, gescheitert war, taten die Leute vielleicht besser daran, sich mit Immobilien zu beschäftigen.
Die Uhr an den Fondamenta Nuove zeigte erst kurz nach elf. Der Vormittag war seiner Mutter stets die liebste [17] Tageszeit gewesen: Wahrscheinlich hatte Brunetti seine Morgenfröhlichkeit, die Paola oft an den Rand der Verzweiflung trieb, von ihr geerbt. Passagiere gingen von Bord, andere stiegen zu, und dann ging es zügig weiter nach Madonna dell’Orto, wo die Familie Brunetti und ihre Freunde ausstiegen und, links an der Kirche vorbei, stadteinwärts zogen.
Am Kanal wandten sie sich nach links, dann über die Brücke nach rechts, und schon waren sie am Ziel. Sergio öffnete die Tür, und im Gänsemarsch stieg man leise die Treppe hinauf und betrat die Wohnung. Während Paola gleich in der Küche verschwand, um Gloria ihre Hilfe anzubieten, trat Brunetti ans Fenster und sah hinüber zur Kirche. Ein Mauervorsprung verdeckte einen Teil der Fassade, so dass er nur die sechs Apostel auf der linken Seite sehen konnte. Die Backsteinkuppel des Glockenturms hatte ihn immer an einen panettone erinnert, so auch jetzt.
Die Gäste hinter ihm tauten allmählich auf; Brunetti, der ihren Gesprächen nur mit halbem Ohr folgte, war erleichtert, dass sie nicht aus falsch verstandener Trauer in gedämpftes Flüstern verfielen. Er blieb mit dem Rücken zum Raum stehen und behielt weiter die Kirche im Auge. Er war nicht in der Stadt gewesen in jener Nacht, als jemand sich still und heimlich hineingeschlichen und die Bellini-Madonna vom Altar der linken Seitenkapelle entwendet hatte. Über zehn Jahre war das jetzt her; damals waren Kunstfahnder aus Rom angereist, aber Brunetti und seine Familie hatten ihre Ferien auf Sizilien nicht unterbrochen. Als sie schließlich nach Hause kamen, waren die Spezialisten schon wieder abgezogen, und die Zeitungen hatten das Interesse an dem Fall [18] verloren. Und das war das Ende vom Lied. Weiter geschah nichts: Das Bildnis hätte sich genauso gut in Luft aufgelöst haben können.
Die Stimmen hinter ihm nahmen eine andere Färbung an, was Brunetti veranlasste, sich wieder dem Raum zuzuwenden. Gloria, Paola und Chiara waren, jede mit einem Tablett, aus der Küche gekommen; die beiden Frauen brachten Tassen und Chiara drei Schalen mit selbstgebackenen Plätzchen. Diese schlichte kleine Feier war für Freunde gedacht, die ihren Kaffee trinken und bald danach aufbrechen würden: Brunetti wusste das und war doch bekümmert über so ein mickriges Gedenken für ein Leben, in dem Essen und Trinken und herzliche Gastlichkeit eine zentrale Rolle gespielt hatten.
Sergio kam mit drei Flaschen Prosecco aus der Küche. »Vor dem Kaffee sollten wir, denke ich, Lebewohl sagen«, meinte er.
Die Tabletts wurden auf dem niedrigen Couchtisch abgestellt, und Gloria, Paola und Chiara verschwanden wieder in der Küche. Als sie wenige Minuten später zurückkehrten, sprossen zwischen den Fingern ihrer erhobenen Hände je drei Proseccokelche.
Kaum dass Sergio mit einem »Plopp« den ersten Korken knallen ließ, wandelte sich wie durch Zauberei die Stimmung im Raum. Er schenkte die bereitgestellten Gläser voll, und während in den ersten der Prosecco aufhörte zu perlen, öffnete er nacheinander die zweite und dann die dritte Flasche und füllte mehr Gläser, als Gäste da waren. Alle drängten sich um den Tisch, nahmen sich ein Glas und hielten es erwartungsvoll empor.
[19] Sergio sah zu Brunetti hinüber, doch der erhob sein Glas und nickte dem älteren Bruder zu, zum Zeichen, dass für den Trinkspruch nun er als Familienoberhaupt zuständig sei.
Daraufhin hob Sergio sein Glas, und schlagartig wurde es still im Zimmer. Er reckte den Arm noch höher und sagte mit einem Blick in die Runde: »Auf Amelia Davanzo Brunetti und auf uns, die wir ihr für immer in Liebe verbunden sind.« Er trank sein Glas zur Hälfte aus. Zwei oder drei der Anwesenden wiederholten seinen Toast mit leiser Stimme, und dann tranken alle. Als man die Gläser abgesetzt hatte, war wieder eine gewisse Leichtigkeit spürbar. Und während das Gespräch sich ungezwungen den Themen des Lebens zuwandte, schlich sich auch das Futur wieder ein.
Einige Gläser blieben halbvoll stehen, und die Gäste gingen zum Kaffee über; man kostete von den Plätzchen und rüstete sich dann allmählich zum Aufbruch. An der Tür wechselte jeder noch ein paar Worte mit den Brüdern und küsste sie zum Abschied.
Zwanzig Minuten später waren Sergio und Guido mit ihren Frauen und Kindern allein. Sergio sagte mit einem Blick auf seine Uhr: »Ich habe für uns einen Tisch reserviert. Ich schlage vor, wir lassen das hier alles so stehen und gehen essen.«
Brunetti leerte sein Glas und stellte es neben die vollen, die unberührt in einem Kreis auf dem Tisch standen. Er wollte Sergio dafür danken, dass er die richtigen Worte gefunden hatte, ohne pathetisch zu werden, doch er wusste nicht, wie. Er hatte sich schon zum Gehen gewandt, als er noch einmal kehrtmachte und seinen Bruder umarmte. Dann [20]
[21] 3
Da die Beerdigung auf einen Samstag fiel, brauchte sich keiner für den nächsten Tag am Arbeitsplatz oder in der Schule beurlauben zu lassen. Bis zum Montagmorgen hatte sich der gewohnte Rhythmus wieder eingespielt, und alle brachen zur üblichen Zeit auf – alle bis auf Paola, für die der Montag zu den unifreien Tagen gehörte, wo sie daheim am Schreibtisch arbeiten konnte. Brunetti ließ sie schlafen. Als er aus dem Haus trat, empfing ihn ein warmer, sonniger Tag; nur die Luft war immer noch ein wenig feucht. Er machte sich auf den Weg zum Rialto, um als Erstes eine Zeitung zu kaufen.
Aufatmend stellte er fest, dass die Trauer nicht allzu schwer auf ihm lastete. Seine Mutter war einem Zustand entkommen, der ihr, hätte sie ihn bewusst erlebt, unerträglich gewesen wäre, und die Erleichterung darüber gab ihm Frieden.
Die Stände mit Schals, T-Shirts und Touristenkitsch, an denen er vorbeikam, hatten alle schon geöffnet, aber er war so in Gedanken, dass er die knalligen Farben gar nicht bemerkte. Er nickte ein oder zwei Bekannten zu, jedoch ohne seinen Schritt zu verlangsamen, damit ja niemand auf die Idee kam, stehenzubleiben und ihn anzusprechen. Wie jedes Mal warf er, bevor er sich zur Brücke wandte, im Vorbeigehen einen Blick zur Uhr hinüber. Pieros Laden zu seiner Rechten war der einzige, der noch Lebensmittel verkaufte: Alle anderen hatten auf irgendwelchen wertlosen Plunder umgestellt. Auf einmal stieg ihm ein so durchdringender [22] Gestank nach Chemikalien und Farbstoffen in die Nase, als hätte man ihn nach Marghera verfrachtet oder das Fabrikviertel hierher versetzt. Der scharfe, widerliche Geruch ätzte seine Schleimhäute und trieb ihm Tränen in die Augen. Das Seifengeschäft gab es schon eine ganze Weile, aber bisher hatten ihn nur die künstlichen Farben gestört; heute war es der Gestank. Erwartete man allen Ernstes, dass die Leute sich damit waschen würden?
Auf dem Weg zum Campo San Giacomo bemerkte er an Ständen, die früher frisches Obst vertrieben hatten, abgepackte Pasta, in Flaschen abgefüllten aceto balsamico und getrocknete Früchte, die ihn mit ihren grellen Farben ankreischten und ebenso in die Flucht schlugen wie zuvor die beißenden Gerüche. Gianni und Laura hatten ihren Obststand schon vor Jahren aufgegeben, genau wie der langhaarige Typ und seine Frau, die allerdings an Inder oder Singhalesen verkauft hatten. Wie lange mochte es noch dauern, bis der Obst- und Gemüsemarkt komplett verschwand und die Venezianer, wie die übrige Welt, ihre Vitamine aus dem Supermarkt beziehen mussten?
Bevor er sich weiter in diese Elendslitanei vertiefen konnte, mischte sich Paolas Stimme in seine Gedanken, und er hörte sie sagen: Wenn sie alte Weiber belauschen wolle, die der guten alten Zeit nachweinten und die ganze Welt in Scherben gehen sahen, dann würde sie sich vormittags für ein Stündchen ins Wartezimmer ihres Hausarztes setzen. Er aber möge sie, zumal in den eigenen vier Wänden, mit solchem Gejammer verschonen.
Die Erinnerung machte ihn schmunzeln. Unterdessen war er auf dem Scheitel der Brücke angelangt und nahm, bevor [23] er auf der anderen Seite hinunterstieg, seinen Schal ab. Scharf nach links, am Ufficio Postale vorbei über die nächste Brücke, und schon stand er vor dem Ballarin, wo er sich einen caffè und eine Brioche genehmigte. Während er, von beiden Seiten eingekeilt, an der Theke lehnte, spürte er, dass die Erinnerung an Paolas Klage über seine Klagen ihn aufgeheitert hatte. Er entdeckte sein Konterfei im Spiegel hinter dem Tresen und grinste sich zu.
Brunetti zahlte und setzte, beschwingt durch das schöne Wetter, seinen Weg fort. Auf dem Campo Santa Maria Formosa knöpfte er seine Jacke auf. Kurz vor der Questura sah er Foa, den Bootsführer, der sich über den Rand seiner Barkasse beugte und den Kanal entlangspähte, in Richtung der griechischen Kirche.
»Was gibt’s, Foa?«, rief Brunetti und blieb neben dem Boot stehen.
Foa drehte sich um und lächelte, als er den Rufer erkannte. »Einer von diesen verrückten tuffetti, Commissario. Der fischt hier, seit ich angelegt habe.«
Brunetti spähte kanalaufwärts bis zum Kirchturm, sah aber weit und breit nur spiegelglattes Wasser. »Wo denn?«, fragte er und lief an der Barkasse entlang bis vor zum Bug.
»Da drüben ist er untergetaucht«, entgegnete Foa mit einem Handzeichen, »bei dem Baum auf der anderen Seite.«
Doch Brunetti sah nur die Wasserfläche des Kanals und im Hintergrund die Brücke und den schiefen Glockenturm. »Wie lange ist er denn schon unten?«, fragte er.
»Kommt mir vor wie eine Ewigkeit, aber es dürfte nicht mal eine Minute sein, Commissario.« Foa sah Brunetti an.
Dann starrten beide Männer schweigend kanalaufwärts, [24] die Augen fest auf die Wasseroberfläche gerichtet, und warteten darauf, dass der tuffetto wieder auftauchte.
Und auf einmal war er da, emporgeschossen wie eine Plastikente in der Badewanne. Eben noch fehlte jede Spur von ihm, doch schon im nächsten Augenblick paddelte der Zwergtaucher geschmeidig dahin, umgeben von einem Strahlenkranz kleiner Wellen, die das Wasser kräuselten.
»Glauben Sie, dass ihm die Fische hier bekommen?«, fragte Foa skeptisch.
Brunetti sah hinunter in das Wasser neben dem Boot: grau, träge, undurchsichtig. »Ich nehme an, sie schaden ihm nicht mehr als uns«, antwortete er.
Brunettis Blick schweifte erneut über den Kanal, aber da war der kleine schwarze Vogel schon wieder untergetaucht. Er überließ Foa den Beobachtungsposten, begab sich in die Questura und hinauf in sein Büro.
Als er an diesem Morgen aus dem Haus gegangen war, hatte Brunetti vor allem die bevorstehende Rückkehr von Vice-Questore Giuseppe Patta beschäftigt. Sein direkter Vorgesetzter war zwei Wochen in Berlin gewesen, wo er an einer Interpol-Konferenz zur Bekämpfung der Mafia teilgenommen hatte. Obwohl die Einladung ausdrücklich an Teilnehmer im Kommissarsrang gerichtet war, hatte Patta seine persönliche Teilnahme für unerlässlich gehalten. Ermöglicht wurde dieses Arrangement durch seine Sekretärin, Signorina Elettra Zorzi, die ihn mindestens zweimal täglich und meist noch öfter in Berlin anrief und seine Instruktionen zu einer Reihe laufender Ermittlungen einholte. Da Patta selbst garantiert niemals von auswärts mit der Questura telefoniert hätte, [25] kam er auch nicht auf die Idee, dass Signorina Elettra ihn die ganze Zeit über aus einem Hotel in Abano Terme anrief, wo sie sich zwei Wochen Sauna, Fango und Massagen gönnte.
Oben in seinem Büro sah Brunetti erst die Akten auf seinem Schreibtisch durch. Dann griff er zur Zeitung und überflog die Titelseite. Von dort blätterte er weiter zu den Seiten acht und neun, wo gelegentlich auch einmal über den italienischen Tellerrand hinausgeblickt wurde. Wahlunruhen in Zentralasien mit zwölf Toten und Militär auf den Straßen; russische Geschäftsleute nebst zwei Leibwächtern in einen Hinterhalt gelockt und getötet; Schlammlawinen in Südamerika, ausgelöst durch illegale Abholzung und schwere Regenfälle; akute Konkursängste bei der Alitalia.
Traten derlei Vorfälle wirklich mit so bestürzender Regelmäßigkeit auf, oder kramten die Zeitungen sie nur aus dem Archiv hervor und recycelten sie nach einem ereignislosen Wochenende, wenn es außer über Sport nichts zu berichten gab? Er blätterte eine Seite weiter, fand jedoch nichts Lesenswertes. Blieben bloß noch Feuilleton, Vermischtes und Sport, aber keins dieser Ressorts interessierte ihn an dem Morgen.
Sein Telefon klingelte. Er meldete sich mit Namen, und der Posten am Haupteingang erklärte, ein Priester wünsche ihn zu sprechen.
»Ein Priester?«, wiederholte Brunetti.
»Sì, Commissario.«
»Lassen Sie sich bitte seinen Namen geben.«
»Jawohl.« Der Beamte deckte kurz die Sprechmuschel ab, dann war er wieder da. »Er sagt, er heißt Padre Antonin, Dottore.«
[26] »Ah, dann können Sie ihn raufschicken«, antwortete Brunetti. »Zeigen Sie ihm den Weg, und ich nehme ihn oben an der Treppe in Empfang.« Padre Antonin war der Geistliche, der über dem Sarg seiner Mutter den letzten Segen gesprochen hatte. Aber er war Sergios Freund, nicht seiner, und Brunetti konnte sich nicht denken, was den Padre in die Questura führte.
Er kannte Antonin schon seit seiner und Sergios Schulzeit. Damals war Antonin Scallon ein ziemlicher Rüpel gewesen, der immer versucht hatte, den anderen Jungs, besonders den kleineren, seinen Willen aufzuzwingen und sich als ihr Anführer aufzuspielen. Wieso Sergio sich mit ihm angefreundet hatte, war Brunetti immer ein Rätsel gewesen, obwohl er merkte, dass Antonin seinen Bruder nie herumkommandierte. Nach der Mittelschule hatten die Brüder verschiedene Schulen besucht, und Brunetti hatte Antonin aus den Augen verloren. Er wusste nur, dass Scallon ein paar Jahre später ins Priesterseminar eingetreten und von dort als Missionar nach Afrika gegangen war. Während seines Aufenthalts in einem Land, dessen Namen Brunetti sich nie hatte merken können, hörte man nur einmal im Jahr von ihm, nämlich kurz vor Weihnachten, wenn er einen Rundbrief verschickte, den auch Sergio bekam und in dem Antonin begeistert von der Missionsarbeit zur Rettung armer Seelen berichtete und der stets mit der Bitte um eine Geldspende schloss. Ob Sergio dieser Bitte nachgekommen war, wusste Brunetti nicht: Er selbst hatte jedenfalls aus Prinzip jede Unterstützung verweigert.
Und dann, vor etwa vier Jahren, war Antonin plötzlich wieder in Venedig aufgetaucht, arbeitete seither als Kaplan [27] am Ospedale Civile und lebte bei den Dominikanern in deren Mutterhaus neben SS. Giovanni e Paolo. Sergio hatte von Antonins Rückkehr erzählt, so wie er dem Bruder zuvor auch gelegentlich die Briefe aus Afrika gezeigt hatte. Darüber hinaus erwähnte Sergio den ehemaligen Schulfreund nur das eine Mal, als er sich erkundigte, ob es Brunetti recht sei, wenn der Priester zur Beerdigung käme und einen Segen spräche; eine Bitte, die Brunetti ihm nicht abschlagen konnte, selbst wenn er es gewollt hätte.
Als Brunetti oben an den Treppenabsatz trat, bog der Priester gerade um die letzte Kehre. Er trug ein bodenlanges Ordenskleid, hielt den Blick gesenkt und eine Hand am Geländer. Von oben konnte Brunetti sehen, wie schütter sein Haar war, wie schmal seine Schultern. Der Priester machte ein paar Stufen vor dem Treppenabsatz halt, atmete zweimal tief durch und grüßte lächelnd, als er sah, dass man ihn beobachtete. Er war so alt wie Sergio, also zwei Jahre älter als Brunetti, doch jeder, der die drei Männer zusammen sähe, würde den Priester für den Onkel der Brüder halten. Er war nicht nur dünn, sondern regelrecht ausgezehrt, und seine Backenknochen sprangen so stark vor, dass die hohlen Wangen darunter zwei straff gespannte, dunkle Dreiecke bildeten.
Antonins Hand am Geländer griff ein Stück weit vor, und mit gesenktem Kopf, die Füße fest im Blick, erklomm er die letzten Stufen. Brunetti blieb nicht verborgen, wie er sich bei jedem Schritt am Handlauf emporzog. Oben angekommen, rang der Priester abermals nach Luft, bevor er Brunetti die Hand entgegenstreckte. Der war erleichtert, dass Antonin keine Anstalten machte, ihn zu umarmen oder ihm gar den Friedenskuss zu entbieten.
[28] »Ich kann mich«, sagte der Priester, »offenbar nicht mehr an Treppen gewöhnen. Nach über zwanzig Jahren ohne bin ich völlig aus der Übung. Vor allem habe ich vergessen, wie anstrengend sie sind.« Die Stimme war unverändert, mit den für das Veneto typischen, übertriebenen Zischlauten. Trotzdem hörte man ihm seine Herkunft nicht mehr ohne weiteres an, denn er hatte den heimischen Tonfall verloren. Als Antonin sich immer noch nicht rührte, begriff Brunetti, dass der Kommentar über die Treppen dem Priester als Vorwand gedient hatte, um Atem zu schöpfen.
»Wie lange warst du eigentlich fort?«, fragte Brunetti, um ihm eine längere Verschnaufpause zu gönnen.
»Zweiundzwanzig Jahre.«
»Und wo genau?«, forschte er weiter, bevor ihm einfiel, dass er das hätte wissen sollen, und sei es nur aus den Briefen, die Sergio erhalten hatte.
»Im Kongo. Als ich hinkam, hieß er allerdings Zaire, aber dann ist man zu dem früheren Namen zurückgekehrt.« Er lächelte. »Dasselbe Land, aber gewissermaßen ein anderer Staat.«
»Interessant«, bemerkte Brunetti unverbindlich. Dann hielt er dem Priester die Tür auf, schloss sie hinter sich und folgte ihm langsam ins Zimmer.
»Setz dich hierher.« Brunetti rückte einen der Besucherstühle vor seinem Schreibtisch zurecht und stellte ihm den anderen gegenüber, wobei er sorgsam auf Abstand zwischen beiden achtete. Er wartete, bis der Priester Platz genommen hatte, bevor auch er sich setzte.
»Danke, dass du zur Beisetzung gekommen bist und den Segen gespendet hast«, sagte Brunetti.
[29] »Nicht der beste Anlass für ein erstes Wiedersehen mit alten Freunden«, versetzte der Priester lächelnd.
War das als Vorwurf gemeint, weil in den Jahren seit seiner Rückkehr weder Sergio noch er versucht hatte, mit Antonin Kontakt aufzunehmen?
»Ich habe deine Mutter im Pflegeheim besucht«, fuhr der Padre fort. »Mehrere Patienten, die ich aus dem Krankenhaus kannte, wurden dorthin verlegt.« Er meinte die private Einrichtung, in der Brunettis Mutter ihre letzten Lebensjahre verbracht hatte. »Ich weiß, sie hat es sehr gut gehabt dort; die Schwestern sind sehr nett.« Brunetti nickte lächelnd. »Schade nur, dass ich nie zur gleichen Zeit wie du und Sergio dort war.« Hier stand der Priester unvermittelt auf, doch nur, um seinen langen Rock zu raffen und zur Seite zu schlagen. Danach setzte er sich wieder und fuhr fort. »Die Schwestern haben mir erzählt, dass ihr oft da wart, alle beide.«
»Wahrscheinlich nicht so oft, wie wir gesollt hätten«, sagte Brunetti.
»Was man ›soll‹ oder nicht, ist unter diesen Umständen wohl nicht entscheidend, Guido. Du gehst, wann immer du kannst, und du gehst aus Liebe.«
»Hat sie gewusst, dass wir da waren?«, entfuhr es Brunetti unbeabsichtigt.
Antonin betrachtete seine im Schoß gefalteten Hände. »Ich denke schon. Manchmal. Allerdings weiß ich bei diesen alten Menschen nie sicher, was sie denken oder was in ihnen vorgeht.« Ratlos hob er die Hände und beschrieb einen Bogen in der Luft. »Ich glaube, was sie noch am ehesten wahrnehmen, sind Gefühle. Zumindest intuitiv. Sie spüren, ob [30] der Mensch, der bei ihnen ist, es gut meint und zu ihnen kommt, weil er sie liebt, sie gern hat.« Er sah Brunetti an und schaute dann wieder auf seine Hände. »Oder sie bemitleidet.«
Brunetti fiel auf, dass Antonins Fingernägel nur das halbe Nagelbett bedeckten. Nägelkauen – eine merkwürdige Angewohnheit bei einem Mann dieses Alters. Doch bei näherem Hinsehen erwiesen sich die Nägel als spröde, ungleichmäßig gebrochen, darüber hinaus leicht nach innen gewölbt und fleckig. Brunetti vermutete als Ursache irgendeine Krankheit, die aus Afrika herrührte. Aber warum litt Antonin dann immer noch daran?
»Empfinden sie das alles gleich?«, erkundigte sich Brunetti.
»Du meinst auch das Mitleid?«, fragte Antonin zurück.
»Ja. Das ist doch etwas anderes als Liebe oder Zuneigung, nicht wahr?«
»Ja, schon«, räumte der Priester lächelnd ein. »Aber die Patienten, die ich beobachten konnte, haben sich auch darüber gefreut: Es ist immerhin weit mehr als das, was die meisten alten Menschen an Zuwendung bekommen.« Gedankenverloren lüpfte Antonin mit der Rechten eine Falte seines Talars, zog sie zwischen den Fingern der anderen Hand hindurch und verpasste ihr so einen langen Kniff. Als er den Stoff wieder losließ, sah er Brunetti an und sagte: »Deine Mutter hatte Glück, dass immer noch so viele Menschen voller Liebe und Zuneigung um sie waren.«
Brunetti zuckte nur die Achseln. Seine Mutter hatte das Glück schon vor vielen Jahren verlassen.
»Warum bist du gekommen?«, sagte er und schob die [31] Anrede »Antonin« nach, weil er spürte, wie schroff seine Frage geklungen hatte.
»Wegen einem meiner Gemeindemitglieder«, begann der Priester, korrigierte sich jedoch sofort: »das heißt, wenn ich eine Gemeinde hätte. So ist sie die Tochter eines der Männer, die ich in der Klinik betreue. Er liegt schon seit Monaten dort, und bei meinen Besuchen habe ich auch seine Tochter kennengelernt.«
Brunetti nickte, sagte aber nichts: seine übliche Taktik, wenn er jemanden zum Weiterreden ermuntern wollte.
»Eigentlich geht es ja um ihren Sohn«, sagte der Priester und senkte den Blick wieder auf seinen Rock.
Da Brunetti weder das Alter des Klinikpatienten noch das seiner Tochter kannte, hatte er natürlich auch keine Ahnung, wie alt der Sohn dieser Frau sein und was er für ein Problem haben mochte. Doch wenn Antonin deswegen zu ihm kam, stand zu vermuten, dass es sich um irgendeinen Gesetzeskonflikt handelte.
»Seine Mutter macht sich große Sorgen um ihn«, fuhr Antonin fort.
Brunetti wusste nur zu gut, dass es vielerlei Ursachen haben konnte, wenn eine Mutter sich um ihren Sohn sorgte: Seine Mutter hatte sich um ihn und Sergio gesorgt, und Paola sorgte sich um Raffi, auch wenn das, was die meisten Mütter heutzutage um ihre Kinder bangen ließ, nämlich dass sie Rauschgift nehmen könnten, bei ihm kaum zu befürchten war. Was für ein Glück, dachte Brunetti nicht zum erstenmal, in einer Stadt mit einem solch geringen Anteil jugendlicher Bevölkerung zu leben. Bei einer so kleinen Zielgruppe wie in Venedig lohnten sich die Mühen und Kosten nicht, die [32] nötig waren, um einen Drogenhandel aufzuziehen: Immerhin ein positiver Nebeneffekt der vom Kapitalismus regierten Welt, für den man Gott danken konnte.
In Brunettis anhaltendes Schweigen hinein fragte Antonin: »Macht es dir was aus, wenn ich dich in dieser Sache zu Rate ziehe, Guido?«
Brunetti lächelte. »Ich weiß ja noch gar nicht, was du von mir willst, Antonin, also kann ich auch nichts dagegen haben.«
Zuerst schien der Priester erstaunt über diese Antwort, doch dann grinste er fast verlegen und sagte zustimmend: »Già, già. Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen.« Und nach einer Pause setzte er hinzu: »Ich bin, scheint’s, die Probleme unserer Wohlstandsgesellschaft nicht mehr gewohnt.«
»Ich weiß nicht genau, ob ich verstehe, was du meinst«, sagte Brunetti. Es war eine Feststellung, hinter der sich eine Frage verbarg.
»Dort, wo ich war, im Kongo, hatten die Leute mit anderen Problemen zu kämpfen: Krankheiten, Armut, Hungersnöten, Soldaten, die ihnen ihr Eigentum fortnahmen und manchmal sogar ihre Kinder.« Der Priester vergewisserte sich mit einem Blick auf Brunetti, dass der ihm weiter zuhörte. »Seither schaffe ich’s irgendwie nicht mehr, mich auf Probleme einzulassen, bei denen es um weniger als das nackte Überleben geht; Probleme, die nicht aus Armut, sondern aus Reichtum erwachsen.«
»Fehlt es dir?«, fragte Brunetti.
»Was? Afrika?«
Brunetti nickte.
Wieder beschrieb Antonin mit erhobenen Händen einen [33] Bogen in der Luft. »Schwer zu sagen. Einiges geht mir schon ab: die Menschen, die ungeheuere Weite, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu leisten.«
»Aber du bist zurückgekommen«, konstatierte Brunetti, diesmal ohne fragenden Unterton.
Antonin sah ihm in die Augen. »Ich hatte keine Wahl«, sagte er.
»Aus gesundheitlichen Gründen?«, erkundigte sich Brunetti in Gedanken daran, wie hinfällig der Priester sich die Treppe hinaufgequält hatte und wie hager und schmächtig er ihm jetzt gegenübersaß.
»Ja«, erwiderte Antonin, »das spielte auch eine Rolle.«
»Und was noch?«, hakte Brunetti nach, weil Antonin auf sein Stichwort zu warten schien.
»Konflikte mit meinen Vorgesetzten«, antwortete der Priester.
Antonins Probleme mit seinen Vorgesetzten interessierten Brunetti herzlich wenig. Dass es zu Zerwürfnissen gekommen war, wunderte ihn nicht, wenn er daran dachte, wie Antonin seinerzeit die anderen Kinder herumkommandiert hatte. »Du bist vor ungefähr vier Jahren zurückgekommen, nicht wahr?«, fragte er.
»Ja.«
»Damals hat da unten der Krieg begonnen?«
Antonin schüttelte den Kopf. »Im Kongo wird immer Krieg geführt. Zumindest dort, wo ich war.«
»Und um was?«
Antonin überraschte ihn mit einer Gegenfrage. »Interessiert dich das wirklich, Guido, oder bist du bloß höflich?«
»Nein, es interessiert mich.«
[34] »Also gut. Bei dem Krieg, wobei es stets mehr als einen gibt, denn er zerfällt in viele Minikriege oder Beutekriege oder räuberische Überfälle, geht es immer darum, anderen etwas abzujagen, das man selber unbedingt haben will. Also wird aufgerüstet, bis man sich stark genug fühlt, der Gegenseite die begehrten Güter zu entreißen, die diese ihrerseits mit Waffengewalt verteidigt. Und dann entbrennt ein Kampf oder eine Schlacht oder ein Krieg, und am Ende behält oder erobert die Partei mit den meisten Waffen oder der größten Truppenstärke das, worauf beide Seiten so erpicht waren.«
»Und das wäre?«
»Kupfer. Diamanten. Andere Mineralien. Frauen. Tiere. Je nachdem.« Antonin warf Brunetti einen Blick zu, dann fuhr er fort. »Lass mich dir ein Beispiel geben. Im Kongo wird ein Mineral gewonnen, das man zur Herstellung der Chips für Mobiltelefone benötigt. Zur Zeit ist der Kongo der Hauptlieferant, also kannst du dir sicher vorstellen, wie unerbittlich die Konkurrenten darum kämpfen.«
»Nein.« Brunetti schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich mir das vorstellen kann.«
Antonin schwieg eine Weile. Dann endlich räumte er ein: »Nein, das kannst du wohl wirklich nicht, Guido. Hier in dieser geregelten Welt mit Polizei, eigenen Autos und Häusern, haben die Menschen wohl keinen Schimmer davon, was es heißt, in einer praktisch gesetzlosen Welt zu leben.« Und bevor Brunetti etwas einwenden konnte, fuhr der Priester fort: »Ich weiß, ich weiß, hier klagt man über die Mafia und ihre Willkürherrschaft, aber der sind immerhin Grenzen gesetzt – bis zu einem gewissen Grad jedenfalls –, was ihr Terrain und ihren Handlungsspielraum betrifft. Um den [35] Unterschied zu verstehen, musst du dir vielleicht vorstellen, wie es hier zuginge, wenn alle Macht allein in den Händen der Mafia läge. Wenn es keine Regierung gäbe, keine Polizei, keine Armee, nichts außer vagabundierenden Gangsterbanden, die sich einbilden, eine Waffe verleihe ihnen das Recht, sich zu nehmen, was immer sie wollen, Güter wie Menschen.«
»Und so hast du gelebt?«, fragte Brunetti.
»Anfangs nicht, nein. Zum Ende hin wurde es immer schlimmer. Vorher genossen wir doch einen gewissen Schutz. Und etwa ein Jahr lang hatten wir die UN-Blauhelme in der Nähe, die einigermaßen für Ruhe sorgten. Doch dann wurden sie abgezogen.«
»Und dann bist du fort?«, fragte Brunetti.
Der Priester rang nach Luft, als hätte man ihm einen Schlag versetzt. »Ja, dann bin ich fort«, sagte er. »Und nun muss ich mich mit den Problemen der Luxusgesellschaft befassen.«
»Was dir offenbar nicht liegt«, warf Brunetti ein.
»Ob es mir liegt oder nicht, ist ganz unerheblich, Guido. Worauf es ankommt, ist, sich ungeachtet aller Unterschiede klarzumachen, dass die Menschen hier wie dort in Nöten sind und dass reiche, gutgestellte Bürger ebenso leiden wie diese armen Teufel, die gar nichts besitzen und denen auch dieses Nichts noch genommen wird.«
»Auch wenn man die Probleme nicht wirklich für vergleichbar hält?«
[36] 4
Glaube hin oder her, Brunetti wusste noch genauso wenig, was den Priester zu ihm geführt hatte, wie bei dessen Erscheinen. Er erkannte dagegen sehr wohl, dass der Padre ihn mit seinen Reden über das Elend der Kongolesen für sich einnehmen, sich sein Wohlwollen erschleichen wollte. Da die Not dieser Menschen selbst einen Stein erweichen würde, war Brunetti neugierig, wieso Antonin offenbar glaubte, sich mit seinen Schilderungen schon als besonders empfindsam zu empfehlen.
Die letzte Bemerkung des Padre ließ Brunetti unbeantwortet im Raum stehen. Auch der Priester blieb still und reglos sitzen. Vielleicht hielt er ja das, was auf Brunetti wie fromme Platitüden gewirkt hatte, für so tiefsinnig, dass es nur stumme Anerkennung verdiente.
Brunetti sah keine Veranlassung, das Schweigen zu brechen. Er wollte nichts von dem Priester, also ließ er ihn schmoren. Endlich sagte Antonin: »Ja, ich möchte deinen Rat einholen. Es geht, wie gesagt, um den Sohn einer Freundin.«
»In Ordnung«, erwiderte Brunetti sachlich. Doch als Antonin nicht weitersprach, fragte er: »Was hat er denn getan?«
Daraufhin presste der Priester die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf, so als hätte Brunetti ihm eine Frage gestellt, die zu schwer, wenn nicht gar unmöglich zu beantworten war. Endlich sagte er: »Getan hat er eigentlich noch nichts. Es geht vielmehr um das, was er zu tun vorhat.«
Brunetti erwog die sich bietenden Möglichkeiten: Der [37] junge Mann – einmal angenommen, dass er noch jung war – mochte irgendein Verbrechen planen. Oder er hatte sich mit Leuten eingelassen, die ihm gefährlich werden konnten. War vielleicht in Drogengeschäfte verwickelt oder gar selber süchtig.
»Was hat er denn vor?«, fragte Brunetti schließlich.
»Er will seine Wohnung verkaufen.«
Die Venezianer waren bekannt für ihren Stolz auf die eigenen vier Wände, aber deswegen war es doch noch lange kein Verbrechen, eine Wohnung zu verkaufen. Außer natürlich, sie gehörte einem nicht.
Brunetti beschloss, diesem Hin und Her ein Ende zu machen, bevor Antonin seine Geduld über Gebühr strapazierte. »Vielleicht sagst du mir erst einmal, ob an diesem Verkauf irgendetwas faul ist?«
Antonin überlegte eine Weile, bevor er darauf antwortete. »Streng genommen nicht, nein.«
»Damit kann ich nun wirklich nichts anfangen.«
»Sicher nicht, nein. Also die Wohnung gehört ihm, mithin ist er gesetzlich berechtigt, sie zu verkaufen.«
»Gesetzlich?«, wiederholte Brunetti, weil der Priester dieses Wort eigens betont hatte.
»Er hat die Wohnung vor acht Jahren, an seinem zwanzigsten Geburtstag, von seinem Onkel geerbt. Und bewohnt sie zusammen mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter.«
»Gehört die Wohnung ihm oder dem Paar?«
»Ihm. Sie ist vor sechs Jahren bei ihm eingezogen, aber die Wohnung läuft weiter auf seinen Namen.«
»Und die beiden sind nicht verheiratet?« Brunetti setzte [38] das voraus, wollte es sich aber zur Sicherheit bestätigen lassen.
»Nein.«
»Und ist die Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung gemeldet?«
»Nein«, antwortete Antonin widerstrebend.
»Warum nicht?«
»Das ist kompliziert«, erwiderte der Priester.
»Wie die meisten Dinge im Leben. Also, warum nicht?«
»Nun, die Wohnung, in der sie zuvor mit ihren Eltern gelebt hatte, gehört der IRE. Als ihre Eltern dann nach Brescia zogen, ging der Mietvertrag auf sie über, weil sie arbeitslos war und ein Kind hatte.«
»Wann sind die Eltern weggezogen?«
»Vor zwei Jahren.«
»Als die Tochter schon mit diesem Mann zusammenlebte?«
»Ja.«
»Verstehe«, bemerkte Brunetti trocken. Die von der IRE verwalteten Sozialwohnungen waren für die Bedürftigsten unter Venedigs Bürgern gedacht. Doch im Lauf der Zeit hatten sich unter die Nutzer Anwälte, Architekten, Mitglieder der Stadtverwaltung oder gar Verwandte von IRE-Mitarbeitern eingeschlichen. Damit nicht genug, wurden viele der oft zu einem Spottpreis angemieteten Wohnungen mit beträchtlichem Gewinn untervermietet. »Die junge Frau wohnt also gar nicht mehr dort?«
»Nein«, gestand der Priester.
»Wer dann?«
»Bekannte von ihr«, antwortete Antonin.
[39] »Aber der Mietvertrag läuft noch auf ihren Namen?«
»Ich glaube schon, ja.«
»Glaubst du es, oder weißt du’s?«, erkundigte sich Brunetti freundlich.
Antonin reagierte spürbar gereizt. »Es sind Freunde von ihr«, entgegnete er schroff, »und sie brauchten ein Dach über dem Kopf.«
Brunetti unterdrückte den Einwand, so ergehe es den meisten Menschen, nur hätten sie in der Regel nicht das Glück, dass man ihnen eine Sozialwohnung zur Verfügung stellt. Stattdessen fragte er unverblümt: »Zahlen sie Miete?«
»Ich glaube schon.«
Brunetti holte hörbar tief Luft. Und der Priester bekräftigte hastig: »Ja doch, sie zahlen Miete.«
Was die Bürger auf Kosten der Stadt erwirtschafteten, brauchte Brunetti nicht zu kümmern. Aber es war immer nützlich zu wissen, wie sie es anstellten.
In die friedliche Atempause hinein sagte Antonin: »Aber das ist nicht das Problem. Es geht, wie gesagt, darum, dass er seine Wohnung verkaufen will.«
»Und warum?«
»Das ist ja genau der Punkt!«, rief der Priester. »Er möchte verkaufen, damit er jemandem das Geld geben kann.«
Brunetti dachte sofort an Wucherer, an Spielschulden. »Wem?«, fragte er.