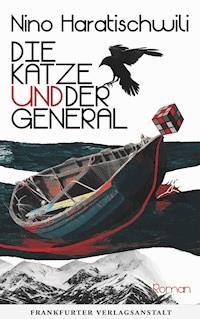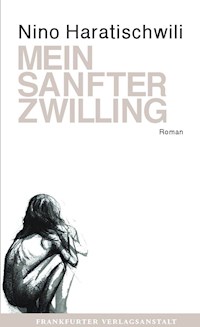27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit vom ins Taumeln geratenen Riesen stürzt der junge georgische Staat ins Chaos. Zwischen den feuchten Wänden und verwunschenen Holzbalkonen der Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen: die freiheitshungrige Dina, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, und die sensible Qeto. Die erste große Liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, die aufbrandende Gewalt in den Straßen, die Stromaus-älle, das ins Land gespülte Heroin und die Gespaltenheit einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt. Erst 2019 in Brüssel, anlässlich einer großen Retrospektive mit Fotografien ihrer toten Freundin, kommt es zu einer Wiederbegegnung. Die Bilder zeigen ihre Geschichte, die zugleich die Geschichte ihres Landes ist, eine intime Rückschau, die sie zwingt, den Vorhang über der Vergangenheit zu heben und eine Vergebung scheint möglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1109
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit vom ins Taumeln geratenen Riesen stürzt der junge georgische Staat ins Chaos. Zwischen den feuchten Wänden und verwunschenen Holzbalkonen der Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen: die freiheitshungrige Dina, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, und die sensible Keto. Die erste große Liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, die aufbrandende Gewalt in den Straßen, die Stromausfälle, das ins Land gespülte Heroin und die Gespaltenheit einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt. 2019 in Brüssel, anlässlich einer großen Retrospektive mit Fotografien ihrer toten Freundin, kommt es zu einer Wiederbegegnung. Die Bilder zeigen ihre Geschichte, die zugleich die Geschichte ihres Landes ist, eine intime Rückschau, die sie zwingt, den Vorhang über der Vergangenheit zu heben. Nach all den Jahren dringt plötzlich Licht in die Schattenwelt ihrer Erinnerungen und eine Vergebung scheint möglich.
Mit Das mangelnde Licht führt es Nino Haratischwili erneut an die blutige Naht zwischen sowjetischer und postsowjetischer Zeit, an die Abbruchkanten der europäischen Geschichte. Sie erzählt von einem verlorenen Land und einer verlorenen Generation, einer Revolution, die ihre Kinder frisst und einer bedingungslosen Frauenfreundschaft, die dem Tod trotzt. Ein großer Roman mit epischem Atem und von dramatischer Pracht, der aufbricht wie ein Granatapfel – und eine Hommage an Georgien, an die Stadt Tbilissi und ihre Menschen, eine Liebeserklärung durch die Zeiten hindurch.
Inhalt
Eins: Wir
Tbilissi, 1987
Brüssel, 2019
Der Hof
Dina
Ira
Nene
Zwei: Die Hundejahre
Leica
Das letzte Läuten
Die Liebenden von Tbilissi
Gogli-Mogli
Der Zoo
Die Stadt der Jungs
Die Warteschlangen
Das Meer der Erloschenen
Drei: Heroin
Разборки / Rasborki
»Die Herrschaften«
Surb Sarkis
Unser Fest
»Betäube mich«
Judaspfennig oder Jesustränen
Circulus vitiosus
Vier: თავისუფლება / Gott deiner selbst
Das Paradies
Der Tauchsieder
»Let the music play«
»Das mangelnde Licht«
Glossar
Für
Sandro (1977–2014)
und
Lela (1976–2015),
die Liebenden von Tbilissi,
und für
Tatuli, mit der ich die Freundschaft lernte
Eins:Wir
Wie habe ich mich an den Tod gewöhnt Es lässt mich staunen, dass ich noch lebe.
Wie habe ich mich an die Geister gewöhnt Dass ich gar ihre Spuren im Schnee erkenne.
Wie habe ich mich an die Trauer gewöhnt Dass ich meine Gedichte in Tränen ertränke.
Wie habe ich mich an die Finsternis gewöhnt Das Licht würde mich quälen.
Wie habe ich mich an den Tod gewöhnt Es lässt mich staunen, dass ich noch lebe.
Terenti Graneli
Tbilissi, 1987
Das Abendlicht verfing sich in ihren Haaren. Sie würde es schaffen, gleich würde sie auch dieses Hindernis überwinden, ihren Körper mit voller Wucht gegen das Gitter pressen, bis es ihrem Gewicht nur noch einen schwachen Widerstand leisten, leicht aufstöhnen und nachgeben würde. Ja, sie würde dieses Hindernis nicht nur für sich, sondern auch für uns drei durchbrechen, um ihren unzertrennlichen Gefährtinnen den Weg ins Abenteuer frei zu machen.
Für den Bruchteil eines Moments hielt ich den Atem an. Mit aufgerissenen Augen schauten wir auf unsere zwischen zwei Welten stehende Freundin: Dinas einer Fuß verharrte noch auf dem Gehsteig der Engelsstraße, der andere ragte bereits in den dunklen Innenhof des Botanischen Gartens; sie schwebte zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen, zwischen dem Kitzel des Unbekannten und der Monotonie des Vertrauten, zwischen dem Weg nach Hause und dem Wagnis. Sie, die Mutigste von uns vieren, öffnete uns eine geheime Welt, zu der sie allein uns Zugang verschaffen konnte, weil für sie Gitter und Zäune keine Bedeutung besaßen. Sie, deren Leben im letzten Jahr des bleiernen, kranken und nach Luft ringenden Jahrhunderts an einem Strick enden sollte, improvisiert aus dem Seil eines Turnrings.
In jener Nacht aber, viele ahnungslose Jahre vom Tod entfernt, war ich gebannt von einem allumfassenden Gefühl, das ich nicht genau einordnen konnte. Heute würde ich es vielleicht einen Rausch nennen, ein Geschenk, das einem das Leben so vollkommen unvorbereitet macht, dieser winzige Schlitz, der sich selten genug zwischen der ganzen hässlichen Alltäglichkeit, der ganzen Schwerstarbeit des Lebens öffnet und der einen erahnen lässt, dass hinter all dem Allzugewöhnlichen doch so viel mehr steckt, wenn man es bloß zulässt und sich von Zwängen und vorbestimmten Mustern löst, um den entscheidenden Schritt zu tun. Denn ohne es recht zu begreifen, ahnte ich bereits damals, dass sich mir dieser Moment für immer ins Gedächtnis einprägen und sich mit der Zeit in ein Sinnbild des Glücklichseins verwandeln sollte. Ich spürte, dass dieser Moment magisch war, und das nicht, weil etwas im eigentlichen Sinne Besonderes geschah, sondern weil wir in unserem Zusammenhalt eine unzerstörbare Kraft bildeten, eine Gemeinschaft, die vor keiner Herausforderung mehr zurückschrecken würde.
Ich hielt den Atem an und beobachtete, wie Dina durch das Gitter in den Hof hineinbrach, mit diesem frohlockenden, triumphalen Gesichtsausdruck. Und auch ich wähnte mich für einen Moment als Herrscherin über jedes Glück und jede Freude, als Königin der Wagemutigen, denn ich war für einen Augenblick sie, Dina, meine tollkühne Freundin. Und nicht nur ich, auch die beiden anderen wurden zu ihr, teilten dieses Gefühl von Freiheit, das lauter Versprechen zu bergen schien, wartete hinter diesen rostigen Streben doch eine ganze Welt nur darauf, von uns erkundet und erobert zu werden, eine Welt, die sich uns zu Füßen legen wollte.
Wir näherten uns der alten Umzäunung des Botanischen Gartens, bestaunten das von Dina vollbrachte Wunder, während sie selbstzufrieden zu uns herübersah, als wollte sie Applaus und Anerkennung dafür, dass sie unseren Zweifeln zum Trotz recht behalten hatte, dass uns nämlich dieses von Rost zerfressene Gitterstück an der Engelsstraße den idealen Durchschlupf bot, um das große und langersehnte Abenteuer zu beginnen.
– Na, wird es endlich?, rief sie uns von der anderen Seite zu, und eine von uns, ich weiß nicht mehr, welche, legte den Zeigefinger auf die zusammengepressten Lippen und stieß ein sorgenvolles »Psst!« hervor.
Das Licht einer einsamen Laterne auf der Straßenseite gegenüber fiel auf Dinas Gesicht, sie hatte Spuren von Rost auf beiden Wangen. Ich machte den ersten Schritt, überwand mit dem Schwung meines rechten Beins die Angst und die Aufregung, unmöglich zu sagen, was überwog. Ich drückte mich fest an Dina, die mir das Gitter, so gut es ging, auseinanderhielt, blieb mit dem Haar an einer der sich kräuselnden und sinnlos abstehenden Drahtschlingen hängen, befreite mich schnell wieder und taumelte dann auf den Innenhof. Dafür erntete ich ein wohlwollendes Kopfnicken und ein verschmitztes Dina-Lächeln. Durch die bestandene Mutprobe angestachelt, rief ich den beiden Nachzüglerinnen zu, sie sollten sich beeilen. Jetzt war ich Teil von Dinas Welt, Teil der Welt der Abenteuer und Geheimnisse, jetzt durfte auch ich so selbstzufrieden aus der Wäsche gucken.
Ich meinte, Nenes Herzklopfen bis zum Eingang des Tunnels zu hören, der wie ein weit aufgerissenes, gähnendes Maul vor uns lag, als wollte er sagen: Ja, ihr glaubt wohl, all eure Ängste überwunden zu haben und schon weit gekommen zu sein, aber das wahrhaft Schauerliche liegt noch vor euch, noch gibt es mich in meiner ganzen dunklen Betonpracht voller Ratten, nicht zu vergessen die gefährlichen Strömungen und albtraumhaften Geräusche.
Ich wandte meinen Blick von dem schwarzen Betonloch ab und konzentrierte mich darauf, Nene und Ira in den Innenhof zu locken. Obwohl der einsetzende Regen mir nicht gerade Mut machte, verjagte ich meine Sorgen angesichts der noch langen Strecke bis zu unserem eigentlichen Ziel.
Ein Auto fuhr vorbei. Nene duckte sich instinktiv. Dina begann zu lachen.
– Sie denkt bestimmt, ihr Onkel sucht bereits nach ihr, und wenn er sie nicht gleich findet, hetzt er ihr seine Hyänen auf den Hals.
– Mach ihr doch nicht noch mehr Angst!, beschwor sie Ira, die Vernünftigste und Pragmatischste von uns vieren, Mitglied des Schachklubs im Pionierpalast und Gewinnerin des vorletzten transkaukasischen Was-Wann-Wo-Quizturniers der Schuljugendmannschaften.
– Komm, Nene, wir beide machen das jetzt!, sagte sie in ihrem gleichmäßig sanften und nachdrücklichen Ton und nahm Nenes zittrige, stets feuchte Hand. Dann bugsierte sie als Erstes Nenes geschmeidigen und weichen Körper durch das Gitter, das Dina und ich auseinanderhielten, und als sich Nene erfolgreich hindurchgezwängt hatte, tat Ira es ihr nach.
– Geschafft! Und war das so schlimm, ihr Angsthasen?, rief Dina triumphierend und ließ das Gitter los, das mit einem armseligen Klappergeräusch zurückschnappte und zitternd in seiner Ausgangsposition zum Stillstand kam.
– Wir kriegen eine Menge Ärger, das sage ich euch, erwiderte Ira, aber ihrer Stimme fehlte der Nachdruck, denn auch sie war von der Euphorie erfasst und verdrängte alle Sorgen und Gedanken an die Probleme, die wir uns mit unserem nächtlichen Abenteuer unweigerlich einhandeln würden. Dann sah sie nachdenklich zum Himmel, als suchte sie dort eine Karte für unsere bevorstehende Wanderung, und dabei fiel ein dicker Regentropfen auf ihre Brille.
An jenem Nachmittag war ich zu spät vom Mathematiknachhilfeunterricht zurückgekommen, auf den mein Vater bestand und den ich gezwungenermaßen bei einem seiner Professorenfreunde nehmen musste (seine Freunde waren alle entweder Professoren oder Wissenschaftler), und Dina hatte bereits in unserer Küche auf mich gewartet. Unter dem Vorwand, gemeinsam Hausaufgaben zu machen, wollten wir unseren Fluchtplan noch einmal durchgehen. Ira und Nene würden später dazustoßen, Ira hatte Schachunterricht, und Nene musste irgendwelche »Sicherheitsvorkehrungen« treffen, um abends noch das Haus verlassen zu dürfen.
Jetzt kramte Dina eine überdimensionierte Taschenlampe aus ihrem zerrissenen Rucksack, die uns für einen Augenblick in Staunen versetzte.
– Kommt euch bekannt vor, was?, grinste sie. – Ja, das ist die von Beso, aber er merkt es bestimmt nicht einmal, wir bringen sie ihm gleich morgen zurück.
Beso war der Hausmeister unserer Schule, und ich wunderte mich, wie Dina es angestellt hatte, ihm die Taschenlampe zu klauen. Nene lachte laut auf, und als hätte das Lachen ihr Antrieb gegeben, rannte sie auf den dunklen Tunnel zu. Wir alle blickten ihr überrascht hinterher, denn sie war die Zögerlichste von uns allen. Der Grund für Nenes Vorsicht lag in ihrer Familiensituation, beherrscht von ihrem übermächtigen und omnipräsenten Tyrannen von Onkel, den man bei uns im Hof hinter vorgehaltener Hand nur »einen Mann aus der Parallelwelt« nannte. Nenes eigentlich leichtsinniges, nahezu naives und überschwänglich sonniges Gemüt stand in völligem Widerspruch zu der eisernen Hierarchie ihres Zuhauses, in dem die Männer regierten und die Frauen sich kampflos dem patriarchalen Gefüge zu ergeben hatten. Aber zum Glück war Nene eine Frohnatur, ihre Energie und Lebenskraft ließen sich durch keine Drohung und keine Strafe bändigen.
Ira putzte ihre Brille an der weißen Schürze ihrer Schuluniform ab, die nach der Kletterei durch das Gitter nicht mehr ganz so kränklich weiß war wie sonst. Iras Schürze wurde täglich von ihrer Mutter gewaschen, gestärkt, gebügelt und um die Tochter festgezurrt, als wäre sie ein Korsett, und während sich bei uns allen die Schleife hinten im Laufe des Schultags lockerte und der Stoff verrutschte, blieb sie bei Ira stets musterhaft am richtigen Platz, als gälte es, allzeit bereit zu sein für das Auftauchen eines Fotografen, der ein Vorzeigekind für die Titelseite der »Komsomolskaja Prawda« suchte.
Dann begann auch Ira zu rennen, um Nene einzuholen. Soweit ich mich erinnern kann, war Nene der einzige Mensch in Iras Leben, für den sie ihre Disziplin, ihren Pragmatismus und ihre Nüchternheit binnen von Sekunden über Bord werfen konnte. Dass Ira bei unserem spätabendlichen und noch dazu absolut vernunftlosen Ausflug in den Botanischen Garten überhaupt mitmachte, war auch Nenes spontaner Einwilligung zu verdanken. Niemals hätten wir gedacht, dass Nene die Angst vor ihrer Familie und ihre Zögerlichkeit so leicht überwinden und zustimmen würde, als wir ihr den Vorschlag unterbreiteten. Als sie in der großen Pause auf dem Schulhof im Lärm der vorbeirasenden Kinder erklärte, dass sie »selbstverständlich mit von der Partie« sei, sahen wir uns ungläubig an, worauf sie für die nächste Viertelstunde die beleidigte Prinzessin spielte – eine ihrer liebsten Rollen. Jeder Versuch von Ira, ihre Freundin von der »dummen Idee« abzubringen, scheiterte, und so blieb Ira nichts anderes übrig, als zähneknirschend ebenfalls einzuwilligen.
Aus einem für uns nicht nachvollziehbaren Grund hatte Nene von Anfang an eine Art Beschützerinstinkt in der etwas altklugen Ira wachgerufen. Immer hielt sie ihre starke, disziplinierte, schützende Hand über Nenes verführbaren, impulsiven und von wirren Emotionen gesteuerten Kopf, als wartete sie jede Minute darauf, dass Nene etwas Unvorsichtiges tut, um in diesem Augenblick für sie da zu sein – gewappnet für jeden Kampf. Und nun rannte sie ihr hinterher, um ihr beizustehen, sobald sie in die lähmende Dunkelheit des Tunnels eintauchen würde. Der Regen fiel jetzt stärker. Ich warf mir den Rucksack über die Schulter und rannte ebenfalls los. Dina folgte mir, und ich weiß nicht, was uns dazu brachte, dass wir beide gleichzeitig auflachen mussten. Vielleicht war es das Wissen, dass wir dem Glück auf die Schliche gekommen waren. Und dieses Glück schmeckte nach unreifen Zwetschgen und nach staubigem Sommerregen, nach Aufregung und Ungewissheit und vielen mit Puderzucker bestäubten Vorahnungen.
Brüssel, 2019
Zaghaft betrete ich den herrschaftlichen, mit wertvollem Fischgrätparkett ausgelegten menschenleeren Saal, im Rücken das Frühlingslicht des späten Nachmittags. In dem Moment gehen brummend die Scheinwerfer an. Das Licht stimmt, beschließe ich auf der Stelle, ich bin erleichtert. Ihre Bilder brauchen dieses bestimmte Licht, dieses geheimnisvolle, nahezu schüchterne Licht, das ihr Können hervorhebt, das entschiedene Schwarzweiß der Fotografien betont, die Klarheit und Stringenz, die nichts Grelles benötigen, auch aus dem Halbschatten zu dem Betrachter sprechen und aus der Düsterheit heraus leuchten können. Ich atme tief ein. Ich bin beeindruckt von den beiden ineinander übergehenden, hallengroßen Räumen, ja, es ist wahrlich eine Retrospektive. Eine Vielzahl ihrer Fotografien – darunter die berühmten und ikonischen, aber auch die weniger bekannten oder bislang unter Verschluss gehaltenen – sind hier versammelt, in dieser fremden, neugierigen Stadt voller Jugendstilhäuser und überfüllter Cafés und Bars, einer Stadt, die sich trotz ihrer Metropolenrolle weigert, diesen Part zu spielen, und sich stattdessen etwas Gemütliches, fast Kleinstädtisches bewahrt hat.
Ich habe vor Jahren viele leichtsinnige und unbeschwerte Stunden hier verbracht. Ich war sogar schon einmal in diesem Gebäude, in diesem angesehenen und angesagten Palast der schönen Künste, Norin hatte mich damals mitgenommen, ich erinnere mich, es war irgendein schräger asiatischer Film, den wir uns gemeinsam angesehen und dabei ständig gekichert hatten, um uns anschließend mit schäumendem belgischem Bier zu betrinken. Meine Erinnerungen an diese Stadt reichen heute noch, um mich von innen heraus zu wärmen, eine kleine Sonne, die ich bei Bedarf jederzeit zum Leuchten bringen kann. Norin und ich haben damals im Keller des Königlichen Museums gearbeitet und waren so stolz, unser Können an diesem vornehmen Ort unter Beweis stellen zu dürfen – man hatte uns Anfängern Ensors Maskenbilder anvertraut, und wir konnten unser Glück kaum fassen. Nach getaner Arbeit verloren wir uns im nächtlichen Treiben dieser umarmenden Stadt, erzählten uns Geschichten und kamen uns schließlich näher. Wie lange ist es her, frage ich mich und bewege mich andächtig durch die noch menschenleeren Räume voller mir so vertrauter Bilder, die an diesem Ort doch so fremd, so anders wirken, dass ich fast eine merkwürdige Eifersucht empfinde, als würde dieser Ort mir meine schmerzlich intime Beziehung zu diesen Fotografien streitig machen, denn in etwas mehr als einer Stunde werden sich die beiden Säle mit einer Schar exklusiver Gäste füllen, eine lange Besucherschlange wird sich bilden, die Auserwählten, die zur Eröffnung geladen sind, werden sich begrüßen und sich aufgeregt in den verschiedensten Sprachen unterhalten, werden georgischen Wein verkosten und Eröffnungsreden über sich ergehen lassen. Und ich werde die zwei Menschen wiedersehen, die mich – neben der toten Fotografin, derentwegen wir uns hier versammeln – am meisten geprägt, zerstört, meine Tage in Glück und Unglück getaucht haben. Zwei Frauen, inzwischen in der Mitte ihres Lebens, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und die mich doch stets wie Schatten verfolgen, egal, wohin ich gehe.
Ich streife weiter an den Bildern entlang, versuche, keinen wirklichen Blickkontakt mit den Fotos aufzunehmen, um die Gesichter aus meiner Vergangenheit nur flüchtig zu streifen, ihnen zu entwischen, noch hätte ich die Möglichkeit, dem allen zu entgehen, zu fliehen, ja, vielleicht sollte ich tatsächlich auf der Stelle kehrtmachen, vielleicht war es ein Fehler, hierhergekommen zu sein, ein Akt, der mir eindeutig zu viel abverlangt, etwas, das meine Kräfte übersteigt. Das wird doch jeder verstehen, ich kann es Anano erklären, die uns alle hier zusammengerufen hat, die keine Widerrede dulden wollte, mich dazu gebracht hat, in den Flieger nach Brüssel zu steigen, und mir einen VIP-Ausweis organisiert hat, mit dem ich diesen Saal eine Stunde vor der Eröffnung als special guest betreten habe. Die mich am Telefon beschwor: »Du musst kommen. Ihr müsst alle drei kommen, ich akzeptiere keine Ausrede.«
Vielleicht kann ich die Vernissage noch verlassen, das Ganze zurückspulen, denn ich weiß nicht, ob ich alles, was an diesem Abend auf mich zurollt wie eine Lawine, unbeschadet durchstehe. Ich habe so lange um meine Sicherheit gerungen, habe mir mit fast militärischer Disziplin das Gewesene ausgetrieben und gehe nun hier durch diesen Saal, in dem meine Schritte laut nachhallen, durchquere diese überdimensionierten, glanzvollen Räume und versuche mein Bestes, die Erinnerungen, die mich wie hungrige Affen von jeder Seite anspringen, abzuwehren.
Aber bin ich nicht an diesen Ort gekommen, um ihr Vermächtnis zu feiern? Was bedeutet: Ich muss mich ausliefern. Das weiß nicht nur ich, das wissen auch die beiden anderen, und deswegen kommen wir, trotz aller Ressentiments und aller Zweifel, und lassen außer Acht, was hinter uns liegt. Wir sind es ihr und uns schuldig, müssen unser Wiedersehen aushalten – und all die, die einmal bei uns waren. Die uns von den Wänden anstarren und ihren Tribut fordern. Kommen wir deswegen auch allein? Ohne es zu wissen, gehe ich davon aus, dass wir alle drei ohne Begleitung nach Brüssel gereist sind – ohne unsere Partner, ohne Kinder, ohne Freunde, die uns unser Wiedersehen erleichtern könnten.
Aber noch bin nur ich hier, noch habe ich die Möglichkeit zur Flucht. Na, und wenn schon, sollen sich alle über meine Feigheit das Maul zerreißen, was spielt das für eine Rolle, wenn es meine einzige Rettung ist? Aber dann bleibt mein Blick an diesem kleinformatigen Bild in einem schlichten Rahmen unter einer faszinierend dünnen Leuchtröhre haften. Warum hängt diese Fotografie so einsam an einer großen Wand, als wäre sie verwaist? Die anderen Bilder sind, soweit ich es sehen kann, alle in Serien gehängt, aber dies hier bildet eine Ausnahme, und je näher ich an es herantrete, umso deutlicher wird mir seine zentrale Funktion: Es ist die einzige Fotografie, die die Künstlerin zeigt, aber nicht von ihr selbst stammt. Die anderen Fotografien, auf denen man sie abgebildet sieht, sind ausnahmslos Selbstporträts, künstlerisch anspruchsvolle, herausfordernde, bis zur Unerträglichkeit entblößende Aufnahmen, die in einer Art Selbstausbeutung ihr Innerstes nach außen kehren, von denen, da bin ich mir sicher, es hier einige geben wird. Aber bei diesem vergleichsweise kleinen Foto handelt es sich um kein Kunstwerk, es ist nicht einmal unter amateurhaften Aspekten besonders gelungen, aber es hat etwas, das mir einen Schauder über den Rücken jagt und mich einen Augenblick lang dazu bringt, den Atem anzuhalten.
Die Fotografie zeigt uns alle vier, sie zeigt die Version von uns, der wir entstammen, so etwas wie den Ursprung, das Ei, aus dem wir gemeinsam geschlüpft sind. Wir stehen an der Schwelle des Lebens, am Anfang unserer Freundschaft, die uns alles abverlangen wird, aber wir wissen noch nichts davon, wir kennen das Blatt nicht, das uns das Leben zugeteilt hat, noch hat die Partie nicht begonnen, noch dürfen wir frei sein, noch dürfen wir alles wollen und alles wünschen.
Die Fotografie, die als eine Art Prolog zu dieser Ausstellung fungieren soll, trägt keinen ihrer sonst so einprägsamen Titel, sie ist nur, sehr schlicht, mit dem Ort der Aufnahme und der Jahreszahl versehen: »Tbilissi, 1987«. Ich bleibe wie gebannt stehen, ich kann mich nicht bewegen, und Bilder fangen an, meinen Kopf zu fluten, ich habe keine andere Wahl, ich werde mich fortreißen lassen, es hat keinen Sinn, gegen etwas anzukämpfen, das einer Naturgewalt gleichkommt. Ich bin machtlos, ich bin plötzlich wieder Kind, ich bin wieder die, die mich von diesem Foto anblickt.
Je länger ich mir diesen kleinen schwarzweißen Abzug ansehe, ganz allein für sich in diesem majestätischen Saal, desto sicherer bin ich mir, dass es sich um genau diesen Tag handelt, den Tag unseres Einbruchs in den Botanischen Garten, um diesen besonderen Moment, in dem ich das Glück zum ersten Mal in meinem Leben auf meinen Handinnenflächen und in meinen Kniekehlen, in meinem Bauchnabel und auf meinen Wimpern gespürt habe. Ich wundere mich nur, warum ausgerechnet dieses Foto als symbolischer Auftakt ausgesucht wurde. Anano ist als Schwester der Künstlerin ihre Nachlassverwalterin und zugleich auch die Beraterin dieser Ausstellung, so hat sie es mir vor einem Monat stolz am Telefon erzählt. Sie muss diese Entscheidung getroffen haben. Hat sie von der Besonderheit dieses Tags gewusst? Hat ihre Schwester ihr davon erzählt?
Genauso merkwürdig erscheint mir die Tatsache, dass dieses Foto, wie ich mich jetzt erinnere, in unserer Wohnung aufgenommen worden ist, und zwar von meinem Vater, der eigentlich nie Fotos von uns gemacht hat, der mich und meinen Bruder höchstens mal zu obligatorischen Fotoatelierbesuchen mitnahm. Aber aus irgendeinem Grund hat er uns an diesem Tag alle zusammen in unserer Küche angetroffen und zur Kamera gegriffen. Keineswegs zu der verhassten Leica meiner Mutter, die lag zu dieser Zeit noch in ihrem dunklen Versteck in seinem Zimmer, es könnte vielleicht die alte Lubitel oder die Smena* meiner Großmütter gewesen sein, in der zufällig ein Film eingelegt war.
Das Bild zeigt uns vier Mädchen an jenem Nachmittag, wie wir nach der Schule unser Abenteuer planen und über den Tisch gebeugt in ein Gespräch vertieft sind, hoch konzentriert, manche von uns ein wenig ängstlich, Dina dagegen euphorisch, bereit zum großen Aufbruch, für die große Mutprobe. Mein Vater muss unseren Anblick so amüsant gefunden haben, dass er es für nötig befand, seine innig geliebte Arbeit zu unterbrechen und die Kamera zu holen.
Ira war zu vernünftig, sich so etwas auszudenken, Nene zu vorsichtig, auch wenn sie nichts anderes tat, als die Schulstunden hindurch zu träumen – von der Freiheit und all dem, was sie damit anstellen könnte, und vor allem von der Liebe, einer übertrieben romantischen, überzuckerten, von Filmen infizierten, atemlosen Liebe. Ich war nichts von alldem, und doch hin- und hergerissen zwischen Dinas Freiheitsdrang, Iras Vernunft und Nenes Träumereien, und so war mir in dieser Konstellation schon zu Beginn die Rolle der Schlichterin, der Ausgleichenden zugewiesen worden, als wäre es immerfort an mir, unsere Freundschaft in der Waage zu halten.
Es war Dina, die den Plan ausgeheckt hatte, die Feuerschluckerin, wie ich sie manchmal nannte, die mit den meisten Schulverweisen, die jede Strafe, die ihr die Erwachsenen für ihre Grenzüberschreitungen auferlegten, mit einem Augenzwinkern hinnahm. Was interessierten sie die Ermahnungen, die Elternabende, bei denen ihre Mutter den verächtlichen Blicken anderer Eltern ausgesetzt war und tiefe Seufzer und das Kopfschütteln der Klassenlehrerin zu erdulden hatte? Diese Strafen entstammten einer Welt, die die Menschen fein säuberlich in gehorsam und rebellisch, in schlau und dumm, in gut und schlecht, in konform und abweichlerisch unterteilte. In Dinas Welt gab es solche Kategorien nicht. In ihrer Welt gab es nur spannend und langweilig, interessant und uninteressant, aufregend und gewöhnlich. Und wenn man sie hätte wirklich strafen wollen, hätte man ihren Maßstäben folgen und sich etwas zu ihren Kategorien Passendes einfallen lassen müssen, aber zum Glück schien ihre Welt den Erwachsenen nicht zugänglich zu sein, und so konnte ihr nichts und niemand etwas anhaben. Und dass Dina die Schule mit einem einigermaßen akzeptablen Abschluss verlassen hatte, war meiner Vermutung nach einzig und allein dem Mitleid der Direktorin mit Dinas alleinerziehender Mutter zu verdanken. Nichts war vor Dinas Neugier sicher, die Neugier war ihr Motor, ihr Kompass, dem sie unbeirrbar folgte. Alles, was ihre Fantasie entzündete, alles, was fremd und anziehend wirkte, musste erkundet und erschlossen werden, jede Grenze war dazu da, überschritten zu werden, jede Absperrung, um sie zu durchbrechen. Und die Kraft, die sie dabei entwickelte, war wie ein Orkan, es war unmöglich, ihr zu widerstehen, sie riss uns mit sich, wie der Wirbelsturm im fernen Kansas Dorothy und Toto ins Land der Munchkins katapultiert hatte – komischerweise eines der wenigen amerikanischen Kinderbücher, die bei uns nicht als »kapitalistischer Schund« eingestuft waren und uns somit zugänglich blieben.
Aber am wenigsten gefeit vor ihrem Orkan war ich. Ich war die Treueste ihres Gefolges, ihr loyalster Gefährte. In all ihre Zauberländer, bis nach Oz selbst, wäre ich ihr gefolgt, und noch viel weiter. Seit dem Tag, an dem wir uns kennenlernten, übte sie eine unwiderstehliche Anziehung auf mich aus, sie steckte mich mit ihrer Neugier an, ich erkrankte an ihr. Nicht dass es mir selbst an Antriebskraft oder Erkundungsdrang gemangelt hätte, nicht dass ich sonderlich brav und gehorsam gewesen wäre, und auch meine Fantasie war durchaus rege. Aber Dinas Erkundungstouren führten viel weiter, als ich selbst zu gehen bereit gewesen wäre.
Und natürlich war es auch Dinas Idee gewesen, in den Botanischen Garten einzusteigen.
Wir vier rasten lachend durch den Tunnel, das Licht von Dinas Taschenlampe flackerte epileptisch im Gang, und unsere Schatten tanzten einen verzerrten Tanz an den feuchten Betonwänden. Der Tunnel galt bei den Tbilisser Kindern als die ultimative Kulisse aller Schauergeschichten, er war angeblich im Zweiten Weltkrieg als Schutzbunker erbaut worden, als es hieß, die Faschisten hätten den Elbrus erreicht. Der Tunnel schien endlos, aber unsere nackten Beine hatten die Angst überwunden, und die Echos unserer Stimmen antworteten uns, bestärkten uns in unserem Vorhaben, es galt, nicht stehen zu bleiben, damit die Dunkelheit und die furchteinflößenden Geräusche unsere Angst bloß nicht wieder wachriefen. Nene war am meisten erregt, erstaunt über ihre eigene Kühnheit, ihr schrilles, explosives, ansteckendes Lachen breitete sich aus und schien diese endlose Leere um uns zum Leben zu erwecken. Das Lachen trug uns davon, immer schneller, immer gelöster und freier, bis wir keuchend, verschwitzt und stolz das andere Ende erreichten und dem Sommerregen in die Arme fielen.
Die Tropfen waren riesig, in Sekundenschnelle waren unsere Uniformkleider, Schürzen und Haare durchnässt, aber es war warm, und es machte uns nichts aus, der unerwartet heiße Juni und unser Mut schützten uns. Nene ließ sich auf den Boden fallen und rang nach Atem. Ira beugte sich nach vorn, stützte ihre Hände auf die Knie, ich lehnte mich an den kalten Tunnelausgang und holte Luft. Aber Dina blieb nicht stehen, als könnte ihr der Atem niemals ausgehen, als wären ihre Lungen für unerreichbare Geschwindigkeiten und endlose Strecken gemacht. Sie breitete die Arme aus und stürzte sich in das Meer aus Regen, dichtem Grün der Pflanzen, warmer Luft und den Gesang des Wasserfalls, den wir alle bereits hören konnten.
– Kommt schon, wir sind gleich da, kommt schon!, rief sie uns zu und ließ den Schein der Taschenlampe über unsere Gesichter wandern.
– Warte, ich muss kurz … ich muss nur kurz …, keuchte Nene, und Ira schüttelte den Kopf, als ärgerte sie sich wieder einmal über die Unvernunft ihrer Freundin, die alle Gefahren ignorierend hierhingekommen war.
Das Ziel war der kleine Wasserfall in der Mitte des Gartens. Das Wasserbecken war für einen Sprung vom Felsen gerade tief genug, und tagsüber im Sommer sah man dort Jungs aus der Nachbarschaft gekonnt Saltos ausführen. Wir hatten bisher immer nur neidvoll zugeschaut, denn bei unseren Besuchen im Botanischen Garten waren entweder Lehrer mit dabei, weil es eine Exkursion war, oder eine Mitarbeiterin von der Kasse, die stets achtgab, dass niemand etwas wagte, was sie ihre Arbeitsstelle kosten könnte.
Nachdem wir wieder zu Atem gekommen waren, machten wir uns, nunmehr eher bedächtig, auf in Richtung des Wasserfalls, schlugen uns durch das magere Mondlicht und den dichtbewachsenen Garten. Der Regen lief über unsere Gesichter, unsere Haare, unsere Kleider und unsere Taschen, und bei jedem Schritt meinte man, kleine Pfützen auf dem Boden zu hinterlassen. Vor uns sahen wir Dinas Taschenlampe immer wieder aufleuchten, ab und zu hörten wir ihre begeisterten Ausrufe, so als müsste sie uns immer noch verführen, überzeugen, die letzten Schritte zum gemeinsamen Ziel auch wirklich zu tun und nicht doch noch vorher kehrtzumachen.
Ira nahm Nene an die Hand, die auf einmal erschöpft wirkte und schreckhaft, als hätte sie schlagartig ihr ganzer Mut verlassen, kaum dass sie den dunklen Tunnel hinter sich gebracht hatte. Wie zwei ältere Damen liefen sie nebeneinander her. Etwas an der Art, wie Ira Nene hinter sich herzog, rührte mich zutiefst – wie sie auf sie aufpasste, auf ihre weichen Füße achtete, dass sie bloß ja nicht stolperten, auf ihre sanften Hände, dass sie sich bloß an keinem abstehenden Ast einen Kratzer holten, auf ihre kleine, rosige, wohlgeformte Statur, ihre babyzarte Haut, ihre sich bereits unter dem Uniformkleid abzeichnenden Brüste; Ira und ich waren die Letzten mit flachen Formen, während Dina und Nene bereits begonnen hatten, sich zu verändern: Dina achtlos und mit einer erstaunlichen Gleichgültigkeit, Nene dagegen mit sichtlichem Stolz und großer Vorfreude auf ihre Frauwerdung, mit ihrem prächtigen weizenblonden Zopf, ihren wässrigen hellblauen Augen, die noch wässriger wurden bei jeder vorhersehbaren Sentimentalität. Ich blieb einen Augenblick stehen, ließ ihnen den Vortritt, um sie besser bestaunen zu können in der Unantastbarkeit ihrer Zweisamkeit.
Wir erreichten die Lichtung, das Gebüsch öffnete sich auf eine von bunten Blumen übersäte Wiese, und linker Hand erblickten wir schon das kleine Bassin, das der Wasserfall über die Jahre unter sich gebildet hatte, und hörten das haltlose Rauschen, sahen den Wasserstrahl aus der Höhe hinunterstürzen und blieben wie angewurzelt stehen.
Ich sah mich nach Dina um, ihre Taschenlampe und ihr Rucksack lagen verwaist am Ufer, während von ihr jede Spur fehlte. Ich rief nach ihr, aber das Rauschen des Wasserfalls übertönte meine Stimme. Ira schloss sich mir an. Wir riefen und riefen, bis wir auf einmal von ganz oben Dinas Kreischen vernahmen und hochblickten. Sie hatte es geschafft und war trotz Regen und Dunkelheit auf den Felsen geklettert. Sie stand über dem Wasserfall, als hätte sie ihn bezwungen, als wäre sie nun die anerkannte Herrscherin über diesen Ort.
– Wie ist sie da bloß hochgekommen?, entfuhr es Nene, und Ira schüttelte vielsagend den Kopf. Ich sah zu Dina hinauf und war ganz ruhig, denn ich wusste, wenn sie es geschafft hatte, würde auch ich es schaffen, sie hatte uns ans Ziel geführt, und solange ich sie in meiner Nähe hatte, brauchte ich keine Angst zu haben.
– Los, kommt hoch!, brüllte sie durch die Nacht, und ich begann, mir die klebenden Kleider vom Leib zu reißen, die klatschnassen Socken und Schuhe. In der weißen Baumwollunterhose mit der Aufschrift »Freitag«, die mir mein Vater als »Wochenpack« von einer seiner Kongressreisen aus Warschau, Prag oder Sofia mitgebracht hatte, hob ich die sinnlos vor sich hin scheinende Taschenlampe auf und drückte sie Ira in die Hand, bat sie, mir den Weg zu leuchten, und machte mich daran, den Felsen zu erklimmen, in dieser albernen Unterhose, die ich nie passend zum Wochentag trug.
Meine Füße taten weh, kleine Steine schnitten mir in die Fersen, aber ich hatte nur Dinas ausgebreitete Arme vor Augen, wie sie da oben stand und auf mich wartete. Ich bahnte mir den Weg, hielt mich an Ästen und Felsvorsprüngen fest, stemmte mich hoch. Ein paarmal rutschte ich ab, mein Herz überschlug sich, ich raffte mich aber schnell wieder auf und versuchte es weiter. Der Lichtstrahl der Taschenlampe leuchtete nur sporadisch auf die Stellen, auf die ich trat, und ich spürte Iras und Nenes sorgenvolle Blicke auf mich gerichtet, strengte mich an, ihnen das Bild eines mühelosen Aufstiegs zu vermitteln. Dann sah ich Dinas Hand und ergriff sie voller Freude. Sie zog mich hoch, und schon stand ich neben ihr. Sie hatte sich inzwischen Uniform und Schuhe ausgezogen und warf sie nun lachend hinunter.
– Bist du bereit?, fragte sie mich und umklammerte meine Hand noch etwas fester. Ich richtete mich auf, stellte mich Schulter an Schulter neben sie – die kleinen abstehenden Brüste mit nahezu farblosen Brustwarzen wirkten wie Fremdkörper an ihrem mir sonst so vertrauten Körper. Ich nickte und trat einen Schritt weiter nach vorn. Ich sah nicht hinunter. Ich sah hinauf. Der Himmel war schwarz, aber ich erkannte den großen Wagen, über den mir mein Vater so gern Geschichten erzählte. Er schien unserem Vorhaben wohlwollend zuzustimmen. Ich zog an Dinas Hand, wir tasteten uns mit den Zehenspitzen weiter auf dem unebenen Boden voran, beugten uns nach vorn, sahen uns noch einmal an, umschlossen die Hände noch fester und sprangen in die Höhe, um gleich darauf hinunterzustürzen.
Ich schrecke auf, jemand tippt mir auf die Schulter. Ich habe nicht einmal Schritte gehört. Ich werde wie aus einem tiefen Schlaf gerissen. Ich sehe das Foto vor mir, ich brauche einen Augenblick, um meine Gedanken und Erinnerungen zu sortieren: der Nachmittag vor unserem Sprung in den Wasserfall. Vor meinem Sprung in die Freiheit. Das Präludium dazu.
– Ich kann es nicht glauben … Du bist gekommen!
Anano fällt mir um den Hals, und ich weiß gar nicht, in welcher Zeit ich gefangen bin, ich hänge zwischen den Zeiten oder bin in allen gleichzeitig. Sie sieht wunderbar aus. So glücklich, so strahlend, in einem schlichten, sommerlich dunkelblauen Kleid, das von ihrer Mutter sein könnte – diese einfachen Wickelkleider, die sie und ihre ältere Tochter so oft getragen und in denen sie wie Kaiserinnen ausgesehen haben. Sie trägt zwei goldene Kreolen und ein wenig Lippenstift, schlichte Ballerinas, die Augen werden von weichen, lebhaften Falten umspielt, dem wilden braunen Haar scheint etwas Grau beigemischt, aber sie sieht immer noch so lieblich aus, so reizend wie ein ewiges Mädchen, vielleicht ist es auch mein Blick auf sie, vielleicht bleibt sie in dieser Geschichte für immer und ewig die jüngere Schwester, und ich bin für den Moment verzaubert, frage mich, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich weiß, dass sie mit einem vermögenden Mann verheiratet ist, der im boomenden Baugeschäft Georgiens zu Geld gekommen ist, und zwei Kinder hat, dass sie in einem Haus irgendwo am Stadtrand von Tbilissi wohnt, einen Garten pflegt – zumindest erwähnte das ihre Mutter am Telefon, und ich kann sie mir in solch einem Umfeld wunderbar vorstellen: sie als eine glückliche Frau und Mutter, als eine leichtlebige, fröhliche Gefährtin, in einem Meer aus Blumen. Sie hat eine Galerie in der Stadt, fördert junge Künstler und kümmert sich, nachdem ihre Mutter nun nicht mehr die Kraft dazu hat, um die Hinterlassenschaft ihrer Schwester. Sie, die Hellste und Zuversichtlichste aus ihrer Familie, die Unbeschadetste von allen, die das Leben entschädigt hat, für alles, was es ihren Familienmitgliedern genommen hat an Liebe und Zuwendung, an Chancen, an Zuversicht und an Gerechtigkeit – sie hat all das bekommen: eine Perspektive, Normalität und Frieden.
Ich muss mich noch an den Gedanken gewöhnen, dass ausgerechnet sie den Nachlass verwaltet, dieses gnadenlose Schwarzweiß der Werke ihrer Schwester, die Radikalität ihrer Sicht und ihrer Person bilden solch einen Kontrast zum weichen Wesen Ananos. Aber einfühlsam und intuitiv, wie sie ist, verlässt sie sich auf Kuratoren, auf Experten und hält sich dezent im Hintergrund, das weiß ich ebenfalls von ihrer Mutter, und ich freue mich in diesem Augenblick aufrichtig für sie, für ihren großen Moment, der in Kürze eingeläutet und an dem sie stellvertretend für ihre Schwester gefeiert werden wird. Ich würde sie noch lange in meinen Armen halten, aber ich lasse los, ich merke, dass sie sich nicht minder freut, mich zu sehen, sie kämpft gegen die Rührung an, die in ihr aufsteigt, die Sentimentalität, die sie so sehr von ihrer Schwester unterscheidet. Ich behalte ihre Hand in meiner.
– Oh Gott, ich glaube es nicht! Ist das zu fassen, dass wir uns alle ausgerechnet in Brüssel wiedersehen? Ist das nicht verrückt? Deda hat mir gesagt, dass ich dir unbedingt einen Kuss geben soll. Du hast es bestimmt mitbekommen, ausgerechnet jetzt vor der Ausstellung hat Mutter es geschafft, sich das Bein zu brechen, und kann nicht kommen. Und, Keto, ich meine, diese Ausstellung, das ist der Wahnsinn, über zwei Jahre haben wir sie vorbereitet, und ich bin so froh und erleichtert, dass sie jetzt endlich eröffnet wird. Ich habe auch Ira und Nene angeboten, dass sie zeitig kommen, damit wir uns vielleicht vor dem offiziellen Startschuss unterhalten können, aber ich weiß nicht, wann genau sie eintreffen werden. Und übrigens soll anschließend groß gefeiert werden, nicht dass eine von euch auf die Idee kommt, einfach abzuhauen, im Garten gibt es später richtig gute Drinks und Musik. Ich meine, wir können nicht eine Retrospektive für sie machen und anschließend nicht feiern, als ob es kein Morgen gäbe …
– Ja, da hast du wohl recht, sage ich und gebe mir Mühe, der Versuchung zu widerstehen, meinen Blick erneut auf das Viererfoto zu richten. Anano bemerkt es und sie lacht.
– Ist das nicht goldig? Ich habe lange überlegt, welches Foto von euch ich nehmen soll, und dann … Ich meine, das hier trifft euch vier so wunderbar, finde ich.
– Das hat mein Vater gemacht. Es war ein sehr besonderer Tag, weißt du … Woher hast du dieses Foto?
– Na, von dir, du musst es meiner Schwester irgendwann gegeben haben.
Aber bevor ich etwas sagen kann, ruft sie ekstatisch aus, sie müsse mich unbedingt den Kuratoren vorstellen, und zieht mich an der Hand durch die große Halle, die sich nach und nach mit einzelnen Menschen zu füllen beginnt.
Wir nähern uns einer hochgewachsenen Georgierin in einem schwarzen Overall und einem unscheinbaren Mann mit Halbglatze und Hornbrille, sie begrüßen mich mit übertriebener Freundlichkeit.
– Keto Kipiani höchstpersönlich!, ruft der untersetzte Mann auf Englisch und streckt mir die Hand hin. Die Georgierin begrüßt mich auf Georgisch und haucht mir Küsschen auf beide Wangen.
– Jetzt sehen wir Sie also leibhaftig, dabei hat man durch die zahlreichen Fotos von Ihnen und Ihren Freundinnen das Gefühl, dass man Sie bereits kennt, fügt die Georgierin diesmal auf Englisch hinzu.
– Genau!, bestärkt sie der Mann.
– Das sind Thea und Mark, die Helden dieser Retrospektive, erklärt mir Anano mit breitem Grinsen. – Mark ist ein weltweit anerkannter Fotografieexperte und leitet das Fotomuseum in Rotterdam, und Thea ist eine renommierte Kunstwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Osteuropa. Sie hat ein großartiges Fotofestival in Tbilissi ins Leben gerufen, du musst es dir unbedingt ansehen.
Anano ist in ihrer Rolle als Gastgeberin sichtlich darum bemüht, dass wir uns alle mindestens genauso wohlfühlen wie sie selbst. Ich lächele verlegen und nicke höflich. Der Satz der Georgierin hat mich aufhorchen lassen: … dabei hat man durch die zahlreichen Fotos von Ihnen und Ihren Freundinnen das Gefühl, dass man Sie bereits kennt …
Natürlich: Wir vier sind hier zur Genüge exponiert. Ich muss mich darauf einstellen, den unzähligen Schattierungen meiner selbst zu begegnen, den Stadien meines Werdens. Ich muss mich darauf einstellen, von der Vergangenheit umarmt zu werden. Ich muss mich darauf einstellen, in die stummen Augen der Toten zu blicken.
Wieder verspüre ich den Drang zu fliehen, wieder blicke ich etwas nervös zum Ausgang, noch ist Zeit, noch kann ich zum Hotel eilen, meinen kleinen Koffer nehmen und mit dem nächsten Zug zum Flughafen fahren, in den Flieger steigen, zurück nach Hause, in meine kleine, abgeschiedene Oase, mich in den blühenden, aus allen Nähten platzenden Garten setzen, einen Wein entkorken und all dem entkommen, den sich anbahnenden Orkan umgehen, verschont bleiben.
Aber plötzlich höre ich ihre Schritte hinter mir, und bevor ich sie sehe, weiß ich bereits, dass Ira gekommen ist. Sie ist eine andere Frau, ein anderer Mensch geworden, von uns allen hat sie vielleicht die bemerkenswerteste Wandlung durchlebt, aber ihre Schritte sind immer noch die gleichen, diese lauten, rhythmischen, schweren Schritte, mit denen sie sich ankündigt und zugleich den Takt vorgibt.
Sie erscheint mir noch größer als in meiner Erinnerung, eine solche Körpergröße war bei ihrer Kinderstatur noch nicht zu erahnen, ihre Eltern waren beide eher klein, und mich erstaunt diese Präsenz jedes Mal aufs Neue, wenn ich sie nach langer Zeit wiedersehe. Sie trägt einen perfekt sitzenden Nadelstreifenanzug, der ihre Androgynität betont, wobei sie die Jacke wegen des warmen Wetters ausgezogen hat und über dem Arm trägt, das eng anliegende weiße T-Shirt unterstreicht ihren trainierten Oberkörper und den imposanten Bizeps. Sie, die Sport früher als idiotische Zeitverschwendung abgetan hat, ist mit den Jahren in den USA zu einem regelrechten Fitnessjunkie geworden und investiert anscheinend immer noch viel Zeit, um ihrem geistigen Niveau auch körperlich in nichts nachzustehen. Ich mag ihre Frisur, die sie vor einigen Jahren für sich entdeckt hat und die mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden ist, neben ihren auffallenden, farblich variierenden Designeranzügen, die sie wie eine Uniform trägt. Der kurze Bob ist auf der linken Seite eindeutig länger als auf der rechten, und der Nacken ist ausrasiert. Sie trägt, wie zu erwarten, keinerlei Schmuck, hat nur etwas Lipgloss aufgelegt. Sie zieht einen kleinen Alukoffer elegant über den Parkettboden hinter sich her, kommt mit zielsicheren Schritten auf uns zu und breitet die Arme aus. Wobei sie zuerst Anano an sich drückt, dann die beiden Kuratoren begrüßt und sich vorstellt, anschließend schlingt sie ihre Arme um mich. Die anderen drei entfernen sich diskret und überlassen uns einander. Wir stehen eine Weile und halten uns fest in den Armen. Ich rieche ihr maskulines Parfum, das wunderbar zu ihr passt, und fühle mich zum ersten Mal, seit ich einen Fuß in dieses Gebäude gesetzt habe, wohl und sicher, mein Gesicht an Iras Hals gelegt. Wenn sie nervös ist, wovon ich ausgehe, dann sieht man es ihr nicht an, und wie so oft bewundere ich ihre Selbstsicherheit, eine mühevoll erarbeitete Erfolgserscheinung ihres siegreichen Anwaltslebens. Ganz anders als mir merkt man ihr kein Unbehagen an, in die lange ausgetriebene Vergangenheit zurückzukehren.
– Ich bin so froh …, murmelt sie, und ihre Stimme klingt auf einmal etwas gebrochen, als ob die Selbstsicherheit ins Wanken geriete, was mir ein Gefühl der Zufriedenheit gibt, so bin ich nicht ganz allein mit meiner Nervosität und dem Grauen vor diesen Fotografien konfrontiert, davor, exponiert und entlarvt zu werden, vor Hunderten von Menschen, die ihre sensationslüsternen Augen auf mich richten.
– Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Allein werde ich das nicht durchstehen, sage ich und wundere mich über meine Wortwahl.
– Wir schaffen das schon. Es ist ein wichtiger Tag für uns alle.
– Nene kommt auch?
Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie, nach all dem, was war, in wenigen Minuten diesen Saal betreten und sich gemeinsam mit uns auf dieses Experiment einlassen wird. Sie, die vielleicht den höchsten Preis von uns allen gezahlt hat, im Stich gelassen und immer und immer wieder verraten wurde, sie, die über so viele Jahre jeden Kontakt zu Ira gemieden hat. Und jetzt soll sie all das hinter sich gelassen haben und einfach so in den Flieger gestiegen sein? Ich zweifle bis zur letzten Minute.
– Sie wird kommen. Ich bin mir sicher, sagt Ira gewohnt zuversichtlich und tritt ein wenig zurück. – Lass dich ansehen. Gut siehst du aus.
– Ach, hör auf, ich habe kaum geschlafen die letzte Nacht, ich habe nichts essen können und fühle mich jetzt schon völlig fertig, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Abend …
– Komm schon, stell dich nicht so an!
Diese lapidare Ermahnung regt mich sofort auf. Auch das ist typisch für sie: gewohnt, Befehle zu erteilen, gewohnt, zu manipulieren, gewohnt, zum erwünschten Urteil zu gelangen.
– Ich stelle mich nicht an, mir geht es nicht gut mit alldem.
– Es tut mir leid, sagt sie und schaut mich dabei direkt an. – Ich weiß, dass es für dich besonders schwer ist. Auch ich bin nervös. Ich meine … das ist wirklich die größte Ausstellung bisher, und alle werden kommen. Aber du weißt, dass das Fernbleiben unentschuldbar gewesen wäre. Das hättest du dir niemals verziehen. Und ich dir übrigens auch nicht.
Sie zwinkert mir zu.
– Wusstest du, dass wir hier auch zu den Kunstwerken gehören?, will ich wissen.
– Natürlich, ich meine, was hast du dir denn gedacht, dass die aus irgendeiner idiotischen Pietät die Fotos rauslassen, auf denen wir abgelichtet sind?
Iras und Nenes Umgang mit unseren Porträts ist schon immer ein anderer gewesen als meiner. Die leicht exhibitionistisch veranlagte Nene und die mit einem beeindruckenden Ego ausgestattete Ira genießen es mit sichtlichem Stolz, ein Teil ihrer Kunst geworden und auf diesen schwarzweißen Aufnahmen verewigt worden zu sein. Anders als ich hatten sie auch die vielen anderen Ausstellungen in Georgien oder im Ausland besucht, sorgsam darauf achtend, sich nicht zu begegnen, und Nene hat hier und da sogar eine Rede gehalten und Interviews über ihre spektakuläre Freundin gegeben.
Ich aber wollte nichts erklären müssen, schon gar nicht der Außenwelt. Meine Erinnerungen, die mich an Dinas Fotografien ketten, sind gewiss ganz anders als die Hintergründe, die die Kunstwelt hineininterpretiert – nie im Leben käme ich auf die Idee, sie mit Fremden zu teilen. Nun bin ich Teil ihrer Kunst, genauso wie Ira und Nene es sind. Meine Abwehr hat durchaus egoistische, selbstschützende Motive, andererseits käme es einem Verbrechen gleich, ihrer Kunst durch meine Äußerungen in irgendeiner Weise zu schaden. Ich, die ich selbst in meinem Leben im Dienst fremder Bilder stehe, sollte dies nur zu gut wissen.
Ira ist in ein angeregtes Gespräch mit Anano vertieft. Mein Blick schweift umher, und ich werde auf eine andere Aufnahme aufmerksam, schlafwandlerisch, wie von einem Sirenengesang angelockt, bewege ich mich auf dieses Foto zu, das ich nicht kenne, das ich zum ersten Mal sehe, ich will wissen, aus welcher Schaffensperiode es stammt, denn eigentlich kenne ich sie alle, weiß bei fast jedem Foto das Wann und Wo, welche Stimmung herrschte, um welches Ereignis es sich handelt, welche Kränkung und welche Freude sich dahinter verbergen. Doch diese Aufnahme sagt mir nichts, ich erkenne aber alles darauf wieder, alles ist so vertraut, es ist, als würde ich in einen Brennnesselbusch fallen und meine Haut steht in Flammen.
Es ist eine Aufnahme unseres Hofs, unsere Wohnungen sind aus der Vogelperspektive zu erkennen, durch die Distanz und Höhe erscheinen sie so winzig mit der flatternden Wäsche, dem kleinen Garten mit dem ewig tropfenden Wasserhahn, der Wippe, dem Granatapfel- und dem Maulbeerbaum. Sie muss aufs Dach geklettert sein, um das Foto zu schießen. Wieder hatte sie keine Hindernisse gescheut und einen Weg gefunden, diesen so vertrauten Ort aus einem vollkommen neuen Blickwinkel zu erkunden.
* Begriffserklärungen siehe im Glossar.
Der Hof
Der Hof war das Universum unserer Kindertage und lag im hügeligsten und buntesten Viertel aller Tbilisser Stadtteile. »Das Sololaki-Viertel verdankt man den wasserreichen Quellen der umliegenden Berge, durch die sich dieser einst verwinkelte Ort im Laufe der Jahrhunderte zu jenem so begehrten und in buntem Mischmasch aufblühenden Viertel entwickelt hat.« Ich betrachte das Foto und höre die Stimme meines Vaters zu mir sprechen, der mir so oft und viel über unser Viertel erzählte, als ich noch an seiner Hand durch die engen Gassen unseres Stadtteils lief. »Unter der arabischen Herrschaft benötigte man viel Wasser, um die Festungsgärten zu gießen, und so ließ man einen Kanal anlegen, der es von den Sololaki-Hügeln ins Tal hinunterleitete. Als später die Türken die Herrschaft übernahmen, machten auch sie Gebrauch von jenem Wasser. Auf Türkisch heißt Wasser su, und so wanderte dieses türkische Wort in die georgische Bezeichnung des Stadtteils ein, und aus dem U wurde ein O. Im neunzehnten Jahrhundert ließen sich viele reiche Georgier in dieser Gegend nieder und legten hier ihre Gärten an, und auch dabei kam dem Wasser eine entscheidende Rolle zu. So wuchs das Sololaki-Viertel zu einem angesehenen Stadtteil, und viele graziöse Villen mit Buntglasfenstern und pittoresken Holzbalkonen schmückten alsbald die kopfsteingepflasterten Straßen.«
Als ich auf die Welt kam und in die schattige und stets feuchte Wohnung in der Rebengasse 12 gebracht wurde, die zwischen der langen Engelsstraße und dem Toneti-Platz lag, wohnten die ranghohen KP-Funktionäre bereits in anderen Vierteln, und die einst prachtvollen Sololaki-Villen waren vom Staat umfunktioniert worden. Die Bewohner lebten nun in den sogenannten Tbilisser Höfen. Wieder höre ich die monotone, beruhigende Stimme meines Vaters in meinem Kopf: »Da wegen der allgemeinen Wohnungsknappheit viele Familien in diesen Höfen hausten und sich das Leben immer mehr nach draußen verlagerte, ging es hier sehr laut zu. Und weil es die Zeit der italienischen neorealistischen Filme war, brachte man diesen Lärm schnell mit Italien in Verbindung. So wurden aus den Tbilisser Höfen die Italienischen Höfe.«
Ich sehe diese Höfe vor mir, ich wandere durch die kopfsteingepflasterten Straßen und biege in die Rebengasse ein, wo mein Leben seinen Anfang nahm. Dieses Viertel ersetzte mir damals die ganze Welt. Hier laufe ich in meiner Vorstellung umher, entlang dem Botanischen Garten, der Kreuzvater-Kirche und der Engelsstraße, in der unsere Schule lag, zu den oberen Hängen des Mtazminda mit der Zahnradbahn, zum Fernsehturm und zum Vergnügungspark, zu den Hügeln nach Okrokana, durch die vielen verwunschenen Gassen und Holztreppen inmitten von Reben, die die Balkone überwucherten, und die kleinen verwinkelten Straßen, über den imposanten Leninplatz zum Rathaus, zwischen lästigen Tratschtanten und den ewig ihre KAMAZ-Autos waschenden Männern, zwischen flatternder Wäsche und kleinen Brunnen – an diesen Orten fanden all meine Tragödien und Komödien statt, dort tastete ich mich ins Leben hinein, dort erlebte ich auch den Zusammenbruch einer Welt, ungläubig, mit weit aufgerissenen Augen und mit Todesangst in den Lungen.
Ich sehe unseren viereckigen Hof vor mir. Die zwei gegenüberliegenden Häuser, dazwischen ein winziger umzäunter Garten, dazu rechter Hand das kleine zweistöckige Steinhäuschen auf Stelzen, das später dazugebaut wurde und, weniger bunt und schön, wie auf Hühnerbeinen etwas verloren herumstand, als wäre es einem russischen Märchen entsprungen.
Anders als bei den tschechoslowakischen oder österreichischen Pawlatschenhäusern hatte man bei uns nicht nur über die Straße und das Treppenhaus mit seinen schiefen Holztreppen Zugang zu den Wohnungen, sondern auch vom Hof aus über die krummen Holzstiegen und Wendeltreppen. Die einzelnen Wohnparteien waren durch einen hölzernen Laubengang miteinander verbunden. Während unser Haus dreistöckig und mit den schnörkeligsten Laubengängen versehen war, war das gegenüberliegende Backsteinhaus erst um die Jahrhundertwende gebaut worden und der solideste Bau des Hofes, mit Efeu bewachsen, zweistöckig, davor Metallbalkone mit blumigen Verzierungen.
Das eigentliche Leben der drei Hausgemeinschaften fand entweder in den Laubengängen oder im Hof statt. Dort wurde Backgammon oder Domino gespielt, dort wurden Rezepte ausgetauscht, dort lagerten die Einmachgläser der Hausfrauen und das abgelegte Spielzeug der Kinder, dort wurden Kräuter gegen Mehl getauscht, Krankheiten besprochen und Ehekrisen ausgetragen, dort wurden Liebschaften entlarvt. Fast alle der hölzernen Wohnungstüren hatten Glasfenster, so dass allen Hofbewohnern klar war, dass jegliche Abschirmung von vornherein eine Illusion darstellte. Es gab immer einen an Schlafstörungen leidenden Nachbarn, der jedes Kommen und Gehen, unabhängig von der Uhrzeit, registrierte, dem jeder Streit zu Ohren kam und der jede leidenschaftliche Versöhnung zu kommentieren wusste. Der Hof war ein Organismus, in dem die einzelnen Wohnparteien die Organe bildeten, alle miteinander verbunden, alle notwendig, um den Körper am Laufen zu halten. Erst später kam mir der Verdacht, dass die Kommunisten bei der Wohnungsverteilung ihr Augenmerk darauf richteten, in diesem Mikrokosmos viele verschiedene Berufsgruppen anzusiedeln, die sich gegenseitig aushelfen konnten, damit dem Staat möglichst wenig Belästigung und Aufwand entstand: Wurde einer krank, wurde er hofintern versorgt, brauchte jemand Strümpfe, die nur unter dem Ladentisch verkauft wurden, regelte man auch das untereinander, wollte sich jemand gute Noten kaufen, um an der Universität studieren zu können, wurde das nachbarschaftlich geklärt. Der Hof war ein Staat im Staat. Ein auf den ersten Blick vorbildlich sozialistischer: Alle waren gleich, mit denselben Rechten ausgestattet, unabhängig von Ethnie und Geschlecht, aber natürlich war auch das nur eine Scheinrealität. Im Grunde hatte jeder seinen Platz in diesem Konstrukt, und jeder wusste über seine Privilegien Bescheid. Und so würde der armenische Schuster Artjom nicht einmal im Traum darauf kommen, seine Fühler nach einer Georgierin aus einer Akademikerfamilie auszustrecken, genauso wenig würde die Fabrikantenfamilie Tatischwili die kurdische Familie von rechts gegenüber zu sich einladen.
Sogar wir, die Kinder des Hofes der Rebengasse 12, hatten diese ungeschriebenen Gesetze verinnerlicht, ohne uns selbst dessen bewusst zu sein. Wir ahmten einfach die Erwachsenen nach, wobei die Tatsache, dass wir den kurdischen Tarik beim Verstecken und bei Himmel-und-Hölle mitspielen ließen, obwohl uns eingetrichtert wurde, dass er schmuddelig war, eine Lernschwäche hatte, seinen Schnodder aß und weggeworfene Kaugummis kaute, einzig und allein darin begründet lag, dass es sich gut anfühlte, jemanden wie ihn in unserer Nähe zu dulden. Denn auch das war eine Eigenheit unseres Hofes, unseres Viertels, ja, vielleicht unserer Stadt: Wir wollten immer um jeden Preis gemocht oder geliebt werden, und wir wussten, dass es sich gut machte, einen Schwächeren zu beschützen, in dieser Mehrvölkerstadt, die seit Jahrhunderten mit den anderen koexistierte. Schließlich waren wir doch die besten Gastgeber und die tolerantesten Nachbarn, wir krümmten niemandem ein Haar und luden alle zu uns ein, wir bewirteten sie und lachten ihnen ins Gesicht, aber wenn sie wieder gingen, atmeten wir erleichtert auf und rümpften die Nase über ihre Tischmanieren oder ihre derbe Art. Die anderen waren immer ein wenig schlechter und ein wenig gröber, ein wenig dümmer und ein wenig benachteiligter als wir.
Unsere Wohnung war meiner Großmutter väterlicherseits, die wir »Babuda eins« nannten, nach der Rehabilitierung ihrer Familie überlassen worden. Sie hatte hohe Decken und feuchte Wände, schnörkelige Balkone zur Straßenseite und tropfende Wasserhähne, gegen die jeder Handwerker machtlos war. Hier wuchs mein Vater auf, dorthin brachte er meine Mutter, nachdem sie Moskau den Rücken gekehrt hatten. Dorthin brachte man auch meinen Bruder und fünf Jahre später mich, nachdem wir in einem kahlen Kreißsaal irgendwo in Bahnhofsnähe das Licht der Welt erblickt hatten. In meinem Zimmer – mein winziges improvisiertes Reich – hingen lauter Poster aus teuer auf dem Schwarzmarkt ergatterten »Ausländischer-Film«-Magazinen. Als Kinder hatten mein Bruder und ich das schöne, etwas größere Zimmer geteilt und nicht selten Kissenschlachten und Mutproben veranstaltet, aber mit den Jahren wurde es zu eng für uns beide, und so wurde ich in die winzige Kammer neben der Küche – einst Vorratskammer – verfrachtet. Ich mochte sie nicht sonderlich gern, aber immerhin hatte ich es besser als Babuda eins und (folgerichtig meine Großmutter mütterlicherseits) Babuda zwei, die sich das Wohnzimmer teilten, in dem sie ihre Schüler empfingen und Bücher übersetzten – und die es während ihrer schlimmsten Auseinandersetzungen genauso teilen mussten wie in den friedlichen Zeiten – und das jeden Abend mit viel Aufwand, mit Geschiebe und Gezerre in ein Schlafzimmer verwandelt wurde.
Der Laubengang im zweiten Stock gehörte nicht nur zu unserer, sondern auch zur Wohnung von Nadja Alexandrowna, eine alleinstehende, kinderlose Witwe, von der wir uns nicht vorstellen konnten, dass sie jemals jung gewesen war, und die den fatalen Fehler begangen hatte, sich während ihrer Studienzeit an der Moskauer Lomonossow-Universität in einen georgischen Gitarrenlehrer zu verlieben. Sie verlor ihren Kopf und ihren Verstand und reiste ihm in seine sagenumwobene Heimat nach, die von vielen ihrer dichtenden Landsleute besungen und bewundert worden war. Nachdem die stürmische Liebe verklungen und die kopflose Leidenschaft abgeebbt waren, quartierte der Gitarrenlehrer seine russische Trophäe bei seiner älteren Schwester ein und verschwand wochenlang in den Armen anderer Damen. Anscheinend war Nadjas Liebe hartnäckiger und unerschütterlicher als die ihres Mannes, denn sie hielt ihm zu seinen Lebzeiten und auch darüber hinaus die Treue und fand jedes Mal irgendeine Entschuldigung für sein unverzeihliches Verhalten. Auch als er mit zwei Frauen uneheliche Kinder zeugte und sie ab und an mit nach Hause brachte, fand Nadja, dass es dem »armen Mann« zustehe, da sie selbst aufgrund einer schwerwiegenden Kinderkrankheit keine bekommen konnte. Mit etwas sehr Entscheidendem musste dieser dauerfeiernde Mann seine fragile und ätherische Frau entschädigt haben, denn anders war ihre bis zur Dummheit aufopferungsvolle Liebe nicht zu erklären. Nach dem Tod der unverheirateten Schwester des Gitarristen und nach dessen Ableben durch Leberzirrhose blieben Nadja die dunkle, feuchte Zweizimmerwohnung, ihre Zimmerpflanzen und ihre Katzen – und ihr Russisch, das sie bis zu ihrem Lebensende nie gegen Georgisch eintauschte, ebenso wenig wie sie es sich nehmen ließ, uns Kinder mit Nougat- und Sauerdornbonbons zu beschenken.
Ich weiß bis heute nicht, warum die Babudas ihre distanzierte Haltung ihr gegenüber bewahrten, sie waren zwar stets freundlich zu ihr, liehen ihr hin und wieder etwas Mehl, Backpulver oder Eier, aber eine gewisse Skepsis blieb bestehen. Wahrscheinlich lag es daran, dass sich die beiden noch sehr gut an ihren Mann und ihr »unwürdiges« Leben an seiner Seite erinnerten und ihr diese weibliche Hingabe, die an nahezu religiöse Selbstaufopferung grenzte, nicht verzeihen konnten. Und obwohl sie viel gemeinsam gehabt hatten – auch Nadja war eine Frau der Literatur und der erhabenen Verse –, schlossen sie keine Freundschaft, und so blieb Nadja Alexandrowna bis zu ihrem Tod bloß eine Nachbarin, die man nur zu großen Festen einlud und der man an Ostern rote Eier und Paska brachte.
Eine Etage tiefer, im ersten Stock, wohnten die Basilias. Was wohl aus ihnen geworden ist? Die voluminöse Nani, nebenberuflich Verkäuferin in einem städtischen Gastronom irgendwo auf der anderen Flussseite, hauptberuflich Schwarzmarkthändlerin und die gewiefteste Frau des ganzen Hofs (nicht einmal Iras Mutter konnte da mithalten). Ich erinnere mich an die bunten Kittel, die sie immer trug. Sie schaffte es wahrlich, mit allen und allem Handel zu treiben: Bat man sie um ein bisschen Salz, wollte sie im nächsten Augenblick ein halbes Kilo Reis als Gegenleistung. Sie konnte jeden dazu überreden, irgendetwas zu kaufen, und vor allem die Frauen des Hofs waren ihr hörig, nahmen ihre Übellaunigkeit, ihre derbe Art geduldig hin, denn gegen eine angemessene Bezahlung konnte sie alles auftreiben, was das Herz begehrte und was der sowjetische Staat nicht hergab: von Kinokarten für eine geschlossene Filmvorführung bis hin zu tschechoslowakischer Unterwäsche. Von ihrem Mann Tariel war meist nur der imposant behaarte Rücken zu sehen, denn auch in seiner Freizeit war er unermüdlich an seinem KAMAZ zugange, der zum Groll aller Kinder immer im Hof parkte und beim Spielen störte. Ihr einziger Sohn, Beso, hatte weder das Talent seines Vaters noch das seiner Mutter geerbt; er war ein langsamer Zeitgenosse, träge und bewegungsfaul, der sich immerzu im Schritt kratzte und schon als kleiner Junge eine ausgeprägte Neugier allem Sexuellen gegenüber zeigte.
Wohnten die Basilias Wand an Wand mit Zizo? Ja, natürlich, so muss es gewesen sein, denn später wurde der Wohnraum dieser alten Dame durch Iras Familie, die Schordanias, beschnitten, und der erste große Hofskandal war vorprogrammiert. Zizo habe ich nie gemocht, musste mir aber immer alles von ihr gefallen lassen, so hatte man es mir und den anderen Kindern des Hofes eingebläut. Denn diese alte alleinstehende Dame mit albernen Hütchen auf dem Kopf und einem stets jammernden Tonfall hatte vor Jahren ihren einzigen Sohn bei einem Autounfall verloren, und dieser Verlust verlieh ihr in den Augen der Hofgemeinschaft einen Märtyrerinnenstatus. Sie durfte, was die anderen nicht durften: schimpfen und klagen, mahnen und eben jammern. Von ihrer Zweizimmerwohnung trat sie später ein Zimmer an Iras Mutter Giuli ab. Aber ihr war damals sicherlich nicht klar gewesen, dass diese ihr dadurch den Zugang zu ihrer Wohnung über das Treppenhaus versperren und zum ewigen Klagen und Stöhnen auf dem Weg über die Wendeltreppe verdammen würde.
Das ganze Erdgeschoss gehörte den Tatischwilis mit ihrer geräumigen Wohnung, dieser nahezu unwirklich vorbildhaften Vorzeigefamilie, der man trotz ihrer übertriebenen Gastfreundschaft, ihrer Geselligkeit und den beeindruckenden Kochkünsten der Familienmutter im Hof mit großem Misstrauen begegnete. Die Ablehnung ging vor allem von den Vertretern der Intelligenzija des Hofes aus und war dem Beruf geschuldet, den der Familienvater einst ausübte, Dawit, der immer nur »der Tschechowik« genannt wurde, ein Wort, dessen Bedeutung ich erst viele Jahre später erfassen sollte – der sowjetische Inbegriff für staatliche Verdorbenheit und Korruption. Diese Menschen waren die »Kapitalistenschweine« der Sowjetära und jedem »ehrbaren« Menschen ein Dorn im Auge. Hinzu kam, dass diese Familie eine Spur zu perfekt schien, und so war man unermüdlich darum bemüht, Fehler und Probleme dieser Musterfamilie aufzudecken.
Anna Tatischwili saß zwei Bänke vor mir und war die inoffizielle Prinzessin der Klasse, eine Schönheit und die Klassenbeste über viele Jahre, bis Ira ihr wenigstens diesen letzten Status streitig machte. Ihr Bruder Otto, der Prinz der Familie, war ein kleiner Sadist. Wie ich ihn hasse, wie mich heute noch dieses Unbehagen befällt, wenn ich an ihn denke. Dieser ewig Flüchtige. Wie es sich wohl mit seiner Schuld leben lässt?
Schon als Kind offenbarte er gewisse Auffälligkeiten, aber man gab sich mit endlosen Rechtfertigungen seiner Eltern zufrieden. Hieß es nicht damals, er sei halt ein »besonderer Junge«, mit dem man viel Geduld bräuchte? Nur einmal, als er eines Tages die Katze von Nadja Alexandrowna im Auffangbecken unter dem Wasserhahn im Hof ertränkte – der kleine Tarik war Zeuge der Folter geworden und hatte uns davon erzählt –, verlor man diese schier endlose Geduld und prophezeite, es würde »kein gutes Ende mit ihm nehmen«. Wie recht sie doch hatten.