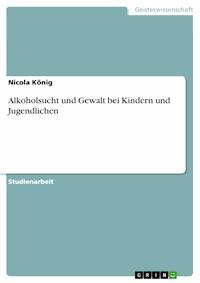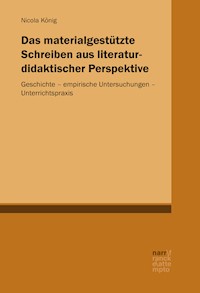
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Einführung des Aufgabenformats des materialgestützten Schreibens im Jahr 2012 markiert eine Zäsur in der Aufsatzdidaktik: Neben dem Interpretieren, Analysieren und Erörtern sind die Schüler:innen aufgefordert, auf der Basis unterschiedlicher Materialien Lexikoneinträge, Kommentare, Reden oder Leserbriefe zu verfassen. Die Fokussierung auf die Adressat:innen und die Synthese zu einem eigenen Zieltext stellen dabei mannigfache Anforderungen an die Lese- und Schreibkompetenzen und deren Vermittlung. Der vorliegende Band rückt eine literaturdidaktische Perspektive in den Vordergrund, indem sowohl auf die verwandten Aufsatzformen als auch auf die Geschichte des Aufsatzes abgehoben wird. Kern der Arbeit sind empirische Untersuchungen in unterschiedlichen Schulstufen, die auf eine Integration des Aufgabenformats in den Deutschunterricht abzielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicola König
Das materialgestützte Schreiben aus literaturdidaktischer Perspektive
Geschichte – empirische Untersuchungen – Unterrichtspraxis
© 2021 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-8233-8470-0 (Print)
ISBN 978-3-8233-0268-1 (ePub)
Inhalt
Einleitung
Die 2012 durch die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (BS AHR) im Fach Deutsch vorgenommene Einführung des materialgestützten Schreibens als neuem verbindlichen Aufgabenformat des Abiturs (s. Abb. 1) markiert einen „Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik im Sinne von „outcome-Orientierung“ Rechenschaftslegung und Sytemmonitoring“.1 Folgt man Becker-Mrotzeks Einschätzung, dass Bildungsstandards das „zentrale bildungspolitische Instrument [sind], das die normativen Erwartungen der Gesellschaft an die Fähigkeiten der nachfolgenden Generation in Bezug auf bestimmte thematisch-inhaltliche Anforderungen verbindlich beschreibt“,2 dann stellt sich die Frage nach den Ursachen gleichermaßen wie den Intentionen der Einführung eines neuen Aufgabenformats.
Die Implementierung des materialgestützten Schreibens in allen sechzehn Bundesländern stellt die an Schule Beteiligten vor große Herausforderungen. Dies liegt nicht nur im Aufgabenformat selbst begründet, sondern auch in dem Umstand, dass die Bildungsstandards zwar eine Angleichung der Leistungsunterschiede intendieren, nicht aber methodische oder curriculare Vorgaben machen. Die Bildungsstandards bilden dabei einen verbindlichen Orientierungsrahmen und jede Schule ist dazu verpflichtet, die Regelstandards umzusetzen. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Herausforderungen aus literaturdidaktischer Perspektive in den Blick zu nehmen und Umsetzungsvorschläge aufzuzeigen. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist dabei dreigeteilt: Wenn die zentrale Änderung in den BS AHR die Einführung eines neuen Aufgabenformats markiert, dann gilt es zunächst, die Defizite zu rekonstruieren, die zur Einführung des Formats geführt haben. Becker-Mrotzek, fachdidaktischer Berater der Arbeitsgruppe, die mit der Entwicklung der Bildungsstandards betraut war, nennt als entscheidende Herausforderungen des materialgestützten Schreibens die Anbahnung eines propädeutischen Wissens, die Vermittlung der Argumentationsfähigkeit sowie der Schreibkompetenz.3 Diese decken sich mit den übergeordneten Zielen der BS AHR Deutsch, in denen die Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung, die allgemeine Studierfähigkeit sowie die wissenschaftspropädeutische Bildung4 angeführt werden. Diese Arbeit folgt Becker-Mrotzeks eindringlicher Forderung, dass das Schreiben in den Unterricht zurückgeholt werden muss, und versucht eine Beurteilung der Notwendigkeit dieser Forderung aus historischer (Teil I), aus schreibdidaktischer (Teil II) und aus praxeologischer Perspektive (Teil III).
Können Aufgabenformate als Überprüfung der Bildungsstandards verstanden werden, so bilden die illustrierenden Prüfungs- und Lernaufgaben ihre Konkretisierung. Die Merkmale und daraus resultierenden Herausforderungen des Aufgabenformats sollen anhand einer konkreten Beispielsaufgabe des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), das mit der wissenschaftlichen Betreuung und der Umsetzung der Bildungsstandards betraut ist, erläutert werden.5 Die BS AHR sind in fünf Kompetenzbereiche gegliedert,6 die prozess- und domänenspezifischen Kompetenzbereiche. Das Schreiben als prozessbezogene Kompetenz wird anhand der domänenspezifischen Bereiche – sich „mit Texten und Medien auseinandersetzen“ sowie „Sprache und Sprachgebrauch reflektieren“7 – konkretisiert. Hier wird die Verzahnung deutlich, die eine literaturdidaktische gleichermaßen wie eine sprachdidaktische Perspektivierung auf das Aufgabenformat des materialgestützten Schreibens erforderlich macht.
BS AHR (2012), S.24
Die Aufgaben der beiden Ausprägungsarten des materialgestützten Schreibens – das Verfassen informierender und argumentierender Texte – werden demnach immer zu domänenspezifischen Themen gestellt. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem argumentierenden Schreiben: Dies ist darin begründet, dass eine Progression vom informierenden zum argumentierenden Schreiben angenommen wird, die sich auch in den veröffentlichten Unterrichtsmodellen widerspiegelt.8 Auch in Bezug auf die Domänenspezifik lässt sich eine Weiterentwicklung beobachten. Während in der Mittelstufe Beispielsaufgaben noch fächerübergreifende Themen behandeln, wird erst in der Oberstufe die Domänenspezifik durchgehend berücksichtigt. Die Konzentration auf das argumentierende Schreiben ist aber auch im Hinblick auf die Aspekte des Problemlösens und der Propädeutik, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der BS AHR spielen, wichtig: „Besonderes Gewicht erhält die Entwicklung der Argumentations- und Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die Bereiche des Faches und in fächerübergreifenden Kontexten“9. Das Erlernen des Argumentierens und Positionierens stellt eine zentrale Herausforderung für die Entwicklung der Schreibkompetenz, aber auch für den Umgang mit Literatur dar, die nicht erst in der oberen Mittelstufe in den Blick genommen werden darf.
Die folgende Beispielsaufgabe mit erhöhtem Niveau ist dem Aufgabenpool der Länder entnommen und dem argumentierenden Typ zugeordnet.
Aufgabenstellung:
Die Intendantin des städtischen Theaters hat in einem Interview mit der lokalen Tageszeitung Bedenken geäußert, „Kabale und Liebe“ auf den Spielplan zu setzen. Dabei bezog sie sich auf kritische Diskussionsbeiträge, wonach das Stück nicht mehr zeitgemäß sei. Ihr Deutschkurs, der Schillers Drama im Unterricht behandelt hat, will sich hierzu in einem Offenen Brief an die Intendantin äußern.
Verfassen Sie auf Grundlage der Materialien M1 bis M9 und Ihrer fachlichen Kenntnisse einen Offenen Brief (siehe dazu M10), der begründet darlegt, inwieweit es auch im 21. Jahrhundert sinnvoll ist, „Kabale und Liebe“ für die Bühne zu inszenieren.1
Die Schüler:innen werden aufgefordert, sich mit der Frage der Aktualität des Dramas Kabale und Liebe zu beschäftigen, indem sie – als Mitglied des Deutschkurses – an die Intendantin des Theaters einen Offenen Brief schreiben. Damit werden in der Aufgabenstellung Zieltext – der Offene Brief – und Situierung – Stellungnahme des Deutschkurses zur Debatte – vorgegeben. Die für den Aufgabentyp des materialgestützten Schreibens typische Adressierung bewegt sich dabei im Spannungsfeld zwischen der genannten Adressatin – der Intendantin – und den eigentlichen Adressat:innen – den Leser:innen des Mediums, in dem der Offene Brief veröffentlicht werden soll. Zum Verfassen des Zieltextes erhalten die Schreibenden elf Materialien mit insgesamt 1659 Wörtern. Darin sind acht lineare pragmatische Texte, zwei Abbildungen und eine Tabelle enthalten.2
Dieses Beispiel veranschaulicht die Grundgedanken des neuen Aufgabenformats: Neben den textgebundenen Aufgaben der Erörterung, Interpretation und Analyse rücken damit Aufgaben ins Zentrum, „die keine vollständige Textanalyse mehr erfordern, da das vorgelegte Material auf der Grundlage von Rezeption und kritischer Sichtung für eigene Schreibziele genutzt werden soll (Materialgestütztes Schreiben).“3 Auf der Basis zahlreicher kontinuierlicher und diskontinuierlicher Texte gilt es, einen eigenen, individuellen informierenden oder argumentierenden Text zu verfassen, der eine vorher bestimmte Adressat:innengruppe berücksichtigt und auf der Basis der zur Verfügung gestellten Materialien sowie des eigenen Weltwissens erfolgt. Das Neuartige des Aufgabenformates ist somit das Zusammenspiel von Textrezeption und -produktion. Das vorgegebene Material muss nicht nur gelesen, in Bezug auf die Aufgabenstellung ausgewertet und mit dem eigenen Vorwissen in Verbindung gebracht werden, sondern es muss vor allem eine Transformation geleistet werden. Pertzel und Schütte4 weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Synthese für dieses Aufgabenformat eine entscheidende Rolle spielt. Es gilt, aus den unterschiedlichen Materialien diejenigen auszuwählen, die für die Adressat:innen und das jeweiligen Schreibziel angemessen sind. Damit wird das Material – und hier liegt ein entscheidender Unterschied zur Interpretation – zum Ausgangspunkt des eigenen Schreibprozesses. Lag bis 2012 durch die EPA – Einheitliche Prüfungsanforderungen Abitur – vorgegeben eine Begrenzung des Umfangs der zu bearbeitenden Texte bei 900 Wörtern, so wurde diese beim textbezogenen Schreiben auf 1500 erweitert.5
Die Herausforderungen des Aufgabenformats
Die Darstellung der Beispielsaufgabe ermöglicht, die Herausforderungen des Aufgabenformats zu beschreiben. Da sie den Aufbau dieser Arbeit bedingen, sollen sie an dieser Stelle kurz skizziert werden. Der Aufgabe muss eine Strittigkeit zugrunde liegen, die ein Argumentieren und Positionieren erforderlich macht. Da eine Vielzahl unterschiedlicher Zieltexte sowohl für das informierende als auch für das argumentierende Schreiben existiert,1 erfordert dies von den Schreibenden ein umfangreiches Textsortenwissen. Im vorliegenden Fall müssen die Schüler:innen wissen, dass der Offene Brief nicht nur die Intendantin, sondern auch die Kulturschaffenden und -interessierten der Stadt ansprechen soll. Gleichzeitig impliziert der Offene Brief eine Asymmetrie zwischen Autor:in und Adressat:innen: Obwohl es sich um einen Brief handelt, liegt ein „öffentlicher Akt der Intimität“2 vor, der in konkrete Sprachhandlungen übersetzt werden muss. Adressat:innenbezogenes Schreiben erfordert demnach die Berücksichtigung der kommunikativen Funktionen des jeweiligen Zieltextes. Damit aber rückt zugleich ein dialogisches Schreiben in den Vordergrund.
Zentral ist weiterhin der Umgang mit der Materialfülle, die einen veränderten Umgang mit Texten sowohl im Hinblick auf den Lese- als auch den Schreibprozess erforderlich macht. Damit zeichnet das Aufgabenformat des materialgestützten Schreibens eine „Hybridität“3 aus, die die Zieltextsorten ebenso wie die Materialien betrifft. So werden literarische Texte neben pragmatischen Texten, journalistische Artikel neben Aphorismen und Abbildungen neben Gedichten präsentiert. Das Material ist somit nicht nur polytextuell, sondern auch „fragmentiert und entkontextualisiert“.4
Auf die Komplexität und die daraus resultierenden didaktischen Herausforderungen ist seit Einführung des Aufgabenformats in zahlreichen Veröffentlichungen verwiesen worden5 und sie wird weder auf Seiten der Praktiker noch in der Forschung bestritten. In dieser Arbeit aber soll es nicht ausschließlich darum gehen, diese Herausforderungen aufzuzeigen. Der erste Teil der Arbeit wirft – ausgehend von einer historischen Verortung des Schulaufsatzes – einen Blick auf die Entwicklungslinien der Aufsatz- und Schreibdidaktik. Ein Abriss der Geschichte des Schulaufsatzes fragt nach den Vorläufern des materialgestützten Schreibens und fokussiert auf die Lehrbarkeit des Schreibens und damit auf die Rolle des Musterwissens, die Rolle der Literatur und das Verhältnis von Mündlich- und Schriftlichkeit. Damit werden Textformen gleichermaßen wie Aufgabenarten in den Blick genommen und ihre Implikationen für die Konstruktion eines Schreibmodells erläutert. Die Darstellung bewegt sich demnach im Spannungsfeld zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft.
Die empirischen Untersuchungen
Damit das Aufgabenformat des materialgestützten Schreibens von den Schülerinnen und Schülern erfolgreich umgesetzt werden kann, bedarf es zum einen geeigneter Aufgabenstellungen und Materialien, zum anderen aber sind Unterrichtsarrangements erforderlich, die die entsprechende Lese- und Schreibkompetenz vermitteln. Wenn Feilke darauf abhebt, dass das materialgestützte Schreiben „nicht nur ein Gegenstand, sondern eine Form des Lernens im Deutschunterricht“ ist,1 das die Textplanung und die Erschließung von Materialien betrifft und somit in den Gesamtunterricht integriert werden muss, dann sind in diesem Sinne die drei empirischen Untersuchungen des dritten Teils dieser Arbeit angelegt. Die Vermittlung einer Schreibkompetenz soll die Schüler:innen dazu befähigen, auf die jeweils variierenden Zieltexte, kommunikativen Situationen und Adressat:innen adäquat zu reagieren und die Materialien angemessen für den eigenen Schreibprozess zu nutzen. Vor allem das Argumentieren und Positionieren stellt in diesem Zusammenhang erhöhte Anforderungen an die Problemlösekompetenz. Die drei empirischen Studien sind als Interventionsstudien angelegt, d.h. sie untersuchen in Feldstudien kausale Zusammenhänge und damit die Wirksamkeit von Interventionen, also Maßnahmen, die dazu geeignet erscheinen, die Schreibfähigkeit zu verändern.
In einem ersten Schritt der empirischen Untersuchung soll es darum gehen, detaillierte Informationen darüber zu erhalten, wie Schüler:innen mit materialgestützten Schreibaufgaben umgehen. Auf der Basis von zwei Aufgaben, konzipiert jeweils für die Mittel- und die Oberstufe, wird untersucht, über welche Präkonzepte die Schreibenden verfügen, wenn sie eine materialgestützte Schreibaufgabe bearbeiten. Um die Schwierigkeiten und Herausforderungen zu beschreiben, hätte es allerdings gereicht, die Schüler:innen die Aufgabe bearbeiten zu lassen. Die Entscheidung für eine Interventionsstudie beruht auf dem Grundverständnis einer eingreifenden Didaktik mit dem Ziel, die Schreibkompetenz der Schüler:innen zu verbessern und Schreibarrangements zu entwickeln, die sie dazu befähigen. Diese müssen, basierend auf aktuellen Lese- und Schreibmodellen, durchgeführt, untersucht, evaluiert und weiterentwickelt werden. Versteht man im Sinne Feilkes materialgestützte Schreibaufgaben primär als Form des Lernens, denn als Gegenstand und nimmt man die in der didaktischen Diskussion antizipierten Herausforderungen ernst, dann kann eine einzige Intervention dem Untersuchungsgegenstand nicht gerecht werden. Zwar ließen sich beispielsweise Prozeduren des Argumentierens valide, objektiv und reliabel auf der Textoberfläche nachweisen und ein derartiges Setting würde den Ansprüchen an eine empirische Untersuchung weitgehend genüge leisten. Aber ein solches Vorgehen bildet weder die Komplexität des Aufgabenformats noch die Unterrichtswirklichkeit ab. Bei den 107 Mittelstufen- und 68 Oberstufenschüler:innen, mit denen die beiden Unterrichtseinheiten durchgeführt wurden, handelt es sich um einen Erstkontakt mit dem Aufgabenformat und auch die Lehrkräfte konnten bisher keine einschlägigen Erfahrungen mit dem Aufgabenformat sammeln.2 Deshalb würde es aus Sicht der Lernenden wie der Lehrenden defizitorientiert anmuten, nur den Ist-Zustand zu erheben, bzw. ausschließlich eine Intervention durchzuführen, die zwar operationalisierbar ist, aber den Bedürfnissen der Durchführenden nicht entspricht.
Aus diesem Grund basieren die beiden Interventionsstudien, durchgeführt jeweils in 5 Klassen und 5 Oberstufenkursen, auf einer vollständigen Unterrichtsreihe mit ungefähr 9–12 Unterrichtsstunden. Die Konzeption der Interventionen für die Mittel- und Oberstufe stützt sich auf eine erfahrungsgeleitete Hypothesenbildung und berücksichtigt bereits erschienene Publikationen3 ebenso wie theoretische schreibdidaktische Modellierungen. Die Schüler:innen verfassen zu Beginn und am Ende der Unterrichtsreihe ihren Zieltext, so dass die Wirksamkeit der Interventionen beurteilt werden kann und die Schreibenden den eigenen Kompetenzzuwachs demonstrieren können. Die Interventionsstudien erlauben es, einen Schreibprozess über einen längeren Zeitraum in den Blick zu nehmen und nicht nur die Schwierigkeiten der Schüler:innen zu beschreiben, sondern auch den Einsatz der Interventionen zu reflektieren. Dadurch sollen Rückschlüsse auf die Aufgabenkonstruktion, die Materialauswahl ebenso wie auf die Planung von Interventionen und die curriculare Anbindung des Aufgabenformats des materialgestützten Schreibens möglich sein.4 Die Gegenüberstellung der Daten der Mittel- und der Oberstufe erlaubt zudem, die Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Aufgaben und damit die Herausforderungen über einen größeren Zeitraum zu betrachten und somit Alterseffekte zu berücksichtigen.5
Die dritte empirische Untersuchung wurde in einem qualitativen Untersuchungsdesign in der Unterstufe des Gymnasiums zum literarischen Essay durchgeführt und nimmt einen Perspektivwechsel vor. Die Forderungen der Didaktik lauten, dass das Schreiben wieder im Unterricht selbst verortet und das Argumentieren gelehrt werden muss.6 Um diesen Anspruch umsetzten zu können, ist es jedoch erforderlich, neu zu denken. Die literarische Perspektive soll daher nicht als Gegenpol, sondern als Ausgangspunkt gesehen werden. Die Unterrichtseinheit ist an aktuelle US-amerikanische schreibdidaktische Modelle angelehnt und basiert auf den Studien und Publikationen des Teachers College Reading and Writing Project der Columbia University, New York. Diesen Ansatz konnte ich während eines Forschungsaufenthaltes kennen lernen. Hospitationen in Schulen und bei Lehrer:innenfortbildungen vermittelten mir einen Einblick in die Chancen dieses Schreibansatzes, der ausgehend von einem literarischen Text ein argumentierendes Schreiben in den Blick nimmt. Anhand einer qualitativen Studie soll überprüft werden, welche argumentativen Schreibkompetenzen Schüler:innen erlangen können, wenn sie frühzeitig in ihrer Schullaufbahn dazu angeleitet werden, schemabasiert in einem literarischen Essay zu argumentieren. Sprach- und Literaturdidaktik werden in diesem Sinne nicht als Kontrahenten verstanden, sondern als Partner mit demselben Ziel, die Schreibkompetenz im Deutschunterricht nachhaltig zu verbessern und die Schüler:innen zum differenzierten, authentischen sowie propädeutischen Schreiben zu befähigen.
IZur Geschichte und Verortung des Aufgabenformats des materialgestützten Schreibens
I.1Die Genese der Einführung des materialgestützten Schreibens
Die 2012 in Kraft getretenen Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (BS AHR) stehen für eine Reform des Schreibunterrichts in der Sekundarstufe II, so postulieren Neumann und Steinhoff.1 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach den Intentionen der Reform, d.h. ihrem Zielpunkt, aber auch nach dem Ausgangspunkt: der Geschichte des Schreibens im Deutschunterricht. Die Neuerungen betreffen besonders die Bedeutung der pragmatischen Texte im Rahmen von Textproduktionen, die Fokussierung auf die Schreibprozesse und die Textfunktion, die das Informieren, Argumentieren und das Erklären betont und damit ein Gegengewicht zum Analysieren und Interpretieren literarischer Texte darstellt.2 Für den Schreibunterricht erfordert diese Akzentuierung eine veränderte Auseinandersetzung mit Texten, sollen diese für die eigene Textproduktion nutzbar gemacht werden, sowie einen hohen Reflexionsgrad: Beides sind zentrale Kompetenzen, die für ein Schreiben in Beruf und Schule erforderlich sind.
Wenn in den Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife im Jahre 2012 erstmals explizit das Aufgabenformat des materialgestützten Schreibens auftaucht, dann muss, um die Intention der Einführung des neuen Aufgabenformates einschätzen zu können, diese im Zusammenhang mit der Anschlussfähigkeit an die Bildungsstandards des Mittleren Schulabschlusses (BS MSA) betrachtet werden. Desweiteren ist die Betonung der kommunikativen Funktionen des Schreibens relevant, die „für das Studium, die Berufsausbildung und erfolgreiches Handeln im Beruf erforderlich sind“3. Zwar wird in den BS AHR auf die „Entwicklung der Argumentations- und Reflexionsfähigkeit“ abgehoben,4 jedoch wird die Ausbildung der Wissenschaftspropädeutik, auf die in neueren Publikationen verwiesen wird, nicht explizit eingegangen.5
Mit der Einführung des neuen Aufgabenformats ist der Wegfall des gestaltenden Schreibens in der schriftlichen Abiturprüfung verbunden.6 Damit steht das materialgestützte Schreiben in den beiden Ausprägungsformen des Verfassens informierender und argumentierender Texte neben den Aufgabenarten der Erörterung, der Interpretation und der Analyse. Der Wegfall des gestaltenden Schreibens markiert somit eine Neuorientierung der Schreibdidaktik, die im Verlauf der Arbeit näher ausgeführt werden soll. Ob die Schwierigkeiten einer Bewertung von kreativen Textprodukten für den Wegfall entscheidend waren oder aber die Orientierung an Schreibprodukten, die stärker an der Berufswelt oder dem Studium ausgerichtet sind, darüber kann nur spekuliert werden. Die Kritik an den Ansätzen des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts aber deutete bereits auf eine derartige Entwicklung hin.7
Dass das materialgestützte Schreiben in der didaktischen Diskussion auf eine Geschichte zurückgreifen kann und keineswegs ein vollständig neues, von fachwissenschaftlichen Diskursen abgekoppeltes Phänomen ist, machen Abraham, Baurmann und Feilke in ihrem Basisartikel in der 2015 zum materialgestützten Schreiben publizierten Praxis Deutsch-Ausgabe deutlich, indem sie auf Unterrichtsmodelle mit materialgestützten Schreibaufgaben verweisen, die bis in das Jahr 2001 zurückreichen.8 Ebenso betonen die Autoren, dass das materialgestützte Schreiben ein Aufgabenformat für alle Schulstufen ist.9 Obwohl dieses explizit in den BS AHR eingeführt wurde, muss es in der Unter- und Mittelstufe angebahnt werden.10
Markiert die Einführung 2012 in den Bildungsstandards einen Paradigmenwechsel, dann ergeben sich daraus gleichermaßen didaktisch-methodische Herausforderungen wie Fragen der Anschlussfähigkeit. So wird in den BS MSA explizit betont, dass die Umsetzung der Bildungsstandards die Chance bietet, „eine anforderungsbezogene Aufgabenkultur“11 zu entwickeln. Aus diesem Grund ist es erforderlich, das Aufgabenformat des materialgestützten Schreibens im Kontext der Bildungsstandards für den Mittleren Bildungsabschluss zu betrachten, der bereits 2004 für das Fach Deutsch eingeführt wurde: Zwar taucht hier der Begriff des materialgestützten Schreibens nicht explizit auf, jedoch wird im Kompetenzbereich Schreiben als Standard zum Texte planen angeführt, dass die Schüler:innen „gemäß den Aufgaben und der Zeitvorgabe einen Schreibplan erstellen, sich für die angemessene Textsorte entscheiden und Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen, ggf. materialorientiert konzipieren [Hervorhebung durch die Verfasserin]“12 sollen. Auch im Zusammenhang mit der Textüberarbeitung wird explizit auf die Schreibsituation und den Schreibanlass abgehoben. Werden die näher zu erbringenden Leistungen konkretisiert, dann heißt es im Anforderungsbereich II: „Bezüge in Texten bzw. Materialien erkennen, um Aussagen zu erfassen“13. Im Zusammenhang mit der Konstruktion von Aufgaben sollen auch thematisch orientierte Textzusammenstellungen angeboten werden. Der Prozesscharakter des Schreibens wird betont.
Dass diese Forderungen in den BS MSA auf Aufgaben im Sinne des materialgestützten Schreibens hinauslaufen, verdeutlicht die angegebene Beispielsaufgabe 114: So wird das „Verfassen eines journalistischen Textes auf der Grundlage korrespondierender Materialien (Aufgabenart: Von einer Textgrundlage ausgehend. Argumentieren, erörtern)“ am Beispiel des Themas „Alkohol: Lebensfreude oder Abhängigkeit?“15 gefordert. Als Materialien werden ein Interview, ein Sachtext sowie Diagramme angeboten. Auch die angeführten Teilaufgaben heben darauf ab, dass die den Materialien entnommenen Informationen in einen eigenen Text überführt werden, der eine klar festgelegte Adressierung hat: „Entnehmen Sie den vorgelegten Texten und der Grafik die geeigneten Informationen, Aussagen und Hinweise und schreiben Sie auf dieser Grundlage einen informierenden Artikel für eine Schülerzeitung zum Thema „Alkohol“! Zeigen Sie in Ihrem Artikel Möglichkeiten auf, wie man dem Alkoholkonsum von Jugendlichen vorbeugen könnte.“16 In den Lösungsvorschlägen wird auf das intentions- und adressatenbezogene Schreiben abgehoben.
Zwar kann man im Sinne des materialgestützten Schreibens bei der Präsentation von drei Materialien noch nicht von einer Materialfülle sprechen und auch das Thema ist nicht domänenspezifisch, wie es in den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife gefordert wird. Trotzdem wird hier von den Schülerinnen und Schülern ein adressatenorientiertes und zieltextgebundenes Schreiben gefordert. Die Informationen der Materialien müssen in einen eigenen Text überführt werden. Die Materialmenge und eine Konzentration auf ein informierendes Schreiben dürften dem Entwicklungsstand der Schüler:innen angepasst sein. Dass 2012 in den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife das materialgestützte Schreiben erstmals auftaucht, kann demnach als logische curriculare17 Fortführung der Forderungen und Standards des Mittleren Bildungsabschlusses verstanden werden.
I.2Das Aufgabenformat des materialgestützten Schreibens im Kontext der Geschichte des Schulaufsatzes
Die 2012 von der KMK beschlossene Einführung des materialgestützten Schreibens steht in der Tradition von Aufsatzformen des Deutschunterrichts, die als Reaktion auf historische, gesellschaftliche, politische und ökonomische Entwicklungen gewertet werden können. Ziel ist es zu untersuchen, ob es Vorläufer und damit didaktische Anknüpfungspunkte des neuen Aufgabenformats gibt. Weiterhin gilt zu klären, in welcher Beziehung Literatur- und Schreibunterricht standen und wie sich das Schreiben über Literatur verändert hat. Es gilt das Verhältnis von Analysen im Gegensatz zu freieren Schreibformen abzuwägen. Ebenso wird die Rolle von Sachtexten für den Schreibprozess betrachtet, um sie dem polytextuellen Materialienverständnis beim materialgestützten Schreiben gegenüberzustellen. Eine historische Verortung konzentriert sich demnach auf die Debatten und Konflikte, die ein adressatenbezogenes, situiertes, auf unterschiedlichen Materialien basierendes Schreiben impliziert und nicht auf eine vollständige historische Darstellung der verschiedenen Aufsatzformen, die umfassend von Ludwig1 vorgenommen wurde. Es wird demnach in dieser Betrachtung darum gehen, einzelne Fakten auszuwählen und darzustellen, die für das materialgestützte Schreiben relevant sind. Damit formt der Diskurs die Betrachtung gleichermaßen wie die Kontingenz.2
Versucht man die gut 300jährige Geschichte des deutschen Aufsatzes zusammenzufassen, so soll in diesem Zusammenhang eine Eingrenzung auf den schulischen Aufsatz vorgenommen werden. Der Aufsatz selbst setzte sich in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts als Textsorte durch, die unterschiedliche Formen schriftlicher Beiträge subsumierte.3 Die Überlieferungsgeschichte bietet dabei ein Ordnungskriterium, das – Ludwig folgend4 – drei zentrale Entwicklungslinien enthält: Die Konzentration auf die Rhetorik, die den deutschen Aufsatz bis ins 18. Jahrhundert geprägt hat, das Ausbilden einer eigenen Tradition, die das 18. und gesamte 19. Jahrhundert beeinflusste, und das 20. Jahrhundert mit der Vorstellung des freien Aufsatzes. Für die inhaltliche Ausrichtung ist die Einteilung Helmers’ weiterführend, die erlaubt, die Vorläufer des materialgestützten Schreibens in den Blick zu nehmen. So unterscheidet Helmers5 den Imitationsaufsatz vom Reproduktions- und vom Produktionsaufsatz. Während der Imitationsaufsatz stark an die Form und damit an die antike Rhetorik gebunden ist, nimmt der Reproduktionsaufsatz die literarischen Stoffe in den Blick und fokussiert auf den Umgang mit diesen. Der Produktionsaufsatz hingegen hebt auf die Gestaltung und Selbstständigkeit der bis dahin überwiegend männlichen Schüler ab. Auf diese Einteilung wird am Ende dieses Kapitels noch einmal zurückgegriffen: Sie soll die Basis einer Auswertung der Einflüsse der Geschichte des deutschen Aufsatzes für das materialgestützte Schreiben darstellen. Um einschätzen zu können, warum es im Laufe der Geschichte des Aufsatzes immer wieder zur Weiterentwicklung und damit verbunden auch zur Ablehnung des Bestehenden gekommen ist, bietet es sich an, auf Helmers’ Dreieck des Gestaltens6 zurückzugreifen:
Helmers’ Dreieck des Gestaltens
Diese Übersicht erlaubt, die einzelnen Aufsatzformen in Bezug auf vorgenommene Schwerpunkte einzuschätzen. Da das materialgestützte Schreiben sowohl auf die Wirksamkeit, die Sachgemäßheit und die Wahrhaftigkeit der Positionen abhebt und damit alle drei Aspekte in den Blick nimmt, soll im Folgenden untersucht werden, auf welche der jeweiligen Strömungen der Aufsatzvermittlung vorwiegend fokussiert wurde.
Die Entwicklung eines Deutschunterrichts und damit verbunden von eigenen Aufsatzformen ist von den politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren der jeweiligen Zeit maßgeblich beeinflusst. Juliane Eckard7 verweist in ihrer Einführung zu Theorien des Deutschunterrichts auf den Zusammenhang zwischen historischen und ökonomischen Bedingungen und zeigt die Einflussnahme auf Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts auf. So könne die Einführung des Deutschen als Unterrichtssprache als Zeichen der Emanzipation des Bürgertums vom Feudaladel verstanden werden. Die Schwierigkeiten, das Fach Deutsch im Lehrplan zu etablieren, demonstriert die Machtansprüche der Herrschenden, einen humanistischen Bildungsanspruch und damit das Lateinische zu verteidigen und die Vermittlung des Lesens und Schreibens in den Blick zu nehmen. Galt im Mittelalter, dass der „gute Theologe (…) der gute Sprachenlehrer“8 ist, vollzog sich spätestens im 19. Jahrhundert eine Verdrängung der Theologie durch die Literaturwissenschaft. Helmers merkt kritisch an: „Nicht die Theorie des künftigen Berufs wird als Grundlage der Berufsausbildung angesehen, sondern die Theorie der Literatur.“9
Aus diesen differierenden Ansprüchen resultiert die Deutschland noch immer prägende Dreigliederung des Schulsystems, die sich mit den Erfordernissen konfrontiert sah – und immer noch sieht –, eine breite Bildung der Gesellschaft im Sinne einer „Volksaufklärung“10 vorzunehmen, die ökonomischen Interessen der Gesellschaft zu befriedigen, eine Mittelschicht auf den Beruf vorzubereiten sowie humanistische Bildungsideale in der Tradition des Lateinunterrichts hochzuhalten. Im Zuge der sich in Europa durchsetzenden Industrialisierungen wurden zunehmend auch naturwissenschaftlich ausgebildete Arbeitskräfte benötigt, die in der Bildung von Realgymnasien mündeten. Das Wahren traditioneller Werte und Inhalte konkurrierte demnach mit den ökonomischen Interessen und den gesellschaftlichen Forderungen nach Partizipation.
Der Einfluss der Rhetorik
Bis weit ins 19. Jahrhundert wurde der Deutschunterricht maßgeblich von der antiken Rhetorik und der lateinischen Sprache, die noch bis ins 17. Jahrhundert die Unterrichtsorganisation und die Inhalte beeinflusst hat, geprägt. Dabei ging es nicht nur um das Halten von Reden im gesellschaftlichen oder schulischen Kontext. Gerade in der Frühen Neuzeit war die Vermittlung der Redekunst das übergeordnete Bildungsziel, an dem sich alle Fächer – „Grammatik, Syntax, Etymologie, lateinische Autorenlektüre, (…), Logik, Dialektik, Philosophie“1 – ausrichteten. Orientiert am antiken Ideal wurden die Reden zunächst übersetzt und analysierend nachvollzogen. Die rhetorischen Übungen zielten darauf ab – unabhängig davon, ob sie in lateinischer oder deutscher Sprache durchgeführt wurden –, einen guten Stil auszuprägen. Auch als im 17. Jahrhundert die deutsche Sprache Einzug in die Schulen hielt, war die Rhetorik noch inhaltsdominierend.
Betrachtet man den antiken Unterricht, so fällt seine Dreigliedrigkeit auf: Zunächst erfolgte eine Unterweisung im Lesen und Schreiben. Den zweiten Teil machte der grammatische Unterricht aus. Hier ging es jedoch nicht nur um das richtige Sprechen und Schreiben, sondern um das Geschriebene im Allgemeinen, d.h. auch um die Auseinandersetzung mit Literatur. Der Rhetorikunterricht als dritte und dominante Säule sollte den Schüler in die Lage versetzen, selbstständig Reden zu verfassen, sich als gebildeter Bürger auszuzeichnen und damit am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Wenn sich hier vielleicht noch nicht explizit von einer beruflichen oder universitären Ausbildung sprechen lässt, so muss die Unterweisung in der Rhetorik doch als Vorbereitung für ein zukünftiges Leben betrachtet werden. Diese Vorbereitung wurde in Form von Übungsformen angeleitet, in denen die unterschiedlichsten Textsorten nebeneinander vorkamen. So spielten auch literarische Texte wie die Fabel oder narrative wie die Erzählung eine Rolle. Konnex war die Rhetorik und damit eine kommunikative Perspektivierung: So ging es um die „Widerlegung eines gegnerischen Argumentes“, die „Stützung einer eigenen Behauptung“, „Lob“, „Tadel“ oder „Vergleich“.2 Für die argumentative Auseinandersetzung spielte vor allem die Chrie eine besondere Rolle: Sie gliedert Inhalt und Form, indem konkrete Anweisungen zu befolgen sind, die die These kontextualisieren und wiedergeben, die auffordern, die eigene Meinung kurz darstellen und durch einen Gegensatz, Vergleiche, Beispiele und Zitate zu stützen.
Neben der Chrie, auf die im Folgenden noch näher eingegangen wird, können zwei weitere rhetorische Übungen als Vorformen des argumentierenden Schreibens im Deutschunterricht gewertet werden, die thesis und die erfundene Rede. Die thesis behandelt im Sinne einer Erörterung eine allgemein strittige Frage und untersucht das Thema argumentativ. Während bei der Chrie die Gültigkeit der These vorausgesetzt wird und der Schreibende im Zuge seiner Mitteilung die Gültigkeit ausbreitet, ist bei der thesis diese erst herzustellen. Damit rückt diese Form des Schreibens in die Nähe des Philosophierens und hat im Gegensatz zu vielen anderen Übungsformen keine klaren Adressat:innen, an die sich der Text wendet. Ludwig stellt als letzte Übungsform die erfundene Rede dar: Der Schreibende muss sich in eine Person versetzen, die die Rede verfasst. Es liegt demnach nicht nur ein Thema, sondern auch eine konkrete Situation, ein Anlass, ein Ort und damit auch ein:e Adressat:in vor. Damit weist die erfundene Rede „kommunikative Bedingungen“3 auf, die erstaunliche Parallelen zur Situierung und zum Adressatenbezug des materialgestützten Schreibens zeigen. Demnach hebt die antike Rhetorik nicht allein auf die Ausprägung eines guten Stils ab, sondern betont den argumentativen Charakter, der auf die jeweiligen Adressat:innen und die Redesituation abzustimmen ist.
Die Entwicklung des Deutschunterrichts aber ist nicht allein von der Übertragung der lateinischen auf eine noch zu entwickelnde deutsche Rhetorik gekennzeichnet. Dawidowski weist auf die Bedeutung „der Sozialgeschichte des Lesens und der Herausbildung des humanistischen Denkens im späten 18. und 19. Jahrhundert“4 hin. Ebenso veränderte sich im 17. und 18. Jahrhundert auch die Schülerschaft. Es galt zunehmend nicht nur Theologen, sondern auch Gelehrte auszubilden. Setzte sich aber das Deutsche als Unterrichtssprache zunehmend durch, dann standen weniger das Erlernen der – lateinischen – Sprache und die Nachahmung eines an der sprachlichen Richtigkeit orientierten Stils im Vordergrund. Die Auseinandersetzung mit den Inhalten gewann an Bedeutung: „Zu jedem Akt des Redens oder Schreibens gehört die Tätigkeit des Sich-Äußerns, Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Ansichten, kurz alles, was sich sozusagen im Kopf des Menschen befindet“5. Das Abheben auf Gefühle und Meinungen betont hier eindeutig eine kommunikative Funktion der Rede. Die rhetorische Produktion eines Textes hob auf Adressat:innen und die Wirkung, die die Rede auf diese haben sollte, ab und demonstriert die Entwicklung vom Imitations- zum Reproduktionsaufsatz.
Bei der Ausbildung einer deutschen Rhetorik spielte Christian Weise – Zittauer Schuldirektor, Verfasser von Schulkomödien und Reformator des deutschen Gymnasiums – eine maßgebliche Rolle. Als Begründer der deutschen Oratorie forderte er vom Schreibenden den Gebrauch der Vernunft ein.6 Gleichzeitig sollte der Unterricht und damit auch die zu verfassenden Reden dem Prinzip der Nützlichkeit folgen7 und den Schülern ein – berufliches – Fortkommen ermöglichen. Dies aber ging Weises Erachtens nicht durch das Abschreiben von Mustern – der Imitation –, wie es noch üblich war. Er suchte Themen aus, die die Schüler verstehen konnten und die für sie eine Bedeutung hatten; zur Gliederung des Stoffes griff er auf das antike Chrien-Konzept zurück. Die Chrie8 – auf Deutsch Bedarf, Nutzen oder Notwendigkeit – kann als in sich schlüssige Darstellung einer These verstanden werden, die Teil einer umfangreicheren Rede ist. Ihre Bedeutung, v.a. auch für die Unterweisung von Schülern, legt Weise in seinen einleitenden Worten zum dritten Kapitel Von der CHRIA dar. Es geht ihm vor allem um eine stufenweise Erhöhung der Komplexität und der Schwierigkeiten, die auch die Entwicklung des Schülers abbilden müssen.9 Die Chrie diente der Verwendung in konkreten Redesituationen und kann somit als grammatisch-rhetorische Übung verstanden werden, die die Argumentationen in zahlreiche Einzelschritte zerlegt. Das Fundament der Chrie stellt dabei die Behauptung dar, die durch einen Beweis gestützt wird. Damit steht der argumentative Kern im Mittelpunkt. Weise reduzierte die ursprünglich aus sieben Redeteilen bestehende Chrie auf vier: „potasis (das Thema der C.), aetologia (Beweis), amplificatio (Erläuterung durch contrarium, comparatum, emxemplum, testimonium) und conclusio (Schlußfolgerung)“10. Er löste sich damit von der festen Reihenfolge der Chrienform und betonte den argumentativen Teil und die Beweisführung, die die Schüler in Schulreden übten. Dadurch wurde nicht so sehr ein bestimmter Stil imitiert, denn auf der Basis eines strukturierenden Gerüsts ein eigener inhaltlicher Zugriff ermöglicht, der weniger auf die Wirksamkeit abhob, denn die Sachgemäßheit betonte. Dass die Anwendung der Chrienform in der Schule auf Dauer zu einem Formalismus geführt hat, ist nicht zu bestreiten.11 Aktuell lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten, wenn man die Verwendung sprachlicher und struktureller Muster beim Erörtern beobachtet, die erstaunliche Parallelen zur Chrienform aufweisen und auch heutzutage noch dazu führen, einem Schema zu folgen, ohne die eigene Position zu benennen und kenntlich zu machen.12
Neben der Rede wurde auch die Briefform im Unterricht praktiziert, die ebenso einem festen Aufbau zu folgen hatte. Auch sie enthielt explizit einen Grund des Schreibens und damit eine Intention. Demnach kann man in diesem Kontext durchaus von einer kommunikativen Struktur und einem Adressatenbezug, d.h. einem appellativen Charakter, sprechen. Es gibt übrigens keine Hinweise dafür, dass das Verfassen von Briefen auf die unteren Jahrgänge beschränkt war, wie es heutzutage der Fall ist. So werden derzeitig Briefe in der Regel nur in den Klassenstufe 5/6 verfasst, der anspruchsvolle Charakter dieser Aufsatzform ist im aktuellen Deutschunterricht aus dem Blick geraten.13 Neben dem Verfassen von Reden und Briefen waren Gedichte die dritte Textsorte, mit der sich Schüler beschäftigten. Hier ging es weniger um die Darstellung von Empfindungen, denn um eine Erhöhung der Eloquenz, d.h. um die Ausprägung des eigenen Stils.
Ein weiterer Aspekt, der für das materialgestützte Schreiben relevant ist, fokussiert auf die Frage, wie Schüler:innen zu dem Wissen gelangen, das sie befähigt, über bestimmte Themen domänenspezifisch zu schreiben. Verbindlich kanonisierte Literaturlisten stellen eine Möglichkeit dar. Wird in den BS AHR der propädeutische Charakter, der zur Partizipation an Beruf und Studium befähigen soll, betont, dann müssen die inhaltlichen Voraussetzungen geklärt werden, um eine differenzierte Argumentation vorzunehmen zu können. Die Präsentation von Materialien im Rahmen des materialgestützten Schreibens stellt eine Realisierungsmöglichkeit dar. Wie aber gestaltete sich für Weise der Erwerb des Wissens und die Bereitstellung von Hintergrundinformationen im Rahmen der Textproduktion und des Verfassens einer Rede? Interessant in diesem Zusammenhang ist, die Themen in den Blick zu nehmen, zu denen Reden gehalten wurden. Nagel führt folgende Fächer bzw. Oberthemen an, die er nach der Reihenfolge ihrer Häufigkeit ordnet: „1. Geschichte, 2. Moral und Ethik, 3. schulische Tugenden und didaktische Fragen, 4. Philosophie, 5. Theologie, Religion und Kirchengeschichte, Gelegenheitsreden, Genealogie, Politik“14. Auffällig ist, dass kein genuin literarisches Themenfeld angeführt wird. Damit gleicht das Vorgehen deutlich stärker dem Verfassen einer Erörterung, das sich in der Mittelstufe auf allgemeine Fragen aus der Lebenswelt der Schüler:innen bezieht. Die Domänenspezifik beim materialgestützten Schreiben, die in der Oberstufe das Aufgabenformat bestimmt, dürfte sicherlich auch eine Rolle dabei spielen, dass es den Schülerinnen und Schülern schwerfällt, sich zu positionieren.15
Weises vorrangiges Erziehungsziel war das politische Wirken des Menschen. Er legte deshalb großen Wert auf die Verwendung des Verstandes beim Verfassen von Reden, der sowohl für das Finden von Gedanken als auch für die Verbindung der Gedanken von Bedeutung ist. Dazu griff er auf die Toplogie zurück: „Niemand kan die geringste Rede aus eigenen Kräfften aufsetzen / wen er keine Probation erdencken kan“.16 Der Rückgriff auf die aus der antiken Rhetorik bekannte Topik, die aus der Gerichtsrede hervorging,17 rückte die Lehrbarkeit des Schreibens in den Mittelpunkt. Sie kann als eine Art Stoffsammlung verstanden werden, die half, das Thema in seiner Breite und Tiefe zu erfassen. Topen sind allgemeine Gesichtspunkte, die bei der Auseinandersetzung mit einem Thema beachtet werden können. Erst nach der Sammlung des Stoffes setzte in der Disposition – die Ordnung der Gedanken – ein. Damit ist die Topik ein argumentationstheoretischer Hintergrund, mit dessen Hilfe man durch Gesetzmäßigkeiten ein Argumentationsziel erreicht. Um Auffassungen überzeugend vertreten zu können, werden Begriffsrelationen hergestellt, die den Stoff und infolgedessen auch die Argumente strukturierten. Ziel ist es, das erworbene Wissen durch thematisches Ordnen abrufen zu können.
Wie bei allen – formelhaften – Anwendungen eines Schemas, das zunächst als Unterstützung gedacht war, drohte auch bei der Umsetzung von Weises Ansatz eine Sinnentleerung des Vorgehens. So wurde der antiken Topik im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte eine zu starke Reglementierung und Klassifikation der Gedanken und damit eine Kleinschrittigkeit, z.B. bei der Umsetzung der Chrienform, vorgeworfen, die dafür sorgte, dass nicht die echte Erkenntnis – die Wahrhaftigkeit –, sondern nur die Ordnung und Strukturierung des Wissens und der Gedanken gefördert werde. Betrachtet man aber das Ziel, eine argumentativ überzeugende, an Adressat:innen orientierte Rede zu verfassen, dann stellt die Topik ein entscheidendes Hilfsmittel im didaktischen Prozess dar. Die Muster konnten als Gerüst verwendet werden, die eigenen Ideen zu strukturieren und argumentativ darzustellen.18 In diesem Zusammenhang können die im aktuellen Deutschunterricht im Umgang mit journalistischen Texten verwendeten W-Fragen als Abkömmlinge der Topik verstanden werden.
Weise griff aber nicht nur auf die Chrienform und die Topik zurück. Um den Schreibenden Hintergrundwissen zu vermitteln, forderte er die Schüler auf, mit Realien zu arbeiten. Dies sind Sammlungen von Notizen, Texten und Bildern – also Vorformen der Materialien, die heutzutage Schülerinnen und Schülern im Rahmen des materialgestützten Schreibens zur Verfügung gestellt werden. „Mit Hilfe der in der Topik zusammengestellten Gesichtspunkte und aus dem Material, das in den Kollektaneen zusammengetragen war, sollten die Schüler den Inhalt für ihre Ausarbeitung finden.“19 Kollektaneen20 – sogenannte Lesefrüchte – können in diesem Zusammenhang als Zusammenstellung unterschiedlicher Texte verstanden werden. Es kann sich dabei sowohl um handschriftliche Notizen oder gedruckte Artikel, um Bilder oder Aphorismen, Zitate oder ganze Texte handeln. Ebenso können eigene Beobachtungen festgehalten werden. Diese Zusammenstellungen existierten sowohl in privater als auch veröffentlichter Form. Anliegen dieses Sammelns war zunächst, Bestehendes zusammenzustellen und dadurch präsent zu machen. Dies war besonders aufgrund der Zunahme der Erkenntnisse der Wissenschaften notwendig geworden. Stötzer21 verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Weise Realfächer im Unterricht einführte, die die Inhalte der Naturwissenschaften, aber auch der Mathematik, der Geschichte, der Geographie und der neuen Sprachen aufnahmen. Die Realien stellten damit das Material für Redeübungen, aber auch für Reden selbst dar. Sie boten demjenigen, der etwas zu einem Thema zu verfassen hatte, Inspirationen gleichermaßen wie Hintergrundinformationen. So wurden die Schüler angehalten, selber Sammlungen anzufertigen und diese in Sammelheften festzuhalten, um für unterschiedliche Anlässe Formulierungen, Versatzstücke und Ideen zur Verfügung zu haben. Gleichzeitig lernten sie, auf Materialien im Sinne von Hintergrundinformationen zurückzugreifen. „Mit Hilfe der in der Topik zusammengestellten Gesichtspunkte und aus dem Material, das in den Kollektaneen zusammengetragen war, sollten die Schüler den Inhalt für ihre Ausarbeitung finden.“22 Realien verkörpern demnach die Einsicht, dass alles Produzierte immer auf bereits Gedachtes und Geschriebenes zurückzuführen ist und damit ein Rückgriff nicht nur legitim, sondern vor allem auch sinnvoll ist.23 Damit aber erhielten die Schüler explizit eine Unterweisung im Schreiben, das nicht nur das Gliedern der argumentativen Struktur, sondern auch das Auffinden und Verwenden von Hintergrundmaterialien beinhaltete. Dieser Herausforderung muss sich eine Didaktik des materialgestützten Schreibens aktuell stellen.
Das Anfertigen von Realien beruhte demnach auf dem Prinzip der Nachahmung ebenso wie auf der Erweiterung des eigenen Horizontes. Vor allem der erste Punkt erwies sich im Lauf der Geschichte der Rhetorik als schwierig, da mit zunehmender Bedeutung und Verwendung der Realien die floskelhafte Übernahme von Ideen und Wendungen zu- und die Eigenständigkeit der Gedanken abnahm. Immer häufiger wurden die Ausführungen des Redners von Zitaten unterbrochen und es entstanden Verweiszusammenhänge, die es erschwerten, der Rede zu folgen. Der Wert des vor allem eigenständigen Anlegens von Realien aber lag unbestritten darin, den jüngeren und unerfahreneren Redeschreibern durch die Zusammenstellung von Materialien aus den verschiedensten Bereichen Inspiration zu ermöglichen und Ideen zur Horizonterweiterung anzubieten. Weiterhin erfuhren die eigenen Gedanken durch den Rückgriff auf Realien eine Kontextualisierung.
Im Hinblick auf die Einführung des materialgestützten Schreibens sind mehre Aspekte der Rhetorik Weises von Interesse: Das Erstellen von Realien und der Umgang mit diesen nimmt, ebenso wie das Einüben der Chrienform, das Vermitteln der Schreib- und Vortragskompetenz in den Blick: Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen der Realien – hier lässt sich durchaus von Polytextualität sprechen – wurden Ideen, aber auch Zitate für die eigene Rede verwendet. Diese verfolgt zwar – im Sinne einer Adressierung – eine kommunikative Funktion, fokussierte aber primär auf den Inhalt: die Sachgemäßheit. Weise bemühte sich – im Sinne Helmers’ – um eine Ausgewogenheit der drei Aspekte beim Gestalten einer Rede. Der Verweis auf die unterschiedlichen Übungsformen legt nahe, dass das Verfassen und Halten von Reden im Unterricht selbst eine zentrale Rolle spielte. Betrachtet man den Umgang der Schüler im 18. Jahrhundert mit den Realien, dann mutet ihre Eigenverantwortlichkeit im Vergleich mit der der Schüler:innen des 21. Jahrhunderts groß an. Dies betrifft besonders die aktuell geführte Diskussion um den Grad der Verbindlichkeit, welche und wie viele der zur Verfügung gestellten Materialen genutzt werden sollen.24
Der Beginn eines Deutschunterrichts
Trotz aller Innovationen, die Weises Ansätze, die deutsche Sprache zu vermitteln, enthielten, blieben diese doch weiterhin der Rhetorik verpflichtet. Und so war das Lateinische noch im 18. Jahrhundert für den Schulbetrieb und seine Organisation maßgeblich. Das betraf die Auswahl der Lektüren und der Lehrbücher ebenso wie die Durchführung von Examina. Erst mit Hiecke wurde ein dezidierter Deutschunterricht eingeführt, der sich intensiv auch mit der Vermittlung der Literatur beschäftigte. Boueke1 betont, dass man von einem Literaturunterricht, der das Verständnis literarischer Texte in den Vordergrund stellt, erst seit dem 19. Jahrhundert sprechen kann. Davor stand eine grammatische, stilistische und rhetorische Bildung im Zentrum. In den kommenden Jahrhunderten bewegte sich der Umgang mit Literatur im Spannungsfeld einer überwiegend analytischen Auseinandersetzung – als Wegbereiter lässt hier Hiecke anführen – und eines emotionalen Zugangs, bei dem Literatur Auslöser sinnlicher und emotionaler Erlebnisse ist. Konsens aber scheint trotz großer didaktischer und methodischer Unterschiede darin zu bestehen, dass der literarische Text als Gegenstand verstanden wird, der dazu geeignet ist, den Menschen zu bilden. Vor allem für die Entwicklung eines gymnasialen Deutschunterrichts und der Betonung eines interpretativen Zugangs zur Literatur hatte Hiecke einen entscheidenden Einfluss: In seiner 1842 erschienenen Abhandlung über den Deutschunterricht betont er die Bedeutung der deutschen Lektüre, die sich nicht nur durch Gehalt auszeichnen müsse, sondern auch die Basis sämtlicher unterrichtlicher Tätigkeit bilde, „für eigne inhalts- und lebensvolle Productionen, für einen interessanten und fördernden grammatischen Unterricht, und für alle sonstige theoretische und historische Belehrung, wie Metrik, Poetik und Literaturgeschichte.“2
Wenn Hiecke die Funktionen der Bildung und in diesem Zusammenhang die Rolle des Deutschunterrichts beschreibt, dann geht es ihm im Sinne einer Allgemeinbildung um die „praktischen Fertigkeiten des guten Lesens, des Verständnisses guter Schriftsteller, des Auffindens treffender Gedanken über angemessene Aufgaben, so wie der richtigen, fließenden und zusammenhängenden mündlichen und schriftlichen Darstellung derselben“3. Im Sinne einer Kompetenzorientierung gilt es, Fähigkeiten zu vermitteln, die jeweils an literarischen Texten oder Themen eingeübt werden sollen. Bedingte somit die Abkehr vom Lateinischen als Unterrichtssprache zunächst einen Rechtfertigungszwang, sich mit deutscher Literatur auseinandersetzen zu dürfen, so legt Hiecke hier den Grundstein und die Basis für einen integrativen Deutschunterricht, wie er heutzutage üblich ist.4
Betrachtet man das Schreiben im Deutschunterricht, so fasst Hiecke dieses unter dem Begriff der „Productionen“ zusammen, wobei Produktion und Rezeption ineinandergreifen sollen. Für die Vermittlung des materialgestützten Schreibens ist interessant, dass Hiecke bei der Vermittlung des Schreibens auf den Begriff der Muster zurückgreift: „Denn die Verarbeitung des mannickfaltigen sich von außen herandrängenden Stoffes zu einer klaren und geordneten Gesammtanschauung ist immer nur möglich durch vorangegangene Bildung an Mustern solcher Verarbeitung.“5 Die durch Lehrer:innen vermittelten Muster helfen den Schreibenden, die ungeordneten Wahrnehmungen zusammenzufügen.6 Wenn Hiecke im Folgenden seine Gedanken zum Schreiben präzisiert, so entwirft er ein erstes Curriculum, das vom Beschreiben des „außer uns Befindlichen“7 ausgeht. Der nächste Schritt stellt die Beschreibung von Personen dar, es schließt sich die – reflexionslose – Schilderung von Erlebnissen an. Nach und nach kommen Themen hinzu, die nicht nur eine Beschreibung, sondern auch ein Nachdenken über das jeweilige Thema beinhalten. Während zu Beginn die Reflexion noch keine Rolle spielen soll, so wird durchaus der Lebensweltbezug betont, indem die „Beobachtungen dessen, was der Schüler um sich sieht“8, aufgenommen werden – beispielsweise in Form von Stadtbeschreibungen. Dieser Lebensweltbezug wird auch im Verfassen von Briefen deutlich; hier sollen nun auch Empfindungen zum Ausdruck gebracht werden. In den oberen Klassen nimmt der reflexive Anteil der Schreibaufgaben mehr und mehr zu. Damit bewegt sich das Schreiben im Spannungsfeld zwischen einem ästhetischen und einem eher kognitiv orientierten Schreiben. Entscheidend ist neben dem Lebensweltbezug ein Maß an Konkretheit in der Aufgabenstellung, das dafür sorgen soll, dass der Schreibende sich nicht in Allgemeinplätzen verliert: „Diese Themen sind aller der Art, daß sie dem Schüler nicht gestatten sich mit vagen Allgemeinheiten zu begnügen, daß sie ihn nöthigen sich concreter Bestimmtheiten der Sache zu bemächtigen.“9 Weiterhin ist Hiecke wichtig, dass der Aufsatz keine moralische Erziehungsinstanz darstellt.
Obwohl Hiecke mehrfach auf die Bedeutung der Literatur für den Schreibprozess abhebt, gibt es doch zahlreiche Themen, die unabhängig von den Inhalten des Literaturunterrichts sind, beispielsweise das Schreiben „über die Abhängigkeit der Lebensweise von der Berufsthätigkeit“10 oder das „Poetische des Krieges“11. Verweist Hiecke auf fächerverbindende Aufgaben, dann wird deutlich, dass den Schülern für das Schreiben zwar nicht explizit Materialien zur Verfügung gestellt werden. Es wird jedoch vorausgesetzt, „daß der Schüler bei dem der Ausarbeitung vorhergehenden Suchen nach concreten Belegen auf ein Material stößt, das ein vorzüglich lebendiges Interesse einzuflößen geeignet ist.“12 Im Zusammenhang mit der Einführung der Textsorten ist es Hiecke wichtig, dass eine Reduktion vorgenommen wird. So soll nur mit wenigen Formen gearbeitet werden, diese sollen aber im Unterricht eingeübt werden. Hiecke postuliert hier demnach eine Transparenz der Anforderungen13 und eine Lehrbarkeit des Schreibens gleichermaßen, die sich auch in einer Planungsphase abbildet. Zu dieser zählt er die Stoffsuche, das Exzerpieren, das Ordnen und Anführen von Belegen. Dass es sich beim Schreiben tatsächlich um einen Prozess handelt, macht nicht nur die curriculare Darstellung der Schreibanlässe und der Themen deutlich. Ebenso fordert Hiecke dazu auf, die Schreibhefte aufzuheben und die Entwicklung des Schreibens in Bezug auf eine inhaltliche wie formale Gestaltung zu dokumentieren.14 Der Schreibprozess wird durch die Phase der Überarbeitung abgeschlossen. Auch diese konkretisiert Hiecke, indem er darauf abhebt, wie die Aufsätze graphisch zu verfassen seien, damit Änderungen eingefügt werden können.15
Zusammenfassend ist Hiecke als Wegbereiter eines eigenständigen Deutschunterrichts zu werten, der nicht nur ein Curriculum der zu lesenden Texte, sondern auch der zu verfassenden Texte entwickelt hat. Damit ist eine eindeutige Zäsur von einem Unterricht, der sich an der antiken Rhetorik orientierte, festzustellen. Durch das Fokussieren auf eigene Textformen, die im Deutschunterricht verfasst werden sollen, wurde die Grundlage für Aufsatzformate gelegt, die auch aktuell noch den Deutschunterricht prägen. Ausgehend von einer Beschäftigung mit der Literatur stand die gemeinsame Erarbeitung des Aufsatzes im Zentrum. Ist das Maß an Selbstständigkeit bei den Schülern als deutlich höher als beim Imitationsaufsatz zu bewerten, so steht doch das Erfassen der Literatur und ihre Analyse fortan im Zentrum. Der Grundstein des Interpretationsaufsatzes16 ist gelegt, der die Geschichte des deutschen Aufsatzes bis heute maßgeblich prägt. Damit aber rücken die kommunikative Funktion und die Wirksamkeit des Textes in den Hintergrund. Der Leser selbst und seine Bewertung treten hinter den literarischen Text zurück. Argumentative, explizit auf Adressat:innen abhebende Fähigkeiten, wie sie beim materialgestützten Schreiben gefordert werden und im Rahmen der Rhetorik noch gelehrt wurden, spielen keine entscheidende Rolle mehr. Versucht man eine Zusammenfassung der Ausführungen, so weist der schriftliche Unterricht drei zentrale Entwicklungslinien auf: Das Durchsetzen der deutschen Sprache und die abnehmende Bedeutung des Lateinischen, die „Abwertung des Mündlichen gegenüber dem Schriftlichen“17 und der ab ca. 1770 sich etablierende „selbstständige Schüleraufsatz, welcher mit sich brachte, dass sich im Schriftlichen immer mehr Stilformen verbreiteten und so das Primat der Schriftlichkeit gegenüber der Mündlichkeit verstärkt wurde.“18
Aufsatzformen im 20. Jahrhundert
Das 20. Jahrhundert ist von verschiedenen Strömungen der Literaturdidaktik geprägt, die ihre Ursprünge zum einen in der Literaturwissenschaft, aber vor allem auch in den historischen Ereignissen haben. Es kann an dieser Stelle keine Rekonstruktion der Literaturdidaktik des 20. Jahrhunderts vorgenommen werden, vielmehr soll auf einzelne Strömungen und Ansätze eingegangen werden, die Grundgedanken des materialgestützten Schreibens beinhalten. Wenn man versucht, den Einfluss der Reformpädagogik auf den Deutsch- und den Aufsatzunterricht einzuschätzen, dann steht im Zentrum der Veränderungen die Rolle, die der Mensch im Allgemeinen und das Kind im Besonderen einnimmt. Weniger der Intellekt, denn die Persönlichkeit und deren Ausprägung standen und stehen im Mittelpunkt. Ihrer Entwicklung sollte sich auch der Deutschunterricht annehmen: „Das Aufkommen des Kriteriums der Wahrhaftigkeit ist identisch mit dem Entstehen der Pädagogik.“1 Mit dieser Verschiebung war eine Ablehnung alter Aufsatzformen verbunden, die eine an der Rhetorik orientierte, auf festen Mustern und Phrasen basierende Auseinandersetzung mit Literatur beinhaltete. Ziel war der ungebundene Aufsatz. Damit fand eine Weiterentwicklung vom Reproduktions- zum Produktionsaufsatz statt, der auf den Sprecher und seine Wahrhaftigkeit fokussiert.
Während in der Kunsterziehungsbewegung die Erlebniskraft des Kindes und seine eigene Gestaltung entscheidend waren, das schreibende Kind demnach zum Schriftsteller werden sollte, findet man in dieser Zeit Ursprünge nicht nur des Kreativen, sondern auch des Literarischen Schreibens. Um diesen Ansatz der Ausbildung einer Persönlichkeit umsetzen zu können, waren Themen notwendig, zu denen das Kind eine persönliche Beziehung hatte. Dieser Anspruch an das Stellen von Lern- und Leistungsaufgaben ist für die zeitgenössische Aufgabenkultur maßgeblich und findet sich in den aktuellen Bildungsstandards, in denen es heißt, dass das Fach Deutsch die Schüler:innen zur „Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben“ befähigen solle.2
Ludwig hebt darauf ab, dass sich nach dem 2. Weltkrieg v.a. der sprachgestaltende Ansatz3 durchgesetzt hat, der zur Kanonisierung der Aufsatzformen und der Entwicklung eines Lehrplans geführt hat. Üblich waren nun die Formen des Berichts, der Erzählung, Beschreibung, Schilderung, Abhandlung und Betrachtung. Die jeweilige Einführung und unterrichtliche Umsetzung war an den entwicklungspsychologischen Stand des Kindes gekoppelt.4 Sanner unterteilt die Geschichte des Aufsatzes in den gebundenen, den freien und den sprachgestaltenden Aufsatz.5 Entscheidend ist, dass Sanner, der selbst dem sprachgestaltenden Ansatz verpflichtet ist, auf die kommunikativen Absichten der Schreiber:innen abhebt: In diesem Zusammenhang verweist er auf den lebensweltlichen Bezug, der vor allem durch die Reformpädagogen mit der Ausprägung des Aufsatzes relevant geworden ist. Sanner geht kritisch auf die Unterteilung der zu schreibenden Texte ein, die er unter dem Begriff der Darstellungsformen subsumiert. Sie führen vor allem zur Verwirrung der Schüler:innen sowie der didaktischen und methodischen Notwendigkeit, die jeweiligen Formate einzuführen und gegeneinander abzugrenzen. Dabei sind für ihn nicht stilistische Aspekte entscheidend, sondern die Absicht, die der Text verfolgt.
Entscheidend ist also, ob ich informieren, in Kenntnis setzen will (dann berichte ich), ob ich durch sprachliche Vergegenwärtigung ein inneres Beteiligtsein des Zuhörens im Sinne von Spannung und Lösung erstrebe (dann erzähle ich), ob ich im weitesten Sinne belehren will (dann beschreibe ich), oder ob ich meinen Eindruck und mein inneres Gestimmtsein anläßlich der Darstellung eines Zustandes oder Vorgangs zum Ausdruck bringen möchte (dann schildere ich).6
Durch die Fokussierung auf die kommunikativen Funktionen wird zwar die Rolle der Schreibenden verstärkt in den Blick genommen. Es geht aber nicht um seine subjektive Wahrnehmung der Wirklichkeit, sondern um seine Beziehung zum Inhalt.
Sanner setzt sich kritisch mit der Prüfung und Bewertung von Texten auseinander, in denen Schüler:innen auch eigene Gedanken und damit das eigene Weltverständnis zum Ausdruck bringen, und er thematisiert die Beurteilung des subjektiven und damit persönlichen Anteils der Texte und die Problematik, sie „ihrem inneren Wert entsprechend einzuschätzen“7. Um objektives, an Themen gebundenes Schreiben zu fördern, verweist er auf Texte, die in anderen Fächern verfasst werden und die damit sachlicher sind. Auch sie können zur Bewertung herangezogen werden. Hier findet demnach keine Abgrenzung von Fächern, sondern ein Herstellen von Synergieeffekten statt. Es wird deutlich, dass die Aufsatzformen nicht einfach abzuprüfende Formen sind, die bestimmten Mustern zu folgen haben. Sie nehmen vielmehr eine Funktion wahr, die sich sowohl an den Adressat:innen als auch an Absender:innen orientiert. Zentral ist damit, in welcher Beziehung Schreibende zum Inhalt stehen.
Um einschätzen zu können, wie das materialgestützte Schreiben in die Geschichte des deutschen Aufsatzes eingeordnet werden kann und welche möglichen Vorläufer es gibt, soll noch einmal auf Helmers’ Unterteilung zurückgegriffen werden: Während der Imitationsaufsatz sich an der vorgegebenen Form und Struktur orientiert und von Schreibenden keine eigene, bzw. nur eine stark zurückgenommene Stellungnahme erfordert, ist die Einführung des Reproduktionsaufsatzes eng mit der Aufgabe des Lateinischen als Schulsprache und der Abkehr von der Imitation der antiken Rhetorik verbunden: „Der letzte Grund für die Verdrängung der Imitation durch die Reproduktion lag zweifellos in der Tatsache, daß das für die Nachahmung erforderliche absolute Stilvorbild fehlte.“8 Das Deutsche war nun nicht nur Bildungs- und Unterrichtssprache, sondern auch Alltagssprache. Der Produktionsaufsatz wurde mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam im Unterricht erarbeitet. Dass im Anschluss an den Imitationsaufsatz neue Themen und damit auch die deutsche Literatur Einzug in den Deutschunterricht fanden, ist Hiecke maßgeblich zu verdanken. Im Produktionsaufsatz nimmt das Maß der Selbstständigkeit und vor allem der Selbstbestimmung der Schüler:innen weiter zu. Der Grad der Subjektivität steigt ebenso wie die Anforderung an die Themenstellung: „Es ist klar, daß die Produktion nur bei solchen Themen zu fordern ist, die dem Schüler einen freien Entfaltungsraum sichern.“9
Die Einführung einer neuen Aufsatzform
Das Format des materialgestützten Schreibens bewegt sich sowohl im Spannungsfeld dieser drei Aufsatzformen als auch zwischen den drei Gestaltungsformen der Wirksamkeit, der Sachgemäßheit und der Wahrhaftigkeit. Die damit verbundenen Ansprüche an die Schüler:innen einerseits und die Schreibdidaktik andererseits stellen gleichermaßen Chancen wie Herausforderungen dar, ein zeitgenössisches, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ansprüchen angepasstes, authentisches Schreiben in den Blick zu nehmen. So beinhaltet das materialgestützte Schreiben das Erfordernis, einen eigenständigen Text auf der Basis der vorgegebenen Materialien, wozu auch literarische Texte zählen, zu produzieren, in dessen Zentrum der argumentative Standpunkt der Verfasserin bzw. des Verfassers deutlich wird. Die Materialien müssen jedoch nicht nur verstanden, analysiert und ausgewertet werden, sondern auch für die eigene Textproduktion, die die Adressierung ebenso wie die Intention des Zieltextes in den Blick nimmt, nutzbar gemacht und somit transformiert werden. Damit positioniert sich das materialgestützte Schreiben in der Nähe des Produktionsaufsatzes.
Betrachtet man die aktuell im Deutschunterricht der Oberstufe zu verfassenden Aufsatzarten, dominiert die vollständige Analyse und Interpretation von literarischen Texten. Diese Textformen erfordern in Bezug auf das Material – den literarischen Text – in der Regel nur selten eine Reduktion. Auch das Setzen von eigenen Schwerpunkten ist in geringerem Maße erforderlich als beim materialgestützten Schreiben. Für die Schreibenden sind beim Interpretieren in Bezug auf die Sachgemäßheit die Anforderungen weitgehend transparent: Der Inhalt des Textes bzw. des Textausschnittes soll in seiner Gänze erfasst und wiedergegeben werden. Zur Bewertung der Schreibprodukte werden überwiegend literaturwissenschaftliche Aspekte herangezogen. Die Lehrkraft ist in der Mehrzahl der Aufgaben die alleinige Adressatin, der zu schreibende Text muss keine kommunikative Funktion aufweisen. Die polytextuelle Materialfülle beim materialgestützten Schreiben hingegen erfordert andere Texterschließungs- und Formulierungskompetenzen. Basierend auf der Auseinandersetzung mit den in den Materialien vertretenen Positionen muss der Schreibende eine eigene Haltung zum Inhalt entwickeln und diese argumentativ nachvollziehbar und glaubhaft vertreten.
Im Zentrum einer argumentierenden, materialgestützten Schreibaufgabe steht die Stellungnahme zu einem strittigen Thema: Die vorgegebenen Materialien entfalten diesen Diskurs thematisch und bieten die Grundlage für eine geforderte – inhaltliche – Stellungnahme. Damit die Schüler:innen sich aber innerhalb dieses Diskurses glaubhaft und nachvollziehbar positionieren können, ist es wichtig, dass die Aufgaben einen hohen Lebensweltbezug aufweisen. Steht die Argumentation im Mittelpunkt, dann muss im Unterricht auch das Argumentieren gelehrt und geübt werden. Hierzu bieten sich Übungsformen wie die Chrie ebenso an wie Muster, die vorgeben, wie eine Argumentation aussehen könnte. Hier geht es weniger um das Imitieren, denn das Lehren von Schreibgerüsten, die die Schreibenden dazu befähigen, sich selbstständig mit einem Thema auseinandersetzen und differenziert Stellung beziehen zu können. Damit aber müssen das Schreiben und das Vermitteln der dazu nötigen Kompetenzen und Muster, wie es in der Rhetorik lange Zeit üblich war, wieder verstärkt in den Blick genommen werden. Unterteilt Ludwig den Schreibunterricht in die drei Formen des Schreib-, Stil- und Aufsatzunterrichts, so wird deutlich, dass Instruktionen zum materialgestützten Schreiben sich nicht allein darauf beschränken können, „die Organisation ganzer Texte“ in den Blick zu nehmen. Ebenso ist es erforderlich, „die schriftliche Formulierung von Ausdrücken“1, die Ludwig dem Stilunterricht zuordnet, zu berücksichtigen. Wenn Ludwig kritisch anmerkt, dass sich der Aufsatzunterricht nicht auf die Vermittlung einiger weniger Aufsatzformen beschränken dürfe, da der Zusammenhang zwischen den drei Formen verloren ginge, dann ist diese Forderung im Hinblick auf die Einführung und Etablierung des materialgestützten Schreibens aktueller denn je.
Eine große Neuerung beim materialgestützten Schreiben stellt die Vorgabe des Zieltextes und der Adressat:innen und damit die Situierung des Schreibens dar. Dadurch spielt vor allem die Wirksamkeit eine zentrale Rolle. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Textsorten näher, so nehmen diese in der Regel selten nur eine einzige Funktion wahr: So soll beispielsweise ein offener Brief an die Intendantin eines Theaters, der zur Aktualität des eines Theaterstückes Stellung nimmt, nicht nur informieren. Der Text muss unterhalten, den Leser der (fiktiven) Zeitung für sich gewinnen, zum Nachdenken anregen, sich positionieren und überzeugen. Die kommunikativen Funktionen, die die Intention des Mitteilenden und die Erwartungen des Lesers berücksichtigen, spielen damit eine entscheidende Rolle. Um einen in dieser Hinsicht wirksamen Text produzieren zu können, bedarf es eines Deutschunterrichts, der das Schreiben thematisiert, dieses im Unterricht stattfinden lässt und den Schülerinnen und Schülern Muster zum Üben anbietet. In Bezug auf die Zieltextsorten bliebe zudem kritisch zu diskutieren, ob es sich hierbei um gebundene oder freie Aufsatzformen handelt und wie das jeweilige Textsortenwissen vermittelt werden kann. Die in neuerlichen Veröffentlichungen v.a. zu unterrichtlichen Umsetzungen zum materialgestützten Schreiben vorgenommene Fokussierung auf den Kommentar als Zieltextsorte scheint eine solche Einschätzung vor allem in Hinblick auf eine Anforderungstransparenz nahezulegen. Sowohl im Hinblick auf die Zieltextsorte als auch die verwendeten Formen der Argumentation stellt sich die Frage, ob nicht Schüler:innen auch über Fähigkeiten der Imitation verfügen müssen. Aus Sicht der Didaktik bliebe weiterhin zu diskutieren, ob den Lernenden nicht Schemata zur Verfügung gestellt werden müssen, die zum Argumentieren anleiten und die geforderten kommunikativen Funktionen vor allem der Positionierung und der Überzeugung lehren. Die Deutschdidaktik muss sich demnach der Aufgabe stellen, die Vermittlung von Schreibkompetenzen verstärkt in den Blick zu nehmen, da für den Deutschunterricht der Oberstufe auch heute vielfach noch gilt, was Ludwig bereits 1996 pointiert feststellte: „Daß auch in der reformierten Oberstufe unserer Schulen noch geschrieben wird, vielleicht sogar viel geschrieben wird, dürfte kaum zu bestreiten sein. Ob Schreiben aber auch gelehrt wird, d.h. Gegenstand von Unterricht ist, das ist die Frage.“2
I.3Das materialgestützte Schreiben im Rahmen schulischer Textformen und Aufgabenarten
I.3.1Die Interpretation
„Eine Interpretation ohne ein gewisses Maß an Kreativität würde unseren Interessen und Zielen nicht dienen, weil sie auf nichts anderes als eine Wiederholung des interpretierten Textes hinauslaufen müsste. Interpretationen sind entweder kreativ oder überflüssig.“1 Obwohl das Interpretieren eine zentrale Tätigkeit und ein Aufgabenformat des Deutschunterrichts in der Mittel- und Oberstufe darstellt, verweist Wieser zutreffend darauf, dass das unterrichtliche Tun häufig sehr unterschiedlich ist, wenn Schüler:innen Interpretationskompetenzen erlangen.2 Das liegt auch in dem Umstand begründet, dass es sich beim Interpretieren ebenso wie beim Erörtern um einen Makrooperator handelt, der unterschiedliche Teilhandlungen beinhaltet. Zudem ist die Interpretation Textform und Aufgabenformat in einem, was nötig macht, die „dialektische Verschränkung von Konstruktions- bzw. Such- und Prüfprozessen beim Interpretieren“3 in den Blick zu nehmen. Wenn es um die Einführung und Etablierung des materialgestützten Schreibens als neuem Aufsatzformat geht, dann stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche theoretischen und didaktischen Überschneidungen zwischen dem Interpretieren und dem materialgestützten Schreiben existieren. Es gilt zu klären, was die entscheidenden theoretischen, der Interpretation zugrundeliegenden Konzepte sind, die als Ausgangspunkt für didaktische Schreibmodelle dienen können, die im Kontext des materialgestützten Schreibens zum Einsatz kommen.
Im Rahmen dieses Kapitels wird es nicht möglich sein, eine umfassende Einführung in die Theorie der Interpretation und der entsprechenden didaktischen Konzepte vorzunehmen. Vielmehr sollen einzelne theoretische Positionen skizziert werden, die ermöglichen, das Format des materialgestützten Schreibens einzuordnen sowie vom Interpretieren abzugrenzen. Dabei soll zunächst der Begriff der Interpretation allgemein gefasst werden, um diesen dann im nächsten Schritt auf das Interpretieren im Literaturunterricht zu beziehen. „Eine wichtige Aufgabe der Interpretationstheorie besteht darin, typische Ziele des Interpretierens zu identifizieren und für ihre Angemessenheit zu argumentieren.“4 Sowohl der Reader Moderne Interpretationstheorien als auch der Tagungsband Interpretationskulturen demonstrieren dabei im Nebeneinander der unterschiedlichen Theorien die Ambivalenz und Brüchigkeit des Interpretierens. Ziel ist es demnach, die jeweiligen Ansätze hinsichtlich ihrer didaktischen und unterrichtlichen Konsequenzen zu befragen.