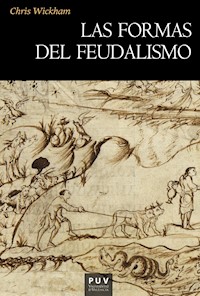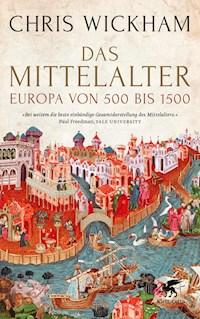
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Bei weitem die beste einbändige Gesamtdarstellung des Mittelalters.« Paul Freedman, Yale University 1000 Jahre europäisches Mittelalter: Souverän schildert und deutet Chris Wickham eine der bedeutendsten weltgeschichtlichen Epochen neu. Eine ebenso präzise wie grandiose Darstellung eines Jahrtausends, das uns bis heute prägt. Zwischen dem Zusammenbruch des weströmischen Reichs und der Reformation liegt eine 1000-jährige Periode gewaltiger Umwälzungen. In einer elegant geschriebenen, umfassenden Darstellung präsentiert Chris Wickham das europäische Mittelalter als eine Epoche gewaltigen Tatendrangs und tiefgreifenden Wandels. Stilsicher und klar erklärt er die wichtigsten Veränderungen in den einzelnen Jahrhunderten, zu denen so zentrale Krisen und Ereignisse wie der Untergang des weströmischen Reichs, die Reformen Karls des Großen, die feudale Revolution, die Zerstörung des byzantinischen Reich und das entsetzliche Wüten der Pest gehören. Mit erhellenden Momentaufnahmen unterstreicht Wickham, wie sich die verändernden sozialen, ökonomischen und politischen Umstände auf das Alltagsleben der Menschen und auf internationale Ereignisse auswirkten. Der Autor bietet sowohl eine neue Interpretation des europäischen Mittelalters als auch eine provokative neue These, inwiefern und warum das Mittelalter bis in unsere Gegenwart hineinwirkt. Eine der fesselndsten Darstellungen des mittelalterlichen Europa seit Jahrzehnten und ein intellektuelles Abenteuer. »Das ist genau das Mittelalter, das wir im 21. Jahrhundert kennenlernen müssen.« John Arnold, University of Cambridge
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1039
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Chris Wickham
DASMITTELALTER
EUROPA VON 500 BIS 1500
Aus dem Englischen von Susanne Held
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Medieval Europe« im Verlag Yale University Press, New Haven und London
© 2016 by Chris Wickham
Für die deutsche Ausgabe
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos und Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © Picture Alliance / CPA Media (Italy / China: Marco Polo sailing from Venice in 1271)
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96208-6
E-Book: ISBN 978-3-608-11028-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
1 Ein neuer Blick auf das Mittelalter
2 Rom und seine Nachfolger im Westen, 500–750
3 Krise und Wandel im Osten, 500–850/1000
4 Das karolingische Experiment, 750–1000
5 Die Expansion des christlichen Europa, 500–1100
6 Die Umformung Europas, 1000–1150
7 Der lange Wirtschaftsaufschwung, 950–1300
8 Die Zwiespältigkeiten politischen Neuaufbaus, 1150–1300
9 1204: Aus Mangel an Alternativen
10 Definitionen einer Gesellschaft: Gender und Gemeinschaft im spätmittelalterlichen Europa
11 Geld, Krieg und Tod, 1350–1500
12 Politik wird neu gedacht, 1350–1500
13 Schluss
Anhang
Anmerkungen
Bibliographie
Abkürzungen
Dank
Karten
Verzeichnis der Abbildungen und Karten
Abbildungen
Karten
Register
Tafelteil
1
Ein neuer Blick auf das Mittelalter
Dieses Buch handelt vom Wandel. Die Epoche, die wir als »Mittelalter(1)« bezeichnen, dauerte tausend Jahre, von 500 bis 1500; und Europa(1), das Thema dieses Buchs, sah nach dieser Periode völlig anders aus als zu deren Beginn. Den Anfang beherrschte das römische Imperium(1), das die eine Hälfte Europas(2) unter sich vereinte, sie aber zugleich auch scharf von der anderen Hälfte abtrennte; ein Jahrtausend später hatte Europa(3) die komplizierte Form angenommen, die es seither prägt: mit der Vielzahl von Staaten(1) in ihrer noch heute mehr oder weniger ausgeprägten, jedenfalls erkennbaren Form. Ich möchte mit diesem Buch zeigen, wie sich dieser Wandel und viele andere Wandlungsprozesse vollzogen und inwiefern sie von Bedeutung sind. Aber ich möchte mich nicht auf die Ergebnisse konzentrieren. Viele Autoren, die sich mit dem Mittelalter(2) befassten, richteten ihr Augenmerk vor allem auf die Ursprünge dieser »National«-Staaten(2) oder auf andere Aspekte dessen, was sie als »Moderne« ansahen. Für solche Autoren erhält die Periode ihren Sinn aufgrund der damit verbundenen Ergebnisse. Ich halte das für einen gravierenden Irrtum. Die Geschichte ist nicht teleologisch: Das heißt, historische Entwicklung bewegt sich nicht auf etwas zu, sondern sie geht von etwas aus. Außerdem kann ich, was mich betrifft, sagen: Die Zeit des Mittelalters, die so voller Energie war, ist an und für sich interessant; sie hat es nicht nötig, in das Raster irgendwelcher späteren Entwicklungen gepresst zu werden. Ich hoffe, mein Buch kann das vermitteln.
Aber das bedeutet nicht, dass die Geschichte des europäischen(4) Mittelalters einfach nur aus durcheinanderwirbelnden Ereignissen bestanden hätte, deren Muster keinerlei Struktur aufwiesen – außer als Bestandteile eines beliebig ausgewählten Jahrtausends. Das Gegenteil ist der Fall. Das Mittelalter(3) zeichnet sich durch mehrere deutlich markierte Momente des Wandels aus; sie sind es, die der Epoche Form geben. Die wichtigsten Momente dieses Wandels sind meines Erachtens folgende – und ihnen allen ist jeweils ein Kapitel in diesem Buch gewidmet: der Untergang des Römischen Reichs(2) im Westen im 5. Jahrhundert; die Krise(1) des Reichs im Osten, als es im 7. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Islam(1) konfrontiert wurde; die Eindringlichkeit des karolingischen Experiments in einer im großen Maßstab moralisch(1) orientierten Regierung im späten 8. und im 9. Jahrhundert; die Ausdehnung des Christentums(1) in Nord- und Osteuropa (vor allem im 10. Jahrhundert); die radikale Dezentralisierung politischer(1) Macht(1) im Westen im 11. Jahrhundert; das demographische(1) und ökonomische(1) Wachstum im 10. und bis zum 13. Jahrhundert; der Wiederaufbau politischer(2) und religiöser Macht im Westen im 12. und 13. Jahrhundert; das Schwinden der Macht von Byzanz(1) zur selben Zeit; der Schwarze Tod(1) und die Herausbildung von Staatsgefügen im 14. Jahrhundert; und das Aufkommen des Engagements breiterer Bevölkerungsschichten zusammen mit der Entstehung von Öffentlichkeit(1) im späten 14. und im 15. Jahrhundert. All diese Wendepunkte wurden durch mehrere strukturelle Entwicklungen verbunden: Dazu gehören unter anderen die Rücknahme und Neuerfindung von Konzeptionen öffentlicher(2) Machtausübung(2); die Verschiebung der materiellen Mittel, die – von der Steuereinziehung(1) zum Landbesitz(1) und wieder zurück – den politischen(3) Systemen zur Verfügung standen; der sich wandelnde Einfluss der Schrift(1) auf die politische(4) Kultur(1); und, in der zweiten Hälfte des Mittelalters(4), die Zunahme formalisierter, bindender Strukturen lokaler Macht(3) und Identität(1), wodurch die Umgangsformen zwischen Herrschern und dem von ihnen regierten Volk verändert wurden. Auch das soll in diesem Buch ausgiebig behandelt werden.
Ein Buch dieses Umfangs kann sich nicht detailliert auf die Mikrogeschichte von Gesellschaften oder Kulturen(2) einlassen; auch kann es keine auf einzelne Länder bezogenen, detaillierten Darstellungen der Ereignisse liefern. Ich biete eine Interpretation des Mittelalters(5), keine lehrbuchmäßige Darstellung – davon gibt es bereits viele: teilweise ganz exzellente Veröffentlichungen, denen nicht noch eine weitere hinzugefügt werden muss.1 Natürlich beginne ich jedes Kapitel mit kurzen Darstellungen der politischen(5) Ereignisse, um meine Argumente in einen Kontext zu stellen – vor allem für jene Leser, die zum ersten Mal in Kontakt mit dem Mittelalter(6) kommen. Doch ich beabsichtige, mich auf die Momente des Wandels und auf die übergreifenden Strukturen zu konzentrieren, um zu zeigen, was meiner Ansicht nach für die Epoche des Mittelalters am charakteristischsten war, wodurch diese Zeit interessant wird; und diese Momente und Strukturen liefern auch die Grundlagen für das, was folgt.
Meine Zusammenstellung solcher Momente des Wandels ergibt außerdem eine andere historische Verlaufslinie im Vergleich zu derjenigen, die offenbar – sei es explizit, sei es implizit – in nur allzu vielen Darstellungen des Mittelalters(7) den Inhalt vorgibt. Eine weit verbreitete Interpretation versteht Europa(5) sogar noch heute in dem Sinn, dass es mit der »Gregorianischen Reform(1)« im 11. Jahrhundert aus einer Phase des Verfalls emporstieg; dass es mit der »Renaissance(1) des 12. Jahrhunderts« aus der Unwissenheit auftauchte; mit der flämischen Tuchherstellung(1) und dem venezianischen(1) Schiffshandel(1)(1) aus der Armut; aus politischer(6) Schwäche mit der Gründung von (National-)Staaten(3) durch Heinrich II.(1) und Eduard (1)I. in England(1), durch Philipp II.(1) und Ludwig IX.(1) in Frankreich(1), durch Alfons VI. und Ferdinand(1)III. [Fernando el Santo] in Kastilien(1); um schließlich im 12. und 13. Jahrhundert, im sogenannten »Hochmittelalter(8)«, seinen Gipfelpunkt zu erreichen: mit Kreuzzügen(1), dem Ritterwesen(1), mit gotischen(1) Kathedralen(1), der Herrschaft(1) des Papstes(1), der Universität(1)(1) von Paris(1), den Märkten(1) der Champagne(1)(1). Im Kontrast dazu durchleben dann die Jahrzehnte und Jahrhunderte nach 1350 wieder einen »Niedergang«, mit Pest(1)(1), Krieg, Schisma(1) und kultureller Verunsicherung, bis schließlich der Humanismus und eine radikale Kirchenreform(1) alles wieder ins Lot bringen. Dieses Narrativ kommt in diesem Buch nicht vor, da es eine verzerrte Darstellung des Spätmittelalters bietet und das Frühmittelalter und Byzanz(2) komplett ausblendet; außerdem ist viel zu viel an dieser Konstruktion dem Wunsch geschuldet, das Mittelalter(9), zumindest jenes nach 1050, zu einem »echten« Bestandteil der Moderne zu machen, was ich bereits früher kritisiert habe. Diese Sichtweise ist auch das verborgene Erbe jenes alten Anspruchs gegenüber der Geschichtswissenschaft, sie möge moralische(2) Lehren erteilen, bewunderungswürdige Perioden, Helden und Schurken vor Augen führen – ein Ziel, von dem Historiker zwar behaupten, sie hätten sich davon verabschiedet, was aber häufig tatsächlich nicht der Fall ist.
Eine dergestalt moralisierende Sicht leitet sich für viele aus dem Wort »mittelalterlich(10)« selbst ab. Das Wort hat eine interessante Geschichte; von Beginn an war es negativ besetzt, und häufig änderte sich daran auch nichts. Seit den Zeiten der römischen Republik bezeichneten sich die Menschen immer wieder als »modern« – lateinisch(1)moderni – und die, die vor ihnen waren, als antiqui, »alt«. Im 14. und 15. Jahrhundert breitete sich unter einigen Intellektuellen(1), den von uns so genannten Humanisten(1), die Gewohnheit aus, das Wort »antiqui« auf die klassischen Autoren des Römischen Reichs(3) und dessen Vorläufer zu beziehen, in denen diese Intellektuellen(2) ihre eigentlichen Vorfahren sahen – im Unterschied zu den als minderwertig(1) angesehenen Autoren des dazwischenliegenden Jahrtausends, das im 17. Jahrhundert immer nachdrücklicher zurückgestuft und infolgedessen medium aevum, das Zeitalter dazwischen, das »Mittelalter(11)« genannt wurde. Der Gebrauch des Begriffs setzte sich dann vor allem im 19. Jahrhundert durch, und er breitete sich auf alles aus: Man sprach von »mittelalterlicher« Regierung, »mittelalterlicher« Wirtschaft, der »mittelalterlichen« Kirche(2) und so weiter, was – ebenfalls im 19. Jahrhundert – deutlich gegen das Zeitalter der Renaissance(2) abgesetzt wurde, von welchem die »moderne« Geschichte angeblich ihren Ausgang nahm.2 Die Zeit des Mittelalters(12) konnte damit als »Betriebsunfall« abgetan werden, als eine Art Rosstäuschertrick, der von einigen wenigen Gelehrten an der Zukunft verübt wurde. Diese Vorstellung wurde allerdings, während sich immer mehr Schichten von »Modernität« aufbauten, zu einem wirkmächtigen Bild.
Als die Geschichtsschreibung(1) dann seit den 1880er Jahren stärker professionalisiert(1) wurde und sich Spezialisierungen für einzelne Perioden herausbildeten, gewann auch die mittelalterliche(13) Vergangenheit ein positiveres Image. Manches daran war eher defensiver Natur, beispielsweise die Behauptungen von Spezialisten, es habe in diversen mittelalterlichen Jahrhunderten bereits eigenständige »Renaissancen« gegeben, die dann ihre Periode in den Augen herablassender moderner Zeitgenossen legitimieren konnten: die »Renaissance(3) des 12. Jahrhunderts« oder auch die »Karolingische Renaissance«. Manches war von echtem, teilweise feurigem Enthusiasmus geprägt, so etwa wenn katholische(1) Historiker die religiöse Unverdorbenheit des Mittelalters rühmten oder nationalistische Historiker sich auf die grundsätzlich mittelalterlichen Wurzeln der grundsätzlich überlegenen Identität(2) ihrer je eigenen Nationen konzentrierten. Die Epoche des Mittelalters(14), lang vergangen und teilweise nur spärlich dokumentiert, wurde hier zum phantasierten Ursprung aller möglichen Sehnsüchte des 20. Jahrhunderts – ebenso fiktional wie die rhetorischen(1) Elaborate der Humanisten(2).
Doch man leistete andererseits im 20. Jahrhundert auch harte empirische Arbeit. Damit geriet die Komplexität und Faszination des Mittelalters(15) zunehmend klar in den Blick. Mittelalter-Historiker schulden der Voreingenommenheit nationalistischer Geschichtsschreibung(2) häufig mehr, als sie bereit sind zuzugestehen. Es gilt nach wie vor, dass englische(2) Historiker eher geneigt sind, das Erstarken des englischen(3) Staates(4) in den Mittelpunkt zu stellen – des ersten Nationalstaats in Europa(6), ein echtes Alleinstellungsmerkmal ihres Landes. Deutsche Historiker plagen sich mit dem Begriff des Sonderwegs ab, der angeblich verhinderte, dass sich in ihrem Land ein vergleichbares Modell herausbilden konnte. Die Italiener(1) schließlich beurteilen die Zerschlagung des Königreichs Italien mit Gleichmut, weil sie den italienischen(2) Städten und mit ihnen der Bürgerkultur Autonomie verschaffte, die zur (für italienische(3) Historiker höchst italienischen(4)) Renaissance(4) führte.3 Doch hat sich die Arbeit auf dem Gebiet der Mittelalterforschung(16) mittlerweile zu einer solchen Gründlichkeit und Differenziertheit entwickelt, dass es zu diesen Auffassungen auch Alternativen gibt, und wir sind eher imstande, sie zu überwinden.
Damit ist zwar ein Problem gelöst, gleichzeitig aber ein anderes aufgeworfen. Wenn wir im Mittelalter(17) nicht mehr eine lange, dunkle Phase der Willkürgewalt(1), der Unwissenheit und des Aberglaubens sehen – was unterscheidet es dann von der Zeit davor und danach? Der Beginn ist in gewisser Hinsicht einfacher auszumachen, da er üblicherweise an den politischen(7) Krisen(2) festgemacht wird, die sich durch den Untergang des Weströmischen Reichs im 5. Jahrhundert ergaben, woraus sich der ungefähre Zeitpunkt von 500 n. Chr. für die Trennlinie zwischen Antike und Mittelalter(18) ergibt. Gleichgültig, ob man nun das Römische Reich(4) als irgendwie »besser« einstuft als die westlichen Nachfolgestaaten(5) oder nicht, so waren letztere jedenfalls mit Sicherheit stärker aufgesplittert(1), strukturell schwächer und wirtschaftlich weniger komplex. Der Bruch wird verkompliziert durch das lange Überleben des Oströmischen Reichs(5), das wir heute als Byzanz(3) bezeichnen; infolgedessen gibt es in Süd-Ost-Europa(7) um 500 keinerlei Scheidelinie. Tatsächlich war auch im Westen lediglich eine Handvoll der heutigen europäischen(8) Nationen betroffen – die größten sind Frankreich(2), Spanien(1), Italien(5) und das südliche Britannien(1) –, denn das Römische Imperium(6) hatte sich nie bis Irland(1), Skandinavien(1), den größten Teil Deutschlands(1) und die meisten slawischsprachigen(1) Länder ausgedehnt.
Kompliziert wird das Problem noch zusätzlich durch Ergebnisse der letzten Generation von Historikern, die zeigen konnten, dass es über die Zeitgrenze des Jahrs 500 hinweg bedeutende Kontinuitäten gab, speziell in Kulturpraktiken(3) – bei religiösen Vorstellungen, beim Begriff öffentlicher(3) Macht(4) –, wodurch sich das Fortleben einer »späten Spätantike« noch für längere Zeit hinzieht, bei den einen bis 800, bei anderen sogar bis zum 11. Jahrhundert. In diesen Fällen wird die Abruptheit des Zusammenbruchs des Römischen Reichs(7) durch den Bezug zwischen Wandel und Beständigkeit abgemildert. Doch das halbe Jahrhundert vor und nach 500 bleibt dennoch ein überzeugender Anfangspunkt und zumindest für mich ein signifikanter Zeitraum, innerhalb dessen sich Veränderungen auf so vielen Ebenen vollziehen, dass sie unmöglich ignoriert werden können.
Das Jahr 1500 (beziehungsweise auch hier wieder das halbe Jahrhundert davor und danach) ist ein schwierigerer Fall: Damals fanden weniger Veränderungen statt, oder die angeblichen Zeichen für den Anbruch der »Moderne« waren nicht alle besonders markant. Die Übernahme von Byzanz(4) durch die osmanischen(1) Türken im Jahr 1453 war nichts im engeren Sinn Weltbewegendes, weil das einst so mächtige Reich mittlerweile in kleine Provinzen innerhalb des heutigen Griechenland(1) und der Türkei(1) zerfallen war, und die Osmanen(2) bedienten sich weiterhin recht effektiv der byzantinischen(5) politischen(8) Strukturen. Die »Entdeckung« Amerikas(1) durch Kolumbus(1) oder, besser gesagt, die Eroberung der größeren Staaten(6) Amerikas(2) durch spanische(2) Abenteurer in den 1520er und 1530er Jahren war für Amerikaner mit Sicherheit eine Katastrophe, doch bis sich die dortigen Entwicklungen spürbar auf Europa(9) (abgesehen von Spanien(3)) auswirkten, verging viel Zeit. Die Bewegung des Humanismus(3), das geistige Herz der Renaissance(5), wirkt in ihrem ganzen Gebaren stark mittelalterlich(19). Was bleibt, ist die Reformation(1), die ebenfalls in die 1520er und 1530er Jahre fällt (und im weiteren Verlauf des Jahrhunderts die katholische(2) Gegenreformation(1)): ein religiöser und kultureller Wandlungsprozess, der West- und Mitteleuropa in zwei Teile spaltete und zwei sich häufig widerstreitende(1) Lager entstehen ließ, die sich in politischer(9) und kultureller Hinsicht stetig auseinanderentwickelten, ein Prozess, der noch heute anhält. Letzteres war sicher ein bedeutender und relativ plötzlicher Bruch, auch wenn er sich auf das orthodoxe(1) Christentum(2) Osteuropas kaum auswirkte. Wenn wir die Reformation(2) als das Ereignis begreifen, das das Ende des Mittelalters(20) in Europa(10) markiert, dann stellt sich allerdings das Problem, dass wir das Mittelalter mit einer politischen(10) und wirtschaftlichen Krise(3) in einer Umgebung kultureller und religiöser Kontinuitäten beginnen lassen und das Ende in einer kulturellen und religiösen Krise(4) in einer Umgebung verorten, wo Politik(11) und Wirtschaft überwiegend unverändert bleiben. In dieser ganzen Definition des Mittelalters(21) steckt also etwas Künstliches, das wir aber kaum beseitigen können.
Diese Erkenntnis erlaubt uns allerdings, uns noch einmal der Frage zuzuwenden, wie wir uns zum Mittelalter(22) als einer in sich geschlossenen Einheit verhalten. Natürlich wäre es möglich, nach einem im Vergleich zum Jahr 1500 besseren Zeitpunkt als möglichem Schlusskandidaten Ausschau zu halten: 1700 womöglich, mit seinen Revolutionen im Wissenschafts- und Finanzwesen; oder 1800, mit seinen politischen(12) und industriellen Revolution(1)en. Schon des Öfteren wurden diese Phasen enger in Betracht gezogen. Allerdings würde man dadurch festschreiben, dass der Wandel auf einem bestimmten Gebiet im Vergleich mit anderen Bereichen am wichtigsten war; man würde neue Grenzen erfinden, statt sie zu relativieren. Wenn wir bei dem bleiben, was wir haben, dann hat das den Vorteil, dass 500 bis 1500 eben eine künstliche Zeitspanne ist, in der Veränderungen auf unterschiedliche Weise an unterschiedlichen Orten verfolgt werden können, ohne dass sie teleologisch auf ein Großereignis am Schluss zulaufen müssten, sei das nun eine Reformation(3), eine Revolution, eine Industrialisierung oder sonst ein Zeichen von »Modernität«.
Hinzuzufügen ist – obwohl ich dergleichen auf diesen Seiten nicht vorhabe –, dass diese Vorgehensweise auch einen weiter ausgreifenden Vergleich ermöglicht. Wissenschaftler, die sich in unserem Jahrtausend mit der Geschichte Afrikas(1) oder Indiens oder Chinas beschäftigen, äußern häufig Kritik an der Bezeichnung »Mittelalter(23)«, weil damit anscheinend europäischer(11) Ballast transportiert wird und vor allem eine Teleologie unvermeidlicher europäischer(12) Überlegenheit vorausgesetzt wird, was die meisten Historiker heutzutage ablehnen. Doch hat man die Künstlichkeit erst anerkannt, dann kann die europäische(13) Mittelalter(24)-Erfahrung komparativ in neutralerer, das heißt konstruktiver Weise gegen andere Erfahrungen abgegrenzt werden.4
Faktisch ist auch »Europa(14)« kein Begriff, der sich von selbst versteht. Es handelt sich – genauso wie bei Südostasien – schlicht nur um eine Halbinsel vor der eurasischen Landmasse.5 Nach Nordosten ist Europa(15) von den großen asiatischen Staaten(7) durch die Wälder Russlands und die Weite Sibiriens(1) getrennt, doch der südlich davon gelegene Steppenkorridor verband – wie nacheinander die Hunnen(1), die bulgarischen(1) Turk(1)-Völker und die Mongolen(1) bewiesen haben – für unternehmungslustige Reiter zu allen Zeiten Asien und Europa(16), und die Steppe(1) setzte sich in Richtung Westen über die Ukraine(1) nach Ungarn(1) ins Herz Europas(17) hinein fort. Vor allem aber: Südeuropa ist untrennbar mit dem Mittelmeerraum(1) verbunden und dadurch in allen Epochen über wirtschaftliche, wenn auch nicht politische(13) und kulturelle Beziehungen mit den anliegenden Gebieten Westasiens und Nordafrikas(2). Als das Römische Reich(8) noch existierte, war das Mittelmeer als Verbindungsfaktor ein sehr viel wichtigeres Studienobjekt als »Europa(18)«: Letzteres war einerseits in das Römische Reich(9) im Süden und andererseits in ein ständig wechselndes Netzwerk von (nach römischer Bezeichnung) »barbarischen« Völkern im Norden aufgespalten. Das sollte sich auch so schnell nicht ändern; die christliche(3) Religion und die Regierungstechniken der nachrömischen Verwaltung(1)(10) weiteten sich erst nach 950 auch über die alte römische Grenze hinweg aus. Damals entwickelte sich das Mittelmeer(2) allmählich auch wieder zu einem wichtigen Handelsdrehkreuz(2), und für den Rest des Mittelalters(25) hatte es dieselbe Bedeutung wie die Tauschnetzwerke(1) im Norden.6 Außerdem war Europa(19) nie eine in sich geschlossene politische(14) Einheit und wurde es auch später nie.
Das heißt nicht, dass die Menschen im Mittelalter(26) nicht von Europa(20) sprachen. Im Umfeld des karolingischen Hofs im 9. Jahrhundert, im Gefolge von Königen, die über das heutige Frankreich(3), Deutschland(2), die Niederlande(1) und Italien(6) herrschten, war manchmal von den jeweiligen Herrschern als den Herren von »Europa(21)« die Rede, ebenso bei den Nachfolgern im ottonischen(1) Deutschland des 10. Jahrhunderts: Man stellte die jeweiligen Herrscher als potentielle Oberherren über nur vage vorgestellte, dabei aber ausgedehnte Länder und Regionen dar, und dafür war »Europa(22)« ein geeignetes Wort. In diesem rhetorischen(2) Sinn überdauerte der Begriff in Kombination mit einem aus der Antike übernommenen schlichten geographischen Rahmen das Mittelalter(27), aber nur selten – nicht nie, aber selten – diente er als Grundlage für irgendeine behauptete Identität(3).7 Es stimmt, dass das Christentum(4) sich während des Hochmittelalters(28) in all die Gebiete ausdehnte, die heute als europäische(23) Länder bezeichnet werden (Litauen(1), das damals sehr viel größer war als heute, war der letzte Staat(8), dessen Herrscher im späten 14. Jahrhundert konvertierten(1)). Doch entstand daraus keine gemeinsame europäische(24) religiöse Kultur(4), denn die Ausbreitung des lateinischen(2) und des griechischen(2) Christentums(5) waren zwei separate Prozesse. Außerdem änderte sich ständig die Grenze zwischen den von Christen und den von Muslimen(1) beherrschten Gebieten: Im Spanien(4) des 13. Jahrhunderts drängten christliche Herrscher in Spanien südwärts; im 14. und 15. Jahrhundert drängten muslimische(2) Herrscher (die Osmanen(3)) nordwärts – die klare Abgrenzung eines »christlichen(6) Europa(25)« (die außerdem immer die zahlreichen Juden(1) in Europa(26) ausklammerte) passte also nie zur Realität, woran sich bis heute nichts geändert hat.
Wir werden sehen, dass in einem sehr allgemeinen Sinn in der zweiten Hälfte der von uns untersuchten Periode Europa(27) tatsächlich in gewissem Ausmaß auf eine gemeinsame Entwicklungsrichtung einschwenkte. Das geschah im Rahmen einer Vielfalt von Institutionen und politischen(15) Gepflogenheiten, etwa dem Netzwerk der Bistümer oder der Verwendung der Schrift(2) in der Regierung, was Verbindungen von Russland bis hinüber nach Portugal(1) schuf. Allerdings reicht das für uns nicht aus, um den Kontinent als Ganzheit anzusehen. Dazu war er innerlich zu vielgestaltig. Sämtliche Behauptungen, es existiere so etwas wie eine europäische(28) und ausschließlich europäische(29) Einheit, sind sogar heute noch reine Fiktion – und für das Mittelalter(29) wären sie völlig aus der Luft gegriffen. Wir sehen also: Das mittelalterliche Europa(30) ist einfach nur ein ausgedehnter, vielgestaltiger Raum innerhalb einer langen Zeitperiode. Es liegen dazu so viele Zeugnisse vor, dass eine differenzierte Untersuchung möglich ist. Eine romantische Vorstellung ist das nicht, und das ist auch gar nicht beabsichtigt. Trotzdem bieten dieser Raum und diese Zeit fesselndes Material. Mein Ziel ist es, diesem Material eine Form zu geben.
Noch eine letzte Warnung an dieser Stelle. Wir kennen zwei gebräuchliche Arten, sich den Jahrhunderten des Mittelalters(30) anzunähern: Die eine geht davon aus, dass die Menschen im Mittelalter Leute »wie wir« waren, die lediglich in einer technisch einfacher ausgestatteten Welt – Schwerter, Pferde, Pergament, keine Zentralheizung – lebten; die andere legt zwischen uns und die Menschen des Mittelalters(31) den Graben eines tiefen Unterschieds und stattet Letztere mit Wertesystemen(2) und Weltauffassungen aus, die von vornherein schwer zu begreifen sind, auf uns häufig unerfreulich wirken und die komplexer Rekonstruktionsbemühungen bedürfen, um zu einer eigenständigen Logik und Rechtfertigung zu kommen. Beide Zugangsweisen haben in gewisser Weise ihren Wert(3), sie sind jedoch beide für sich genommen Sackgassen. Die erste riskiert, sich in Banalitäten zu erschöpfen oder in eine Moralisierung(3) zu verfallen, die sich aus der Enttäuschung ergibt, wenn Akteure im Mittelalter(32) anscheinend daran scheiterten, etwas zu begreifen, was für uns klar auf der Hand liegt. Auch die zweite Methode birgt das Risiko, moralisierend(4) zu werden, doch ihre Alternative ist allzu häufig eine Art Kollusion bis hin zur Possierlichkeit: Der Historiker wird zum Anthropologen, der sich lediglich, manchmal allerdings nur im kleinsten Rahmen, auf die Faszination des Absonderlichen konzentriert. Ich möchte mich eher beider Methoden in einem weiter ausgreifenden historisierenden Versuch bedienen, um herauszufinden, wie die Menschen im Mittelalter(33) in ihren jeweiligen tatsächlichen politischen(16) und ökonomischen(2) Umgebungen und mit den Werten(4), die sie tatsächlich vertraten, Entscheidungen trafen, indem sie »ihre eigene Geschichte mach[t]en, aber sie mach[t]en sie nicht aus freien Stücken unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorhandenen, gegebenen und überlieferten Umständen«.8 Marx(1), von dem diese Worte stammen, ging nicht davon aus, dass eine solche Analyse zu stillschweigendem Einvernehmen führen könnte, was auch ich nicht tue, doch sie erfordert jedenfalls das Verständnis verschiedener Handlungsträger in einer sehr anderen, aber nicht unkenntlichen Welt: Das ist für jede Form von Geschichtsschreibung(3) erforderlich, wobei es natürlich wichtig ist zu sehen, dass die 980er Jahre höchst befremdlich waren, und wir müssen unsere Phantasie anstrengen, um die damaligen Werte(5), die damalige politische(17) Logik zu rekonstruieren; aber genauso wichtig ist es, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass dasselbe auch für die 1980er Jahre gilt.
* * *
In den letzten Passagen dieses einleitenden Kapitels möchte ich einige grundlegende Parameter für die Funktionsweise der mittelalterlichen(34) Gesellschaft vorstellen, die dazu dienen, die unterschiedlichen Verhaltensmuster und politischen(18) Ausrichtungen einzuschätzen, die uns im weiteren Verlauf des Buchs begegnen werden. Im ersten Abschnitt spreche ich über Politik(19), vor allem während der mittleren Periode des Mittelalters; dann komme ich in geraffterer Form auf die Wirtschaft und einige grundlegende Aspekte der Kultur(5) des Mittelalters(35) zu sprechen. Die Menschen im Mittelalter dachten und handelten nicht alle gleich, natürlich gab es auch damals immense Unterschiede. Aber es gab doch auch einige Merkmale, die die überwiegende Mehrheit betrafen. Einige dieser Merkmale waren schlicht Folgen grundlegender sozioökonomischer Gegebenheiten, die, wie wir sehen werden, für die gesamte Epoche typisch waren.
Es war nicht einfach, sich im Europa(31) des Mittelalters(36) fortzubewegen. Das Römische Reich(11) hatte ein Netzwerk von Straßen(1) hinterlassen, allerdings reichte dieses nicht über die römischen Grenzen entlang des Rheins(1) und der Donau(1) hinaus; das Straßensystem(2) im übrigen Deutschland(3) und in noch größerem Ausmaß weiter im Norden und Osten war auf lange Zeit hinaus nur rudimentär entwickelt, und Reisende waren daher wenn möglich auf den Wasserstraßen und in Flusstälern(1) unterwegs. In einer Welt ohne Landkarten konnten nur Experten(1) irgendwelche Streckenerkundungs-Risiken auf sich nehmen. Abgesehen von den Alpen(1) gibt es in Europa(32) keine hohen Berge; das entscheidende Hindernis waren damals die Wälder, die – abgesehen von Britannien(2) und Regionen des Mittelmeerraums(3) – den größten Teil von Kontinentaleuropa überzogen: Rund die Hälfte des heutigen Deutschland(4), rund 30 Prozent des heutigen Frankreich(4) und ein noch größerer Teil Osteuropas bestanden aus Wald. Die Geschichten von tapferen jungen Schneiderlein, die sich in den Märchenwäldern der Gebrüder Grimm(1) verirren, waren keine Phantasie, jedenfalls nicht in dieser Hinsicht. Im Jahr 1073 musste der deutsche Kaiser Heinrich(1)IV. nach einem schnellen Rückzug im Zusammenhang mit dem Ausbruch des großen Sachsenaufstands seinen Weg durch den Wald nehmen, weil die Sachsen(1) die Straßen(3) bewachten, und er war mit seinem Gefolge drei Tage ohne Verpflegung unterwegs, bevor wieder besiedelte Gebiete erreicht wurden. Und man war in allen Fällen, auch auf den Straßen(4), langsam unterwegs. Als sich derselbe Heinrich(2), der mittlerweile die Sachsen(2) besiegt hatte, während der Jahre 1075 bis 1076 mit Papst(2) Gregor VII.(1) einen politischen(20) Showdown mit einem regen Austausch(2) an Drohbotschaften lieferte, der sich schnell zu wechselseitigen Absetzungsdrohungen hochschaukelte, dauerte es fast einen Monat, bis eine dieser Botschaften den ganzen Weg zwischen Südsachsen und Utrecht(1) in den heutigen Niederlanden(2), wo Heinrich(3) sich aufhielt, und Rom(1) zurücklegte – wobei in diesem Zusammenhang noch schnelle berittene Boten eingesetzt wurden. Sie waren immerhin bis zur Einführung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert das schnellste Kommunikationsmittel(1).9 Die Landschaft war insgesamt eine Gefahr und voller Unwägbarkeiten; die erhabene Schönheit einer Bergkette nahm fast niemand wahr – Berge galten eher als Aufenthaltsort von Dämonen(1) und (in Skandinavien(2)) von Trollen.
Allerdings dürfen wir diesen Wildnis-Charakter auch nicht übertreiben. Er war ein Hintergrund, der sich nur hin und wieder mehr in den Vordergrund schob, was einige europäische(33) Politik(21)-Systeme nicht davon abhielt, eine große Ausdehnung zu erreichen, und zwar auch über längere Zeiträume hinweg. Das Karolingerreich(1) nahm, wie wir schon gesehen haben, mehr als die Hälfte Westeuropas(34) ein; die Macht(5) der Fürsten von Kiew(1) im 11. Jahrhundert reichte fast ebenso weit, sie erstreckte sich über das heutige Russland und die Ukraine(2), das Land nördlich der offenen Steppe(2), das praktisch vollständig mit Wald bewachsen war. Die Menschen konnten durchaus herumkommen. Könige waren häufig während ihrer gesamten Regierungszeit unterwegs – König Johann(1) von England(4) (1199–1216)10 legte täglich im Schnitt 20 Kilometer zurück und blieb nur selten länger als ein paar Nächte an einem Ort.11 Große Heere bezwangen regelmäßig tausend Kilometer und mehr, etwa bei den Feldzügen deutscher Kaiser in Italien(7) im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert oder bei den Märschen über Land und den Meeresüberquerungen durch die Kreuzfahrer(1), die mit dem Ziel aufbrachen, Palästina(1) oder Ägypten(1) anzugreifen – abgesehen von allem anderen waren das zumindest logistisch triumphale Unternehmungen. Auch größere Bevölkerungsgruppen(2) konnten sich, wenn auch langsamer, von einem Ort zum anderen bewegen, wie die deutsche Migrationsbewegung in ausgedehnte Gebiete Osteuropas nach 1150 zeigt. Sicher ist aber festzuhalten, dass die europäische(35) Welt im Allgemeinen sehr stark ortsgebunden war. Die meisten Menschen kannten nur die unmittelbare Umgebung, einige nächstgelegene Dörfer(1) beziehungsweise Märkte(2) in ihrer direkten Nähe. Ein Graf – also der örtliche Vertreter des Königs –, dessen Aufgabenbereich am Rand eines Königreichs lag, konnte häufig für einen beträchtlichen Zeitraum machen, was er wollte, ohne dass der König dazu in der Lage war, ihn davon abzuhalten, oder in manchen Fällen sogar überhaupt davon Kenntnis hatte, was sein Repräsentant(1) im Schilde führte. Die Kommunikationsschwierigkeiten(2) standen dem immer im Weg. Doch wenn es sich um tatkräftige Könige handelte, dann tauchten sie früher oder später mit bewaffneten(1) Männern auf (oder sie beauftragten andere Grafen, sich des Problems anzunehmen), und den Grafen war klar, dass ihnen das bevorstand: Damit war zumindest bis zu einem gewissen Grade offener Abtrünnigkeit vorgebeugt. Außerdem gab es noch andere Regierungstechniken, mit denen die Macht(6) von Herrschern recht weit und recht zuverlässig ausgeweitet werden konnte. Wir werden uns in späteren Kapiteln damit befassen. Hier möchte ich zunächst einige grundlegende Mechanismen politischer(22) Macht(7) vorstellen, die unsere Epoche zu einem Großteil prägten. Ich konzentriere mich auf einen bestimmten Fall und befasse mich anschließend mit dessen Bedeutung.
Im Sommer des Jahres 1159 erhob der König von England(5), Heinrich II.(2) (1154–1189), Anspruch auf die südfranzösische Grafschaft(1) Toulouse(1). Heinrich war bereits im Besitz der Hälfte von Frankreich(5), von Herzogtümern und Grafschaften(2) von der Normandie(1) im Norden bis zu den Pyrenäen(1) im Süden. Diese Gebiete waren zu einem Teil von seinen beiden Eltern geerbt, zum anderen hatte seine Frau Eleanor(1) [Aleonòr d’Aquitània], ihrerseits Erbin des großen Herzogtums Aquitanien(1), sie in die Ehe mitgebracht; man konnte mit guten Gründen behaupten, dass auch Toulouse(2) zu Eleanors(2) Erbe gehörte, falls Heinrich(3) den dortigen Grafen zum Einlenken bewegen konnte. All diese französischen(6) Ländereien(2) besaß er durch den französischen(7) König Ludwig VII.(1) (1137–1180), dem er gehuldigt und Treue geschworen hatte: Erst im Jahr 1158 hatte er versprochen, Leben und Person Ludwigs zu verteidigen. Ludwig jedoch, dessen Machtbereich(8) auf die Gegend um Paris(1) beschränkt war, hatte keinerlei Perspektive, der Militärmacht(9) Heinrichs Paroli bieten zu können.
Heinrich(4) marschierte in jenem Sommer mit einem riesigen Heer in der Grafschaft(3) Toulouse(3) ein, wahrscheinlich mit dem größten Aufgebot, das er je zusammengerufen hatte, darunter auch die wichtigsten Barone aus seinen englischen(6) und französischen(8) Domänen(3); ja sogar der König von Schottland(1), Malcolm(1)IV., der Heinrich Treue geschworen hatte, war mit dabei. Ludwig(2) konnte Heinrich(5) nicht gestatten, seine Autorität noch weiter auszudehnen, außerdem war Graf Raimund V.(1) von Toulouse(4) sein Schwager. Er musste also den Versuch unternehmen, diesem beizustehen, aber was konnte er tun? Ludwig beschloss, mit relativ kleinem Gefolge (also schnell) nach Toulouse zu reiten, und als Heinrich mit seinem Heer eintraf, befand sich der König von Frankreich(9) bereits in der Stadt(1) und organisierte die Verteidigung. Heinrich(6) hätte Toulouse sehr wahrscheinlich trotz der starken Befestigungsanlagen(1) einnehmen können – so sah jedenfalls eindeutig sein Plan aus –, doch mittlerweile befand sich der Herr, dem er Treue geschworen hatte, innerhalb der Stadtmauern. Eine zeitgenössische Quelle vermerkt: »Er wollte die Stadt(2) Toulouse(5) nicht belagern, zu Ehren(1) Ludwigs(3) des Königs der Franzosen, der diese Stadt(3) gegen König Heinrich(7) verteidigte«; eine andere Quelle (die die Meinung vertrat, dass Heinrich falsch gehandelt hatte) sagte, er habe den Rat, nicht anzugreifen, aus »eitlem Aberglauben und Ehrfurcht« befolgt. Heinrich befand sich also offenbar in einer Zwickmühle. Wenn er seinen Herrn angriff, dem er geschworen hatte, dass er ihn verteidigen werde, welchen Wert(6) hatten dann noch die Eide(1) seiner eigenen Barone ihm gegenüber?(2) Und was fing er mit einem König an, den er als Gefangenen genommen hatte, der aber sein Herr war? Er griff also nicht an, und nach einem mit Raubzügen verbrachten Sommer zog er sich schließlich zurück. Heinrich(8), einer der beiden mächtigsten Monarchen in Westeuropa(36), konnte es nicht riskieren, als Eidbrecher(3) wahrgenommen zu werden; er zog es vor, als gescheiterter Stratege Ansehen zu verlieren – und das in beträchtlichem Ausmaß.12
Worauf es in diesem Fall ankam, war die persönliche Beziehung zwischen Heinrich(9) und Ludwig(4). Diese Beziehung war durch zeremonielle(1) Akte abgesichert – durch Eide(2), Huldigungen (die formale Anerkennung einer persönlichen Abhängigkeit) und so weiter; und sie hing sehr eng mit Ehre(4) zusammen. Außerdem war sie mit Herrschaftsvorstellungen verknüpft: Das Zeremoniell(2) war Teil der Bedingungen, mit denen Heinrich(10) als Herr das runde Dutzend seiner Grafschaften(4) und Herzogtümer mit den damit verbundenen Ländereien(4) vom König von Frankreich(10) bekommen hatte – im Unterschied zu seinem eigenen reichsten und kohärentesten Territorium, England(7) selbst, wo er seinerseits der souveräne Herrscher war. Damit befinden wir uns mitten in jener Welt, die häufig als militärischer(1) Feudalismus bezeichnet wird: Eine breite Elite(1)-Schicht hoher Aristokraten(1) und Ritter(2) leistete Militärdienst(2) und bewies politische(23) Loyalität, und sie erhielten als Gegengabe Ämter(1) oder Ländereien(5) von Königen oder auch weniger bedeutenden Adligen(2), die ihnen wieder genommen wurden, wenn sie sich als untreu erwiesen. Solche Männer wurden häufig als die eingeschworenen vassi, als Vasallen des Königs, bezeichnet, und der an Bedingungen gebundene Landbesitz(6) hieß feoda, Lehen, woraus sich die Worte »feudal« und »Feudal(1)-Vasallen« in der modernen Terminologie der Geschichtswissenschaft ableiten. Heinrichs(11) französische(11) Ländereien(7) werden in zeitgenössischen Quellen häufig als feoda bezeichnet; auch Heinrichs Barone kamen vor allem in ihrer Eigenschaft als seine »eingeschworenen« Gefolgsleute und Empfänger von Grundbesitz mit nach Toulouse(6).
Gerade in den letzten Jahren wurde übrigens die Terminologie des »Feudalismus(2)« oder »Lehnswesens(1)« häufig in Frage gestellt. Susan Reynolds(1) machte darauf aufmerksam, dass militärische(3) und politische(24) Verpflichtungen oder die Bedeutung von Wörtern wie »Lehen« nur selten klar definiert waren, jedenfalls nicht im Frankreich(12) des 12. Jahrhunderts. Mehrere Experten(2) verwiesen auch darauf, dass »Feudalismus« kein mittelalterliches(37) Wort ist und unter der Feder diverser moderner Autoren sehr viele unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Man hat daher auch argumentiert, das Wort sei so schwammig geworden, dass es praktisch nutzlos sei. Meiner Meinung nach ist der Begriff durchaus noch nützlich, wenn man ihn klar definiert.13 Wenn ich ihn trotzdem in diesem Buch nur selten verwende, dann liegt das lediglich daran, dass ich versuche, Fachtermini so weit wie möglich zu vermeiden, nicht weil dieser Begriff an sich problematischer wäre als irgendeiner der anderen Begriffe, mit denen Historiker arbeiten. Jedenfalls war für Heinrichs(12) Handlungsweise im Zusammenhang mit der Belagerung von Toulouse(7) eindeutig der Umstand entscheidend, dass Ludwig(5) Heinrichs Lehnsherr(2) war, dem Heinrich als Gegenleistung für seine französischen(13) Ländereien(8) einen Eid(3) geschworen hatte, und dass Heinrichs Barone zu Heinrich in derselben Beziehung standen. Das Herrschaftsverhältnis, ob man es nun als »feudal« bezeichnet oder nicht, prägte diese Begegnung mit Sicherheit.
Ein Hauptgrund war darin zu sehen, dass der Militärdienst(4) der Oberschicht überwiegend nicht gegen Besoldung geleistet wurde. Söldner(1) wurden im 12. Jahrhundert eingesetzt und machten den Großteil der Infanterie aus (was auch für das Heer Heinrichs(13) im Jahr 1159 galt), die Reiterei hingegen und die Führungsschicht setzten sich überwiegend aus Männern zusammen, die – selbst wenn sie teilweise ebenfalls entlohnt wurden – persönliche Verpflichtungen hatten, entweder gegenüber dem Königreich oder gegenüber der Person des Königs oder auch gegenüber beiden.14 Das Römische Reich(12) hatte ein vollständig bezahltes Heer besessen, das sehr viel umfangreicher gewesen war als seine Pendants im Mittelalter(38), außerdem ständig einsatzbereit war; und um das aufrechterhalten zu können, mussten auf Landbesitz(9) hohe Steuern(2) erhoben werden – wir werden sehen, dass Landbesitz bei weitem die wichtigste Quelle von Reichtum war. Das ermöglichte eine sehr einheitliche politische(25) Struktur, und das Verschwinden dieses Steuersystems(1) im Westen (vgl. das zweite Kapitel) war der Hauptgrund dafür, dass frühmittelalterliche Nachfolgerstaaten(9) so viel schwächer waren. Die byzantinischen(6) und osmanischen(4) Reiche waren ähnlich organisiert, was in Südosteuropa im Mittelalter eine starke Kontinuität zur Folge hatte, wie wir im dritten und im neunten Kapitel sehen werden. Auch in Westeuropa(37) griff man im ausgehenden Mittelalter(39) wieder auf allgemeine Besteuerung(3) zurück, wenn auch in geringerem Ausmaß und sehr viel weniger effizient; das hatte damals zur Folge, dass einerseits die wirtschaftlichen Ressourcen(1) der Herrscher sich veränderten und andererseits neue Probleme auftauchten: Vor allem sahen die Herrscher sich jetzt genötigt, die Zustimmung jener Aristokraten(3) und Stadtbewohner(1) zu erhalten, die die Truppen bezahlen sollten (oder zumindest die Last auf ihre Bauern(1) abwälzen mussten). Wir werden im elften und zwölften Kapitel sehen, wie sich im ausgehenden Mittelalter(40) im Westen dadurch das politische(26) Kräfteverhältnis veränderte.
Im Frankreich(14) des 12. Jahrhunderts jedoch, und überhaupt im überwiegenden Teil Europas(38) und während nahezu des gesamten Mittelalters(41), zog niemand in nennenswertem Ausmaß Steuern(4) von Grundbesitz ein. Das hatte zur Folge, dass die Streitkräfte auf der Grundlage des Einsatzes von Landbesitzern aufgebaut werden mussten oder indem man Land vergab, von dem im Heer dienende Männer leben konnten; oder, im Fall des Einsatzes von Söldnern(2), indem man sie von den Erträgen aus dem Grundbesitz von Königen oder Grafen bezahlte und aus Abgaben(1) von Landbesitzern, die diese entrichteten, um sich vom Militärdienst(5) loszukaufen. In der damaligen Welt hing ein beträchtlicher Teil des Militärdiensts(6) und damit der Zusammensetzung eines Heers von persönlichen Beziehungen ab, die mit Grundbesitz gekoppelt waren.
Diese Grundbesitz-Politik(27) wurde im Jahr 1940 von dem bedeutenden französischen(15) Historiker Marc Bloch(1) detailliert erforscht – mit einem seither unerreichten Scharfsinn. (Er bezeichnete diese auf Grundbesitz beruhende Gesellschaft als »feudal«, wobei das Wort bei Bloch(2) sehr viel mehr umfasst als nur Lehen und Vasallen.) Er argumentierte, eine auf Grundbesitz beruhende Gesellschaft bringe eine »Fragmentierung(2) der Gewalten« mit sich: Sie habe die Tendenz, dezentralisierte(1) politische(28) Strukturen hervorzubringen, schlicht aus dem Grund – um es sehr viel undifferenzierter als Bloch(3) auszudrücken –, dass man in einem Null-Summen-Spiel desto weniger hat, je mehr man an Grundbesitz weggibt, und dass spätere grundbesitzende Eliten(2) dann wahrscheinlich ihrem Grundherrn umso weniger bereitwillig gehorchen dürften, je weniger dieser zu vergeben hatte.15 Das war, wie wir sehen werden, nicht ganz zutreffend, vor allem nicht im Frühmittelalter(42); und gerade die Karolinger(2), die keine Steuern(5) erhoben, herrschten nach allen später angelegten Maßstäben über sehr ausgedehnte Ländereien(10). Doch steht es außer Frage, dass Steuern(6) einziehende Staaten(10) grundsätzlich sehr viel stabiler sind als diejenigen, die sich auf die Grundlage des Gabenaustauschs(3) von Land gegen militärische(7) oder politische(29) Loyalität stützen. Bezahlte Soldaten und Beamte(1) sind berechenbarer als diejenigen, die mit Landvergaben entlohnt werden; die Illoyalen und Unfähigen erhalten im ersteren Fall einfach keinen Lohn mehr. Ein Herrscher, dessen Ressourcen(2) sich einzig aus Grundbesitz speisen, muss vorsichtiger vorgehen, vor allem, wenn er es mit Militärführern(8) aus der Aristokratie(4) zu tun hat, deren Grundbesitz ihnen kaum abzunehmen ist, wenn er – oder in selteneren Fällen sie – auf politischen(30) Erfolg aus ist. Diese Konstellation prägte die meisten mittelalterlichen(43) Staatswesen(11).
Es könnte den Anschein erwecken, als wären wir jetzt von der Diskussion politischer(31) Aktivitäten unmerklich in den Bereich von Militärfragen(9) geraten. In unserer Epoche gab es zwischen diesen beiden Bereichen allerdings keinen allzu großen Unterschied. Das Regieren drehte sich im gesamten Mittelalter um zwei zentrale Strukturen: die Organisation von Recht und Gerechtigkeit und die Organisation von Kriegen. Politische Loyalität war von der Bereitschaft zu kämpfen nicht zu trennen; infolgedessen waren die Angehörigen des Land besitzenden Adels(5) im Mittelalter(44) fast immer militärisch(10) ausgebildet und hatten eine militärische(11) Identität(4) – ein Umstand, dem wir in diesem Buch immer wieder begegnen werden. Wenn Herrscher für ihre militärischen(12) Erfolge und ihre Gerechtigkeit gerühmt wurden (wozu auch ihre Fähigkeit gehörte, Verlierer dazu zu bewegen, ihre Niederlage zuzugestehen, was beides abdeckte), wurden sie häufig als die Ursache für das wirtschaftliche Wohlergehen ihres Reichs angesehen – andererseits wurden Klimakatastrophen oft als Ergebnis des Fehlverhaltens ungerechter Herrscher interpretiert –, doch wirtschaftliche Entwicklung wurde selten als ihr Verantwortungsbereich verstanden; die Armenfürsorge war den Ortsgemeinden und kirchlicher Mildtätigkeit überlassen; für Schulbildung(2) wurde privat bezahlt, dasselbe galt für die medizinische(1) Versorgung.
Der schmale Aufgabenbereich einer Regierung in Westeuropa(39) und deren enge Verbindung zu persönlichen Beziehungen hat sogar bei einigen einflussreichen Historikern zu der Meinung geführt, es sei wenig hilfreich, das Wort »Staat(12)« zu verwenden, wenn wir von politischen(32) Verfassungen des Mittelalters(45) sprechen.16 In den folgenden Kapiteln wird deutlich werden, dass ich diese Auffassung nicht teile; ich bin vielmehr der Meinung, dass sowohl die öffentliche(4) Autorität von Königen im frühen Mittelalter(46) als auch die ab dem 13. Jahrhundert zunehmend komplexen administrativen Systeme sinnvoll in Kategorien von Staatsmacht(10) beschreibbar sind. Dementsprechend werde ich das Wort in diesem Buch für die meisten europäischen(40) politischen(33) Systeme verwenden, abgesehen lediglich von den ganz schlichten Strukturen in der Nordhälfte des Kontinents. Allerdings war deren Aufgabenbereich beschränkt, wie auch immer man sie beschreibt.
Um nun zu Heinrich II. und Ludwig VII.(6) zurückzukommen: Die Landpolitik war im Jahr 1159 ein dominanter Faktor. Heinrich war sogar bereit, in England(8) die letzten Reste einer Grundsteuer(7) aufzugeben, die die dortigen Könige – als Einzige im lateinischen(1) Europa(41) in der damaligen Periode – seit über einem Jahrhundert angesammelt hatten.17 Möglicherweise tat er das, um keine Opposition(1) aufkommen zu lassen; doch offenbar rechnete er damit, in dem Null-Summen-Spiel von Landvergaben über so viele Ressourcen(3) zu verfügen, dass er sich auf die Loyalität und Dankbarkeit seiner wichtigsten Adligen(6), sowohl auf französischer(16) wie auf englischer Seite, verlassen konnte. Außerdem waren sie Teilnehmer an seinen Oster(1)- und Weihnachtsspielen und Mitwirkende in der gesamten Zeremonialkultur(1), die sich um ihn (15)und andere Herrscher herum gebildet hatte – mit ganz eigener Etikette und eigenem Rollenverhalten – und die dazu diente, die Treueverhältnisse zu stützen.18 Und ganz überwiegend behielt er recht. Doch selbst er konnte nicht riskieren, die Wurzel dessen zu kappen, was er als Lohn für seine Großzügigkeit erhielt – das Prinzip des abgelegten Treueeids(4) –, indem er den Eid(5), den er Ludwig(7) geschworen hatte, brach. Das zeigt, dass die Politik(34) der Landvergabe nicht zwingend zu den zynischen Machenschaften von Aristokraten(7) führen musste, die nur auf die Gelegenheit warteten, sich von schwachen Herrschern loszusagen. Die Verpflichtungen, die mit der Übernahme von Land verbunden waren, die Ehre(5), die mit Treue einherging, spielten ebenfalls eine Rolle. Vom Verlust der Ehre konnte man sich kaum mehr erholen; man musste hier sehr vorsichtig vorgehen, und ein Großteil politischen(35) Handelns im Mittelalter(47) hing davon ab, wie weit man gerade noch davonkommen konnte, bevor man als unwiderruflich ehrlos galt – ich werde darauf gleich noch zu sprechen kommen.
Darüber hinaus wurden im 12. Jahrhundert die Rechte der Adligen(8) und die Verpflichtungen, die mit den Treue-Eiden(6) verknüpft waren, strenger gefasst, wie sowohl Ludwig(8) als auch Heinrich(16) sehr wohl wussten; sie nutzten diesen Umstand in anderen Kontexten auch jeweils zu ihrem Vorteil. Andere Adlige(9) in dieser Zeit setzten womöglich tatsächlich Eide(7) und Ehre(6) aufs Spiel, Heinrich(17) aber war ein zu geschickter Akteur, als dass er sich auf dieses Risiko eingelassen hätte. Jedenfalls waren die Machtbeziehungen(11) innerhalb dieser Treuestrukturen ausschließlich um die Politik(36) der Landvergabe aufgebaut. Wenn wir verstehen, wie dieser Mechanismus funktionierte, dann haben wir einen großen Teil der politischen(37) Praxis im Europa(42) des Mittelalters(48) verstanden; lediglich die stärkeren Staatensysteme von Byzanz(7) und der Osmanen(5) sowie von al-Andalus(1), dem muslimischen(3) Spanien(5), lagen außerhalb dieser Sphäre.
* * *
Was die ökonomischen(3) Verhältnisse angeht: Der Hauptpunkt, den ich hier ansprechen möchte und der dem Buch auch im Weiteren zugrunde liegt, ist schnell umrissen. Die politischen(38) Gemeinwesen im Mittelalter(49) stützten sich in ihrem Zusammenhalt und in ihrem Erfolg auf die Kontrolle über Grund und Boden, wie wir gerade schon gesehen haben. Das liegt ganz einfach daran, dass sämtliche vorindustriellen Gesellschaften vor allem auf landwirtschaftlichem(1) Wohlstand(1) basierten. Es gab im Mittelalter(50) und auch noch lange danach nichts, das man als Fabrik hätte bezeichnen können. Es gab Handwerker(1), die häufig auch in größerer Zahl zusammenarbeiteten – etwa in ägyptischen(2) Städten im 10. Jahrhundert oder im Flandern(1) und Norditalien(8) des 13. Jahrhunderts: Handwerker(2), die in großen Mengen Stoffe(2) oder Metallarbeiten für Märkte(3) in Europa(43) herstellten. Aber die Technologien, deren sie sich bedienten, waren sehr viel einfacher als diejenigen zukünftiger industrieller Betriebe, und vor allem handelte es sich nur um einen eng begrenzten Anteil an der Gesamtbevölkerung; nicht einmal ein Fünftel der Bevölkerung(3) Europas(44) lebte nach 1200 in – häufig sehr kleinen – Städten, und davor waren es noch weniger. (Man kann bei diesen Zahlen nur spekulieren, da uns keine Daten vorliegen, doch kann dieser Wert(7) als ungefährer Anhaltspunkt dienen; vgl. das siebte Kapitel für nähere Ausführungen.) Auch Bergbau(1) wurde betrieben: Man förderte Eisen, außerdem Silber, um ab ungefähr 950 die Münzstätten(1)(1) in Europa(45) zu beliefern, doch waren in diesem Metier noch weniger Menschen beschäftigt.
Die meisten Menschen, über vier Fünftel der Bevölkerung(4) im Frühmittelalter(51) und nicht sehr viel weniger in den späteren Jahrhunderten, waren Bauern(2): Sie arbeiteten also direkt auf dem Feld als Subsistenzlandwirte, auf mehr oder weniger genau abgegrenzten Ländereien(11) und in stabilen Siedlungen (üblicherweise in Dörfern(2), manchmal auch auf vereinzelt liegenden Bauernhöfen(3)). Landwirtschaftliche(2) Produkte machten im Mittelalter den Löwenanteil dessen aus, was durch menschliche Arbeit produziert wurde, und deshalb war die Kontrolle darüber und natürlich auch über den Grund und Boden, von dem diese Produkte stammten, von so zentraler Bedeutung.
Doch wer hatte nun die Kontrolle über das Land und das, was darauf produziert wurde? In einigen Fällen waren es die Bauern(4) selbst – in jenen Teilen Europas(46), wo Bauern häufig auch Grundbesitzer waren. Das traf vor allem auf Nord- und Osteuropa zu, und vor allem in der ersten Hälfte des Mittelalter(52)-Millenniums, obwohl es auch landbesitzende Bauern im Süden, in Spanien(6) und Italien(9), sowie in Byzanz(8) gab. Dort, wo staatlicherseits Steuern(8) eingezogen wurden, bei den Byzantinern und den Arabern(1) und im Spätmittelalter(53) auch in vielen Königreichen und Stadt(4)-Staaten(13) im Westen, oder wo einzelne Herrscher, weniger systematisch, von eigenständigen Bauern Tribut(1) einzogen, wie etwa die ersten Fürsten und Herzöge in großen Teilen Osteuropas – in all diesen Fällen übten die Herrscher eine gewisse Kontrolle über das bebaute Land aus, einfach weil sie einen Teil dessen für sich beanspruchten, was dort produziert wurde, auch wenn sie faktisch nicht die Besitzer waren.
Ein großer Teil Europas(47) jedoch befand sich im Besitz von Nicht-Bauern(5): von Landbesitzern, die davon lebten und ihren Reichtum dem Umstand verdankten, dass sie von den Bauern Pacht(1) einzogen. (Entlohnte Landarbeiter gab es vor 1200 kaum.) Diese Landbesitzer bildeten die aristokratische(10) Elite(3) Europas(48): die militarisierten Grundherren, deren Treue (oder Untreue) im Verhältnis zu den Königen wir gerade beschrieben haben; dazu kamen die großen Kirchen(3) – Ländereien(12) in Kirchenbesitz konnten bis zu einem Drittel der Gesamtfläche eines Königreichs ausmachen. Auch Könige selbst waren Grundbesitzer, und auch ihre Ressourcen(4) stammten, wenn sie keine Steuern(9) erhoben, ganz überwiegend von dem Grund und Boden, der sich direkt in ihrem Besitz befand. Der Reichtum der Oberschicht – seien es nun Könige, Kirchenmänner(4) oder Aristokraten(11) – stammte also von dem, was sie den Bauern abnehmen konnten. Das geschah durch Anwendung oder Androhung von Gewalt(2).
Natürlich wurde nicht jeder Scheffel Getreide(1) mit Gewalt(3) eingezogen. Die Adligen(12) verfügten nicht über die dafür nötige militärische(13) Stärke; immerhin gab es sehr viel mehr Bauern(6) als Aristokraten(13). Faktisch vereinbarten die Bauern in den meisten Fällen ihre Pacht(2), und die Adligen(14) fanden sich häufig damit ab, dass solche Vereinbarungen zur Gewohnheit wurden und kaum mehr geändert werden konnten. Doch war der Einzug von Pacht(3) grundsätzlich durch den potentiellen Einsatz von Gewalt(4) durch die bewaffneten(2) Männer gestützt, die im Dienst der Grundherren standen; beim Akt des Pachteinzugs(4) waren häufig Bewaffnete(3) anwesend, die die Prozedur überwachten(1) (was in noch stärkerem Ausmaß für den Einzug von Steuern(10) galt, der tendenziell auf noch weniger Zustimmung bei den Betroffenen stieß). Und auf den Widerstand(1) von Bauern(1), der – beispielsweise im Zusammenhang mit willkürlichen Erhöhungen von Pacht(5) und Abgaben(2) – auch selbst manchmal in Gewalt ausarten konnte, wurde prinzipiell mit dem Einsatz von Gewalt(5) reagiert.
Es gibt zahlreiche Zeugnisse der häufig abstoßenden Dinge, zu denen Grundherren gegenüber widerspenstigen Bauern(7) fähig waren – Enteignung(1), Zerstörung von Eigentum, Schläge, Verstümmelung, Folter(1). Von Folter wird in den uns vorliegenden Quellen überwiegend in einem Ton von Empörung berichtet, im Fall von Schlägen und Verstümmelungen hingegen klingen die Berichte meistens nur sachlich und nüchtern. (Die Quellen stammen überwiegend von Geistlichen, die das Fehlverhalten der Aristokratie(15) ablehnten, selbstbewussten Bauern allerdings meistens noch ablehnender gegenüberstanden.19) Auch hier gilt: Die meisten waren solchen Brutalitäten nicht ausgesetzt, doch die Möglichkeit bestand immer, und das war den Bauern auch klar. Das heißt, Gewalt(6) war immer ein impliziter Bestandteil der mittelalterlichen (54)Agrargesellschaft. Trotzdem leisteten Bauern manchmal Widerstand(2)(2), und manchmal waren sie damit sogar erfolgreich; doch in den allermeisten Fällen waren und blieben sie Untergebene ihrer Grundherren.
Rechtlich gesehen gab es freie Bauern(8) und solche, die nicht frei waren. Zwischen den einzelnen Gesellschaften bestanden Unterschiede in Hinsicht darauf, was es bedeutete, frei zu sein – sei es vor dem Gesetz(1) oder in der Praxis(1) (was nicht dasselbe war). Sicher aber gehörte zur Freiheit, dass ein freier Bauer vollständig an öffentlichen(5) Aktivitäten teilnehmen durfte, so etwa an den für die frühmittelalterliche(55) Politik(39) wichtigen Versammlungen(1), und dass er Zugang zu den Gerichtshöfen(1) hatte. Waren(1) solche Bauern Pächter, dann bedeutete Freiheit häufig auch einen geringeren Pachtzins(6). Unter den Unfreien(1) (im Lateinischen(1) als servi oder mancipia bezeichnet) waren die Unterschiede größer. Servus bedeutete in der Antike »Sklave(1)« im Sinne von beweglichem Eigentum: Viele servi arbeiteten in der Landwirtschaft(3) in Sklavenplantagen, auch wenn es solche Betriebe bereits im spätrömischen Imperium(13) relativ selten gab; im gesamten Mittelalter(56) waren Sklaven in vielen Gesellschaften Hausbedienstete. Insgesamt waren jedoch im Mittelalter die meisten servi Pächter. Sie hatten keine Rechte, da diese per definitionem auf die Freien beschränkt waren, und sie zahlten nicht nur höhere Pacht(7), sondern mussten häufig auch erniedrigende unbezahlte Fronarbeit leisten. Doch sie standen in ähnlichen Pachtverhältnissen(8) wie die Freien, und unser Wort »Sklave(2)« ist eigentlich für sie nicht angebracht – ich werde sie daher im Folgenden durchweg als »Unfreie(2)« bezeichnen.
Innerhalb von Dorfgemeinschaften(1) gab es recht komplexe Hackordnungen zwischen freien und unfreien(3) Pächtern, vor allem im Frühmittelalter(57). Im Lauf der Zeit gingen diese Strukturen in großen Teilen Europas(49) zurück; die gemeinsame Erfahrung wirtschaftlicher Abhängigkeit wurde wichtiger als formal-rechtliche Unterschiede, und es kam immer häufiger zu Eheschließungen zwischen Freien und Unfreien(4) (auch wenn das noch auf lange Zeit hinaus streng untersagt war). Als die Grundherren dann auch auf freie Pächter zunehmend mehr Druck ausübten, gerieten beide Gruppen nach der Jahrtausendwende in eine ähnliche Situation faktischer gesetzlicher Abhängigkeit, die häufig als »Leibeigenschaft(1)« bezeichnet wird. Beim Widerstand(3) der Bauern(9) im Frühmittelalter war der Anlass häufig der Umstand, dass freie Pächter über die Grenze zwischen Freien und Unfreien(5) gedrängt wurden, doch im 11. und 12. Jahrhundert ging es eher um die Bedingungen praktischer Abhängigkeit, die damals weiter verbreitet war (siehe unten im siebten Kapitel), und die Trennlinie zwischen Freien und Unfreien(6) verlor an Bedeutung. Doch sie spielte nach wie vor eine Rolle: Sowohl in England(9) als auch in Katalonien(1) gab es beispielsweise nach 1200 freie Pächter, die keine »Leibeigenen« waren, und das Ende der Leibeigenschaft(2) für die vor dem Gesetz(2) Unfreien(7) im 15. Jahrhundert bedeutete eine wichtige Veränderung.20
Das Kräftespiel(3) zwischen Grundherren und Bauern(10) lag nicht nur der gesamten mittelalterlichen(58) Wirtschaftsgeschichte zugrunde, sondern auch den sozialpolitischen Entwicklungen; es war die Grundlage für die Rigidität der Grenzen innerhalb der sozialen Schichtung (vgl. das zehnte Kapitel), und es ermöglichte, wie dargelegt, die gesamte Grundbesitz-Politik(40). Im weiteren Verlauf wird klar werden, wie diese Beziehungen sich in unterschiedlichen Perioden und Umständen veränderten: wie sich in Nordeuropa in der zweiten Hälfte des Mittelalters ein autonomer Bauernstand(11) allmählich zurückbildete (Kapitel 5); wie sich der Charakter von Herrschaft(2) im Westeuropa(50) des 11. Jahrhunderts veränderte, was zur Einführung zahlreicher Sonderabgaben führte, die der bäuerlichen(12) Bevölkerung vor Ort aufgezwungen wurden (Kapitel 6); welche Auswirkung das Wirtschaftswachstum(1) des Hochmittelalters(59) auf den Wohlstand(2) der Bauern und der Grundherren hatte und wie die Beziehung zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen ausgehandelt wurde (Kapitel 7); und wie der spätmittelalterliche – sowohl der erfolgreiche wie der erfolglose – Widerstand(4)(4) der Bauern gegen Grundherren und Staaten(14) organisiert war (Kapitel 12).
Was man jedoch im weiteren Verlauf dieses Buchs an keiner Stelle vergessen sollte, ist die schlichte Tatsache, dass Reichtum und politische(41) Macht(12) auf der Ausbeutung der bäuerlichen(13) Mehrheit beruhten. Die gesamte wirtschaftliche Dynamik der mittelalterlichen(60) Gesellschaftssysteme, auch jeder Wandel, den wir als wirtschaftliche »Entwicklung»(2) zu bezeichnen pflegen – die zahlen- und größenmäßige Zunahme von Märkten(4) oder das Wachstum von Städten(5) und Handwerk für überwiegend aus der Aristokratie(16) stammende Käufer –, war abhängig von der ungleichen Beziehung zwischen Herren und Bauern(14) und dem Mehrwert(8), den Erstere den Letzteren abpressten. Bauern kommen durchaus nicht auf jeder Seite dieses Buchs vor, doch fast alles, was hier vorkommt, wurde mit dem Mehrwert(9) bezahlt, den die Bauern mehr oder weniger widerwillig in Form von Pachtzins(9) abgaben, und es wäre nicht angebracht, das zu vergessen.
Was nun die grundlegenden kulturellen Rahmenbedingungen des Mittelalters(61) betrifft, so kann man hier nicht so einfach generalisieren, und auch eine Auswahl zu treffen ist schwieriger. Ich möchte lediglich drei Aspekte der mittelalterlichen Kultur(6) näher beleuchten, die auf Voraussetzungen beruhen, welche im Vergleich mit anderen Aspekten in Europa(51) weiter verbreitet waren: die Einstellungen(10) zur Ehre(7), zu Geschlechterrollen und zur Religion. Jeder dieser Bereiche wird später wieder auftauchen und im weiteren Verlauf mit Blick auf einzelne Regionen und Perioden detaillierter charakterisiert werden, doch eine gewisse Hinführung soll bereits hier stattfinden.
Wie wir schon gesehen haben, beruhte ein Großteil der Wirkmächtigkeit politischer(42) Beziehungen im Hochmittelalter(62), aber auch lange vorher und lange nachher, auf Ehre(8). Man kann kaum überschätzen, wie wichtig es in sämtlichen Gesellschaftsschichten des Mittelalters, in jeder Periode und in jeder Region Europas(52) war, einen ehrbaren Ruf zu haben. Das galt auch für die Bauernschaft(15), selbst wenn es viele gab, die der Meinung waren, Bauern(16) seien nicht dazu in der Lage, ein Ehrgefühl zu entwickeln. Und es galt auch für Frauen(1), selbst wenn viele der Meinung waren, die Ehre von Frauen sei identisch mit der Familienehre(9) ihres Mannes. Der Vorwurf der Treulosigkeit oder Feigheit oder des Diebstahls oder (wenn es um Frauen ging) des unerlaubten Geschlechtsverkehrs(1) oder (bei einem Mann) der Vorwurf, von seiner Frau(2) betrogen worden zu sein – all das waren Bedrohungen der Ehre(10). Wenn man als Dieb überführt worden war, dann musste man mit der Todesstrafe rechnen (Diebstahl galt, weil er heimlich geschah, in weiten Teilen des mittelalterlichen(63) Europa(53) als schlimmer denn ein öffentlich(6) verübter Mord); und selbst wenn einem das erspart blieb, riskierte man, so ehrlos(11) zu werden, dass man seinen rechtlichen Ruf verlor, das, was im Westen im späteren Mittelalter(64)fama(1) genannt wurde – es bedeutete, dass man vor Gericht(2) nicht mehr als Zeuge aussagen konnte und unter Umständen sogar keinen Eid(8) mehr schwören durfte. Letzteres stellte in sich eine gravierende gesellschaftliche Benachteiligung dar, weil Eide(9) nicht nur in der Politik(43) eine zentrale Rolle spielten, sondern in sämtlichen Rechtsverfahren(1)(1); wenn man also seinen guten Ruf verlor(12), war man in vielerlei Hinsicht rechtlich wehrlos.21
Männer verteidigten ihre Ehre(13) gegen dergleichen Anschuldigungen oder gegen größere oder kleinere Kränkungen anderer Art mit förmlichen Eidschwüren(10), aber durchaus auch – direkter – mit Gewalt(7). Gewalt war als Mittel der Auseinandersetzung so allgemein anerkannt, dass es in Gerichtsverfahren(2)(3) als Strategie akzeptiert wurde: Mit Übergriffen auf das Eigentum des Gegners konnte man zum Ausdruck bringen, dass es einem ernst war mit der Absicht, diesen vor Gericht(4) zu bringen; und wenn man sein Eigentum gegen Angriffe nicht verteidigte, konnte das so interpretiert werden, dass man weniger Anrecht darauf hatte. Bauern(17) trugen Messer bei sich und machten davon Gebrauch; die Tötungsraten in englischen(10) Dörfern(3) des Mittelalters(65) waren ebenso hoch wie diejenigen in den gewalttätigsten(8)US-amerikanischen Städten des 20. Jahrhunderts.22 Im Hoch- und Spätmittelalter unternahmen Aristokraten(17), die beleidigt worden waren, Angriffe auf die Ländereien(13) und Burgen(1) ihres Gegners (das Duell war bis Ende des Mittelalters(66) und danach kaum üblich). Rachemorde waren normal, man sah sie als eine Ehrensache(14) an.
Es wäre falsch, die meisten mittelalterlichen(67) Kulturen(7) als Fehdekulturen(1) zu bezeichnen; mit einigen klaren Ausnahmen – eine war Island(1), eine andere die städtische Elitegesellschaft(4) im Italien(10) des Spätmittelalters(68) – handelte es sich bei den meisten Fällen von Gewalt(9) um einmalige Vorkommnisse, die mit Entschädigung und/oder dem Einschalten gerichtlicher(5) Instanzen geschlichtet werden konnten. Wenn allerdings Männer sich mit Geld(2) oder der Überlassung von Gaben einigen und so die Spirale der Gewalt beenden konnten, die wir als Fehde(2) bezeichnen, dann konnte unter Umständen ebendas wieder unehrenhaft(15) wirken – man musste, wenn man einen Gewaltkreislauf(10) in Gang brachte oder beendete, sehr vorsichtig sein, dass man nicht die eigene Ehre(16) aufs Spiel setzte.
Selbst Männer der Kirche(5), die es als ihre Aufgabe ansahen, Frieden zu stiften und der Gewalt(11) ein Ende zu bereiten (wir kennen viele Beispiele, dass sie genau das auch taten), konnten diese Logik nachvollziehen. Bischof(1) Gregor von Tours(1) (gest. 594) beispielsweise, der in seinen Historiae(1) eine detailreiche Darstellung seiner Zeit liefert, berichtet von einem Aristokraten(18) namens Chramnesind, der Geld(3) als Entschädigung für die Ermordung seiner Verwandten durch die Hand eines anderen Aristokraten(19) namens Sichar genommen hatte. Einige Jahre später saß Chramnesind mit seinem früheren Feind beim Wein(1), und der mittlerweile betrunkene Sichar bemerkte, Chramnesind habe bei der ganzen Sache einen guten Schnitt gemacht. Daraufhin dachte Chramnesind (so die Darstellung Gregors(2)): »Wenn ich den Verlust meiner Verwandten nicht räche, verdiene ich hinfort nicht mehr, als Mann bezeichnet zu werden; man muss mich ein schwaches Weib nennen«, und er tötete Sichar auf der Stelle. Gregor(3) billigte diesen Impuls eindeutig, obwohl er derjenige war, der die Einigung zustande gebracht hatte. Sichars Beleidigung, die im Wesentlichen auf die Behauptung hinauslief, Chramnesind habe auf feige Weise vom Tod seiner Verwandten profitiert, hätte in vielen mittelalterlichen(69) Gesellschaften mörderische Implikationen gehabt; die berühmte Fehde(3) zwischen Arrighi und Buondelmonti(1) im Florenz(1) des 13. Jahrhunderts soll auf ganz ähnliche Weise begonnen haben.23
Um es noch einmal zu sagen: Die Wertvorstellungen(11) waren nicht in allen mittelalterlichen(70) Gesellschaften dieselben. Das Bild von einem »Geist des Mittelalters« spukt in zu vielen Büchern herum, vor allem in solchen, denen es um das Argument geht, die Menschen im Mittelalter hätten nicht »rational« über diesen oder jenen gesellschaftlichen oder religiösen Aspekt nachgedacht; auch das ist ein Argument, das in diesem Buch nicht vorkommen wird. Der Begriff der Ehre(17) hatte gewiss diverse Varianten. Es war etwa im Allgemeinen für einen Mann nicht unehrenhaft(18), außereheliche Kinder zu haben (auch wenn es mancherorts – nicht überall – ein rechtliches Hindernis für die Kinder selbst darstellte); aber eine große Ausnahme war die Situation im spätmittelalterlichen(71) Irland(2), dass es nämlich gegen die Ehre ging, nicht jeden anzuerkennen, der an der Tür klopfte und vorgab, ein solches außereheliches Kind zu sein – vor allem Adlige(20) konnten in Irland zu zahlreichen Kindern dieser Art kommen, häufig auf der Grundlage recht windiger Behauptungen.24 Doch kann man jedenfalls sagen, dass die gewaltsame(12) Verteidigung der Ehre(19) recht verbreitet war.
Darin drückte sich auch ein sehr machohaftes Gebaren aus, was das Chramnesind-Zitat ja explizit zur Sprache bringt: Es ging darum, ein Mann und keine Frau(3) zu sein. Noch machomäßiger wurde es, wenn – was sehr oft vorkam – Männer betrunken waren. Tatsächlich fielen zahlreiche beleidigende Bemerkungen, die dann in Gewalt(13) mündeten, bei fortgeschrittenen Zechgelagen. (Sein Biograph Einhard(1)