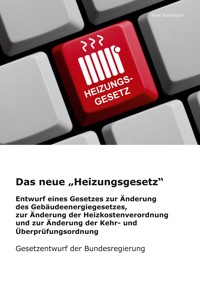
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Energiewende im Wärmebereich ist ein zentraler Schlüsselbereich für die Erreichung der klimapolitischen Ziele und für die Reduktion der Abhängigkeit von Importen fossiler Energie. Mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird zum Heizen unserer Gebäude und zur Versorgung mit Warmwasser verbraucht. Über 80 Prozent der Wärmenachfrage wird noch durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt. Dabei dominiert das Erdgas im Gebäudewärmebereich. Über 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases verbrennen wir jährlich, um unsere Gebäude zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizöl mit knapp 25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent. Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme kann Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren. Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP sah daher vor, dass ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Die Regierungskoalition hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine entschieden, dass schon ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung diese Vorgabe erfüllen soll. Das vorliegende Gesetz verankert diese zentrale Vorgabe im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und gewährleistet damit, dass künftig nur noch moderne, zukunftsfähige Heizungen auf einer Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien (EE) in Deutschland eingebaut werden dürfen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Pflicht technologieneutral auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden kann, und ermöglicht auch beim Einbau von neuen Heizungen in bestehenden Gebäuden noch die partielle Nutzung von fossilen Energien. Die verantwortlichen Eigentümer müssen aber bei jedem Heizungswechsel berücksichtigen, dass spätestens bis zum Jahr 2045 die Nutzung von fossilen Energieträgern beendet sein muss und danach alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Dieses Buch enthält den vollständigen Gesetzesentwurf und ist damit eine gute Grundlage für Immobilieneigentümer zur Vorbereitung künftig notwendiger Entscheidungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Gesetzentwurf der Bundesregierung
A. Problem und Ziel
B. Lösung
C. Alternativen
D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
E. Erfüllungsaufwand
E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
F. Weitere Kosten
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Artikel 1: Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes
Artikel 2: Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung
Artikel 3: Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung
Artikel 4: Inkrafttreten
Begründung
A. Allgemeiner Teil
I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen
II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
III. Alternativen
IV. Gesetzgebungskompetenz
V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen
VI. Gesetzesfolgen
VII. Befristung; Evaluierung
B. Besonderer Teil
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehrund Überprüfungsordnung
A. Problem und Ziel
Die Energiewende im Wärmebereich ist ein zentraler Schlüsselbereich für die Erreichung der klimapolitischen Ziele und für die Reduktion der Abhängigkeit von Importen fossiler Energie. Mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird zum Heizen unserer Gebäude und zur Versorgung mit Warmwasser verbraucht.
Über 80 Prozent der Wärmenachfrage wird noch durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt. Dabei dominiert das Erdgas im Gebäudewärmebereich. Über 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases verbrennen wir jährlich, um unsere Gebäude zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizöl mit knapp 25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent. Stromdirektheizungen und Wärmepumpen machen jeweils nicht einmal 3 Prozent aus. Die übrigen 6 Prozent entfallen auf Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, wie Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse und Kohle. Bei den neu installierten Heizungen betrug der Anteil von Gasheizungen im Jahr 2021 sogar 70 Prozent.
Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme kann Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren. Der Koalitionsvertrag sah daher vor, dass ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Die Regierungskoalition hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine entschieden, dass schon ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung diese Vorgabe erfüllen soll.
Das vorliegende Gesetz verankert diese zentrale Vorgabe im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und gewährleistet damit, dass künftig nur noch moderne, zukunftsfähige Heizungen auf einer Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien in Deutschland eingebaut werden dürfen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Pflicht technologieneutral auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden kann, und ermöglicht auch beim Einbau von neuen Heizungen in bestehenden Gebäuden noch die partielle Nutzung von fossilen Energien. Die verantwortlichen Eigentümer müssen aber bei jedem Heizungswechsel berücksichtigen, dass spätestens bis zum Jahr 2045 die Nutzung von fossilen Energieträgern beendet sein muss und danach alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.
Dieses Gesetz sieht zudem vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf den Energiemärkten einige Vorgaben für die Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudeenergiebereich vor, die schnell wirken und gewährleisten sollen, dass Heizenergie, egal ob mit fossilen Energien oder mit erneuerbaren Energien erzeugt, effizient genutzt wird.
Ergänzend hierzu setzt sich die Bundesregierung derzeit auf der EU-Ebene im Rahmen des Green Deals und der Beratungen zur Gebäudeeffizienz-Richtlinie (EPBD) für ambitionierte Mindesteffizienzstandards für Gebäude ein, um den Wärmebedarf zu senken und gemeinsam mit der in diesem Gesetz verankerten Vorgabe zur schrittweisen Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung die Wärmewende entscheidend voranzubringen.
Der Umbau der Wärmeversorgung ist aufgrund der großen Vielfalt an unterschiedlichen Gebäuden, der unterschiedlichen Situation der Eigentümer und der Auswirkungen auf die Mieter mit großen und zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die derzeitige Krise auf den Energiemärkten und die sprunghaft angestiegenen Preise für Erdgas und andere fossile Brennstoffe zeigen jedoch, dass dieser Umbau nicht nur aus klimapolitischen Gründen, sondern auch aus sozialpolitischen Gründen dringend notwendig ist. Ein Beibehalten der derzeitigen fossil dominierten Versorgungsstrukturen würde aufgrund der Knappheit auf den Märkten für fossile Energieträger und deren Ballung in geopolitischen Konfliktregionen immer wieder zu kaum kalkulierbaren Preissprüngen und damit zu erheblichen sozialen Verwerfungen führen, die nur begrenzt und temporär durch staatliche Hilfsmaßnahmen abgefedert werden können. Eine auf erneuerbaren Energien basierende Wärmeversorgung dürfte mittel- bis langfristig eine sehr viel kalkulierbarere, kostengünstigere und stabilere Wärmeversorgung gewährleisten. Insbesondere der Nutzung der überall kostenlos verfügbaren erneuerbaren Umweltwärme mittels Wärmepumpen und Solarthermie wird dabei eine entscheidende Rolle zukommen.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende für die Energieversorgung in Deutschland. Der Wärmebereich ist von dieser Zeitenwende aufgrund der großen Abhängigkeit von Erdgas wie kein anderer Sektor betroffen. Energiesouveränität ist zu einer Frage der nationalen und europäischen Sicherheit geworden. Die mit diesem Gesetz forcierte Beschleunigung der Wärmewende ist daher nicht nur klimapolitisch, sondern auch in Anbetracht der aktuellen Krise geopolitisch und ökonomisch geboten.
Damit leistet das Gesetz einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 7 und 13 der UN-Agenda 2030, die verlangen, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen und gleichzeitig den Zugang zu bezahlbarer, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern.
B. Lösung
Die Einführung einer Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien bei möglichst jedem Einbau einer neuen Heizung in neuen oder in bestehenden Gebäuden ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität in Deutschland im Jahr 2045. Um das Ziel der Treibhausgasneutralität zu erreichen, müssen jedoch alle Gebäude ihre Wärme künftig klimaneutral erzeugen oder klimaneutral erzeugte Wärme aus einem Wärmenetz beziehen. Mit der Einführung der 65-Prozent-EE-Vorgabe wird zugleich die hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern im Wärmebereich schrittweise mit jedem Heizungswechsel reduziert. Gutachterliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bestätigen, dass das gültige wirtschaftliche Anforderungsniveau nach wie vor das in der EU-Gebäuderichtlinie verankerte Kriterium der Kostenoptimalität erfüllt.
Entscheidend für eine gute Klimabilanz und eine kostenverträgliche Wärmeversorgung ist zudem der effiziente Betrieb der Heizungsanlagen, der durch Elemente der Heizungsüberprüfung und Messung transparent gemacht wird und damit eine Optimierung zur weiteren Steigerung der Wirtschaftlichkeit erlaubt. Um die Effizienz von Heizungsanlagen auch im Betrieb möglichst hoch und so den Energieverbrauch von Gebäuden so gering wie möglich zu halten, sind neben einer neuen Vorschrift zur Betriebsprüfung von Wärmepumpen auch die Verstetigung der ordnungsrechtlichen Vorgaben aus der nur befristet geltenden Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSimiMaV) vorgesehen. Diese Vorgaben umfassten eine Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung, die insbesondere auch fossil betriebene Anlagen adressiert. Als wesentliche Optimierungsmaßnahme wird ein hydraulischer Abgleich vorgesehen. Dem derzeit noch bestehenden Mangel an Fachkräften sowie dem hohen bürokratischen Aufwand wird durch die Eingrenzung auf Gebäude mit mehr als sechs vermieteten Wohnungen Rechnung getragen.
Der Gesetzentwurf stellt sicher, dass spätestens im Jahr 2045 keine fossil betriebenen Heizungsanlagen mehr in Betrieb sind.
C. Alternativen
Keine. Alternative Lösungen wurden intensiv geprüft. Trotz umfassender Förderung insbesondere durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden gegenwärtig immer noch bei rund einem Drittel der neuen Gebäude und bei drei Viertel der bestehenden Gebäude fossil betriebene Heizsysteme (insbesondere Erdgas-Kessel) eingebaut. Mit rund 15 Prozent im Jahr 2021 stagniert der Anteil erneuerbarer Energien an der Bereitstellung von Gebäudewärme weitgehend auf einem sehr niedrigen Niveau. Daher bedarf es einer Anpassung und Weiterentwicklung des bisher gewählten Instrumentenmixes aus freiwilligen informatorischen Maßnahmen, Förderung, marktwirtschaftlichen Ansätzen und ordnungsrechtlichen Vorgaben an die Anforderungen, die sich aus den ambitionierteren Klimazielen für 2030 und 2045 ergeben. Die gesetzliche Regelung ist für die Erreichung der ambitionierten deutschen Klimaziele und zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen erforderlich.
Eine Verstärkung klarer ordnungsrechtlicher Vorgaben, begleitet durch weitere Maßnahmen parallel zu diesem Gesetzgebungsverfahren (wie zum Beispiel die Diversifizierung und Neuausrichtung existierender Förderprogramme und die Intensivierung von Qualifikationsmaßnahmen für Handwerkerinnen und Handwerker), geben den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern, den Investorinnen und Investoren sowie auch den Herstellern von Heizungsanlagen und Installateurinnen und Installateuren die Planungssicherheit, um die notwendigen Investitionen rechtzeitig umzusetzen, die das Gelingen der Wärmewende sicherstellen.
D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Die nachstehenden Angaben sind noch nicht vollständig überprüft und unterliegen einem Änderungsvorbehalt.
Bund, Ländern und Kommunen entstehen Investitionskosten, um die Vorgabe des Anteils von 65 Prozent erneuerbaren Energien bei Heizungsanlagen in öffentlichen Gebäuden zu erfüllen.
Ein finanzieller und (plan-)stellenmäßiger Mehrbedarf im Bereich des Bundes ist unabhängig davon, ob er durch die geplanten Maßnahmen selbst oder durch den die Maßnahmen begleitenden Verwaltungsaufwand hervorgerufen wird, im jeweils betroffenen Einzelplan gegenzufinanzieren.
Daneben führt der Vollzug des Gesetzes durch die Länder zu Verfahrenskosten.
E. Erfüllungsaufwand
Die nachstehenden Angaben sind noch nicht vollständig überprüft und unterliegen einem Änderungsvorbehalt.
Im Folgenden wird der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung dargestellt. Dem Erfüllungsaufwand werden im Folgenden jeweils die erzielbaren Einsparungen über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen gegenübergestellt, um eine Orientierung zur Wirtschaftlichkeit der Anforderungen zu geben.
Der Erfüllungsaufwand für die Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung kann aufgrund der technologieoffenen Regelung und der großen Spreizung bei den potentiellen Investitionskosten nur grob dargestellt werden. Im Folgenden wird daher jeweils die Bandbreite der möglichen Investitionskosten, aber auch der Auswirkungen auf die Betriebskosten dargestellt.
E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
(1) Erfüllungsaufwand außer Heizen mit Erneuerbaren-Regelung
(a) Zusammenfassung
Durch das Gesetz entsteht für Bürgerinnen und Bürger ein jährlicher Erfüllungsaufwand von insgesamt ca. 50 Millionen Euro.
Summiert über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (drei bis 20 Jahre) stehen dem Erfüllungsaufwand jeweils Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von rund 238 Millionen Euro gegenüber.
Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca.182 Millionen Euro. Dem stehen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (fünf bis 20 Jahre) insgesamt ca. 989 Millionen Euro an Einsparungen gegenüber.
(b) Im Einzelnen
Die Streichung der Vorgaben der §§ 34 bis 45 und der §§ 52 bis 56 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verursacht keine Be- oder Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger.
Die Änderung von § 51 Absatz 1 Nummer 2 GEG und die Einführung des neuen § 51 Absatz 1 Satz 2 GEG (Anforderungen an ein bestehendes Gebäude bei Erweiterung und Ausbau) bewirken einen jährlichen Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 667.800 Euro.
Durch die neu eingeführten Heizungsoptimierungspflichten (§§ 60a, 60b und in § 64) entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 2,4 Millionen Euro. Für die betroffenen Anlagen ergeben sich Einsparungen, die sich über die Lebensdauer der jeweils betroffenen Anlagen auf rund 6,7 Millionen Euro summieren. Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 99,9 Millionen Euro. Dem stehen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (drei bis 20 Jahre) wiederum Einsparungen von ca. 493 Millionen Euro gegenüber.
Die Neuregelung für Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakältesysteme in Anlage 8 bewirkt außerdem einen jährlichen Erfüllungsaufwand von ca. 18,5 Millionen Euro. Durch die zusätzliche Dämmung werden über 20 Jahre ca. 91,5 Millionen Euro eingespart.
Insgesamt ergibt sich für die verpflichtend vorgesehene Messausstattung und Gebäudeautomation von neu eingebauten Heizungsanlagen nach § 71a Absatz 1 bis 3 GEG ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 3,7 Millionen Euro pro Jahr. Durch die Vorgaben für die Gebäudeautomation nach § 71a Absatz 4 bis 7 entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von ca. 11,7 Millionen Euro. Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 138 Millionen Euro. Dem jährlichen Erfüllungsaufwand stehen Einsparungen über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von 17 Millionen Euro gegenüber. Dem einmaligen Erfüllungsaufwand stehen Einsparungen über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von ca. 396 Millionen Euro gegenüber.
Die Änderung der Heizkostenverordnung (Streichung der Ausnahme der Erfassungs- und Abrechnungspflicht nach Verbrauch bei Wärmepumpen) verursacht einen jährlichen Erfüllungsaufwand von ca. 13,4 Millionen Euro. Dem stehen Einsparungen von ca. 67 Millionen Euro über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (20 Jahre) gegenüber.
Erfüllungsaufwand Bürgerinnen und Bürger (exklusive Heizen mit Erneuerbaren)
Jährlicher Erfüllungsaufwand
Einsparungen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Einsparungen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen
50 Millionen Euro
182 Millionen Euro
238 Millionen Euro
989 Millionen Euro
(2) Erfüllungsaufwand Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung
Durch die Vorgabe für die Nutzung von erneuerbaren Energien beim Einbau von neuen Heizungsanlagen entsteht den Bürgerinnen und Bürgern bis zum Jahr 2028 ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 9,157 Milliarden Euro. Dem stehen Einsparungen über die Betriebszeit von 18 Jahren in Höhe von ca. 11,014 Milliarden Euro gegenüber. Ab dem Jahr 2029 beträgt der jährliche Erfüllungsaufwand nur noch rund 5,039 Milliarden Euro. Dem stehen Einsparungen von rund 11,125 Milliarden Euro gegenüber.
Jährlicher Erfüllungsaufwand Bürgerinnen und Bürger
Investitionskosten
Einsparungen über 18 Jahre
Bis 2028
9,157 Milliarden Euro
11,014 Milliarden Euro
Ab 2029
5,039 Milliarden Euro
11,125 Milliarden Euro
E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Die Vorhaben führen im Saldo zu einem „In“ von ca. 453.000 Euro jährlich für die Wirtschaft (Bürokratiekosten aus Informationspflichten). Für die Nachweispflichten für die Begründung einer Ausnahme nach § 60b Absatz 7 entsteht für die Wirtschaft ein Zeitaufwand von ca. 18.127 Euro pro Jahr. Zudem verursacht die monatliche Mitteilung der fernabgelesenen Ergebnisse der Erfassung für Wärmepumpen nach der Heizkostenverordnung Kosten in Höhe von 355.200 Euro pro Jahr und die Erstellung der verbrauchsabhängigen Abrechnung nach der Heizkostenverordnung Kosten in Höhe von ca. 79.704 Euro pro Jahr.
Das Gesetz dient teilweise der Umsetzung einzelner noch nicht umgesetzter Vorgaben der Gebäuderichtlinie 2010/31/EU (EPBD). Die Belastungen aus der 1:1-Umsetzung von EU-Vorgaben sind (§ 71a Absätze 4 bis 7) im Rahmen der „One-in-one-out“-Regelung nicht zu beachten.
Der Erfüllungsaufwand für Bürokratiekosten aus Informationspflichten wird durch andere Einsparungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz kompensiert.
KMUs sind vor allem als Gebäudeeigentümer von den Gesetzesänderungen betroffen. Der für sie entstehende Erfüllungsaufwand ist im Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft enthalten. Die Reglungen zur Gebäudeautomation betreffen sie nur, wenn sie in ihren Nichtwohngebäuden Heizungsanlagen oder kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen/Klimaanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 290 Kilowatt betreiben. Die Betroffenheit von den Gesetzesänderungen ist allgemein von den Gebäuden, die Unternehmen für ihre Geschäfte nutzen, und nicht von der Größe des Unternehmens abhängig (der Anzahl der Beschäftigten im Unternehmen und dem Jahresumsatz des Unternehmens). Von der Heizen-mit Erneuerbaren-Regelung sind sie nicht mehr betroffen als größere Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung, da die Vorgaben für den Einbau oder das Aufstellen von neuen Heizungsanlagen für alle gelten. Die Regelung bietet verschiedene Erfüllungsoptionen, sodass KMUs eine für ihre Bedürfnisse passenden Lösung finden können. Da viele Handwerksbetriebe KMUs sind, profitieren sie davon, dass durch die neuen Regelungen für sie eine höhere Nachfrage nach ihren Dienstleistungen generiert werden kann und sie zudem neue Dienstleistungen anbieten können (vgl. § 60a, § 60b und § 64 GEG)
(1) Erfüllungsaufwand außer Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung
(a) Zusammenfassung
Durch das Gesetz entsteht für die Wirtschaft ein jährlicher Erfüllungsaufwand von insgesamt ca. 1,12 Milliarden. Euro. Summiert über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (drei bis 20 Jahre) stehen dem jeweils Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von rund 1,558 Milliarden Euro gegenüber.
Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 12,472 Milliarden Euro. Dem stehen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (drei bis 20 Jahre) insgesamt rund 35,903 Milliarden Euro gegenüber.
(b) Im Einzelnen
Die Streichung der Vorgaben der §§ 34 bis 45 und der §§ 52 bis 56 GEG verursacht keine Be- oder Entlastungen der Wirtschaft.
Die Änderung von § 51 Absatz 1 Nummer 2 GEG und die Einführung des neuen § 51 Absatz 1 Satz 2 GEG (Anforderungen an ein bestehendes Gebäude bei Erweiterung und Ausbau) bewirken einen jährlichen Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 60,1 Millionen Euro.
Durch die neu eingeführten Heizungsoptimierungspflichten (§§ 60a, 60b und in § 64) entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 540.000 Euro. Für die betroffenen Anlagen ergeben sich Einsparungen, die sich über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (drei bis 20 Jahre) auf insgesamt rund 2,3 Millionen Euro summieren. Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 72 Millionen Euro. Dem stehen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (3 bis 20 Jahre) wiederum Einsparungen von ca. 203 Millionen Euro gegenüber. Daneben entstehen jährliche Fortbildungskosten von ca. 3,9 Millionen Euro und einmalige Fortbildungskosten von ca. 38,5 Millionen Euro.
Die Neuregelung für Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakältesysteme in Anlage 8 bewirkt außerdem einen jährlichen Erfüllungsaufwand in Höhe von 2 Millionen Euro. Durch die zusätzliche Dämmung werden über 20 Jahre ca. 10,4 Millionen Euro eingespart.
Insgesamt ergibt sich für die verpflichtend vorgesehene Messausstattung und Gebäudeautomation von neu eingebauten Heizungsanlagen nach § 71a Absatz 1 bis 3 GEG ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 517.000 Euro pro Jahr. Durch die Vorgaben für die Gebäudeautomation nach § 71a Absatz 4 bis 7 entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von ca. 1,052 Milliarden Euro. Zusätzlich einsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 12,4 Milliarden Euro. Dem jährlichen Erfüllungsaufwand stehen Einsparungen über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von rund 1,538 Milliarden Euro gegenüber. Dem einmaligen Erfüllungsaufwand stehen Einsparungen über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von ca. 35,7 Milliarden Euro gegenüber.
Die Änderung der Heizkostenverordnung (Streichung der Ausnahme der Erfassungs- und Abrechnungspflicht nach Verbrauch bei Wärmepumpen) verursacht einen jährlichen Erfüllungsaufwand von ca. 1,5 Millionen Euro. Dem stehen Einsparungen von ca. 8,4 Millionen Euro über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (20 Jahre) gegenüber.
Erfüllungsaufwand Wirtschaft (exklusive Heizen mit Erneuerbaren)
Jährlicher Erfüllungsaufwand
Einsparungen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Einsparungen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen
1,12 Milliarden Euro
1,558 Milliarden Euro
12,472 Milliarden Euro
35,903 Milliarden Euro
(2) Erfüllungsaufwand Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung
Durch die Vorgabe für die Nutzung von erneuerbaren Energien beim Einbau von neuen Heizungsanlagen entsteht der Wirtschaft bis zum Jahr 2028 ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 2,693 Milliarden Euro. Dem stehen Einsparungen über die Betriebszeit von 18 Jahren in Höhe von rund 8,268 Milliarden Euro gegenüber. Ab dem Jahr 2029 beträgt der jährliche Erfüllungsaufwand nur noch rund 2,534 Milliarden Euro. Dem stehen Einsparungen von rund 8,222 Milliarden Euro gegenüber.
Jährlicher Erfüllungsaufwand Wirtschaft
Investitionskosten
Einsparungen über 18 Jahre
Bis 2028
2,693 Milliarden Euro
8,268 Milliarden Euro
Ab 2029
2,534 Milliarden Euro
8,222 Milliarden Euro
E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
(1) Erfüllungsaufwand außer Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung
(a) Zusammenfassung
Durch das Gesetz entsteht für die Verwaltung ein jährlicher Erfüllungsaufwand von insgesamt 112 Millionen Euro. Summiert über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (fünf bis 20 Jahre) stehen dem jeweils Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von rund 158 Millionen Euro gegenüber.
Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 1,243 Milliarden Euro. Dem stehen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (fünf bis 20 Jahre) insgesamt 3,586 Milliarden Euro gegenüber.
Hiervon sind 1 Prozent der Kosten dem Bund und 99 Prozent den Ländern und Kommunen zuzurechnen, wenn man darauf abstellt, wie viele Gebäude sich schätzungsweise im Eigentum des Bundes und der Länder befinden. Es existieren keine Daten zu der genauen Aufteilung von Nichtwohngebäuden und Wohngebäuden auf Bund, Länder und Kommunen, weshalb diese Aufteilung auf einer auf Annahmen basierenden Schätzung des Statistischen Bundesamtes beruht.
(b) Im Einzelnen
Die Streichung der Vorgaben der §§ 34 bis 45 und der §§ 52 bis 56 GEG verursacht keine Be- oder Entlastungen der Verwaltung.
Die Änderung von § 51 Absatz 1 Nummer 2 GEG und die Einführung des neuen § 51 Absatz 1 Satz 2 GEG (Anforderungen an ein bestehendes Gebäude bei Erweiterung und Ausbau) bewirken einen jährlichen Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 6 Millionen Euro.
Durch die neu eingeführten Heizungsoptimierungspflichten (§§ 60a, 60b und in § 64) entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 62.905 Euro. Für die betroffenen Anlagen ergeben sich Einsparungen, die sich über die Lebensdauer der jeweils betroffenen Anlagen auf rund 184.000 Euro summieren. Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 2,6 Millionen Euro. Dem stehen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (fünf bis 20 Jahre) wiederum Einsparungen von ca. 16 Millionen Euro gegenüber.
Die Neuregelung für Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakältesysteme in Anlage 8 bewirkt außerdem einen jährlichen Erfüllungsaufwand 420.000 Euro. Durch die zusätzliche Dämmung werden über 20 Jahre ca. 2,1 Millionen Euro eingespart.
Insgesamt ergibt sich für die verpflichtend vorgesehene Messausstattung und Gebäudeautomation von neu eingebauten Heizungsanlagen nach § 71a Absatz 1 bis 3 GEG ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 81.900 Euro pro Jahr. Durch die Vorgaben für die Gebäudeautomation nach § 71a Absatz 4 bis 7 entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von ca. 105 Millionen Euro. Zusätzlich entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 1,24 Milliarden Euro. Dem jährlichen Erfüllungsaufwand stehen Einsparungen über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von ca. 154 Millionen Euro gegenüber. Dem einmaligen Erfüllungsaufwand stehen Einsparungen über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von ca. 3,57 Milliarden Euro gegenüber.
Die Änderung der Heizkostenverordnung (Streichung der Ausnahme der Erfassungs- und Abrechnungspflicht nach Verbrauch bei Wärmepumpen) verursacht einen jährlichen Erfüllungsaufwand von ca. 299.288 Euro. Dem stehen Einsparungen von ca. 1,7 Millionen Euro über die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (20 Jahre) gegenüber.
Erfüllungsaufwand Verwaltung (exklusive Heizen mit Erneuerbaren)
Jährlicher Erfüllungsauf- wand
Einsparungen über die je- weilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Einsparungen über die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen
112 Millionen Euro
158 Millionen Euro
1,243 Milliarden Euro
3,586 Milliarden Euro
(2) Erfüllungsaufwand Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung
Durch die Vorgabe für die Nutzung von Erneuerbaren Energien beim Einbau von neuen Heizungsanlagen entsteht der Verwaltung bis zum Jahr 2028 ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 449 Millionen Euro. Dem stehen Einsparungen über die Betriebszeit der Heizungsanlagen von 18 Jahren in Höhe von rund 974 Millionen Euro gegenüber. Ab dem Jahr 2029 beträgt der jährliche Erfüllungsaufwand nur noch rund 344 Millionen Euro. Dem stehen Einsparungen von rund 945 Millionen Euro gegenüber.
Jährlicher Erfüllungsaufwand Verwaltung
Investitionskosten
Einsparungen über 18 Jahre
Bis 2028
449 Millionen Euro
974 Millionen Euro
Ab 2029
344 Millionen Euro
945 Millionen Euro
F. Weitere Kosten
Bei neuen Informations- und Dokumentations- sowie Schulungspflichten für Dienstleister ist denkbar, dass diese die Kosten an ihre Kunden weitergeben und sich somit die Preise für die Dienstleistungen erhöhen. Bei der Annahme der Sachkosten wurden dieses Kosten jeweils eingepreist. Zudem können die durch die Änderung der Heizkostenverordnung entstehenden Kosten an die Nutzer der Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten weitergegeben werden. Die Schornsteinfeger erheben zudem Gebühren für ihren neuen Aufgaben nach der Gebührenordnung.
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehrund Überprüfungsordnung
Vom ...
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes
Das Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 18a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert1):
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Nach der Angabe zu § 9 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 9a Länderregelung“.
b) Teil 2 wird wie folgt geändert:
aa) Die Angabe zur Überschrift von Teil 2 Abschnitt 4 wird gestrichen.
bb) Die Angaben zu den §§ 34 bis § 45 werden durch folgende Angaben ersetzt:
㤠34 (weggefallen)
§ 35 (weggefallen)
§ 36 (weggefallen)
§ 37 (weggefallen)
§ 38 (weggefallen)
§ 39 (weggefallen)
§ 40 (weggefallen)
§ 41 (weggefallen)
§ 42 (weggefallen)
§ 43 (weggefallen)
§ 44 (weggefallen)
§ 45 (weggefallen)“.
c) Die Angabe von Teil 3 wird wie folgt gefasst:
„Teil 3 Anforderungen an bestehende Gebäude“.
d) Die Angabe zur Überschrift von Teil 3 Abschnitt 1 wird gestrichen.
e) Die Angabe zur Überschrift von Teil 3 Abschnitt 2 wird gestrichen.
f) Die Angaben zu den §§ 52 bis 56 wird durch folgende Angabe ersetzt:
㤠52 (weggefallen)
§ 53 (weggefallen)
§ 54 (weggefallen)
§ 55 (weggefallen)
§ 56 (weggefallen)“.
g) Nach der Angabe zu § 60 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 60a Betriebsprüfung von Wärmepumpen
§ 60b Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung
§ 60c Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung“.
h) Die Angabe zu Teil 4 Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 wird wie folgt gefasst:
„Unterabschnitt 4
Anforderungen an Heizungsanlagen; Betriebsverbot für Heizkessel
§ 71 Anforderungen an Heizungsanlagen
§ 71a Messausstattung von Heizungsanlagen, Informationspflichten, Gebäudeautomation
§ 71b Anforderungen bei Anschluss an ein Wärmenetz und Pflichten für Wärmenetzbetreiber
§ 71c Anforderungen an die Nutzung einer Wärmepumpe
§ 71d Anforderungen an die Nutzung einer Stromdirektheizung
§ 71e Anforderungen an eine solarthermische Anlage
§ 71f Anforderungen an Biomasse und Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate
§ 71g Anforderungen an eine Heizungsanlage bei Nutzung von fester Biomasse
§ 71h Anforderungen an eine Wärmepumpen-Hybridheizung
§ 71i Übergangsfristen bei Heizungshavarien
§ 71j Übergangsfristen bei Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes
§ 71k Übergangsfristen bei einer Heizungsanlage, die sowohl Erdgas als auch Wasserstoff verbrennen kann
§ 71l Übergangsfrist bei einer Etagenheizung oder einer Einzelraumfeuerungsanlage
§ 71m Übergangsfrist bei einer Hallenheizung
§ 71n Verfahren für Gemeinschaften der Wohnungseigentümer
§ 71o Regelungen zum Schutz von Mietern
§ 71p Verordnungsermächtigung zu dem Einsatz von Kältemitteln in elektrischen Wärmepumpen und Wärmepumpen-Hybridheizungen
§ 72 Betriebsverbot für Heizkessel
§ 73 Ausnahme“.
i) Nach der Angabe zu § 114 wird folgende Angabe angefügt:
„§ 115 Übergangsvorschrift für Geldbußen“.
2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„ (1) Ziel dieses Gesetzes ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu leisten. Dies soll durch wirtschaftliche und sozialverträgliche Maßnahmen zum effizienten Einsatz von Energie sowie der zunehmenden Nutzung von erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme für die Energieversorgung von Gebäuden erreicht werden.“
b) In Absatz 2 werden die Wörter „Schonung fossiler“ durch die Wörter „stetige Reduktion von fossilen“ ersetzt.
c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„ (3) Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage sowie der dazugehörigen Nebenanlagen zur Erzeugung sowie zum Transport von Wärme, Kälte und Strom aus erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaßnahmen in Gebäuden liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis der Gebäudebetrieb im Bundesgebiet treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaßnahmen als vorrangige Belange in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden.“
3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefügt:
„4a. „blauer Wasserstoff“ Wasserstoff, der durch Reformation oder Pyrolyse aus Erdgas hergestellt wird und der den nach Maßgabe der delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852) des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeidet (ABl. L 442 vom 9.12.2021, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 (ABl. L 188 vom 15.7.2022, S. 1) geändert worden ist, geltenden technischen Bewertungskriterien zum Nachweis des wesentlichen Beitrags zum Klimaschutz genügt; in Bezug auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen muss danach der Mindestschwellenwert für die Einsparung der Lebenszyklus-THG-Emissionen von 73,4 Prozent gegenüber einem Vergleichswert für fossile Brennstoffe erreicht werden; gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) ist diese Verringerung gegenüber einem Vergleichswert von 94 Gramm Kohlendioxidäquivalent pro Megajoule nachzuweisen, indem das entstehende Kohlendioxid abgeschieden und gespeichert oder in Produkten dauerhaft gebunden wird; für die Erfüllung der Nachweispflicht für die dauerhafte Speicherung oder Bindung des Kohlendioxids gelten die Vorgaben gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwachung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 (ABl. L 442 vom 9.12.2021, S. 1) geändert worden ist, oder entsprechende EU-Vorgaben; die Einsparungen bei den Lebenszyklus-Treibhausgas-Emissionen werden nach der in Artikel 28 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82; ABl. L 139 vom 18.5.2022, S. 1) genannten Methode oder alternativ gemäß ISO 14067:2018 (119) oder ISO 140641:2018 (120) berechnet; soweit die EU in einem anderen verbindlichen Rechtsakt für die Herstellung von blauem Wasserstoff für die im Rahmen dieses Gesetzes einschlägigen Einsatzfelder andere Nachhaltigkeitsanforderungen vorgibt, sind diese anzuwenden,“.
bb) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt:
„8a. „Energieleistungsvertrag“ eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Begünstigten und dem Erbringer einer Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung, die während der gesamten Vertragslaufzeit einer Überprüfung und Überwachung unterliegt und in deren Rahmen Investitionen für Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen in die betreffende Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung in Bezug auf einen vertraglich vereinbarten Umfang an Energieeffizienzverbesserungen oder ein anderes vereinbartes Energieleistungskriterium, wie finanzielle Einsparungen, getätigt werden,“.
cc) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a eingefügt:
„9a. „Gebäudenetz“ ein Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme und Kälte von mindestens zwei und bis zu 16 Gebäuden und bis zu 100 Wohneinheiten,“.
dd) Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 10a eingefügt:
„10a. „gebäudetechnische Systeme“ die technische Ausrüstung eines Gebäudes oder Gebäudeteils für Raumheizung, Raumkühlung, Lüftung, Warmwasserbereitung für den häuslichen Gebrauch, eingebaute Beleuchtung, Gebäudeautomatisierung und -steuerung, Elektrizitätserzeugung am Gebäudestandort oder für eine Kombination derselben, einschließlich Systemen, die Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen,“.
ee) Nach Nummer 13 werden folgende Nummern 13a und 13b eingefügt:
„13a. „größere Renovierung“ die Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Prozent der wärmeübertragenden Umfassungsfläche einer Renovierung unterzogen werden,
13b. „grüner Wasserstoff“ Wasserstoff, der die Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 7 sowie Artikel 28 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 in der jeweils geltenden Fassung, erfüllt, wobei der Wasserstoff zur Speicherung oder zum Transport auch in anderen Energieträgern chemisch oder physikalisch gespeichert werden kann,“.
ff) Nach Nummer 14 wird folgende Nummer 14a eingefügt:
„14a. „Heizungsanlage“ eine Anlage zur Erzeugung von Raumwärme, Warmwasser oder einer Kombination davon einschließlich Hausübergabestationen, mit Ausnahme von handbeschickten Einzelraumfeuerungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 3 und offenen Kaminen nach § 2 Nummer 12 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4676) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,“.
gg) Nummer 16 wird wie folgt gefasst:
„16. (weggefallen),“.
hh) In Nummer 29 wird das Wort „Festkörper-Wärmespeichern“ durch das Wort „Wärmespeichern“ ersetzt.
ii) Nach Nummer 29 wird folgende Nummer 29a eingefügt:
„29a. „System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung“ ein System, das sämtliche Produkte, Software und Engineering-Leistungen umfasst, mit denen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher und sicherer Betrieb gebäudetechnischer Systeme durch automatische Steuerungen sowie durch die Erleichterung des manuellen Managements dieser gebäudetechnischen Systeme unterstützt werden kann,“.
jj) Nach Nummer 30 wird die folgende Nummer 30a eingefügt:
„30a. „unvermeidbare Abwärme“ der Anteil der Wärme, der als Nebenprodukt in einer Industrie- oder Gewerbeanlage oder im tertiären Sektor aufgrund thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten anfällt, nicht durch Anwendung des Standes der Technik vermieden werden kann, in einem Produktionsprozess nicht nutzbar ist und ohne den Zugang zu einem Wärmenetzungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet werden würde,“.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 5 wird die Angabe „; oder“ durch ein Komma ersetzt.
bb) Die Nummer 6 wird durch folgende Nummern 6 und 7 ersetzt:
„ 6. die aus grünem Wasserstoff oder den daraus hergestellten Derivaten erzeugte Wärme oder
7. die dem Erdboden oder dem Wasser entnommene und technisch nutzbar gemachte oder aus Wärme nach den Nummern 1 bis 6 technisch nutzbar gemachte Kälte.“
c) Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„B1.io masse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), in der jeweils geltenden Fassung,“.
4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Wörter „grundlegenden Renovierung gemäß § 52 Absatz 2“ durch die Wörter „größeren Renovierung gemäß § 3 Nummer 13a“ ersetzt.
b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„ (4) Die Länder können durch Landesrecht für öffentliche Gebäude, mit Ausnahme der öffentlichen Gebäude des Bundes, eigene Regelungen zur Erfüllung der Vorbildfunktion treffen und zu diesem Zweck von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichen. Hiervon ausgenommen sind Vorgaben für die Berechnungsgrundlagen und -verfahren nach Teil 2 Abschnitt 3.“
5. In § 6a Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz“ durch die Wörter „Bundesministerium der Justiz“ ersetzt.
6. In § 7 Absatz 1 und 5 werden jeweils die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch „Wirtschaft und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ durch die Wörter „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ ersetzt.
7. In § 9 Absatz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ durch die Wörter „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ ersetzt.
8. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:
㤠9a
Länderregelung
Die Länder können durch Landesrecht weitergehende Anforderungen an die Erzeugung und Nutzung von Strom oder Wärme sowie Kälte aus erneuerbaren Energien in räumlichem Zusammenhang mit Gebäuden sowie weitergehende Anforderungen oder Beschränkungen an Stromdirektheizungen stellen.“
9. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„ 3. die Anforderungen nach den §§ 71 bis 71h erfüllt werden.“
b) Absatz 5 wird aufgehoben.
10. § 22 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ ersetzt und die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ werden durch die Wörter „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ ersetzt.
b) In Satz 3 wird das Wort „Fernwärmenetz“ durch das Wort „Wärmenetz“ ersetzt.
c) In Satz 4 werden die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ ersetzt und die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ werden durch die Wörter „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ ersetzt.
11. § 31 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „und 34 bis 45“ gestrichen.
b) In Absatz 2 werden die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ durch die Wörter „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ ersetzt.
12. Die Überschrift von Teil 2 Abschnitt 4 wird gestrichen.
13. Die Angaben §§ 34 bis 45 werden wie folgt gefasst:
㤠34 (weggefallen)
§ 35 (weggefallen)
§ 36 (weggefallen)
§ 37 (weggefallen)
§ 38 (weggefallen)
§ 39 (weggefallen)
§ 40 (weggefallen)
§ 41 (weggefallen)
§ 42 (weggefallen)
§ 43 (weggefallen)
§ 44 (weggefallen)
§ 45 (weggefallen)“.
14. Die Überschrift von Teil 3 wird wie folgt gefasst:
„Teil 3
Anforderungen an bestehende Gebäude“.
15. Die Überschrift von Teil 3 Abschnitt 1 wird gestrichen.
16. In § 47 Absatz 4 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung selbst bewohnt“ eingefügt.
17. In § 50 Absatz 4 Satz 4 werden die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ durch die Wörter „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ ersetzt.
18. In § 51 Absatz 1 wird folgender Satz wird angefügt :
„Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in Fällen, bei denen die hinzukommende zusammenhängende Nutzfläche mehr als 100 Prozent der Nutzfläche des bisherigen Gebäudes beträgt oder größer als 250 Quadratmeter ist, die Anforderungen nach den §§ 18 und 19 einzuhalten.“
19. Die Überschrift von Teil 3 Abschnitt 2 wird gestrichen.
20. Die Angaben §§ 52 bis 56 werden wie folgt gefasst:
㤠52 (weggefallen)
§ 53 (weggefallen)
§ 54 (weggefallen)
§ 55 (weggefallen)
§ 56 (weggefallen)“.
21. Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt:
㤠60a
Prüfung und Optimierung von Wärmepumpen
(1) Wärmepumpen, die als Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten oder zur Einspeisung in ein Gebäudenetz, an das mindestens sechs Wohnungen oder sonstige selbständige Nutzungseinheiten angeschlossen sind, nach Ablauf des 31. Dezember 2023 eingebaut oder aufgestellt werden, müssen nach einer vollständigen Heizperiode, spätestens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme, einer Betriebsprüfung unterzogen werden. Satz 1 ist nicht für Warmwasser-Wärmepumpen oder Luft-Luft-Wärmepumpen anzuwenden. Die Betriebsprüfung nach Satz 1 muss für Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen, spätestens alle fünf Jahre wiederholt werden.
(2) Die Betriebsprüfung nach Absatz 1 umfasst:





























