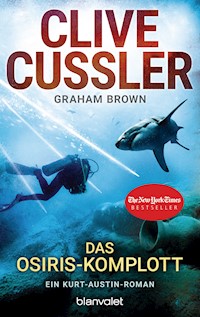
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Tariq Shakir ist einer der mächtigsten Männer Nordafrikas, und sein Traum von einem neuen ägyptischen Reich, das selbst das der Pharaonen in den Schatten stellt, ist zum Greifen nah. Denn in der Stadt der Toten wurde eine Pflanze entdeckt, deren Saft das Leben beenden, aber auch den Tod besiegen kann. Kurt Austin und sein NUMA-Team setzen alles daran, die Wahrheit hinter den Legenden aufzudecken. Aber um das zu erreichen, müssen sie der größten Legende Ägyptens gegenübertreten: Osiris, dem Herrscher der Unterwelt.
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Kurt Austin nicht entgehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein New York Times-Bestseller. Auch auf der deutschen Spiegel-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Der leidenschaftliche Pilot Graham Brown hält Abschlüsse in Aeronautik und Rechtswissenschaften. In den USA gilt er bereits als der neue Shootingstar des intelligenten Thrillers in der Tradition von Michael Crichton. Wie keinem zweiten Autor gelingt es Graham Brown verblüffende wissenschaftliche Aspekte mit rasanter Nonstop-Action zu einem unwiderstehlichen Hochspannungscocktail zu vermischen.
Die Kurt-Austin-Romane bei Blanvalet
1. Tödliche Beute
2. Brennendes Wasser
3. Das Todeswrack
4. Killeralgen
5. Packeis
6. Höllenschlund
7. Flammendes Eis
8. Eiskalte Brandung
9. Teufelstor
10. Höllensturm
11. Codename Tartarus
12. Todeshandel
13. Das Osiris-Komplott
Clive Cussler& Graham Brown
DAS OSIRIS-KOMPLOTT
Ein Kurt-Austin-Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
PROLOG
IN DER TOTENSTADTAbydos, Ägypten1336 v. Chr., im siebzehnten Jahr der Herrschaft des Pharaos Echnaton
Der Vollmond warf einen bläulichen Schimmer auf den ägyptischen Wüstensand, verlieh den Dünen die Farbe von Schnee und machte aus den verlassenen Tempeln von Abydos Bauwerke aus Alabaster und Knochen. Das helle Licht des Nachtgestirns erzeugte Schatten, die gerade über die Säulen und Mauern glitten, als eine Prozession von Eindringlingen durch die Totenstadt wanderte.
Sie bewegten sich mit langsamen, feierlichen Schritten durch die Nekropole, dreißig Männer und Frauen, die Gesichter von den Kapuzen wallender Gewänder verhüllt, die Augen auf den Weg gerichtet, der vor ihnen lag. Sie passierten sowohl die Grabkammern, in denen die Pharaonen der Ersten Dynastie ruhten, als auch die Schreine und Monumente, die während des Mittleren Reiches zu Ehren der Götter errichtet worden waren.
An einer Kreuzung, wo der Treibsand den erhöhten Fußweg bedeckte, kam die Prozession schweigend zum Stehen. Ihr Anführer, Manu-hotep, blickte in die Dunkelheit, den Kopf lauschend zur Seite geneigt, und fasste den Speer mit festerem Griff.
»Hast du etwas gehört?«, fragte eine weibliche Stimme hinter ihm.
Sie gehörte seiner Frau, die jetzt über seine Schulter blickte. Hinter ihnen warteten mehrere andere Familien und ein Dutzend Diener, die Bahren trugen. Auf ihnen lagen die Kinder einer jeden Familie, alle von der gleichen rätselhaften Krankheit dahingestreckt.
»Stimmen«, sagte Manu-hotep. »Ein Flüstern.«
»Aber die Stadt ist verlassen«, sagte die Frau. »Die Nekropole zu betreten, ist laut dem Erlass des Pharaos ein Verbrechen. Selbst wir riskieren den Tod, indem wir uns hier aufhalten.«
Er schlug die Kapuze seines Mantels zurück. Zum Vorschein kamen ein glatt rasierter Schädel und eine goldene Halskette, die ihn als Mitglied von Echnatons Hofstaat auswies. »Niemand ist sich dessen deutlicher bewusst als ich.«
Über Jahrhunderte hatte Abydos, die Totenstadt, in voller Blüte gestanden, bevölkert von Priestern und gläubigen Anhängern von Osiris, dem Herrscher des Totenreichs und Gott der Fruchtbarkeit. Die Pharaonen der früheren Dynastien waren dort begraben worden, und obgleich zahlreiche Könige der jüngeren Zeit an anderen Orten die ewige Ruhe fanden, hatten sie doch gerade dort immer wieder neue Tempel und Monumente zu Osiris’ Ehren errichtet. Alle – mit Ausnahme von Echnaton.
Fünf Jahre nachdem er seinem Vater Amenophis III. als Amenophis IV. auf den Thron gefolgt war, hatte er etwas Unvorstellbares getan: Zuerst hatte er seinen Namen in Echnaton geändert, und dann hatte er die alten Götter abgeschafft, hatte ihre Anzahl per Dekret erst drastisch reduziert und dann den ägyptischen Götterhimmel zerschlagen und durch einen einzelnen Gott seiner Wahl ersetzt. Dies war Aton, der Sonnengott, dem die Priester und Untertanen von nun an huldigen mussten.
Deshalb wurde die Totenstadt aufgegeben, und Priester und Anbeter hatten sie schon vor langer Zeit verlassen. Jedem, der innerhalb ihrer Grenzen angetroffen wurde, drohte die Todesstrafe. Jemandem wie Manu-hotep jedoch, der zum Hofstaat des Pharaos gehörte, drohte noch Schlimmeres: unbarmherzige Folter, bis er seine Verfehlung ausdrücklich bereute und darum bat, getötet zu werden.
Ehe Manu-hotep weitersprechen konnte, nahm er eine Bewegung wahr. Aus der Dunkelheit stürmten drei Männer Waffen schwingend auf die Gruppe zu.
Manu-hotep stieß seine Frau in die Schatten zurück, benutzte den Speer in seiner Hand als Lanze und stieß zu. Er traf den Anführer des Trios in der Brust und spießte ihn auf. Aber der zweite Mann kam hinter ihm hervor und griff Manu-hotep mit einem bronzenen Dolch an.
Als er sich wegdrehte, um der Klinge auszuweichen, geriet Manu-hotep ins Straucheln und stürzte. Im Sand liegend, riss er den Speer an sich und stieß ihn dem zweiten Angreifer entgegen. Er verfehlte ihn zwar, aber während der Mann zurückwich, drang eine zweite Speerspitze durch seinen Körper und ragte in Magenhöhe aus seinem Leib, als einer der Diener in den Kampf eingriff. Der verwundete Mann sank auf die Knie, schnappte keuchend nach Luft und schaffte es nicht einmal mehr, einen Schmerzenslaut von sich zu geben. Als er sich im Sand ausstreckte, hatte der dritte Angreifer bereits kehrtgemacht und rannte um sein Leben.
Manu-hotep erhob sich und schleuderte den Speer mit einer kraftvollen Körperdrehung. Er verfehlte sein Ziel nur um wenige Zentimeter, und der flüchtende Angreifer verschwand in der Nacht.
»Grabräuber?«, fragte jemand.
»Oder Spione«, sagte Manu-hotep. »Ich habe schon seit Tagen das Gefühl, dass wir verfolgt werden. Wir müssen uns beeilen. Wenn er es schafft, dem Pharao Meldung zu machen, werden wir den nächsten Morgen nicht erleben.«
»Vielleicht sollten wir diesen Ort lieber verlassen«, drängte seine Frau. »Ich glaube, dass das, was wir vorhaben, ein Fehler ist.«
»Echnaton zu folgen, war ein Fehler«, sagte Manu-hotep. »Der Pharao ist ein Ketzer. Weil wir ihn unterstützt haben, bestraft uns Osiris jetzt. Gewiss hast du bemerkt, dass nur unsere Kinder in den tiefen Schlaf gefallen sind, aus dem sie nicht mehr aufwachen; nur unser Vieh ist auf der Weide verendet. Wir müssen Osiris um Gnade bitten. Und wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und sollten es so bald wie möglich tun.«
Während dieser Worte festigte sich Manu-hoteps Entschluss. In den langen Jahren der Regentschaft Echnatons war jeglicher Widerstand mit Waffengewalt gebrochen worden, aber die Götter hatten begonnen, selbst Rache zu üben, und jene, die dem Pharao gefolgt waren, traf es am schlimmsten.
»Hier entlang«, sagte Manu-hotep.
Sie drangen nun tiefer in die verlassene Stadt ein und erreichten schon bald das größte Bauwerk der Nekropole, den Tempel des Osiris.
Breit und mit einem flachen Dach versehen, das seine Weitläufigkeit unterstrich, war der Tempel von hohen Säulen umgeben, die wie riesige steinerne Pflanzenschösslinge aus mächtigen Granitblöcken in den nächtlichen Himmel wuchsen. Eine breite Rampe führte zu einer Plattform aus sorgfältig geglätteten Steinplatten hinauf. Roter Marmor aus Äthiopien wechselte sich mit blauem Lapislazuli aus Persien ab. Den Eingang zum Tempel bildeten zwei mächtige bronzene Torflügel.
Manu-hotep blieb vor ihnen stehen und zog sie mit erstaunlicher Leichtigkeit auf. Der Geruch von Weihrauch wallte ihm entgegen, und der Anblick von Feuer vor dem Altar sowie lodernden Fackeln in Wandhalterungen überraschte ihn. Im flackernden Lichtschein waren Sitzbänke zu erkennen, die man zu einem Halbkreis angeordnet hatte. Tote Männer, Frauen und Kinder lagen darauf, umringt von schluchzenden und Gebete flüsternden Angehörigen ihrer Familien.
»Anscheinend sind wir nicht die Einzigen, die sich über Echnatons Verbot hinwegsetzen«, stellte Manu-hotep fest.
Einige der im Tempel Anwesenden wandten sich zu ihm um, zeigten darüber hinaus jedoch keinerlei Reaktion.
»Schnell«, trieb er seine Diener zur Eile an.
Sie kamen im Gänsemarsch herein und legten die Leiber der Kinder überall dort ab, wo sie Platz fanden, während sich Manu-hotep dem prachtvollen Altar des Osiris näherte. Dort kniete er mit gesenktem Kopf neben dem Feuer nieder und verbeugte sich, um ein Gebet zu sprechen. Aus den Falten seines Mantels zog er zwei Straußenfedern hervor.
»Gebieter der Toten, in tiefer Not kommen wir zu dir«, flüsterte er. »Unsere Familien wurden von großem Leid heimgesucht. Unsere Heime sind verflucht, unsere Äcker und Weiden sind unfruchtbar und wertlos. Wir bitten dich, hab Erbarmen mit unseren Toten und nimm sie gnädig im Jenseits auf. Dich, der du das Tor des Totenreiches bewachst, der du über die Wiedergeburt des Korns aus der gefallenen Saat gebietest, flehen wir an: Gib unseren Heimen und unserem Land das Leben zurück.«
Ehrfürchtig legte er die Federn nieder, streute eine Mischung aus Quarzsand und Goldstaub darauf und trat vom Altar zurück.
Ein Windstoß wehte durch den Altarraum und bog die Flammen zur Seite. Ein dumpfes Dröhnen folgte und brach sich als vielfältiges Echo an den Wänden der Tempelhalle.
Erschreckt fuhr Manu-hotep herum und konnte gerade noch sehen, wie die mächtigen Torflügel am Ende des Tempels zuschlugen. Beunruhigt bemerkte er, dass die Fackeln an den Wänden heftig flackerten und zu verlöschen drohten. Aber dann beruhigten sie sich und brannten gleich wieder so hell wie zuvor. In ihrem Licht gewahrte er die Umrisse mehrerer Gestalten hinter dem Altar, wo vor einem Augenblick noch niemand gestanden hatte.
Vier von ihnen waren in schwarze und goldene Gewänder gehüllt – Priester des Osiris-Kults. Der Fünfte jedoch war anders gekleidet, so als sei er der Herrscher der Unterwelt persönlich. Seine Arme und Hüften waren mit dem Stoff umwickelt, in den gewöhnlich die Mumien der Toten eingehüllt wurden. Armreifen und Halsketten aus Gold funkelten auf grünlich schimmernder Haut, und eine Krone aus geflochtenen Straußenfedern schmückte seinen Kopf.
In der einen Hand hielt diese Gestalt einen Schäferstab, in der anderen einen goldenen Flegel, um den Weizen zu dreschen und das lebendige Korn von der toten Spreu zu trennen. »Ich bin der Bote des Osiris«, sagte dieser Priester. »Das Abbild von dem Großen Herrscher des Totenreichs.«
Die Stimme war tief und volltönend und hatte einen nicht mehr irdischen Klang. Jeder der im Tempel Anwesenden verneigte sich, und die Priester zu beiden Seiten des Altars traten vor. Sie schritten um die Toten herum und verstreuten Laubblätter, Blüten und, wie es Manu-hotep erschien, getrocknete Hautfetzen von Schlangen und Eidechsen.
»Du erbittest die Gnade des Osiris«, sagte der göttliche Gesandte.
»Meine Kinder sind tot«, erwiderte Manu-hotep. »Für sie erbitte ich die Gunst eines angenehmen Lebens im Totenreich.«
»Du dienst dem Verräter«, erhielt er als Antwort. »Daher bist du es nicht wert, einer solchen Gnade teilhaftig zu werden.«
Manu-hotep hielt den Kopf gesenkt. »Ich habe meiner Zunge gestattet, Echnatons Forderungen zu verbreiten«, gestand er. »Dafür magst du mich bestrafen. Aber nimm meine Angehörigen im Jenseits auf, wie es ihnen versprochen worden war, ehe Echnaton uns verdorben hat.«
Als Manu-hotep aufzublicken wagte, sah er, dass der Avatar ihn mit schwarzen Augen fixierte.
»Nein«, sagten die Lippen schließlich. »Osiris verlangt ein Zeichen von dir. Du musst ihm beweisen, dass du aufrichtig bereust.«
Ein knochiger Finger deutete auf eine rote Amphore, die auf dem Altar stand. »Dieses Gefäß enthält ein Gift, das man nicht schmecken kann. Nimm es und träufle es in Echnatons Wein. Es wird seine Augen verdunkeln und ihn blenden. Er wird dann seine geliebte Sonne nicht mehr betrachten können, und seine Regentschaft wird enden und zu Staub zerfallen.«
»Und meine Kinder?«, fragte Manu-hotep. »Wenn ich dies tue, werden sie mit einem angenehmen Leben nach dem Tode belohnt?«
»Nein«, sagte der Priester.
»Aber warum nicht? Ich dachte, du …«
»Wenn du diesen Weg wählst«, unterbrach ihn der Priester, »wird Osiris dafür sorgen, dass deine Kinder wieder in dieser Welt leben können. Er wird den Nil erneut in einen Fluss des Lebens zurückverwandeln und zulassen, dass auch deine Felder wieder fruchtbar sind. Nimmst du diese Ehre, Osiris zu rächen, an?«
Manu-hotep zögerte. Dem Pharao den Gehorsam zu verweigern, war eine Sache, aber ihn zu ermorden …
Während er noch nachdachte, bewegte sich der Priester plötzlich und tauchte ein Ende des Flegels in das Feuer neben dem Altar. Die Lederriemen der Waffe fingen zischend Feuer, als seien sie mit Öl getränkt. Mit einer Drehung des Handgelenks schwang der Priester die Waffe hinab auf die trockenen Laubblätter und die Spreu, die von seinen Begleitern verstreut worden waren. Laub und Spreu gerieten sofort in Brand, und die Flammen folgten dem Weg, den die Priester zuvor gegangen waren, bis die Lebenden und die Toten von einem Feuerkreis umschlossen waren.
Manu-hotep wich vor den Hitzewogen zurück. Der Rauch und die Dämpfe entfalteten ihre Wirkung, verschleierten seine Sicht und störten seinen Gleichgewichtssinn. Als er den Kopf hob, erkannte er, dass ihn bereits eine ganze Flammenwand von den Priestern, die sich jetzt entfernten, trennte.
»Was hast du getan?«, schrie seine Frau.
Die Priester stiegen die Treppe hinter dem Altar hinunter. Die Flammen loderten brusthoch, und Trauernde und Tote waren in diesem Flammenring gefangen.
»Ich habe gezögert«, murmelte er. »Ich hatte Angst.«
Osiris hatte ihnen eine Chance geboten. Aber er hatte sie nicht genutzt. Hilflos und verzweifelt starrte Manu-hotep die mit Gift gefüllte Amphore auf dem Altar an. Ihre Umrisse verschwammen in der Hitze, und als sich dann eine dichte Rauchwolke auf Altar und Tempelbesucher herabsenkte, verschwand sie vollständig.
Manu-hotep erwachte von dem hellen Licht, das durch die Öffnungen im Dach des Tempels hereindrang. Das Feuer war erloschen und hatte einen Ring aus Asche übrig gelassen. Der Geruch von Rauch lag in der Luft, und die dünne Schicht einer Substanz bedeckte den Fußboden, die aussah, als hätte sich der Morgentau mit der Asche vermischt, oder so, als sei ein feiner Regen gefallen.
Ausgelaugt und verwirrt richtete er sich auf und schaute sich um. Die Torflügel am Ende der Tempelhalle standen offen. Kühle Morgenluft wehte herein. Die Priester hatten sie doch nicht getötet. Aber weshalb nicht?
Während er noch krampfhaft nach einer Erklärung suchte, bewegte sich neben ihm eine kleine Hand mit winzigen Fingern. Er wandte den Kopf und sah seine Tochter, die wie in einem krampfartigen Anfall zitterte. Dabei öffnete und schloss sich ihr Mund wie bei einem Fisch, der am Flussufer aufs Trockene geraten war.
Er streckte die Hand nach ihr aus. Sie war warm – nicht kalt – und bewegte sich und wirkte auch gar nicht mehr starr. Er konnte es kaum fassen. Sein Sohn bewegte sich ebenfalls und zuckte mit den Beinen wie ein Kind während eines heftigen Traums.
Er versuchte, die Kinder zum Sprechen zu bringen und vom Zittern zu befreien, aber beides gelang ihm nicht.
Die Kinder der anderen Familien befanden sich in dem gleichen Zustand.
»Was ist mit ihnen?«, fragte seine Frau furchtsam.
»Sie sind zwischen Leben und Tod gefangen«, vermutete Manu-hotep. »Wer kann wissen, welche Schmerzen sie erleiden müssen.«
»Was sollen wir tun?«
Jetzt galt es, nicht mehr zu schwanken. Kein Zögern mehr. »Wir tun das, was Osiris verlangt«, sagte er. »Wir blenden den Pharao.«
Er stand auf und stapfte durch die Asche zum Altar. Die rote, mit Gift gefüllte Amphore stand noch immer auf ihrem Platz, allerdings war sie jetzt rußgeschwärzt. Er ergriff sie, erleichtert und von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt. Und voller Hoffnung.
Er und die anderen verließen den Tempel und warteten darauf, dass ihre Kinder wieder sprachen oder auf sie reagierten oder auch nur zur Ruhe kamen. Es würde Wochen dauern, bevor dies geschähe, Monate, bis all jene, die wiederbelebt worden waren, den gleichen Zustand erreicht hätten, in dem sie sich befunden hatten, ehe sie der Tod ereilte. Aber zu diesem Zeitpunkt würden die Augen Echnatons ihre Sehkraft eingebüßt haben, und die Regentschaft des ketzerischen Pharaos mochte dann längst ihrem Ende entgegentaumeln.
1
Bucht von Abukir, an der Mündung des Nils1. August 1798, kurz vor Einbruch der Abenddämmerung
Der donnernde Klang von Kanonenschüssen rollte über die weite Fläche der Bucht von Abukir, während Blitze das graue Zwielicht des sinkenden Tages für kurze Momente aufhellten. Weiße Schaumfontänen wurden in die Höhe geschleudert, als gusseiserne Geschosse dicht vor ihren anvisierten Zielen im Wasser einschlugen. Aber das angreifende Schiffsgeschwader näherte sich mit hohem Tempo einer vor Anker liegenden Flotte. Die nächste Salve würde nicht vergebens abgefeuert werden.
Aus diesem Gewirr von Segelmasten entfernte sich ein Langboot, angetrieben von den starken Armen sechs französischer Matrosen. In anscheinend selbstmörderischer Mission nahm es direkten Kurs auf das Schiff, das sich im Zentrum der Schlacht befand.
»Wir kommen zu spät!«, rief einer der Ruderer.
»Pullt, was das Zeug hält!«, antwortete der einzige Offizier in der Gruppe. »Wir müssen die L’Orient erreichen, ehe die Briten sie umzingeln und die gesamte Flotte angreifen!«
Die betreffende Flotte war Napoleons große Mittelmeer-Marinestreitmacht, die aus siebzehn Schiffen inklusive dreizehn Linienschiffen bestand. Sie erwiderten die englischen Salven mit einer Serie eigener Donnerschläge, und die Szenerie versank schnell in einer Wolke dichten Pulverdampfs, noch bevor die Abenddämmerung hereinbrach.
In der Mitte des Langboots saß ein französischer Zivilist namens Emile D’Campion und fürchtete um sein Leben.
Wenn er nicht damit gerechnet hätte, jeden Moment sterben zu müssen, wäre er vielleicht von der rohen Schönheit des Panoramas beeindruckt gewesen. Der Künstler in ihm – denn er war ein bekannter Maler – hätte möglicherweise darüber nachgedacht, wie sich die Wildheit des augenblicklichen Geschehens am besten auf das unschuldige Gewebe einer Leinwand übertragen ließ. Das entsetzliche Pfeifen der Kanonenkugeln, die kreischend auf ihre Ziele zurasten. Die hohen Segelmasten, die sich wie ein Dickicht von Bäumen zusammendrängten, in banger Erwartung der Holzfälleraxt. Besondere Sorgfalt hätte er vielleicht darauf verwendet, den Kaskaden weißer Gischt den letzten rosigen und blauen Schimmer des sich verdunkelnden Himmels zu verleihen. Aber D’Campion zitterte am ganzen Körper und krampfte die Hände zu beiden Seiten um den Bootsrand, um nicht von der Sitzbank zu rutschen.
Als eine verirrte Kugel kaum einhundert Meter von ihnen entfernt ins Wasser der Bucht einschlug und einen schäumenden Krater erzeugte, konnte er nicht mehr an sich halten und musste seiner Angst mit einer in dieser Situation eigentlich unsinnigen Frage Luft machen: »Weshalb in Gottes Namen schießen sie auf uns?«
»Das tun sie gar nicht«, erwiderte der Offizier.
»Wie wollen Sie dann erklären, weshalb die Kanonenkugeln so nahe bei uns einschlagen?«
»Die übliche englische Schießkunst«, sagte der Offizier. »Sie ist extrêmement pauvre. Absolut armselig.«
Die Matrosen lachten. Ein wenig zu heftig, zu laut, dachte D’Campion. Sie hatten ebenfalls Angst. Seit Monaten wussten sie, dass sie der Fuchs waren, den die englischen Hunde jagten. Sie hatten einander in Malta um nur eine Woche verfehlt und in Alexandrien um nicht mehr als vierundzwanzig Stunden. Nun, nachdem Napoleons Heer an Land gegangen war und sie in der Mündung des Nils ankerten, hatten die Engländer und ihr Jagdführer, Horatio Nelson, schließlich die Witterung aufgenommen.
»Ich muss wohl unter einem unglücklichen Stern geboren worden sein«, murmelte D’Campion halblaut. »Ich sage, wir kehren um.«
Der Offizier schüttelte den Kopf. »Meine Befehle verlangen, dass ich Sie und diese Koffer zu Admiral Brueys d’Aigalliers an Bord der L’Orient bringe.«
»Ich kenne Ihre Befehle«, entgegnete D’Campion. »Ich war zugegen, als Napoleon sie formulierte. Aber wenn Sie vorhaben, dieses Boot zwischen die Kanonen der L’Orient und der Schiffe Nelsons zu lenken, dann werden Sie am Ende nur fertigbringen, dass wir alle den Tod finden. Wir müssen umkehren, entweder zum Strand oder zu einem der anderen Schiffe.«
Der Offizier wandte sich von seinen Männern ab und blickte über die Schulter in das Zentrum der Schlacht. Die L’Orient war das größte und stärkste Kriegsschiff der Welt. Sie war eine schwimmende Festung, wog fünftausend Tonnen und hatte eine Mannschaft von über eintausend Männern. Flankiert wurde sie von zwei anderen französischen Linienschiffen und befand sich damit in einer unangreifbaren Verteidigungsposition. Nur dass offenbar niemand die Briten davon in Kenntnis gesetzt hatte, deren kleinere Schiffe sie direkt und unbehelligt angriffen.
Breitseiten wurden auf kürzeste Entfernung zwischen der L’Orient und dem britischen Kriegsschiff Bellerophon ausgetauscht. Das kleinere englische Schiff bekam am meisten ab, da seine Steuerbordreling zu Brennholz zertrümmert wurde und zwei seiner Masten brachen und umkippten und auf die Decks krachten. Die Bellerophon trieb manövrierunfähig nach Süden, aber noch während sie sich aus dem Schlachtgeschehen entfernte, füllten andere englische Schiffe augenblicklich die Lücke, die sie hinterließ. In der Zwischenzeit drehten ihre kleineren Fregatten im flachen Wasser und schoben sich durch die Lücken in der französischen Kampflinie.
Mitten in dieses Gewimmel hineinzurudern, betrachtete D’Campion als vollkommenen Irrsinn und machte einen anderen Vorschlag. »Warum bringen wir die Koffer nicht zu Admiral Brueys, sobald er die englische Flotte erledigt hat?«
Nach diesen Worten nickte der Offizier. »Seht ihr?«, sagte er zu seinen Männern. »Deshalb nennt Le Général ihn savant, einen Wissenden.«
Der Offizier deutete auf eins der Schiffe in der französischen Nachhut, die noch nicht von den Engländern angegriffen worden war. »Nehmt Kurs auf die Guillaume Tell«, sagte er. »Dort ist Konteradmiral Villeneuve. Er wird wissen, was zu tun ist.«
Die Ruderer legten sich wieder mit aller Kraft in die Riemen, und das kleine Boot entfernte sich eilig aus dem tödlichen Schlachtgetümmel. Sich einen Weg durch die Dunkelheit und die dichten Rauch- und Pulverdampfwolken suchend, brachte die Mannschaft das Boot zum Ende der französischen Linie, wo vier Schiffe warteten und eine seltsame Ruhe herrschte, während weiter vorn heftige Kämpfe tobten.
Kaum war das Langboot mit einem dumpfen vernehmlichen Laut gegen die dicke Rumpfbeplankung der Guillaume Tell gestoßen, als auch schon Seile von der Reling herabgelassen wurden. Sie wurden eilig gesichert, und Männer und Fracht wurden schnellstens an Bord gehievt.
Als D’Campion auf dem Deck stand, hatte die Heftigkeit und Wildheit der Seeschlacht in einem Maße zugenommen, wie er es sich in seinen schlimmsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Die Engländer hatten sich einen bedeutenden taktischen Vorteil erkämpft, obgleich sie leicht in der Unterzahl waren. Anstatt sich auf ein Gefecht Breitseite gegen Breitseite mit der gesamten französischen Flotte einzulassen, hatten sie die Nachhut aus französischen Schiffen ignoriert und das Feuer auf den vorderen Abschnitt der französischen Linie verdoppelt. Jedes französische Schiff musste sich jetzt gegen zwei englische Schiffe wehren, je eins auf beiden Seiten. Das Ergebnis war vorhersehbar: Die glorreiche französische Kriegsflotte wurde vollkommen zerschlagen.
»Admiral Villeneuve wünscht, Sie zu sprechen«, sagte ein Stabsoffizier zu D’Campion.
Er wurde unter Deck geführt und zu Konteradmiral Pierre-Charles Villeneuve gebracht. Der Admiral hatte volles schlohweißes Haar, ein schmales Gesicht unter einer hohen Stirn und eine lange römische Nase. Er trug eine makellose Uniform, die im Wesentlichen aus einer dunkelblauen Jacke bestand, die mit goldenen Borten und goldenen Knöpfen und einer roten Schärpe verziert war. In D’Campions Augen sah der Offizier aus, als nehme er an einer Parade und nicht an einer Schlacht teil.
Für einen Moment strich Villeneuve mit den Fingerspitzen über die Schlösser des schwersten Koffers. »Wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie einer von Napoleons savants.«
Savant war Bonapartes Wort, über das sich D’Campion und einige andere ärgerten. Sie waren Naturwissenschaftler und Gelehrte, von General Napoleon zusammengerufen und nach Ägypten gebracht, wo nach seiner Überzeugung Schätze zu finden waren, die die Bedürfnisse von Leib und Seele erfüllten.
D’Campion war ein angehender Experte in der neuen Wissenschaftsdisziplin, die sich mit dem Übersetzen aus alten Sprachen beschäftigte, und in dieser Hinsicht barg kein Ort größere Geheimnisse oder vielfältigere Möglichkeiten als das Land der Pyramiden und der Sphinx.
Und D’Campion war nicht nur einer von den vielen savants. Napoleon hatte ihn persönlich ausgewählt, den Wahrheitsgehalt einer geheimnisvollen Legende zu überprüfen. Eine umfangreiche Belohnung wurde ihm versprochen, darunter größerer Reichtum, als D’Campion in zehn Leben hätte erwerben können, und ein Landbesitz, der ihm von der neuen Republik geschenkt werden würde. Er würde mit Orden ausgezeichnet und mit Ruhm und Ehre überhäuft werden, aber zuerst müsste er etwas finden, von dem es gerüchteweise hieß, dass es im Land der Pharaonen existierte – eine Möglichkeit zu sterben und danach wieder ins Leben zurückzukehren.
Einen Monat lang hatten D’Campion und seine kleine Gruppe an einem Ort, den die Ägypter Totenstadt nannten, so viel eingesammelt und weggeschafft, wie sie tragen konnten.
»Ich gehöre zur Commission des sciences et des arts«, sagte D’Campion und verwendete die offizielle Bezeichnung, die er vorzog.
Villeneuve war anscheinend nicht beeindruckt. »Und was haben Sie an Bord meines Schiffes gebracht, Monsieur Commissaire?«
D’Campion wappnete sich, seinen Standpunkt verteidigen zu müssen. »Das darf ich nicht sagen, Admiral. Die Koffer müssen auf strikten Befehl General Napoleons persönlich geschlossen bleiben. Über ihren Inhalt ist strengstes Stillschweigen zu bewahren.«
Villeneuve schien noch immer unbeeindruckt. »Sie können jederzeit wieder verschlossen werden. Geben Sie mir den Schlüssel.«
»Admiral«, warnte D’Campion, »der General wird nicht sehr erfreut sein.«
»Der General ist nicht hier!«, schnappte Villeneuve.
Napoleon war zwar zu dieser Zeit bereits eine mächtige Persönlichkeit, aber Kaiser war er noch nicht. Das Direktorium, das aus fünf Männern bestand, die die Revolution anführten und steuerten, behielt die Kontrolle über die Entwicklung, während andere bereits Vorbereitungen trafen, die Macht zu ergreifen.
Dennoch fiel es D’Campion schwer, Villeneuves Handlungsweise zu verstehen. Napoleon war jemand, mit dem man sich lieber nicht anlegen sollte. Ebenso wenig mit Admiral Brueys d’Aigalliers, der Villeneuves direkter Vorgesetzter war und kaum einen Kilometer entfernt um sein Leben kämpfte. Weshalb beschäftigte sich Villeneuve mit solchen Dingen, wenn er doch eigentlich Nelson angreifen sollte?
»Den Schlüssel!«, verlangte Villeneuve ungeduldig.
D’Campion wurde aus seinen Gedanken gerissen und traf die zu diesem Zeitpunkt vernünftigste Entscheidung. Er nahm die Schnur, an welcher der Schlüssel hing, von seinem Hals und reichte sie Villeneuve. »Hiermit übergebe ich die Koffer in Ihre Obhut, Admiral.«
»Das sollten Sie auch lieber tun«, sagte Villeneuve. »Sie dürfen sich zurückziehen.«
D’Campion wandte sich zum Gehen, hielt dann jedoch inne und wagte es, eine andere Frage zu stellen. »Werden wir bald in die Schlacht eingreifen?«
Der Admiral hob eine Augenbraue, als sei die Frage völlig absurd. »Wir haben keine Befehle, das zu tun.«
»Befehle?«
»Von Admiral Brueys auf der L’Orient wurden keine entsprechenden Signale gegeben.«
»Admiral«, sagte D’Campion, »die Engländer beschießen ihn von beiden Seiten. Jetzt ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt, auf Befehle zu warten.«
Villeneuve stand plötzlich auf und ging wie ein wütender Bulle auf D’Campion los. »Erdreisten Sie sich etwa, mir Ratschläge zu erteilen?«
»Nein, Admiral, es ist nur so, dass …«
»Der Wind steht ungünstig«, fauchte Villeneuve und winkte ab. »Wir müssten durch die Bucht gegen den Wind aufkreuzen, um auch nur halbwegs in die Nähe des Kampfgeschehens zu gelangen. Für Admiral Brueys wäre es erheblich einfacher, sich zu uns zurückfallen zu lassen, damit wir ihn unterstützen können. Bisher allerdings hat er sich noch nicht dazu entschlossen.«
»Aber wir können doch nicht untätig hier ausharren!«
Villeneuve ergriff einen Dolch, der auf seinem Schreibtisch lag. »Ich töte Sie, wenn Sie weiter in diesem Ton mit mir reden. Außerdem, was wissen Sie schon vom Segeln oder Kämpfen, Savant?«
D’Campion wusste, dass er seine Grenzen überschritten hatte. »Ich entschuldige mich, Admiral. Es war ein anstrengender und nervenaufreibender Tag.«
»Lassen Sie mich allein«, sagte Villeneuve. »Und danken Sie Gott, dass wir noch nicht in die Schlacht eingreifen, denn in diesem Fall würde ich Sie mit einer Glocke um die Schultern aufs Vorderdeck stellen, damit die Engländer etwas haben, worauf sie zielen können.«
D’Campion machte einen Schritt rückwärts, verbeugte sich knapp und entfernte sich dann eilig. Er stieg hinauf an Deck, fand in der Nähe des Bugs einen freien Platz und verfolgte von dort aus das Gemetzel in der Ferne.
Selbst aus dieser Distanz betrachtet war die Brutalität der Schlacht kaum zu ertragen. Für einen Zeitraum von mehreren Stunden feuerten die beiden Flotten aus nächster Nähe aufeinander; Seite an Seite und Mast an Mast trieben die Schiffe nebeneinander her, während Scharfschützen auf dem Oberdeck darauf lauerten, jeden zu töten, der sich ins Freie hinauswagte.
»Ce courage«, murmelte D’Campion. Wie tapfer die Kämpfenden waren!
Aber Tapferkeit reichte nicht aus. Mittlerweile feuerte jedes englische Schiff drei bis vier Schüsse für jeden Schuss ab, den die Franzosen abgaben. Und dank Villeneuves Weigerung, in den Kampf einzugreifen, verfügten sie auch noch über mehr Schiffe.
Im Zentrum der Schlacht bepflasterten drei Schiffe Nelsons die L’Orient und zerstampften sie zu einem Schrotthaufen, der kaum noch als Schiff zu erkennen war. Ihre eleganten Konturen und die alles überragenden Masten waren längst dahin. Die massiven Seitenwände des Rumpfs waren zersplittert und geborsten. Auch wenn noch einige Kanonen intakt waren und Kugeln gegen die Gegner schleuderten, konnte D’Campion doch erkennen, dass das Flaggschiff dem Tod geweiht war.
D’Campion sah Flammen wie Quecksilber über das Hauptdeck huschen. Sie tanzten hin und her und zeigten keinerlei Erbarmen, als sie an den Leinen der längst gefallenen Segel emporkletterten und durch die offenen Luken ins Schiffsinnere tauchten.
Plötzlich zuckte ein Blitz auf und blendete D’Campion, obgleich er beinahe gleichzeitig die Augen vor dem grellen Licht schloss. Darauf folgte ein Donnerschlag, der lauter war als alles, was D’Campion jemals gehört hatte. Er wurde von der Druckwelle zurückgeschleudert, die zudem sein Gesicht versengte und sein Haar in feine Asche verwandelte.
Er landete halb auf der Seite, schnappte gierig nach Luft und rollte sich mehrmals über die Decksplanken, um winzige Flammen zu ersticken, die über seine Jacke züngelten. Als er schließlich aufblickte, bekam er einen Schock.
Die L’Orient war verschwunden.
Flammen loderten auf dem Wasser in einem weiten Kreis um die ehemalige Position des Flaggschiffs herum. So heftig war die Explosion gewesen, dass sechs weitere Schiffe in Brand geraten waren – drei der englischen Flotte und drei der französischen. Der Schlachtenlärm ließ nach, als Matrosen mit Pumpen und Schöpfeimern einen verzweifelten Kampf aufnahmen, um die eigene Vernichtung durch die gierigen Flammen abzuwenden.
»Das Feuer muss ins Magazin eingedrungen sein«, war die Stimme eines zu Tode betrübten französischen Matrosen zu hören.
In den Laderäumen eines jeden Kriegsschiffs hatte man Hunderte Fässer Schießpulver gestapelt. Bereits der winzigste Funke war gefährlich und konnte das Ende bedeuten.
Tränen rannen über das Gesicht des Matrosen. D’Campion verspürte in seinem Magen eine brennende Übelkeit, aber er war von dem grässlichen Anblick viel zu überwältigt, um eine Reaktion der Trauer zu zeigen.
Mehr als eintausend Mann hatten sich auf der L’Orient befunden, als sie in Abukir eingetroffen war. D’Campion selbst hatte sich an Bord des Flaggschiffs aufgehalten und des Öfteren mit Admiral Brueys d’Aigalliers zu Abend gespeist. Fast jeder, den er während dieser Reise kennengelernt hatte, war auf diesem Schiff gewesen, sogar die Kinder – Söhne der Offiziere, die gerade elf Jahre alt waren. Während sein Blick über die im Wasser treibenden Trümmer glitt, konnte sich D’Campion nicht vorstellen, dass auch nur einer von ihnen überlebt hatte.
Dahin waren außerdem – abgesehen von den Koffern, die Villeneuve jetzt in Besitz genommen hatte – die Bemühungen seines einmonatigen Aufenthalts in Ägypten und die einmalige Gelegenheit seines Lebens.
D’Campion sank auf das Deck. »Die Ägypter haben mich gewarnt«, sagte er.
»Sie haben Sie gewarnt?«, wiederholte der Seemann fragend.
»Dass ich keine Steine aus der Totenstadt mitnehmen soll. Ein Fluch läge auf ihnen, sagten sie. Ein Fluch … und ich habe sie noch wegen ihres lächerlichen Aberglaubens ausgelacht. Aber nun …«
Er versuchte aufzustehen, aber die Beine versagten ihm den Dienst, und so sackte er wieder auf die Planken. Der Matrose kam zu ihm und half ihm, unter Deck zu gelangen. Dort wartete er auf die letzte englische Attacke, die sie endgültig vernichten würde.
Sie erfolgte im Morgengrauen, als sich die Engländer sammelten und anschickten, die Reste der französischen Flotte anzugreifen. Doch anstelle des von Menschen erzeugten Donners und des Krachens und Knirschens von Holzbalken beim Aufprall eiserner Kanonenkugeln hörte D’Campion nur das Pfeifen des Windes in der Takelage, als sich die Guillaume Tell in Bewegung setzte.
Er schleppte sich hinauf an Deck und stellte fest, dass sie sich unter vollen Segeln auf Nordostkurs befanden. Die Engländer verfolgten sie, fielen jedoch schnell zurück. Gelegentliche Rauchwolken verrieten ihre vergeblichen Versuche, die Guillaume Tell aus der Ferne mit einem Kanonenschuss zu treffen. Und schon bald waren nicht einmal mehr ihre Segel am Horizont zu sehen.
Für den Rest seiner Tage zweifelte D’Campion an Villeneuves Mut, aber niemals äußerte er sich abfällig über die Schlauheit des Mannes und versicherte jedem, der ihm zuhörte, dass er dem Vizeadmiral sein Leben verdankte.
Am späten Vormittag hatten die Guillaume Tell und drei andere Schiffe unter Villeneuves Kommando Nelson und seine unbarmherzigen Kampfgefährten weit hinter sich gelassen. Sie gelangten nach Malta, wo D’Campion bis zu seinem Tod arbeitete, studierte, sogar brieflich mit Napoleon und Villeneuve korrespondierte und über den verlorenen Schatz nachgrübelte, den er aus Ägypten mitgenommen hatte.
2
M.S. Torino, siebzig Meilen westlich von MaltaGegenwart
Die M.S. Torino war ein 1973 erbautes, einhundert Meter langes Frachtschiff mit stählernem Rumpf. Mit ihrem fortgeschrittenen Alter, ihrer bescheidenen Größe und der niedrigen Geschwindigkeit war sie mittlerweile nicht mehr als ein »Küstenfahrer«, der kurze Strecken auf dem Mittelmeer zurücklegte und während seiner üblichen Runde, die Libyen, Sizilien, Malta und Griechenland einschloss, auch kleine Inseln anlief.
In der Stunde vor Sonnenaufgang fuhr sie nach Westen, war siebzig Meilen von ihrem letzten Zielhafen in Malta entfernt und unterwegs zu der kleinen Insel Lampedusa, die von Italien verwaltet wurde.
Trotz der frühen Stunde standen mehrere Männer auf der Brücke. Jeder von ihnen wirkte hochgradig nervös – und mit gutem Grund. Während der letzten Stunde folgte ihnen ein unbekanntes Schiff ohne Positionslichter.
»Holen sie weiter zu uns auf?«
Die Frage wurde vom Kapitän des Schiffes, Constantin Bracko, gerufen, einem stämmigen Mann mit Preisboxerarmen, ergrautem Haar und Bartstoppeln, die seinem Gesicht das Aussehen von grobem Sandpapier verliehen.
Mit einer Hand auf dem Ruder wartete er auf eine Antwort. »Nun?«
»Das Schiff ist noch immer hinter uns«, antwortete der Erste Offizier. »Es folgt jeder Kursänderung. Und kommt stetig näher.«
»Alle Lichter löschen«, befahl Bracko. Ein anderer Matrose legte eine ganze Serie von Hauptschaltern um, und die Torino wurde dunkel. Als das Schiff mit der Nacht verschmolz, änderte Bracko abermals den Kurs.
»Das wird uns wenig nützen, wenn sie über Radar oder Nachtsichtgeräte verfügen«, sagte der Erste Offizier.
»Immerhin gewinnen wir ein wenig Zeit«, erwiderte Bracko.
»Könnte es der Zoll sein?«, fragte ein anderer Matrose. »Oder die italienische Küstenwache?«
Bracko schüttelte den Kopf. »So viel Glück werden wir nicht haben.«
Der Erste Offizier wusste, was diese Feststellung bedeutete. »Die Mafia?«
Bracko nickte. »Wir hätten zahlen sollen. Schließlich schmuggeln wir in ihren Gewässern. Dafür verlangen sie ihren Anteil.«
In der Annahme, dass er ihnen im Dunkel der Nacht entkommen könnte, war Bracko ein Risiko eingegangen. Diesmal waren die Würfel zu seinen Ungunsten gefallen. »Holt die Waffen heraus«, entschied er. »Wir müssen kämpfen.«
»Aber Constantine«, sagte der Erste Offizier. »Bei dem, was wir geladen haben, wird das böse enden.«
Das Deck der Torino war mit Frachtcontainern vollgestellt, aber in den meisten befanden sich Drucktanks, so groß wie Autobusse, die mit flüssigem Propangas gefüllt waren. Sie schmuggelten auch andere Dinge, darunter zwanzig Fässer einer geheimnisvollen Substanz, die von einem Kunden aus Ägypten an Bord geschafft worden waren. Auf Grund der hohen Benzinsteuern in ganz Europa war es jedoch das Propangas, das den höchsten Profit versprach.
»Sogar Schmuggler müssen Steuern zahlen«, murmelte Bracko leise vor sich hin. Mit ihren Forderungen nach Schutzgeldern, Transitgeldern und Liegegebühren waren die kriminellen Syndikate genauso schlimm wie die Regierungen. »Jetzt müssen wir doppelt zahlen. Geld und Fracht. Vielleicht sogar dreifach, wenn sie ein Exempel an uns statuieren wollen.«
Der Erste Offizier nickte. Er hatte nicht den geringsten Wunsch, den Treibstoff eines Fremden mit seinem Leben zu bezahlen. »Ich hole die Pistolen«, sagte er.
Bracko warf ihm einen Schlüssel zu. »Weck die Männer. Wir kämpfen, oder wir sterben.«
Der Schiffsoffizier machte sich auf den Weg zum Waffenschrank und zu den Kojen auf dem Unterdeck. Während er sich entfernte und im Niedergang verschwand, betrat eine andere Gestalt das Ruderhaus. Es war ein Passagier, der sich mit dem seltsam klingenden Namen Ammon Ta vorgestellt hatte. Bracko und die Mannschaft nannten ihn den Ägypter.
»Warum wurde das Schiff verdunkelt?«, fragte Ammon Ta ganz offen heraus. »Weshalb ändern wir den Kurs?«
»Können Sie sich das nicht denken?«
Nach kurzem Überlegen schien der Ägypter zu begreifen. Er zog eine 9-mm-Pistole aus seinem Hosenbund, hielt sie locker in der Hand und ging zur Tür, um in die Dunkelheit hinauszublicken.
»Hinter uns«, sagte Bracko.
Bracko hatte die Worte noch nicht vollständig ausgesprochen, als er schon den Beweis erhielt, dass er sich irrte. Auf der Backbordseite, nicht weit vom Bug entfernt, flammten zwei Scheinwerfer auf. Einer tauchte die Kommandobrücke in blendendes Licht, der andere war auf die Reling gerichtet.
Zwei Schlauchboote näherten sich in rasender Fahrt. Instinktiv drehte ihnen Bracko das Schiff entgegen, aber es hatte keinen Sinn. Sie beschrieben einen weiten Bogen und kamen zurück, wobei sie sich nach Kurs und Tempo der Torino richteten.
Enterhaken wurden hochgeschleudert und verfingen sich in den drei Stahlkabeln, die die Sicherheitsreling darstellten.
Sekunden später begannen zwei Gruppen bewaffneter Männer an den Enterseilen empor und auf die Torino zu klettern.
Von den Booten wurde Feuerschutz gegeben.
»Volle Deckung!«, rief Bracko.
Aber während ein dichter Kugelregen ein Brückenfenster zerschmetterte und als Querschläger von der Wand gegenüber dem Fenster abprallte, machte der Ägypter keinerlei Anstalten, sich eine Deckung zu suchen. Stattdessen trat er hinter die schwere Lukentür, warf einen Blick hinaus und feuerte aus der Pistole in seiner Hand mehrere Schüsse ab.
Zu Brackos Überraschung waren die Pistolenschüsse tödlich. Ammon Ta hatte trotz des schwankenden Decks und des ungünstigen Schusswinkels zwei der Piraten mit perfekten Kopftreffern ausgeschaltet. Sein dritter Schuss löschte einen der Suchscheinwerfer, der in ihre Richtung schwenkte.
Nach den Schüssen zog sich der Ägypter ohne Hast oder hektische Bewegungen zurück, als ein wahrer Kugelorkan aus Maschinenpistolen entfesselt wurde.
Bracko blieb auf dem Deck liegen, während die Projektile durch das Ruderhaus sirrten. Eine Kugel streifte seinen Arm. Eine andere zertrümmerte eine Flasche Sambuca, die Bracko als Talisman dort aufbewahrte. Als sich die Flüssigkeit auf dem Deck ausbreitete, betrachtete Bracko dies als schlechtes Omen. Drei in der Flasche enthaltene Kaffeebohnen sollten Wohlstand, Gesundheit und Glück verheißen, aber sie waren nirgendwo zu sehen.
Mittlerweile rasend vor Wut, holte er seine eigene Pistole aus dem Schulterhalfter, um sich an dem Kampf zu beteiligen. Er schaute zu dem Ägypter hinüber, der stehengeblieben war. Angesichts der Kaltblütigkeit des Mannes und seiner tödlichen Präzision änderte Bracko blitzschnell seine Meinung von ihm. Er wusste zwar nicht, wer dieser Ägypter wirklich war, hatte jedoch plötzlich das Gefühl, er könnte der gefährlichste Mann auf dem Schiff sein.
Gut, dachte er, wenigstens ist er auf unserer Seite.
»Hervorragend geschossen«, rief er. »Vielleicht habe ich mich in Ihnen getäuscht.«
»Vielleicht habe ich das auch so gewollt«, sagte der Ägypter.
Weitere Schüsse fielen in der Dunkelheit, diesmal rührten sie vom Heckbereich des Schiffes her. Als Antwort erhob sich Bracko und feuerte blindlings durch das zertrümmerte Fenster zurück.
»Sie vergeuden Munition«, sagte der Ägypter.
»Ich verschaffe uns etwas Zeit«, widersprach Bracko.
»Die Zeit arbeitet für die«, sagte der Ägypter und deutete nach draußen. »Mindestens zwölf Männer haben Ihr Schiff geentert. Und ein drittes Schlauchboot nähert sich von achtern.«
Eine zweite Maschinenpistolensalve aus dieser Richtung bestätigte die Aussage des Ägypters.
»Das ist nicht gut«, meinte Bracko. »Der Waffenschrank befindet sich auf dem unteren Achterdeck. Wenn meine Männer nicht an ihn herankommen oder es nicht schaffen sollten, hierher zurückzukehren, sind wir hoffnungslos in der Unterzahl.«
Der Ägypter ging zur Lukentür, öffnete sie einen Spaltbreit und blickte in den Niedergang hinunter. »Scheint, als ob genau das bereits der Fall ist.«
Der Klang rennender Füße hallte durch den Laufgang, und Bracko wappnete sich für einen Zweikampf, aber der Ägypter zog nun die Tür vollständig auf und ließ einen humpelnden, blutenden Matrosen hereinstolpern.
»Sie haben das Unterdeck besetzt«, stieß der Matrose keuchend hervor.
»Wo sind die Gewehre?«
Der Matrose schüttelte den Kopf. »Wir sind nicht an sie herangekommen.«
Der Mann presste sich eine Hand auf den Leib, wo Blut aus einer Schusswunde heraussickerte. Er sackte zu Boden und blieb reglos liegen.
Das Enterkommando arbeitete sich in Richtung Bug vor und schoss auf alles, was ihm in den Weg kam. Bracko ließ das Ruder los und versuchte, seinem Matrosen zu helfen.
»Lassen Sie ihn«, sagte der Ägypter. »Wir müssen von hier weg.«
Bracko hasste es, die Anweisung des Ägypters zu befolgen, aber er konnte erkennen, dass jede Hilfe zu spät käme. Entschlossen, ein Blutbad anzurichten, spannte Bracko seine Pistole und ging zur Lukentür. Er war bereit, wild um sich schießend in den Kampf zu stürzen, gleichgültig was ihn da draußen erwartete, aber der Ägypter ergriff seinen Arm und hielt ihn zurück.
»Lassen Sie mich los«, verlangte Bracko.
»Damit Sie sinnlos sterben können?«
»Sie haben meine Mannschaft ermordet. Das kann ich nicht geschehen lassen, ohne darauf zu reagieren.«
»Ihre Mannschaft ist bedeutungslos«, erwiderte Ammon Ta eisig. »Wir müssen zu meiner Fracht.«
Bracko war perplex. »Glauben Sie wirklich, dass Sie mit Ihrer Ladung Hasch lebend hier rauskommen?«
»Diese Fässer enthalten etwas weitaus Wirkungsvolleres«, entgegnete der Ägypter. »Wirkungsvoll genug, um Ihr Schiff vor diesen Narren zu retten, wenn wir rechtzeitig herankommen. Und jetzt bringen Sie mich gefälligst dorthin.«
Während der Ägypter noch redete, gewahrte Bracko in den Augen des Mannes eine seltsame Eindringlichkeit. Vielleicht – nur vielleicht – phantasierte er ja nicht. »Kommen Sie.«
Mit dem Ägypter im Schlepptau kletterte Bracko durch das zertrümmerte Brückenfenster und sprang auf den nächststehenden Frachtcontainer hinab. Der Abstand betrug gut zwei Meter, und er landete ziemlich unbeholfen mit einem lauten Dröhnen. Dabei stauchte er sich das Knie.
Der Ägypter landete neben ihm, duckte sich sofort und wandte sich mit einem fragenden Gesichtsausdruck um.
»Ihre Fracht befindet sich in der ersten Containerreihe«, erklärte Bracko. »Folgen Sie mir.«
Sie verfielen in Laufschritt und sprangen von Container zu Container. Als sie die vorderste Reihe erreichten, kletterte Bracko zwischen den Containern aufs Deck hinunter.
Der Ägypter folgte dicht hinter ihm, und sie blieben für einen Moment zwischen den Stahlbehältern in Deckung. Mittlerweile hatte der durch die Entfernung gedämpfte Lärm des Feuergefechts abgenommen. Es fielen nur noch vereinzelte Schüsse. Die Schlacht neigte sich ihrem Ende entgegen.
»Dies ist der Container«, sagte Bracko.
»Öffnen Sie ihn«, verlangte der Ägypter.
Bracko benutzte für das Vorhängeschloss den Hauptschlüssel und zog mit einem kräftigen Ruck an dem Hebel, der die Tür sicherte. Innerlich krümmte er sich, als die betagten Scharniere mit einem schrillen Kreischen protestierten.
»Hinein«, befahl der Ägypter.
Bracko betrat den dunklen Container und knipste eine Handlampe an. Einer der zylindrischen Propangasbehälter nahm den größten Teil des Raumes ein, aber vor der hinteren Wand standen die weißen Fässer, die der Ägypter an Bord gebracht hatte.
Bracko führte Ammon Ta zu ihnen.
»Was nun?«, fragte Bracko.
Der Ägypter gab keine Antwort. Stattdessen löste er den Deckel von einem der Fässer und legte ihn beiseite. Zu Brackos Überraschung quoll ein weißer Nebel über den Rand des Behälters und schwebte abwärts.
»Flüssiger Stickstoff?«, fragte Bracko und spürte sofort, wie sich die Luft in seiner Nähe abkühlte. »Was um alles in der Welt bewahren Sie darin auf?«
Ammon Ta ignorierte ihn auch jetzt und arbeitete schweigend weiter. Er holte eine mit Stickstoff gekühlte Flasche mit einem seltsamen Symbol auf dem Korpus heraus. Während Bracko das Symbol anstarrte, dämmerte ihm, dass dies wahrscheinlich Nervengas oder irgendeine andere Art von biologischer Waffe war.
»Hinter dem sind die da draußen her!«, platzte Bracko heraus, wirbelte herum und packte den Ägypter. »Es geht gar nicht um Propangas oder Schutzgeld. Die wollen eigentlich Sie und diese Chemikalie. Sie sind der Grund, weshalb diese Kerle meine Mannschaft getötet haben!«
Die spontane Attacke hatte den Ägypter überrumpelt, aber der Mann erholte sich schnell von dem Schreck. Er schlug Brackos Hände zur Seite, drehte dem Kapitän einen Arm auf den Rücken und stieß ihn zu Boden.
Einen Moment später, nachdem er mit den Decksplanken Bekanntschaft gemacht hatte, spürte Bracko, wie das Gewicht des Ägypters auf seiner Brust landete. Er blickte in ein gnadenloses Augenpaar.
»Ich brauche dich nicht mehr«, sagte der Mann.
Ein brennender Schmerz durchfuhr Bracko, als ein Dolch mit dreieckiger Klinge in seinen Magen gestoßen wurde. Der Ägypter drehte ihn, zog ihn dann heraus und erhob sich.
Überwältigt von grässlichen Schmerzen, bäumte sich Bracko auf und löste den Griff. Sein Kopf sank auf den stählernen Boden des Containers, während er die Hände auf den Leib presste und das warme Blut spürte, das seine Kleidung tränkte.
Ihn erwartete nun ein langsamer und qualvoller Tod. Ein Tod, den zu beschleunigen der Ägypter nicht für notwendig hielt, während er in aller Ruhe das Blut von der kurzen dreieckigen Klinge abwischte und den Dolch in die Scheide zurückschob, ein Satellitentelefon hervorholte und auf eine Taste drückte.
»Unser Schiff ist überfallen worden«, meldete er jemandem am anderen Ende der Verbindung. »Kriminelle, wie es scheint.«
Eine lange Pause folgte, dann schüttelte der Ägypter den Kopf. »Es sind zu viele, um den Kampf gegen sie aufzunehmen … ja, ich weiß, was getan werden muss … der Dunkle Nebel darf nicht in die Hände der anderen fallen. Empfiehl mich Osiris. Wir sehen uns im Totenreich.«
Er trennte die Verbindung, ging zum Ende der Propangasflasche und benutzte einen großen Rollgabelschlüssel, um ein Auslassventil zu öffnen. Ein lautes Zischen ertönte, als Gas auszuströmen begann.
Als Nächstes holte er eine kleine Sprengladung aus einer Tasche seiner Jacke, befestigte sie an der Gasflasche und stellte den Zeitzünder ein. Danach kehrte er zum vorderen Ende des Frachtcontainers zurück, öffnete seine Tür einen Spaltbreit und schlüpfte in die Dunkelheit hinaus.
In einer Pfütze seines eigenen Blutes liegend, wusste Constantine Bracko genau, was ihn erwartete. Trotz seines fast sicheren Todes – gleichgültig, wodurch verursacht – war er entschlossen, die Explosion wenn irgendwie möglich zu verhindern.
Er wälzte sich herum, vor Schmerzen stöhnend. Er schaffte es noch, bis zur Gasflasche zu kriechen, wobei er eine breite Blutspur auf dem Stahlboden hinterließ. Dann versuchte er, das Auslassventil mit dem Engländer-Schraubenschlüssel zu verschließen, musste jedoch feststellen, dass ihm die Kraft fehlte, das schwere Werkzeug in Position zu bringen und festzuhalten.
Er ließ es auf das Deck fallen und schob sich vorwärts, wobei ihm jede Bewegung einen unterdrückten Schmerzensschrei entlockte. Der Geruch des Propangases war betäubend, der Schmerz in seiner Magengrube wirkte wie eine lodernde Feueresse. Seine Augen quittierten nach und nach den Dienst. Er fand die Sprengladung, konnte jedoch die Knöpfe auf dem Zifferblatt der Zeituhr kaum noch erkennen. Er zerrte an dem Timer, und dieser löste sich von der Flasche, als gleichzeitig die Türen des Frachtcontainers aufschwangen.
Bracko wandte sich um. Zwei Männer stürmten herein und richteten ihre Waffen auf ihn. Als sie näher kamen, entdeckten sie den Zeitzünder in seiner Hand.
In diesem Augenblick sprang er auf null, explodierte in Brackos Griff und entzündete das Propangas. Der Frachtcontainer sprengte sich selbst mit einem grellweißen Lichtblitz auseinander.
Die Wucht der Explosion lockerte den vorderen Stapel der Frachtcontainer und ließ sie über die Reling ins Meer kippen.
Bracko und die beiden Männer der Piratenbande verdampften in dem Explosionsblitz, aber Brackos Bemühungen hatten den Plan des Ägypters vereitelt. Von der Stahlwand der Gasflasche zu weit entfernt, war die Ladung nicht stark genug, um den Zylinder zu verletzen. Stattdessen löste sie eine Verpuffung aus und entzündete ein alles verzehrendes Feuer, das von dem noch immer aus dem offenen Auslassventil strömenden Propangas gespeist wurde.
Die Flammenzunge leckte aus dem Tank heraus und brannte sich wie ein Schneidbrenner durch alles hindurch, in dessen Nähe sie kam. Als der Tank verrutschte, sank die Spitze der Flamme herab und leckte über das Deck.
Während die überlebenden Piraten die Flucht ergriffen, weichte das stählerne Deck unter der Gasflasche auf und wölbte sich. Innerhalb mehrerer Minuten wurde das Deck so weit geschwächt, dass das Ende der schweren Gasflasche teilweise einsank und hindurchrutschte. Die Flasche ragte nun in einem schiefen Winkel in die Höhe, und die Flamme hüllte sie ein. Von diesem Zeitpunkt an war alles nur noch eine Frage der Zeit.
Etwa zwanzig Minuten lang setzte das brennende Schiff seine Fahrt nach Westen fort, ein treibender Feuerball, der meilenweit zu sehen war. Kurz vor Tagesanbruch traf die Torino auf ein Riff, das sich nur eine halbe Meile von der Küste Lampedusas entfernt befand.
Frühaufsteher auf der Insel kamen heraus, um das Feuer zu beobachten und zu fotografieren. Während sie verfolgten, wie die Propangasflasche platzte, wurden fünfzehntausend Gallonen unter Druck stehenden Treibstoffs freigesetzt, und eine blendend helle Explosion, heller als die aufgehende Sonne, illuminierte den Horizont.
Als der Lichtblitz erlosch, war der Bug der M.S. Torino verschwunden und der Rumpf so aufgerissen wie eine Sardinenbüchse. Darüber sammelte sich eine dunkle Wolke, die auf die Insel zutrieb und wie ein Regenschauer im Wind hing, der den Erdboden nicht erreichte.
Seevögel stürzten vom Himmel herab, tauchten mit leisem Klatschen ins Wasser und schlugen mit dumpfen Lauten auf dem Sand auf.
Die Männer und Frauen, die herausgekommen waren, um das Spektakel zu verfolgen, rannten nun los, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber die tentakelartigen Ausläufer des treibenden Nebels überholten sie, und sie stürzten genauso abrupt und unerwartet zu Boden, wie die Möwen vorher vom Himmel gefallen waren.
Vom Wind getrieben, segelte der Schwarze Nebel über die Insel hinweg und weiter nach Westen. Er hinterließ eine Totenstille – und eine Landschaft, die mit reglosen Leibern übersät war.
3
Mittelmeer, siebzehn Meilen südöstlich von Lampedusa
Eine schemenhafte Gestalt sank lässig und in gleichmäßigem Tempo auf den Meeresboden hinab. Von unten betrachtet erschien der Taucher eher wie ein Bote des Himmels als wie ein Mensch. Erheblich größer wirkte er wegen zwei Atemflaschen, einem entsprechend verstärkten Tragegeschirr und einem Antriebsaggregat, das zusammen mit einem Paar stummelartiger Flügel auf seinem Rücken festgeschnallt war. Um das seltsame Bild zu vervollständigen, bewegte sich die Gestalt in einer Lichtwolke, die von zwei auf den Schultern fixierten Scheinwerfern erzeugt wurde, deren gelbe Lichtstrahlen sich in die Dunkelheit bohrten.
In einhundert Fuß Tiefe und dicht über dem Meeresgrund konnte der Mann deutlich einen Lichtkreis auf dem Meeresboden erkennen. Innerhalb dieses Kreises war eine Gruppe orangefarben gekleideter Taucher damit beschäftigt, einen so erheblichen Fund auszugraben, dass er der epischen Geschichte der Punischen Kriege zwischen Karthago und Rom ein neues Kapitel hinzufügen würde.
Er landete etwa zwanzig Meter von der beleuchteten Arbeitszone entfernt und betätigte den Schalter des Sprechgeräts an seinem rechten Arm.
»Hier ist Austin«, sprach er in das Helmmikrofon. »Ich bin unten angekommen und begebe mich jetzt zur Ausgrabung.«
»Roger«, antwortete eine leicht verzerrte Stimme in seinem Ohr. »Zavala und Woodson erwarten Sie schon.«
Kurt Austin aktivierte sein Unterwasserantriebsaggregat, hob leicht vom Meeresgrund ab und bewegte sich in Richtung der Ausgrabungsstelle. Auch wenn die meisten Taucher standardisierte Trockentauchanzüge trugen, testeten Kurt und zwei andere die neu entwickelten Membrananzüge, in denen ein konstanter Druck herrschte und die ihnen gestatteten, Tauchfahrten ohne die sonst notwendigen Dekompressionspausen durchzuführen.
Bisher hatte Kurt seinen Anzug benutzerfreundlich und komfortabel gefunden. Dass er ein wenig klobig erschien, war eigentlich keine Überraschung. Als er die beleuchtete Zone erreichte, passierte Kurt ein dreibeiniges Stativ mit einem Unterwasserscheinwerfer. Ähnliche Leuchtkörper waren rund um den Arbeitsbereich aufgestellt worden. Sie waren durch Stromkabel mit einer Gruppe windmühlenähnlicher Turbinen in geringer Entfernung verbunden.
Die herrschende Strömung trieb die Turbinenflügel an, die wiederum den elektrischen Strom zum Betreiben der Scheinwerfer erzeugten, die ihrerseits gestatteten, dass die Ausgrabungen erheblich zügiger durchgeführt werden konnten.
Kurt ließ sich von seinem Unterwasserantrieb über das Heck des alten Schiffswracks hinwegtragen und landete auf der anderen Seite.
»Seht mal, wer endlich den Weg hierher gefunden hat«, sagte eine freundliche Stimme über die Helmsprechanlage.
»Ihr kennt mich doch«, erwiderte Kurt. »Ich warte immer, bis die Schwerstarbeit erledigt wurde, dann erscheine ich und ernte den Ruhm.«
Die anderen Taucher lachten. Nichts konnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Kurt Austin war stets als Erster am Ort des Geschehens, verließ ihn als Letzter und verbiss sich gerne aus reiner Sturheit in ein scheinbar zum Scheitern verurteiltes Projekt, bis es wieder zum Leben erwachte oder sämtliche Möglichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes erschöpft waren, um einen weiteren Versuch zu starten.
»Wo ist Zavala?«, fragte Kurt.
Die anderen Taucher deuteten auf einen Punkt weiter draußen, in fast vollkommener Dunkelheit. »Er besteht darauf, Ihnen etwas Wichtiges zu zeigen. Wahrscheinlich hat er eine altertümliche Flasche Gin gefunden.«
Kurt nickte, aktivierte seinen Antrieb und steuerte dorthin, wo Joe Zavala zusammen mit einer Taucherin namens Michelle Woodson arbeitete. Sie hatten einen Bugabschnitt des Wracks ausgegraben und starre Kunststoffwände aufgebaut, um zu verhindern, dass Sand und Schlick nachrutschten und auffüllten, was sie soeben freigelegt hatten.
Kurt sah, wie Joe sich leicht straffte, und dann hörte er über die Helmsprechanlage den fröhlichen Tonfall in der Stimme seines Freundes.
»Tun Sie lieber so, als ob Sie sehr beschäftigt seien«, sagte Joe. »El Jefe stattet uns einen Besuch ab.«
Genau genommen traf es zu. Kurt war der Chef der Abteilung für Spezial-Unternehmungen der National Underwater and Marine Agency, ein ziemlich einzigartiger Zweig der Bundesregierung, der sich mit den Geheimnissen der Weltmeere befasste. Aber Kurt gestaltete seine Tätigkeit nicht wie ein typischer Boss. Er bevorzugte Teamarbeit, zumindest so lange, bis schwierige Entscheidungen getroffen werden mussten. Diese traf er selbst. Das, so war er überzeugt, lag in der Verantwortung eines Leitenden.
Was Joe Zavala anging, so war er eher so etwas wie Kurt Austins Komplize und weniger ein Angestellter. Die beiden gerieten seit Jahren immer wieder in die heikelsten Situationen. Allein im vorangegangenen Jahr waren sie an der Entdeckung der S.S. Waratah beteiligt gewesen, einem Schiff, das verschwunden und, wie allgemein vermutet, 1909 gesunken war; dann waren sie unter der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea in eine Invasion geraten, und schließlich hatten sie eine weltweite Falschgeldoperation gestoppt, die derart raffiniert eingefädelt worden war, dass dabei ausschließlich Computer und nicht eine einzige Druckerpresse verwendet wurden.
Danach waren beide reif für einen ausgiebigen Urlaub gewesen. Eine Expedition, um auf dem Grund des Mittelmeers nach Überresten des Altertums zu suchen, bot sich dabei als ideale Erholungsaktivität an.
»Ich hab schon gehört, dass ihr beiden hier unten eine ruhige Kugel geschoben habt«, scherzte Kurt. »Ich bin nur gekommen, um diese Praxis zu beenden und eure Gehälter zu kürzen.«
Joe lachte. »Du wirst doch wohl niemanden feuern, der bloß die Absicht hatte, seine Wettschulden zu bezahlen, oder?«
»Du? Du zahlst Wettschulden? Den Tag möchte ich erleben.«
Joe deutete auf das freigelegte Gerippe eines antiken Schiffes. »Was hast du mir gesagt, als wir zum ersten Mal das Bild des Tiefen-Sonars erblickt haben?«
»Ich sagte, es sei das Wrack eines karthagischen Schiffes«, erinnerte sich Kurt. »Und du hast darauf gewettet, dass es eine römische Galeere ist – was sich, angesichts aller Artefakte, die wir geborgen haben, zu meinem nicht geringen Entsetzen, als richtig erwiesen hat.«
»Aber was wäre denn, wenn meine Einschätzung nur zu fünfzig Prozent zutrifft?«
»Dann würde ich sagen, dass du besser bist als sonst.«
Joe lachte wieder und wandte sich an Michelle. »Zeigen Sie ihm, was wir gefunden haben.«
Sie winkte Kurt zu sich herüber und richtete ihre Lampe auf den freigelegten Abschnitt. Dort war ein langer, spitzer Dorn zu sehen – der Rammsporn der römischen Galeere –, den man in eine andere Art von Holz hineingestoßen hatte. Dort, wo sie und Joe den Sand entfernt hatten, konnte Kurt den geborstenen Rumpf eines anderen Schiffes erkennen.
»Was ist das, was ich dort sehe?«, fragte Kurt.
»Das, mein Freund, ist ein Corvus«, antwortete Joe.
Das lateinische Wort ließ sich am besten mit »Rabe« übersetzen, und der antike Eisensporn ähnelte tatsächlich dem spitzen Schnabel eines Vogels, sodass Kurt sich vorstellen konnte, woher diese Waffe ihren Namen hatte.
»Für den Fall, dass du im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst haben solltest«, fuhr Joe fort, »nur so viel: Die Römer waren lediglich bescheidene Seefahrer und den Karthagern unterlegen. Sie waren jedoch bessere Soldaten und fanden einen Weg, um dies zu ihrem Vorteil auszunutzen, indem sie ihre Feinde rammten, diesen Eisensporn in den Rumpf eines feindlichen Schiffs bohrten und dann eine Art schwenkbare Gangway benutzten, um an Bord der Schiffe ihrer Feinde zu gelangen. Mit Hilfe dieser Taktik verwandelten sie jede Seeschlacht in einen Nahkampf Mann gegen Mann.«
»Haben wir dann also zwei Schiffe vor uns?«
Joe nickte. »Eine römische Trireme und ein karthagisches Schiff, durch den Corvus untrennbar miteinander verbunden. Dies ist eine Schlachtenszene von vor zweitausend Jahren, im Strom der Zeit erstarrt und konserviert.«
Kurt staunte über diese unerwartete Entdeckung. »Wie konnte es passieren, dass sie auf diese Weise gleichzeitig gesunken sind?«
»Die Wucht des Zusammenpralls hat wahrscheinlich beide Schiffsrümpfe bersten lassen«, vermutete Joe Zavala. »Und als ihr Schiff zu sinken begann, konnten die Römer den Corvus nicht freibekommen. So gingen sie dann Arm in Arm unter, zusammengeschmiedet für alle Ewigkeit.«
»Was bedeutet, dass wir beide recht haben«, sagte Kurt. »Ich vermute, dass du mir trotz allem den Dollar nicht bezahlen wirst.«
»Einen Dollar?« Diese entgeisterte Frage kam von Michelle Woodson. »Bei Ihren heftigen Diskussionen über dieses Thema während der letzten Monate ging es nur um einen einzigen Dollar?«
»Eigentlich drehte es sich sogar nur um die Frage, wer die Klappe am weitesten aufreißen darf«, gestand Kurt.
»Außerdem kürzt er mir immer wieder mein Gehalt«, sagte Joe. »Daher kann ich mir als Einsatz nicht mehr leisten.«
»Sie beide sind einfach unverbesserlich«, seufzte die Taucherin mit einem Ausdruck komischer Verzweiflung.
Kurt hätte dieser Feststellung gerne aufrichtig zugestimmt, erhielt dazu jedoch gar nicht mehr die Gelegenheit, weil eine andere Stimme im Helmfunk erklang und ihn unterbrach.
Eine Schrift auf dem helminternen Display bestätigte, dass der Funkruf von der Sea Dragon über ihnen an der Wasseroberfläche kam. Das Symbol eines kleinen Vorhängeschlosses hinter seinem und Joes Namen verriet ihm außerdem, dass der Ruf ausschließlich an sie weitergeleitet wurde.
»Kurt, hier ist Gary«, sagte die Stimme. »Können Sie und Zavala mich gut verstehen?«
Gary Reynolds war der Kapitän der Sea Dragon.
»Laut und deutlich«, sagte Kurt. »Wie ich sehe, benutzen Sie den privaten Kanal. Ist was nicht in Ordnung?«
»Das befürchte ich. Wir haben einen Notruf aufgefangen. Und ich weiß nicht, wie wir darauf reagieren sollen.«
»Wie das?«, fragte Kurt.
»Weil der Ruf nicht von einem Schiff kam«, sagte Reynolds. »Sondern von Lampedusa.«
»Von der Insel?«
Lampedusa war eine kleine Insel mit fünftausend Einwohnern. Sie gehörte zu Italien, lag jedoch näher bei Libyen als bei der Südspitze von Sizilien. Die Sea Dragon hatte dort jede Woche für einen Tag angelegt, um aufzutanken und Proviant zu laden, ehe sie auf ihre Position über dem gesunkenen Wrack zurückkehrte. Auch zu diesem Zeitpunkt hielten sich fünf Angestellte der NUMA an Land auf, um die Logistik der Forschungsgruppe zu organisieren und die Artefakte, die aus dem Meer zutage gefördert wurden, zu katalogisieren.
Joe stellte die nächstliegende Frage: »Warum sollte jemand auf einer Insel einen Hilferuf über einen Seenotkanal senden?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Reynolds. »Die Jungs in der Funkzentrale waren so schlau, sofort den Recorder einzuschalten, als ihnen klar wurde, was sie da empfingen. Wir haben uns die Aufnahme mehrmals angehört. Sie klingt ein wenig verzerrt, aber der Ruf kam zweifelsfrei von Lampedusa.«
»Können Sie uns den Notruf vorspielen?«
»Ich dachte schon, Sie würden niemals darum bitten«, sagte Reynolds. »Warten Sie einen Moment.«
Nach einigen Sekunden Stille hörte Kurt das Summen und Knistern atmosphärischer Störungen und ein Feedbackpfeifen, ehe er eine Stimme ausmachen konnte. Das erste Dutzend Worte konnte Kurt nicht verstehen, doch dann wurde das Signal klarer und die Stimme lauter. Sie gehörte einer Frau. Einer Frau, die sehr ruhig klang, aber gelegentlich auch besorgt, wenn nicht gar verzweifelt.
Etwa zwanzig Sekunden lang sprach sie Italienisch, dann wechselte sie ins Englische.
»… ich wiederhole, hier ist Dr. Renata Ambrosini … wir wurden angegriffen … zurzeit sind wir im Krankenhaus eingesperrt … wir brauchen dringend Hilfe … Wir sind hermetisch abgeriegelt, und unser Sauerstoffvorrat geht zur Neige. Bitte antworten Sie!«
Sekundenlanges atmosphärisches Rauschen folgte, dann wurde die Nachricht wiederholt.
»Irgendein Verkehr auf den Notruf-Frequenzen?«, fragte Joe Zavala.
»Nichts«, antwortete Reynolds. »Aber aus übergroßer Vorsicht habe ich unser Logistik-Team gerufen. Niemand hat geantwortet.«
»Das ist seltsam«, sagte Joe. »Eigentlich soll ständig jemand am Funkgerät sitzen, während wir hier draußen sind.«
Kurt war der gleichen Meinung. »Rufen Sie jemand anderen«, empfahl er Reynolds. »Im Hafen befindet sich eine Station der italienischen Küstenwache. Versuchen Sie, den Kommandanten zu erreichen.«





























