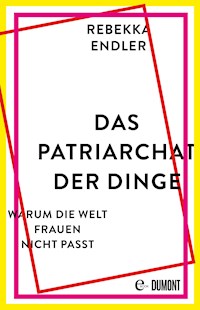
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Umwelt wurde von Männern für Männer gestaltet. In ›Das Patriarchat der Dinge‹ öffnet Rebekka Endler uns die Augen für das am Mann ausgerichtete Design, das uns überall umgibt. Und sie zeigt, welche mitunter lebensgefährlichen Folgen es für Frauen hat. Unsere westliche Medizin ist beispielsweise – mit Ausnahme der Gynäkologie – auf den Mann geeicht: von Diagnoseverfahren und medizinischen Geräten bis hin zur Dosierung von Medikamenten. Aber auch die Dummys für Crashtests haben den männlichen Körper zum Vorbild – und damit das ganze Auto samt Airbags und Sicherheitsgurten. Der öffentliche Raum ist ebenso für Männer gemacht: Architektur, Infrastruktur und Transport, sogar die Anzahl öffentlicher Toiletten oder die Einstellung der Temperatur in Gebäuden. Wer überlebt einen Herzinfarkt? Wer friert am Arbeitsplatz und für wen ist dieser gestaltet? Für wen sind technische Geräte leichter zu bedienen? Das Patriarchat ist Urheber und Designer unserer Umwelt. Wenn wir uns das bewusst machen, erscheinen diese Fragen plötzlich in einem neuen Licht. »Rebekka Endler zeigt die Ungerechtigkeiten unserer materiellen Welt.« DIE ZEIT, SACHBUCHBESTENLISTE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
REBEKKA ENDLER
DASPATRIARCHATDER DINGE
WARUM DIE WELTFRAUENNICHT PASST
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag Köln
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Ulrike Ostermeyer, Berlin
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7091-2
www.dumont-buchverlag.de
INKLUSIVES VORWORT
Es gibt diese Geschichte, wie eine alte Frau in Pompei mich einmal mit einem Wischmopp verdroschen und als »puttana« beschimpft hat, weil ich auf dem Männerklo pinkeln war und mich nicht in die lange Schlange vor der Frauentoilette eingereiht hatte. Ich habe sie in den letzten fünfzehn Jahren häufig erzählt, sie ist meine kleine Anekdote darüber, welchen Preis meine Unangepasstheit einmal gehabt hat. Das Fazit der Geschichte lautete bisher in etwa so: Wie antiquiert und reaktionär ist doch das Weltbild dieser Frau, und ja, auch länder- und generationenspezifische Kulturunterschiede spielen bestimmt eine Rolle. Hin und wieder diente die Geschichte auch als Beispiel dafür, wie Frauen sich gegenseitig in den Rücken fallen, statt Verständnis für den alltäglichen Struggle des Frauseins aufzubringen. Von alleine bin ich nicht darauf gekommen, dass der Kern des Problems allerdings ganz woanders liegen könnte.
Dann habe ich vor zwei Jahren einen fünfminütigen Radiobeitrag über »Potty Parity« gemacht, was noch nicht einmal meine Idee gewesen war, sondern ein Auftrag. Im Internet fand ich die Dissertation einer Frau, die über Toiletten-Designs promoviert und eigene Urinale für Frauen entwickelt hatte. Bettina Möllring, Professorin für Industriedesign in Kiel, erzählte mir so viel über die Geschichte der Toiletten und all die patriarchalen Ungerechtigkeiten, die unseren Alltag prägen, dass ich das unmöglich alles in fünf Minuten unterbringen konnte. Also machte ich das, was ich immer mache, wenn ich das Gefühl habe, auf journalistisches Gold gestoßen zu sein: Ich recherchierte weiter, und als die Sache rund war, schlug ich meine Geschichte über den Zusammenhang von öffentlichen Toiletten und Patriarchat einigen Redaktionen vor, die längere Formate betreuen (Radio und Print), und erhielt – Absagen. Da es ums Pinkeln ging, mangelte es nicht an Wortspielen: Das Thema habe keine große Dringlichkeit (höhö), Geschichten über Urinale hätten in der Redaktion ein schweres Standing (höhö) … Aber meine Lieblingsabsage lautete schlicht: Das Thema habe weder politische noch gesamtgesellschaftliche Relevanz. Wie grottig muss ich meinen Pitch angepriesen haben, wenn das dabei herauskommt!
Oder bin ich da versehentlich auf etwas anderes gestoßen? Bettina Möllring hat mir von dem Widerstand erzählt, mit dem sie seit Jahrzehnten zu kämpfen hat, wenn männliche Entscheidungsträger die Wichtigkeit von gleichberechtigtem Pinkeln mit einem beschwichtigenden Lächeln abtun – die Politik hat Wichtigeres zu tun, als sich mit so einem Pipifax zu beschäftigen. Es fühle sich an wie ein Kampf gegen Windmühlen, so Möllring. Kämpfte ich jetzt etwa auch gegen Windmühlen? Bloß dass meine männlichen Entscheidungsträger Redakteure und keine Politiker waren?
Bingo.
Dieses Buch ist also meine Recherchereise quer durch die tief verwurzelten patriarchalen Ideen, die unsere Gesellschaft prägen, und über ihren Einfluss auf das ganz alltägliche Design in unserer Umwelt und in unserem Leben. Es ist auch ein Buch über die Wut, die all jene verspüren, die damit begonnen haben, an den bestehenden Strukturen, Ideen und Designs zu rütteln – und darüber, wie sie lernen, mit dem Backlash der patriarchalen Übermacht umzugehen.
Die Geschichte des patriarchalen Designs geht so: Der Mann ist das Maß aller Dinge. Wortwörtlich. Was reale UnannehmlichkeitenI für mindestens 50Prozent der Bevölkerung bedeutet. Und nicht nur in der Kloschlange. Wer überlebt einen Autounfall? Wer eine Krankheit? Was ist überhaupt eine Krankheit und was nicht? Warum ist Sprache so, wie sie ist? Warum ist Sport so anders, je nachdem, ob Frauen oder Männer ihn betreiben? Für wen ist eine Stadt gebaut? Wieso sind alle großen Straßen männlich? Warum haben meine Jeans unbrauchbare Taschen? Warum ist das Internet so, wie es ist?
Bei der Recherche ist mir schnell klar geworden, dass ich kein Buch über das Patriarchat schreiben kann, ohne auch gleichzeitig über Kapitalismus und Diskriminierung zu schreiben. Denn viele der Geschichten zeigen: Im Zentrum steht immer der Machterhalt. Und wer hat die Macht? Reiche Menschen. Weiße Menschen. Männer. Die meiste Macht entfällt auf den reichen, weißen cis Mann.
Ich habe mit vielen unterschiedlichen Frauen aus unterschiedlichen Generationen für dieses Buch gesprochen. Nur Frauen, das hat sich so ergeben und war nicht von Anfang an geplant, allerdings habe ich schnell gemerkt, dass meine Interviewanfragen bei Männern sonderbare Reaktionen auslösten, auf die ich kurz gesagt schlicht keine Lust hatte.II Lieber Spaß bei der Arbeit haben und mit Wissenschaftlerinnen, Expertinnen, Pionierinnen, Aktivistinnen, Frauen sprechen, die im Laufe ihres Lebens auf Hindernisse gestoßen sind und beschlossen haben, daran zu arbeiten, sie aus dem Weg zu räumen – für sich und für die Personen, die folgen werden. Denn, so viel steht auch fest, aus ihren Geschichten und Erfahrungen sind abseits der betonierten Wege neue Trampelpfade entstanden, die hoffentlich für die kommenden Generationen leichter zu beschreiten sind. Ein Spaziergang durchs Leben für jede und jeden lautet das Versprechen am Ende des feministischen Regenbogens. Ist doch klar!
Aber im Ernst: Ich glaube, wenn wir es schaffen, auch jenseits von akademischen Diskursen und der eigenen progressiven Blase Gespräche über diese Mechanismen in Gang zu setzen, also Aufmerksamkeit auf diese Dinge zu lenken, gewinnen wir alle etwas. Dafür können die Beispiele in diesem Buch ein Anfang sein, es ist kein umfassendes Inventar oder gar eine Enzyklopädie des patriarchalen Designs, denn viel größer als die Menge der Dinge, die hier vorkommen, ist die Menge der Dinge, auf die ich nicht gestoßen bin oder die ich platzbedingt weglassen musste.
Irgendwann im Laufe der Schreiberei fragte mich mein Steuerberater, warum ich denn gerade so wenig Radio mache, und als ich ihm erklärte, dass ich gerade ein Buch über patriarchales Design schreiben würde, war seine Reaktion: »O Gott, muss ich jetzt Angst haben«III
Diese Angst, die Männer heimsucht, sobald Frauen Missstände offenlegen, ist in meiner Recherche allgegenwärtig gewesen. Anfang Mai 2020 veröffentlichte das Funk-Kollektiv STRG_F auf Youtube eine Doku über ein verwandtes Thema, den #GenderDataGap. Impulsgeber ist ein Buch von Caroline Criado-Perez mit dem Titel Unsichtbare Frauen, in dem es darum geht, dass wissenschaftliche Erhebungen, die oft am Anfang von Forschung und Entwicklung stehen, größtenteils von männlichen Daten ausgehen.1 Aus diesem Datenungleichgewicht, das historisch gewachsen ist und sich bis heute hartnäckig hält, ist eine Welt auf männlicher Datenbasis, also aus männlich normierten Berechnungen geworden. Die Doku von STRG_F erhielt innerhalb der ersten Tage auf Youtube mehr als doppelt so viele schlechte Bewertungen wie positive. Und mehrere Tausend wütende Kommentare, hauptsächlich von Typen, die den Eindruck erwecken, die Macher:innen des Films wollten ihnen persönlich etwas wegnehmen.
Männliche Privilegien, so hartnäckig sie sich in unserer patriarchalen Welt halten, so fragil scheinen sie auch zu sein. Der Beweis findet sich in jeder Kommentarspalte unter jeder beliebigen feministischen Veröffentlichung.
Ein langjähriger Freund und älterer Kollege, mit dem ich in unregelmäßigen Abständen über den Recherche- und Schreibprozess gesprochen habe, meinte, ich müsse aufpassen, dass dies kein »biestiges« Buch werde. Abgesehen davon, dass »biestig« gleich neben »zickig« in den Giftschrank der sexistischen Adjektive gehört und mit Sicherheit noch nie als Ratschlag für die Tonalität eines Buches von einem männlichen Autor bemüht wurde, zeigt sich daran noch etwas anderes: Ungerechtigkeit zu bemerken und aufzuschreiben ist in Ordnung, doch wenn daran eine Emotion geknüpft ist, dann bitte nicht so etwas Negatives und unweibliches wie Wut – denn das macht es dann »schwerer, ernst genommen zu werden«. »Da werden Weiber zu Hyänen«, schrieb Friedrich Schiller 1799 in Das Lied von der Glocke – gefährliche Anarchie, wo kämen wir denn hin, wenn wir Frauen uns von Gefühlen leiten ließen. Schlicht unweiblich, nein unmenschlich, ja animalisch.
Soraya Chemaly schreibt in ihrem Buch Speak out!: Die Kraft weiblicher Wut, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ganz großartig darin ist, die weibliche Wut zu pathologisieren, anstatt sie ernst zu nehmen und in ihr das Potenzial für den Wandel zu sehen, den wir erleben möchten.2
Wir lernen von klein auf, dass Wut hässlich ist und dass wir Frauen, wenn uns Ungerechtigkeit widerfährt, zwar um Hilfe bitten oder traurig sein dürfen, aber bitte nicht wütend. Logisch: Traurigkeit ist passiv. Eine traurige Frau leidet als Opfer, von ihr geht keine Gefahr für die bestehende Ordnung aus. Wut hingegen hat Aktivierungspotenzial. Wut kann Motivation für ein Buch sein. Oder, wie die amerikanische Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Audre Lorde schrieb: »Wut kann zu etwas wachsen, das sich auf die Gesellschaft wie ›corrective surgery‹ auswirkt.«3 Wenn die Nasenscheidewand so schief ist, dass der Mensch nicht mehr atmen kann, muss die Nase erst gebrochen werden, bevor es besser wird …
Die Wut, die zu diesem Buch geführt hat, habe ich also nicht zensiert, sondern vor meinen Karren gespannt. Aber gleichzeitig habe ich versucht, das fragile männliche Ego mitzudenken und Nasen mit Vorsicht zu brechen – denn wie David Graeber in seinem Buch Bürokratie. Die Utopie der Regeln bemerkt hat, reagieren Männer allein auf den Vorschlag, es könnte eine andere Perspektive als ihre eigene geben, gewohnheitsmäßig so, als wäre ihnen allein durch die Erwähnung bereits Gewalt angetan worden.4
Trotz des gelegentlichen Impulses, alles plattmachen zu wollen, glaube ich fest daran, dass feministischer gesellschaftlicher Wandel inklusiv sein muss. Also für alle Menschen einen Zugewinn an Lebensqualität zu bieten hat. Von einem Auto, das so designt ist, dass es bei einem Aufprall nicht nur den Fahrer, sondern auch die Fahrerin bestmöglich schützt, profitieren alle, die Männer inklusive. Denn wer hat nicht gerne eine lebendige Frau, Freundin, Mutter, Tochter, Schwester etc., und zwar ungeachtet ihrer Hautfarbe und Religion, ihres Kontostandes oder ihrer sexuellen Orientierung. Und wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende denken, kommen wir automatisch beim Intersektionalen Feminismus an.
Dieser Begriff geht auf die amerikanische Bürgerrechtlerin und Juraprofessorin Kimberlé Crenshaw zurück, die ihn vor mehr als 30Jahren geprägt hat – als »Linse oder Prisma, das verdeutlicht, wie verschiedene Formen von Ungleichheit miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig verschlimmern. Nicht jede Ungleichheit wird auf die gleiche Art und Weise erzeugt.«5 Es geht darum, die Beziehung zwischen den verschiedenen Mechanismen der Machtzentrierung zu untersuchen, indem ein besonderer Fokus auf Menschen gelegt wird, die sich an den Schnittstellen gleich mehrerer Diskriminierungserfahrungen befinden, zum Beispiel Sexismus, Armut und Hautfarbe. Beispiel: Was nützt es der migrantischen Frau, die den Lebensunterhalt mit Putzen verdient und in prekären Verhältnissen ohne Altersvorsorge lebt, wenn die Frau, für die sie die Hausarbeit erledigt, als Managerin in Power-Suits Glasdecken durchbricht? An ihrer Situation ändert sich dadurch rein gar nichts. Gleichberechtigung und soziale Teilhabe sickern nicht von alleine von oben nach unten durch, im Übrigen genauso wenig wie Wohlstand durch Steuererleichterungen für die Reichen.
Dies ist kein Buch über feministische Theorie, denn darüber haben schon andere geschrieben (lesen Sie deren Bücher!). Es ist vielmehr ein Buch über das Leben, die Praxis, den Alltag.
Ein erfolgreicher Feminismus darf nicht bloß zweckdienlich für mich, die weiße, privilegierte, heterosexuelle cis Frau, sein, sondern muss jede Ursache von Diskriminierung und Unterdrückung ansprechen und bekämpfen, das heißt nicht nur Sexismus, sondern auch Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Alter, Körperbeschaffenheit, sexueller Orientierung, ReligionIV… Nicht all diese Themen finden sich hier wieder, dazu ist das Buch nicht umfangreich genug und mein Wissen zu begrenzt. Aber, keine Sorge, erhellende Literatur für ein tieferes Verständnis von Intersektionalem Feminismus lässt sich leicht finden!
Ob ich so etwas wie die »phallische Saftpresse von Philippe Starck« meine, wurde ich vor Kurzem von einer Künstlerin gefragt, als ich ihr erzählte, dass ich über Design schreibe. Ich googelte, und nein: Es wird zwar an einigen Stellen auch um Design in Phallusform gehen, aber eine kultige, wenn auch sichtlich unpraktische Saftpresse fällt für mich nicht unter meine Definition von patriarchalem Design, da dieses Design für alle Nutzer:innen gleichermaßen unpraktisch ist, jedenfalls, soweit ich es den Online-Produktrezensionen entnehmen konnte. Es diskriminiert nicht zwischen Mann und Frau, zwischen weiß und nicht weiß, jung und alt – es ist einfach nur eine Designer-Saftpresse, die mangelhaft funktioniert. Function follows form. Und dass dieses Ding in all seiner Fehlerhaftigkeit, wäre es von einer Frau entworfen worden, wahrscheinlich nie einen solchen Kultstatus erreicht hätte, mag an den Strukturen des Patriarchats liegen, ist aber an sich kein patriarchales Design.
Unpraktische Saftpresse, aber kein patriarchales Design
Design ist die Form, die wir unseren Ideen geben. Alles, was menschengemacht ist, ist gestaltet. Es umfasst sowohl die Dinge der materiellen Welt – wie Autos, Sextoys, Bohrmaschinen, Fahrräder, Klamotten – als auch die nicht materiellen Dinge wie soziales Design: den öffentlichen Raum, die Stadtplanung, aber auch Sprache, Gesetze und Politik. Ein weiterer, großer und stetig wachsender Bereich, in dem Ideen eine Form erhalten, ist das Internet, sind die sozialen Medien, Algorithmen, Community-Richtlinien und was sonst noch so in diesen CyberspaceV gehört.
Es ist ein Buch darüber, warum die Welt so ist, wie sie ist, und warum vielen MenschenVI das nicht passt. Und darüber, was wir tun können, um sie zu verändern. Es ist die Geschichte des Blümchenkleides, genau wie die der Fußballschuhe, die Geschichte von Videospielen, Sex und Religion. Es geht einerseits um völlig sinnlos gegendertes Design, um Ideen und Erfindungen mit dem alleinigen Zweck, die Frau im Zaum zu halten. Es geht aber auch um sinnlos ungegendertes Design, das Frauen daran hindert, ihr Potenzial auszuschöpfen, sei es Leistung zu erbringen oder schlicht zu überleben. Und es geht darum, wie das patriarchale als das grundlegende Design hinter fast allem steht, was uns umgibt.
Aber fangen wir mit dem Anfang an.
Kapitel 1
SPRACHKONSTRUKTE
Am Anfang war das Wort. Noch bevor wir als Kleinkinder der 1980er-, 1990er- oder 2000er- Jahre in Lackschühchen oder Ninja-Turtle-Pullover gesteckt wurden, lernten wir vom allerersten Tag an Sprache, unsere »Muttersprache«. In meinem Fall war das Französisch, da ich aber außer mit meiner Mutter und meinem Bruder sonst mit niemandem Französisch gesprochen habe, wurde meine Muttersprache mit der Einschulung mehr und mehr durch das in Deutschland ja wesentlich praktischere Deutsch abgelöst. Sprache ist sehr viel mehr als eine Aneinanderreihung von Silben und Wörtern, in ihr stecken Ideen, die wir als gesellschaftliches Kollektiv mehrheitlich teilen, einprogrammiert wie ein Code, nicht immer sichtbar, hörbar, dennoch formen sie uns. Ein paar dieser Codes habe ich mir etwas genauer angeschaut, den Anfang macht die Binarität.
Linguistischer Völkerball
Die Einteilung in weiblich und männlichI ist in den europäischen Sprachen allgegenwärtig. Aber die Idee von zwei einander entgegengesetzten Kategorien ist nicht biologisch, sondern sozial konstruiert. Geschlechteridentitäten, existieren sowohl dazwischen als auch jenseits der gesellschaftlichen Schubladen, die wir in der Mehrheitsgesellschaft dafür vorgesehen haben.
Erst mal müssen wir zwischen Sex und Gender unterscheiden, zwischen BiologieII und Soziologie. Beides, Sex und Gender, findet sich in patriarchalem Design wieder, aber in Bezug auf Sprache geht es in erster Linie um Gender, also darum, was ich, was unsere Nachbar:innen, Erzieher:innen und Modedesigner:innen etc. unter weiblich und männlich verstehen, also um die sozial konstruierte Idee davon, welche Eigenschaften zu welchem Geschlecht gehören. Und bloß weil »Geschlecht« konstruiert ist, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Dass die Konsequenzen nicht real sind. Meistens bedeutet es sogar genau das Gegenteil: Unsere Ideen-Konstrukte sind um einiges robuster als Stein-Konstrukte wie Denkmäler, die sich auch einfach abreißen lassen.
Wer ist Bouba und wer ist Kiki?
Nehmen wir ein sprachliches Beispiel dafür, wie die Verknüpfung von Sprache und Welt funktioniert. Seit knapp 100Jahren existieren Bouba-&-Kiki-Experimente. Die Mehrheit der Menschen (je nach Studie bis zu 98Prozent) kann den beiden willkürlichen Formen die Namen Bouba und Kiki zuordnenIII, und zwar ungeachtet ihres Kulturkreises. In einigen Versuchen wurden Bouba und Kiki dann auch noch bestimmte Eigenschaften wie »gemütlich« oder »lustig« zugewiesen, und auch da gab es erstaunliche Übereinstimmungen.
Was hat das mit weiblich und männlich zu tun? Nun, ähnlich wie Bouba und Kiki sind auch Vorstellungen darüber, was weiblich und männlich ist, total willkürlich, und dennoch herrscht ein großer gesellschaftlicher Konsens darüber, in welche Gehirnschublade Eigenschaften einsortiert werden. Aber anders als Bouba und Kiki, deren Namensgebung konsequenzlos bleibt, da sich keine:r der beiden für eine Führungsposition bewerben und auch keine Bahnhaltestelle nach ihr:ihm benannt wird, haben unsere sprachlichen Zuschreibungen von Geschlechtereigenschaften Auswirkungen auf das Miteinander.
In The Last Bohemians, einem meiner vielen Lieblingsinterviewpodcasts, interviewt Ali Gardiner in einer Folge die feministische Filmemacherin Vivienne Dick, und als es um ihren Umzug von Irland nach New York als junge Frau in den späten 1970er-Jahren geht, sagt Gardiner anerkennend zu Dick: »It takes balls to do that«IV. Hm …
Ich glaube nicht, dass ein Hodensack zur Grundausstattung für ein aufregendes, unkonventionelles Leben gehört, aber ich verstehe gut, warum es für das Patriarchat von Vorteil ist, diese Assoziation zu kultivieren. Es ist tatsächlich eine Frage der Kultur: In so vielen Sprachen benutzen wir Synonyme für Hoden, um auszudrücken, dass eine Person besonders mutig ist.V Eier in der Hose haben, avoir des couilles … Und 1932 nutzte Ernest Hemingway in seinem berühmten Roman Tod am Nachmittag zum ersten Mal cojones, um den Mut eines Stierkämpfers zu beschreiben6, clever, weil Stierkampf gleich Spanien, ergo mutige spanische Hoden. Aber männliche Genitalien wurden in der westlichen Kultur schon sehr viel früher als die Quelle für Edel- und Wagemut identifiziert. Im England des 16.Jahrhunderts wurde darüber philosophiert, ob der Hodensack nicht nur Samen enthalte, sondern eben auch das, was den Mann zum Mann mache: physische Stärke und virile Tugenden, alles praktisch in ein Säckchen verpackt und unter den Penis zwischen die Beine gehängt. Interessanterweise schienen sich die alten Griechen eher uneins über die Frage zu sein, inwieweit die Größe des Hodens ein Indikator für den Mut einer Person ist. Zwar kommt der am häufigsten verwendete Mut-Begriff »andria« von »anēr«, Mann, und in antiken Komödien finden sich sowohl Figuren mit riesigen Hoden, die Potenz verkörpern, als auch solche, denen die Hoden fehlen, Zeichen eines Daseins als Schwächling. Andererseits schien man sich aber auch Gedanken um die Ausprägung toxischer Männlichkeit zu machen, die von zu großen Testikeln herrühren könnte. Mangelnde Selbstkontrolle und lüsternes, gefährliches Verhalten zum Beispiel, weshalb so viele Helden in der griechischen Kunst eher so etwas in der Größe kleiner Muskatnüsse zwischen den Beinen hängen haben. Gleiches gilt übrigens auch für die Penisgröße – je tugendhafter der Held, desto kleiner sein gesamtes Gehänge. Über diese Vorstellung von »Eier gleich Mut« stolpert man leicht, auch, weil es so plakativ ist. Aber die deutsche Sprache ist voller impliziter Geschlechterzuschreibungen. Ein anderes hässliches Beispiel: Anfang Februar 2020, am Tag nach dem Coup, durch den der thüringische Ministerpräsident aus den Reihen der FDP mithilfe von AfD-Stimmen gewählt worden war, sprach der Bundesvorsitzende der Liberalen Christian Lindner davon, dass Thomas Kemmerich »übermannt« worden sei. Aus diesem Grund sei er – und das sind meine Worte – nicht mehr Herr seiner selbst gewesen und habe die Wahl angenommen, obwohl ihm da schon hätte klar sein müssen, dass dies ein Fehler war.
Herkules mit tugendhafter Ausstattung
Mal abgesehen davon, dass diese ganze Chose mittlerweile Geschichte ist und Kemmerich hinlänglich bewiesen hat, wes Geistes Kind er ist, lohnt es sich, kurz über »übermannen« nachzudenken. »Übermannt werden« ist nämlich eine der wenigen männlichen Optionen, Gefühle zu äußern beziehungsweise sie überhaupt zuzulassen – weil Mann nicht die Wahl hat. Die angebliche Schwäche wird in diesem Kontext als eine kriegerische Niederlage inszeniert.
Die Römer werden regelmäßig von Asterix und Obelix übermannt – eine Naturgewalt (beziehungsweise eine dank Zaubertrank übernatürliche Gewalt) bricht über den Mann herein und hinterlässt ihn vollkommen machtlos, daher auch die grammatikalische Passivkonstruktion. Ich habe geschaut, welche Wörter am häufigsten in Kombination mit »übermannt« verwendet werden, in alphabetischer Reihenfolge sind es die folgenden: Begeisterung, Drang, Emotion, Erregung, Freude, Frühlingsgefühl, Furcht, Gefühl, Glücksgefühl, Heimweh, Leidenschaft, Lust, Mitleid, Müdigkeit, Nostalgie, Rausch, Rührung, Scham, Schlaf, Schmerz, Sehnsucht, Trauer, Träne, Verzweiflung, Wut, Zorn. Man könnte auch sagen: »Übermannt zu werden« ist eine männlich-akzeptable Art des Kontrollverlustes, da sie von außen und sozusagen kriegsbedingt zugefügt wird.
Wenn eine Frau es schafft, männlichen Kriterien zufolge irgendetwas zu leisten, ohne dabei ihre typisch weiblichen Tugenden zu vernachlässigenVI, wird sie gerne als »echte Powerfrau« angepriesen. Die Powerfrau steht auf einem Sockel, auf den meist Männer sie gestellt habenVII, nach dem Motto: Schaut her, wenn Frau will, dann kann auch sie Kraft und Macht ausstrahlen. Aus männlicher Sicht ein Vorbild für all jene Frauen, die meckern und sich von den Erwartungen an Karriere und Familie überfordert fühlen. Nicht so die Powerfrau, denn sie hat ja Power und signalisiert: Hey, alles prima!
Wie absolut patriarchal, paternalistisch und lächerlich das ist, würde schnell klar, wenn wir anfingen, irgendwelche Männer, die in ihrem Leben schon mal etwas geleistet haben, als »echte Powermänner« zu bezeichnen. Kai Pflaume, Moderator, Werbe- und Stilikone, Familienvater – ein »echter Powermann«!
Apropos Familienvater … Was machen eigentlich all die Familienmütter da draußen? Ach, ich vergaß – die Frau kümmert sich ja ohnehin um die Familie, weil Care-Arbeit in ihrer Natur liegt, anders als bei Männern, die sich bloß gegen ihren Instinkt nicht wie absolut egoistische Arschlöcher verhalten. Familienmutter ist also einfach keine hervorstechende Eigenschaft.
Ich könnte noch eine lange Liste von Beispielen anbringen, aber ehrlich gesagt wäre das weder besonders informativ noch unterhaltsam. Der Erkenntnisgewinn sollte also nicht in der Menge liegen, sondern eher darin, dass wir uns klarmachen, was unsere Worte ausdrücken und anrichten.
Ein Beispiel habe ich aber noch: 1996, ich war in der 6. Klasse, und irgendein Lehrer dirigierte ein Völkerballspiel. Jungs gegen Mädchen, oder wie er sagte: »herrlich« gegen »dämlich«. Während die meisten Jungs sich köstlich über diesen Prä-Mario-Barth-Humor amüsierten, schauten wir Mädchen verschämt zu Boden und rüsteten uns innerlich für die unvermeidbare Niederlage. Mit Bällen abgeschossen zu werden, das war die eine Sache, aber uns in unseren Bemühungen »dämlich« zu nennen, war die größere Demütigung. Mein vorpubertäres Ich spürte zum ersten Mal bewusst den Puls im Hals schlagen, so wütend war ich! Herren – herrlich, Damen – dämlich, so flach und gemein kann Sprache doch nicht sein
Auch wenn das natürlich etymologischer Quatsch ist: Was blieb, ist das Gefühl, dass Worte länger wehtun können als ein Ball mitten in die Fresse.
Die Spione machten sich auf den beschwerlichen Weg durch die laue Nacht.
Einigen Frauen wurde dabei zu warm, und sie zogen ihren Trenchcoat aus.
Den Stein des Anstoßes ins Rollen bringen
Selbst Typen, die behaupten, »alles, was nicht generisches Maskulinum ist, ist unschön und stört den Lesefluss« – und davon gibt es immer noch viele –, müssen doch merken, dass ihr Gehirn beim zweiten Satz gedanklich zurückspringt, um nachträglich das Bild im Kopfkino zu korrigieren.
Der viel zitierte Sokrates sagte einst, dass, wer in der Sprache nicht vorkomme, dies auch nicht im Bewusstsein tue. Und etwa 2400Jahre später stellen wir fest: Ja, das stimmt, und daran hat sich nicht viel geändert. Das heißt aber nicht, dass alle Frauen sich bis dato mit ihrer Unsichtbarkeit abgefunden hätten. Auftritt Marlies KrämerVIII: Wenn OG für Original Gangster steht, dann ist Krämer so etwas wie eine OF, eine Original Feminist. Damit meine ich allerdings nicht, dass sie eine der ersten feministischen Denkerinnen ist. Es ist eher so, dass alles im Lebensweg der 1937 im saarländischen Illingen geborenen Krämer darauf hindeutet, dass sie nicht durch Schriften oder Lehren feministischer Ikonen radikalisiert wurde, sondern aus sich selbst heraus, durch die eigene, unmittelbare Lebensgeschichte. Ihr Vater verwehrte ihr das Studium, es folgte eine Ausbildung zur Verkäuferin, und mit Mitte dreißig wurde sie Witwe, alleinerziehend mit vier Kindern. Krämer hat viele Baustellen des Feminismus am eigenen Leib erlebt: kostenlose, unsichtbare Care-Arbeit, ungleiche Bildungschancen, Leben in prekären Verhältnissen, das Gefühl, für Entscheidungsträger:innen unsichtbar zu sein … Irgendwann hat sie beschlossen, sich zu wehren. Es begann 1990, als sie sich weigerte, der Inhaber ihres neuen Reisepasses zu sein. Das sei nicht sie, Frau Marlies Krämer, also unterschrieb sie nicht. Es dauerte sechs Jahre und brauchte mehrere Unterschriftensammlungen, bis der Bundesrat nach EU-Verhandlungen entschied, dass es von nun an Inhaber und Inhaberinnen von Personaldokumenten geben sollte. Ein erster kleiner Erfolg, mit dem sie sich aber nicht zufriedengeben wollte. Schließlich, seien wir mal ehrlich, wird das Leben einer Frau Krämer nicht allein dadurch besser, dass sie nun offiziell Inhaberin eines Ausweisdokuments ist. Erst recht nicht in den 1990er-Jahren, als die Debatte um geschlechtergerechte Sprache gerade erst begonnen hatte und die ersten größeren Veränderungen noch fast drei Jahrzehnte entfernt waren.
Was Sokrates schrieb und Krämer empfand, belegen heute Studien: Frauen werden nicht automatisch mitgedacht, wenn sie unerwähnt bleiben. Wer also ständig Kunde sagt oder hört, der schließt unterbewusst aus, dass es auch Kundinnen gibt. Und dass eine Kundin möglicherweise andere Bedürfnisse, Prioritäten und Wünsche haben könnte als der durchschnittliche Kunde, bleibt damit ebenfalls unsichtbar.
»Mechaniker müssen in der Lage sein, viele Werkzeuge zu bedienen. Deswegen sollten sie keine langen Fingernägel haben.«
Diese beiden Sätze haben Teilnehmer:innen einer Studie aus dem Jahr 2002 auf Deutsch und Französisch gelesen, und dabei wurde gemessen, wie lange Personen brauchten, um den zweiten Satz zu verstehen. Beide Sprachen haben, im Gegensatz zu Englisch beispielsweise, ein grammatikalisches Geschlecht. »Mechaniker« ist also sowohl generisches Maskulinum als auch eine Bezeichnung für einen stereotyp-männlich assoziierten Beruf. Erst beim Lesen der »langen Fingernägel« wird klar, dass der Begriff sich in diesem Fall wahrscheinlich auf Männer und Frauen bezieht. Die Personen brauchten länger, um den zweiten Satz zu verstehen, als die Kontrollgruppe, die ebenfalls im generischen Maskulinum las, jedoch im Zusammenhang mit einem weiblich konnotierten und meistens auch weiblich gegenderten Berufsfeld wie »Callcenter-Mitarbeiter« oder »Kosmetiker«.7
Neben dem Argument, dass das schrecklich unpräzise und damit unpraktisch ist, funktioniert Sprache in unserem Kopf auch als Trigger für das Bewusstsein. Fragt man Menschen nach »geeigneten Politikerinnen und Politikern für die nächste Bundestagswahl«, so fallen Männern und Frauen weit mehr Frauen ein, als wenn man schlicht nach »Politikern« fragt. Auch die Frage nach berühmten »Schriftstellerinnen und Schriftstellern« förderte, wenig überraschend, auf Anhieb mehr Frauen aus den Untiefen der Gedächtnisse als das generische Maskulinum.8
Seit dem 12.Oktober 2020 hege ich die Vermutung, dass meine 42Millionen Mitbürgerinnen und ich vogelfrei sind – Gesetzlose, die in einem legislativen Niemandsland existieren. Denn an diesem Tag hat das Bundesinnenministerium (CDU/CSU) einen Gesetzesentwurf zum Sanierungs- und Insolvenzrecht des Justizministeriums (SPD) gestoppt – wegen verfassungsrechtlicher Bedenken –, weil dort von »Geschäftsführerin«, »Verbraucherin« und »Schuldnerin« die Rede war. Der Entwurf war, anders als sonst üblich, nicht im generischen Maskulinum, sondern im generischen Femininum verfasst worden, was den Koalitionspartnern so gar nicht goutierte. Ein Sprecher des BMI tat kund, dass der Entwurf »in ausschließlich weiblicher Begriffsform« rechtlich gesehen möglicherweise nur für Frauen gelte. Spannend! Gelten denn dann nicht möglicherweise gerade alle Gesetze nur für Männer? Das BMI sieht das nicht so, denn »das generische Maskulinum ist anerkannt für Menschen von männlichem und weiblichem Geschlecht«, so der Sprecher. Das generische Femininum sei hingegen »zur Verwendung für weibliche und männliche Personen bislang sprachwissenschaftlich nicht anerkannt«. Soso. Vereinfacht gesagt lautet das Argument: Das hat so zu sein, weil … ja, weil …, das haben wir immer schon so gemacht! Dass den Herren im Innenministerium dabei nicht klar wurde, dass ihr Argument problemlos auch gegen das generische Maskulinum verwendet werden kann, wäre bemerkenswert, wenn es nicht schon vor über 30Jahren von der Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch genauso beschrieben worden wäre.9 Pusch war die Erste, die der geschlechtlichen Absurdität in der deutschen Sprache die Bezeichnung »generisches Maskulinum« gab und das Problem anhand des folgenden Beispiels erläuterte: »99Sängerinnen und 1 Sänger sind zusammen 100Sänger (merke aber: 99Birnen und 1 Apfel sind zusammen nicht 100Äpfel, höchstens 100Früchte!) Futsch sind die 99Frauen, nicht mehr auffindbar, verschwunden in der Männer-Schublade.« Und auch die deutsche Rechtssprache ist kein in Stein gemeißeltes Regelwerk, sondern im ständigen Wandel, wie Anna Katharina Mangold, Professorin für Europäisches Recht an der Europa-Universität in Flensburg schreibt.10
Diesem Wandel ein wenig auf die Sprünge zu helfen, das wird wahrscheinlich die Intention der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gewesen sein, als sie unter Zuhilfenahme eines schnöden GesetzesentwurfsIX erfolgreich Aufmerksamkeit auf das sprachliche Ungleichgewicht lenkte. Auch die New York Times griff das Thema auf und berichtete, dass sich hieran zeige, »wie in Deutschland mit seinen tief verwurzelten Geschlechternormen Sprachkonventionen zu einer Hürde auf dem Weg der Gleichberechtigung werden können«.11
Autor Nele Pollatscheck hat ebenfalls etwas gegen die tief verwurzelten deutschen Geschlechternormen, bloß sieht sie die Lösung nicht im Gendern, sondern in einer Sprachentwicklung jenseits des Genderns – weshalb sie auch lieber Autor als Autorin ist. Ich gebe zu: Diese Fixierung auf Genitalien, dieses Gefühl, durch »:in« als Extrawurst auf sein Geschlecht reduziert zu werden, kenne ich. »Gendern ist eine sexistische Praxis, deren Ziel es ist, Sexismus zu bekämpfen«, schreibt Pollatschek im Tagesspiegel, wir fügen mit jedem :in implizit das Adjektiv »weiblich« hinzu, das uns vom anderen Geschlecht unterscheidet.12 Durch das Sichtbarmachen von Frauen wird der Fokus also auf ihre Andersartigkeit, nicht auf ihre Gleichberechtigung gelegt. Das leuchtet mir alles ein. Bloß: Ich weiß im Moment keine bessere Lösung. Denn im Englischen, auf das Pollatschek sich in ihren Beispielen bezieht, gibt es kein grammatikalisches Geschlecht, the actor ist erst mal neutral, erst durch die weibliche Form the actress wird das Neutrale zum Männlichen. Möglicherweise reformbedürftig, doch wir haben im Deutschen bis heute der, die, das. Wieso, weshalb, warum Wer nicht (hinter)fragt, bleibt …
Solange es das sprachliche Unsichtbarmachen von real existierenden strukturellen Ungleichgewichten gibt, bestehe ich weiterhin auf die weibliche Form, auch wenn das, nach Pollatschek, jedes Mal einem Ausruf von »Vagina!«X gleichkommt. Also auch in diesem Buch, wo ein konsequenter Einsatz gegenderter Sprache tatsächlich präziser ist und eine nicht gegenderte Sprache verwirrend wäre. Denn die Art und Weise, wie wir im Alltag gendern, formt unbewusst unsere Wahrnehmung.
Während des Corona-Sommers 2020 habe ich im Radio ein Gespräch zwischen einem Korrespondenten und einem Moderator gehört. Es ging um die Frage, ob es (Stand: August 2020) wieder sicher sei, die Kinder in die Schule zu schicken. Gegendert wurden: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Nicht gegendert wurden: Mediziner, Politiker, Forscher. Könnte das eventuell etwas mit Status zu tun haben Dabei ist gerade im Bereich der öffentlichen Berufsbezeichnungen eine ausgeglichene sprachliche Repräsentation von Frauen und Männern ein Kriterium dafür, ob sich ein Kind eine berufliche Zukunft auf dem Gebiet zutraut.
Matthäus und Matilda
Ein Klassiker und Evergreen unter den Langzeit-Gender-Experimenten, der die Macht von Sprache und Wahrnehmung auf eine einfache Weise veranschaulicht, ist der sogenannte »Draw-a-Scientist«-Test. Seit mehr als 50Jahren bekommen Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, meist in englischsprachigen Ländern, die Aufgabe, eine Person aus der Wissenschaft zu zeichnen. Und seit ebenfalls 50Jahren zeigt ein Großteil der Zeichnungen eindeutig Männer in Laborkitteln. Typische »Accessoires« wie Bücher, Reagenzgläser oder auch einfach eine Brille sind dagegen häufiger auf Bildern mit Wissenschaftlerinnen zu sehen, ganz so, als wären Requisiten nötig, um eine Frau in diesem wissenschaftlichen Kontext erkennbar zu machen.XI In der ersten Versuchsanordnung zwischen 1966 und 1977 zeigten von den 5000 Kinderzeichnungen nur 28Wissenschaftlerinnen, und alle 28 waren von Mädchen gemalt worden. Weniger als ein Prozent der Kinder stellte sich unter scientist also eine Frau vor, allein unter den Mädchen waren es 1,2Prozent. Diese Zahl ist im Laufe der Zeit stetig gestiegen, und vorangetrieben haben diese Veränderungen Mädchen. 1985 zeigten immerhin 33Prozent ihrer Zeichnungen eine Frau, 2016 58Prozent, zum ersten Mal hatten Mädchen also mehr Wissenschaftlerinnen als Wissenschaftler gemalt. (Jungen hingegen malen bis heute in neun von zehn Fällen einen Mann).13 Doch bevor wir uns überschwänglich über den positiven Trend freuen – es gibt einen Haken: Je älter die Mädchen sind, desto weniger Wissenschaftlerinnen malen sie, ganz so, als würde das Leben junge Frauen desillusionieren und der Zuversicht einer wissenschaftlichen Karriere berauben, die sie als Sechsjährige noch hatten (70Prozent malten eine Frau). Mit 16Jahren malten nur noch 25Prozent eine Wissenschaftlerin. So einfach das Experiment auch ist, so gut zeigt es die prävalenten Rollenverständnisse und Stereotype in der Gesellschaft im Wandel der Zeit. Denn auch die Anzahl der tatsächlichen Wissenschaftlerinnen ist in den letzten Jahren weltweit gestiegen, allerdings nicht in demselben Umfang wie ihre Repräsentation auf den Kinderbildern – und außerdem sehr abhängig vom Fachgebiet: In den Ingenieurwissenschaften waren es beispielsweise 2015 weltweit noch immer nur 28,4Prozent.14
Unsichtbare Wissenschaftlerinnen erzeugen wir auch dadurch, wie wir über sie sprechen. Was haben Darwins Evolutionstheorie, die Newton’schen Gesetze, Einsteins Relativitätstheorie, die Mendel’schen Regeln und sogar Schrödingers Katze gemeinsam? Sie alle tragen den Namen ihres Entdeckers, genauer gesagt den Nachnamen. Was es nicht gibt, ist die Curie’sche Radioaktivität, die Meitner’sche Kernspaltung, den Goeppert-Mayer-Nukleus oder die Franklin’sche Doppelhelix-DNA …
Die beiden letztgenannten Namen kannte ich bisher noch nicht. Ich musste googeln, um auf zwei Wissenschaftlerinnen zu stoßen, die bahnbrechende Entdeckungen gemacht haben. Rosalind Franklin entdeckte als Erste die Doppelhelix der DNA und hielt sie fotografisch fest. Das war 1952 ein Riesending, denn die Genforschung steckte noch in den Kinderschuhen, die DNA war gerade erst entdeckt worden, und noch wusste niemand so genau, wie sie aussieht. Antworten auf diese Frage konnten zur Entschlüsselung der Bestandteile und damit zu einer Bauanleitung allen Lebens führen. Dennoch ist Rosalind Franklin außerhalb von Fachkreisen kaum jemandem ein Begriff, geschweige denn ein geläufiger Name.
Wir kennen nicht nur mehr Männer beim Namen, manch einer wurde sogar regelrecht zur Marke. Der Nachname reicht aus, um ein Bild und eine Leistung vor Augen zu haben. Apropos Bild: Wer kennt ihn nicht, den Zunge herausstreckenden Einstein, den Andy Warhol in leuchtenden Farben zur Ikone gemacht hat? Hingegen eine Physikerin in leuchtenden Farben, da kommt mir zumindest nichts in den Sinn.XII Das ist kein Zufall! Amerikanische Studien haben gezeigt: Wenn wir in der dritten Person (also »sie/er«) über Menschen des öffentlichen Lebens sprechen, tendieren wir dazu, doppelt so häufig männliche Personen nur mit dem Nachnamen zu nennen als weibliche Personen, die eher mit Vor- und Nachnamen genannt werden.15 2016 ist es im US-Wahlkampf Trump gegen Hillary Clinton so gewesen.XIII
Auch in der deutschen Politikberichterstattung lassen sich Unterschiede in der Benennung von Frauen und Männern feststellen. Die Germanistin Mirjam Schuck untersuchte anhand einer Sammlung von über zwei Milliarden zufällig aus dem Internet gefischten deutschen Sätzen die verschiedenen Varianten der Namensgebungen rund um die damals (2014) in der Bekanntheit in etwa gleichauf liegenden Politiker:innen Angela Merkel und Gerhard Schröder.XIV Analysiert wurden ausschließlich Sätze, in denen die beiden gemeinsam vorkamen. Sie stellte fest, dass »Schröder« alleine sehr viel häufiger verwendet wurde als »Merkel« alleine, dafür aber »die Merkel« oder »Frau Merkel« häufiger vorkamen als das männliche Pendant »der Schröder« oder »Herr Schröder«.16 Einige Stichproben meinerseits haben jedoch ergeben, dass sich zumindest in der Berichterstattung großer deutscher Medien eine geschlechtsneutrale Namensgebung etabliert zu haben scheint: einmalige Nennung von Vor- und Nachnamen und anschließend Nachname.
Und auch jenseits der Politik gibt es die etwas veraltete Tradition, Schauspielerinnen oder Sängerinnen als besonders divenmäßig, aber auch einzigartig rüberkommen zu lassen, indem man sie als Grande Dame von irgendwas bezeichnet und passend dazu mit einem Artikel versieht: die Dietrich, die Huppert, die Callas. Einzigartig eben. Diese Asymmetrie deutet darauf hin, dass wir Frauen in der Öffentlichkeit immer noch als Anomalie Frau markieren müssen. Ganz so, als müssten Frauen zu jeder Zeit als geschlechtliche Wesen erkennbar sein, während Männer einfach Menschen sind. Und das spielt eine Rolle, weil Menschen, die schlicht beim Nachnamen genannt werden, für wichtiger und bekannter gehalten werden.
Geht es um eine Frau, dann gilt es auch, sie unmissverständlich auf ihren angestammten Platz zu verweisen: Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, die im Coronavirus-Update des NDR seit Herbst 2020 über Covid-19 informiert, wird im Spiegel-Interview als »Quotenfrau« und »die Neue an Drostens Seite«XV bezeichnet. Mit »Drosten« ist natürlich Christian Drosten gemeint, der »Popstar« (auch Originalzitat!) unter den Virologen. Gerne wird eine Frau gleich in Relation zu einem Mann definiert: »Die neue Rezo geht durch die Decke«. So lautete im April 2020 in der Neuen Zürcher Zeitung die Überschrift eines Artikels über Mai Thi Nguyen-Kim, die mit ihrem Youtube-Kanal maiLab Naturwissenschaften so erklärt, dass wir sie alle verstehen. Nguyen-Kim hat Abschlüsse der Eliteunis MIT und Harvard, ist promovierte Chemikerin und preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin. Dass uns für so eine außerordentlich erfolgreiche Frau als Vergleich bloß irgendein Mann einfällt, ist bezeichnend.
Und wenn wir über den Bekanntheitsgrad nachdenken, dann zeigt sich, dass dieser mit mehr Sichtbarkeit und höherem Status einhergeht, wodurch sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, mit Preisen bedacht zu werden.XVI Es geht im wahrsten Sinne des Wortes darum, sich einen Namen zu machen. Danach gilt: Wer hat, dem wird gegeben. Oder besser noch: Wen man kennt und erkennt, der wird anerkannt.
Dieses Phänomen heißt Matthäus-Effekt, benannt nach dem Apostel, und es gilt für die Wissenschaft, wo bekannte Persönlichkeiten ihre Aufsätze in renommierten Publikationen eher unterbringen können als weniger bekannte, genauso wie überall sonst seit biblischen Zeiten (wahrscheinlich aber auch schon davor).
»Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, der wird auch das genommen, was sie hat.«
So steht es im Matthäus-Evangelium (13:12). Okay, die weiblichen Pronomen im zweiten Teil des Satzes sind meine Korrekturen, die uns die Realität ein Stückchen näherbringen sollen. Denn angelehnt an das »Prinzip der Erfolge«, beschrieben im Matthäus-Effekt, gibt es auch den umgekehrten Effekt – Matilda.
Der Matilda-Effekt, benannt nach der amerikanischen Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage, die schon Mitte des 19.Jahrhunderts beklagte, dass Errungenschaften von Frauen in der Wissenschaft von deren Kollegen vereinnahmt werden, beschreibt also den gleichen Rückkopplungseffekt wie Matthäus, bloß mit negativen Vorzeichen. Es ist ein statistisch nachweisbarer Effekt, der veranschaulicht, wie weibliche Forschung bis heute nicht die Sichtbarkeit und Anerkennung findet, die sie verdient hat. Weibliche Erfolge werden immer noch häufig Männern zugeschrieben.17
Und wo wir von Erfolgen sprechen – die Bibel, weltweiter Bestseller, kann durchaus als bedeutender Erfolg bezeichnet werden. Doch wurde die Bibel wirklich ausschließlich von Männern geschrieben? Oder findet sich vielleicht sogar ein Matilda-Effekt im Matthäus-Evangelium? Margaret Rossiter, die Entdeckerin und Benennerin des Matilda-Effekts, berichtet über eine Priscilla, von der die Bibelforschung herausgefunden haben will, dass sie Teile des neuen Testamentes verfasst hat. Weil die Informationslage im Internet dünn und uneindeutig war, habe ich mit Andrea Taschl-Erber gesprochen, der Bibelwissenschaftlerin und Expertin für die Rolle von Frauen im Neuen Testament, und sie nach Priscilla gefragt:
Priska, oder Priscilla, wie sie an einigen Stellen heißt, taucht im Neuen Testament mehrmals auf und ist offenbar eine wichtige Person im ersten Jahrhundert des entstehenden Christentums. Aber das Konzept von »Autorschaft«, wie wir es heute kennen, das gab es in der Antike hier so noch nicht: Die biblischen Texte sind teilweise über mehrere Generationen hinweg entstanden, als Arbeit eines Kollektivs. Gleichzeitig wissen wir, dass Frauen im frühen Christentum eine wichtige Rolle gespielt haben, und je mehr Menschen kollektiv an etwas arbeiteten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Frauen dabei waren und ihren Beitrag zur Entstehung geleistet haben. Möglicherweise als Ideengeberinnen, als diejenigen, die Überliefertes niederschrieben oder überarbeiteten. Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, nach denen die Evangelien benannt sind, sind Traditionsnamen und eher als Sammelbezeichnungen für diese Kollektive zu verstehen, die über sehr lange Zeiträume an den Inhalten gearbeitet haben, es handelt sich also nicht um Namen konkreter Männer, die diese Geschichten aufschrieben. Ob aber nun Priska daran mitgeschrieben hat, das kann heute niemand sagen. Natürlich kann man sich heute in Bezug auf die Briefe und Evangelien berechtigt fragen: Warum sind alle nach Männern benannt? Warum geht man implizit davon aus, dass alles von Männern geschrieben wurde, wohingegen die Autorinnenschaft erst wissenschaftlich belegt werden muss? Und wie soll das überhaupt gehen? Es ist unmöglich, sich wissenschaftlich festzulegen: Was hat eine Frau geschrieben? Was ein Mann? Aufgrund welcher Kriterien im Text? In der Bibelwissenschaft spricht man vonfemale voices:Die Forscherinnen schauen bei den Texten gezielt nach Hinweisen darauf, welche Standpunkte vertreten werden; wenn sie Frauen begünstigen, könnten diese eher von Autorinnen stammen. Alles, was mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hat, könnte zum Beispiel auf authentischen weiblichen Traditionen beruhen. Im Umkehrschluss vertreten male voices eher männliche Standpunkte. Beispielsweise finden sich in den im Namen des Paulus überlieferten Briefen Dinge wie die, dass Frauen zu schweigen haben. Das könnte von einem Mann stammen.
Die Tatsache, dass bis heute niemand weiß, ob Priscilla/Priska ein biblisches Beispiel für den Matilda-Effekt ist, offenbart besonders schön den Kern des Problems. Immerhin scheint die Bibel ja voller namenloser Beispiele für den Matilda-Effekt zu sein. Bloß: Unsichtbare Frauen aus der Antike sichtbar zu machen ist eben noch schwieriger als zeitgenössische.
Was sich aber heute mit Sicherheit sagen lässt: Der Soziologe, der den Matthäus-Effekt entdeckt und benannt hat, hat dabei selbst einen Matilda-Effekt verursacht, denn er hat seine Veröffentlichungen zu großen Teilen auf die Arbeit und Entdeckungen seiner jüngeren und bis dahin unbekannten Mitarbeiterin Harriet Zuckermann gestützt, ohne sie namentlich zu erwähnen. Ich glaube, einfacher kann man die Ambivalenz des Geschlechterverhältnisses zwischen Matthäus und Mathilda kaum veranschaulichen, schließlich ist die wahre Entdeckerin des Matthäus-Effektes aufgrund ihres Geschlechts dem bis dahin unbekannten Matilda-Effekt zum Opfer gefallen.XVII
Fast immer, wenn es um derartige Phänomene geht, gibt es Geschichten, die mit »bekanntestes Beispiel für den Sowieso-Effekt ist XY« anfangen. In der Natur des Matilda-Effekts liegt es jedoch, dass Bekanntheit ausgeschlossen oder sehr limitiert ist. Deswegen schließen wir den Kreis an dieser Stelle einfach nur mit einer von unzähligen Geschichten, stellvertretend für all jene, die wir nicht kennen. Und zwar mit der Geschichte der eingangs erwähnten Rosalind Franklin.
Sie war eine 32Jahre alte Biochemikerin und Röntgenspezialistin, als sie als Allererste die Doppelhelix der DNA fotografierte. Doch es waren drei ihrer Kollegen, die die DNA auf Grundlage der Arbeit ihrer Kollegin als Erste veröffentlichten und die Lorbeeren dafür einheimsten, das heißt internationale Anerkennung erhielten und mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Franklin bekam weder die Nobelpreisverleihung mit noch die Entdeckungen, die erst aufgrund ihrer eigenen Arbeit möglich wurden, denn sie starb mit 37Jahren an Eierstockkrebs, eine Krankheit, die sehr wahrscheinlich auf die radioaktive Strahlung zurückzuführen ist, der sie während der Jahre im Labor ausgesetzt war.
Das Patriarchat der Sprache ist, wie wir schimpfen, beleidigen, unterbrechen, aber auch wie wir zensieren und maßregeln, Zugang zu bestimmten Milieus regulieren und Status kommunizieren, und deswegen – bevor wir uns dem nächsten Thema widmen – sei noch erwähnt: Als Konsequenz aus den besprochenen Studien werden alle Frauen, die ich für dieses Buch interviewt habe, ungeachtet dessen, ob wir uns im Interview geduzt oder gesiezt haben und in welcher Funktion ich mit ihnen gesprochen habe, einmal mit Vor- und Nachnamen genannt und anschließend nur noch mit Nachnamen. Ehre, wem Ehre gebührt.XVIII
Kapitel 2
WEM GEHÖRT DER ÖFFENTLICHE RAUM?
Wenn es darum geht, wer im öffentlichen Raum mehr Platz einnimmt, sieht es in der Stadt unter den Pflanzen nicht viel anders aus als unter den Menschen. Die überwiegende Mehrheit der in den Städten gepflanzten Bäume sind Männer, stand in einer sehr lustigen taz-Kolumne.18 Männer? Ja, richtig – bei vielen Baumarten, den sogenannten zweihäusigen Bäumen, gibt es weibliche und männliche Pflanzen.I Und von letzteren gibt es einfach sehr viel mehr. Ob sich das Geschlechterverhältnis grob im Rahmen desselben von – sagen wir mal – Statuen und Denkmälern oder Straßennamen befindet, lässt sich leider nicht genau sagen. Dafür lässt sich aber der Grund für die männliche Dominanz benennen: Denn anders als die weiblichen Pflanzen, die Blüten und Früchte produzieren, die wiederum eventuell auf den Boden fallen, riechen und gammeln, Windschutzscheiben dicker Autos einsauen und einfach lästige Arbeit für die Straßenreinigung verursachen, sind die männlichen Bäume auf den ersten Blick pflegeleichter.II Ihre genetische Aufgabe ist es, einfach bloß Pollen herzustellen und diese dann zwecks Befruchtung in die Welt abzusondern.
Aber Moment mal … Pollen? Verursachen die nicht Allergien? Und wie! Was aus Faulheit begann, weil man sich um die »Nebenprodukte« der weiblichen Bäume hätte kümmern müssen, bezahlen nicht wenige von uns, mich eingeschlossen, mit einem sehr viel höheren Preis, nämlich mit Heuschnupfen. Hinzu kommt noch, dass die männlichen Bäume schlechter als die weiblichen darin sind, Schadstoffe aus der Luft aufzunehmen – neben der Optik und dem Schatten ja eigentlich der Hauptgrund für die Begrünung unserer Städte. Wie überall sonst auf der Welt verursacht ein Überschuss an Männlichkeit also Probleme, die etwas komplexer sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. Würde man bei der Bepflanzung von Städten auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis achten, gäbe es keine toxische Männlichkeit, da weibliche Pflanzen die Pollen aufnehmen und »unschädlich« machen, besser gesagt sie produktiv in Früchte übersetzen können. Inwieweit die Analogie jetzt noch übertragbar ist, sei mal dahingestellt.III Die Lösung ist aber für Pflanzen und Menschen gleich und naheliegend: eine Frauenquote.
Unser Umgang mit dem öffentlichen Raum ähnelt dem Umgang mit Sprache. Von klein auf lernen wir sprechen und erkunden gleichzeitig den Raum, in dem wir uns bewegen, mit einer Selbstverständlichkeit, die den meisten von uns angeboren ist. Die Dinge sind eben, und die Dinge heißen irgendwie. Raum ist, genau wie Sprache, ein soziales Konstrukt, an dem sich Marker wie Geschlecht, Hautfarbe, Gesellschaftsschicht ablesen, mehr noch, verewigen lassen. Die Architektur-Professorin Leslie Weisman erklärte schon vor 30Jahren in ihrem Buch Discrimination by Design, dass dies die Eigenschaften sind, die darüber entscheiden, wie wir den öffentlichen Raum wahrnehmen.19 Es ist also nicht nur eine persönliche Geschmacksfrage, ob die Parkanlage oder das Wohnhaus als schön, sicher und praktisch wahrgenommen wird, sondern im Kern auch die Frage, wer wir sind und wie viel gesellschaftliche Macht wir haben.
Dominante Kanten
Ich wohne in einem Innenstadtviertel, in einer kleinen Straße mit Mehrfamilienhäusern, Alt- und Neubauten gemischt – typisch für Köln. Die neueren Häuser haben alle eine Ausfahrt oder eine Garageneinfahrt, aber die Anzahl der Garagenplätze und Innenhofparkmöglichkeiten ist sehr viel niedriger als die Anzahl der Wohnungen. Grob geschätzt würde ich sagen, etwa fünf Prozent der Wohnungen in meiner Straße haben die Möglichkeit, ein Fahrzeug irgendwo anders als auf der Straße zu parken. 95Prozent haben das nicht, ist aber auch nicht so schlimm, denn viele besitzen, wie wir, gar kein Auto. Was ich aber vor nicht allzu langer Zeit hatte beziehungsweise vor mir hergeschoben habe, ist ein Kinderwagen, und deshalb weiß ich auch, wie ätzend Bordsteinkanten zum Beispiel an Kreuzungen sind. Bei meinem »Wir suffern ein bisschen for Fashion«-Retro-Modell aus den 1970er-Jahren war jeder Bordstein, jede Kreuzung, jede Straßenüberquerung eine Hürde, die bewusst genommen werden musste, wenn der schlafende Kinderkopf nicht unkontrolliert kullern sollte. Und warum? Weil in den meisten Orten Deutschlands und dem Rest der Welt Gehwege zwar für Autos abgesenkt werden, nicht aber für Fußgänger:innen. Dabei ist die Anzahl der Menschen, die von abgesenkten Bordsteinen profitieren würden, groß, denn neben Kinderwagen sind noch Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen, mit Geh- oder Sehbehinderung, kleine Kinder, die mit Roller oder Fahrrad auf dem Gehsteig unterwegs sind, von diesem unsinnigen Hürdenparcours betroffen. Was haben alle diese Menschen gemeinsam? Sie sind gewöhnlich nicht die typischen Entscheidungsträger.
Das Beispiel Bordsteinkante ist exemplarisch und nur eines von vielen Symptomen, die unsere autofixierten Städte so mit sich bringen, denn abgesenkt werden sie vielerorts nur dort, wo es den Autos etwas bringt. 62Prozent aller Fahrzeuge in Deutschland sind auf Männer zugelassen, sie fahren im Schnitt außerdem ungefähr doppelt so viele Kilometer pro Tag mit dem Auto (29Kilometer) wie Frauen, die auf 14Kilometer kommen.20 Auch wenn sich bezogen auf die Rollenverteilung einige Dinge geändert haben, so ist die Frage danach, wie und wann Männer und Frauen sich im öffentlichen Raum bewegen, historisch gewachsen und auf die Dualität in der heterosexuellen Kernfamilie zurückzuführen. Wir leben und bewegen uns heute in einer urbanen Struktur, die in Deutschland während des sogenannten Wirtschaftswunders in den 1950er- und 1960er-Jahren entstanden ist: Der Mann ist alleiniger Versorger, er geht morgens aus dem Haus, bewegt sich im öffentlichen Raum, verdient das Geld und entscheidet darüber, wie es ausgegeben wird. Sein Wohlbefinden, sein schnelles und bequemes Vorwärtskommen, sowohl im Straßenverkehr als auch im Leben, ist der Mittelpunkt jeder entstehenden Struktur. Währenddessen schmeißt die traditionelle Wirtschaftswunderfrau den Haushalt und kümmert sich um die Kinder – was bedeutet, dass sie den Großteil ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt. Dass auch die Hausfrau mal vor die Tür muss, um beispielsweise einkaufen zu gehen, war egal, denn ihr Wohlbefinden im öffentlichen Raum spielte wirtschaftlich keine Rolle. Die Soziologin Marie Gilow hat untersucht, wie diese »kleinen« täglichen Fahrten sich auf die heutigen Mütter auswirken, die zudem noch einer Erwerbsarbeit nachgehen. Sie kommt zu dem Schluss, dass diese weibliche Mobilität als anstrengende Arbeit gewertet werden muss, sowohl psychologisch als auch körperlich, mitsamt allen Risiken, die eine fordernde Arbeit für unsere Gesundheit hat.21 Lösungen wären beispielsweise: autofreie Innenstädte, breitere Gehwege, sodass Kinderwagen und Rollatoren und so weiter sich nicht wie Konkurrenten fühlen müssen, mehr Park- und Grünflächen, die auch im Winter und abends beleuchtet und belebt sind, mehr Sitzgelegenheiten zum Ausruhen und Freund:innen treffen und nicht zuletzt mehr Pinkelmöglichkeiten. Doch das kostet natürlich alles viel Geld. Wieder einmal reichen sich das Patriarchat und der Kapitalismus die Hand, im gegenseitigen Einvernehmen über ihr Ziel, nämlich die männliche Gewinnmaximierung.
Heute ist das weder zeitgemäß noch gut fürs Geschäft. Die Kölner Innenstadt ist ein Extrembeispiel; große, mehrspurige Autobahnzubringer verbinden für Autofahrer:innen kreuz und quer alle Himmelsrichtungen, während ein Großteil der Straßen im Stadtkern aus einer Zeit ohne Autos stammt. Was nach dem Zweiten Weltkrieg noch übrig war, wurde für den Autoverkehr umgebaut, was wiederum dazu geführt hat, dass heute alles ein einziges Einbahnstraßenlabyrinth ist, das für Radfahrer:innen eine Nahtoderfahrung nach der nächsten bereithält. Aber auch das Zufußgehen ist nicht ohne, da der Platz sehr begrenzt ist und größtenteils von Autos verstopft wird. Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren – alles hat sich der Herrschaft des Autos unterzuordnen.
Das ist nicht einfach so passiert, sondern war eine politische Entscheidung.
Das Beispiel der spanischen Stadt Pontevedra, die seit 20Jahren als größtenteils autofrei gilt, zeigt: Wenn Fußgänger:innen Priorität haben – metaphorisch wie praktisch, denn sie haben in Pontevedra grundsätzlich Vorfahrt –, dann führt dies nicht nur zu einer Belebung der Innenstadt, sondern auch dazu, dass Menschen mehr Zeit mit Bummeln verbringen und dementsprechend mehr Geld ausgeben. Parallel dazu verhinderte die Befreiung der Innenstadt von Autos auch ein Abwandern von Konsument:innen in große Supermärkte und Malls am Stadtrand.22
Unsere Umgebung spiegelt nicht nur alteingesessene Strukturen wider, sie erschafft diese Strukturen auch immer wieder neu, verewigt sie. Was daran liegt, dass wir Architektur als etwas begreifen, das für die Ewigkeit erschaffen wird.IV Erst seit relativ kurzer Zeit entwickelt sich ein kleines kollektives Bewusstsein dafür, dass die Gestaltung von öffentlichen Räumen eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden spielt und es sinnvoller ist, »draußen« als Variable zu betrachten. Als Variable, die sich wegbewegt von der cis männlichen Designnorm, in die allerdings nur sehr langsam Bewegung kommt. Denn die Zahl der Architektinnen, Bauingenieurinnen und Städteplanerinnen stieg in den vergangenen Jahrzehnten zwar stetig an, dennoch sind sie in vielen Ländern, auch in Deutschland, immer noch in der Unterzahl. Hinzu kommt, dass die Entscheidungsträger:innen zu häufig immer noch ausschließlich Entscheidungsträger sind.
Es gibt viele Möglichkeiten, den öffentlichen Raum für oder gegen bestimmte Bürger:innen zu gestalten. »Defensive Architecture« heißt das, und darunter fallen beispielsweise Platztrenner auf Bänken, die verhindern, dass Menschen dort liegen und schlafen können, Zäune, Spikes und Bolzen, die ebenfalls Schutz- und Schlafplätze unerreichbar machen. Armut und Obdachlosigkeit sollen mit dieser Praxis unsichtbar gemacht werden, für all diejenigen, die es nicht betrifft. Als Begründung wird meistens angeführt, dass es das Sicherheitsgefühl von Frauen wiederherstellen soll, die sich durch die Anwesenheit von obdachlosen Menschen gestört fühlen. Bloß welche Frau soll hier geschützt werden? Besonders hart trifft das nämlich obdachlose FrauenV, die zu den am meisten gefährdeten in unserer Gesellschaft gehören und aufgrund ihrer prekären Lage am häufigsten Gewalt in jeglicher Form ausgesetzt sind. Verdrängt man sie aus der Öffentlichkeit, drängt man sie gleichzeitig aus dem Blickfeld von potenziellen Helfer:innen.
Dominanz ist eben etwas, was sehr eng mit dem Raum verbunden ist. Denken wir nur einmal darüber nach, wie wir reagieren, wenn uns eine andere Person auf einem begrenzten Gehweg entgegenkommt – wer weicht aus? Die allermeisten Menschen denken nicht darüber nach, und viele Männer dominieren den Gehweg nicht bewusst, aber die Irritation in dem Moment, in dem sie verstanden, dass sie mir ausweichen müssen, ist köstlich. Ein anderes Beispiel ist natürlich Manspreading in öffentlichen Verkehrsmitteln. Breitbeinig in Bus und Bahn zu sitzen hat (in den allermeisten, nicht-pathologischen Fällen) nichts mit der Beschaffenheit von Penis und Hoden oder des männlichen Beckens und seinem Verhältnis zu den Schultern zu tunVI, sondern ist erlerntes männliches Verhalten, das ebenfalls auf Dominanz im öffentlichen Raum abzielt.
Wer pinkelt wo?
Als Geerte Piening, eine 21-jährige niederländische Studentin, im März 2015 mit Freund:innen ausging und sich gegen drei Uhr morgens auf den Weg nach Hause machte, da drückte ihre volle Blase. Der Wirt hatte die Toilette schon geputzt und setzte sie vor die Tür. Aber die knapp drei Kilometer mit voller Blase auf dem Fahrrad nach Hause zu fahren, schien Piening ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Sie und ihre Freund:innen entdeckten in der Nähe ein Plaskrul, eine Art Pinkel-Kreisel (ein Pissoir, das typisch für die Amsterdamer Innenstadt ist), und sie witzelten noch, ob Piening es mal ausprobieren sollte, stattdessen fand sie jedoch eine Ecke, die vor Blicken geschützt war, ließ die Hose herunter, hockte sich hin und ließ es laufen. Als ihre Freund:innen die Polizist:innen sahen, war es schon zu spät, Piening wurde beim Wildpinkeln »erwischt«.VII An diesem Abend ahnte Piening nicht, dass dieser Vorfall sie noch Jahre später beschäftigen und zu einer Galionsfigur der »Potty Parity«-Bewegung machen würde. Denn als Piening am nächsten Morgen aufwachte, da fiel ihr als Erstes das Knöllchen ein, und so öffnete sie ihr Laptop, um nach öffentlichen Toiletten zu suchen, die nachts zugänglich gewesen wären. Daraufhin entschied sie sich, das Bußgeld von 140Euro plus 9 Euro Bearbeitungsgebühr nicht zu bezahlen, sondern Widerspruch einzulegen. 2015 gab es allein in der Amsterdamer Innenstadt 35Plaskrul-Pissoirs und ganze zwei Sitzklos, von denen sich das nächste mehr als eineinhalb Kilometer von Pienings nächtlichem Standort entfernt befand. Die Situation in den gesamten Niederlanden sah nicht viel anders aus: Im selben Jahr gab es in den Niederlanden 565 öffentliche Toiletten, die auch nachts zugänglich waren, 204 davon allerdings Urinale.
Plaskrul, öffentliches Pissoir in Amsterdam
Eineinhalb Jahre nachdem Piening beim Wildpinkeln erwischt worden war, erhielt sie eine Vorladung in dieser Sache. Die Verhandlung dauerte nur etwa 20Minuten, dann kam der Richter zu seinem Urteil: Eines dieser Urinale, das Plaskrul, das Piening und ihre Freund:innen ebenfalls gesehen hatten, befand sich in einem Umkreis, den der Richter als zumutbare Distanz für eine volle Blase festlegte. Die Tatsache, dass keine einzige Toilette für Frauen in einem vergleichbaren Umkreis auffindbar war, interessierte dabei nicht. Weiterhin gab der Richter bekannt, dass er in seiner beruflichen Laufbahn noch nie auf eine Frau getroffen sei, die beim Wildpinkeln erwischt worden war, woraus er ableitete, dass es keine Notwendigkeit für mehr Frauentoiletten in der Öffentlichkeit gebe. Männer hingegen würden weitaus häufiger des Wildpinkelns überführt, was auf einen »erhöhten Bedarf an Urinalen in der Öffentlichkeit« schließen ließe. Weiterhin argumentierte er, dass es »zwar unbequem sein mag, Frauen jedoch die Urinale für Männer mitbenutzen« sollten. Das bedeutet: Wenn Männer nicht in eine Toilette, sondern irgendwohin urinieren, dann deshalb, weil wir es ihnen dort noch nicht bequem genug eingerichtet haben. Wildpinkeln für den Infrastrukturwandel, jeder Strahl ein Marker für ein fehlendes Urinal. Doch eine Frau, die exakt das Gleiche tut, ist an der ihr zugewiesenen Rollenerwartung, sich an die vorgegebene Infrastruktur anzupassen, gescheitert.
Diese Ansicht, so empörend sie vielen von uns heute erscheint, hat Tradition. Sie entspricht der ebenfalls lang gehegten Auffassung, dass wir Frauen, um den Anforderungen unseres Geschlechts zu entsprechen, die totale Kontrolle über unsere Körperfunktionen besitzen. Wenn’s juckt, wird nicht gekratzt. Wenn’s langweilig ist, wird nicht gegähnt. Und wenn’s drückt, wird nicht gepupst und eben auch nicht gepinkelt. Die anständige Frau weiß sich zu beherrschen. Die durch diese Beherrschung entstandene Macht ist zwar nur Selbstbeherrschung, aber immerhin ist dies eine weibliche Domäne. Natürlichen körperlichen Bedürfnissen – von Pupsen bis hin zu sexuellen Bedürfnissen – nachzukommen, ist bis heute für Frauen mit deutlich mehr Tabus behaftet als für Männer, eben weil wir so sozialisiert sind, dass Männer »gar nicht anders können«.VIII
Da der Fall in den Niederlanden auch schon vor der Urteilsverkündung eine große mediale Aufmerksamkeit erregt hatte und Dutzende Journalist:innen vor dem Gericht auf Piening warteten, dauerte es nicht lange, bis Tausende Menschen sich mit ihr solidarisierten. Frauen posteten unter dem Hashtag #zeikwijfIX Fotos, die sie beim Versuch zeigten, ein Urinal zu benutzen, und dabei wiederum einige Male gegen die Richtlinien der sozialen Plattformen verstießen, weshalb die Bilder gelöscht wurden. Denn eines hatte der Richter nicht auf dem Schirm: die weibliche Erfahrung. Jede Person mit Vulva, die schon einmal versucht hat, ein Urinal zu benutzen, weiß, es ist so gut wie unmöglich, dies zu tun, ohne sich a.) in der Öffentlichkeit zu entblößen und b.) sich selbst dabei anzupinkeln. Denn in dem oben erwähnten Plaskrul befindet sich in der Mitte der Mini-Labyrinth-Spirale ein Auffangtrichter, der so gut wie unerreichbar ist für den Urinstrahl, wenn er nicht aus einem Penis geschossen kommt. Zwar ist der Sichtschutz für die Rückseite besser, allerdings beginnt dieser erst ab Kniehöhe, sodass eine Person, sollte sie sich zum Pinkeln hinhocken, mit den Pobacken nach allen Seiten hin sichtbar wäre. Die Proteste erinnerten viele Niederländerinnen an die Aktionen der Dolle Minas (Wütende Minas), einer feministischen Gruppierung, die sich Ende der 1960er-Jahre formiert und eine ganze Reihe gesellschaftlicher Ziele formuliert hatte, unter anderem auch: mehr öffentliche Toiletten für Frauen. Schon damals fotografierten Aktivistinnen sich bei dem Versuch, in den Plaskrul zu pinkeln, und prangerten die Missstände der ungerechten Verteilung von Pinkelmöglichkeiten an. Zwischen den Protesten der Dolle Minas und dem von Piening liegen etwa 45Jahre, viel getan hat sich nicht.
Der Bau von Kanalisationen war im 18.Jahrhundert in den europäischen Großstädten ein prestigeträchtiges Projekt, das aufgrund von CholeraepidemienX und wegen des bestialischen Gestanks zwingend notwendig wurde – dennoch mussten die Entscheidungsträger von dieser Notwendigkeit erstmal überzeugt werden. Anders als zum Beispiel der Ausbau von Gasleitungen, der allen als vorteilhaft einleuchtete, weil dadurch mehr Straßen nachts beleuchtet werden konnten, war der kostspielige Ausbau einer unterirdischen Kanalisation oberirdisch nicht sichtbar. Um diese Umbaumaßnahmen dennoch sichtbar zu machen, und weil es in den allermeisten Wohnhäusern noch keine separaten Toiletten in jeder Wohnung gab, entstanden nun die ersten »modernen« öffentlichen Bedürfnisanstalten. Und die entstanden: für Männer. Denn wer sonst sollte im öffentlichen Leben eine so wichtige Rolle spielen, dass derart teure Hightech-Installationen angemessen wären? Natürlich gab es im öffentlichen Raum immer auch Frauen, aber diejenigen, die große Teile ihres Tages an der frischen Luft verbrachten, waren Mägde, Marktfrauen, Kindermädchen – Frauen niederen Standes, deren Wohlergehen, Gesundheit und Sicherheit nicht auf der Agenda der Stadtplaner standen. Für die Ehefrauen und Töchter der wichtigen Männer geziemte es sich nicht, sich länger als für die Distanz von A nach B in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Und mit Öffentlichkeit ist übrigens nicht bloß die Straße gemeint, sondern alles, was sich außerhalb der eigenen vier Wände abspielte. Aus diesem Grund ist die Thematik des Zugangs zu einer öffentlichen Toilette – neben der Menschenrechtsthematik – auch die grundsätzliche Frage danach, wem der öffentliche Raum gehört.XI
Während der fortschreitenden Industrialisierung im 19.Jahrhundert, als das Potenzial der Arbeitskraft von Frauen erkannt wurde und Fabriken Arbeiterinnen brauchten, veränderte sich etwas. Bis jetzt waren die weiblichen Arbeitsplätze auf Haus, Hof und Markt beschränkt, die Fabrik war hingegen ein Ort, an dem Arbeiter:innen sehr lange Zeit am selben Fleck standen. Auf einmal galt es, die Arbeitszeit vor Ort zu optimieren, und das hieß, nicht nur ausreichend Toiletten zur Verfügung zu stellen, sondern den Gang dorthin auch so kurz wie möglich zu gestalten. In den USA





























