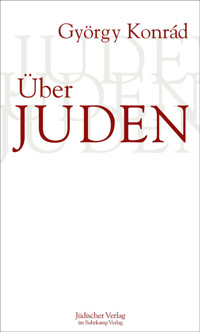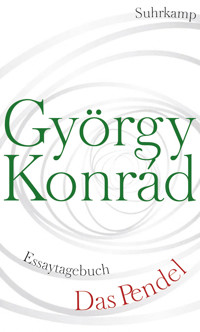
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Den vorangegangenen Götzen haben wir gestürzt, und gekommen ist die Chimäre des Fanatismus.« Mit präziser Imagination und analytischer Skepsis blickt György Konrád, Dichter und Chronist, auf die Gegenwart. Im Licht der todbringenden Erlebnisse seiner Kindheit, der blutig gescheiterten ungarischen Revolution von 1956 und der bleiernen Zeit danach erscheinen auch der Umbruch von 1989 als Scheinsieg und die aufbrechenden Energien im rechten politischen Spektrum seines Landes als Menetekel einer sich wiederholenden Vergangenheit. Erneut scheint es keinen Fortschritt zu geben und bei der Teilung in Mächtige und Ohnmächtige bleiben zu müssen. Das Personal der Geschichte wechselt, aber hinter gewendeten Masken brodelt der Haß, machen sich die immergleichen alten Kräfte, Despoten und Helfershelfer, bemerkbar. Ein zeitdiagnostisches und ein Warnbuch also und doch auch ein Buch der Courage und der Glückserfahrung, voller Hoffnung, daß der Einzelne im Strom des »Unaufhörlichen« sich wird behaupten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
György Konrád
Das Pendel
Essaytagebuch
Aus dem Ungarischen von
Hans-Henning Paetzke
Suhrkamp Verlag
Originaltitel: Inga. Pendulum
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© György Konrád, 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-75480-1
www.suhrkamp.de
Ich werde beobachtet. Allein im Garten. Das vergesse ich nicht. Auch auf dem Podium, selbst wenn ich mich dort verstecke.
Von der Akazienholzbank aus immer nur den Berg betrachten, an die Steinmauer gelehnt, immer nur im Freien mit Heft und Feder bewaffnet. Nie endgültig sein, immer nur im Zustand von Anfang und Geburt, umgeben vom Säuseln des Windes, frei von der Sorge um die Verantwortung für das Buch und die Speicherung der Vergangenheit. Boden unter den Füßen spüren, das Sonnenlicht ertragen, nichts mehr besitzen, das Haus hinter mir lassen, ihm entfliehen.
Noch herrscht hier Frieden. Kein Grund zum Klagen darüber, daß es dereinst keinen mehr geben wird. Solange ich nicht abgeholt werde, kann ich getrost am Tisch im Garten sitzen. Vielleicht kommt auch niemand mehr. Was zählt, ist die Bank und nicht die Tatsache, daß man hereinkommen kann. Sogar Pech und Schwefel kann es regnen. Verharren will ich im Bestreben um ein geräuschloses Dasein. Unauffällig bleiben, wie es mir nur irgend möglich ist.
Durch das Fenster sehe ich einen Hubschrauber. Während ich dies niederschreibe, verschwindet er, fliegt vom Fenster aus herüber in mein Bewußtsein. Die Wirklichkeit ist nur gewesen. Das Ereignis, hat es einen Zeugen gegeben, verwandelt sich während des Geschehens in ein Erinnerungsbild. Wirklichkeit ist Geschehen, Konfiguration, und existiert nur für einen Moment. Wo ist das Gestern geblieben? Gestohlen worden.
Worauf ich warte? Auf den Sinn meines Lebens. Soll er doch zur Gartenpforte eintreten, den Hut ziehen und grüßen: »Verehrter Herr, ich bin der Sinn Ihres Lebens.«
Mit welchem Recht erhebe ich Anspruch darauf, zu bleiben? Eine Antwort gibt es nicht. Wir müssen gehen, für die nach uns Kommenden Platz machen.
Ich brauche jemanden, an dem ich meine Freude habe, um den ich mich kümmere, für den ich arbeite, an etwas, was dann auch er an jemanden weitergeben wird. Meine Frau auf der anderen Seite der Wand weiß auch ohne Worte, wie es um mich bestellt ist. Ein großes Glück, wenn sowohl Ehefrau als auch Ehemann so geschäftig sind.
Daß sie mich früher oder später hinausbringen werden, ahne ich schon. Noch klammere ich mich am Treppengeländer fest und versuche, um jeden Preis zu bleiben. Gibt es eine Rechtfertigung für mein Leben? Einzig die, daß es geschehen ist. Ob ich mich mit seiner Fortsetzung zufriedengebe? Diese Möglichkeit begeistert mich.
Auf meine Weise habe ich ziemlich höflich erledigt, was zu erledigen war. Ich jammere nicht, ich hasse nicht, ich prahle nicht. Schön langsam habe ich mich aus dem Verkehr gezogen und mache mir an meinen Erinnerungen zu schaffen. Doch ob mir tatsächlich widerfahren ist, was ich vergessen habe? Und wenn ich einige Bilder aus der Dunkelheit heraufbeschwöre? Im Kopf gesammelt habe ich viele Bilder, sie dort so roh belassen, vielleicht hole ich sie einmal hervor. Oder niemals.
Existiert zwischen Wirklichkeit und Fiktion noch etwas anderes? Vielleicht das Pendel. Das Hin und Her, das Sich-Zulachen. Auf wessen Ankunft ich hoffe? Bei meinem Tändeln bedarf es sozusagen keinerlei äußerer Veränderung. Von anderen verlange ich nichts, nicht einmal, mir ihnen gegenüber recht geben zu können.
Träger bin ich, Kettenglied, Postbote, die Wörter gehen durch mich hindurch. Ich bearbeite das schamlose Rohmaterial, verdichte und lege es anderen dann vor. Wort für Wort taste ich meinen Nachlaß ab, stelle mich auf den Kopf. Der Verstand soll ruhig arbeiten, durch nichts darf der Gang der Gedanken behindert werden.
Bequem ist für mich sogar die unbequeme Situation. Auch kalt ist nicht kalt, auch warm ist nicht warm. Ob einer friert oder schwitzt, ist nicht unbedingt eine Frage der Temperatur, vielmehr eine der Selbstdisziplin. Mir geht es in einem Saal ebensogut wie in einer Kammer. Ich muß nicht fortwährend angesprochen werden. Wer sich nicht gern in seiner Werkstatt zu schaffen macht, der schindet andere.
Die erste Person Singular soll sich selbst erkennen? Dieses Ich erwische ich, bekomme es am Genick zu packen, da kann es zappeln, wie es will, ich blicke hinein, nehme es auseinander. Was befindet sich im Innersten? Ein substantivisches Lichtei? Oder nur die Unerschöpflichkeit der Wiederholung? Oder sollten wir trotz allem zum Tor der Sklerose ins Nichts hinüberschreiten? Der gerissene Händler bietet eine Katharsis an, eine Konzentration aus Freude und Qual. Wofür er sich ein wenig Geld erhofft. Jeder Satz, jeder Absatz eine Einheit, alles muß über eigenen Mitteilungswert verfügen. Auch die Teile selbständige, geordnete Stöße.
Wieviel Geschichte kann sich selbst in einer einzigen Wohnung abspielen! Auch jene eine Wohnung, die mit einem Roman zu vergleichen wäre, hat so viele Helden, wie es Bewohner darin gibt.
Ich sehe einen farbenprächtigen Blumengarten, die barocke Phantasie einer alten Frau, ihr gegenüber einen alten Herrn mit seinen eher latinischen, quadratisch angelegten Beeten. Der vertrottelte Pedant, sagt die in die Jahre gekommene Frau von ihrem Nachbarn. Ein alter Katatoniker, erinnert sich nur an den Nußbaum und an das kleine Kalb aus seiner Kindheit.
Du findest Steinnymphen und Wasserbecken, moosbewachsene Säulen und immer etwas Übertriebenes, verdreifachte Torbögen und Türme, auch hier sollte noch etwas hin, und dort sollten wir uns zusätzlich etwas vorstellen können. Was den Baumeistern an Närrischem in den Sinn gekommen ist, das konnten sie, ärmlich zwar, aber dennoch, umsetzen.
Vier schwarze Tauben mit weißem Bauch flattern vor mir in wechselnden Formationen umher. Auf einen Stock gestützt nähert sich mir der neunzigjährige Herr Nachbar, sein Spazierkreis wird zusehends kleiner. Anderthalb Stunden muß dieser Spaziergang dauern, alles wird nach der Uhr verrichtet. Pärchen mittleren Alters in einem Gartenlokal tunken den Teller mit Brot aus. In den Cafés ist die Umgebung komprimiert; die Spannung zwischen außen und innen ist im Gleichgewicht.
Auf dem Tennisplatz wimmelt es nachmittags von Kindern, sie springen umher, üben Aufschläge, schlagen geschickt zurück, die Mamas lesen im Auto oder plaudern an der Straßenecke. Ein Mädchen mit langen Beinen, den Tennisschläger in der Hand, stützt sich auf ein Fahrrad.
Ich sehe ein Haus und erinnere mich an meine Vergangenheit. Könnte ich darin umherwandeln, würde ich an Amnesie leiden. Jeder Spaziergang ist willkürlich, zufällig und für sich genommen vollkommen. Jedes Haus hat ein Gesicht und sagt viel über die darin Wohnenden. An den Fassaden Löwen, Engel, die dicken Mauern bergen den Überfluß des neunzehnten Jahrhunderts. Hier ist jedermann auf seine Weise unanständig oder anständig. Der nächtliche Tau liegt morgens noch auf dem Gras. Auch die Sonne wirft ihr Licht nur seitwärts auf die Natursteinmauern des Nachbarhauses. Gibt es ein Selbstbewußtsein ohne Lokalbewußtsein?
Schön warm ist es hier, nun können die Enthüllungsschriften kommen, die Schmähreden, und sie können mich mit vorwurfsvollen Fragen überhäufen: »Hast du gesagt, ich sei ein kleiner Idiot?« »Weiß der Teufel. Kann sein.«
Dann kommen die Gütigen: »Möchtest du gar nichts? Keine Rache? Niemandes Tod?« »Du bist nett, aber nein danke.« »Und die alten Spezis?« »Sind alle schon gestorben.« »Und wer noch nicht?« »Dem wünsche ich das Beste.«
Reliquien sind wir, Veteranen, Datenquellen. Was wir erzählen, ist mit Vorsicht zu genießen. Allesamt Zeitzeugen, die wir vor einem halben Jahrhundert noch über die Margaretenbrücke schlenderten, am Nachmittag des 23.Oktober 1956, in der Zeit des goldenen Herbstes, als es bei Tagesanbruch schon kühl war und in der Nacht vielleicht sogar schon Frost herrschte; tagsüber aber mußte man den Mantel ausziehen. Jene Generation ist im Schwinden begriffen, und präzises Erinnern ist so selten wie das Aufflackern eines Streichholzes in der Dunkelheit. Sogar mich selbst kenne ich kaum, die anderen noch weniger. Ich urteile nicht, verteidige mich höchstens. Dies steht uns zu, diese persönliche Einsamkeit im Universum. Der Glaube daran, Teil des Ganzen zu sein, zeugt von Stolz und Demut zugleich. Jedes Ereignis hat einen Sinn, alles richtet sich nach einem Plan. Bauen bis ans Ende, der Plan verändert sich Minute für Minute, zwischendurch Bröckeln, Plagen, Einstürzen, Schwund.
Bis unter die Arme in der Vergangenheit begraben, greife ich nach den Visionen der Zukunft oder ziehe meinen Kopf vor ihnen ein. Vor allem Vogelstimmen und Hundegebell dringen im Garten an mein Ohr, nur das Gesumm von fernen Automotoren und das zu vernachlässigende Dröhnen am Himmel vorüberziehender Maschinen sind zu vernehmen. Der Hahn kräht auch am späten Vormittag, selbst die kleinen Enten haben etwas zu schnattern. Niedrig fliegen die Schwalben.
Schon seit langem bemerke ich, daß auch das wenige viel sein kann. Der frisch gewaschene Spitzenvorhang flattert im Wind auf der Leine. Den Garten kann ich auch nach hinten verlassen, nicht nur nach vorn zur Straße hin, zwischen Sträuchern hinein ins Maisfeld flüchten, das mir Deckung gibt. Vorn kommen die Besucher herein, doch der listige Einsiedler geht hinten hinaus.
Mit einem Sprung ins Ungewisse könnte hier ein neues Kapitel beginnen. Ich habe keinen blassen Schimmer, worauf es hinauslaufen wird. Voller Ahnungen treibt es mein Bewußtsein hierhin und dorthin: in die Große Markthalle, auf den Lokomotivenfriedhof, in mein Heimatdorf. Eingebettet in diesen geographischen Raum, huschen meine Gedanken gelegentlich über die Staatsgrenzen hinweg.
Eine sich selbst gestaltende Geschichte, eine Prozedur, die sich zum Kochbuch erklärt. Zahlreiche Gerichte lassen sich zubereiten. Auch das Leben des geneigten Lesers könnte Gegenstand verblüffend vieler Romane sein.
Als Gefängnisinsasse beispielsweise könnten wir uns, um die Langeweile zu vertreiben, mit solchen Gedanken ein Amüsement verschaffen. Unter Millionen Ereignissen befinden wir einige wenige für wert, beschrieben zu werden. Auch das Fallen eines Wassertropfens kann durch mikroskopisches Beobachten endlos lange ausgedehnt werden.
Das Kunstwerk ist ein organisierter Traum. Nicht die Reihe der vielen Buchstaben, sondern die ihnen zugrunde liegende Serie an Ereignissen. Der Gedanke stellt sich ein wie eine Offenbarung, die Ideen begegnen ihrem Körper. Das echte Werk hinterläßt einen unvergeßlichen Eindruck. Der Künstler gibt dir ein Rätsel auf, das du lange betrachten kannst. Das Werk gleicht einem Gesicht, es blickt zurück, sieht dich an, sucht dich, und du versteckst dich vor ihm.
Eine Stimme dringt an dein Ohr, und du erschauderst. Schreiben bedeutet für dich Selbstverteidigung, Abtasten, Beschwörung, Halluzination. Essay: Klingenkreuzen! Roman: Also mit einem Wort, so war das … Lebt ein Roman, dann funktioniert er, reift wie der Wein im Faß. Wir bauen, kombinieren, die Aneinanderreihung ist die Form selbst. Der Schriftsteller hat keine Ahnung, was als nächstes folgen wird. Dann taucht etwas auf, und niemand weiß, warum ausgerechnet dies. Aber vielleicht ist es gerade so gut; Willkür bringt das Phänomen hervor. Das wahre Phänomen ist eine nicht zu knackende Nuß, du kannst so fest zudrücken, wie du willst, sie läßt sich nicht zerquetschen.
Ich suche nach der Wahrheit für mein eigenes Leben und nach einer Antwort auf die Frage, was mich hier umgibt. Diese Frage stelle ich selbst dann, wenn jede Antwort auf die eine oder andere Pleite hinausläuft. Doch gibt sich Handeln nicht eben im Fiasko zu erkennen?
Begeben wir uns nachmittags gegen fünf Uhr in ein Café. Um diese Zeit treffen sich hier Leute, die schon getan haben, was zu tun war, die ihren Schreibtisch hinter sich gelassen, etwas getrunken und geschmaucht haben, wovon die weiße Tapete an der Wand in farbenfrohes Zwielicht getaucht wurde.
Jawohl, noch schreibe ich, bin schon zum dritten Mal verheiratet. Seit dreißig Jahren. Auch Kinder habe ich, fünf insgesamt, schön sind sie und vortrefflich.
Was mit Budapest los ist? Ein Regime ist an der Macht, das einem die Laune verdirbt, und das Volk gibt sich neunmalklug, läßt sich indes an der Nase herumführen.
Nebenbei bemerkt lebt der Mensch in Straßen und Häusern, nicht im Regime. Die Titelhelden trifft er selten. Den ihretwegen empfundenen Verdruß muß er nicht unbedingt übertreiben. Dort, wo ich gerade bin, geht es mir ziemlich gut. Fernweh quält mich keines. Ich bilde mir ein, etwas klarer zu sehen als in meiner Jugend. Wenn nichts dazwischenkommt, werde ich bis zum Augenblick meines Todes in der lernenden Arbeit am Schmerz lobenswerte Fortschritte erzielen.
Dieses schon nicht mehr ganz junge Subjekt genießt in einem Haus mit Garten die zeitlose Wiederholung sowie eine Stille leiser als Stille. Gegen Abend allerdings kommen fast immer Gäste. Auch meine Knie spüren Beruhigung. Unter zahlreichen Kinderpopos haben sie das Ihre getan, sind auf und ab gehüpft, haben hüpfen lassen, hoppe, hoppe Reiter, ein ganzes Gestüt für das Pferdchenspiel aufmarschieren lassen.
Das Ich ist lediglich eine Form der Konjugation. Indem ich es ausspreche, stellen sich weitere Fragen. Wer und was ist es, und woher weiß ich, was es ist? Würde ich dieses Ich mit meinem Eigennamen ausstatten und es an einen beliebigen Schauplatz einer früheren Lebensperiode stellen, wäre es nicht einfach hineinzuschlüpfen. Ich müßte mich dafür abplagen, würde in mein damaliges Selbst nur stockend und mühsam hineinfinden. Wie in einen Taucheranzug, wie in einen Overall, wie in einen von Spinnweben überzogenen Schrank, wie in ein vergessenes Aktenbündel, wie in eine verlassene Werkzeugkammer. Hier ist der Schlüssel, du kannst die Schubladen herausziehen. Was bekomme ich in die Hand? Alte Fotografien, Gesichter, Namen, Ausweise, Adressenlisten, Telefonverzeichnisse. Und davor graut es mich.
Autos halten vor unserem Haus, zerren mich aus meinem Bau hervor, von Zeit zu Zeit findet sich dieser Höhlenbewohner auf dem Laufband von Flughäfen wieder. Von früh bis spät sitze ich in einer Geisterbahn, besuche ehemalige Klassenkameraden auf fernen Kontinenten. Die Erkenntnis, daß X immer noch ein genauso liebenswertes Rindvieh ist wie seit eh und je, beruhigt mich. Übernachtet habe ich in vielen Zimmern, und nach ihrem Verlassen genoß ich es, daß sie sich von meinem Körper ablösten. An die Ordnung der Dinge und die zweckmäßigen Bewegungen in den fremden Räumen, um mich nicht am Tisch oder der Schrankecke zu stoßen, hatte ich mich bereits gewöhnt. Allerdings ereilen mich seit neuestem mehr Unfälle als früher. Im Schlaf falle ich aus dem Bett oder schlage bei ungewolltem Einnicken mit dem Kopf auf der Tischkante auf. Am Besteigen der Straßenbahn und am Überqueren der Brücke hat sich seit meiner Schulzeit nichts geändert. Im Alter begreife ich die Freude am bloßen Dasein, am Atmen beispielsweise. Zwischen Kühen und hohen Pappeln laufe ich über die große Wiese, durch verwelkte Gräser. Am Bachufer fliegt plötzlich ein Fasanenschwarm empor. Wild tost der Sturm zwischen den Zweigen. Auf dem niedergetretenen feuchten Gras markieren zwei Spuren den Fußpfad. Gegenüber die Burgruine, umgestürzte Holzpflöcke und daran befestigt schadhaftes Stacheldrahtgeflecht. Nur Wildenten höre ich, sonst nichts. Ich blicke zurück zum Dorf, sehe einzig das verblassende Kirchenkreuz und die in die Höhe ragenden Bäume. Gelegentlich vernehme ich aus dem Rabenhotel Gekrächze, stolpere zwischen weißen Feldblumen in tiefe Radspuren; allmählich erwachen meine Lebensgeister.
Rücklings liege ich auf der Wiese, vor mir das große Himmelsgefäß. Im Stehen lasse ich meine Blicke schweifen, nehme die Landschaft in Besitz. Wenn ich liege, lasten Himmel und Sterne auf mir, das ganze Universum. Auch auf weichem Grund kann man laufen, selbst auf der frischen Mahd. Doch angenehmer ist die Elastizität ausgetretener Pfade, dort, wo die Schritte den Boden fester gestampft haben.
Das Laufen hat keinen anderen Sinn als sich selbst. Für den Fußgänger gibt es keine natürlichere Lebensbetätigung als einzig das Vorankommen im Raum, weg von zu Hause nach irgendwohin, dann wieder zurück. Das ist alles.
Noch gibt es große Felder, auf denen ich niemandem begegne, noch gibt es verschwiegene Bäume und neugierige Rabenschwärme, noch kann man kraftvoll in die Weite spucken.
Viel bin ich in der Welt umhergezogen, gern saß ich auf Ochsenkarren und in Flugzeugen, meistens aber blieb ich an Ort und Stelle, reglos selbst auf einem sich bewegenden Gefährt. Ich hocke in meiner Höhle. Mein Schatz besteht darin, nicht angeredet werden zu können. In den Augen dessen, der das ständige Gespräch für menschenfreundlich hält, ein schrecklicher Egoismus.
Allmorgendlich in der Badewanne überblicke ich Gründe dafür, den Tag beginnen zu lassen, und während des Abtrocknens finde ich Argumente gegen den Tod. Dafür bedarf es eines groben Frottétuches. Daß der Widder, der Initiator, seinen Rundgang bei der Sonne und zwischen den Sternzeichen beginnt, ist klar, solange sich der Skorpion, mein anderes Wesen, nicht von hinten in mir verkrallt.
Ein anständiger Mensch ist immer ein Held. Manchmal fällt das auf, meist allerdings nicht. Wären etwa die mit Maschinenpistolen bewaffneten jungen Leute überall auf der Welt Helden? Weil sie ihre Waffe mit ins Bett nehmen, als wären sie Gangster oder Terroristen oder deren Verfolger? Diesen und jenen einfach nur so abknallen, das wäre Heldentum? Einen Kopfschuß verpaßt bekommen, der Kugel treu, patriotisch und gläubig entgegenlaufen? Das wäre Heldentum? Sich hinrichten lassen, nachdem wir unser eigenes Massengrab ausgehoben haben? Das wäre Heldentum? Sich köpfen lassen, zum Märtyrer werden, das wäre Heldentum? So sähe ein Held aus?
Warum wohl gehe ich dorthin, von wo es besser wäre zu verschwinden? Warum wohl gefällt es mir, ein Zimmer langsamer oder schneller zu verlassen, wie es mir auch angenehm ist, aus manch einer Scheide mit erschlaffender und zusammenschrumpfender Lunte zu gleiten? So wie es ebenfalls angenehm war, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Professoren- oder Forschungsbüro das Licht auszuschalten und die Tür hinter mir zu schließen.
Viele Länder gibt es auf der Welt, in denen rätselhaft in ihrem Wachhäuschen herumhantierende Grenzbeamte lange trödeln, längst schon alles notiert und kontrolliert und festgestellt haben, daß mein Name sogar auf mehreren Listen vermerkt worden ist, weil mich die Neugier zu etwas verleitet hat, ich mich darin verstrickt habe, so daß ich jetzt zur Seite gewinkt werde, denn als auf dem Bildschirm oder im schwarzen Buch mein Name vor den Augen des Grenzoffiziers erscheint, strafft sich sein Gesicht in einer einzigen Erstarrung. Das ist nun die Situation, auf die er hinter halb geschlossenen Augenlidern gewartet hat, und von dem Moment an befindet er sich im Einsatz. Jetzt muß er zeigen, was er kann. Rascheln im Dickicht, und unter dem Hochsitz tauchen auf der Lichtung das Wildschwein oder der Hirschbock auf. So stehe ich mit einem flüchtigen Lächeln auf den Lippen vor dem Fenster des Paßkontrolleurs.
Auf Flughäfen, deren Toiletten und Rohre schmutzig und verrostet sind, deren Wände sich verfärbt haben, wo sich Fußgeruch und der Duft erbärmlicher Waschmittel mit dem nach Knoblauch stinkenden Atem des sich nur nachlässiger Körperpflege unterziehenden Personals vermischen, wo also die bewaffneten Organe durchaus präsent sind und eine gemeinsame Mischung aus unordentlicher Unbekümmertheit und ängstlichen Befürchtungen bilden, dort wurde ich aus dem Strom der Fluggäste herausgefischt, in eine enge Kabine gebeten und aufgefordert, alle meine Kleidungsstücke abzulegen, damit meine Sachen einzeln durchsucht werden könnten. Nach Möglichkeit sollte ich dies schnell und bereitwillig tun, schließlich läge es in meinem ureigenen Interesse, das Reiseziel gemäß meinem Flugticket zu erreichen. In jede Tube und jeden Schuh sahen sie hinein. Doch schließlich erteilte der Geheimdienstchef mir die Erlaubnis, mich zu entfernen. Letztlich wäre es nicht zweifelsfrei gut gewesen, mich zurückzuhalten. Unerwünschte Komplikationen hätten sich ergeben können. Übrigens ist es meiner verdächtigen Person gelungen, das an die entsprechende Adresse gelangen zu lassen, was ich ihr hatte zuspielen wollen, was mir wichtig war, um es dann wieder an mich zu nehmen und die Arbeit daran fortzusetzen. Immer wieder schafften wir es, die Texte in verschiedener physischer Form in Bewegung zu setzen. Manchmal bissen die Kontrollen an den ausgelegten Ködern an und übersahen das Wesentliche. Um gewitzter zu sein als wir, hätten sie früher aufstehen müssen.
Ein Alter gibt dem Pferd nur selten die Sporen zu kosten, wenn aber doch, dann johlt und jauchzt er: Geschwind, mein kleiner Teufel! Mittagessen am Seeufer in einem vielbesuchten und in gutem Ruf stehenden Gasthaus. Das junge Personal hübsch und höflich, der alte Wirt spielt das mit mancherlei Gebrumm einhergehende Schauspiel der Weinwahl. Nach dem Kaffeegenuß schreckt mich zunehmendes und von Gedämpftheit in Rasen übergehendes Getöse auf. Geschrei unter meinem Fenster. Sich wie toll gebärdende Kerle stürmen säbelrasselnd die Treppen empor und reißen die Türen auf. Da ist es ratsam, zuvor zum Hinterausgang zu verduften und sich in der Menge zu verlieren.
Meine freundliche Visage schießt komplizenhafte Strahlen in die klobigen Gesichter martialischer Waffenträger. Kumpel, da entlang, sagen sie, oder klettere hier heraus. Ich sehe nichts. Natürlich kann sich auch ein Kunstfehler einschleichen. Dann verrottet man vorübergehend hinter Gittern und schützt sein Leben gegen niederträchtige Schufte.
Nein, ich möchte wirklich keinen Radau machen, mag weder Revolutionen noch Feuersbrünste, weder Erdbeben noch Familienzwist, noch Ehezerrüttung. Nach dem Unglück muß man nicht suchen. Ich bin abergläubisch, das normale Unheil reicht auch schon aus: die Verdummung, die kleinen körperlichen Gebrechen, die gebrochene Hand, die Gleichgewichtsstörungen und die Schwäche meiner neunzigjährigen Mutter, der tödliche Autounfall eines Kindes aus der Verwandtschaft, der Tod guter Bekannter.
Der dreiundneunzigjährige Onkel Marci wird im Krankenhaus auf den Steinfußboden gelegt; zwei Tage bringt der Bewußtlose dort zu, während er nach meiner Mutter ruft. Der Neffe, ein reicher Mann, Chefarzt im selben Krankenhaus, in dem der Onkel auf dem Flur liegt, geht hinauf in die Wohnung, durchstöbert die Schränke, Onkel Marci muß doch ein Sparbuch besitzen; er ist beunruhigt, daß am Ende nichts werden könnte aus dem erhofften Erbe. Mein nächtliches Aufschrecken verdient, erwähnt zu werden. Manchmal entsetzt mich der Gedanke, plötzlich nicht mehr atmen zu können. Bei solchen Gelegenheiten muß ich ein starkes Getränk zu mir nehmen und hinaus auf den Balkon treten, um mit dem Blick eines Hirten die flirrenden Lichter des Gebirgskamms in Augenschein zu nehmen. Aufmerksam begleite ich den trottenden Gang eines einsamen Mannes dort unten. Meinen Besuchern gegenüber gebe ich mich interessiert, brabbele etwas, kämpfe gegen das bleierne Gewicht meiner Augenlider an, nach einem halben Liter Wein indes überwältigt mich märchenhafter Zorn.
Noch möchte ich mich nicht davontrollen, doch schon macht die Schwächung des Geistes stille Fortschritte. Angenehm, durch das dichte Gras des Gartens in Hegymagas zu gehen. Mit Wohlgefallen betrachte ich die Hauswurze am Zaun. Nachts hat es ergiebig geregnet, die große Tannenkrone wiegt sich im Nordwind. Die kleinen Bäume genießen die verregneten Nächte, saugen sich mit Feuchtigkeit und Biegsamkeit voll, üppige, finstere Schädel unter dem dunklen Himmel. Nach einem langen und tiefen Atemzug röten sich am Sonnabend die weißgetünchten Wände.
Wie sieht einer aus, der den Zeitgenossen gefällt oder eben nicht gefällt? Nimmt der Militär den ersten Platz ein, tut dies auch das Töten. Der Zivilist dagegen ist lächerlich. Gibt es einen Feind, dann ist er überall zu finden, auch im Inneren. Also muß das Land von ihm gesäubert werden. Der Glorienschein von Militär und Heldentoten ist in Europa verblaßt. Nicht die Geheimpolizei vergreift sich jetzt an den Gedanken der Bürger, sondern die als Modewelle über uns hereinbrechende Oberflächlichkeit.
Heroismus? Besser nur der gute Geschmack. Der Beobachtende verbreitet die Praxis des Verstehens und betrachtet Handeln nicht als Selbstzweck. Im zwanzigsten Jahrhundert behauptete sich die romantische Vermutung vom Sieg des Zügellosen und Barbarischen: daß gut sei, was unterliege, und daß der Instinkt den Verstand bestimme. Die Gebildeten schämten sich vor den Ungebildeten, als wären diese moralisch etwas Besonderes. Dann stellte sich heraus, daß es nicht an dem ist und der Zivilisiertere auf längere Sicht den Sieg davonträgt. Unter den von Begabung und Klarblick zeugenden Werken ist der angenehme Zeitvertreib beachtenswert. Und zusehends verdient es auch die Kunst der inneren Einstellung, gewürdigt zu werden.
Meine Frau schläft im Zimmer nebenan, meine kleineren und größeren Kinder jedes in seinem Zimmer oder seiner Wohnung. Nachts um zwei erhebe ich mich von der Schreibmaschine, gehe hinaus auf die verschneite Terrasse, schmauche eine Pfeife, trinke Tee. In jener törichten alten Ordnung habe ich das gleiche getan wie jetzt. Mit dem Wandel der Regime muß nicht zwangsläufig ein Wandel meiner Gewohnheiten und Passionen einhergehen.
Unter dunklen Wolken arbeite ich bei starkem Wind, ergötze mich an dem im Nachbargarten zwischen Apfelbäumen und Brennesseln verfallenden Natursteinschuppen, an dem zwischen sich loslösenden Steinen Staub aufwirbelnden Lehm und dem durchgebogenen Sturzbalken. Ich grüße die gurrend einherstolzierenden Tauben und tätschele den Wulst an der Rinde der alten Bäume.
Junge Mädchen in interessanten Blusen, hellrosafarbene und rötlichbraune Blumen, umringen eine ältere Dame in rotem Morgenrock mit schneeweißem Pudel. Am Zaun versucht ein Neufundländer, seinen Kopf hindurchzuzwängen. Gepflegt sind die Gärten gerade so, daß ihre Vernachlässigung nicht ins Auge springt.
Liebe Leser, noch befinden wir uns in der alten Ordnung, in der weichgewordenen Diktatur. Dieser Zusammenschluß von Eifer und Nachlässigkeit ist ein kostbarer historischer Augenblick. Zwei Kinder tanzen mit einem Ball um uns herum. Der alte Wissenschaftler schlurft auf dem langen Balkon hin und her. Manchmal setzt er sich, um zu verschnaufen. Kurz darauf erhebt er sich wieder und spaziert, auf seinen Stock gestützt, erneut auf und ab. Das ist es, was ihm mit über neunzig an Bewegung bleibt. Fremde kennenzulernen, danach verspürt er keine Sehnsucht mehr.
In meiner Kindheit nisteten im Hohlraum des basteiartigen Giebels auf dem Dach der Synagoge neben unserem Haus Störche. Die Storchenhochzeit, deren auf der Terrasse sitzender, aufmerksamer Beobachter ich gewesen war, hatte schon stattgefunden. Aufschlußreich, wie sich das Storchenmännchen auf den Rücken des Weibchens stellte und, ohne sich in die Lüfte zu erheben, flügelschlagend triumphierte, während es wie aus der Maschinenpistole schießend mit dem Schnabel klapperte, seine Frau indes gehorsam unter ihm hockte. Im April brütete das Weibchen bereits die Eier aus, und das Männchen kehrte mit einem zappelnden Frosch im Schnabel von weitem Streifzug zurück.
In jenem Jahr mußte ich noch nicht zur Schule gehen. Eigentlich hätte ich schon gehen müssen, doch am ersten Tag heulte ich, ließ das Kindermädchen nicht von meiner Seite weichen. Das gleiche tat ich auch am nächsten Tag. Am dritten verdrosch ich meine Klassenkameraden der Reihe nach. Als ich am vierten Tag dafür mit dem vom Holzfederkasten abziehbaren Deckel schmerzende Hiebe auf die Hände bekam, nannte ich meinen Lehrer einen Idioten und erklärte zu Hause, nicht mehr zur Schule gehen zu wollen.
Die Familie erwies sich auch diesmal als nachgiebig und ließ mich privat unterrichten. Ein ausgezeichneter Zustand. Den ganzen Vormittag hatte ich frei, nach dem Mittagessen kam um drei eine nette Lehrerin, und um vier ging sie auch schon wieder. Von da an hatte ich frei. Vormittags konnte ich meine Schulkameraden ärgern. Vor ihrem Fenster zeigte ich mich auf dem Schulhof und schoß den Ball gegen die Tempelmauer.
Später kam ich doch nicht um die Schule herum. In der Rangfolge der Sich-Prügelnden behauptete ich den ersten Platz, obschon ich darum mit Spiegel, dem Sohn des Fuhrmanns, dem bei jedem Atemzug blasenschlagend der Rotz zur Nase heraushing, erbitterte Kämpfe auszufechten hatte. Dieser grünlichgelbe Schaum stieß mich ab. Das Raufen verlief meist blutig, wir rissen uns wechselseitig an Ohren und Nasenflügeln. Die Kinder standen um uns herum und feuerten beide Kontrahenten an. Spiegel und ich lagen auf der Erde, im Wechsel oben und unten. Wer oben war, der schlug den Kopf des anderen auf den Boden. Dann einigten wir uns über die Spielregeln: Treten, an den Haaren ziehen, spucken und Rotz verschmieren galten nicht.
In der Schulzeit vergriffen wir uns nicht aneinander, benahmen uns sogar ausgesprochen höflich, schonten unsere Kräfte für ernste Ringkämpfe. Wegen geringfügiger Meinungsverschiedenheiten bekamen wir uns nicht in die Haare, im Gegenteil, bei kleinen Auseinandersetzungen verbündeten wir uns sogar, reglementierten das Duell der anderen, während unser Zweikampf sich bereits mit moralischem Inhalt durchsetzt hatte. Wir hielten uns an ein ungeschriebenes Gesetz, uns in Zukunft außerhalb des Matches nicht mehr um Katis Gunst zu keilen, eines dreisten Mädchens mit dünnen Beinen und Zöpfen, das während unseres Kampfes mit den Zähnen klapperte. Eines Tages schlug Kati vor, uns heute nicht darum zu prügeln, wem sie erlauben sollte, sie nach Hause zu begleiten und den Schulranzen zu schleppen, weil sie früher heimgehen müßte. Statt dessen sollten wir sie beide ohne die üblicherweise vorangehende Schlägerei begleiten.
In jüngeren Jahren glaubte ich oft, der Angriff erfolge von außen, nahe in der Gestalt anderer Menschen. Erst später kam ich dahinter, daß die wahre Bedrohung eher in mir selbst angelegt ist, im sittlichen und technischen Überholtsein, in den Verschleißerscheinungen, von denen das Unheil ausgeht. Nicht die Unterdrückung, nicht das System und die Struktur, nicht die anderen Menschen, nicht die Wegelagerer, nicht die Räuber, nicht die Banditen reiten auf unsere schutzlose Behausung zu, nicht die Besatzungstruppen dröhnen unter unseren Fenstern, niemand befindet sich vor unserer Haustür. Der Feind ist hier, in mir selbst. Die Gegenwart selbst siecht dahin. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, daß ich dem Grenzmoment näher gerückt bin, nur weiß ich eben nicht, wie nahe. Doch wenn es mir angenehm ist, dort zu sein, wo ich bin, dann kann die Zeit ruhig vergehen. Ist sie indes schlecht, würde ich sie am liebsten zerren und schubsen, nur damit sie vergeht. In meinem Zimmer, im Garten, im Dorf und in der Stadt, im Jahresrad drehe ich meine ständigen Runden.
Es blubbert die Kaffeemaschine, duftet die Erdbeermarmelade und leuchten die frischen Brötchen im Korb. Die Jungen gehen zur Schule, winken zum Abschied vom Treppenabsatz, streben dem Berg zu, der für sie eine ganze Welt ist. Auch die Mädchen sind dort, sie werden zusehends komischer, einmal sind sie verliebt und dann wieder untreu.
Noch vor dem Zweiten Weltkrieg bewegte auch ich mich hockend und kniend über den Schulhof, während wir sangen: »Der Hase ruft sein Junges auf grünes Feld, komm, mein Häschen, Gott lädt ein zu seinem Fest!« Ich aber kniff die vor mir hüpfenden Mädchen in den Hintern, zog sie an den Zöpfen, trieb allerlei Unfug, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, damit sie sich mit mir beschäftigten. Im allgemeinen wunderte ich mich über sie.
Zum Zeitvertreib ärgere ich die Mädchen auch seither gern. Die netteren unter ihnen neigen dazu, meine Mätzchen mit einem vergnügt komplizenhaften Lächeln zur Kenntnis zu nehmen. In einem Gartenlokal hat die zehn Monate alte Zsuzsi gestern unermüdlich und mit Methode die in unserer Nähe sitzenden Gäste verzaubert. Wenn sie die eine Tischgesellschaft geschafft hatte, machte sie sich an die nächste. Sosehr sie sich auch in ihre uninteressante Konversation vertieft haben mochten, Zsuzsi jauchzte und juchzte, bis sie nicht anders konnten, als sich mit ihr zu beschäftigen. Blickten sie zu ihr hin, zauberte Zsuzsi ein Lächeln auf ihre Lippen, um dann blitzschnell eine honigsüße Lachsalve abzufeuern. Doch sobald sie sich unterwarfen und das Strahlen des schlauen Babys erwiderten, ließ Zsuzsis Interesse rapide nach, und sie hielt Ausschau nach neuer Beute. Ansonsten erwies sie sich in ihrem rollenden Wagen beim Umherblicken als zivilisierte und angenehme Dame.
In der zweiten Klasse der Grundschule wachte ich eines Morgens auf, während ich mit der einen Hand an der Wand klebte, mit der anderen den eckigen Pfosten des Messingbetts festhielt und dem Herrn Rechenschaft über meine fragwürdigen Taten ablegte: »Bitte schön, rechnen wir ab. Kein Anflehen, bitte, hier ist alles, wie es schon geschrieben steht, unabänderlich, es läßt sich nicht ausradieren, dabei wartet dort im Fach meines Federkastens der noch kaum benutzte Elefantenradiergummi.«
Mir geht es gut, und das auch dann, wenn es mir nicht ein jeder glaubt, selbst dann, wenn ich anscheinend nicht viel Grund dazu habe. Wenn mich beispielsweise 1986 – im Alter von dreiundfünfzig Jahren – jemand fragte, ob ich optimistisch sei, dann bejahte ich dies, um so eifriger, als in diesem Jahr einer meiner Söhne geboren wurde. Und wenn mir 1987 dieselbe Frage gestellt wurde, änderte sich an meiner Antwort nichts, denn auch in diesem Jahr wurde mir ein Junge geschenkt.
Das sei sehr erfreulich, erklärte der Fragende, doch ihn interessiere in der Zeit der Wende vor allem meine politische Befindlichkeit. Aha. Nach 1989 seien meine Schwierigkeiten mit der Zensur und verschiedene andere Freiheitsbeschränkungen verschwunden. Es gebe zahlreiche Publikationsmöglichkeiten, es liege also an mir, für eine Veröffentlichung lohnende Texte zu verfassen. Die Politische Polizei behindere meine Kontakte zu anderen Menschen in Ungarn und im Ausland nicht mehr. Wenn ich irgendwohin innerhalb Europas fliegen wolle, bräuchte ich keine Aus- und Einreisegenehmigungen. Es gebe keine Vorschriften, wie lange ich im Ausland verweilen dürfe, meine Manuskripte könnten ebenso ruhig reisen wie meine Hemden und an den Grenzen vergreife sich niemand mehr an meinen Hosentaschen.
Ich bin frei, habe beispielsweise das Recht und die Möglichkeit, über sechzig Jahre hinweg zurückzuschweben in jenes erwähnte Messingkinderbett, und kann meinen Hader mit dem Allmächtigen fortsetzen. Bitte schön, höchster Vater, ich war böse, habe auf allen vieren unter dem Klavier die Pedale kreuz und quer heruntergedrückt. Das schön einstudierte Spiel meiner Schwester Evchen habe ich verdorben. Dabei war unser Vater ins Kinderzimmer gekommen, hatte es sich in dem weißen Armsessel bequem gemacht, um seiner Tochter zu lauschen. Wirst du mir jetzt mit meiner Gabel auf die Hand hauen?
Frau Altmann hatte mir mit dem Zeigestock auf die Finger gehauen, weil ich diese beim Staccato nicht hoch genug gehoben hatte. Dieses Unrecht schrie nach Rache: Mit Kleister aus Gummiarabikum bestrich ich den gelblichen Stuhl, auf dem die Klavierlehrerin Platz nahm. Als dann das Staccato folgte, der Fehler und das Stockprogramm, erhob sich der verruchte Schüler und verließ den Schauplatz, das Kinderzimmer. Die Klavierlehrerin sprang auf und hätte ihn zu packen bekommen, doch zusammen mit ihr erhob sich auch der Stuhl, von dem sie sich nur durch das Herablassen ihres Rocks hätte befreien können.
Zu Evchen werde sie auch weiterhin kommen, doch zu mir breche sie alle diplomatischen Beziehungen ab, erklärte Frau Altmann meiner Mutter. Da meine Frechheiten mit dem Pedal erst noch folgten, darf ich feststellen, daß meine Streiche nicht minder große Anstrengungen erforderten, als für das richtige Heben der Finger zum Staccato vonnöten gewesen wären.
Die Ordnung in unserem Haus funktionierte in den Jahren meiner Kindheit sozusagen von selbst. Darauf achtete auch das Personal. Jede Mahlzeit hatte zu einem festgelegten Zeitpunkt stattzufinden. Das Mittagessen Punkt 12Uhr umfaßte stets drei Gänge, am Sonnabend und Sonntag gab es auch eine Vorspeise. Als dritter Gang wurde nach unserem Geschmack, besser gesagt: gemäß dem Wunsch der Kinder, Torte serviert. Das Mittagessen wurde von der Köchin zubereitet. In das Eßzimmer brachte sie es immer in einer Porzellanterrine, die Suppe somit nie in jenem Topf, in dem sie gekocht worden war, vielleicht um unser Feingefühl mit den Einzelheiten des vom Huhn bis zum Teller führenden Weges nicht zu stören.
Nach dem ersten Gang klingelte meine Mutter, woraufhin die Köchin hereinkam, die schmutzigen Teller abräumte, den Rest mitnahm und das nächste Gericht auf einer Porzellanplatte auf den Tisch stellte. Zusammen mit dem Hofarbeiter aß sie in der Küche. Dem Arbeiter gönnte sie einen Teller, sie selbst aß aus der Schüssel oder aus dem Topf.
Auch bei Tisch herrschte Ordnung. Zur Rechten meines Vaters saß meine Mutter, zu seiner Linken das Kindermädchen, neben ihr der großgewachsene Buchhalter in seinen sorgfältig geschneiderten Anzügen, der um jeweils einen Platz weiter zu uns Kindern nach unten rutschte, wenn Gäste kamen. Der Buchhalter war Junggeselle und verliebt in das Kindermädchen, das dieses Gefühl erwiderte, was auch meine Schwester Éva und ich guthießen, zumal er als Mittelverteidiger der Dorfmannschaft das gegnerische Tor mit strammen Schüssen bestürmte, die starke Beinmuskeln ahnen ließen. Auch er mußte Deutsch beherrschen, damit sich das Kindermädchen nicht ausgeschlossen fühlte.
Bei Tisch war ständige Unterhaltung erwünscht. Im Kloster, wo Kindergärtnerinnen ausgebildet wurden, verlangten die holländischen Nonnen dies auch von Annie. Wenn wir still wären, erklärte Annie, würden wir uns allzusehr im Geschmack der Speisen verlieren. Betrieben wir indes Konversation, würden wir den Genüssen der biederen bürgerlichen Küche keine überflüssige Beachtung schenken. Und tatsächlich, bei dem gefüllten Hühnchen und den mit Vanille- oder Nußcreme bestrichenen Eierkuchen wären wir Kinder geneigt gewesen, uns der Gier hinzugeben. Annie dagegen bestand darauf, unseren Eltern zu berichten, was wir vormittags gelernt hatten.
Zum Glück hatten die holländischen Nonnen Annie auch die Liebe zum Fahrradfahren eingeimpft, weshalb sich unsere schönsten Erlebnisse mit Fahrradausflügen in der Tiefebene verbanden. Da Annie ein hübsches und liebenswürdiges Mädchen war, stieß ihr bedauerndes Achselzucken, mit dem sie nix verstehn