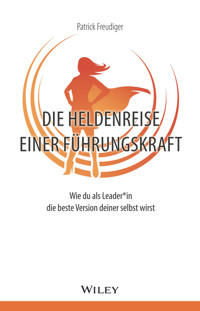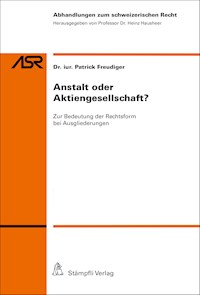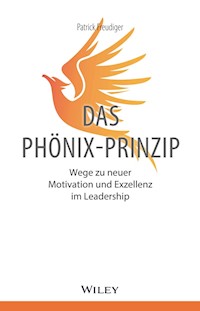
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ist "Chefsein" überhaupt noch erstrebenswert? Patrick Freudiger sagt: Ja! Denn die simple Tatsache, dass das Verhalten des Chefs die geführten Mitarbeiter zu Höchstleistungen anspornen aber auch zu einer demotivierten Arbeitshaltung führen kann, hat nach wie vor Gültigkeit. Dennoch fühlen sich manche Chefs ausgebrannt, unmotiviert und fragen sich, ob sie wirklich noch weiter als Führungskraft tätig sein wollen.
Hier tut es Not, sein Führungsverhalten nachhaltig radikal zu verändern und wieder Leidenschaft am Job zu entwickeln. Doch wie gelingt das? Zu dieser Kernfrage liefert der Autor konkrete praktische Handlungsempfehlungen, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und bei disziplinierter Anwendung zu ausgezeichneten Ergebnissen führen. Mit dem Resultat: "Chef SEIN macht Spaß" und "einen Chef zu HABEN, macht auch Spaß".
Dieses Buch gibt dem Leser Instrumente an die Hand, die ihm helfen, sich als Führungskraft auf individueller und organisatorischer Ebene neu zu entdecken. Wer bereit ist, den Weg einer Verhaltensänderung zu gehen, wer sich nicht scheut, sich aus der Komfortzone herauszubewegen, wer mutig genug ist, sich selbst zu begegnen, der bekommt mit diesem Buch eine Werkzeugkiste der Extraklasse an die Hand, die ihn sein Leben lang auf seinem Weg der Führung verlässlich zur Seite steht. Das Buch bietet dem Leser die Chance, sich hinsichtlich seines Führungsverhaltens neu zu programmieren. Das bedeutet, die Schwächen seines bisherigen Führungsverhalten radikal zu verbessern und sich mit einem authentischen Führungsstil als Führungskraft neu zu positionieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2021 Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, GermanyAlle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51055-9ePub ISBN: 978-3-527-83707-6
Umschlaggestaltung: Susan Bauer
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Geleitwort
Vorwort
1 Einleitung
Warum ich ein Buch über Führung geschrieben habe
Für wen ist dieses Buch und was bietet es?
Warum das »Phönix-Prinzip«?
Wie ist dieses Buch aufgebaut?
Wie lesen Sie dieses Buch?
Jürg Meyer – ein ganz »normaler« Chef
Anmerkungen
2 Genussfrei, gehetzt, kontrolliert – warum Führungskraft sein keinen Spaß mehr macht
Führungskräfte ohne Spaß machen keinen Spaß
Führungskraft – die anspruchsvollste Rolle der Welt?
Die Falle schnappt zu
Regelmäßige Frustration
Wenn der Körper streikt …
Der Zusammenbruch
War das jetzt alles?
Anmerkungen
3 Warum fallen uns Veränderungen so schwer?
Heutige Situation als Ergebnis vergangener Entscheidungen
Bisheriger Erfolg als Stolperstein
Paradoxon des Erfolgs
Schlafwandelnd durch das eigene Leben?
Schnelles Denken, langsames Denken
Gutes Bauchgefühl oder einfach nur denkfaul?
Vorteile des Bewährten zu groß – wahrgenommene Not zu klein
Anmerkungen
4 Stillstand oder geht es weiter?
WII-FM – jedermanns Lieblingsradiosender
»Love it, change it or leave it«
Raus aus der Opferrolle, rein in die 100-prozentige Verantwortung
»Hätte, hätte, Fahrradkette!«
Nach vorne schauen
Zusammenfassung
Anmerkungen
5 Best of 60 Jahre Führungsforschung
Die »eierlegende Wollmilchsau« der Führung?
Die sechs Meilensteine im Überblick
Erster Meilenstein: Menschenbilder als Grundlage des Führungsverhaltens
Zweiter Meilenstein: Von autoritär bis kooperativ geführt – der Einbezug von Mitarbeitenden in die Entscheidungsfindung
Dritter Meilenstein: Der ideale Mix zwischen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung und Effektivität
Vierter Meilenstein: Auf den Mitarbeitenden kommt es an …
Fünfter Meilenstein: »Agile Führung« als Antwort auf unterschiedliche Führungssituationen
Sechster Meilenstein: Transformationale Führung als Antwort auf die Frage nach Sinnstiftung
Zusammenfassung: Exzellenz in Leadership aus Sicht der Führungsforschung
Das halb volle Glas
Sabbatical
Scheidung
Gewohnheiten ändern
Anmerkungen
6 Das Phönix-Prinzip für Exzellenz in Leadership
Entwicklungsstufen als Führungskraft
Ein konkreter Weg zu Exzellenz in Leadership
Das Modell im Überblick
Der obere Halbkreis: mein persönlicher, authentischer Führungsstil
Der Wendepunkt
Der untere Halbkreis: mein internes Steuersystem
Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Elementen
Achtung: Haftungsausschluss
Anmerkungen
7 Die praktische Anwendung des Phönix-Prinzips
Erste Erkenntnisse
Exzellenz in Leadership als 5-stufiger Prozess
Schritt 1: Mein authentisches Führungsmodell
Schritt 2: Assessment des eigenen Führungsverhaltens
Schritt 3: Wahl der Entwicklungsfelder
Schritt 4: Anpassung des internen Steuersystems
Schritt 5: Verankerung neuer Gewohnheiten
Anmerkungen
8 Time to Change – das Phönix-Prinzip in Action
Erster Arbeitstag – alles beim Alten?
Abgeschottet im Kloster
Der lange Weg zu neuen Gewohnheiten
Drei Tage, die Ihr Leben als Führungskraft verändern
Die Verankerung im Führungsalltag
Dranbleiben
Ein Coach als Katalysator, um schneller vorwärtszukommen
Anmerkungen
9 Am Ziel
Zum Führen geboren – sind Führungsqualitäten in die Wiege gelegt oder erlernbar?
Üben, üben, üben
Das Wichtigste in Kürze
The Show must go on
Anmerkungen
Danke!
Anmerkungen
Der Autor
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 5
Abb. 5.1: X-Y-Theorie von McGregor
Abb. 5.2: Führungsstile unter Einbindung von Mitarbeitenden in die Entscheid...
Abb. 5.3: Reddins vier Führungsstile durch Kombination von Beziehungsorienti...
Abb. 5.4: Das 3-D-Modell der Führungsstile von Reddin
Abb. 5.5: Instrumente je Führungsstil
Abb. 5.6: Wahl des Führungsstils in Abhängigkeit von Fähigkeiten und Motivat...
Abb. 5.7: Empfohlener Führungsstil je Reifegrad
Abb. 5.8: Merkmale starrer und agiler Führung
Abb. 5.9: Transaktionale versus transformationale Führung
Abb. 5.10: Kombination transaktionaler und transformationaler Führung
Kapitel 6
Abb. 6.1: Die Entwicklung des persönlichen authentischen Führungsstils im La...
Abb. 6.2: Das Phönix-Prinzip für Exzellenz in Leadership
Abb. 6.3: Bedeutung der Führungsrollen in Abhängigkeit der hierarchischen Po...
Abb. 6.4: Gegenüberstellung der vier Führungsrollen
Abb. 6.5: Von einer Annahme zu einem Glaubenssatz
Abb. 6.6: Effektive Gewohnheiten
Abb. 6.7: Die vier Phasen einer Gewohnheit
Abb. 6.8: Das Durchbrechen von Gewohnheiten
Abb. 6.9: Gewohnheiten als Brücke zwischen dem internen Steuersystem und dem...
Abb. 6.10: Einfache und komplexe Gewohnheiten
Abb. 6.11: Fortlaufendes Verbessern des Führungsverhalten
Kapitel 7
Abb. 7.1: In 5 Schritten zu Exzellenz in Leadership
Abb. 7.2: Diese Menschen haben Sie am meisten geprägt
Abb. 7.3: Liste von Werten (in Anlehnung an »Principles and Values of Succes...
Abb. 7.4: Meine wichtigsten Werthaltungen
Abb. 7.5: Meine beiden wichtigsten Werthaltungen
Abb. 7.6: Auswirkungen der beiden wichtigsten Werte auf mein Entscheidungs- ...
Abb. 7.7: Eigenschaften exzellenter Führungskräfte, die die Rolle als Förder...
Abb. 7.8: Eigenschaften exzellenter Führungskräfte, die die Rolle als Unters...
Abb. 7.9: Eigenschaften exzellenter Führungskräfte, die die Rolle als Veränd...
Abb. 7.10: Eigenschaften exzellenter Führungskräfte, die die Rolle als Visio...
Abb. 7.11: Eigenschaften exzellenter Führungskräfte, die die Kernkompetenz K...
Abb. 7.12: Mein authentisches Führungsmodell
Abb. 7.13: Authentisches Führungsmodell von Patrick Freudiger
Abb. 7.14: Kurz-Assessment der eigenen Veränderungsbereitschaft
Abb. 7.15: Radardiagramm zur Visualisierung der Führungskompetenzen
Abb. 7.16: Detaillierte Angaben zu einer Führungskompetenz
Abb. 7.17: Übersicht der Themen mit der niedrigsten Bewertung
Abb. 7.18: Visualisierung der Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdbild
Abb. 7.19: Meistgenannte Entwicklungsbereiche von Führungskräften
Abb. 7.20: Wahl der konkreten Entwicklungsfelder
Abb. 7.21: Verfahren der Neuroassoziativen Konditionierung
Abb. 7.22: Analyse der wiederkehrenden Tätigkeiten, die negative Emotionen h...
Abb. 7.23: Analyse von Personen, die negative Emotionen hervorrufen
Abb. 7.24: Liste Ihrer derzeitigen Werthaltungen
Abb. 7.25: Top 20 von Führungskräften aus Sicht der Geführten
Abb. 7.26: Liste Ihrer zukünftigen Werthaltungen
Abb. 7.27: Ausgewählte Glaubenssätze von Führungskräften
Abb. 7.28: Angestrebte Referenzerlebnisse
Abb. 7.29: Liste der Gewohnheiten als Führungskraft
Abb. 7.30: Ineffektive Gewohnheiten von Führungskräften
Abb. 7.31: Detaillierte Analyse einzelner Gewohnheiten
Abb. 7.32: Verändern der Gewohnheiten unter Einbezug der geführten Mitarbeit...
Abb. 7.33: Aktionsplan zur Überprüfung der neuen Führungsgewohnheiten
Kapitel 8
Abb. 8.1: 3-Tages-Programm zur Anwendung des Phönix-Prinzips im Überblick
Abb. 8.2: Meine täglichen Fragen
Kapitel 9
Abb. 9.1: Erfolgsvoraussetzungen, um Exzellenz in Leadership zu erreichen
Orientierungspunkte
Cover
Titelseite
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
Fangen Sie an zu lesen
Danke!
Der Autor
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
307
308
309
310
Geleitwort
Als ich im November letzten Jahres Patrick Freudigers Anfrage zu einem Experteninterview zum Thema Leadership im Zusammenhang mit seinem Buchprojekt erhielt, freute ich mich über die Gelegenheit, ausführlich über ein Thema zu sprechen, dem Zeit meines Lebens mein reges Interesse gilt und das mich immer wieder von Neuem fasziniert und gerade in Zeiten von Umbrüchen und Diskontinuitäten entscheidend wichtig für Erfolg ist.
Warum ist Führung ein Thema, das sich nicht erschöpft? Wie kommt es, dass mir dieses Thema immer wieder neue Einsichten offenbart? Schon seit meiner Kindheit begeisterten mich Menschen mit starker Ausstrahlung und Wirkungskraft. Es inspiriert mich, wenn Menschen mit ihrem Charisma andere dazu bringen, ihnen zu folgen, um gemeinsam zu neuen Grenzen und damit auch zu Abenteuern aufzubrechen. Aus dieser Faszination entstand mein eigener Wunsch, auch diese Dynamik, diese Verantwortung anzustreben und somit Gestaltung aktiv bewirken zu können.
Ich sehe Führung auch als eine Pflicht gegenüber der Gemeinschaft. Wenn man über Führungswillen und -kompetenz verfügt, ist es wichtig, dies mit einer gesellschaftlichen »licence to operate« auch zum Wohle aller Stakeholder zu tun.
Doch wann tritt Wirkung ein, wann ist Führung relevant und wie unterscheidet sie sich von bloßem Aktivismus? Es ist nicht allein die Quantität, die längerfristig Wirkung schafft, das was allgemein mit »Purpose« umschrieben wird. Es ist etwas, das mit Veränderung zu tun hat und aus dem man nachhaltige Erfolge schafft.
Führung dehnt sich über mehrere Dimensionen aus und ist immer und unmittelbar an den aktuellen Zeitgeist geknüpft. Jede Generation entwickelt ihre eigenen Führungsprinzipien. Es ist der Zeitgeist, der Führung stets im Wandel hält und der auch von Führung Anpassung erfordert. Eine Dimension von Führen bedeutet schlicht überleben und idealerweise robuster in einer sich verändernden Welt zu agieren. Wer und was sich nicht adaptiert, kann dies nicht. Dabei spielt die Größe der Einheit, die es zu führen gilt, keine Rolle. Der Erfolg von Führung liegt eben nicht in der Größe; er liegt in der Fähigkeit zur Adaption.
So kann es vorkommen, dass im Zuge des Wandels einst erfolgreiche Führung versagt und zum Misserfolg wird, auch das liegt im Wesen der Natur von Führung. Zur Adaption gehört zu erkennen, wo Grenzen liegen, sei es auf der Ebene von Fachwissen, gesellschaftlicher Kodizes oder in der Divergenz von Werten zwischen Führungskraft und gelebter Unternehmenskultur. Anspruch auf dauerhaften Erfolg gibt es bei Führung nicht, auch sie unterliegt durchaus einer »Biokurve« – mutiges Adaptieren ist das einzig Beständige hierbei.
So habe ich im Laufe meiner Karriere erkannt, dass die einzig erfolgreiche Führung die situative Führung ist. Mitarbeitende, Aufgaben und Projekte müssen in den richtigen Kontext eingeordnet werden. Führungskräfte, die das verstanden haben, die in der Lage sind, Situationen und Mitarbeitende richtig einzuschätzen, und ihr Führungsverhalten dementsprechend modifizieren, sind Führungskräfte, die dann auch etwas bewirken können. Es liegt nicht an den vielen Arbeitsstunden pro Woche, die Wirkung erzielen. Es liegt an der Kontinuität, sich immer wieder mit den Dynamiken auseinanderzusetzen.
Eine Führungskraft, die situativ führt, ist präsent und verfügt über eine hohe Kommunikationsfähigkeit. Dabei ist auch Disziplin eine essenzielle Eigenschaft im Sinne von andauernder Geistesgegenwart und vor allem Reflexionsfähigkeit. Denn Führung bedeutet Verantwortung für einen Prozess und Menschen zu übernehmen und hierfür bedarf es Authentizität im Sagen und im Tun.
Selbst Menschen mit angeborener Führungskompetenz brauchen – wie beim Spitzensport – innere Disziplin, um erfolgreich zu sein. Gerade weil es in der sich rasant verändernden Welt mehr denn je um Adaption geht, ist andauerndes Lernen als Führungskraft entscheidend. Und die Bereitschaft zu lernen, sollte gegenüber allen Impulsen der Umwelt vorhanden sein.
Die ständige Adaption des eigenen Führungsverhaltens steht im Zentrum dieses Buches. Mit dem Phönix-Prinzip gibt Patrick Freudiger dem Leser sowohl einen gedanklichen Ordnungsrahmen als auch eine konkrete Herangehensweise an die Hand, um sein Führungsverhalten zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Führen und insbesondere verantwortungsvolles Führen macht Spaß und ist der Treiber einer sich weiterentwickelnden Gesellschaft – und so wünsche ich jedem Leser viele positive Impulse bei der Lektüre.
Karl Gernandt
Executive Chairman
Kühne Holding AG
Vorwort
Ein guter Freund von mir, er heißt Walter, hat mich dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Der Anlass war sein 60. Geburtstag, den er im Februar 2019 mit einem rauschenden Fest feierte.
Walter und ich haben uns vor mehr als 30 Jahren an der Universität Bern kennengelernt. Ich junger Student der Informatik. Walter junger Assistent am Institut für Informatik. Nach dem Studium haben wir uns für ein paar Jahre aus den Augen verloren. Ich startete meine berufliche Karriere als Assistent an der Universität. Walter heuerte bei einem großen Bankinstitut an. Walter wurde später mein Klient und ein guter Freund. Ich blickte immer zu ihm auf. Er war mein Mentor – ein Vorbild in Sachen Mut, Demut und Selbstdisziplin. Mit diesen Tugenden brachte es Walter an die Spitze eines großen, internationalen Konzerns, was mich offen gesagt sehr beeindruckte.
Ich freute mich sehr auf das Geburtstagsfest. Unter den rund 150 Gästen waren viele berufliche Weggefährten. Menschen zwischen 45 Jahren – also solche, die noch mit Leib und Seele ihre Karriere vorantreiben – und 70 Jahren –, Menschen, die bereits die Früchte ihres erfolgreichen beruflichen Wirkens im Ruhestand genießen. Es war eine gelungene Stimmung zwischen feierlich und feucht-fröhlich.
Ein zentrales Gesprächsthema, das uns neben Laudationen und Musik-Einlagen den ganzen Abend über begleitete: Unlust am Führen im Job. »Eigentlich will ich nicht mehr, finanziell muss ich aber noch, denn ich habe mich ja gerade erst vor zwei Jahren scheiden lassen.« »Es ist so mühsam mit den jungen Menschen. Ich weiß nicht, wie ich die Generation Z packen kann.« »Mein Chef ist ein totaler Trottel. Ich möchte nichts lieber als meinen Job hinschmeißen. Aber als 57-Jähriger werde ich wohl nichts Gleichwertiges mehr finden.« Es gab viele solcher Aussagen – oft von Menschen, die es weit, aber nicht auf die CEO-Position geschafft haben.
Spannend zu beobachten waren auch die Reaktionen meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, als ich ihnen erzählte, dass ich nach ein paar Jahren als CIO in einem größeren Konzern mit knapp 55 zurück in die berufliche Selbstständigkeit wechsle. Angetrieben von der Lust, etwas selbst zu gestalten und eine Aufgabe wählen zu können, die mich ganz erfüllt. »Du tust dir das echt nochmal an?«, »mir wäre das zu mühsam«, »Respekt«, »machst du nicht große finanzielle Einbußen bei diesem Schritt?«
In den Tagen nach dem Fest ließen mich die Aussagen, die Stimmung und die unterschiedlichen Gespräche nicht los. Viele der Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe, und welche wie ich Mitte fünfzig sind, haben anscheinend den Spaß an ihrem Job verloren. Ist dies Ausdruck einer verspäteten Midlifecrisis, oder ist das Führen in der VUCA-Welt wirklich anspruchsvoller geworden?
Diese Fragen haben mich beschäftigt und ich habe die Reflexion darüber zum Anlass genommen, das vorliegende Buch zu schreiben. Das Buch fokussiert darauf, aus dem unangenehmen Zustand der Unzufriedenheit herauszukommen, und liefert ein Führungsmodell, das Phönix-Prinzip zur Erlangung von Exzellenz in Leadership. Durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Führungsverhalten und dem Streben nach Exzellenz in Leadership kommt der Spaß an Führung zurück. Das Phönix-Prinzip leitet Sie Schritt für Schritt an, in ein freudvolles Führungsdasein zurückzufinden.
Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, entsprechende Gefühle hegen, halten Sie genau das richtige Buch in Ihren Händen. Ich bin überzeugt, dass Sie bei konsequenter Anwendung der dargelegten Handlungsempfehlungen nicht nur den Spaß an der Führungsaufgabe zurückgewinnen, sondern diese mehr denn je genießen werden.
Nun mögen Sie einwenden, dass Sie nach wie vor Spaß an Führung haben. Auch dann halten Sie das richtige Buch in Ihren Händen. Denn dann sind Sie jemand, für den persönliche Weiterentwicklung eine Selbstverständlichkeit ist. Für Sie ist Führung ein Wachstumsziel, eine unaufhörliche spannende Reise, die Sie wach und beweglich bleiben lässt und auf der Sie immer wieder etwas Neues zu entdecken bereit sind.
Ihr
Patrick Freudiger
Neerach, 5. April 2021
1Einleitung
Warum ich ein Buch über Führung geschrieben habe
Die Richtung zu bestimmen, Menschen zu steuern und in Bewegung zu setzen: Führen ist etwas Selbstverständliches, etwas Alltägliches. Führung als praktische Fähigkeit ist Teil unseres Menschseins. Auch Menschen, die über sich sagen, dass sie keine Führungspersönlichkeiten sind, geraten immer wieder in Situationen, in denen sie führen. Zum Beispiel als Eltern oder als Teil einer Sportmannschaft. Jeder von uns hat im Laufe seines Lebens viele Erfahrungen mit Führung gemacht – als Führender und als Geführter. Gerade die Erfahrung, geführt zu werden, ist oft ein sehr prägendes Erlebnis. Und nicht zuletzt haben wir tagtäglich mit der schwierigsten Führungsaufgabe überhaupt zu tun: Uns selbst führen. Die Allgegenwärtigkeit von Führung und die ihr innewohnende Komplexität machen das Thema zu einem schier unerschöpflichen Gegenstand, mit dem sich zu beschäftigen ungemein attraktiv und faszinierend ist. Das zeigt sich auch in den 75 000 Suchergebnissen, welche zum Begriff Führung auf Amazon angezeigt werden. Eine der rund 1600 Veröffentlichungen, die zum Thema Führung im Jahr 2021 erscheinen, halten Sie in Ihren Händen. Dafür danke ich Ihnen!
Warum schreibe ich ein Buch über Führung, wenn es doch schon eine Flut an Publikationen dazu gibt? Die Antwort ist simpel: Führung beschäftigt mich bereits den Großteil meines Lebens – schon vor Beginn meiner eigentlichen beruflichen Karriere. Meine ersten konkreten Erfahrungen mit Führung waren militärischer Art. Nach dem Absolvieren der Rekrutenschule 1985 wurde mir nahegelegt »weiterzumachen«, das heißt, als Korporal im Schweizer Militär die ersten Erfahrungen als Führungskraft zu sammeln. Im Sommer 1986 auf dem Waffenplatz Thun tat ich genau dies als Kommandant eines Kampfpanzers. Beim Ausbilden der Soldaten wurde mir damals bewusst: Führung ist nichts Einfaches und wohl nichts, was mir natürlich in die Wiege gelegt worden war. Ein zentrales Führungsprinzip habe ich aus dieser Zeit mitgenommen: Führen durch Vorleben oder neudeutsch »Leading by Example«. Ein Führungsgrundsatz, plausibel und einfach klingend – aber unerhört schwierig in der praktischen Umsetzung1. Zum Beispiel dann, wenn man als Informatikstudent gelernten Mechanikern das Dieselaggregat eines Kampfpanzers erklären soll. Ein zweiter Aspekt, der mich im Laufe meiner Karriere noch lange beschäftigen sollte: »Leadership is simple, but not easy«.2 Führungsprinzipien sind meist leicht zu verstehen, aber äußerst anspruchsvoll im Alltag umzusetzen. Der dritte Aspekt, der mich bewogen hat, ein Buch über Führung zu schreiben, ist, dass ich Menschen mag und ich mich für Menschen interessiere.
In meinem ersten Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Marketing und strategische Unternehmungsführung der Universität Bern lernte ich das Thema Führung aus einem anderen Blinkwinkel kennen. Ich befasste mich dort fünf Jahre mit dem Thema Führung aus theoretischer Perspektive.
In dieser Zeit setzte ich mich vor allem mit dem damaligen Trendthema der Erfolgsfaktorenforschung auseinander, welches eine große Faszination auf mich ausübte. Was macht einige Menschen und Organisationen so viel erfolgreicher als andere? Welche Eigenschaften zeichnen solche »Super Achiever« aus?
Der Erfolgsfaktorenforschung liegt die simple Annahme zugrunde, dass nicht alle Dinge gleich wichtig für den Erfolg einer Sache sind:
»Kritische Erfolgsfaktoren sind die wenigen Schlüsselbereiche, in denen positive Ergebnisse zwingend notwendig sind, damit eine bestimmte Führungskraft ihre Ziele erreichen kann.«3
Die wissenschaftliche Suche nach den »Naturgesetzen des Erfolgs« von Branchen, Unternehmen, Führungskräften und Menschen ist mittlerweile 60 Jahre alt, hat aber nichts von ihrer magischen Anziehungskraft verloren.4
Nach der gereiften Erkenntnis, dass es Erfolgsfaktoren gibt, hat mich die Lust, diese zu kennen, nicht mehr losgelassen. Ich habe die Erfolgsfaktoren immer als eine Art Abkürzung verstanden: der schnellste, effektivste Weg, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Ich habe bis zum heutigen Tag in allen meinen beruflichen Stationen weiter nach Erfolgsfaktoren geforscht. Bei der Gründung und dem Aufbau zweier Unternehmensberatungsfirmen habe ich mich damit auseinandergesetzt, welche Schlüsselfaktoren nötig sind, um mit einer Beratungsfirma überdurchschnittlich erfolgreich zu sein. In der Rolle als Berater reflektierte ich zusammen mit meinen Klienten die Erfolgsfaktoren, um in einer bestimmten Unternehmenssituation und einer bestimmten Branche erfolgreich zu sein. Als Führungskraft und als Teil einer Konzernleitung habe ich nach den Erfolgsfaktoren gesucht, um die von mir geleiteten Organisationseinheiten bestmöglich zu entwickeln.
Vor einigen Jahren entdeckte ich, dass ich neben der Rolle als Führungskraft großen Spaß daran habe, meine Erfahrungen weiterzugeben – sei es als Sparringspartner oder als Coach für Führungskräfte. Meine Mission in diesen beiden Rollen ist simpel: Führungskräfte und ihre Teams zu befähigen, die Effektivität und Effizienz ihres Führungsverhaltens zu steigern – als Individuen und als Team. Es erfüllt mich, bestehende und angehende Führungskräfte auf ihrem Weg zu Exzellenz in Leadership zu unterstützen.
Als Konsequenz möchte ich Ihnen mit diesem Buch ein praktisches Werkzeug zu Exzellenz in Leadership an die Hand geben.
Für wen ist dieses Buch und was bietet es?
Als ich den Impuls spürte, ein Buch über Führung zu schreiben, stellte sich mir auch gleich die Frage, für wen ich dieses Buch schreibe.
Das Buch ist für Führungskräfte. Für Managerinnen und Manager. Für Chefinnen und Chefs mit Erfahrung und für »Greenhorns«. Für Menschen, die Spaß an Führung haben, und solche, die den Spaß verloren haben. Für Führungskräfte, die am Anfang ihrer Karriere stehen und noch Großes bewirken wollen, und für Führungskräfte, die am Ende ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Für Führungskräfte, die sich gerne reflektieren und sich stets verbessern wollen. Für Führungskräfte, die wissen, dass sie sich als Führungskraft verbessern müssen, wenn sie ihren »Job« behalten wollen.
Es ist ein Buch für Führungskräfte, welche besser verstehen wollen, auf was es letztlich ankommt, um exzellent zu sein: Exzellenz definiert als Ausdruck persönlicher Erfüllung und der Erbringung von herausragenden Resultaten.
Letztlich habe ich das Buch auch für mich geschrieben. Denn es ist eine einmalige Gelegenheit, mein theoretisches Wissen und meine Erfahrungen zu reflektieren und zu einem Ganzen zusammenzufügen.
Ich wünsche mir, dass die Lektüre dieses Buches für Sie unterhaltsam ist und dass Sie eine Vielzahl von Erkenntnissen für sich herausziehen können.
Warum das »Phönix-Prinzip«?
Eine einmalige Rezeptur
Um zu veranschaulichen, wie das Phönix-Prinzip entstanden ist, möchte ich ein Anschauungsbeispiel aus der Küche wählen. Stellen Sie sich vor, Sie kochen einen Sud mit den besten und hochwertigsten Zutaten so lange ein, bis der Wassergehalt vollständig verdampft und der Geschmack maximal intensiviert ist. Was bleibt, ist die geschmackliche Essenz aller Zutaten.
Das Phönix-Prinzip besteht aus den reduzierten Anteilen dessen, was exzellente Führung ausmacht und wie man diese erreicht. Die Zutaten bestehen aus meinen persönlichen Erfahrungen und dem aus meiner Sicht Besten, was die Literatur zum Thema Führung zu bieten hat. Im Laufe von 35 Jahren habe ich eine Unmenge an Wissen und Erkenntnissen zum Thema Führung und Leadership gesammelt und erprobt. Ein stetig iterativer Prozess, geprägt durch Versuch-und-Irrtum – kontinuierlich sich weiterentwickeln, ausprobieren, experimentieren und neugierig sein für neue »Führungs-Ideen«.
Überprüft und ergänzt habe ich die Rezeptur an dargelegten Ideen und Konzepten anhand von persönlichen, mündlichen Interviews mit 100 ausgewählten Top-Führungskräften in Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Ihnen gebührt mein herzlichster Dank. Die ausgewählten Führungskräfte haben ein Durchschnittsalter von 51 Jahren. Sie verfügen durchschnittlich über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft, zu 80% sind sie männlich und zu 20% weiblich.
»Wie Phönix aus der Asche«
Der Vogel Phönix, Symbol für die Wiederauferstehung, wird in vielen Büchern, Filmen und Liedern thematisiert. Am Ende seines Lebens verbrennt er, um dann aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. Die Redewendung »wie Phönix aus der Asche« steht daher für etwas, das schon verloren geglaubt war, aber zu neuem Leben wiedererwacht. Das, was verloren geglaubt war, ist der Spaß und die Lust an Führung, die wir wiedergewinnen wollen.
Dieses Buch basiert auf dem geistigen Fundament verschiedener Autoren, deren Überlegungen mich geprägt und beeindruckt haben: Jack Canfield, Dr. Stephen R. Covey, Dr. Marshall Goldsmith, Darren Hardy, Dr. James M. Kouzes, Dr. Barry Z. Posner, Anthony Robbins, Reinhard K. Sprenger, Brian Tracy und Dr. Peter Warschawski. Diesen herausragenden Persönlichkeiten bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ihre Ansichten und Ideen haben mich geprägt und letztendlich möglich gemacht, dass dieses Buch entstanden ist.
Wie ist dieses Buch aufgebaut?
Im Wesentlichen besteht dieses Buch aus zwei Teilen: einem theoriegeleiteten ersten Teil 1 und einem praktischen zweiten Teil 2. Vorliegendes Buch ist also nicht nur zum Lesen, sondern zur aktiven Umsetzung in der Praxis gedacht.
Im ersten Teil, welcher die Hauptkapitel 2 bis 5 umfasst, führe ich Sie schrittweise an das Phönix-Prinzip heran. Zunächst forschen wir nach den Ursachen, weshalb viele Führungskräfte den Spaß am Führen verloren haben. Danach gehen wir der Frage auf den Grund, weshalb uns Veränderungen in beruflich unbefriedigenden Situationen so schwerfallen. Anschließend legen wir in Kapitel 5 das theoretische Fundament für das Phönix-Prinzip mit den wichtigsten Erkenntnissen aus 60 Jahren Führungsforschung. Sind Sie ein eiliger Leser und in erster Linie an der praktischen Anwendung von Führungstheorie interessiert? Dann können Sie dieses Kapitel »gefahrlos« überspringen.
Im zweiten Teil des Buches, der die Hauptkapitel 6 bis 9 umfasst, stelle ich Ihnen das Phönix-Prinzip für Exzellenz in Leadership vor. Zuerst im Überblick, dann werden die einzelnen Elemente detailliert erörtert. Im Anschluss zeige ich Ihnen, wie Sie das Phönix-Prinzip in Ihren Führungsalltag integrieren und praktisch anwenden können. Ich veranschauliche dies anhand von vielen Beispielen und liefere Ihnen praktische Checklisten zum Ausfüllen5. Zudem finden Sie ein Drei-Tages-Programm, um mit der Anwendung des Phönix-Prinzip erfolgreich zu starten.
Wie lesen Sie dieses Buch?
Es ist mir ein herzliches Anliegen, Sie dazu einzuladen, einige ausgewählte Prinzipien in diesem Buch zu verinnerlichen. Wenn Sie einige Prinzipien mit Herz und Verstand aufgenommen haben, wenn Sie sie inhaliert haben und ihre Wirkung zu spüren beginnen, werden Sie entdecken, wie bedeutsam sie für Ihr Leben sind. Denn Sie bieten Ihnen den Schlüssel zu Ihrem ganz persönlichen Erfolg.
Kernaussagen habe ich am Rand mit einem Icon gekennzeichnet. Nehmen Sie sich die Zeit, sie zu verinnerlichen.
Wenn Sie diesem Icon begegnen, bedeutet dies: »Bitte lesen Sie den nachfolgenden Abschnitt langsam. Noch besser: Lesen Sie ihn laut. Am besten: Lesen Sie ihn einer anderen Person vor und diskutieren Sie anschließend darüber.«
Diese Abschnitte eignen sich auch gut als Diskussionsgrundlage in einem Gruppenaustausch.
Jürg Meyer – ein ganz »normaler« Chef
Lernen Sie nun meinen Protagonisten Jürg kennen. Er wird Sie durch das gesamte Buch mit seiner Geschichte begleiten. Jürg ist ein fiktiver Charakter, den ich in ähnlicher Ausprägung in vielen Unternehmen kennengelernt habe. Ich bin sicher, auch Sie wird Jürg an den einen oder anderen Weggefährten oder Weggefährtin erinnern – vielleicht in manchen Aspekten nicht zuletzt an Sie selbst? Die Wahl einer Figur wie Jürg veranschaulicht die konkreten Führungsdynamiken und führt raus aus der reinen Theorie in die gelebte Praxis.
Jürg Meyer ist 48 Jahre alt, Schweizer, in Oerlikon bei Zürich aufgewachsen. Sein Vater arbeitete Zeit seines Lebens in der Züricher Stadtverwaltung, seine Mutter war Sekretärin in einer Schulbehörde. Nach der Sekundarschule ging Jürg in eine Lehre als Versicherungskaufmann. Seine Eltern wollten, dass er diesen Beruf erlernt. Er schloss seine Ausbildung erfolgreich ab und ging anschließend in die Rekrutenschule als Panzersoldat. Die Kameradschaft, die klaren Strukturen, die Disziplin gefielen Jürg und er blieb dem Militär und auch dem militärischen Führungsstil treu verbunden. Vor ein paar Jahren wurde er altershalber als Major nach mehr als 1000 Diensttagen aus dem Militärdienst entlassen6. Für Jürg war das ein trauriger Tag. Die militärische Führungserfahrung nutzte und nutzt Jürg auch im zivilen Leben. In der Versicherung wurde er bald zum Teamleiter, später zum Abteilungsleiter befördert. Mit 43 drückte er noch einmal die Schulbank und absolvierte ein Executive MBA an der Universität Basel. Sein deklariertes Ziel: in den erlauchten Kreis des Direktoriums aufgenommen zu werden.
Seit 22 Jahren ist Jürg mit Susanne verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder großgezogen, Max und Anna, 15 und 17 Jahre alt. Jürg lebt mit seiner Frau, seinen Kindern und Familienhund Emma in einem Einfamilienhaus in einem Vorort von Zürich. In seiner Freizeit fährt er gerne Rad und spielt Tennis; mit seinen Jugendfreunden spielt er seit Jahren zusammen in einer Band.
Seit 10 Jahren arbeitet Jürg bei der Phönix Versicherung und seit fünf Jahren als Mitglied des oberen Kaders. Diese Position hat er sich aus einer Kombination von Hartnäckigkeit, Loyalität, politischen Ränkespielen und vielen Überstunden erarbeitet. In seiner Funktion führt er rund 400 Mitarbeitende. Er verdient ein ordentliches Salär – deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt – und er hat eine Vorsorgelösung, die ihm nach seiner Pensionierung ein angenehmes Leben ermöglicht.
So sieht von außen betrachtet das Leben von Jürg im Großen und Ganzen erfolgreich aus. Er, seine Frau und seine beiden Kinder sind eine typische glückliche Schweizer Familie.
Anmerkungen
1
Als Beispiel lässt sich die Führung von Knowledge Workern nennen. Spezialisten, welche deutlich mehr Fachwissen haben als ihr Vorgesetzter. Das »Vormachen« kann sich hier also nur auf nicht-fachliche Themen beziehen.
2
Ein Zitat von Jocko Willink and Leif Babin aus dem Buch »Extreme Ownership - How U.S. Navy SEALs Lead and Win«. Definition von »Extreme Ownership«: es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Anführer.
3
John F. Rockart, Christine V. Bullen: A primer on critical success factors, 1979
4
In den achtziger Jahren erlebte die Erfolgsfaktorenforschung mit der PIMS-Studie und der Publikation »In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies« von Peters & Waterman einen ersten Höhepunkt. Man glaubte, den Heiligen Gral gefunden und die Geheimnisse erfolgreicher Führung entschlüsselt zu haben. Dem war nicht so. Im Gegenteil, es entbrannte ein heftiger Streit über die richtigen Erfolgsfaktoren zwischen den Vertretern zweier Denkschulen: das in den achtziger Jahren vorherrschende Paradigma der Industrieökonomie von Michael Porter (Marktbedingungen bzw. die Wettbewerbskräfte determinieren die Wettbewerbsstrategie einer Unternehmung und deren konsequente Umsetzung führt zum Unternehmenserfolg) versus den damals neuen Ansatz des Ressource Based View (der Mix an einzigartigen intellektuellen Fähigkeiten, Patenten/Innovationen, Geschäftsprozessen einer Unternehmung determinieren den Unternehmenserfolg). Die beiden Theorien wurden gegenübergestellt, um herauszufinden, welcher Ansatz korrekt ist, die größere Erklärungskraft hat. Aktueller Erkenntnisstand in der Forschung: Beide Erklärungsansätze können einen signifikanten Teil der Varianz des Unternehmenserfolgs erklären, also ein »unentschieden«. Klar war in jedem Fall: Es gibt so etwas wie Erfolgsfaktoren auf verschiedenen Ebenen: der Branche, des Unternehmens, des Menschen.
5
Die Checklisten sind über mehrere Kapitel verteilt. Sie können diese als ein Paket im PDF-Format kostenfrei beziehen. Mehr Informationen hierzu finden Sie am Ende des Buches im Kapitel »der Autor«.
6
Eine Besonderheit der Schweizer Armee ist das Milizsystem. Dies bedeutet, dass Jürg seine militärische Karriere neben seiner ordentlichen beruflichen Tätigkeit verfolgt hat.
2Genussfrei, gehetzt, kontrolliert – warum Führungskraft sein keinen Spaß mehr macht
Führungskräfte ohne Spaß machen keinen Spaß
Im Laufe meines beruflichen Wirkens als Berater, Unternehmer und Führungskraft sind mir drei Dinge klar geworden:
eine gute Führungskraft zu sein ist äußerst anspruchsvoll,
die wenigsten Führungskräfte sind gute Führungskräfte,
gute Führungskräfte können sich selbst reflektieren.
In den letzten Jahren haben mich meine Erfahrungen und Beobachtungen mit Berufskolleginnen und -kollegen zu einer weiteren Erkenntnis geführt: Vielen Führungskräften macht das Führen deutlich weniger Spaß als früher. Die Handelszeitung untermauert diese Behauptung in einem Artikel mit dem Titel »Warum Management keinen Spaß mehr macht« mit drei knackigen Worten: Genussfrei, gehetzt, kontrolliert.1 Die Auswirkungen fehlenden Spaßes an der Arbeit zeigt sich darin, dass viele Führungskräfte ihr Leistungspotenzial bei Weitem nicht ausschöpfen. Da sie naturgemäß in ihrer Rolle als Führungskraft Mitarbeitende führen, wirkt sich dies unmittelbar auch auf das Leistungsniveau ihrer Teams aus. Eine lustlose Führungskraft schafft es kaum, ihre Mitarbeitenden zu begeistern, zu beflügeln, zu inspirieren und für eine »Extrameile« zu motivieren. Begeistern kann nur, wer selbst begeistert ist, und echte Begeisterung kommt naturgemäß von innen. Verharren Vorgesetzte in solchen Gemütszuständen hat es oft eine toxische Wirkung auf die Organisation und ich frage mich, weshalb diese Menschen nicht etwas anderes in ihrem Leben tun, etwas das ihnen mehr Erfüllung bringen würde. Die Antwort liegt auf der Hand: Der Job als Vorgesetzter ist in aller Regel besser bezahlt und findet mehr Ansehen als der Job des Mitarbeitenden. Kraft ihrer Position können sich Vorgesetzte Berater leisten, die ihnen Arbeit abnehmen, und Vorgesetzte werden in der Regel weniger kontrolliert als die Mitarbeitenden.
Sie finden, ich übertreibe? Die Beliebtheit der Kurzgeschichten unter dem Titel Business Class des Bestsellerautors Martin Suter sprechen vom Gegenteil. Martin Suter parodiert in Business Class eine Vielzahl von Führungskräften, die teilweise an Narzissmus und Dreistigkeit kaum zu übertreffen sind. Und dennoch, die große Resonanz auf diese Geschichten lässt vermuten, dass diese Figuren zuhauf in der tagtäglichen Realität in den Chefetagen größerer Unternehmen existieren. Jeder von uns kennt solche Führungskräfte in seinem persönlichen Umfeld, hat unter solchen Führungskräften gearbeitet oder trägt selbst Züge einer solchen Führungspersönlichkeit in sich. Was kennzeichnet diese Figuren? Politische Ränkespiele, Ich-Bezogenheit, Selbstdarstellung, Betrügereien und Lügereien, Durchtriebenheit und Gemeinheiten, aber auch Duckmäusertum und Arschkriecherei. Spaß am Job? Spaß am Gewinnen von Machtspielen auf jeden Fall. Vorbildrolle für die Mitarbeitenden? Vorleben? Inspirieren? Beflügeln? Fehlanzeige. Um es mit den Worten von Martin Suter zu sagen:
»Mit Talent, Glück und Tüchtigkeit allein ist es nicht getan. Eine Karriere ist immer auch eine taktische Operation. Es genügt nicht, mit aller Macht auf sein Ziel zuzustreben, man muss auch verhindern, dass ein anderer es vor einem erreicht.«2
Im vorliegenden Buch gibt es ebenfalls einen Protagonisten. Sie haben Ihn bereits kennengelernt. Er heißt Jürg. Er hilft uns mit seinen Erfahrungen und Erlebnissen, die dargelegten theoretischen, methodischen Überlegungen anhand von nachvollziehbaren Alltagsbeispielen zu verdeutlichen. Ähnlich wie die Protagonisten bei Martin Suter ist es mir wichtig, eine Figur mit Wiedererkennungswert zu erschaffen, eine Figur, von der man das Gefühl hat, sie aus seinem Arbeitsumfeld zu kennen, oder in der man sich selbst ein Stück weit wiedererkennt.
Führungskraft – die anspruchsvollste Rolle der Welt?
Gestalten, Großes bewirken, Umdenken erzeugen, Menschen bewegen und begeistern – es gibt viele Gründe, die dafürsprechen, Führungskraft zu werden. Um das zu realisieren, geht man gerne die Extrameile, übernimmt zusätzliche Verantwortung und Verpflichtungen.
Die Rolle der Führungskraft ist anspruchsvoll. Ein wesentlicher Reiz liegt mit Sicherheit in dem meist hohen Gestaltungsspielraum, den die Rolle als Führungskraft mit sich bringt. Je höher die Position in der Organisationshierarchie, desto größer ist die Entscheidungskompetenz und Gestaltungsfreiheit.
Spannend zu beobachten ist, dass, obwohl es im Kern der Führung immer um Menschen geht, die Erfolgsfaktoren der Führung jedoch einem laufenden Wandel unterliegen. So wird neben der Grundvoraussetzung, Menschen zu mögen, eine große Wandlungsbereitschaft der Führungskraft vorausgesetzt.
Fünf Thesen, die ich im Nachfolgenden erläutere, machen exzellente Führung so anspruchsvoll:
Disruptive Megatrends fordern agile Führungskräfte.Viele unserer Führungsgrundsätze basieren auf veralteten Denk- und Verhaltensmodellen.Hierarchie-Strukturen machen Führungskräfte zu einsamen Wölfen.Mikropolitik und Bullshit-Kultur – das heißt, es wird eine Art der Kommunikation gepflegt, die einerseits prätentiös, andererseits inhaltlich leer ist – sind toxisch für das Arbeitsklima.Menschen wollen heute anders geführt werden als früher.Disruptive Megatrends fordern Führungskräfte
Die VUCA-Welt3 ist kein theoretisches Konstrukt, sondern existiert tatsächlich. Seit dem Ausbruch der Corona Krise wissen wir das definitiv. Nie zuvor mussten Volkswirtschaften, Regierungen, Organisationen und Führungskräfte sich mit einem derart disruptiven Ereignis auseinandersetzen.
Auch ohne Covid-19 verändert sich die Welt für Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden rasant.
Mit den folgenden vier Megatrends müssen sich Führungskräfte neuerdings auseinandersetzen:
Megatrend
Digitalisierung:
Traditionelle Geschäftsmodelle und Branchen, wie zum Beispiel Printmedien, Versicherungen, Fachmärkte, Reisebüros und Rechtskanzleien werden zunehmend in ihrer Existenz bedroht. Marktanteile gehen an neue Mitbewerber mit innovativen Dienstleistungsangeboten verloren. Die Rentabilität sinkt. Daraus resultiert ein enormer Veränderungs-, Innovations- und Kostendruck.
Megatrend
Wertewandel
bei den Mitarbeitenden: Mitarbeitende, insbesondere die rasch wachsende Anzahl an Knowledge Workern, sprechen kaum mehr auf die klassischen Anreizmechanismen (primär finanzielle Anreize, traditionelle Karrieremodelle) an. Die Sinnstiftung einer Organisation rückt verstärkt in den Mittelpunkt und fordert traditionelle auf Marktanteile und finanzielle Performance ausgerichtete Unternehmensstrategien heraus.
Megatrend
Fachkräftemangel:
Der Fachkräftemangel, insbesondere bei IT-Berufen führt dazu, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zugunsten von qualifizierten Arbeitnehmern verschiebt. Diese Mitarbeitenden sind anspruchsvoll und zeigen eine hohe Wechselbereitschaft, falls ihre Erwartungen nicht erfüllt werden.
Erschwerend hinzu kommt die demografische Entwicklung in den kommenden Jahren: Die Generation der Babyboomer, der geburtenstarken Jahrgänge, geht schon bald in Rente.
Megatrend
Wissenskultur:
Durch die fortschreitende Digitalisierung werden neue Fähigkeiten und neue Kenntnisse von den Mitarbeitenden verlangt. Das, was man einst gelernt hat, ist schnell veraltet. Die Bedeutung des lebenslangen Lernens nimmt zu. Es ist ein Muss, »am Ball« zu bleiben, was gerade für ältere Mitarbeitende anspruchsvoll ist.
Diese verschiedenen Megatrends verstärken sich gegenseitig und wirken als Brandbeschleuniger in einem per se schon anspruchsvollen, marktlichen Umfeld.
Viele unserer Führungsgrundsätze basieren auf veralteten Denk- und Verhaltensmodellen
»Chef, du bist das Problem!« Überzeugen Sie sich selbst und googeln »mein Chef ist …« und Sie erhalten die folgenden Autovervollständigungen angezeigt: »eine Niete«, »ein Blender«, »ein Kontrollfreak«, »inkompetent«, »ein Narzisst«, »ein Idiot«, »doof«, »unfair«, »ein Choleriker« und »faul«. Kaum eine der vorgeschlagenen Autovervollständigungen ist eine positive Ergänzung4. Zufall? Kaum, denn verschiedene empirische Untersuchungen gelangen zu den identischen Ergebnissen. Gemäß Gallup, einem der führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitute, wechseln 70 % der Menschen ihren Job aufgrund ihres direkten Vorgesetzten5. Eine andere empirische Untersuchung besagt, dass 65 % der Mitarbeitenden aussagen, dass sie lieber ihren Vorgesetzten austauschen würden als eine Lohnerhöhung zu erhalten6. Der größte Unzufriedenheitsfaktor ist bei vielen Mitarbeitenden der direkte Vorgesetzte.
Ein Hauptgrund hierfür ist, dass die gelebten Führungsgrundsätze auf veralteten Denk- und Verhaltensmustern aufbauen und unnütze Chef-Attitüden die Mitarbeitenden unnötigerweise demotivieren.
»Wir verbringen viel Zeit damit, Führungskräften beizubringen, was sie tun sollen. Wir verbringen nicht genug Zeit damit, den Führungskräften beizubringen, was sie nicht tun sollen. Die Hälfte der Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, muss nicht lernen, was zu tun ist. Sie müssen lernen, was sie anders machen sollten.«7
In der Folge stelle ich einige weitverbreitete Führungsprinzipien und Führungsverhaltensmuster sowie die daraus resultierenden Folgen dar:
»Command & Control
«:
Das Führungsprinzip von »Weisung und Kontrolle« war jahrzehntelang in klassisch hierarchisch aufgestellten Organisationen weit verbreitet. Vor dem inneren Auge formt sich ein schwarz-weißes Bild von einem autokratischen Chef, der auf einem Podest hinter einem riesigen Schreibtisch sitzend wachsam und streng auf seine an Pulten im Stehen arbeitenden Mitarbeitenden herabschaut, die vor Angst gebeugt emsig über ihrer Arbeit hängen. Diese Darstellung ist maßlos überzeichnet. Streng genommen basieren auch heute viele Unternehmen noch auf Misstrauen, was eine Command-and-Control-Logik notwendig macht. Es wird eine Hierarchie installiert, die unter anderem dafür da ist, Mitarbeitende beherrschbar und kontrollierbar zu machen. Auf die Führungspositionen setzt man Mitarbeitende mit loyaler Gesinnung, die gekonnt mit dem Machtinstrument Angst zu operieren wissen und die keine Skrupel kennen, um die gesetzten Ziele zu erreichen.
Die meisten internen Instrumente und Prozesse werden in der Folge über die Hierarchie gespielt: Aufgaben und Projekte werden über die Hierarchie im Unternehmen verteilt. Berichtswege gehen über die Hierarchie. Urlaub, Bestellungen, Reiseanträge, Reisekostenabrechnungen und noch vieles mehr müssen von Führungskräften freigegeben werden. Zielvereinbarungen, Incentivierungen, Leistungsbeurteilungen, Entwicklungsvereinbarungen führen die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden durch.
In vielen Fällen hat sich dieses Prinzip in der Vergangenheit auch bewährt. In der Schweiz haben etliche Führungskräfte ihre erste Führungserfahrung als Unteroffiziere in der Schweizer Armee gemacht und sind dabei in der »3-K-Regel« (Kommandieren, Kontrollieren, Korrigieren) ausgebildet worden.
Zur Generation Y und Z, zu den Digital Natives und den Knowledge Workern der Gegenwart, passt dieser Führungsstil nicht mehr. Die Leitwerte der Mitglieder der Y- und Z-Generation sind von ihrer Biografie geprägt und drücken sich in ihrem Streben nach Offenheit, Unabhängigkeit, Individualität, Sinnmaximierung, Leistung und persönlicher Entwicklung aus. Das macht sie unabhängig und bisweilen desorientiert. In Führungsbeziehungen entziehen sie sich damit in verstärktem Maße der Kontrolle8. Eine Haltung »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« schafft eine Kultur des Misstrauens. »Man muss sich Respekt erst verdienen«-Mentalität stößt bei jungen Arbeitskräften auf Unverständnis.
»Null-Fehler-Toleranz
«, »Null-Fehlerkultur« oder »Null-Fehler-Management«:
Dieses Prinzip macht in Organisationen und Funktionen, in welchen ein winziger Fehler im Zweifelsfall zu katastrophalen Auswirkungen führen kann, Sinn. Zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt. Selbst mit der kleinstmöglichen Fehlerrate besteht für Passagiere oder Astronauten ein hohes Sicherheitsrisiko, das es zu beseitigen gilt. Hier wird das Gesamtsystem so konzipiert, dass es mögliche Fehler direkt kompensieren kann. Genauso, wenn der Produktionsprozess selbst gefährlich ist – beispielsweise, weil mit hochgiftigen Chemikalien gearbeitet wird –, kann jeder Fehler, jede Änderung im Ablauf katastrophale Folgen haben.
Durch sorgfältige Arbeit und mehrfache Kontrolle können Fehler reduziert werden. Ganz ausbleiben werden sie nie. Dafür steigen die Kosten zur Fehlervermeidung umso stärker, je mehr sich der Arbeitsprozess der Perfektion annähert. Diese Kosten bestehen nicht nur im Kontrollaufwand. Noch mehr ins Gewicht fällt, dass bei größtmöglicher Fehlervermeidung auch Kreativität und Eigenständigkeit der Mitarbeitenden gegen Null gedrückt werden. Die Anwendung dieses Prinzips hat in den meisten Organisationen negative Auswirkungen in Form einer verminderten Produktivität und höherer Kosten.