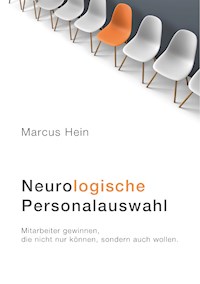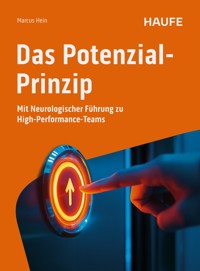
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Die Arbeitswelt wandelt sich rasant: Wie können Führungskräfte nicht nur Ergebnisse erzielen, sondern ihre Mitarbeitenden nachhaltig inspirieren und motivieren? Was wäre, wenn Arbeit nicht nur Sicherheit bietet, sondern Sinn stiftet und Freude bereitet? Marcus Hein beleuchtet die Herausforderungen moderner Führung und liefert praxisnahe Strategien und Wege, um echte Veränderungen zu bewirken. Er zeigt, wie Sie als Führungskraft wachsen und gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden ermutigen, über sich hinauszuwachsen. Sie erfahren, wie Unternehmen eine Kultur schaffen, in der Teams aufblühen, Potenziale entfalten und außergewöhnliche Erfolge erzielen. Sein Buch ist eine Einladung, Ihr Team zu überdurchschnittlichem Erfolg zu führen. Inhalte: - Wie Motivation entsteht - Neurobiologische Grundlagen - Grundprinzipien und Praxis Neurologischer Führung - Vision und Sinn – Das Gefühl, bedeutsam zu sein und gebraucht zu werden - Ziele setzen und kommunizieren - wirksam im Gehirn ankommen - Mitarbeitende auswählen, onboarden, entwickeln und binden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort1 Die verborgenen Schlüssel zur Motivation2 Die Vision3 New Work – New Leadership3.1 Die Idee von New Work3.1.1 Von der Industrialisierung zu New Work3.1.2 Wandel des Menschenbildes3.2 Die Mythen über New Work3.3 Die wahre Essenz von New Work3.4 Transformation zu New Leadership3.5 Der Übergang zur Neurologischen Führung3.6 Neurologische Führung vs. Neuroleadership4 Neurobiologische Grundlagen4.1 Aufbau und Entwicklung des Gehirns4.1.1 Die Entstehung des Gehirns und die Entwicklung neuronaler Strukturen4.1.2 Synaptische Autobahnen4.1.3 Bewusstes und Unbewusstes4.2 Wahrnehmung4.3 Persönlichkeit4.4 Verstand, Gefühle, Affekte und Emotionen: Die Grundlage für Führungsverhalten4.5 Motivation und Belohnungserwartungen: Führung als Motivationstraining5 Wie entsteht Motivation?5.1 Herausforderungen der Mitarbeitermotivation5.2 Die Basis der Motivation: Motive und Ziele5.3 Extrinsische vs. intrinsische Motivation5.4 Motivationstheorien5.4.1 Die Maslow’sche Bedürfnispyramide5.4.2 Genetische Motivationsfaktoren: The Big Three5.5 Neurologische Motivationsstrategien5.5.1 Motivationsrichtung: vermeidend vs. anstrebend5.5.2 Motivationsniveau: proaktiv vs. reaktiv5.5.3 Quelle der Motivation: internal vs. external5.5.4 Grund der Motivation: optional vs. prozedural5.5.5 Motivationale Entscheidungsfaktoren: gleich vs. verschieden5.5.6 Merkmale der Informationsverarbeitung: detailorientiert vs. global orientiert5.5.7 Konformität der Motivation: gehorsam vs. renitent5.5.8 Arbeitsorganisation: Menschen vs. Aufgaben5.5.9 Arbeitsstil: unabhängig – beteiligend – kooperativ5.5.10 Stressverarbeitung: emotional – flexibel – kognitiv6 Neuroleadership6.1 Neurowissenschaften für Führungskräfte6.2 Das SCARF-Modell7 Positive Psychologie und das PERMA-Modell7.1 Das PERMA-Modell7.2 Neurologische Führung und das PERMA-Modell8 Grundprinzipien Neurologischer Führung8.1 Verstehbarkeit8.2 Fokussierung8.3 Partizipation8.4 Feedback und Würdigung8.5 Verbundenheit8.6 Sinnhaftigkeit8.7 Vertrauen8.8 Stärken und Talente8.9 Positive Emotionen9 Neurologische Führung9.1 Vision – Mission – Strategie 9.1.1 Vision: Das gemeinsame Anliegen9.1.2 Mission und Strategie9.2 Ziele setzen und kommunizieren9.2.1 Ziele formulieren9.2.2 Ziele und Aufgaben kommunizieren9.2.3 Check it! – Ziele absichern9.2.4 Transformation übergeordneter Ziele9.2.5 Wahrnehmung und Begeisterung9.3 Planen und Organisieren9.3.1 Die drei Prinzipien erfolgreicher Organisation9.3.2 Werte und Regeln als Basis effektiver Organisationen9.3.3 Richtlinien und Vorschriften9.3.4 Job-Fit – der Richtige am richtigen Platz9.3.5 Flow – der Weg zu Spitzenleistungen9.3.6 Delegieren – eine zentrale Führungstechnik9.3.7 Meetings9.3.8 Gesunde Aufgabengestaltung9.3.9 Planen und Organisieren für eine zukunftsfähige Organisation9.4 Entscheiden9.4.1 Irrtümer bei Entscheidungen9.4.2 Strategien für kluge Entscheidung9.4.3 Partizipation9.5 Kontrollieren9.5.1 Zweck der Kontrolle9.5.2 Feedback – konstruktiv und motivierend9.6 Mitarbeitende auswählen9.6.1 Grundprinzipien der Neurologischen Personalauswahl9.6.2 Das neurologische Anforderungsprofil für die Rolle erstellen9.6.3 Praktische Entscheidungskriterien und Checklisten für die Auswahl9.6.4 Beförderung und interne Weiterentwicklung9.6.5 Die strategische Verantwortung der Personalauswahl9.7 Mitarbeitende onboarden9.7.1 Pre-Boarding: Die Weichen stellen9.7.2 Boarding: Den ersten Eindruck meistern9.7.3 Einarbeitung: Schnell zur vollen Produktivität9.8 Mitarbeitende entwickeln9.8.1 Selbstverantwortung und Führungskompetenz9.8.2 Strategische Mitarbeiterentwicklung9.8.3 Stärkenorientierte Entwicklung9.8.4 Feedback geben – Verhalten lenken9.8.5 Individuelle Talente und Motivation verstehen9.8.6 Jobrotation, Jobenrichment und Jobenlargement9.8.7 Autonomie und Spielräume schaffen9.8.8 Soziale Unterstützung und Teamentwicklung9.8.9 Mitarbeitergespräche als Entwicklungstool9.8.10 Fördern durch Wissensvermittlung und Expertentum9.8.11 Zusammenfassung: Der strategische Ansatz zur Mitarbeiterentwicklung9.9 Mitarbeitende binden9.9.1 Neurobiologische Grundlagen der Mitarbeiterbindung9.9.2 Vertrauen und Sicherheit als Grundlage der Bindung9.9.3 Purpose und Sinn: Warum das Gefühl, gebraucht zu werden, entscheidend ist9.9.4 Feedback und Anerkennung: Die unterschätzten Werkzeuge der Mitarbeiterbindung9.9.5 Potenziale entfalten und Perspektiven schaffen9.9.6 Work-Life-Balance und betriebliche Unterstützungsangebote9.9.7 Soziale Eingebundenheit und Teamkultur stärken9.9.8 Was langfristige Bindung ausmacht10 Führung als Schlüssel zur ZukunftLiteraturverzeichnisÜber den AutorStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-19007-4
Bestell-Nr. 12234-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-19008-1
Bestell-Nr. 12234-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-19009-8
Bestell-Nr. 12234-0150
Marcus Hein
Das Potenzial-Prinzip
1. Auflage, Juli 2025
© 2025 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
www.haufe.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Stoffers Grafik-Design Leipzig, KI-generiert mit Midjourney
Produktmanagement: Mirjam Gabler
Lektorat: Maria Ronniger, Text + Design Jutta Cram
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, und der Ruf nach qualifizierten Arbeitskräften wird immer lauter. Trotz steigender Fluktuationsraten und Krankenquoten scheint sich jedoch wenig zu verändern. Viele Menschen erleben ihre Arbeit immer noch als notwendiges Übel, als Mittel zum Zweck, das sie eher überstehen als wirklich ausleben. Es scheint, als wären wir in einem Kreislauf der Mittelmäßigkeit gefangen, aus dem kaum jemand ausbrechen kann oder will.
Doch was wäre, wenn Arbeit mehr sein könnte? Was wäre, wenn Arbeit nicht nur den Lebensunterhalt sichert, sondern tatsächlich einen Sinn und Lebensfreude stiften könnte? Während viele Führungskräfte und Unternehmen noch im alten Paradigma gefangen sind und versuchen, Mitarbeitende mit kurzfristigen Anreizen und Incentives zu motivieren, gibt es Unternehmen und Führungskräfte, die bereits neue Wege gehen und dabei eine erstaunliche Transformation erleben. Sie zeigen, dass es möglich ist, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen nicht nur funktionieren, sondern aufblühen und ihre beste Leistung bringen.
Die Neurowissenschaften und die moderne Psychologie geben uns die Werkzeuge an die Hand, um genau diesen Wandel zu gestalten. Sie zeigen uns, dass Motivation und Engagement keine Mysterien sind, sondern durch klare Prinzipien und nachvollziehbare Methoden gefördert werden können. Dieses Buch ist ein Wegweiser für alle, die den Wunsch und den Mut haben, das Potenzial ihrer Mitarbeitenden voll zu entfalten und nicht länger auf das Übliche zu setzen.
Wir stehen an einer historischen Schwelle: am Übergang von einer Welt, die Arbeit als bloße Pflicht sieht, hin zu einer Gesellschaft, die Arbeit als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und sinnstiftenden Aufgabe begreift. Der Weg dorthin ist nicht leicht – er erfordert Führungskräfte, die bereit sind, alte Muster loszulassen und ihr eigenes Menschenbild zu hinterfragen. Führungskräfte, die nicht mehr dem Irrtum verfallen, dass materielle Anreize zu Höchstleistungen führen, sondern die erkennen, dass es um mehr geht – um Sinn, um persönliche Entwicklung und um echte, emotionale Bindung.
Dieses Buch wird Ihnen nicht nur die Herausforderungen der modernen Führung aufzeigen, sondern Ihnen auch konkrete Wege und Strategien an die Hand geben, um echte Veränderungen in Ihrem Team und Ihrem Unternehmen zu bewirken. Es geht darum, wie Sie nicht nur selbst in Ihrer Rolle als Führungskraft wachsen, sondern auch Ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen können, über sich hinauszuwachsen. Sie werden sehen, wie leicht es sein kann, wenn man die richtigen Stellschrauben kennt und mit Überzeugung und Konsequenz an diesen dreht.
»Das Potenzial-Prinzip« ist mehr als nur ein Leitfaden – es ist ein Aufruf, Teil einer neuen Bewegung zu werden. Einer Bewegung hin zu einer Arbeitswelt, in der Mitarbeitende nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern in der sie inspiriert, engagiert und voller Energie sind. Es ist eine Einladung an Sie, sich auf den Weg zu machen und Ihr Team zu einem echten Erfolgsfaktor in Ihrem Unternehmen zu entwickeln. Wenn Sie den Mut haben, Dinge anders zu machen, wenn Sie bereit sind, echte Verantwortung zu übernehmen und aus der Tretmühle des Durchschnitts auszubrechen, dann ist dieses Buch Ihr Werkzeugkasten. Es wird Sie nicht nur dazu befähigen, andere zum Strahlen zu bringen, sondern auch selbst in Ihrer Führungsrolle zu glänzen.
Gehen Sie mit mir diesen Weg – lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Arbeit mehr ist als ein lästiges Übel, dass Führung mehr ist als Kontrolle und dass Menschen mehr sind als bloße Produktionsfaktoren. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass auch Ihr Verantwortungsbereich zu einem Ort wird, an dem Menschen gern ihr Bestes geben und über sich hinauswachsen. Ich lade Sie herzlich ein, Ihre Herausforderungen mit mir zu diskutieren, falls Sie wirklich etwas bewegen wollen.
Bedanken möchte ich mich für die wunderbare, kritische und konstruktive Begleitung dieses Buchprojekts durch Mirjam Gabler und Maria Ronniger. Ich weiß, dass ich nicht immer einfach bin – aber diese beiden Damen haben mich das nie spüren lassen. Auch möchte ich mich bei meiner lieben Frau für die Geduld und Unterstützung und bei meiner besten Freundin für Inspiration und den »Tritt in den Hintern« bedanken. Danke an all die Führungskräfte in Training und Coaching, die mir gezeigt haben, was geht und wo Grenzen überwunden werden können.
In diesem Buch verwende ich keine durchgängige Anrede. Da ich die meisten Leserinnen und Leser nicht kenne, verwende ich das formale Sie. Außerdem spreche ich mal in der maskulinen, mal in der femininen und auch in der neutralen Form. Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass das keine Ausgrenzung bedeuten soll. Für mich gibt es nur Menschen. Egal welchen Geschlechts, welcher Identität, welcher Vorlieben, Herkunft, Hautfarbe oder Ansichten, hege ich für alle gleichermaßen hohe Wertschätzung. Dennoch möchte ich mich für jede Verletzung hier schon entschuldigen – das war und ist nicht meine Absicht.
Marcus Hein, Krefeld März 2025
1 Die verborgenen Schlüssel zur Motivation
MotivationMitarbeitermotivationMotivationWarum springen manche Menschen montagmorgens voller Energie aus dem Bett, während andere die Tage bis zum nächsten Wochenende zählen? Diese Frage steht im Zentrum eines weit verbreiteten Phänomens in der heutigen Arbeitswelt: Viele Mitarbeitende erleben ihre Arbeit als bloße Pflicht – als notwendiges Übel, um den Lebensunterhalt zu sichern. Studien wie der Engagement-IndexEngagement-Index des Gallup-Instituts zeigen Jahr für Jahr, dass rund 85 % der Arbeitnehmer entweder Dienst nach Vorschrift machen oder innerlich bereits gekündigt haben (Gallup, 2025). Sie zeigen in ihren Studien auch, welche Stellschrauben es gibt, um auf diese Verteilung positiven Einfluss zu nehmen.
Abb. 1.1:
Gallup Engagement Index Deutschland 2024 (Gallup, 2025)
Dennoch bleibt die Verteilung dieser Gruppen seit Jahrzehnten nahezu unverändert. Was läuft hier schief? Und: Wie können wir es endlich ändern?
Das Leiden der Führungskraft
Es gibt zahlreiche Bücher, Modelle und Trainings für Führungskräfte. Doch trotz all dieser Erkenntnisse scheint sich in der Praxis kaum etwas zu verändern. Viele Führungskräfte erleben, dass ihre Bemühungen nur begrenzte Wirkung haben. Sie stehen unter Druck, die Produktivität zu steigern, die Fluktuation zu senken und den Krankenstand zu reduzieren – und doch fühlen sie sich oft machtlos, wenn sie ihre Teams nicht dauerhaft motivieren können.
Woran liegt das? Liegt es an den Mitarbeitenden, den Führungskräften selbst oder am System? Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter. Die meisten Führungskräfte befinden sich in einem Umfeld, das sie dazu drängt, mit dem Strom zu schwimmen und sich gegenseitig im Leiden zu bestätigen. Trainings und Coachings entwickeln sich oft zu Selbsthilfegruppen, die Leidensgemeinschaften bilden, aber nichts an der Situation ändern. Diese Haltung blockiert den Weg zu echten Veränderungen.
Neurowissenschaft: Ein Blick ins Gehirn
Um die Wurzel des Problems zu verstehen, müssen wir tiefer gehen – buchstäblich. Die moderne Neurowissenschaft bietet uns neue Einsichten in die Funktionsweise unseres Gehirns und zeigt uns, wie Führung auf der tiefsten Ebene wirken kann. Forschungsergebnisse legen nahe, dass unser Gehirn mehr von sozialen Bindungen und Sinnhaftigkeit beeinflusst wird als von finanziellen Anreizen. Motivation entsteht nicht durch Geld, sondern durch Vertrauen, Wertschätzung und Sinn.
Wenn Führungskräfte verstehen, wie das Belohnungssystem funktioniert und wie Neurotransmitter und Hormone auf das Führungsverhalten reagieren, können sie ihre Art zu führen revolutionieren. Dopamin treibt uns an, belohnt uns und gibt uns Energie – aber nur kurzfristig. Langfristig brauchen wir emotionale BindungenEmotionale Bindung und das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. OxytocinOxytocin, das sogenannte Bindungshormon, spielt eine zentrale Rolle im Führungsprozess. Führungskräfte, die eine Kultur des Vertrauens aufbauen und Wertschätzung zeigen, aktivieren die Ausschüttung von Oxytocin und schaffen eine emotionale Bindung, die über bloße Zielvorgaben hinausgeht. Hier liegt einer der verborgenen Schlüssel zur Motivation: Menschen, die sich sicher und wertgeschätzt fühlen, sind bereit, ihr Bestes zu geben. Sie erleben psychologische Sicherheit, die für hohe Leistungs- und Veränderungsbereitschaft, aber auch für emotionale Bindung der Mitarbeitenden sorgt.
Der wichtigste Schritt für eine Führungskraft ist es, sich aus dem Durchschnitt herauszuheben und volle Verantwortung zu übernehmen. Es gibt unzählige Beispiele, die beweisen, dass eine positive Führungskultur viel bewirken kann. Doch dies erfordert Mut, gegen den Strom zu schwimmen und sich nicht in Ausreden zu flüchten.
In den folgenden Kapiteln werden wir uns mit den wissenschaftlichen Grundlagen und den praktischen Anwendungen befassen, die es Führungskräften ermöglichen, die Motivation und das Engagement ihrer Mitarbeitenden grundlegend zu verändern. Dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie Sie nicht nur eine delegierende, sondern eine inspirierende Führungskraft sein können.
2 Die Vision
Wenn wir die neurobiologischen Grundlagen der MotivationMotivation verstehen, wird deutlich, dass eine andere Art von Führung nötig ist. Eine, die nicht nur Mitarbeitende inspiriert, sondern die Arbeitswelt als Ganzes revolutioniert. Meine Vision ist …
Vision: Neurologische Führung
Eine Arbeitswelt voller Inspiration, in der Menschen aufblühen, über sich hinauswachsen und gemeinsam überdurchschnittliche Erfolge feiern.
Diese Vision steuert mein ganzes Denken, Wollen und Streben, darin einen wertvollen Beitrag zu leisten. Diese Vision ist ein Leitstern, der viel größer ist als ich selbst. Vollumfänglich werde ich sie in meinem Leben nicht realisieren können, schon gar nicht allein. Und vielleicht kann ich Sie als Leser, als Leserin mit diesem Buch dafür gewinnen, an dieser Vision mitzuarbeiten – in Ihrem Verantwortungsbereich und auch weit darüber hinaus.
Meine Vision ist es, dass mehr und mehr Unternehmen sich dieser Vision anschließen. Diese Unternehmen kennen weder Personalmangel noch Mangel an Absatz, Umsatz sowie Innovation. Diese Unternehmen beweisen, dass nachhaltiges Wirtschaften gewinnträchtig ist. Damit ändern sich ganze Wirtschaftssysteme. Weder Umwelt noch Menschen werden Opfer des Wirtschaftens. Es entsteht ein Wir, das über den Verantwortungsbereich, über Unternehmen, Städte und Länder weit hinausgeht. Immer mehr Shareholder investieren in Unternehmen, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht – nicht als Plattitüde, die man gern auf Homepages oder in Hochglanzbroschüren druckt, sondern »in echt«. Diese Unternehmen profitieren von anhaltendem, überdurchschnittlichem Wachstum.
Es entstehen Unternehmen und Gesellschaften, in denen Stresserkrankungen und Burnout Fremdwörter sind. Und dass, obwohl niemand in ein oft übergriffiges GesundheitsmanagementGesundheitsmanagement investiert. Jeder ist darauf bedacht, sich selbst in einem optimalen Zustand zu erhalten, sich gesund zu ernähren, sich zu bewegen sowie ausreichend und qualitativ hochwertig zu schlafen. Führungskräfte sind darin ein Vorbild. Sie zeigen einen perfekten Mix aus fokussiertem, inspiriertem Handeln und ernst genommener Self-Care.
Was ich mir vorstelle, ist keine kleine Korrektur oder ein weiteres Optimierungsprojekt. Meine Vision ist eine Revolution der Arbeitswelt – eine radikale Veränderung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer zutiefst menschlichen Haltung basiert.
Eine Arbeitswelt voller Inspiration
Als Führungskraft haben Sie für Ihren Verantwortungsbereich eine Vision, ein gemeinsames Anliegen formuliert, Sie kommunizieren es an jeder Stelle nach innen und außen. Ihren Mitarbeitenden ist diese Vision klar und präsent und sie sind davon getrieben, ihren Tag mit der Frage zu beginnen: Wie kann ich heute zu dieser Vision, diesem gemeinsamen Anliegen unseres Verantwortungsbereichs beitragen?
Diese Vision erfüllt Sie und Ihre Mitarbeitenden einerseits mit Sinn und Bedeutung. Andererseits empfinden Sie und Ihre Mitarbeitenden ein überdurchschnittliches Streben, diese Vision zu realisieren.
Für Sie persönlich ist es eine große Freude, selbstständig handelnde Mitarbeitende zu sehen und wahrzunehmen, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Mitarbeitende aus anderen Verantwortungsbereichen fragen interessiert, was bei Ihnen los ist. Das ganze Unternehmen will wissen, wie Sie es schaffen, so begeisterte und gut gelaunte Mitarbeitende zu haben, die selbst montagmorgens fröhlich zur Arbeit kommen. Sie ziehen neue Mitarbeitende an wie ein Magnet, weil Ihre Mitarbeitenden voller Begeisterung von ihrer Arbeit erzählen.
Ganz nebenbei ist die Krankenquote auf 2 Prozent gesunken und die Produktivität hat sich erheblich gesteigert. Ihre Vorgesetzten und die Geschäftsführung werden auf Sie aufmerksam. Und Sie erzählen davon, wie Sie es gemacht haben, beginnend mit einer Vision, dem gemeinsamen Anliegen Ihres Verantwortungsbereichs.
Die Begeisterung in Ihrem Team strahlt ins ganze Unternehmen hinein. Sie erfahren auch Missgunst oder man sagt Ihnen, dass sie mit Ihren Mitarbeitenden einfach nur eine Menge Glück gehabt haben. Kollegen wollen Sie davon überzeugen, dass das in ihrem eigenen Verantwortungsbereich so nicht möglich ist – und sprechen in einem wenig wertschätzenden Ton von ihren Mitarbeitenden …
Und Sie erzählen von Ihrem Team und wie sich Menschen weiterentwickelt haben, wie sich Konflikte aufgelöst haben und das Team wie nie zuvor zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt. Ihre Kollegen schütteln nur den Kopf und glauben, dass Sie ein Glückspilz sind.
Doch da gibt es auch den einen Kollegen oder die eine Kollegin, die wirklich interessiert nachfragen, wie Sie das erreicht haben. Sie erzählen von Ihren Schritten der Umsetzung. Ihr Kollege will von Ihnen lernen und Sie versprechen, ihn dabei zu unterstützen. Es kommt zu einem inspirierenden Austausch, der die Zusammenarbeit positiv beeinflusst. Sie werden gemeinsam zu einer Keimzelle für eine positive Veränderung in Ihrem Unternehmen.
Eine Arbeitswelt, in der Menschen aufblühen
Wenn Sie in Ihren Verantwortungsbereich schauen, stellen Sie fest, dass sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert haben. Sie sind viel begeisterter, weil sie einen tiefen Sinn in dem sehen, was sie tun. Sie lächeln und lachen. Es gibt viel mehr Energie in Ihrem Team. Sie stellen sich den Herausforderungen und merken, dass sie zu viel mehr fähig sind, als sie bislang glaubten.
Gerade die jungen Mitarbeitenden blühen auf, weil Sie und Ihre älteren Mitarbeitenden an sie glauben und ihnen etwas zutrauen. Sie sprechen mit der jungen Generation regelmäßig über deren Stärken und Erfolge, sie fordern sie heraus und nehmen sie ernst. Eine sagt zu Ihnen: »Weißt du, dass ich hier jetzt das erste Mal in meinem Leben erlebe, dass jemand an mich glaubt und mir etwas zutraut? Hier werde ich ernst genommen und man hört mir wirklich zu.«
Und auch Sie selbst blühen mehr und mehr auf. Es erfüllt Sie mit Stolz, dass Sie diesen Wandel geschafft haben und dass alle Mitarbeitenden mitziehen. Viele unterstützen Sie in diesem Wandel tatkräftig und die anfängliche Skepsis weicht immer mehr.
Inzwischen gibt es kritische Stimmen von außen, die die Entwicklung als Seifenblase bezeichnen. Auch gibt es ironische Bemerkungen. Sie gehen damit aber gelassen um, weil Ihr Ziel viel größer ist und Sie über den dummen Bemerkungen stehen. Sie gehen unbeirrt Ihren Weg.
Ihre Mitarbeiter wachsen über sich hinaus
Ihnen ist klar, dass die größte Motivation dann entsteht, wenn Menschen über sich hinauswachsen können, wie es die oberste Stufe der Maslow’schen Bedürfnispyramide ausdrückt. Sie selbst empfinden das so für sich und reflektieren Ihr eigenes Wachstum. Sie leiten Ihre Mitarbeitenden zur Reflexion an, fokussieren auf Stärken und fordern sie immer wieder heraus, weiter zu wachsen. Gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden haben Sie Reflexionsrunden eingerichtet – zu zweit, aber auch im ganzen Team. Sie teilen eigenes Wachstum, aber auch die Beobachtungen über das Wachstum der anderen.
Mitarbeitende berichten, dass sogar ihre Familien und Freunde eine positive Entwicklung wahrnehmen: »Noch vor ein paar Monaten bist du nach Hause gekommen, hast deine Tasche in die Ecke geworfen und mit dir war nichts mehr anzufangen. Mittlerweile begrüßt du uns fröhlich und erzählst lauter schöne Dinge von der Arbeit.«
Sie feiern gemeinsam überdurchschnittliche Erfolge
Sie haben es nicht glauben wollen, dass so viel Wachstum und damit verbundener Erfolg möglich ist. Eigentlich hätten Sie sich dafür viel mehr anstrengen müssen. Aber mit dem neuen Miteinander, dem neuen Wir, ist es leichtgefallen und hat großen Spaß gemacht. Jedem im Team ist klar geworden, dass der Erfolg über das Wir kommt. Sie unterstützen sich gegenseitig, bestärken und ermutigen sich. Wenn Erfolge realisiert werden, sind es immer gemeinsame Erfolge.
Früher haben Sie versucht, den Ball flach zu halten – heute greifen Sie nach den Sternen, suchen gemeinsam Herausforderungen und bewältigen diese. Sie haben sich gemeinsam zu einer High-Performance-Kultur verpflichtet, die jeden Einzelnen und das ganze Team herausfordert. Dennoch achten Sie wechselseitig aufeinander und bremsen, falls sich jemand überfordert. Bei alldem erleben Sie, wie glücklich Ihre Mitarbeitenden sind, wie stolz sie auf ihre gemeinsame Leistung und ihre Erfolge sind. Sie feiern diese Erfolge gemeinsam. Regelmäßig schauen Sie auf das Erreichte und nehmen es bewusst wahr. Sie würdigen diese Erfolge, indem Sie darüber sprechen und festhalten, welche Stärken dazu geführt haben.
Man bewundert Sie und Ihr Team dafür, welch großartige Entwicklung Sie genommen haben. Sie werden zu einem Vorbild und Best-Practice-Beispiel im ganzen Unternehmen.
Diese Vision kann Wirklichkeit werden – in Ihrem Verantwortungsbereich, Ihrem Unternehmen und weit darüber hinaus. Alles beginnt mit einem einzigen Schritt: der Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen. Sind Sie bereit, die ersten Schritte zu wagen?
3 New Work – New Leadership
New WorkNew Work zeigt sein Potenzial, wenn es richtig verstanden und umgesetzt wird. New LeadershipNew Leadership muss verstehen, was New Work wirklich ist. Eines vorab: New Work ist nicht mehr Freizeit, mehr Flexibilität, eine Viertagewoche, Mobile Work oder die Übernahme der Kinderbetreuung. New Work ist nicht das, was viele Toppersonaler und Personalvorstände durch die sozialen Medien schreien. New Work ist viel mehr und geht viel tiefer. Wer das nicht versteht, wird in Zukunft Schwierigkeiten haben, freie Stellen zu besetzen. Diese Unternehmen werden nicht in finanziellen Konkurs gehen, sondern wegen fehlenden Personals schließen müssen – eine längst zu beobachtende Realität. Lassen Sie uns reflektieren, was sich in der Gesellschaft und ArbeitsweltArbeitswelt verändert hat, was New Work wirklich ist und wie New Leadership darauf reagieren muss.
Viele Unternehmen verstehen New Work nur als eine Anpassung an die Forderungen der Mitarbeitenden nach mehr Freiheit und Flexibilität. Doch die Konsequenzen sind fatal, wenn das zentrale Anliegen und die emotionale BindungEmotionale Bindung vernachlässigt werden. Mitarbeitende, die sich ohne klare Zielsetzung und emotionale Bindung frei entfalten sollen, reagieren oft mit Überforderung oder Resignation. Studien zeigen, dass in solchen Situationen die Krankenquote und die Fluktuation ansteigen (Gallup, 2025). Ein fehlendes Verständnis für das Warum hinter ihrer Arbeit kann langfristig zu Demotivation und Burnout führen.
Wenn Führungskräfte die Prinzipien von New Leadership und Neurologischer Führung anwenden, können sie in der modernen Arbeitswelt echte Begeisterung entfachen und ihre Teams zu Höchstleistungen motivieren. Führungskräfte, die sich an der Neurologischen Führung orientieren, schaffen emotionale Bindung und klare Orientierung. Sie geben ihren Mitarbeitenden nicht nur Freiheit, sondern auch Sinn und Inspiration. Der Erfolg solcher Unternehmen zeigt sich nicht nur in besseren Ergebnissen, sondern auch in motivierten, gesunden Teams und einer positiven Unternehmenskultur.
3.1 Die Idee von New Work
Die Arbeitswelt von morgen ist voller Potenzial. New Work ist mehr als nur eine Reaktion auf flexible Arbeitsmodelle, Homeoffice, Digitalisierung oder die Einführung der Viertagewoche. Es ist ein umfassendes Paradigma, das die Art und Weise, wie wir Arbeit und Zusammenarbeit gestalten, grundlegend verändert. Meine Idee von New Work zielt darauf ab, Menschen nicht nur effizienter, sondern vor allem erfüllter arbeiten zu lassen. Hier stehen der Mensch und seine individuelle Entwicklung im Mittelpunkt, eingebettet in ein inspirierendes und wertschöpfendes Miteinander.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Menschen nicht mehr nur arbeiten, um zu überleben, sondern um einen echten Beitrag zu leisten – für sich selbst und ihr Unternehmen. Unternehmen sollten Orte sein, an denen Menschen ihre Stärken einbringen, wachsen und sich beweisen können. Es geht nicht primär um monetäre Belohnung, sondern um eine sinnvolle Tätigkeit, die den Menschen erfüllt und begeistert.
Sie können sich für Ihren Verantwortungsbereich fragen:
Wie stark ist Ihre Vision im Unternehmen verankert?
Wie lautet die Vision Ihres Verantwortungsbereichs? Oder gibt es gar keine?
Können Ihre Mitarbeitenden jederzeit klar ausdrücken, wofür Ihr Verantwortungsbereich steht?
Inwieweit fühlen sich Ihre Mitarbeitenden inspiriert und durch die Vision des Unternehmens geführt? Welche Aspekte der Vision sind für sie besonders motivierend?
Wie stark sind Ihre täglichen Entscheidungen von der übergeordneten Vision Ihres Verantwortungsbereichs geprägt?
Menschen arbeiten in einem Umfeld, in dem sie durch ein gemeinsames Anliegen verbunden sind, das weit über operative Ziele hinausgeht. Dieses Anliegen ist mehr als ein Leitbild an der Wand – es ist ein Leitstern für das tägliche Handeln. In Unternehmen, die sich an diesem Gedanken orientieren, entsteht eine Arbeitskultur, in der sich Mitarbeitende ihrer Ziele und des gemeinsamen Anliegens bewusst sind. Führungskräfte in dieser Welt fragen sich nicht nur Was tun wir?, sondern auch Warum tun wir das? und Was bedeutet das für uns und für andere?
New Work bedeutet auch eine Verschiebung der Verantwortlichkeiten: von oben nach unten und von außen nach innen. Mitarbeitende sind nicht nur Teil eines Systems, sondern aktiv Mitgestaltende. Sie sind befähigt, eigenverantwortlich zu handeln und eigeninitiativ Beiträge zu leisten. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem jeder und jede Einzelne einen Teil zu gemeinsamen Zielen beiträgt.
In New Work können Menschen ihrem Warum folgen. Sie engagieren sich nicht aus Zwang oder extrinsischen Anreizen, sondern aus einer tiefen Überzeugung und Leidenschaft heraus. In New Work geht es nicht darum, die Leistung Einzelner isoliert zu betrachten, sondern die Fähigkeit zu fördern, als Teil eines großen Ganzen wirksam zu werden.
Führungskräfte als Wegbereiter
New Work verlangt von Führungskräften, dass sie ihre Rolle neu definieren. Sie sind keine bloßen Organisatoren, sondern Wegbereiter, die ihre Mitarbeitenden inspirieren und unterstützen. Sie erkennen die Potenziale, ermöglichen Wachstum und schaffen einen Raum, in dem Menschen gedeihen können. Ihre Aufgabe besteht nicht mehr nur im Anweisen – sie verstehen sich als Dienstleistende, die mit ihrem Einsatz für den Erfolg der einzelnen Teammitglieder und des gesamten Teams sorgen.
Der wirtschaftliche Erfolg als Resultat
New Work strebt nicht nur nach einer Verbesserung der Arbeitsatmosphäre, sondern nach nachhaltigem wirtschaftlichem Erfolg. Unternehmen, die diesen Ansatz leben, schaffen nicht nur ein gesundes Umfeld für ihre Mitarbeitenden, sondern steigern langfristig ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Zufriedene, motivierte Mitarbeitende führen zu zufriedenen Kunden – und das hat direkte Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit. Der wirtschaftliche Erfolg ist nicht mehr die oberste Zielsetzung, sondern selbstverständliche Folge von New Work.
Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Upstalsboom, das mit einer MitarbeiterzufriedenheitMitarbeiterzufriedenheit von 80 Prozent und einer KrankenquoteKrankenquote von 3 Prozent Benchmarks setzt. Dort wird New Work vorbildlich gelebt, und mit dem organisationalen Change verdoppelten sich die Umsätze innerhalb von drei Jahren, während die Produktivität allein von 2013 auf 2014 um 40 Prozent zunahm (Upstalsboom, 2025). Das alles war aber nicht die Absicht, sondern die Folge.
3.1.1 Von der Industrialisierung zu New Work
Die Geschichte der Arbeitswelt ist eine Geschichte des stetigen Wandels. Die industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert markierte einen tiefgreifenden Wendepunkt, der viele grundlegende Veränderungen mit sich brachte. Was einst durch Handwerkskunst und landwirtschaftliche Arbeit dominiert wurde, verwandelte sich in eine industrielle Gesellschaft, die zunehmend von Maschinen und Fabriken geprägt war. Diese Entwicklung veränderte nicht nur die Art der Arbeit, sondern auch das Selbstverständnis der arbeitenden Menschen.
Die Ära der Industrialisierung: Arbeit als Pflicht und Prozess
Mit dem Beginn der IndustrialisierungIndustrialisierung wurden Massenproduktion und Standardisierung der Schlüssel zur EffizienzEffizienz. Arbeitsprozesse wurden mechanisiert und optimiert, um den wachsenden Bedarf an Gütern und Dienstleistungen zu decken. Diese Phase der Industrialisierung führte jedoch auch zu einer Entfremdung der Arbeiter von ihrem Produkt, was Karl Marx als Entfremdung der Arbeit bezeichnete. Wo einst Handwerker eine direkte Beziehung zu ihrem Werk hatten, sahen sich Fabrikarbeiter nun als Teil eines riesigen Produktionsprozesses, bei dem die individuelle Leistung kaum sichtbar war.
Diese Entfremdung ging einher mit strengen HierarchienHierarchie und einem autoritären FührungsstilAutoritärer Führungsstil. Die Aufgabe der Führung bestand hauptsächlich darin, die Einhaltung von Prozessen zu überwachen und Anweisungen zu erteilen. Effizienz wurde zur obersten Maxime, und das Menschenbild reduzierte sich auf den sogenannten Homo oeconomicusHomo oeconomicus – den rational handelnden, durch Anreize motivierten Mitarbeiter.
Der Taylorismus und die Wissenschaft der Effizienz
Anfang des 20. Jahrhunderts veränderte Frederick Winslow Taylor das Verständnis von Arbeit nachhaltig. Der von ihm begründete TaylorismusTaylorismus führte zu einer wissenschaftlichen Organisation der Arbeit, die darauf abzielte, jeden Arbeitsprozess in seine kleinsten Einzelschritte zu zerlegen und so die Produktivität zu maximieren. Taylors Ansatz betonte Spezialisierung, Präzision und Effizienz. Jeder Handgriff und jeder Prozessschritt wurde standardisiert und die menschliche Arbeitskraft wurde auf ein funktionales Element innerhalb einer größeren Maschine oder Produktionsanlage reduziert. Dieses Konzept erwies sich als überaus erfolgreich in einer Zeit, in der die Nachfrage nach industriellen Gütern stark anstieg. Gleichzeitig legte der Taylorismus den Grundstein für das heutige Verständnis von Prozessen und Effizienz, das viele Unternehmen immer noch prägt. Allerdings hat diese Herangehensweise auch ihre Schattenseiten: Sie reduziert die HandlungsspielräumeHandlungsspielraum der Mitarbeitenden auf das Notwendigste und beschränkt deren Selbstbestimmung.
Der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft
Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Arbeitswelt weiter. Die wachsende Automatisierung und Mechanisierung führte zu einer Verlagerung von Arbeitskräften aus der Industrie in den DienstleistungssektorDienstleistungssektor. Der technologische Fortschritt und die DigitalisierungDigitalisierung ermöglichten neue Arbeitsformen und eine stärkere Spezialisierung. Die Rolle der Führungskräfte änderte sich schrittweise von strikten Kontrollinstanzen zu Koordinatoren von Wissen und Fähigkeiten. Gleichzeitig stieg die Bedeutung von Wissen und Information. Wissen wurde zur zentralen Ressource und qualifizierte Arbeitskräfte wurden zu den neuen Schlüsselfiguren der Wirtschaft. Diese Entwicklung brachte eine veränderte Erwartungshaltung gegenüber den Führungskräften mit sich. Der Fokus verschob sich allmählich von der KontrolleKontrollieren der physischen Arbeit hin zur Schaffung einer Umgebung, in der Wissensträger ihre Fähigkeiten optimal einbringen konnten.
Die Digitalisierung und die Grenzen der Prozessorientierung
Mit der fortschreitenden Digitalisierung hat sich die Arbeitswelt erneut tiefgreifend verändert. Viele Routinetätigkeiten wurden durch Maschinen und Computer übernommen, und Unternehmen begannen, digitale Lösungen zu entwickeln, um ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten. Die Digitalisierung brachte jedoch auch Herausforderungen mit sich: Viele Unternehmen fingen an, ihre bestehenden Prozesse unreflektiert zu digitalisieren, ohne die zugrunde liegenden Arbeitsabläufe grundlegend und kritisch zu überdenken. Das führte oft dazu, dass ineffiziente Prozesse lediglich digitalisiert wurden – mit der Folge, dass die grundlegenden Probleme weiterbestehen.
Von der Industrialisierung zu New Work: Ein Paradigmenwechsel
Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und der Übergang zur digitalen Arbeitswelt bilden den Hintergrund für das Entstehen des New-WorkNew Work-Ansatzes. New Work ist jedoch weit mehr als nur eine Reaktion auf technologische Veränderungen. Es ist eine Philosophie, die einen radikalen Bruch mit dem traditionellen Verständnis von Arbeit fordert. New Work stellt den Menschen wieder in den Mittelpunkt und setzt auf Selbstbestimmung, Sinnhaftigkeit und individuelle Stärken.
Der Begriff »New Work« wurde in den 1970er-Jahren von dem deutsch-amerikanischen Sozialphilosophen Frithjof Bergmann geprägt (Bergmann, 2004). Bergmann erkannte, dass die klassische Lohnarbeit nicht mehr das Maß aller Dinge sein sollte. Er propagierte ein neues Verständnis von Arbeit, das nicht länger nur den wirtschaftlichen Erfolg in den Mittelpunkt stellt, sondern die Frage: »Was willst du wirklich, wirklich tun?« Bergmanns Vision von New Work stellte die individuelle Sinnfindung und SelbstverwirklichungSelbstverwirklichung der Menschen in den Vordergrund. Dieser Anspruch wurde bereits mit der BedürfnispyramideBedürfnispyramide von Abraham Maslow 1943 als eine Theorie der menschlichen Motivation entwickelt (Maslow, 1943).
Der Wandel von der IndustrialisierungIndustrialisierung hin zu New Work erfordert eine grundlegende Veränderung der FührungskulturFührungskultur. Führungskräfte müssen lernen, ihre Mitarbeitenden nicht mehr als Produktionsfaktoren zu sehen, sondern als eigenständige Akteure, die ihre Talente und Potenziale bestmöglich entfalten können. Die Rolle der Führungskraft ändert sich von der »Weisungsinstanz« hin zur »Inspiration und Begleitung«.
3.1.2 Wandel des Menschenbildes
Der Wandel der Arbeitswelt ging stets Hand in Hand mit einem Wandel des Menschenbildes. In den vergangenen Jahrhunderten änderten sich die gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was den Menschen ausmacht und wie seine Rolle in der Arbeitswelt zu verstehen ist. Diese Veränderungen beeinflussten maßgeblich die Erwartungen an Führung und Organisationen.
Von Tradition zu Individualität
In den vorindustriellen Zeiten war das Menschenbild stark durch Traditionen, soziale Hierarchien und festgelegte Rollenbilder geprägt. Der Mensch wurde häufig als Teil eines größeren Gefüges gesehen, und seine individuelle Freiheit war begrenzt. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft – sei es die Familie, das Dorf oder eine Zunft – bestimmte das Leben und die Arbeit eines Menschen. Arbeit war eng mit der eigenen Identität verknüpft und oft eine Frage der Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft.
Mit der Industrialisierung und der zunehmenden Mechanisierung der Arbeit erlebte der Mensch eine neue Form der ArbeitsorganisationArbeitsorganisation. An die Stelle des Handwerks und der selbstbestimmten Arbeit traten die MassenproduktionMassenproduktion und die FabrikarbeitFabrikarbeit. Der Mensch wurde zunehmend als austauschbare Arbeitskraft wahrgenommen, als eine Ressource im Rahmen eines mechanischen Produktionssystems. In dieser Phase rückte nicht der Einzelne, sondern die Effizienz der Arbeitsabläufe in den Mittelpunkt. Die Menschen wurden stärker entfremdet von dem, was sie produzierten, und ihr Wert wurde oft an ihrer Produktivität gemessen.
Gleichzeitig kamen mit der Aufklärung neue Ideen von FreiheitFreiheit, AutonomieAutonomie und IndividualitätIndividualität auf. Diese philosophischen Strömungen legten den Grundstein für eine gesellschaftliche Veränderung, die sich in der Arbeitswelt erst allmählich durchsetzte. Die Industrialisierung führte zwar zur EntfremdungEntfremdung und Reduktion des Menschen auf eine Nummer in einem Produktionsprozess, doch parallel dazu entstanden neue Bewegungen, die das Individuum als eigenständigen Akteur mit eigenen Zielen und Entscheidungsfreiheit betonten. Diese Entwicklungen begannen, das Menschenbild nachhaltig zu verändern, und legten den Grundstein für die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Selbstbestimmung in der Arbeitswelt.
Vom Arbeitskraftmodell zum Humanressourcenansatz
Im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Verständnis des Menschen weiter. In der Zeit des Taylorismus und der wissenschaftlichen Managementlehre wurde der Mensch als Arbeitskraft betrachtet, die es zu optimieren galt. Effizienz, Präzision und Produktivität standen im Vordergrund, und der Mensch wurde oft als austauschbare Ressource gesehen, die verwaltet und kontrolliert werden musste.
Doch dieses Menschenbild veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte. Mit der Verlagerung zur DienstleistungsgesellschaftDienstleistungsgesellschaft und dem Aufkommen neuer Technologien rückten die individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale der Mitarbeitenden zunehmend in den Mittelpunkt. Der Begriff »Human Resources«Human Resource etablierte sich und mit ihm das Konzept, dass Menschen einen wertvollen und entwickelbaren Faktor darstellen, der gezielt gefördert werden muss, um den Erfolg von Organisationen zu sichern.
Das Menschenbild des Homo oeconomicus
Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklung war die Vorstellung vom Homo oeconomicusHomo oeconomicus – des rational handelnden Menschen, der stets bestrebt ist, seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Dieses Bild prägte die klassische Wirtschaftstheorie und hatte lange Zeit einen starken Einfluss auf die Führungspraxis. Führung bestand in diesem Verständnis darin, AnreizeAnreiz zu schaffen, die die Mitarbeitenden zu bestimmten Handlungen motivieren sollten. GeldprämienGeldprämie, BonusprogrammeBonusprogramm und andere finanzielle AnreizeFinanzieller Anreiz dominierten das Führungsverständnis.
Doch dieses Bild vom Homo oeconomicus geriet zunehmend in die Kritik. Psychologische und soziologische Studien zeigten, dass Menschen nicht nur durch extrinsische AnreizeExtrinsische Motivation wie Geld motiviert werden, sondern auch durch intrinsische Faktoren wie SinnSinnMeaningSinn, AnerkennungAnerkennung und persönliche EntwicklungMitarbeiter entwickelnPersonalentwicklungMitarbeiter entwickeln. Dies führte zu einem Umdenken in der Führungspraxis und zur Suche nach einem Menschenbild, das den komplexen Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht wird.
Vom Self-Actualizing Man zum Complex Man
Self-Actualizing ManComplex ManIn den 1960er- und 1970er-Jahren etablierte sich das Konzept des Self-Actualizing ManSelf-Actualizing Man. Es basiert auf den Arbeiten von Psychologen wie Abraham Maslow, der in seiner berühmten BedürfnispyramideBedürfnispyramideBedürfnispyramide die SelbstverwirklichungSelbstverwirklichung als höchste Stufe der menschlichen MotivationMotivation beschrieb (Maslow, 1943). In diesem Menschenbild steht die persönliche EntwicklungMitarbeiter entwickeln im Vordergrund. Der Mensch strebt danach, sein volles PotenzialPotenzial auszuschöpfen und sich selbst zu verwirklichen.
Diese Entwicklung wurde durch den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Individualität und Vielfalt unterstützt. In einer zunehmend globalisierten Welt wurden kulturelle Unterschiede und individuelle Lebensentwürfe stärker wahrgenommen und anerkannt. Menschen wollten nicht mehr nur arbeiten, um zu leben, sondern in ihrer Arbeit auch Sinn finden und ihre Stärken einbringen. Die Generationen YGeneration Y und ZGeneration Z fordern genau das: FreiheitFreiheit, Selbstverwirklichung und die Möglichkeit, das zu tun, was ihnen wirklich wichtig ist.
Doch dieses Menschenbild wird in der heutigen Arbeitswelt durch ein noch komplexeres Bild ergänzt – den Complex ManComplex Man. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Mensch nicht nur ein rationales Wesen ist, das klaren Regeln folgt, sondern auch eines, das von unzähligen Einflüssen geprägt ist. Jeder Mensch ist das Produkt seiner Erfahrungen, seiner sozialen Beziehungen und seiner biologischen Grundlagen. Auf seiner inneren »Festplatte« sind zahlreiche Prägungen, Erlebnisse und Werte gespeichert, die sein Verhalten in der Gegenwart beeinflussen.
Die Führung der Zukunft: Individuell, situativ und sinnorientiert
Die Veränderungen im Menschenbild zeigen, dass klassische Führungsmodelle, die auf dem Homo oeconomicus basieren, zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Führungskräfte sind heute gefordert, ihre Mitarbeitenden nicht mehr nur als Human ResourcesHuman Resource zu sehen, die es zu optimieren gilt, sondern als einzigartige Individuen mit eigenen Stärken, Motiven und Bedürfnissen. Die Kunst der Führung besteht darin, diesen komplexen und vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden.
Situative, individuelle Führung und eine starke Sinnorientierung sind dabei zentrale Elemente. Es geht nicht nur darum, die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu erkennen, sondern auch darum, ihnen ein inspirierendes Ziel zu bieten, das über rein materielle Anreize hinausgeht. Führungskräfte müssen in der Lage sein, die Komplexität der heutigen Arbeitswelt zu verstehen und mit den individuellen Prägungen ihrer Mitarbeitenden umzugehen.
3.2 Die Mythen über New Work
Mythen über New WorkIn den letzten Jahren hat der Begriff »New Work« eine enorme Popularität erlangt. Dabei hat sich rund um dieses Konzept eine Vielzahl an Mythen und Missverständnissen gebildet. Diese Mythen beeinflussen das Verständnis von New Work oft in eine Richtung, die den eigentlichen Kern verwässert. Unternehmen, die sich auf die Oberflächenaspekte dieser Mythen verlassen, setzen ihre Zukunftsfähigkeit aufs Spiel.
Mythos 1: New Work bedeutet weniger Arbeit und mehr Freizeit
Eine weitverbreitete Annahme ist, dass New Work vor allem auf mehr Freizeit, flexible Arbeitszeiten, die Viertagewoche oder die Möglichkeit des Homeoffice abzielt. Während Flexibilität ein Bestandteil von New Work sein kann, ist sie nicht das eigentliche Ziel. Bei New Work geht es vielmehr um eine tiefere Veränderung der Arbeitswelt, bei der die Menschen mit ihren Bedürfnissen stärker in den Fokus rücken und ihre Arbeit sinnvoller gestalten können. Der Mythos, dass es lediglich um ein Mehr an Freizeit und ein Weniger an Arbeit geht, greift viel zu kurz.
New Work
Tatsächlich geht es bei New Work um eine Neuausrichtung, bei der Arbeit zu einer Quelle der Selbstverwirklichung und nicht zu einem notwendigen Übel wird.
Mythos 2: New Work ist Homeoffice und digitale Tools
HomeofficeSeit der Pandemie hat das Homeoffice einen enormen Schub erlebt und viele Unternehmen haben dies als Synonym für New Work verstanden. Doch New Work ist weit mehr als die Ausstattung der Mitarbeitenden mit Laptops und digitalen Tools. Es geht um die Schaffung einer Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Selbstverantwortung basiert. Ohne diesen kulturellen Wandel bleibt New Work eine leere Hülle – unabhängig davon, wie modern die technischen Mittel sind.
Mythos 3: New Work ist eine Modeerscheinung
Ein weiteres Missverständnis ist die Auffassung, New Work sei ein kurzfristiger Trend, der bald wieder abebben wird. Tatsächlich aber ist es eine tiefgreifende Veränderung der Arbeitswelt, die sich aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen ergibt. Unternehmen, die glauben, es handele sich um eine vorübergehende Erscheinung, laufen Gefahr, die Dringlichkeit des Wandels zu unterschätzen und langfristig den Anschluss zu verlieren.
Mythos 4: New Work funktioniert nur in bestimmten Branchen
Ein häufiger Einwand lautet, dass New Work nur in bestimmten Bereichen wie IT, Marketing oder in kreativen Berufen umsetzbar sei. Dies führt oft dazu, dass traditionelle Branchen wie das produzierende Gewerbe, die Logistik oder der Handel New Work als nicht relevant für ihre eigenen Strukturen abtun. Dabei wird übersehen, dass New Work weniger eine Frage der Branche als vielmehr eine Frage der Haltung ist. Es geht um die Veränderung der Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten und was Arbeit für sie bedeutet.
New Work für unterschiedliche Branchen »übersetzen«
Die Frage ist nicht, ob New Work in einer Branche funktioniert, sondern wie es in spezifische Kontexte übersetzt werden kann.
Mythos 5: New Work ist ein Selbstläufer
Manche Unternehmen und Führungskräfte glauben, New Work bedeute einfach, ein paar Regeln zu ändern, und dann geschehen die Veränderungen automatisch. Doch diese Annahme verkennt die Komplexität eines tiefgreifenden Kulturwandels. Es reicht nicht, Rahmenbedingungen zu schaffen – die Menschen müssen auf diesem Weg aktiv mitgenommen werden. Führungskräfte sind gefordert, einen Wandel im Denken, Handeln und in der Zusammenarbeit zu gestalten und vorzuleben. Ohne ein aktives Engagement der Führungsebene und klare Kommunikation droht das Konzept von New Work zu scheitern.
Zusammenfassung
Die Mythen rund um New Work zeigen, dass es nicht ausreicht, einzelne Maßnahmen umzusetzen oder oberflächliche Veränderungen einzuleiten. New Work erfordert eine tiefgreifende Transformation der gesamten Unternehmenskultur, der Führung und des Verständnisses von Arbeit. Wer New Work nur als Ansammlung von modernen Arbeitsmethoden und Incentives versteht, läuft Gefahr, den wirklichen Kern des Konzepts zu übersehen, und scheitert an den oberflächlichen Anpassungen.
3.3 Die wahre Essenz von New Work
Die wahre Essenz von New Work liegt in der grundlegenden Neuausrichtung dessen, was Arbeit bedeutet und welchen Stellenwert sie für den Einzelnen und die Gesellschaft hat. Während sich viele Diskussionen auf technische und organisatorische Aspekte konzentrieren, geht es bei New Work im Kern um ein tiefgreifendes Verständnis von FreiheitFreiheit, SelbstverwirklichungSelbstverwirklichung und einer neuen Art der ZusammenarbeitZusammenarbeit. Diese neue Perspektive geht weit über flexible ArbeitszeitenFlexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder moderne Arbeitsräume hinaus.
Arbeit als Ausdruck der eigenen Stärken und Leidenschaften
New Work stellt die Frage »Was willst du wirklich, wirklich tun?« in den Mittelpunkt (Bergmann, 2004, S. 121 ff.). Diese Frage, geprägt von Frithjof Bergmann, ist eine Aufforderung an jeden Einzelnen, sich mit den eigenen Stärken und Leidenschaften auseinanderzusetzen. Ziel ist es, eine Tätigkeit zu finden, die nicht nur der eigenen Existenzsicherung dient, sondern die Quelle von Sinn und Erfüllung ist. Dies setzt voraus, dass Unternehmen und Führungskräfte Rahmenbedingungen schaffen, in denen Mitarbeitende ihre Fähigkeiten und Talente frei entfalten können. Es bedeutet, den Menschen als einzigartiges Individuum wahrzunehmen, dessen Potenzial gefördert werden muss.
Freiheit und Selbstverantwortung
Ein zentrales Element von New Work ist die zunehmende FreiheitFreiheit, die Mitarbeitende in ihrer Arbeitsgestaltung erhalten. Diese Freiheit geht Hand in Hand mit einem hohen Maß an SelbstverantwortungSelbstverantwortung. Es ist die Abkehr von der alten Vorstellung, dass Führungskräfte ständig kontrollieren und überwachen müssen. Stattdessen entsteht eine Kultur des VertrauensVertrauen, in der Mitarbeitende in der Lage sind, ihre Aufgaben selbstständig zu organisieren und Verantwortung für ihre Ergebnisse zu übernehmen. Dies erfordert jedoch von Führungskräften eine deutliche Veränderung ihrer Rolle – weg von der klassischen Kontrollfunktion hin zu einer unterstützenden und inspirierenden Haltung.
Sinn und gemeinsames Anliegen
Ein weiteres wesentliches Merkmal von New Work ist die SinnhaftigkeitSinnhaftigkeit der Arbeit. Menschen sind heute immer weniger bereit, ihre Zeit und Energie in Aufgaben zu investieren, die für sie keinen erkennbaren Sinn haben. New Work betont die Notwendigkeit, dass sowohl Mitarbeitende als auch Unternehmen ein klares, gemeinsames Anliegen verfolgen, das mehr umfasst als rein wirtschaftliche Ziele. Dieses Anliegen gibt den Mitarbeitenden Orientierung und eine tiefe innere Motivation, die weit über materielle Anreize hinausgeht. Unternehmen, die ein gemeinsames Anliegen erfolgreich kommunizieren, schaffen eine starke Identifikation und eine gemeinsame Basis für Engagement und Zusammenhalt.
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
New Work bedeutet auch eine neue Art der ZusammenarbeitZusammenarbeit. HierarchienHierarchie verlieren an Bedeutung, stattdessen rückt die Zusammenarbeit auf Augenhöhe in den Fokus. In der Praxis bedeutet dies, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden nicht mehr als bloße Ausführende sehen, sondern als gleichwertige Partner im gemeinsamen Streben nach Erfolg. Entscheidungen werden nicht von oben herab getroffen, sondern im Dialog mit denjenigen, die die Arbeit ausführen. Diese Art der Zusammenarbeit schafft nicht nur mehr Autonomie, sondern führt auch zu innovativeren und nachhaltigeren Lösungen.
Kontinuierliches Lernen und Entwicklung
Ein weiteres wesentliches Element von New Work ist das kontinuierliche LernenLernen und die persönliche WeiterentwicklungWeiterentwicklung. In einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt ist es entscheidend, dass Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich ständig weiterzuentwickeln und neue FähigkeitenFähigkeiten zu erlangen. Unternehmen, die dies fördern, schaffen eine Kultur des Wachstums und der Flexibilität, die es den Mitarbeitenden ermöglicht, sich immer wieder erfolgreich neuen Herausforderungen zu stellenHerausforderung. Dies erfordert jedoch nicht nur die Bereitstellung von Lernangeboten, sondern auch die Bereitschaft der Führungskräfte, aktiv als Mentoren und Unterstützer aufzutreten. Und natürlich schauen die Mitarbeitenden auf Sie: Wie stellen Sie kontinuierliches Lernen und Ihre eigene Entwicklung sicher?
3.4 Transformation zu New Leadership
Die TransformationTransformation zu New LeadershipNew Leadership ist die logische Konsequenz aus den veränderten Anforderungen der Arbeitswelt und den neuen Erwartungen an Führung. Während klassische Führungsmodelle oft noch in hierarchischen Strukturen verankert sind, setzt New Leadership auf ein Führungsverständnis, das Menschen in den Mittelpunkt stellt, ihr Potenzial erkennt und freisetzt sowie eine inspirierende Vision verfolgt.
Von der Kontrolle zur Inspiration
Die klassische Vorstellung von Führung basierte lange Zeit auf KontrolleKontrollieren und Autorität. Führungskräfte sollten Regeln setzen, überwachen und für die Einhaltung der Abläufe sorgen. Doch in einer New-Work-Welt, die von SelbstverantwortungSelbstverantwortung, Flexibilität und Sinnhaftigkeit geprägt ist, genügt diese Herangehensweise nicht mehr. New Leadership bedeutet, Kontrolle loszulassen und stattdessen die Rolle des Coaches und Mentors einzunehmen. Moderne Führungskräfte inspirieren ihre Mitarbeitenden durch eine klare Vision und ein gemeinsames Anliegen. Sie schaffen einen Rahmen, in dem Vertrauen und EigenverantwortungEigenverantwortung wachsen, und legen dabei den Fokus auf Entwicklung statt auf Kontrolle. Der Wandel von der Führungskraft zum CoachFührungskraft als Coach ermöglicht es, die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden zu stärken und sie zu motivieren, eigenverantwortlich und kreativ zu arbeiten.
Vom Chef zum Ermöglicher
Bei New Leadership geht es weniger darum, Anweisungen zu geben, sondern vielmehr darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Mitarbeitende aufblühen und sich entfalten können. Führungskräfte werden zu ErmöglichernFührungskraft als Ermöglicher, die dafür sorgen, dass ihre Teams Zugang zu den notwendigen Ressourcen, Informationen und Netzwerken haben, um erfolgreich zu sein. Sie unterstützen ihre Mitarbeitenden dabei, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, und fördern eine offene Kommunikationskultur.
Dieser Wandel setzt voraus, dass Führungskräfte eine neue Haltung einnehmen: weg vom Allwissenden hin zum Lernenden. Es ist die Bereitschaft erforderlich, auch eigene Unsicherheiten zuzulassen und eine Fehlerkultur zu etablieren, die das Wachstum der Mitarbeitenden fördert. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem Kreativität, Mut und Innovationskraft gedeihen.
Führen mit emotionaler Intelligenz
Eine entscheidende Komponente von New Leadership ist die emotionale IntelligenzEmotionale Intelligenz. Führungskräfte müssen in der Lage sein, nicht nur die eigenen EmotionenEmotion wahrzunehmen, zu reflektieren und zu steuern, sondern auch die Bedürfnisse und Gefühle ihrer Mitarbeitenden zu sehen und einfühlsam darauf zu reagieren. In einer Arbeitswelt, die von komplexen Herausforderungen und schnellem Wandel geprägt ist, wird emotionale Intelligenz zur Schlüsselkompetenz. Es geht darum, Empathie zu zeigen, die unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen der Mitarbeitenden zu erkennen und authentisch darauf einzugehen. Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden emotional erreichen und echte VerbundenheitVerbundenheitZugehörigkeitVerbundenheit schaffen, erzeugen eine deutlich höhere Motivation und Leistungsbereitschaft.
Partizipation und Stärkenorientierung
New Leadership bedeutet auch, Mitarbeitende aktiv einzubinden und ihre Stärken zu fördern. Statt EntscheidungenEntscheiden von oben herab zu treffen, sollen Führungskräfte Räume für PartizipationPartizipation schaffen, in denen Mitarbeitende ihre Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen können. Diese Beteiligung stärkt nicht nur das Engagement, sondern führt auch zu besseren Entscheidungen und innovativeren Lösungen.
Zudem basiert New Leadership auf einer stärkenorientierten Haltung. Führungskräfte konzentrieren sich darauf, die individuellen Stärken ihrer Mitarbeitenden zu erkennen und gezielt einzusetzen. Diese FokussierungFokussierung auf PotenzialePotenzial statt auf DefiziteDefizite ermöglicht es, eine Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung zu schaffen, die langfristig zu mehr Leistung und Zufriedenheit führt. Im Übrigen stärkt dies auch die Gesundheit und Resilienz der Mitarbeitenden.
Die Rolle der Führungskraft neu denken
Die Transformation zu New Leadership erfordert einen ParadigmenwechselParadigmenwechsel im Führungsverständnis. Es geht darum, die Rolle der Führungskraft nicht als Machthaber, sondern als Gestalter und Begleiter zu verstehen. Diese Veränderung beginnt bei der eigenen Haltung und setzt voraus, dass Führungskräfte bereit sind, Verantwortung abzugeben und eine neue Art der Führung zu leben. Dabei gilt es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende sich sicher fühlen, Risiken einzugehen, eigene Ideen zu verfolgen und Verantwortung zu übernehmen. Führung wird damit zur Schlüsselfunktion, die nicht nur für Ergebnisse, sondern vor allem für die Entwicklung der Mitarbeitenden verantwortlich ist.
Bodo JanssenJansen, Bodo betont seit Jahren die neue Rolle der Führungskraft und sagt: »Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg« (Janssen, 2022). Damit wird deutlich, dass die Zeit von Macht, Unantastbarkeit und übergroßem Ego vorbei ist. Die Rolle der Führungskraft ist es, Mitarbeitenden Orientierung zu geben und in ihnen das zu wecken, was möglich ist – und das ist meist mehr, als sie selbst von sich glauben.
3.5 Der Übergang zur Neurologischen Führung
Neurologische FührungDie Einführung von New Work und die daraus entstehende Veränderung im Führungsverständnis erfordert einen nächsten entscheidenden Schritt: den Übergang zur Neurologischen Führung. Denn während New Leadership bereits wesentliche Elemente wie emotionale Intelligenz, Stärkenorientierung und Partizipation integriert, bietet die Neurologische Führung eine wissenschaftlich fundierte Grundlage, um diese Prinzipien gezielt zu vertiefen und die Wirksamkeit von Führung zu steigern.
Die Wissenschaft hinter der Neurologischen Führung
Der zentrale Unterschied zu klassischen Führungsansätzen liegt in der wissenschaftlichen Fundierung. Neurologische Führung stützt sich auf moderne Erkenntnisse aus der NeurobiologieNeurobiologie, der positiven PsychologiePositive Psychologie und der Verhaltensforschung. Dabei wird das menschliche Gehirn nicht mehr nur als Black Box betrachtet, sondern als zentrales Steuerungsorgan für Entscheidungen, Emotionen und Verhaltensweisen. Die neuesten neurowissenschaftlichen Studien zeigen, wie eng Führung und Gehirnfunktionen miteinander verbunden sind. Führungskräfte beeinflussen nicht nur das Verhalten ihrer Mitarbeitenden, sondern auch die neuronalen Prozesse, die Motivation, Bindung und Engagement auslösen. Mit diesem Wissen können Führungskräfte gezielter und wirksamer Einfluss nehmen und ihr eigenes Verhalten reflektieren und anpassen.
Vom Verständnis zur Praxis: Neurologische Führung anwenden
Während klassische Führungsmodelle auf einem mechanistischen Verständnis von MotivationMotivation und Verhaltenssteuerung basieren, zielt Neurologische Führung darauf ab, das Verständnis von Führung radikal zu vertiefen. Es reicht nicht aus, lediglich Anweisungen zu geben oder Mitarbeitende durch extrinsische Anreize zu motivieren. Neuro