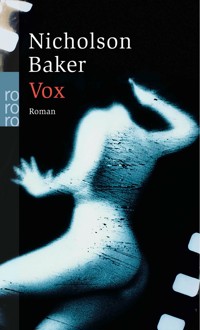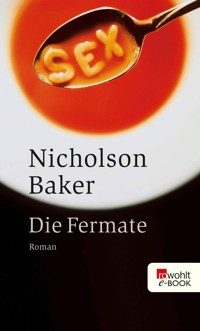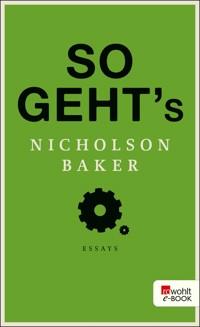9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Hallo, meine kleinen Vögelchen. Ich heiße Paul Chowder, und ich sitze hier im blendenden Mittagslicht neben dem Hühnerstall und erzähle euch von den Dingen, von denen erzählt werden muss. Ihr wisst schon: Liebe, Ruhm, das Nichts, versunkene Kathedralen und das selbstfahrende Regenmobil von Sears.» Paul ist Dichter (mäßig erfolgreich), und er vermisst seine Exfreundin Roz, die ihn verlassen hat. «Die Versunkene Kathedrale» ist von seinem Lieblingskomponisten Debussy, er hat sie einst als Junge auf dem Fagott gespielt. Das, leider, hat er längst verkauft. Um seinem Leben wieder Sinn zu geben und seinen drohenden Fünfundfünfzigsten zu vergessen, besorgt er sich eine akustische Gitarre und sattelt auf Pop- und, vor allem, Protestsongs um. Er weiß nicht, was ihm mehr zuwider ist: Amerikas Drohnenkrieg oder Roz' neuer Freund. Während er auf seinem alten Bauernhof in Maine darüber nachdenkt, erheitern allerlei tröstliche Alltagsvergnügen sein schwankendes Gemüt: sein Traum-Rasensprenger, die Saiten seines Eierschneiders, die einen fast perfekten Mollakkord ergeben, ein Workoutprogramm mit Pfiff sowie einige Experimente mit Tabak … «Das Regenmobil» ist ein bezaubernder Monolog, gespickt mit musikalischen Referenzen von Debussy über Tracy Chapman bis hin zu Paul selbst, vorgetragen mit dem typischen sanften Baker'schen Humor und gewürzt mit den dezenten Lehren jener praktischen Alltagsphilosophie, die Bakers großer menschlicher Weisheit entspringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Nicholson Baker
Das Regenmobil
Roman
Über dieses Buch
«Hallo, meine kleinen Vögelchen. Ich heiße Paul Chowder, und ich sitze hier im blendenden Mittagslicht neben dem Hühnerstall und erzähle euch von den Dingen, von denen erzählt werden muss. Ihr wisst schon: Liebe, Ruhm, das Nichts, versunkene Kathedralen und das selbstfahrende Regenmobil von Sears.»
Paul ist Dichter (mäßig erfolgreich), und er vermisst seine Exfreundin Roz, die ihn verlassen hat. «Die Versunkene Kathedrale» ist von seinem Lieblingskomponisten Debussy, er hat sie einst als Junge auf dem Fagott gespielt. Das, leider, hat er längst verkauft. Um seinem Leben wieder Sinn zu geben und seinen drohenden Fünfundfünfzigsten zu vergessen, besorgt er sich eine akustische Gitarre und sattelt auf Pop- und, vor allem, Protestsongs um. Er weiß nicht, was ihm mehr zuwider ist: Amerikas Drohnenkrieg oder Roz' neuer Freund. Während er auf seinem alten Bauernhof in Maine darüber nachdenkt, erheitern allerlei tröstliche Alltagsvergnügen sein schwankendes Gemüt: sein Traum-Rasensprenger, die Saiten seines Eierschneiders, die einen fast perfekten Mollakkord ergeben, ein Workoutprogramm mit Pfiff sowie einige Experimente mit Tabak …
«Das Regenmobil» ist ein bezaubernder Monolog, gespickt mit musikalischen Referenzen von Debussy über Tracy Chapman bis hin zu Paul selbst, vorgetragen mit dem typischen sanften Baker’schen Humor und gewürzt mit den dezenten Lehren jener praktischen Alltagsphilosophie, die Bakers großer menschlicher Weisheit entspringt.
Vita
Nicholson Baker wurde 1957 in Rochester, New York, geboren. Er studierte u.a. an der Eastman School of Music und lebt heute in South Berwick, Maine. Er hat zahlreiche Romane und Sachbücher veröffentlicht. 1997 erhielt er den Madison Freedom of Information Award, 2001 den National Book Critics Circle Award für «Der Eckenknick», 2014, zusammen mit seinem Übersetzer, den Internationalen Hermann-Hesse-Preis. Zuletzt erschienen von ihm «Eine Schachtel Streichhölzer», «Menschenrauch», «Haus der Löcher» und die Essaysammlung «So geht’s».
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
«Traveling Sprinkler» bei Penguin Group, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Traveling Sprinkler» Copyright © 2013 by Nicholson Baker
Umschlaggestaltung ANZINGER/WÜSCHNER/RASP, München
ISBN 978-3-644-03631-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
einunddreißig
zweiunddreißig
dreiunddreißig
vierunddreißig
fünfunddreißig
Anhangtexte
Für M.
eins
Rosslyn rief an, um mich zu fragen, was ich gern zum fünfundfünfzigsten Geburtstag hätte. Einer ihrer vielen Vorzüge ist es, dass sie sich Geburtstage merken kann. Ich überlegte kurz. Ich wusste, was ich wollte: Ich wollte eine billige Akustikgitarre. Bei Best Buy kriegt man welche schon für rund siebzig Dollar. Sie sind in einem tollen Pappkarton. Als ich das letzte Mal dort war, habe ich zwei Kartons gesehen, die an der Wand lehnten und warteten. Fast hätte ich gesagt, dass ich gern so eine hätte – ich war schon gefährlich nah dran –, aber dann habe ich es doch nicht gesagt, denn man kann seine ehemalige Freundin wohl schlecht um eine Gitarre bitten, auch nicht um eine billige. Es ist ein zu bedeutsames Geschenk. Es setzt zu viel voraus. Es bringt sie in eine heikle Lage. Und «Am liebsten hätte ich dich wieder» kann man natürlich auch nicht sagen.
Stattdessen sagte ich also: «Ich glaube, am liebsten hätte ich ein Eiersalatsandwich.» Rosslyn macht einen ganz besonderen Eiersalat – sie tut eine seltene Paprikasorte und Estragon oder sonst ein abseitiges Gewürz dazu, das ich nicht kenne. «Wir könnten uns am Fort McClary treffen», sagte ich. «Wenn du die Eiersalatsandwiches machst, bringe ich den Picknickkorb und die geschnittenen Möhren mit.»
Früher waren wir manchmal beim Fort McClary, um den Seetang zu riechen und uns die Boote anzuschauen. Ich glaube, dort hat der Unabhängigkeitskrieg angefangen, aber genau weiß ich es nicht. Im Gras liegen riesige behauene, Stonehenge-artige Steine herum, die mal Teil eines Verteidigungswalls werden sollten, der aber nie gebaut wurde. Ich glaube, Paul Revere ritt mit seinem armen, schnaubenden Pferd den ganzen Weg bis Fort McClary, um Bescheid zu sagen, dass die Briten kommen, was der Beginn eines sinnlosen Handelskriegs war, der gar nicht hätte sein müssen.
Rosslyn schwieg einen Augenblick.
«Oder», sagte ich, «falls ein Picknick zu aufwendig ist, könnten wir einfach im Friendly Toast zu Mittag essen.»
«Nein, nein, ich kann dir auf jeden Fall ein Eiersalatsandwich machen», sagte sie. Ich hörte regelrecht, wie sie nachsichtig lächelte, wie eine, die jemanden mal vor langer Zeit geliebt hat.
Wir vereinbarten, uns am Fort McClary zu treffen und ein Geburtstagspicknick zu machen.
Heute Morgen hatte ich einen literarischen Traum. Rosslyn lebte noch mit mir zusammen, und ich sollte ein Buch mit militärischen Rezepten namens Gulaschkanone: Tolle Gerichte aus Armeeküchen besprechen. Rosslyn und ich testeten eines der Rezepte, und zwar für Tintenfisch-Walnuss-Muffins. Rosslyn zog das Blech mit den Muffins aus dem Backofen, und ich biss in einen hinein. «Wie schmeckt er?», fragte sie.
«Nicht besonders», sagte ich.
«Das überrascht mich nicht», sagte sie. Wir überlegten kopfschüttelnd, wie ich was Nettes über das Kochbuch sagen könnte.
«Vielleicht kannst du ja die Walnüsse loben?», sagte Rosslyn.
Da wachte ich auf.
Ich parke in der Inigo Road, meiner absoluten Lieblingsstraße. Ich wünschte, ich könnte etwas über die Wendung «glückliche Wendung» schreiben, aber dafür ist keine Zeit. Sehr bald werde ich fünfundfuckingfünfzig. Die fünf Fs. Vor zehn Jahren gab’s mal drei f-Laute, aber diesmal ist es definitiv schlimmer. Wenn man nicht gerade Yeats oder Merwin heißt, ist man als Dichter mit fünfundfünfzig weg vom Fenster. Mit fünfundfünfzig war Dylan Thomas schon sechzehn Jahre unter der Erde. Keats war mit, wie viel?, sechsundzwanzig?, tot. Ritt durch die Gegend und hustete sich das Blut aus seinen traurigen Lungen. Und Wilfred Owen erst.
Als ich zum ersten Mal Keats Sonett «Wenn Angst mich fasst» las, aß ich gerade ein Thunfisch-Jumbo. Ich studierte angewandte Musik mit Schwerpunkt Fagott. Ich hatte das Gedicht in der Norton Anthology of Poetry gefunden – die kürzere schwarze Ausgabe mit dem Blake-Aquarell eines Greifs auf dem Umschlag. Ich hielt die Norton mit meinem braunen Plastiktablett aufgeschlagen und fing an zu lesen, wobei ich das Thunfisch-Baguette aß und ab und zu einen Schluck V8-Gemüsesaft aus einer kleinen Dose trank.
Keats sagt: «Wenn Angst mich fasst, ich hörte auf zu sein». Er sagte nicht: «Wenn ich Angst habe, ich könnte», hm, «tot umfallen» oder «mein Leben aushauchen» – nein, es heißt: «hörte auf zu sein». Ich hörte auf zu kauen. Mich packte die Leere und Unfassbarkeit in dieser Wendung. Und dann kam die nächste Zeile, und ich machte ein kleines, verblüfftes Hm. «Wenn Angst mich fasst, ich hörte auf zu sein», sagt Keats, «Bevor die Feder noch hat eingebracht / Die Ernte meines Geists …».
Ich möchte ja nicht behaupten, dass die Cafeteria sich drehte. Sie regte sich nicht. Ich hörte das mahlende Geräusch der druckenden Registrierkasse. Aber ich dachte sehr angestrengt nach. Ich dachte an einen großen Schildkrötenpanzer, den mir jemand geschenkt hatte, als ich noch klein war. Auf der Innenseite war eine Art mittig verschmolzene Wirbelsäule. Dieser Knochengrat stank fürchterlich, wenn man aus der Nähe daran roch, auf normale Entfernung war er allerdings geruchlos. Ich stellte mir den Schildkrötenpanzer als ein menschliches Schädeldach vor und auch, wie Keats’ Feder Bröckchen Gedankenfleisch daraus einbrachte.
Die Feder ist ja das einzige Werkzeug, das scharf genug ist, um die Arbeit des Ernteeinbringens ordentlich zu erledigen. Keats wusste das. Er hatte eine medizinische Ausbildung. Er sollte Arzt werden. Er mochte das Medizinstudium nicht besonders, aber er assistierte bei Operationen. Die Vorstellung des Kopfinneren als eines Gegenstandes mit Spalten und Verstecken – dass es dort etwas einzubringen gab –, das kannte er aus erster Hand. Und er wusste auch, denn er war ein kranker Mann, dass seine Ängste begründet waren. Seine Mutter starb an Schwindsucht. Er war ein vierzehnjähriger Junge, als er nachts aufblieb und ihr zusah, wie sie starb. Er wusste, was es bedeutete, wenn das Dasein eines komplizierten, sanften Menschen einfach so aufhörte zu sein. Und sein Gehirn war übervoll von der Ungeschriebenheit dessen, was er zu sagen hatte. Er musste sich beeilen. Das alles wusste er.
Der Rest des Gedichts ist nicht annähernd so gut, aber es endet mit einem Knaller: «Bis Ruhm und Liebe in ein Nichts zerfällt.»
Ich habe die Liste mit den Dingen, über die ich heute schreiben wollte, nicht dabei. Manchmal notiere ich mir Dinge, über die ich schreiben will, auf ein gefaltetes Blatt Papier, aber das habe ich im Bett liegen lassen. Es ist ein leeres Bett. Es wird wohl einer meiner Leeres-Bett-Geburtstage. Davon hatte ich so einige.
Aber ein Geburtstag im Sommer ist was Gutes. Auf dem Ast bei meinem Auto, auf jedem Zweig, der nicht tot ist, tut sich eine Menge. In den Bäumen steht der Saft, und den Blättern bleibt gar keine andere Wahl, als auszutreiben. Milliarden Knospen an jedem Baum, die Blätter entfalten sich zitternd, dängen nach draußen. Eine Zwangsmigration. Der Saft steht unter Druck, und die Blätter müssen von den Enden der Zweige nach draußen fliehen. Damit entsteht über der ganzen Inigo Road ein grüner Dunst.
Ich habe einfach auf den Sommer gewartet, gewartet und ihn gewollt, und nun ist er da. Gestern war es sogar heiß, und heute habe ich in die Ecke meines Computerbildschirms einen Post-it-Zettel geklebt: KEINEN YUKON JACK, BIS DU FERTIG BIST. I need a new drug. Das hat Huey Lewis gesungen und war dann so dumm, Ray Parker Jr. zu verklagen, weil der die Bassline für den Titelsong von Ghostbusters geklaut haben soll.
Ich überlege hin und her, ob ich mir eine Dose Skoal rauchlosen Tabak kaufen soll.
Drei schnelle Abschiedsgläschen Yukon Jack. O Gott verdammt. Jetzt tief durchatmen. Hallo, meine wunderlichen Hirngespinste, ich bin Paul Chowder. Ich bin hier und ihr auch. Wir sind im selben Minkowski-Raum, der die Form eines Sattels hat. Ihr seid im Sattel, ich bin im Sattel, und wir fallen auch nicht von Reveres Pferd, weil es das gar nicht gibt.
Meine Knie lachen. Ist das erlaubt?
Hier mein Tipp zur Nacht. Nicken. Manchmal lohnt es sich zu nicken. Einfach heftig nicken. So geht das also? Okay, nicken, ja. Nicken üben.
Vor fünfunddreißig Jahren, da war ich zwanzig, habe ich mein Heckel-Fagott verkauft. Das war’s dann. Jetzt soll ich einen neuen Gedichtband schreiben, den ich Kummermütze nenne. Ich will nicht daran arbeiten. Heute habe ich zur Anregung in ein extrem langes Gedicht von Samuel Rogers namens Human Life reingeschaut, weil mir der Titel gefiel. Es hat mir nicht besonders viel gebracht, aber mir ist wieder eingefallen, dass Samuel Rogers mit Tennyson und Coleridge befreundet war, und deswegen habe ich dann auch meine alte Tennyson-Ausgabe hervorgeholt und mir sein extrem langes Gedicht Maud angesehen, erzählt von einem weitschweifigen Gestörten. Tennyson war, als er Maud schrieb, sehr krank, wenn nicht klinisch verrückt, und einiges davon ist unlesbar. Aber eine sehr hübsche, hochfliegende Stelle gibt es, an die erinnert sich jeder. Sie beginnt so: «Komm in den Garten, Maud, / denn Nacht, die schwarze Fledermaus, ist los.» Da hat Tennyson uns erwischt. Die Nacht ist eine schwarze Fledermaus. Wie aufregend und unviktorianisch ist das denn? In derselben Passage ist die Rede von einer ungewöhnlichen Kammermusikgruppe, die anscheinend die ganze Nacht den Rosen ein Ständchen gebracht hat – eine Flöte, eine Geige und ein bassoon – ein Fagott eben. Es ist ein Fagott, nicht weil Tennyson Ahnung vom Fagott gehabt hätte, sondern weil er ein ausdrucksstarkes Wort brauchte, das sich auf tune und moon reimt. Und auch, weil er sich vielleicht an eine andere poetische Fagott-Passage erinnerte, aus Coleridges Der alte Matrose:
Da tönt von fern das laute Fagott:
Vom Sitz fährt auf der Gast.
Auch Coleridge hatte keine Ahnung vom Fagott, sonst hätte er es nicht als laut bezeichnet. Die Bürde des Fagotts als Orchesterinstrument ist, dass es recht leise ist, viel leiser im Volumen, als seine Größe vermuten lässt. Bei einer Hochzeit im Jahr 1797, als Coleridge an seinem Gedicht arbeitete, hätte es eventuell benutzt werden können, um zusammen mit dem Spinett oder dem Cello die Basslinie zu spielen. Aber Fagottisten auf der ganzen Welt sind Coleridge dankbar, dass er sie in seine Strophe aufgenommen hat.
Charles Darwin wusste über das Fagott ein klein wenig mehr als Coleridge oder Tennyson. Als er alt und traurig war, bat er seinen Sohn, einem Haufen Regenwürmer etwas auf dem Fagott vorzuspielen, um ihre Reaktion auf leise Klänge zu studieren. Auch spielte er ihnen etwas auf der Blechflöte vor, hämmerte auf einem Klavier herum und schrie sie an. «Sie nahmen nicht die geringste Notiz», sagte Darwin. Es gibt auch ein Gedicht über die Vokale von John Gould Fletcher, einem der Imagisten. Der Buchstabe U klinge, so Fletcher, wie «heiße Fagotte und Flöten, die ruhelos brummen, / Schmetterlinge, Hummeln eine heiße Rose umsummen». Fletcher las die Heiße-Fagotte-Passage in London Amy Lowell vor, und später schrieb er eine Autobiographie mit dem Titel Life Is My Song. Noch später wurde er depressiv und ertränkte sich in einem kurz zuvor geschlämmten Teich in Little Rock, Arkansas, der keinen Meter tief war.
Dass ich mein Fagott verkauft habe, war einer meiner größten Fehler. Seitdem habe ich es schon tausendmal bereut. Und das Seltsame ist: Ich habe drei Gedichtbände geschrieben, aber noch nie ein Fagottgedicht. In keinem einzigen Gedicht habe ich das Wort «Fagott» verwendet. Kein Mal. Wahrscheinlich habe ich es mir aufgespart, was nicht immer eine gute Idee ist.
Nan, meine Nachbarin, hat mich gebeten, mich um ihre Hühner zu kümmern. Sie hat fünf Hennen plus einen schlaffschwänzigen Bantamhahn, der in dem Ruf steht, erbittert sein Revier zu verteidigen, wobei er sich mit mir immer gut verträgt, aber er starrt mich mit einem Auge misstrauisch an und kräht gehörig. Nan ist in Toronto, wo sie sich um ihre Mutter kümmert, der es nicht gut geht. Sie, Nan, war in letzter Zeit ein wenig eigenartig – abwesend und unnahbar. Das könnte daran liegen, dass sie sich Sorgen wegen ihrer Mom macht, ich glaube allerdings auch, dass ihr «Freund» Chuck vielleicht nicht mehr aktuell ist. Er wartet U-Boote, und in der Marinebasis Kittery gab es einen Brandanschlag, der an einem sehr schicken Atom-U-Boot Schäden von einer halben Milliarde Dollar anrichtete. Ein Arbeiter in der Basis gestand, das Feuer gelegt zu haben, weil er an dem Tag früher nach Hause wollte. So sieht es bei der Marine aus.
Ich muss die Hühner nur morgens rauslassen, damit sie den Tag über im Gras nach Kleinzeug picken können. Ich streue ihnen ein bisschen Maisschrot unter die Büsche, um ihnen zu einer besseren Pick-Quote zu verhelfen. Dann, wenn es langsam dunkel wird, warte ich darauf, dass sie eines nach dem anderen in ihren Schuppen laufen, und schließe die Tür. Man kann sie nicht hineintreiben, man muss eben warten, bis sie von allein reingehen. Ich habe mir angewöhnt, meinen weißen Plastikstuhl in Nans Garten mitzubringen und abzuwarten, bis sie ihren Tag abgeschlossen haben. Mache ich die Tür nicht zu, könnten die Hühner nachts von Waschbären oder Füchsen angefallen werden.
Ah, da laufen sie jetzt, eines nach dem anderen in ihr Gehege. Die Hennen sind groß, braun und flauschig, und ihr Hinterteil ist weiß von Hühnerkacke und vom Eierlegen. Der Hahn ist klein und schillert blau-schwarz. Wahrscheinlich paaren sie sich die ganze Nacht, keine Ahnung. An der Tür ist ein verblasstes Schild mit der Aufschrift «Jedes Vögelchen willkommen».
Der weiße Plastikstuhl ist bequem, aber nicht so bequem wie der Fahrersitz in meinem Auto. Neuerdings lebe ich praktisch in meinem Auto, und meistens tanke ich bei Irving Circle K. Ich mag Irving auch deshalb, weil da aus blechernen Lautsprechern bei der Zapfsäule Oldies laufen. Und auch, weil sie die kleinen Klicker in der Zapfpistole lassen, sodass man schon mal lostanken, reingehen und bei dem Mann an der Kasse, der aussieht, als hätte er einen gewaltigen Kater, eine Flasche Pellegrino-Wasser und einen Beutel Planter’s Nussmischung kaufen kann.
Heute ging ich bei Irving mit meinen Einkäufen zurück zum Wagen und wollte schon geistesabwesend losfahren, ohne die Zapfpistole aus dem Tank zu ziehen. Ich hörte ein Klacken, und als ich mich umdrehte, lag der Schlauch auf dem Boden, inmitten einer, wie es aussah, dunklen, sich ausbreitenden Benzinlache. Ich glaubte schon, ich hätte die Pistole abgerissen. Ich sagte: «O nein!», und stieg aus, und dann sah ich, dass mir nur die Schatten einen Streich gespielt hatten. Die Pistole war in Ordnung. Sie war aus dem Tank gerutscht und heruntergefallen, aber es gab keinerlei Anzeichen einer Beschädigung des Schlauchs und kein ausgelaufenes Benzin. Ich war zutiefst erleichtert. Ich fuhr los und sang dabei ein Lied, das ich einige Wochen davor bei einer Quäkerandacht gehört hatte; es heißt «How Can I Keep from Singing?». Einer der Ältesten bei der Andacht, Chase, hatte stumm dagestanden und dann gesagt, er denke an ein Lied, das Pete Seeger oft gesungen habe. Pete Seeger habe es von einer Sängerin namens Doris Plenn gehört, sagte Chase, die es wiederum von ihrer Großmutter gelernt habe. Und dann sang er es. Er war kein großer Sänger, aber das machte nichts. «My life flows on in an endless song», sang er. «Above earth’s lamentation.» Ich war so tief beeindruckt, dass ich es, als ich wieder zu Hause war, auf iTunes nachschaute und zwei Versionen von dem Lied kaufte, eine von Bruce Springsteen und eine von einer Gruppe namens Cordelia’s Dad, begleitet von langsamen Fiedelakkorden.
Vor langer Zeit waren die Quäker gegen Musik eingestellt – sie sagten, die Mühen, die es einen Musiker kostete, ein Instrument zu lernen, hielten ihn von lohnenderen Bestrebungen ab. Aber jetzt stehen sie manchmal bei ihren Versammlungen da und singen ein Lied.
Ich brauche wirklich eine Gitarre.
zwei
Ich ging mit meinem Freund Tim in einer Bäckerei in Waltham, die er mag, Mittag essen. Er unterrichtet an der Tufts. Er ist ein guter Kerl, und zurzeit ist er wahrhaft besessen von Killerdrohnen. Früher konnte er über nichts anderes als die Kriegsverbrechen Königin Viktorias sprechen, heute sind es die Predators und Reapers und der CIA-Chef der Drohnen, John Brennan. Tims neue Heldin ist Medea Benjamin von CODEPINK, die ein Buch mit dem Titel Drohnenkrieg – Tod aus heiterem Himmel herausgebracht hat. Tim ist gerade von einem Drohnengipfel in Washington zurückgekehrt, wo Medea und andere Anti-Drohnen-Leute Reden hielten. Er hatte mich gefragt, ob ich mitwolle, aber ich hatte abgelehnt – zu weit, zu aufwühlend, zu schrecklich, zu aktuell.
Während Tim und ich in der Bestellschlange standen, erzählte er mir, was passierte, als Medea Benjamin zu einer Gesprächsrunde mit John Brennan ging. Das war anscheinend ein ziemliches Ding. Tim zückte sein Handy und spielte mir ein YouTube-Video vor. Brennan spricht darüber, wie Al-Kaida Männer, Frauen und Kinder tötet, und da steht plötzlich Medea Benjamin auf und sagt: «Und was ist mit den Hunderten Unschuldiger, die wir in Pakistan, im Jemen, in Somalia mit unseren Drohnenschlägen töten? Ich spreche für diese unschuldigen Opfer.» Die Moderatorin versucht, sie zum Schweigen zu bringen, doch Medea lässt sich nicht beruhigen. Ein riesiger Mann in einem gelben POLIZEI-Hemd packt sie, hebt sie hoch und schleppt sie raus, wobei sie weiterhin laut über das Töten Unschuldiger, die Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit redet. Sie klammert sich an die Ausgangstür, versucht, im Raum zu bleiben, während der riesige gelbe Polizist mit dem rasierten Schädel an ihr zerrt, und sie sagt: «Ich liebe die Rechtsstaatlichkeit. Ich liebe mein Land. Sie geben uns weniger Sicherheit, indem Sie so viele Unschuldige auf der ganzen Welt töten, schämen Sie sich!» Und dann geht die Tür zu, und sie wird weggebracht. Brennan rückt das Mikrophon zurecht, sagt leise zu niemand Speziellem danke und fährt mit seinem Vortrag fort.
«Ist das zu glauben?», sagte Tim.
«Die hat schon was», sagte ich.
Wir erreichten den Anfang der Bestellschlange. «Nimm doch das Thunfisch-Artischocken-Sandwich», sagte er. «Wie der Laden hier auf seine Kosten kommt, ist mir ein Rätsel. Da sind neun Leute hinterm Tresen. Sie backen ihr eigenes Brot und machen phantastische Thunfisch-Artischocken-Sandwiches.»
Wir setzten uns nach draußen, und Tim fragte mich, was ich so machte. Ich sagte ihm, ich hätte ein paar Hühner gehütet und trinke keinen Yukon Jack mehr, weil er mir nicht bekomme und ich einen Gedichtband fertigstellen müsse. Ich sagte, ich überlegte, ob ich mal den rauchlosen Tabak von Skoal probieren solle.
«Du meinst, die kleinen Dosen?», sagte Tim. «O Gott, nein. Wenn du schon Tabak brauchst, dann solltest du Pfeife rauchen. Das ist eher dein Stil.»
«Mein Großvater hat Pfeife geraucht, und es hat ihm nicht gutgetan», sagte ich.
«Und Zigarren? Mark Twain war ein großer Zigarrentyp. Ganz zu schweigen von Castro und JFK.»
«Aber dann ragt einem so ein großes braunes Ding aus dem Gesicht. Ich will nicht in Rauchwolken gehüllt sein.»
«Das verstehe ich», sagte Tim. «Aber Skoal ist was für Proleten.»
Ich biss von dem Sandwich ab und dachte über Zigarren nach. «Amy Lowell hat die ganze Nacht Zigarren geraucht», sagte ich. «Sie hat Zigarren geraucht und Gedichte geschrieben, und peng, war sie Imagistin.»
«Na bitte», sagte Tim.
«Aber so toll war der Imagismus gar nicht. Außerdem bin ich mit Lyrik durch.»
Tim spöttelte. «Du bist doch nicht mit Lyrik durch.»
«Doch. Ich werde jetzt Gitarre spielen.»
«Ah, Gitarre», sagte Tim. «Ich kenne an der Tufts zwei, nein, drei, die mit Gitarre angefangen haben. Das macht man in den mittleren Jahren. Auf Kollegiumspartys stehlen sie sich davon und spielen Clapton Unplugged und Blind Lemon Jefferson.»
«Genau», sagte ich. «Ich will irgendwie zurück zur Musik. Ich vermisse sie.»
«Stimmt, hab ich vergessen, du hast ja mal Oboe gespielt.»
«Fagott, ja.»
«Vielleicht könntest du ja auch Songs schreiben.»
«Vielleicht. Auf der Fahrt hierher habe ich ein Lied über Seetang gesungen.»
«Man neigt zum Carrageen, wie? Protestlieder? Antikriegslieder?»
«Nein, aber ich arbeite an einigen politischen Gedichten. Ich habe ein langes, heftiges Gedicht über Archibald MacLeish und die CIA in der Mache.»
«Klingt mir sperrig.» Tim wischte sich den Mund ab. «Wir brauchen eine Anti-Drohnen-Hymne. Eine, die man auf den Barrikaden singen kann, was wie Dylans ‹Masters of War›.»
Ich fragte ihn, was für ihn das beste Antikriegslied überhaupt sei.
Er überlegte kauend. Vielleicht Donovans «Universal Soldier», meinte er, oder Lennons «Imagine». Nein, das beste Antikriegslied, sagte er abschließend, sei von einem namens Bagel.
Ich sah ihn zweifelnd an. «Bagel heißt der?»
«Bogle. Es geht um den Ersten Weltkrieg.» Er legte sein Sandwich hin und holte wieder sein Handy heraus. «Auf YouTube gibt’s eine tolle Version von so einem jungen Typen, der singt es total abgefahren.» Stirnrunzelnd tippte er eine Weile auf den Bildschirm, ohne das Video zu finden. «Ich schick dir den Link. Da verdrückst du garantiert eine Träne.»
Ich fragte Tim, ob er jemanden kennengelernt habe. «An der Front läuft nichts», sagte er. «Ich spare meine ganze Liebe für Medea Benjamin auf.»
Ich fuhr nach Portsmouth zurück, auf der Route 95, und meine Reifen drehten und drehten sich und sagten zur Straße immer wieder dasselbe. Und die Straße kapiert es nie, lernt nie. Als ich an den Spurrand geriet, fuhren meine Reifen über die unterbrochenen weißen Linien. Das Geräusch war fft, fft, fft, wie Papier, das aus einem Kopierer springt. Ich sah ein Schild, SLOW TRAFFIC AHEAD, und ich machte eine Melodie dazu. She said there’s slow traffic, slow traffic, slow traffic ahead. Das sang ich in ungefähr dreißig Variationen, bis meine Stimme rau war. Ich sah das Schild des staatlichen Spirituosenladens, der wie ein Gefängnis beleuchtet ist. Ich bog nicht in die Einfahrt ein. Ich dachte an die Freundlichkeit von Rosslyns Mund.
Bei Irving Circle K kaufte ich eine lila Dose Skoal Berry Blend und eine grüne Dose Skoal Apple Blend Langschnitt-Tabak. Zu Hause schaute ich mir dann das YouTube-Video First Dip Video Skoal Cherry Longcut an. Ein Siebzehnjähriger stopfte sich einen Brocken Tabak mit Kirschgeschmack in die Backe und spuckte beim Sprechen in einen Krug. Er hatte mit Rauchen aufgehört und dippte jetzt. «Einer meiner Freunde, der dippt, sagt, man kann ohne Lippe leben, aber nicht ohne Lunge», sagte er. «Das unterstütze ich.» Ich sah mir noch weitere Erst-Dip-Videos an – es gibt Hunderte. Manche Dipper hatten besondere Speichelgefäße namens mudjug, Spucknapf. Sie wälzten gekonnt mächtige «Hämmer» – nasse Tabakklumpen – in den Backentaschen herum und sagten oft «Wahnsinn». Sie verglichen Geschmacksrichtungen und Marken – Wintergrün mit Apfel, Grizzly mit Cope oder Copenhagen. Ein Junge namens Outlawdipper lud sich das halbe Gesicht voll mit Cope Wintergreen. «Mein Zahnfleisch bringt mich noch um», sagte er. «Mein blödes Zahnfleisch ist schon richtig geschrumpft. Vielleicht sollte ich nicht mehr dippen. Nah.» Das sympathische junge Gesicht von einem riesigen Tabakpriem verformt, führte Outlawdipper in hohem Sprechtempo diverse Spucknapf-Stile vor, alle erhältlich auf Mudjug.com – den holzgemaserten Mudjug, den «Red Bandana»-Mudjug und seinen Lieblings-Mudjug, den aus Kohlefaser. «Sieht super aus», sagte er. «Macht dir bloß leider Hirn und Augen kaputt.» Einer, der sich Cutlerylover nannte, steckte sich einen übergroßen Dip rein. Er rieb sich die Schläfen und sagte: «Uh, mir wird echt schwummrig, auf das Gefühl steh ich definitiv nicht.» Er schaltete die Kamera ab und war eine Weile weg, um sich zu erbrechen. Als er wiederkam, sagte er: «Das mache ich in meinem ganzen Leben nicht noch mal.» Ich ging auf Mudjug.com – wo «der einzige Spucker, der für die Streitkräfte gut genug ist» verkauft wird. Ein Sergeant im Irak schrieb eine Bewertung: «Wenn wir in diesen langen Konvois sind, in die Fahrzeuge gequetscht wie die Sardinen, kann man nirgendwohin spucken, ohne jemanden zu treffen», sagte er. Aber mit seinem Mudjug habe sich das alles geändert. «Ich hab das Ding durch ziemlich harte Zeiten im ganzen Nahen Osten mit mir rumgetragen, und wenn die Gefechte vorbei sind, bin ich mit meinem Mudjug immer noch da und warte auf mehr. Ein zäher kleiner Napf ist das, kann ich nur sagen. Gott segne ihn. Hurra!»
Ich ging nach draußen und setzte mich mit einer Papierserviette an den Picknicktisch. Es war ungefähr ein Uhr morgens. Nachdem ich locker auf den Deckel der Tabakdose geklopft hatte, wie man das ja soll, ritzte ich mit dem Daumennagel die Papierversiegelung auf. Dann zog ich die Unterlippe vor, machte einen kleinen Trog daraus und stopfte ein haariges Klümpchen Skoal Berry Blend hinein. Es schmeckte ein bisschen wie Skittles – wie ein Päckchen Skittles, das nach einer Überschwemmung in einem verdreckten Keller gefunden wurde. Mein Mund pumpte nun beachtliche Mengen Speichel, den ich ins Gras spuckte, wobei ich mir lächerlich vorkam. Ich verlor die Kontrolle über meinen dichten Hammer – Tabakkrümel wanderten in meinen Backen herum. Eine mentale Wirkung gab es nicht – keinen Rausch –, und dann, heiliger Mindfuck von Corned Beef und Kuhglocke, schnurrte mein Hirn plötzlich dicht in sich zusammen und platzte auf. Meine Backenknochen sangen Spirituals, und ich lachte. In meinen Fingern war eine nadelige Kälte. Ich hatte einen starken Würgereiz, überwand ihn aber. Interessant, wie der Körper das Heft in die Hand nimmt. Ich fand es wichtig, das braune Zeug auszuspucken, mir die Zunge abzuwischen und mich ins Gras zu legen, alles zugleich. Dort lag ich dann eine Weile und sagte: «Gott, hilf mir.»
Das High war extrem, aber kurzlebig. Es war eine irgendwie unachtsame Freude – zu gewaltsam. Erkenntnistüren öffneten sich keine. Ich dachte an John Candy, der in Splash sagt: «Mein Herz schlägt wie ein Kaninchen.»
Guten Tag! Ich bin offiziell Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika. Millionen anderer Menschen leben mit mir in diesem Land, und ich kenne ihre Namen nicht. Ich habe eine Menge Wörter im Kopf, Fetzen Popmusik, Wendungen, Ortsnamen und Bruchstücke von Lyrik und Prosa. «Tough stuff». «Rough trade». «Party hardy». «Cheez Whiz». «Telefunken». «Matisyahu». «Znosko-Borovsky». «Misty moisty». «Heftiges Mondlicht». «Mudjug».
Ich habe ein wiederkehrendes Problem mit dem Kiefer, von dem ich Ihnen sehr gern erzählen möchte.
Aber vielleicht nicht jetzt.
Egal wie warm die Nacht ist, legt man sich im T-Shirt eine Zeitlang ins Gras, wird einem irgendwann kühl, und dann will man Obdach. Das ist meine mühsam erworbene Wahrheit der Nacht. Das und dass Skoal Berry Blend nicht meine Droge ist.
drei
Heute kommen Leute zum Tee, die ich nicht sehr gut kenne. Ich habe den Staub von der Teekanne gewaschen, ein paar Teebeutel entdeckt und das Tablett meiner Großmutter abgewischt. Diese halbförmlichen Geselligkeiten machen mich fertig. Ich habe zwei Stunden damit verbracht, das Wohnzimmer auf Vordermann zu bringen und sicherzustellen, dass die Toilette im Erdgeschoss benutzbar ist. Der Staubsaugerschlauch ist extrem geknickt und verstopft schnell, und die Saugbürste musste ich mit Klebeband reparieren. Warum habe ich «zum Tee» gesagt? Weil ich gastfreundlich sein und ihnen kein Abend- oder Mittagessen machen oder nur Drinks bieten wollte. Ich hätte sagen sollen, kommt, setzt euch in den Garten, trinkt ein Bier und esst Chips und grüne Guacamole, die aus einem Plastikbeutel gedrückt wird – dann wäre ich glücklicher und sie vielleicht auch.
Eine ist Dichterin, die ich in Cincinnati kennengelernt habe, als ich dort letztes Jahr eine Lesung hatte – eine Frau mit einer freundlichen, lauten Lache und einem dramatischen Lippenstift –, der andere ist wohl ihr Freund, der Filme macht; sie wollen eine Art Doku über Reime machen. Weil ich vor ein paar Jahren eine Anthologie herausgebracht habe, Reim Allein, glauben sie, dass ich ihnen vielleicht helfen kann, Geld aufzutreiben, oder dass ich ihnen Leute für ein Interview vorschlage. Sie haben ihr Projekt bei Kickstarter. Und ich möchte ihnen sagen: Viel Glück, viel helfen kann ich euch nicht, hier habt ihr dreißig Dollar für euren Kickstarter-Fonds, aber ich weiß nichts Brauchbares mehr über Lyrik. Ich mag sie schon noch irgendwie, und jeden Tag, den ich lebe, erscheint sie mir rätselhafter und weiter von mir weg. Aber das werde ich natürlich nicht sagen. Ich schenke ihnen nur den Tee ein und reiche den Teller mit den Shortbread-Keksen herum.
Hey, Junior Birdmen. Ich bin Paul Chowder, und ich bin hier in der Grelle des Mittags beim Hühnerstall und spreche mit Ihnen nur über die Dinge, die gesagt werden müssen. Sie wissen ja, was das ist. Liebe, Ruhm, das Nichts, versunkene Kathedralen und das Regenmobil von Sears. Morgen ist Nan wieder zurück.
Ich möchte einen Aufbruch. Ich möchte eine Fremdsprache sprechen. Ich möchte eine Alternativroute anbieten. Ich möchte zerlumpte Arme voll luzider Verwirrung ansammeln, die einen umhaut.
Ich möchte Songs schreiben. Keine Gedichte mehr – Songs. Gestern im Auto habe ich sogar noch einen anderen Song erfunden. Es ist ein Protestsong. Er geht so: «I’m eating a Burrito, and I’m not killing anyone. / I’m eating a Burrito, and I’m not killing anyone. / I’m eating a Burrito, and I’m not killing anyone.» Die Melodie ist ein bisschen wie «Behind Blue Eyes» von den Who.
Das Brauchbarste, was ich an der Musikhochschule gelernt habe, war nicht der übermäßige Sextakkord oder wie man einen Kanon im Halbtonschritt schreibt oder eine bestimmte Stelle am Rohrblatt abschabt, damit man beim Fagott-Solo in Le sacre du printemps leichter das hohe D erreicht. Das Brauchbarste habe ich im Orchestrierungskurs gelernt. Der Lehrer sagte: «Als Erstes müssen Sie Folgendes wissen: Das Orchester spielt nicht gleichgestimmt. Erst dadurch klingt es wie ein Orchester. Es kann gar nicht vollkommen gleichgestimmt sein. Wäre es das, dann hätte es einen gänzlich anderen Klang. Es ist ein kollektives Musikinstrument, das immer ein klein wenig verstimmt ist.»
Was auf andere Weise auch auf das Klavier zutrifft. Das Klavier ist so gestimmt, dass es ein klein wenig verstimmt ist – auch dadurch erhält es seinen Charakter. Die Verstimmung nennt man «gleichstufige Stimmung». Außerdem ist Holz ein kompliziertes, gewebiges Material, das Wassersäulen enthält, und der Ton geht durch diese langen Zellschall-Resonatoren, und wenn er ins Auditorium braust, ist er ein klein wenig zerwühlt. Er wird herumgeschlagen – und ist nun wärmer, und ein Dunst von Ungenauigkeit hängt über ihm. Das Holz hat das Timbre benebelt und schafft damit die notwendige Verstimmtheit, die Natürlichkeit, die unwahre Wahrheit des Klavier- oder Orchesterklangs. Denn darauf baut die Musik: die Einzigartigkeit jeder Äußerung.
Wie sich zeigte, hatte das Kickstarter-Paar nur wenig Interesse an den Shortbread-Keksen. Sie hatten eine Videokamera und Leuchten mitgebracht, und sie wollten mich zur Geschichte des Reims interviewen. Ich sagte, im zwanzigsten Jahrhundert sei mit dem Reim unter anderem passiert, dass es so viele hervorragend aufgenommene Songtexte gebe, von Cole Porter, von Leiber und Stoller, von Mann und Weil, von Lennon und McCartney et cetera, dass schon in den sechziger Jahren der alte Ella-Wheeler-Ansatz, der Sara-Teasdale-Ansatz, der A.-E.-Housman-Ansatz, der Robert-Frost-Ansatz nichts mehr gebracht hätten und dass die Dichter sich überlegen mussten, was sie tun konnten, was künstlerischer und gehobener war. Worauf sie das Badmintonnetz abschafften – den Reim überhaupt.
Beim Reden fiel mir auf, dass das Ansprechende an Songtexten war, dass die Musik die Konsonanten einnebelt und auflöst. «Man braucht bloß denselben Vokalklang, und schon hat man den Reim», hörte ich mich sagen. «Das ist sehr befreiend.» Ich holte meine Lautsprecher und spielte den Videomachern einen Song von Stephen Fearing vor, den ich mag, «Black Silk Gown». Stephen Fearing singt: «The night is shot with diamonds, above these dark New England towns, / And the highway drawn beneath me like a black silk gown.» Wäre es ein gedrucktes Gedicht, klänge der Reim von towns und gown nicht ganz richtig, aber mit der Musik dazu ist er perfekt. Im Studio platziert Fearing ein winziges Mikrophon in seine akustische Gitarre, und der Klang, den er darauf zupft, ist sehr groß. Er ist ein affenfingriger, wahnsinniger Gitarrist.
Nachdem sie ihre Videoausrüstung eingepackt hatten und gegangen waren, fuhr ich zu Planet Fitness und arbeitete auf den Geräten dort, sah dabei, wie die Nachrichtensprecher auf der Reihe der Fernsehschirme den Mund bewegten, und hörte Donovan «Universal Soldier» singen. Das ist ein guter Protestsong, geschrieben hat ihn Buffy Sainte-Marie. Dann stieg ich ins Auto, trank etwas Pellegrino und schwitzte. Ich saß vornübergebeugt da, den Kopf auf dem Lenkrad, und ließ mein ganzes Ich und meinen Geist in die Lippen strömen, sodass sie von ungeäußerten Wörtern angeschwollen waren. Ich dachte an Schauspieler mit großen Lippen und wie ich, hätte ich große Lippen, mit leichtem Stirnrunzeln dastünde und meine vollen Lippen ausstülpte und wie das vielleicht auf Frauen attraktiv wirken würde, da Frauen anscheinend James Dean und andere sexuell uneindeutige Leute mochten. Meine Lippen fühlten sich an wie die eines Pferdes. Ein Apfel, und schon mümmle ich. Hi, ich bin Harry Connick, Jr. Ich wäre wirklich gern Harry Connick, Jr.
Es wird Zeit, dass ich meine Burrito-Rabattkarte mal wieder bei Dos Amigos Burritos lochen lasse.
Es ist immer besser, neu anzufangen, als umzuschreiben. Der Kult des Umschreibens hat die Lyrik praktisch kaputtgemacht. Beispielsweise könnte ich jetzt im Moment, hey, ein Gedicht mit «Ich wischte das Tischchen mit einem Höschen von ihr» anfangen lassen. Kein schlechter Anfang. Daran ließe sich anknüpfen. Wirklich. Ich habe ein altes Höschen von Rosslyn, und manchmal, wenn ich das Wohnzimmer für Teegäste präsentabel machen muss, spritze ich etwas Old-English-Möbelpolitur auf das Tischchen meiner Großmutter, das leider einmal mit Polyurethan restauriert wurde, und poliere es, bis es schön glänzt.
Heute dachte ich: Mein Geburtstag steht an, und niemand weiß, dass ich mir eine Gitarre wünsche: Ich gehe einfach zu Best Buy und kaufe mir selber eine. Und das tat ich auch, wobei ich, als ich auf den Parkplatz fuhr, die herrlichen, gestreiften Farben des neuen Schildes am Old-Navy-Laden bewunderte, der versucht, sich in einer veränderten Welt neu aufzustellen. Auch Best Buy strauchelt ein bisschen, wie ich gelesen hatte – keiner kauft mehr CDs, und Netflix und andere Filmstreamer haben das DVD-Geschäft zerstört, und der Verkauf von Videospielen ist am Boden. Aber in der Musikabteilung war eine Menge Lärm, und meine Gitarre war auch noch da. Das Wort «Maestro» war in einer FünfzigerJahre-Handschrift gehalten, und auf der Schachtel stand: «Hier ist alles, was Sie brauchen!» Ich legte sie aufs Dach meines Autos und riss sie auf. Drin war eine Gitarre mit sechs Saiten, ein schwarzer Koffer, ein Riemen, ein paar Plektren und eine Garantie. Ha, eine Garantie. Wie viele solcher Garantiekarten habe ich in meinem Leben schon gesehen und weggeworfen? Hundert? Ich wusste, die Gitarre würde nie kaputtgehen, und ist sie auch nicht.
Ich stieg ein und schlug mit dem Daumen an der stärksten, dicksten Saite einen Ton an. Ein nahezu unbegreiflich prachtvoller Ton brandete aus dem großen Loch, aus dem Innern des hölzernen Velodroms der Gitarre. Es brachte etwas in meiner Hypophyse zum Schwingen. «Ooh, ist das schön», sagte ich.
Ich fuhr nach Hause und arbeitete die ersten Gitarrenlektionen in GarageBand durch. Ich übte Akkorde, bis mir die Fingerspitzen schrecklich weh taten. Man hat ja keine Vorstellung, wie scharf Gitarrensaiten sind. Ich betrachtete meine Finger und sah tiefe rote Rillen. Zum Glück verfehlte die Saite so gerade das taube Stück Haut auf dem Zeigefinger, wo ich mich mal beim Brotschneiden geschnitten habe.
Ich wollte gleich Moll-Tonarten spielen, doch der fröhliche, gepflegte Lehrer von GarageBand, der da auf seinem Hocker saß, sagte mir, wie man Dur-Tonarten spielt. Sie lassen einen immer mit Dur-Tonarten anfangen, obwohl man dann meistens bei Moll landet.