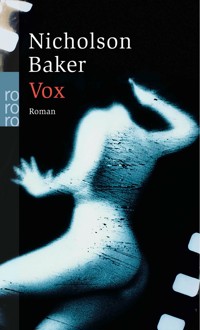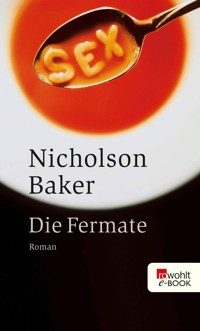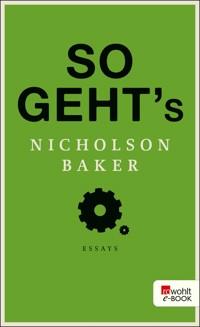
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fünfzehn Jahre nach seinem ersten Essayband «Wie groß sind die Gedanken?» wendet sich Nicholson Baker ein weiteres Mal diversen Problemen der Welterklärung zu und erzeugt bei ihrer Lösung eine funkensprühende, lachmuskelstrapazierende und zugleich stark informationshaltige Kunst. Die hier versammelten Perlen seiner Essayistik beschäftigen sich mit bisweilen klein erscheinenden Themen, aus denen unvermutet große werden - etwa ein raffinierter Aufsatz über die Paraphrase am Beispiel der spezifischen Plattheit von Murmeltierschwänzen. Hat jemand Interesse an der richtigen Technik des Abschreibens, dem Drachensteigenlassen, des notorischen Lügners Daniel Defoes Wahrheiten, dem Zeitunglesen, «Sex and the City 1840», dem kometenhaften Aufstieg der Lesegeräte und vielem mehr? Er oder sie greife zu diesem Buch. Auch auf einen sinnreichen Exkurs über das Rasenmähen braucht dann nicht verzichtet zu werden. Kurz: Hier ist ein einmaliger Omnibus von superbem Lern- und Unterhaltungswert für Liebhaber des gehobenen Um-die-Ecke-Denkens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Nicholson Baker
So geht’s
Essays
Über dieses Buch
Fünfzehn Jahre nach seinem ersten Essayband «Wie groß sind die Gedanken?» wendet sich Nicholson Baker ein weiteres Mal diversen Problemen der Welterklärung zu und erzeugt bei ihrer Lösung eine funkensprühende, lachmuskelstrapazierende und zugleich stark informationshaltige Kunst. Die hier versammelten Perlen seiner Essayistik beschäftigen sich mit bisweilen klein erscheinenden Themen, aus denen unvermutet große werden – etwa ein raffinierter Aufsatz über die Paraphrase am Beispiel der spezifischen Plattheit von Murmeltierschwänzen. Hat jemand Interesse an der richtigen Technik des Abschreibens, dem Drachensteigenlassen, des notorischen Lügners Daniel Defoes Wahrheiten, dem Zeitunglesen, «Sex and the City 1840», dem kometenhaften Aufstieg der Lesegeräte und vielem mehr? Er oder sie greife zu diesem Buch. Auch auf einen sinnreichen Exkurs über das Rasenmähen braucht dann nicht verzichtet zu werden.
Kurz: Hier ist ein einmaliger Omnibus von superbem Lern- und Unterhaltungswert für Liebhaber des gehobenen Um-die-Ecke-Denkens.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel
«The Way the World Works» bei Simon & Schuster, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2016
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Way the World Works» Copyright © 2012 by Nicholson Baker
Umschlaggestaltung ANZINGER | WÜSCHNER | RASP, München
ISBN 978-3-644-04021-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Leben
Schnur
Münzen
Wie ich meine Frau kennengelernt habe
La Mer
Warum ich das Telefon mag
Was am 29. April 1994 geschah
Sonntags auf der Müllkippe
Mit Ohrstöpseln schreiben
Eines Sommers
Lesen
Thorin, Sohn des Thrain
Eng liniert
Tintenlast
No Step
Ich sagte mir
Defoe sagt die Wahrheit
Von A bis Zyxt
Das Nicken
David Remnick
Bibliotheken und Zeitungen
Immer weiter für die Zukunft
Wenn die Bibliotheken es nicht tun, wer dann?
Die Zeitung lesen
Die Times 1951
Sieh mal das Luftschiff da!
Sex and the City, um 1840
Technik
Bring mir eine Gondel
Der Charme von Wikipedia
Der Kindle 2
Papierhersteller
Googles Erde
Steve Jobs
Krieg
Warum ich Pazifist bin
Die Sprache, die wir nicht können, kennen wir nicht
Painkiller Deathstreak
Letzter Essay
Mähen
Quellen
Vorwort
1982, da kam ich gerade als Schriftsteller in Schwung, rief mich William Whitworth, der Herausgeber von The Atlantic, an, um mir zu sagen, er stelle eine Ausgabe zum 125. Jubiläum zusammen und ob ich nicht etwas Kurzes fürs Editorial der Zeitschrift beitragen könne. Geschmeichelt schrieb ich etwas Nachdenkliches, aber auch (hoffte ich) Knackiges namens «Meinungsänderungen». Weitere Texte folgten, und ich hatte zunehmend das Gefühl, dass ich meinen kleinen Beitrag zur Rückkehr des aus der Mode gekommenen persönlichen Essays leistete. Zu meinen Helden gehörten G.K. Chesterton, Christopher Morley, Alice Meynell, William Hazlitt, William James und Samuel Johnson. 1996 hatte ich dann genug für eine Sammlung, Wie groß sind die Gedanken. Jetzt haben wir 2012, und wie es aussieht, wird es Zeit für eine zweite, etwas unfänglichere Lese. Der erste Abschnitt dieses Buches, LEBEN, besteht aus mehr oder weniger chronologisch angeordneten autobiographischen Schnipseln, es folgen Meditationen über das LESEN und das Vorgelesenbekommen. Dann erzähle ich, wie ich einmal eine öffentliche BIBLIOTHEK verklagte, und spreche über die Schönheiten und Wunder alter ZEITUNGEN, und schließlich kommen ein wenig TECHNO-Journalismus und Schriften über den KRIEG und die Leute, die gegen ihn sind, gefolgt von einem LETZTENESSAY übers Rasenmähen, den ich für den American Scholar schrieb. Ich mähe gern Rasen, und ich fand es nicht ganz richtig, das Buch mit einem impressionistischen Artikel über meine erfolglosen Bemühungen zu beenden, eine Reihe brutaler Videospiele zu beherrschen. Hierin werden Sie Sachen über Drachenschnur, E-Reader, Ohrstöpsel, Telefone, Münzen in Brunnen, Papiermühlen, Wikipedia, Kollektaneenbücher, Flugzeugtragflächen, Gondeln, das OED, Call of Duty, Dorothy Day, John Updike, David Remnick und Daniel Ellsberg finden. An manchen Stellen habe ich einen Titel geändert oder einen Satz oder Absatz, der entfernt wurde, damit etwas passte, wieder eingefügt. Ich hoffe, Sie stoßen auf ein paar Themen, die Sie interessieren.
Bedanken möchte ich mich bei Jofie Ferrari-Adler von Simon & Schuster sowie bei den sorgfältigen, freundlichen Redakteuren, mit denen ich an diesen Texten gearbeitet habe, besonders bei Deborah Garrison, Henry Finder, Alice Quinn und Cressida Leyshon vom New Yorker, bei Anne Fadiman und Sandra Costich vom American Scholar, bei Robert Silvers und Sasha Weiss vom New York Review of Books, bei Jennifer Scheussler und Laura Marmor von der New York Times sowie bei James Marcus von Harper’s.
Leben
Schnur
Ich war zwei Jahre alt, als wir nach Rochester, New York, zogen, in eine Wohnung an einer Straße, die nur einen Block lang war, und sie hieß Strathallan Park.
Mit ihrer Kürze war die Straße perfekt, dachte ich: Sie hatte zwei Enden und nicht viel Mitte, wie ein Stock, den man gedankenverloren aufhebt, um damit an einen Zaun zu klopfen, oder wie ein Stück Schnur, das die Leute in der Lebensmittelabteilung von Sibley’s, dem Kaufhaus im Zentrum, von an der Wand befestigten Spulen abschnitten, um eine Schachtel mit einem kleinen Kuchen darin zu umwickeln. Man konnte von unserem Ende der Straße, das in der Nähe der University Avenue lag, bis ganz zum prachtvolleren Ende an der East Avenue rennen, ohne zum Verschnaufen anhalten zu müssen, fast jedenfalls, und wenn man dann an dieser Ecke angekommen war und sich umdrehte, keuchend, die Hände auf den Knien, konnte man den ganzen geraden Gehweg entlangblicken, vorbei an den Karomustern der Einfahrten und den perspektivisch verkürzten Rasenstücken bis zu der Stelle, wo man losgelaufen war. Alles in meiner Straße fiel sogleich ins Auge.
Einige Rasenflächen in der Strathallan Park, wenngleich klein, waren penibelst gepflegt – leuchtend grün und flauschig, und sogar gerändert waren sie: Mittels eines stumpfen Handschneiders am Ende einer Stange hatten die Rasenpfleger schmale, fast verborgene Tröge oder Rinnen in den Rasen am Rand von Gehwegen oder Pfaden gegraben und damit ihr Territorium markiert, als umrahmten sie einen Comic. Das sah sauber aus, aber in den Rinnen konnte sich ein kleinfüßiger Mensch, der nicht auf seine Schritte achtete, den Knöchel verstauchen, und auch für den Dreiradverkehr bargen sie Gefahren: Versuchte man, mit Höchstgeschwindigkeit einen anderen Dreiradfahrer links zu überholen, wobei die Knie wirbelten wie die Fingerknöchel eines Pianisten beim letzten furiosen Triller einer Kadenz, konnte man mit dem Rad in eine Rinne geraten und umkippen oder das Rennen verlieren.
Einige Abschnitte des Gehwegs in der Strathallan Park bestanden aus Schieferplatten, die über den ausgreifenden Wurzeln von Ulmen anstiegen und abfielen (eine Ulme hatte eine tödliche Wunde im Stamm, aus der, wie Blut, schwarzes Sägemehl und Hunderte eingeringelter Larven flossen), und manche Abschnitte des Gehwegs bestanden aus gealtertem Beton, in den Fugen geschnitten waren, damit er sauber brach, sollte ein wachsender Baum es von ihm verlangen. Diese Fugen erinnerten mich an die eingedrückte Linie, die auf der Mitte eines Bazooka-Kaugummis verlief, den man in einem winzigen Süßwarenladen im Souterrain eines Mietshauses in der Nähe unserer Wohnung kaufen konnte: Der schweigsame Mann dort verlangte für jeden Kaugummi, maschinell in Wachspapier gewickelt, das an den Enden zum Dreieck gefaltet war, einen Penny. Mitverpackt war ein Innenblatt mit einem Comic darauf, den wir mit großem Interesse lasen, über den wir aber niemals lachten. Für denselben Penny konnte man aber auch zwei uneingewickelte rote Bonbons kaufen, die wie römische Münzen geformt waren. Sie waren kaubar, und wenn man sie gegen die Sonne hielt, fiel das Licht hindurch, doch eine rote römische Münze leistete nicht, was ein harter, pinkfarbener Bazooka-Klotz konnte, wenn er sich unter der gewaltigen Stampf- und Quetschkraft des ersten Kaudrucks verformte: Sie sorgte nicht dafür, dass sich die Augen saftig in den Höhlen drehten, auch nicht, dass alle Speichelbrunnen auf einmal sprudelten.
Zog man einen Teil eines gut durchgekauten Kaugummis aus dem Mund, wobei man das Ende mit den Zähnen festhielt, verlängerte er sich zu durchhängenden Fasern, die feiner und blasser als ein Faden waren. Und in jenen Strathallan-Jahren dachte ich ziemlich oft über Faden, Schnur und Zwirn nach – Zwirn ist ein schönes Wort –, namentlich über Fadenspulen, umso mehr, als ich die Sache mit der Nähmaschine raushatte, die ich wie ein Auto fuhr, wobei ich auf das elektrische Wimmern des Fußpedals, unmittelbar bevor das Rad mit dem silbernen Knubbel sich zu drehen begann, horchte und es hinauszögerte und dann den Nascar-Stofffetzen um einen anspruchsvollen geschlossenen Rundkurs aus Schlingen und S-Kurven steuerte. Trat man das Singer-Pedal voll durch, hob und senkte sich der herabsausende Hebel seitlich an der Maschine so schnell, dass zwei Geisterhebel daraus wurden, der eine am oberen Wendepunkt, der andere am unteren, und die geruckte Spule obendrauf reagierte, indem sie auf ihrer Spindel hüpfte und wirbelte und ihr eng gewickeltes Leben wegwarf.
Manchmal erlaubte mir meine Mutter, dass ich die Spule von der Nähmaschine nahm und das ganze Wohnzimmer mit dem Faden durchzog, wobei ich mit einem kleinen Ankerknoten an einem Schubladengriff begann und sie um Beistelltische, Türknaufe, Lampensockel und Schaukelstuhlarmlehnen herum abspulte, bis sich alles miteinander verband. Wenn ich dann mit diesem Netz fertig war, konnte man das Zimmer nur noch verlassen, indem man sich unter die Fadenschicht duckte und hinauskroch.
Vor der Nadel der Nähmaschine nahm ich mich in Acht – mein Vater erzählte mir, meiner Großmutter sei einmal eine Nähmaschinennadel durch den Fingernagel gegangen, nahe am Knochen, und ebenso wenig mochte ich die langen, blitzenden Spritzennadeln namens «Booster» in Dr. Ratabaws Praxis einen Block weiter in der Goodman Street. Eines Morgens, ich hatte gerade gebadet und trug nur T-Shirt und Unterhose, stieg ich in den Lichtschacht eines Souterrainfensters hinten an unserem Haus und scheuchte dabei ein paar Wespen auf, die dort eine Siedlung von Eigentumswohnungen errichtet hatten, und da bekam ich mehrere Dutzend kürzernadelige Booster-Spritzen auf einmal und sah, wie sich erboste, in der Sonne schimmernde Wespenunterleibe auf den Arm meiner Mutter setzten, während sie sie von mir abwischte. Danach bemühte ich mich, in Dr. Ratabaws Praxis mutiger zu sein.
Das war also meine erste Straße, Strathallan Park. Dort lag alles ganz nah, aber manchmal schweiften wir auch weiter in die Ferne, zum Beispiel in die Midtown Plaza, wo ich einen Mann sah, der in der dortigen Clock of All Nations eine Tür öffnete und in ihre blaue Mittelsäule stieg. In der Clock of All Nations steuerten dicke Zöpfe aus bunten Drähten jeweils eine andere Pappfigur, die damals, in der Zeit vor dem Niedergang der Midtown Plaza, wonach die Uhr stehenblieb, noch alle tanzten. In der Parkleigh-Apotheke kauften wir einen Drachen und Schnur und gingen damit auf die Rasenfläche hinter der Memorial Art Gallery, wo es drei, vier riesige Bäume und viele bumerangförmige Samenschoten gab, die wie Rumbakugeln rasselten. Es herrschte nicht genug Wind, um den Drachen steigen zu lassen, also gingen wir damit in einen Park, wo er sich in einem Baum verfing und zerriss. Mein Vater reparierte ihn an Ort und Stelle, und obwohl er nun eine Narbe aufwies und vom Kreppband schwerer geworden war, brachten wir ihn noch einmal kurz in die Luft, bis er sich ein zweites Mal im selben Baum verfing. Da lag der Ursprung meines Interesses am Drachensteigenlassen.
Dann, als ich sechs war, zogen wir – das heißt außer mir noch meine Schwester Rachel, mein Vater und meine Mutter – in ein Haus in der Highland Avenue. Dort gab es vorn am Geländer der Treppe einen Pfosten, der sich ideal dafür eignete, die Diele und das Wohnzimmer mit Fäden zu durchziehen, was ich mehrmals tat, und es gab einen Portikus auf der Einfahrt und sechs Badezimmer, von denen einige auch benutzbar waren, und in der Flurkammer gab es ein altes Holztelefon, das zu einem anderen Telefon in einem Raum in der Garage ging. Das Telefon war tot, wie meine Schwester und ich verifizierten, indem wir an den jeweiligen Enden unhörbare Fragen schrien, aber um sein Kabel waren Fäden mit einem interessanten Hahnentrittmuster gewoben, und da das Telefon nicht viel benutzt worden war, waren die Fäden auch nicht ausgefranst.
Wie sich zeigte, war auch die Highland Avenue ein ideales Stück Straße, genau wie die Strathallan Park, nur umgekehrt: Sie war nämlich endlos. In der einen Richtung fiel sie am Cobbs Hill Drive vorbei ab, in den ich auf meinem Schulweg immer links abbog, dann ging sie an dem Rasen- und Gartengeschäft vorüber, wo mein Vater jeden Sonntag prähistorischen Mauerpfeffer kaufte, und schließlich einfach immer weiter. In der anderen Richtung verlief sie entlang der Häuser unserer Nachbarn, der Collins, der Cooks, der Pelusios und der Eberleins, und eines vorstädtisch wirkenden Hauses auf der linken Seite, und dann wurde sie zu einer ziemlich schmalen Straße ohne Gehwege, die sich einfach immer weiter erstreckte, wer weiß schon, wohin. In der Strathallan hatten wir die Hausnummer 30 gehabt, jetzt hatten wir 1422, was bedeutete, dass es in unserer Straße über tausend Häuser geben musste. Und dann hieß sie auch nicht einmal Street, sondern Avenue. Avenues waren, wie ich dachte, stärker befahren und daher wichtiger als Straßen – Monroe Avenue, East Avenue, Lyell Avenue, Highland Avenue –, sie führten bis in umliegende Bezirke und Länder, und da die Welt rund war, trafen sich ihre Enden alle auf der anderen Seite. Ich freute mich sehr, Teil von etwas so Unendlichem zu sein.
Bald nach unserem Einzug schenkten meine Großeltern uns eine Hängematte aus grüner und weißer Schnur. Wir hängten sie an zwei Haken auf der vorderen Veranda, und ich legte mich hinein und schaute auf das Fragment der Highland Avenue, das ich durch das straffe Gitterwerk der Schnüre sah. Ich hörte einen Wagen nahen, lange bevor ich ihn sah, und während er vorbeifuhr, rauschte sein Geräusch über die Einfahrt zu mir herauf wie eine Welle auf den Strand. Und dann zählte ich. An einem Tag zählte ich in dieser Hängematte tausend Autos. Das dauerte ungefähr eine halbe Stunde – tausend war doch nicht so nahe an der Unendlichkeit, wie ich geglaubt hatte.
Und der Cobb’s Hill Park, einen halben Block von uns entfernt, war, wie ich herausfand, eines der besten Gelände der Stadt, um Drachen steigen zu lassen. Mein Vater brachte sogar einen Kastendrachen in die Luft, was ich nie schaffte; stand er erst oben, war er wie ein Stein, reglos, am Himmel festgenagelt. Der Schlüssel zum Drachensteigen war, so stellte ich fest, dass man oft den Finger anlecken und in die Luft halten musste, und immer musste man sich mehr Schnurrollen kaufen, als man dachte, denn die Schnurhersteller schummelten, indem sie ihr Produkt in einem offenen Kreuzmuster um einen leeren Pappzylinder wickelten – es sah so aus, als hielte man einen kilometerlangen Ballen Schnur in der Hand, während sie tatsächlich nur dreihundert Meter maß, was gar nichts war. Wie auch immer, uns ging ständig die Schnur aus.
Um abends einschlafen zu können, begann ich, an Drachen zu denken, die nie herunterkommen müssten. Ich würde mehr Schnur geben, ein halbes Dutzend Rollen, und wenn ich wüsste, dass der Drachen ruhig in der Luft stand, würde ich das Ende an einen schweren Ring im Boden binden, der nicht ausreißen konnte, und dann würde ich mit Stöcken in der Tasche die Drachenschnur hinaufklettern. Ich stiege ein ganzes Stück hinauf, machte dann eine Schlinge um einen Fuß, die einen Teil meines Gewichtes trug, und knüpfte aus der Drachenschnur, an der ich hinge, eine Art Baumhaus. Dabei würde der Drachen ein Stück heruntergezogen, aber ich wäre so hoch am Himmel, dass der Höhenverlust nicht weiter ins Gewicht fiele, und die Stöcke, die ich mitgebracht hätte, würde ich als Klammern oder Leisten benutzen, um die ich die Schnur wickelte, wobei ich die Struktur der Hängematte imitierte, bis ich schließlich ein kleines, windabweisendes Krähennest wie der Korb eines Heißluftballons geschaffen hätte. Ich verbrächte die Nacht dort oben, und am nächsten Morgen, wenn Leute mit ihren Drachen in den Park kämen, würden sie zu mir heraufzeigen und wären beeindruckt.
Aber das war nur zum Einschlafen; mein größter echter Moment des Drachensteigens auf dem Cobbs Hill kam um 1966, als ich neun war. In dem Jahr hatte ich einen Fledermausdrachen geschenkt bekommen. Er traf aus England via Bermuda in einem langen Pappkarton ein, auf dem «Fledermausdrachen» stand. Die Flügel bestanden aus schwarzem, leicht dehnbarem Vinyl, mit vier Holzdübeln zur Verstrebung, einem Kreuzstück aus Fiberglas und einem Dreieck aus Vinyl, darin ein metallener Führungsring, an den die Schnur gebunden wurde. Er war vollkommen schwarz, ein schöner Drachen, aber ich schaffte es nicht, ihn mehr als ein paar Minuten in der Luft zu halten, weil er so schwer war.
An einem Wochenende gingen dann mein alter Dreiradrivale Fred Streuver und ich auf den Cobbs Hill, als ein kräftiger, stetiger Wind von der Pittsfield Plaza her wehte, und der Fledermausdrachen ging hoch und blieb oben. Wir waren baff. Was hatten wir richtig gemacht? Wir gaben Schnur nach. Anscheinend wollte der Drachen am Himmel bleiben. Nichts, was wir taten, konnte ihn stören. Er war hungrig nach Schnur und zog und zog, wollte weiter hinauf, über den Weg bei den Tennisplätzen. Ich band eine weitere Schnur daran und achtete darauf, dass ich einen Kreuzknoten machte – so einen, der immer enger und fester wird, je mehr man daran zieht. Unsere schwarze Fledermaus war jetzt jenseits der Fliederbüsche bei der Culver Road, sie stand hoch, hoch in der Luft, war von ganz Rochester aus zu sehen – von Hunderten von Menschen –, und dann banden wir eine weitere Rolle daran, und nun war sie jenseits der Culver Road und wollte immer noch mehr Schnur.
Ich bekam es fast schon mit der Angst – da hielt ich etwas fest, was lebte und flog und dennoch ganz weit weg war. Nun, da ich mich weit in die leere Luft hinausgedacht hatte, wo der Drachen war, vergaß ich beinahe, auf dem Gras von Cobbs Hill das Gleichgewicht zu halten. Nicht einmal die Kreuzknoten, die wir geknüpft hatten, waren noch zu sehen – die Schnur wurde mit jeder Minute unendlicher.
Dann, wie immer, ging sie uns aus. Aber wir wollten mehr. Wir wollten, dass unsere Fledermaus eine volle Meile hinausging. Fred hielt die Schnur, und ich las ein Stück Schnur auf, das schon gegangene Drachenleute zurückgelassen hatten; ich band es daran, obwohl ein Nestknäuel darin war, in dem ein Zweig steckte; und der Drachen zog weiter. Ich fand eine weitere weggeworfene Schnur, aber da waren Fred und ich dann zu hastig beim Knotenbinden; inzwischen lachten wir wie die Irren, wir waren müde, und keiner von uns überprüfte, was der andere gemacht hatte. Wir schickten die neue Schnur hinauf, aber erst als sie schon ein Stück weg war, sah ich eine winzige, unerfreuliche Bewegung in dem Knoten. Es war ein gewundenes, irgendwie verstohlenes Ruckeln. Ich sagte: «Nein, hol ihn runter!», und packte die Leine, doch der Drachen zog zu kräftig, und der fehlerhafte Knoten schüttelte den Rest seiner Schlaufen ab – es war ein, das sah ich nun, Altweiberknoten gewesen. Die Schnur, die wir hielten, wurde schlaff, und die Schnur auf der anderen Seite des schlechten Knotens wurde ebenfalls schlaff und trieb seitwärts davon.
Weit jenseits der Culver Road erfuhr der Drachen auf einen Schlag die Wahrheit: Er warf sich wie gestoßen oder erschossen ein paar Meter zurück, und seine Fledermausflügel flatterten wie schlaffe Segel, und dann sauste er aus dem Himmel in Bäume, die hinter anderen Bäumen waren, die hinter Häusern waren, die hinter Bäumen waren.
Wir gingen ihn suchen, doch er war weg. Er war irgendwo in ein Viertel mit kurzen Sträßchen gefallen, in eines von hundert kleinen Gärtchen.
(2003)
Münzen
1973, da war ich sechzehn, bekam ich einen Job bei der Gebäudewartung in der Midtown Plaza, damals Rochesters florierende Shoppingmall im Zentrum. Ich verbrachte einen Tag damit, Nägel aus Kanthölzern zu ziehen – dabei laut Ravels Bolero pfeifend, damit die Sekretärinnen merkten, dass ich das eine oder andere über französische Musik wusste –, und dann steckte mich Rocky, der Boss, ein schmucker Mann mit Schnurrbart, zu dem Faktotum der Mall, Bradway. Bradway brachte mir bei, wie man Aktenschränke richtig verschiebt (man geht damit abwechselnd über Eck, als tanzte man langsam mit ihnen, und wenn man einen von ihnen halbwegs an seinem Platz in der Reihe hat, legt man einfach den Fußballen an eine Ecke und tritt nach unten, worauf der Schrank wie von einem Magneten gezogen an seinen Platz gleitet); und er brachte mir bei, wie man eine Kreideschnur schnalzen lässt, wie man in eine Rigipsplatte Kurven schneidet, wie man ein Loch für ein Halteverbotsschild gräbt, wie man die hydraulische Spannung an einer automatischen Tür einstellt, wie man korrekt einen Vorschlaghammer benutzt und wie man die Leuchtstoffröhren an der Decke eines Fahrstuhls auswechselt. Er trug eine komische Brille, und er sang den Sekretärinnen «Pretty, Pretty Paper Doll» vor, was ihnen und mir peinlich war, aber er war ein anständiger Mensch und ein guter Lehrer. Aus Gründen, die ich noch heute nicht verstehe, mochte ihn einer aus der Wartungsabteilung nicht; er nannte ihn immer einen «Proktologenspaß».
Eines Nachmittags gab mir Bradway einen Piepser und meinte, er wolle mir auch zeigen, wie man die Pennys im Brunnen auffege. Der Brunnen der Midtown Plaza hatte eine fünf Meter hohe, nach innen geneigte Fontäne, und an einer Seite waren vier oder fünf niedrige, von unten beleuchtete Pilzbrunnen; das Wasser lief um eine Treppe, die auf die zweite Ebene der Mall führte, herum und darunter hindurch. Vom Treppenabsatz und vom Geländer auf der zweiten Ebene, vor allem aber, wenn sie daran vorbeigingen, warfen Leute Pennys hinein. Auch ich hatte schon Pennys hineingeworfen. Wenn man den Penny mit einem Wunsch belegte, musste man ihn sehr hoch schnippen – je mehr Zeit er in der Luft verbrachte, desto mehr Gelegenheit hatte er, ein wichtiger Penny zu werden, ein einmaliger Glückspenny – und dann zusehen, wie er ins Wasser klatschte und auf den gefliesten Beckenboden trudelte. Man musste sich merken, wo er gelandet war. Es war der Penny mit den zwei sehr fleckigen Pennys links daneben – oder halt, war es nicht einer von denen in einer ganz ähnlichen Konstellation einen halben Meter weiter? Jeden Tag konnte man nach seinem Penny schauen oder nach dem, den man zu seinem Penny erklärt hatte, um zu sehen, wie es ihm ging, ob er schon wunscherfüllende Kräfte ansammelte.
Als Bradway dann sagte, ich – eine Wartungskraft, die zwei Dollar fünfzig die Stunde verdiente – solle alle Pennys auffegen, überkam mich ein selbstgefälliger Schauder. Wir gingen in den Souterrain und holten ein Paar Gummistiefel wie zum Fliegenfischen, einen schwarzen Eimer mit ein paar Löchern drin, eine Kehrschaufel und einen Gummiwischer mit Stiel. Bradway zeigte mir den Schalter, mit dem die Pumpe für die Brunnen abgestellt wurde. Ich drückte. Es klackte.
Als wir wieder oben waren, lag das Wasser nahezu still. Ich trat über den Marmorrand hinein, bekam den langen Stiel mit dem Gummiwischer gereicht und machte mich daran, anderer Leute Glück herumzuschieben. Der Beckenboden war mit kleinen blauen Fliesen bedeckt und auch ein wenig glitschig, sodass die von dem Gummiwischer herumgeschobenen Pennys plane Kupferplatten bildeten, deren Teile sich so arrangierten, dass sie in die angrenzenden Rundungen der anderen passten, bis sich schließlich eine Reihe Pennys aufwarf, Gipfel bildete und zurückklappte, dabei eine zweite Schicht entstehen ließ, worauf sich eine weitere bildete, bis in einer Ecke des Beckens schließlich ein abgesunkenes Riff aus Kleingeld entstanden war – darunter auch Nickels und Dimes, aber keine Quarters. «Genau so, feg sie einfach da zu dem Haufen hin», sagte Bradway. Er gab mir den schwarzen Eimer mit den Löchern, dann rollte ich die Ärmel so hoch es ging, schöpfte das Kleingeld mit dem Kehrblech auf und schüttete es, ganz unter Wasser, in den Eimer. Es klang wie Ankerketten auf dem Meeresboden. Indem wir so viel wie möglich unter der Wasseroberfläche machten, behandelten wir die Penny-Entfernung ein wenig diskret.
Bradway ging weg, während ich in größerem Umkreis fegte, und ich bedachte die Vorübergehenden mit einem überheblichen, aber müden Blick: Ich war der Wartungsmann, der im Wasser stand, sie waren lediglich Fußgänger in einer Mall. «Behältst du das ganze Geld selbst?», fragte mich ein Mann. Ich sagte, nein, das komme zu einer gemeinnützigen Stiftung. «Ich bin eine prima Stiftung, Mensch», sagte er. Am kniffligsten war es, um die Pilzbrunnen herum zu fegen (die bei abgestelltem Wasser nur Stiele waren), aber selbst das war nicht besonders schwierig, und als ich die versprengten Münzen auf den offenen Fliesen hatte und das Kleingeld in einer blassen Schlammwolke vor mir her schob, kam ich mir vor wie ein wettergegerbter Cowboy, der seine Herde nach Hause treibt.
Bradway kam wieder, und gemeinsam zogen wir den schwarzen Eimer heraus, wobei das Wasser aus den Löchern lief. Er war extrem schwer. Wir stellten ihn auf eine zweirädrige Karre. «Spürst du den Schleim?», sagte Bradway. Ich nickte. «So nimmt die Bank das Geld nicht an.» Wir fuhren mit dem Lastenaufzug in das Souterrain, wo er mir einen Raum zeigte, in dem eine alte gelbe Waschmaschine stand. Gemeinsam kippten wir das Geld hinein, dann drehte Bradway die Scheibe auf Normalwäsche; die Münzen durchliefen einen Kreislauf, der irgendwie matschig klang. Nach dem Mittagessen schöpfte ich das saubere Geld heraus und rollte es zur Bank. Wie aufgetragen, fragte ich nach Diane. Diane führte mich zum Tresor, wo ich den schwarzen Eimer neben ein paar schmutzigen Säcken mit Quarters von der Karre schob.
In jenem Sommer reinigte ich den Brunnen jede Woche. Jede Woche gab es neues Geld aufzufegen. Ich selbst schnippte weitere Münzen hinein; einen Nickel ließ ich absichtlich ein paar Wochen liegen und schob sämtliche Pennys um ihn herum, damit mein Wunschgeld mehr Zeit hatte, Fahrt aufzunehmen. Beim nächsten Mal fegte ich ihn allerdings mit den anderen weg, versuchte dabei jedoch, seinen Weg zu verfolgen, während sich eine Masse Münzen an dem Gummiwischer aufreihten wie Ferkel an der Sau. Es gab immer wieder Kollisionen und Kippungen, und auch die kleinen Wellen des Wassers trugen zu dem Durcheinander bei. Meine Münze rutschte über eine andere und fiel nach rechts, und dann, als ich sie alle in den Eckhaufen schob, stürzte eine Münzlawine darüber, und sie war nicht mehr zu sehen.
Einmal geriet ich an eine Münze, die sehr lange – vielleicht Jahre – ungefegt unter der Treppe im Wasser gelegen hatte. Sie war schwarz und voller Kraft. Ich schob sie zu den anderen in den Haufen, kippte sie in die Waschmaschine und lieferte sie bei Diane in der Bank ab.
(2001)
Wie ich meine Frau kennengelernt habe
Sie kam eine Treppe in einem Studentenwohnheim herauf, ich trug mein Fahrrad die Treppe hinab. Ich hörte das Klicken des langsam sich drehenden Reifens, als ich mich vorstellte.
Ich stand in ihrem Zimmer, die Hände in den Hosentaschen, während sie ihre Italienisch-Hausarbeiten machte. Sie saß auf dem Fußboden, gegen das Etagenbett gelehnt, und trug saubere, verknitterte T-Shirts in verschiedenen Farben. Sie war mit ihrer Kleidung unzufrieden, und mehrmals täglich zog sie sich um. Wenn ein Lied kam, das sie mochte, bewegte sie fast umerklich den Kopf. Sie besaß keinen BH, auch wenn ihre Mutter sie bestürmte. Sie mochte einen, der auf dem Flur wohnte; und ich mochte es, wie sie errötete, wenn er vorbeischaute. Bei unserem ersten Date trug sie einen wunderschönen Kaschmirmantel, den sie in einem Secondhandladen gekauft hatte. Er hatte einen Schalkragen aus Lammwolle, der gut zu ihren weichen, nachdenklichen Lippen passte. Ich wollte, dass wir auf der dünnen Schneeschicht auf dem Gehweg vor dem Verwaltungsgebäude Schuh-Ski machten, aber sie wollte nicht. An jenem Abend schneite es immer wieder große Designerflocken. Sie erzählte mir von einem Kätzchen, das sie in einem der Foren Roms gefunden habe und das zu einer mächtigen, arroganten, freundlichen Katze herangewachsen sei. Einmal, sagte sie, sei die Katze vom Balkon ihrer Wohnung im fünften Stock an der Piazza Paganica gefallen und habe sich beim Aufprall die Nase gebrochen; seit diesem Sturz schnurre sie besonders laut und schallend.
(1993)
La Mer
Nach der Schule, als ich dreizehn war, sagte mir mein Fagottlehrer, die Philharmoniker von Rochester, bei denen er das zweite Fagott spielte, probten ein Musikstück namens La Mer. Mer heiße nicht «Mutter», sagte er – es heiße «Meer», und das Besondere an La Mer sei, dass es auch wirklich nach Meer klinge. Er spielte mir etwas aus der Partitur vor, während ich mein Instrument zusammensteckte. Was er da spielte, klang für mich nicht nach Meer, aber das war keine Überraschung, weil auf dem Fagott nichts nach Meer klingt. Einige Monate später kaufte ich mir eine Platte, auf der Pierre Boulez und die New Yorker Philharmoniker La Mer spielten. Ich setzte den schweren, gepolsterten Kopfhörer auf, der für jedes Ohr wie ein aufblasbares Rettungsfloß war, und ich hörte Debussys seitwärts wogende Wasserhänge, von deren Kämmen kalte Gischt wehte, und ich sah die jähe Weite des Meereshorizonts, die auf den Sturm folgte, und ich registrierte verblüfft, wie sehr das alles wie das flüssige Leben war. Es war genauso gut wie Joseph Conrads «Taifun», damals eine meiner Lieblingserzählungen – vielleicht sogar besser.
Später, nachdem ich mich an der Musikhochschule beworben hatte, kaufte ich die Taschenpartitur von La Mer und versuchte herauszubekommen, wie Debussy das gemacht hatte, aber die Partitur war keine große Hilfe. Woher bezog Debussy das Selbstbewusstsein, eine halbe Melodie zu nehmen und sie dann, nachdem er sie kurz betrachtet hatte, wie einen zerfetzten Brocken Seetang wegzuwerfen? Wie machte er aus einem Orchester, einem stacheligen Ballen Pferdehaare und einer alten Maschine etwas, was spritzte und brandete, das Gleichgewicht verlor und es wiederfand? Es mag Dinge an La Mer geben, die ein wenig unbefriedigend sind – an manchen Stellen wird vielleicht zu viel mit der Ganztonskala gearbeitet (damals etwas Neues, heute von Fernsehkrimimusik ausgelutscht), und Debussy machte, glaube ich, auch einen Fehler, als er die Blechfanfare am Ende wegnahm –, aber dieses Stück enthält so viele Naturwunder, dass man an den tristen Momenten einfach vorbeirauscht, als wären es Supermärkte, ohne sie weiter zu beachten, während man die Gezeitenwunder betrachtet.
Debussy beendete La Mer – änderte die Orchestrierung und korrigierte die Fahnen – während eines Monats in England im Sommer 1905, in Eastbourne, einem spätviktorianischen Badeort, wohin er mit Emma Bardac gefahren war. Emma war da noch mit einem gut situierten Bankier verheiratet und hochschwanger mit Debussys einzigem Kind. Als ich vor ein paar Jahren in einer seiner Biographien blätterte, hielt ich bei einem Foto Debussys inne, wie er auf der steinernen Balkonbrüstung des Grand Hotels von Eastbourne stirnrunzelnd in den Sucher einer Kamera blickt. Die Kamera war auf den Kanal gerichtet. Zu der Zeit lebte ich in Ely, nördlich von Cambridge, aber nachdem ich eine Karte und ein Kursbuch befragt hatte, erkannte ich, dass ich mit Leichtigkeit an einem Tag nach Eastbourne und wieder zurück fahren konnte.
Eines Morgens im März fuhr ich mit der quietschenden, altersschwachen Lokalbahn los; ich ging in die Stadt, dann in ein Antiquariat, in dem es nichts von Debussy gab, und schließlich zur Touristeninformation, wo eine freundliche Frau ein rotes Notizbuch mit dem Titel Famous People hervorzog, in dem es Texte über Wordsworth, Tennyson, Swinburne (der ganz in der Nähe, auf dem Beachy Head, «An eine Seemöwe» schrieb), König Arthus und Debussy gab. Die Frau wies mich in die Richtung des Grand Hotels, und als ich es endlich fand, nachdem ich auf der Küstenstraße falsch abgebogen war, sagte man mir, die Debussy-Suite sei die 227, allerdings könne ich nicht hinein, um aus den Fenstern der Suite hinauszuschauen, da es jetzt fast Anmeldezeit sei und die Übernachtungsgäste jeden Moment eintreffen könnten.
Also setzte ich mich in den Garten auf eine weiße Bank, mit dem Rücken zum Meer, und schaute zu dem Balkon hinauf, wo Debussy und Emma vor gar nicht so vielen Jahren über den Kanal hinweg auf ein unsichtbares Frankreich geblickt hatten. Der Balkon befand sich genau über dem Haupteingang, unter den Lettern «Grand Hotel». In dem fahlen Sonnenlicht zeichnete ich die Fassade mit ihren blicklenkenden Beaux-Arts-Urnen und -Voluten (1876 von R.K. Blessley entworfen); mir schien, dass Debussy, der oft mittellos war und einen leichtsinnigen Umgang mit Geld pflegte, sich hier, als er sein überschäumendes Seegedicht abschloss, arbeitsam und reich vorgekommen war, vielleicht zum letzten Mal. Ein paar Monate später, wieder in Paris, schoss sich seine verlassene und verzweifelte Frau am Herzen vorbei, und auch wenn sie wieder gesund wurde, hatte sich damit für alle das Leben verändert.
Ich ging wieder ins Hotel und die Feuertreppe hinauf in den ersten Stock. (Die Treppe hatte hübsch geschnitzte Geländerknubbel.) Es war eines jener Gebäude, in denen die Treppen und die Anordnung der Fenster nicht synchron sind; im Treppenhaus war das obere Ende des Fensterrahmens dicht am Boden, sodass ich mich tief bücken musste, wobei mir der Kopf hämmerte, um einen guten Blick zu bekommen. Mir blieben nur noch ein, zwei Minuten, bis ich wieder zum Zug musste. Außen auf der Scheibe war getrockneter Regenstaub, dennoch blickte ich übers Wasser und sah, dicht am Ufer, ein unerwartetes Spiel grüner, goldener und türkisfarbener Wellen – eigentlich nicht Wellen, weil sie so winzig waren, aber doch kleine Manifestationen flüssiger Subenergie. Die Wolken sahen aus wie ein Glas mit Ausspülwasser, wenn man ein Aquarell malt – langsam sich verdünnendes schwarzes Gewoge in dem weißen Wasser, das man vorher gemacht hat, als man die weiße Farbe aus dem Pinsel wusch. Doch an dem Tag wollte das Meer die Wolken nicht reflektieren; es hatte seine eigene Stockenten-Palette, deren feine Abstufungen mit den Hängen der vom Wind strukturierten Dünung variierten. Durch das schmutzige Fenster glaubte ich einen Augenblick lang zu sehen, was Debussy gesehen hatte.
(2001)
Warum ich das Telefon mag
Als ich klein war, spielte ich oft mit dem Telefon. Ich mochte die körperliche Empfindung des Wählens und wie mein Finger in seinem Ziffernloch (erst war es aus schwarzem Metall, dann aus bequemerem, durchsichtigem Plastik) den Bogen eines perfekten Kreises entlanggeführt wurde, als wäre er ein Stift in einem Spirographen. Manchmal ließ ich ihn schnell zurückfahren und spürte dabei, wie sich das Mittelrad leicht dagegenstemmte.
Auch trug über einen Zeitraum von mehreren Jahren, als ich heranwuchs, kein Familienmitglied eine Armbanduhr, und im ganzen Haus gab es keine verlässlich gehende Uhr. (Auf dem Kaminsims stand eine antike, aber die ließen wir oft ablaufen.) Meine Aufgabe war es, häufig mehrmals täglich die Zeit- und Temperaturansage, die von der Sparkasse von Rochester gesponsert wurde, anzurufen und in Erfahrung zu bringen, wie spät es war. Ich machte diese Anrufe sehr gern. Mit den anderen Telefonnummern, die ich mir gemerkt hatte, erreichte ich lediglich Leute meines Alters (z.B. meinen Freund Fred, GI2–1397, und meinen Freund Maitland, CH4–4158), die Zeit- und Temperaturansage hingegen verband mich mit einer wirklicheren, küchenlosen Welt der Atomuhren, Zinseszinsen und des absoluten Nullpunkts, mit Zeiten und Temperaturen, die erregend unhinterfragbar waren, bestätigt, wie es schien, vom National Bureau of Standards und der FDIC, einem Einlagensicherungsfonds. Am Tag nach der Zeitumstellung war die Zeit- und Temperaturansage immer besetzt, ein Zeichen für eine simultane stadtweite Aktivität, so eindeutig wie der Abfall des Wasserdrucks in den Werbepausen bei der Superbowl.
Später lernte ich den Trick, mich selbst anzurufen: Man wählte eine kurze Nummer (war es die 811?), dann tippte man genau zum richtigen Zeitpunkt auf die Gabel, und wie durch ein Wunder klingelte daraufhin das eigene Telefon, das Telefon, das man berührte – ein Ergebnis, das in jenen Jahren vor der Entdeckung anderer einsamer selbstgewählter Freuden exotisch, schockierend und lohnend schien.
Ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass ich in Vox, meinem Telefonsexroman, das romanhafte Äquivalent dieser frühen telefonischen Zerstreuungen gestaltet habe: Ich beschwor oder nutzte die, wie ich hoffte, dem Niveau des National Bureau of Standards entsprechenden Wahrheiten der Interessen und Koketterien zweier typisch gesprächiger Telefonierer, die für mich wie auch füreinander zunächst Fremde waren und daher als bloße Stimmen vom absoluten Nullpunkt ihrer anfänglichen Verbindung zum hohen Fahrenheit-Bereich ihrer liebevoll verbalisierten Orgasmen gelangen mussten. Zugleich ließ ich natürlich mein eigenes Telefon klingeln.
(1994)
Was am 29. April 1994 geschah
Ein Beitrag zu: «240 Ecrivains Racontent Une Journée du Monde», einer Anthologie des Nouvel Observateur zu den Ereignissen des 29. April 1994
Ich brachte meine Tochter zur Schule und schrieb dann im Büro eine E-Mail über Bibliothekskataloge, obwohl ich eigentlich einen Roman besprechen sollte. Ein Faktenchecker von einer Zeitung rief an, um zu erfragen, ob ich siebenunddreißig sei und ob es korrekt sei zu sagen, ein Buch von mir sei an einem bestimmten Tag 1992 erschienen. Ich aß mit meiner Frau und dem schlafenden fünf Monate alten Sohn in einem chinesischen Restaurant zu Mittag. Wir sprachen über einen Artikel über Obdachlosigkeit, den sie im New York Review of Books gelesen hatte. Danach schrieb ich noch mehr über Bibliothekskataloge. Als ich nach Hause kam, trug meine Tochter eine neue Pfadfinderinnenuniform. Sie war stolz auf ihre langen Strümpfe mit den blauen Troddeln, und von ihrem Stolz traten mir die Tränen in die Augen, teils aber auch deshalb, weil ich müde war, nachdem ich den ganzen Tag über Bibliotheken geschrieben hatte.
Auf der hinteren Veranda legten wir Kreppband zur Bestimmung der Ausmaße eines zweiten Badezimmers aus, das möglicherweise in der Waschküche entstehen sollte. Stühle standen für Waschbecken und Toilette; der Raum erwies sich als zu klein, um auch noch eine Dusche unterzubringen.
Ich kaufte fürs Abendessen Hamburger und lieh Arsen und Spitzenhäubchen aus, um es mit der ganzen Familie anzusehen (die es noch nicht kannte), aber meine Tochter bekam davon Angst, sodass wir das Band anhielten. Ich brachte meinen Sohn zum Lachen, indem ich ihm mit meinem Bart die Fußsohlen kitzelte und an seinen Rippen Kaugeräusche machte. Als beide Kinder schliefen, sah sich meine Frau den Rest des Films an, ich hingegen döste, um fünfundvierzig Grad zur Seite gekippt, auf dem Sofa. Dann ging ich in mein Arbeitszimmer und sortierte die Post, die ich beantworten sollte, zu vier Stapeln. Zwar beantwortete ich keinen Brief, hatte aber das Gefühl, schon durch das Sortieren vorangekommen zu sein. Eines der Poststücke, die ich mir ansah, war ein Fax vom Nouvel Observateur, und da sah ich, dass heute ja der Tag war, über den ich schreiben sollte, und dass ich mir bis dahin keinerlei Notizen gemacht hatte. Also schrieb ich ein paar auf den Rand des Faxes, die auf dem glänzenden Papier verschmierten, aber noch leserlich blieben.
Als Letztes, bevor ich mich schlafen legte, steckte ich eine Diskette zwischen die beiden Hälften meiner Brieftasche, damit ich nicht vergaß, sie nach Phoenix, Arizona, mitzunehmen, wohin ich am nächsten Morgen flog, um dabei zu sein, wenn ein Freund von mir eine groß gewachsene Frau heiratete, die einmal in einem Jeep-Werbespot mitgewirkt hatte. Beim Einschlafen streichelte ich den Verlobungsring meiner Frau.
Jetzt, mehrere Monate später, ist das Badezimmer fertig. Die Streifen Kreppband, die wir nach Abschluss unserer architektonischen Planung an jenem Abend nicht mehr abgepellt hatten, sind nun unauslöschlich auf den grauen Dielen der hinteren Veranda festgebacken. Eigentlich sind sie die einzigen fassbaren Überreste dieses Tages.
(1994)
Sonntags auf der Müllkippe
Es ist Sonntagnachmittag in South Berwick, und ich bin an der Müllkippe, wo ich auf einem weißen Plastikliegestuhl sitze. Die Mülltage sind Mittwoch, Samstag und Sonntag; die meisten Leute gehen sonntagnachmittags hin. Am meisten Betrieb ist kurz vor sechs, wenn die Müllkippe schließt: Kommt man zu spät, hockt man bis Mittwoch auf seinem Müll, und wenn es Mittwoch wird, vergisst man es wahrscheinlich. In unserer Stadt gibt es keine Müllabfuhr – jeder muss sich hier selbst kümmern. Kurz vor dem Wahltag zeigen sich die Kandidaten für den Gemeinderat hier, schütteln Hände und machen Wahlkampf – nur hier an der Müllkippe hat ein Kandidat die Chance, einen Wähler aus jedem Haushalt zu erwischen. Viele Bewohner setzen kaum einen Fuß in die kleinen Geschäfte in der Hauptstraße, auch das Postamt suchen sie nicht oft auf, ihre Lebensmittel kaufen sie in Supermärkten jenseits der Grenze in einem anderen Staat, die Kinder werden mit dem Bus zur Schule gefahren. Aber zur Müllkippe kommt jeder. «Hier ist mehr los als im Rathaus», sagte Jim zu mir. Jim ist der Leiter der Müllkippe – ein stämmiger, stark von der Sonne geröteter Mann in den Zwanzigern. Nachdem ich ungefähr eine halbe Stunde auf meinem Plastikstuhl gesessen hatte, im Schatten am Rand des Parkplatzes, kam Jim zu mir, um sich davon zu überzeugen, dass ich auch keine illegalen Giftstoffe in die Büsche kippte. Ich sagte ihm, ich schriebe über die Müllkippe, weil die meisten Leute glücklich seien, wenn sie hierherkämen. Tatsächlich lächle ich jetzt gerade, während ich diesen Satz tippe, mit Blick auf die sonnenbeschienenen Autos und Pick-ups und die langen, rechteckigen Container, die jeweils unterschiedliche Müllarten aufnehmen. Darunter ist ein schöner roter Container, frisch gestrichen, groß wie ein Eisenbahnwaggon, an der Seite eine Leiter, vorn dran ein Schild mit der Aufschrift: «Nur für Schindeln».
Zwar sagen wir Müllkippe dazu, aber streng genommen ist es gar keine: Es war nur einmal eine Deponie. Hinter dem Hauptgebäude ist ein steiler künstlicher Berg, über und über bedeckt mit gelben Wildblumen, aus dem zwei T-förmige Gebilde herausragen. Das sind Lüftungsklappen; sie geben eingesperrte Gase aus dem Haufen ab. Und der ganze Müll, den wir heute hierherbringen, geht auf Lastwagen ins nahegelegene Städtchen Biddeford, wo er verbrannt wird. Die Einwohner von Biddeford klagen über den Gestank; aus unbekannten Gründen haben die Biddeforder ihre Verbrennungsanlage mitten in den Ort gebaut. Ich sagte zu Jim, dem Leiter, unsere Müllkippe sehe in letzter Zeit so sauber aus. Als Jim vor einem Jahr die Stelle antrat, war sie ein einziges Chaos; jetzt ist alles in Ordnung, und es riecht auch nicht. «Jeden Abend reinigen wir sämtliche Recycling-Tonnen mit einer Mischung aus Simple Green, Bleiche und Wasser», sagte Jim. «Wir haben hier keine Bienen mehr. Als ich hier anfing, gab’s noch eine Menge Bienen.»
Die Agamenticus Road führt zur Müllkippe. Agamenticus heißt ein Berg in der Nähe; da soll es seltene Pflanzen geben, die ausschließlich auf dem Agamenticus wachsen, aber ich habe sie noch nie gesehen. Oben auf dem Agamenticus ist auch ein Steinhaufen. Angeblich erinnerten hier die Indianer an eine heilige Begräbnisstätte, indem sie einen großen Steinhaufen errichteten; heute bringen auch Besucher des Berges Steine mit. Auf dem Agamenticus war ich nur einmal, bei der Müllkippe Hunderte Male, oft mit meinem Sohn. Man biegt am Bürgerkriegsdenkmal nach rechts in die Agamenticus Road ab, fährt an ein paar Häusern und einem Friedhof vorbei und dann, gleich nach dem Eisstand und dem Blumengeschäft, biegt man links ab und befindet sich auf einer asphaltierten Fläche vor dem Hauptgebäude der Deponie, einem braunen Schuppen. Daneben ist eine klaffende Öffnung – eine Art doppelt hohe Garagentür –, in die die Leute ihre durchsichtigen Mülltüten werfen. Eine der Freuden macht hier das Werfen aus: Heute habe ich jede Tüte aus dem Unterarm heraus geworfen, sodass sie einen letzten, vielfarbig wirbelnden Moment in der Luft hatte, bevor sie in die Verdichtungsgrube fiel. Manchmal kippe ich die ganze Mülltonne (die ich hinten in meinem Van hergefahren habe) um und schüttele ihren Inhalt heraus, indem ich sie hoch über der Schulter halte: Die Tüten kommen langsam, leise zischend heraus, zurückgehalten von dem Vakuum, das ich mehrere Tage zuvor geschaffen hatte, indem ich sie fest in die Tonne stopfte, um den Deckel schließen zu können. Die Tüten für Normalmüll müssen durchsichtig sein, damit die Müllleute sich davon überzeugen können, dass man nichts Verbotenes hineinwirft, etwa Katzenstreu. Katzenstreu kommt in einen anderen riesigen Container, der abseits von dem großen steht, ein Behältnis, das ausschließlich Matratzen, alten Sofas und Katzenstreu vorbehalten ist.
Im Hauptgebäude sind drei Öffnungen – eine ist mit «Braun» etikettiert, an einer steht «Grün», an einer «Durchsichtig». Früher waren die Öffnungen mit Schwingklappen aus Plexiglas versehen, doch die Klappen sind jetzt entfernt – eine Verbesserung. In diese Öffnungen werfen wir Flaschen und Gläser. Wenn die Flaschen in die Tonnen auf der anderen Seite der Schwingklappen fallen (oder jenseits davon, wo die Schwingklappen waren, als es noch Klappen gab), ist das Geklirr, das sie dabei machen, schmerzhaft laut. Es ist eine Erleichterung, wenn die Flaschen zerbrechen: Zerbrechen ist merklich weniger laut als intaktes Klirren. Warum? Vielleicht weil etwas von der kinetischen Energie durch das Zerbrechen verbraucht wird und es keine zerbrochenen inneren Flaschenhohlräume gibt, die den ausstrahlenden Lärm ersticken.
Einen Hang links vom Hauptgebäude hinunter stehen zwei dunkelgrüne Container, jeder so groß wie ein Campingwagen. In den einen kommen Zeitungen und Zeitschriften, in den anderen kommt Pappe. In den Container für Pappe kann man Pizzakartons wie Frisbees schleudern und hoffen, dass sie oben auf dem Haufen landen, ganz hinten im Dunkeln. Oft rutschen die Kartons wieder heraus. Ich kippte mehrere Tüten mit Zeitungen in den Container für Zeitungen und Zeitschriften. Drinnen ist auf der Hälfte eine Trennwand, damit die anderthalb Meter hohe Papierflut nicht nach vorn rutschen kann. In diesem Nachrichtengelass ist es düster und warm: Die Hochglanz-Werbebeilagen machen glitschig-wispernde Geräusche, wenn man sie aus der Tüte entlädt.
Das Aufregendste an der Müllkippe ist der kleine Schuppen mit dem Zementboden und dem Schild darüber, auf dem «Tauschladen» steht. Darin lassen die Leute ihren funktionsfähigen Schrott zurück. Im Tauschladen sind mir heute drei Toaster, zwei Tischbacköfen, ein Fahrrad, ein Lehrbuch für Chirurgie, viele Paar Schuhe, zwei Tonbandgeräte und ein Kleinkindersitz fürs Auto aufgefallen. Ein Mann mit einem großen hochsitzenden Bauch lud eine grün-weiße Swimmingpool-Liege ab, die er nicht gebrauchen konnte, eine halbe Stunde später sah ich eine Großmutter damit weggehen und ihren Enkel mit einer Spielzeuggarage.
Mein Sohn und meine Frau brachten mir aus dem Tauschladen einmal ein Fahrrad mit: Es hat zwei Platten, aber sonst ist es noch gut in Schuss. Ein andermal entdeckten wir dort einen alten Rodelschlitten. Unsere Freunde, die Remicks, haben einen Heimtrainer, eine Tretmühle, mehrere Verlängerungskabel und einen Campingkocher, alles vom Tauschladen. Meine Beute war eine komplette Ausgabe der Golden Book Encyclopedia mit Trompe-l’Œil-Gemälden auf den Umschlägen – meine geliebte Kindheits-Enzyklopädie. Seitdem habe ich hier noch weitere solche Enzyklopädien gesehen – anscheinend schmeißen momentan Familien im ganzen Land die ihren raus. Heute Nachmittag habe ich mir ein Fünfzigerjahre-Taschenbuch von Lao-Tse und ein Buch über die Tschechoslowakei 1968 ausgesucht. (Lao-Tse sagt: «Regiere ein großes Land so, wie kleine Fische gegart werden.») Die Bücherregale sind im hinteren Teil des Schuppens – manchmal bereitet es mir ein seltsames Vergnügen, die Reihen der Reader’s-Digest-Sammelbände auszurichten.
Gerade geht eine ungefähr achtzigjährige Frau mit frischer weißer Dauerwelle zielstrebigen, aber manchmal unsicheren Schritts zum klaffenden Maul der Müllkippe. Sie trägt eine blaue Freizeithose und hat eine kleine durchsichtige Tüte mit sauberem Alte-Leute-Müll dabei. Sie wirft die Tüte hinein und beobachtet, wie sie ihren Platz unter den Beiträgen aller anderen einnimmt. Vielleicht wegen der Durchsichtigkeit der Tüten erscheint die Müllkippe wie ein Ort für Vertraulichkeiten – jeder kann sehen, was der andere nicht mehr will.
Jeden Sonntag fährt einer der Mitarbeiter die gezahnte Schaufel eines Baggers tief in den mit Pappe angefüllten Container, um sie zusammenzupressen: Mit heulendem Motor verschwindet der sinkende Arm des Geräts in das Gewirr der Kartons, die nach oben wie auch nach hinten gedrückt werden, und zieht sich wieder zurück wie eine Hand, die bei einer Tombola in einen Korb voller Lose greift, um den Gewinner zu ziehen.
(2000)
Mit Ohrstöpseln schreiben
Vor ein paar Jahren kaufte ich mir bei earplugstore.com eine Industrie-Spenderbox mit 200 Paar Mack’s Ohrstöpseln. Meistens kaufe ich sie aber im Drugstore. Seit kurzem bietet Mack’s sie in Orange an, was weniger eklig ist als weiß.
Ich kann überall sitzen, an jedem lauten Ort, und arbeiten. Alles geht sieben Meter weiter weg, als es tatsächlich entfernt ist. Jene tschilpende, bellende, klingelnde Kassenlade, die die Welt darstellt, ist außer Reichweite und daher kostbarer.
Man braucht eine gute Abdichtung. Löst man den Daumen von einem hineingestopften Stöpsel, stößt das Trommelfell einen winzigen, stummen Schmerzensschrei aus, wie ein Wort auf Arabisch. Dann weiß man, dass man eine gute Abdichtung hat.
(2007)
Eines Sommers
Eines Sommers wohnte ich in einem Haus, das gerade renoviert wurde, in einem hellgelben Zimmer mit einer Matratze auf dem Boden. Ich erwachte spät und versuchte, im Bett zu tippen. Ich arbeitete an einer Geschichte über einen Mann, der zufällig auf der Straße seinem Gehirn über den Weg läuft. Sein Gehirn trägt ein flottes Hütchen und hat es eilig. Es hat irgendeinen Verkaufsjob. Abends ging ich in ein Restaurant namens Gitsis Texas Hots, bestellte zwei Hot Dogs und eine Tasse Kaffee und sah mein Tagwerk von «Mein Gehirn» durch. Die Geschichte wurde nie fertig.
Eines Sommers fuhr meine Familie mit einer anderen Familie in einem Boot über die Georgian Bay. In dem Boot war ein Mädchen, das mit offenen Augen schlief.
Eines Sommers machten ein Freund und ich eine Fahrradtour. In einer Kleinstadt im Staat New York öffnete jemand eine Autotür, und wir beide stießen dagegen und stürzten auf die Straße. Und uns war nichts passiert. Später versammelte sich in dem Baum über unseren Schlafsäcken am frühen Morgen eine Schar Vögel.