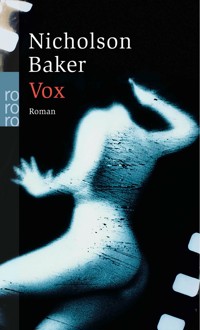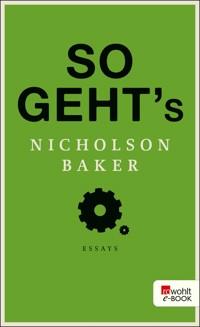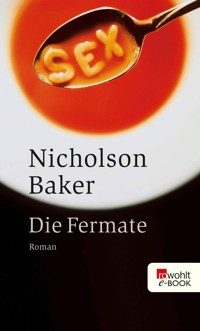
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine kunstvolle und äußerst amüsante Satire auf unser Zeitalter des Sex. Arno Strine, der Held in Nicholson Bakers Roman Die Fermate, verfügt über die phantastische Gabe, mit einem Fingerschnippen die Zeit anzuhalten. Eine herrliche Chance, Frauen auszuziehen! Doch zugleich ist Arno ein Produkt des Medienzeitalters und ein Mensch, der nichts mehr ersehnt als ein bisschen echte Intimität. Bakers erotische Satire zeichnet sich durch kunstvolle Sprache, Wortwitz und unerwartete Wendungen aus. «Arno Strine ist ganz zweifellos eines der reizendsten Schweine der Literaturgeschichte», schrieb der Stern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte Die Fermate «ein hinreißendes Buch». Ein Skandal wie weiland Nabokovs Lolita? «Mitnichten – dafür ist das Ganze viel zu komisch», urteilte Die Weltwoche. Tauchen Sie ein in Nicholson Bakers Welt der Erotik, Sexualität und des Voyeurismus – humorvoll, geistreich und provokant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nicholson Baker
Die Fermate
Roman
Über dieses Buch
«Arno Strine ist ganz zweifellos eines der reizendsten Schweine der Literaturgeschichte.» (Stern)
Eine kunstvolle, lustvolle und äußerst amüsante Satire auf unser Zeitalter des Sex. Ihr Held Arno Strine verfügt über die phantastische Gabe, mit einem Fingerschnippen die Zeit anzuhalten. Eine herrliche Chance, Frauen auszuziehen! Doch zugleich ist Arno ein Produkt des Medienzeitalters und ein Mensch, der nichts mehr ersehnt als ein bisschen echte Intimität.
«Ein hinreißendes Buch.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
«Es wundert nicht, dass der Wäschegrabscher und Spielzeug-Sexist von der amerikanischen Kritik als Ausgeburt eines Pornographen ausgemacht wurde. Ein Skandal wie weiland Nabokovs ‹Lolita›? Mitnichten – dafür ist das Ganze viel zu komisch.» (Die Weltwoche)
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel «The Fermata» bei Random House, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2013
Copyright © 1994 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Fermata» Copyright © 1994 by Nicholson Baker
Umschlaggestaltung Walter Hellmann
ISBN 978-3-644-03031-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Für meinen Vater
Eins
Ich werde meine Autobiographie Die Fermate nennen, obwohl «Fermate» nur einer der vielen Namen ist, die ich für die Furche habe. «Furche» ist natürlich auch einer. Von Zeit zu Zeit, für gewöhnlich im Herbst (vielleicht einfach nur deshalb, weil meine Hormonströme dann am stärksten sind), merke ich, dass ich über die Fähigkeit verfüge, in die Furche zu springen. Ein Furchensprung ist ein Zeitraum von unterschiedlicher Länge, in dem ich lebendig und bewegungsfähig bin und denke und schaue, während die übrige Welt angehalten ist oder pausiert. Über die Jahre musste ich mir vielerlei Techniken ausdenken, um den Stopp auszulösen. Bei manchen kamen Kippschalter, Gummibänder, Nähnadeln, Nagelknipser und andere Haushaltsgegenstände zum Einsatz, bei anderen nicht. Die Fähigkeit scheint letztendlich aus mir selbst heraus zu kommen, so bombastisch das auch klingen mag, aber wenn ich sie beschwöre, muss ich glauben, dass sie mir äußerlich ist, damit es richtig funktioniert. Ihren Ursprüngen versuche ich nicht sehr oft nachzuspüren, weil ich befürchte, dass zu genaue Nachforschungen jedwede inneren Zustände zerstören könnten, die ihr zugrunde liegen; schließlich ist sie das bedeutendste und beständigste Abenteuer meines Lebens.
In der Tat befinde ich mich auch jetzt, in diesem Moment, in der Furche. Doch zunächst würde ich gern meinen Namen hinschreiben – ich heiße Arnold Strine. Arno ist mir allerdings lieber als das ausgeschriebene Arnold. Meinen Namen zu tippen rüstet mich irgendwie – es hilft mir, in dieser Sache voranzukommen. Ich bin fünfunddreißig. Ich sitze auf einem Bürostuhl, dessen vier breite schwarze Rollen lautlos über den Teppichboden gleiten, im sechsten Stock des MassBank-Gebäudes im Zentrum von Boston. Ich blicke zu einer Frau namens Joyce hoch, die ich zwar nicht ausgezogen, aber deren Kleidung ich etwas umarrangiert habe. Ich blicke sie direkt an, aber sie merkt nichts davon. Während ich sie anblicke, halte ich das, was ich sehe und denke, mit einer elektronischen, von vier D-Batterien gespeisten Casio-CW-16-Kofferschreibmaschine fest. Bevor ich mit den Fingern geschnippt habe, um den Zeitfluss im Universum anzuhalten, ist Joyce in einem graublauen Strickkleid über den Teppichboden gegangen, während ich ungefähr zehn Meter entfernt an einem Schreibtisch saß und ein Band abtippte. Ich konnte ihre Hüftknochen unter dem Kleid sehen und wusste sogleich, dass es Zeit zum Einschnippen war. Die Handtasche hängt noch über ihrer Schulter. Ihr Schamhaar ist tiefschwarz und schön anzusehen – es ist sehr dicht. Wenn ich nicht schon wüsste, wie sie heißt, würde ich jetzt wahrscheinlich ihr Portemonnaie öffnen und es in Erfahrung bringen, weil es besser ist, wenn ich den Namen der Frauen kenne, die ich ausziehe. Zudem hat es etwas sehr Erregendes, fast Bewegendes, einen schnellen Blick auf den Führerschein einer Frau zu werfen, ohne dass sie es weiß – das Bild zu mustern und zu überlegen, ob es ihr gefallen oder sie unglücklich gemacht hat, als sie es bei der Zulassungsstelle ausgehändigt bekam.
Doch den Namen dieser Frau kenne ich. Ich habe schon ein paar von ihren Bändern abgetippt. Die Sprache ihrer Diktate ist lockerer als die mancher anderen in der Kreditabteilung – gelegentlich benutzt sie Wendungen wie «auf Vordermann bringen», «abhaken» oder «in Angriff nehmen», die man in den monatlichen Kreditberichten größerer Regionalbanken nur sehr selten findet. Kürzlich endete eines ihrer Diktate ungefähr folgendermaßen: «Kyle Roller gab zu verstehen, dass er sich mit dem Thema seit 1989 befasst habe. Seitdem liegt das Volumen bei 80000 $. Er betonte, dass ihr Service unterdurchschnittlich sei. Er gab zu verstehen, dass er weitere Geschäfte mit ihnen auf Eis gelegt habe, weil sie ihn ‹nach Strich und Faden angelogen› hätten. Er gab ferner zu verstehen, er wolle nicht, dass sein Name den Pauley Brothers gegenüber erwähnt werde. Diese Information wurde Joyce Collier am …» (sie sagte das Datum) «… übermittelt.» Vom Stil her mag das nicht gerade Penelope Fitzgerald sein, aber in diesen Berichten lechzt man ja nach jeder kleinen Lebenszuckung, und ich gebe zu, dass es mich wie ein Pfeil durchbohrte, als ich sie «nach Strich und Faden angelogen» sagen hörte.
Letzte Woche trug Joyce schon einmal dieses graublaue, das Hüftbein betonende Kleid. Sie legte mir ein Band zum Abtippen hin und sagte mir, dass ihr meine Brille gefalle, und seitdem bin ich verrückt nach ihr. Ich errötete, dankte ihr und sagte, dass mir ihr Halstuch gefalle, und es war auch wirklich ein sehr hübsches Halstuch. Es war in allen möglichen Gold-, Schwarz- und Gelbtönen sowie mit kyrillischen Buchstaben designt. Sie sagte: «Ach, vielen Dank, mir gefällt es auch» und überraschte mich (und wahrscheinlich uns beide) damit, dass sie es vom Hals löste und langsam durch die Finger zog. Ich fragte, ob das tatsächlich kyrillische Buchstaben seien, die ich da vor mir sähe, und sie bejahte, erfreut über mein Interesse, aber dann sagte sie, sie habe einen Freund, der Russisch könne, gefragt, was sie bedeuteten, und er habe gemeint, sie bedeuteten nichts, es sei nur ein Buchstabengewirr. «Umso besser», sagte ich idiotischerweise; es war mir wichtig, ihr zu zeigen, wie kalt es mich ließ, dass sie einen Freund erwähnt hatte. «Der Designer hat die Buchstaben wegen ihrer äußerlichen Schönheit ausgewählt – er tat nicht so, als würde er die Sprache kennen, indem er ein wirkliches Wort verwendete.» Die Situation drohte koketter zu werden, als wir beide es wollten. Ich überspielte das rasch, indem ich sie fragte, wie schnell sie das Band erledigt haben wolle. (Ich bin übrigens Zeitarbeiter.) «Eilt nicht», sagte sie. Sie band sich ihr Halstuch wieder um, und bevor sie ging, lächelten wir uns noch einmal fast innig zu. Den ganzen Tag war ich glücklich, nur weil sie gesagt hatte, dass ihr meine Brille gefiel.
Joyce wird in meinen Lebensaufzeichnungen wohl kaum eine größere Rolle spielen. Ich habe mich schon sehr, sehr oft in Frauen verliebt, vielleicht hundert- oder hundertfünfzigmal; auch ausgezogen habe ich Frauen schon oft: Die Umstände, in denen ich mich momentan befinde, sind daher nicht besonders ungewöhnlich. Ungewöhnlich daran ist nur, dass ich jetzt darüber schreibe. Ich weiß, dass es Tausende von Frauen auf der Welt gibt, für die ich potenziell Liebe empfinden könnte so wie jetzt für Joyce – zufällig arbeitet sie eben in diesem Büro in der Inlandskreditabteilung der MassBank, wo ich ebenso zufällig ein paar Wochen Zeitarbeiter bin. Doch das ist das Eigenartige an den Erwartungen, die das Leben an einen stellt – man soll vergessen, dass es Hunderte von Städten gibt, jede einzelne voller Frauen, und dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass man die ideale für sich gefunden hat. Man soll sich einfach die Beste aus denen aussuchen, die man kennt und für sich einnehmen kann, und das tut man dann auch ganz vergnügt – mit dem Gefühl, dass die Liebe, die man der Auserwählten zukommen lässt, schon nicht verschenkt sein wird.
Es war aber auch mutig und freundlich von Joyce, mir so ein Kompliment wegen meiner Brille zu machen. Ich schmelze auf der Stelle dahin, wenn man mich wegen etwas lobt, woran ich innerlich so meine Zweifel habe. Meine erste Brille bekam ich im Sommer nach der vierten Klasse. (Im Übrigen ist die Vierte auch das Jahr, in dem ich erstmals in die Furche sprang – meine Herrschaft über die Zeit war schon immer auf eine Weise, die zu verstehen ich nicht vorgebe, mit meinem Gesichtssinn verbunden.) Bis vor zwei Jahren, als ich beschloss, es wenigstens einmal mit Kontaktlinsen zu versuchen, trug ich sie regelmäßig. Vielleicht wäre alles anders, wenn ich Linsen hätte. Also besorgte ich mir welche, und ich hatte meinen Spaß mit den Ritualen ihrer Pflege – der Pflege dieses anspruchsvollen Zwillingspaars, das ständig gebadet und gewechselt werden musste. Ich fand es schön, sie mit der Salzlösung zu bespritzen, eine davon in einer Wasserperle auf der Fingerspitze zu haben und ihren saarinenesken Aufschwung zu bewundern, und wenn ich sie zusammenbog und Oberfläche an leicht glitschiger Oberfläche rieb, um die Proteinablagerungen aufzubrechen, erinnerte ich mich oft an die Befriedigung beim Zubereiten eines Omeletts in einer Teflonpfanne. Doch obwohl sie als Hobby dankbar waren und obwohl ich, wenn ich die Zentrifugalreinigungsmaschine, die ich eigens für sie bestellt hatte, öffnete, ebenso erregt war, wie ich es gewesen wäre, hätte ich einen automatischen Brotbackofen oder ein neuartiges Erotikspielzeug gekauft, störten sie doch meine Würdigung der Welt. Auch durch sie hindurch konnte ich sehen, aber freuen konnte ich mich nicht an dem, was ich sah. Die gesamte Bandbreite meiner optischen Prozessoren wurde mit «Auf-deinem-Augapfel-ist-ein-Störenfried»-Botschaften überflutet, sodass vieles von den visuellen Nebenerträgen meiner Retina einfach nicht durchkam. Die Anblicke, die einem doch Spaß machen sollen, etwa wenn man an einem stürmischen Tag durch den Park geht und beobachtet, wie den Leuten die Handtaschen am Arm herumgeweht werden – sie machten mir keinen Spaß.
Zunächst dachte ich, der Verlust der Schönheit der Welt lohne sich, wenn man dann für die Welt besser aussähe: Ohne Brille sah ich wirklich besser aus – die flotte Narbe auf meiner linken Braue, wo ich mich an einem Aluminiumrest geschnitten hatte, wurde dadurch auffälliger. Ein Mädchen von der High School, das ich kannte (und auszog), sang immer leise nach einer selbsterfundenen Melodie «Il faut souffrir pour être belle», und diesen abgelauschten Grundsatz nahm ich ernst; ich war bereit, ihn nicht nur im engeren Sinn des schmerzhaften Haarebürstens oder (sagen wir) Augenbrauenzupfens und Lippensaugens zu begreifen, sondern in jenem weiteren Sinn, dass Leiden den Grund für Schönheit in der Kunst legt, dass der Künstler oder die Künstlerin Gram und Not erleiden muss, um seinem oder ihrem Publikum Schönheit zu liefern – dieser ganze abgenudelte Schrott. Und so trug ich weiterhin Linsen, selbst wenn jedes Blinzeln eine Trockenfolter war. Aber dann bemerkte ich, dass auch mein Tippen litt – und da, denn ich bin Zeitarbeiter und verdiene mit Tippen mein Brot, war nun wirklich die Grenze erreicht. Besonders wenn ich Zahlen tippte, war meine Fehlerquote gewaltig. (Einmal tippte ich zwei Wochen lang nichts anderes als sechsstellige Zahlen.) Immer häufiger bekam ich auf einmal Finanztabellen, die ich angelegt hatte, mit rot umkringelten falsch getippten Zahlen und der Frage zurück: «Fühlen Sie sich heute nicht wohl, Arno?» Auch fiel mir auf, dass mir Kontaktlinsen, ähnlich wie es bei ständigem lautem Fabriklärm der Fall wäre, das Gefühl gaben, drei Meter von allen anderen um mich herum entfernt zu sein. Sie isolierten mich, trugen nicht dazu bei, meine – naja, ich sollte es wohl meine Einsamkeit nennen – loszuwerden, sondern verstärkten sie noch. Ich vermisste die scharfen Ränder meiner Brille, die mir geholfen hatten, mir einen Weg ins gesellige Leben zu bahnen; sie waren ein Teil dessen gewesen, was, wie ich fand, mein typischer Ausdruck war.
Als ich heute hiermit anfing, hatte ich nicht die Absicht, mich mit dieser Brillengeschichte aufzuhalten. Aber sie spielt eine wesentliche Rolle. Ich sehe mir gern Frauen an. Ich möchte sie gern klar sehen können. Und das ganz besonders gern in einer Situation wie dieser, in der ich mich jetzt gerade befinde und in der ich Joyce nicht direkt ansehe, sondern vielmehr über die erstaunliche Tatsache nachdenke, dass ich jederzeit von der Seite aufblicken und auf jeden Teil von ihr, der nach mir schreit, starren kann, so lange ich will, ohne sie zu belästigen oder in Verlegenheit zu bringen. Joyce trägt keine Brille, aber meine Exfreundin Rhody trug eine – und irgendwann merkte ich dann, dass Frauen, wenn sie mir mit Brille gefielen, was sie durchaus tun, auch an mir eine Brille akzeptieren würden. Eine Brille an einer nackten Frau bringt mir dasselbe wie manchen Männern Stöckelschuhe, eine tätowierte Schlange, ein Fesselkettchen oder ein falscher Schönheitsfleck – sie hebt ihre Nacktheit hervor; sie bewirkt, dass die Frau nackter erscheint, als sie es vollständig nackt täte. Auch möchte ich ganz sicher sein, dass sie jeden Zoll meines Richards mit absoluter Klarheit sieht, und wenn sie eine Brille trägt, dann weiß ich, dass sie es kann, wenn sie will.
Der entscheidende Moment kam schließlich, als ich eine Nacht mit einer Frau verbrachte, einer Büroleiterin, die, glaube ich jedenfalls, früher mit mir schlief, als sie eigentlich vorhatte, nur weil sie nicht wollte, dass ich merkte, wie ihre Linsen sie störten. Es war sehr spät, aber ich glaube, sie wollte noch etwas länger reden, und dennoch (so meine Theorie) hatte sie es ganz eilig, ins Bett zu kommen, weil die nach ihrer Denkweise extreme Intimität, mit ihrer Brille vor mir zu erscheinen, nur nach der weniger extremen Intimität, mit mir zu vögeln, möglich war. Da ihre Augen wirklich ganz unglücklich rosa aussahen, lag es mir mehrmals während unserer Unterhaltung auf der Zunge zu sagen: «Möchtest du dir nicht die Linsen rausnehmen? Ich nehm meine auch raus.» Aber dann tat ich es doch nicht, weil ich dachte, es könnte herablassend klingen, nach dem Motto «Ich weiß alles über dich, Baby, deine blutunterlaufenen Augen verraten dich». Vielleicht hätte ich es doch sagen sollen. Aber ein paar Tage danach trug ich bei der Arbeit wieder die Brille. Sogleich sank meine Fehlerquote. Sogleich war ich glücklicher. Insbesondere erkannte ich die entscheidende Bedeutung von Scharnieren für meine Lebensfreude. Wenn ich morgens vor dem Duschen und dem Weg zur Arbeit meine Brille aufklappe, bin ich wie ein aufgeregter Tourist, der sich an seinem ersten Urlaubstag aus dem Hotelbett erhoben hat: Gerade habe ich die beiden Verandatüren aufgerissen, die auf einen sonnenbeschienenen Balkon mit Blick auf die gesamte was auch immer führen – Schifffahrtsstraße, Bucht, Tal, Parkplatz. (Wie kann man nur den Blick auf einen Motelparkplatz am frühen Morgen nicht schön finden? Die neuen, subtileren Autofarben, die blaugrünen und die wärmeren Grautöne, dazu das Wissen, dass all die Fahrer in der Demokratie des Schlafes nivelliert und die Scheiben und Hauben draußen kalt und sogar betaut sind, geben Anlass zu einer der inspirierenderen Visionen, die das Leben vor neun Uhr bereithalten kann.) Aber vielleicht sind es die Verandatüren doch nicht so ganz. Vielleicht stelle ich mir eher vor, dass die Scharniere meiner Brille die Hüftgelenke einer Frau sind: Ihre langen, grazilen Beine öffnen sich und sitzen den ganzen Tag rittlings auf meinem Gesicht. Einmal fragte ich Rhody, ob es ihr gefalle, wenn mein Brillengestell sie innen an den Schenkeln kitzelte. Sie sagte: «Meistens hast du die Brille dann ja schon abgenommen, oder?» Das musste ich zugeben. Sie sagte, es gefalle ihr nicht, wenn ich die Brille aufhabe, weil sie wolle, dass mein Eindruck von ihrer offenen Vaga eher sisleyhaft als Richard-Estes-mäßig sein sollte. «Aber manchmal mag ich es, wenn deine Ohren ganz oben über meine Schenkel streichen», räumte sie ein. «Und wenn ich deine Ohren fest mit den Schenkeln zudrücke, kann ich mehr Geräusche machen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich außer Kontrolle gerate.» Rhody war ein guter, ja, ein sehr guter Mensch, und vielleicht hätte ich doch nicht versuchen sollen, wenn auch noch so versteckt auf meine Furchenerlebnisse anzuspielen, da sie das wenige, was ich ihr über die Fermatierung erzählt hatte, abstoßend fand; was sie davon erfuhr, trug zu unserer Trennung bei.
So! Ich denke, ich habe nachgewiesen, dass mein Brillentragen eine emotionale Vorgeschichte hat. Indem die große Joyce – die, während ich das tippe, im Zustand der Halbnacktheit über mir aufragt – also sagte, dass die Brille ihr gefalle, sagte sie genau das Richtige, wenn sie mein Herz gewinnen wollte, was wahrscheinlich gar nicht der Fall war. Man muss sehr vorsichtig sein mit Komplimenten an einen fünfunddreißigjährigen Zeitarbeiter, der in seinem Leben noch nichts erreicht hat. «Hallo, ich bin der Zeitarbeiter!» Das sage ich meist am ersten Tag eines Auftrags zu dem Menschen am Empfang; das ist das Wort, das ich benutze, weil es das Wort ist, das jeder benutzt. Seit über zehn Jahren, seit ich von der Uni weg bin, bin ich nun Zeitarbeiter. Dass ich nichts aus meinem Leben gemacht habe, liegt einfach daran, dass meine Fähigkeit, in die Furche zu springen (oder «die Kupplung zu treten», «die Spalte zu finden», «einen Tag frei zu nehmen» oder «einen Aufschub zu erwirken»), kommt und geht. Ich schätze diese Fähigkeit, die, wie ich vermute, nicht weit verbreitet ist, aber weil ich sie nicht ständig habe, weil sie ohne Vorwarnung nachlässt und erst Monate oder Jahre später wiederkehrt, hänge ich in einer Art zerstörerischem kondratjewschen Boom-und-Pleite-Kreislauf fest. Habe ich sie verloren, existiere ich einfach, tue nur das Minimum, um mich am Leben zu erhalten, weil ich weiß, dass alles, was ich erreichen will (und ich habe meine Ambitionen), gewissermaßen unendlich aufschiebbar ist.
Grob geschätzt habe ich insgesamt vielleicht nur zwei Jahre Privatzeit in der Furche verbracht, wenn man die einzelnen Minuten und Stunden zusammenzählt, vielleicht sogar weniger; aber sie gehören mit zum Besten, Lebendigsten, was ich erlebt habe. Mein Leben erinnert mich an das Problem mit der Kapitalertragssteuer, worüber ich einmal einen Zeitungskommentar gelesen habe: Wenn der Gesetzgeber die Prozentsätze des steuerfreien Kapitalgewinns ständig ändert oder dies auch nur verspricht und dabei die Steuer aufhebt und wieder einsetzt, beginnt der rational denkende Investor, seine Investitionsentscheidungen nicht auf die bestehenden Steuergesetze zu gründen, sondern auf die Gewissheit, dass sie sich ändern werden, was (so die überzeugende Argumentation der Kommentatorin) den Kreislauf des Kapitals destruktiv in falsche Kanäle lenkt. So geht es auch mir während der Zeiten, in denen ich darauf warte, dass meine Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, wiederkommt. Ich denke: Warum soll ich jetzt Ernst Renan lesen oder Matrix-Algebra lernen, da ich, wenn ich wieder in der Lage bin zu furchen, Privatstunden oder gar -jahre damit verbringen kann, jedwede flüchtige intellektuelle Neugier zu befriedigen, während die ganze Welt auf mich wartet? Nachholen kann ich immer. Und das ist das Problem.
Wenn ich an meinem ersten Arbeitstag in einem Büro erscheine, ist man etwas verwirrt – warum macht dieser nicht mehr junge Mann, dieser fünfunddreißig Jahre alte Mann Zeitarbeit? Vielleicht hat er eine kriminelle Vergangenheit, vielleicht hat er zehn Jahre mit Drogen verloren, oder: Vielleicht ist er ja ein Künstler? Aber nach ein paar Tagen hat man sich daran gewöhnt, denn ich bin eine ziemlich tüchtige und gutwillige Schreibkraft, vertraut mit den meisten der üblicherweise angewandten Softwares (und auch mit einigen der vergessenen wie nroff, Lanier und NBI sowie den guten alten treuen DEC-Systemen mit dem goldenen Schlüssel), und ich kann schwierige Handschriften ungewöhnlich gut lesen und auch für Diktierende, die in ihrer kreativen Erregung so manches vergessen, Satzzeichen hinzufügen. Gelegentlich benutze ich meine Furchenfähigkeit, um alle mit meiner scheinbaren Tippgeschwindigkeit zu verblüffen; ich schreibe dann ein Zweistundenband in einer Stunde ab oder dergleichen. Aber ich achte darauf, sie nicht zu oft zu verblüffen und eine Zeitarbeiterlegende zu werden, da dies mein großes Geheimnis ist, das ich nicht gefährden will – es ist das Einzige, was mein Leben lebenswert macht. Wenn die Intelligenteren in irgendeinem Büro mir prüfend höfliche kleine Fragen stellen, um mir auf den Zahn zu fühlen, lüge ich oft und sage, ich sei Schriftsteller. Es ist fast komisch, mit anzusehen, wie erleichtert sie sind, endlich eine Erklärung für mein geringes berufliches Ansehen zu haben. Und eine so große Lüge ist es ja auch gar nicht, denn hätte ich nicht so viel von meinem Leben damit verschwendet, auf die nächste Fermatenphase zu warten, dann hätte ich inzwischen sehr wahrscheinlich irgendein Buch geschrieben. Und ein paar kleinere Sachen habe ich tatsächlich auch geschrieben.
Ich tippe dies auf einer elektronischen Kofferschreibmaschine, weil ich nicht riskieren will, etwas davon in das LAN der Bank einzugeben. In der Furche sind Local Area Networks unberechenbar. Wenn es mit meinem Karpaltunnel schlimm wird, schreibe ich meine privaten Sachen auf einer manuellen; davon scheint es besser zu werden. Aber ich muss nicht: Batterien und Elektrizität funktionieren in der Furche durchaus – überhaupt bleiben, soviel ich sehen kann, alle Gesetze der Physik in Kraft, aber nur insoweit, als ich sie zu neuem Leben erwecke. Am besten beschreibe ich es so, dass sich jetzt in diesem Moment, weil ich mit den Fingern geschnippt habe, jegliches Geschehen überall im Zustand gelartiger Erstarrung befindet. Ich kann mich bewegen, und die Luftmoleküle teilen sich, um mich durchzulassen, aber sie tun es widerstrebend, widerwillig, und je weiter ein Gegenstand von mir entfernt ist, desto gründlicher pausiert er. Wenn einer gerade auf dem Motorrad einen Berg hinabfuhr, ehe ich «vor einer halben Stunde» die Zeit anhielt, verharrt der Fahrer reglos auf dem Motorrad, es sei denn, ich gehe zu ihm und stupse ihn an – worauf er umfällt, aber etwas langsamer, als er in einem nicht pausierenden Universum fiele. Er würde nicht mit der Geschwindigkeit, mit der er fuhr, weiter bergabrollen, er würde einfach nur umkippen. Ich war immer versucht, in der Furche kleine Flugzeuge zu fliegen, aber so dumm bin ich nicht. Fliegen ist aber eindeutig möglich, ebenso wie die Zeitpausierung in einem fliegenden Flugzeug. Die Welt kommt so, wie sie ist, zum Stillstand, nur nicht da, wo ich die Hand im Spiel habe, und meistens versuche ich, so unaufdringlich wie möglich zu sein – so unaufdringlich, wie meine Lust es zulässt. Beispielsweise setzt diese Schreibmaschine aufs Blatt, was ich tippe, weil durch den Vorgang des Tastendrückens Ursache und Wirkung lokal funktionieren. Ein Kreislauf wird geschlossen, ein wenig Elektrizität tröpfelt aus den Batterien usw. Ich weiß ehrlich nicht, wie weit nach außen sich meine persönliche Verzerrung der temporären Zeitlosigkeit, die ich schaffe, messbar ausbreitet. Allerdings weiß ich, dass sich die Haut einer Frau während einer Fermate weich anfühlt, wo sie weich ist, und warm, wenn sie warm ist – auch ihr Schweiß fühlt sich warm an, wenn er warm ist. Es ist eine Art umgekehrter Midas-Effekt, den ich in der Furche bewirke – die Welt ist reglos und statuesk, bis ich sie berühre und wieder normal weiterleben lasse.
Die Idee, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben, kam mir erst gestern bei einem typischen chronanistischen Erlebnis. Es ist fast unglaublich, wenn man bedenkt, dass ich seit der vierten Klasse furche und mich dennoch nie aufgerafft habe, darüber zu schreiben, während ich mich in dem Zustand befand. Eine Weile führte ich an der High School und am College in Kurzform Buch – Datum und Uhrzeit der Furche, was ich machte, wie lange in persönlichen Minuten, Stunden oder Tagen sie dauerte (denn Uhren laufen in der Furche zumeist wieder weiter, wenn ich sie schüttle, ich kann also leicht messen, wie lange ich draußen war), ob ich etwas Neues erfahren habe oder nicht und so weiter. Man sollte meinen, wenn einer tatsächlich die Welt anhalten und aussteigen kann wie ich, dann würde er ziemlich früh darauf kommen, die Welt einmal anzuhalten, um mit einiger Sorgfalt zum Nutzen der Neugierigen aufzuzeichnen, wie es ist, wenn man die Welt anhält und aussteigt. Aber ich merke schon jetzt, so früh in meiner ersten autobiographischen Fermate, warum ich es nie getan habe. Leider ist es genauso schwierig, während einer Fermatierung zu schreiben wie in der Echtzeit. Nach wie vor muss man alles, was man zu sagen hat, hintereinandersetzen, während man doch natürlich alles auf einmal sagen will. Aber ich versuch’s einfach mal. Ich bin jetzt fünfunddreißig, und ich habe mit Hilfe der Furche eine ganze Menge gemacht, meist Schlimmes (darunter übrigens auch die scheinbar auswendige Rezitation von Dylan Thomas’ «Gedicht zu seinem Geburtstag» in der letzten Stunde eines Seminars über moderne lyrische Dichtung am College: Es ist ein längeres Gedicht, und jedes Mal, wenn ich aus Nervosität eine Zeile vergessen hatte, hielt ich einfach die Welt an, indem ich den Kippschalter meines Zeitverzerrers – so nannte ich den modifizierten Garagentüröffner, den ich damals benutzte – umlegte und mein Gedächtnis mit einem Blick auf den Text, den ich in meinem Notizheft hatte, auffrischte, und keiner merkte was) – und wenn ich jetzt nicht einige dieser privaten Abenteuer niederschreibe, dann werde ich es bereuen, das weiß ich.
Gerade habe ich mich auf meinem Stuhl umgedreht, um mich wieder mit dem Anblick von Joyce’ Schamhaar zu überraschen. Nach all den Jahren finde ich es noch immer ungeheuerlich, dass ich das kann. Sie war etwa zehn Meter von meinem Schreibtisch entfernt durch einen weiten leeren Raum gegangen, ein paar Papiere auf dem Arm, zu jemand in seinem Abteil, und mein Blick schoss nur so zu ihr hin, tauchte sauber, ohne Kringel, durch die Brille, die sie schön gefunden hatte, schöpfte Mut daraus, dass er durch den optischen Einfluss von etwas, das sie bemerkt und gemocht hatte, hindurchmusste. Es war, als bewegte ich mich am Bogen meines Gesichtsfeldes entlang und berührte sie visuell. (An jenen mittelalterlichen Theorien des Sehens, nach denen die Augen Strahlen aussenden, ist bestimmt etwas dran.) Und eben als mein sehendes Ich sie erreichte, blieb sie einen Moment stehen, um etwas in den Papieren, die sie trug, nachzusehen, und als sie hinabsah, fiel mir die schlichte Tatsache auf, dass ihre Haare heute geflochten waren.
Sie sind zu einem französischen Zopf, so heißt das, glaube ich, geflochten. Jedes der massiven Haarbüschel trägt zur Gesamtfestigkeit des Zopfes bei, und die ganze Konstruktion ist als Teil ihres Kopfes geflochten, wie eine Reihe schimmernder außenliegender Rückenwirbel. Es beeindruckt mich, dass Frauen eine so komplizierte Form hinbekommen können, und das ohne viele lose Strähnen, ohne Hilfe, morgens, nach Gefühl. Frauen stehen in viel engerem Kontakt mit ihrem Rücken als Männer: Sie können weiter hinaufgreifen und tun dies auch täglich, um den BH zu lösen, sie können sich die Haare stutzen und flechten, sie können ihre hinteren Blusenschöße sauber in den Rock gestopft halten. Sie machen sich Gedanken darüber, wie die Ränder ihrer Unterhose von hinten durch die taschenlose Hose hindurch aussehen. («Höschen» ist ein Wort, das man vermeiden sollte, finde ich.) Aber ein französischer Zopf, in dem drei sportliche Delphine sanft untereinander hinwegtauchen und in einer unablässigen eleganten Verschlingung wieder an die Oberfläche kommen, ist das schönste und eindrucksvollste Ergebnis dieses Gefühls für den Dorsalbereich. Kaum hatte ich Joyce’ Zopf gesehen, wusste ich, dass es Zeit war, die Zeit anzuhalten. Ich musste ihren massiven Zopf und den Kopf darunter in meiner Hand fühlen.
Gerade als sie weitergehen wollte, schnippte ich also mit den Fingern. Das ist meine neueste Methode, in die Furche zu gelangen, und eine der einfacheren, die ich bis jetzt entwickeln konnte (viel direkter als etwa meine früheren Techniken der mathematischen Formel oder der vernähten Schwielen, auf die ich noch zurückkommen werde). Sie hörte das Schnippen nicht, nur ich hörte es – das Universum hält an einem unbestimmten Punkt an, kurz bevor mein Mittelfinger gegen den Daumenballen klatscht. Ich holte meine Casio hervor und rollte auf meinem Stuhl zu ihr hinüber. (Ich rollte nicht rückwärts, sondern vorwärts, was auf Teppichboden gar nicht so leichtfällt, weil es schwierig ist, die richtige Bodenhaftung zu bekommen. Ich wollte sie unterwegs nicht aus den Augen verlieren.) Sie war mitten im Schritt begriffen. Ich streckte die Hände aus und legte sie auf ihre Hüftbeine. Es fühlte sich an, als sei Kaschmir oder etwas ähnlich Feines in der Wolle, und es war schön, ihre Hüftbeine durch den weichen Stoff zu fühlen und zu sehen, wie meine Hände sich, der Innenkurve ihrer Taille folgend, die das Kleid in gewissem Maß verborgen hatte, winkelten. Manchmal, wenn ich in der Furche eine Frau das erste Mal berühre, spanne ich die Arme an, bis sie vibrieren, sodass die Form dessen, was unter meinen Händen ist, als neue Information durch meine Nerven weitergeleitet wird. Ich weiß vorher nie genau, was ich während eines Sprungs mache. Um ihr Kleid aus dem Weg zu bekommen, hob ich den weichen Saum über ihre Hüften, raffte ihn zu zwei flügeligen Ballen und schlang diese zu einem großen, weichen Knoten. Es hatte so ausgesehen, als habe sie unter dem Kleid ein kleines Spitzbäuchlein (bei manchen Frauen kann das, finde ich, sexy wirken), aber wenn dem so war, dann verschwand es oder verlor seine Kontur, sobald ich ihr die Strumpfhose und Unterhose, so weit ich konnte, herunterzog, was nicht sehr weit war, da ihre Beine gehend auseinanderstanden. (Bevor ich jedoch ihre Strumpfhose, die von rauchblauer Farbe ist, herunterzog, berührte ich durch eine Laufmasche im dunkleren Teil oben an der Hüfte ein Oval ihrer Haut.) Und dann bot sich mir der Anblick, den ich jetzt vor mir habe, der Anblick ihrer Schamhaare.
Normalerweise stehe ich nicht sonderlich auf Schamhaar – ich habe, glaube ich, keinerlei Dauerfetische, weil jede Frau anders ist, und man weiß ja nie, welche besondere Eigenheit oder welcher Zwischenschritt zwischen Eigenheiten einen packt und sagt: «Sieh dir das an – genau das ist dir noch nie in den Sinn gekommen!» Jede Frau inspiriert ihren eigenen Fetisch. Und es ist ja nicht so, dass Joyce einen lächerlichen Vaga-Afro oder eine gewaltige Totschlägerwucherung von einem Sexspitzbart gehabt hätte – eigentlich ist ihre Behaarung gar nicht dichter als bei den meisten anderen. Nur bedeckt sie vielleicht eine größere Fläche, und ihre Schwärze funkelt sozusagen – ihr gewölbter Rand reicht ein wenig weiter den Bauch hoch. Ein wenig? – was sage ich da? Sie ist so groß wie Südamerika! Der Gedanke, ich hätte sterben können, ohne das gesehen zu haben – ich hätte mir einen anderen Auftrag aussuchen können, als Jenny, meine Koordinatorin, mir vor ein paar Wochen sagte, was ich zur Auswahl hatte. Das Erregende an ihren Ausmaßen ist vielleicht, dass sie, weil sie höher reicht als die Schambehaarung bei anderen Frauen, asexueller und zugleich auch sexueller wird – die Slangbegriffe dafür wie «Mösenhaare» und «Fotzenhaare» (ich scheue mich vor beiden Wörtern, außer wenn ich kurz vor dem Kommen bin) treffen hier nicht zu, weil es, strenggenommen, gar kein «Scham»haar mehr ist – seine Ränder reichen bis in die weichen Liebesregionen des Unterbauchs hinein, also vermischen sich Liebe und Sex. Ich wollte es fühlen, dieses dichte, sisalig satt federnde Vlies, das dem ganzen Hüftbereich ihres Körpers ein außerordentlich zierliches Aussehen verleiht. Es ist eine Art kleines Schwarzes, unter dem ihr Klitherz schlägt – so viel Würde hat es.
Doch statt gleich die Hand daraufzulegen, beraubte ich mich ein Weilchen seines Anblicks und legte die Hand stattdessen sachte auf ihren Zopf, der kühl und dick und weich und dicht ist – ein vollkommen anderer Begriff von Haar, so anders, dass die Vorstellung, die beiden Haargattungen teilten sich denselben Begriff, befremdlich ist –, jedoch ihrer Kopfkurve in gleicher Weise folgt wie das Schamhaar der Kurve über ihrem Schambein, und als ich spürte, wie die Empfindung des französischen Zopfes in die Höhlung meiner Hand drang, die sich nach sexuellen Formen und Texturen sehnt, kraulte ich mich mit den Fingern meiner anderen Hand durch ihr Schokotortenfell und verband so die beiden aufreizenden Handvoll selbstgezogenes Protein mit den Armen, und mir war, als würde ich eine Autozündung kurzschließen; die Doppelvergaser meines Herzens heulten auf. Weiter tat ich nichts, sondern setzte mich an die Maschine und tippte es hin, bevor ich das Gefühl wieder vergaß. Vielleicht werde ich auch gar nichts weiter tun. Dieses sexy, sexy Schamhaar! Jetzt fällt mir auf, dass seine Konturen denen eines schwarzen Fahrradsattels ähneln: eines schwarzen Ledersattels an einem Rennrad. Schnüffeln etwa deshalb diese komisch-traurigen Gestalten, von denen man manchmal hört, an Sätteln von Mädchenfahrrädern? Nein, für die ist es nicht die Form, sondern die Tatsache, dass der Sattel zwischen den Beinen eines Mädchens war. Die sind wirklich zu bedauern. Für andere als meine eigenen Zwangsvorstellungen habe ich keine Sympathie. Die Übereinstimmung zwischen Schamhaar und schmalen schwarzen Lederfahrradsätteln würde ich allerdings gern vor diesen Leuten retten.
Na gut, das dürfte fürs Erste genügen. In dieser Furche bin ich jetzt, Moment, fast vier Stunden und habe acht einzeilige Seiten geschrieben, und das Problem ist, wenn ich zu lange drinbleibe, dann habe ich morgen einen Jetlag, da es dann nach meiner inneren Uhr vier Stunden später ist als in Wirklichkeit. Meistens bleibe ich nicht annähernd so lange in einem Sprung. Ich werde jetzt Joyce’ Sachen wieder in Ordnung bringen, ihr Kleid glatt streichen (trüge sie ein Baumwollkleid, dann hätte ich nie einen Knoten hineingemacht, weil die Falten dann zu deutlich zu sehen wären und sie verwirren würden), an meinen Schreibtisch zurückrollen und den Tag zu Ende bringen. Das Gute daran ist, wenn sie mir im Lauf des Nachmittags noch ein Band zum Tippen bringt, werde ich viel entspannter und daher liebenswerter sein, als wenn ich sie nicht ohne ihr Wissen oder ihre Bewilligung teilweise entkleidet hätte. Wissend und gewinnend werde ich mit ihr scherzen. Ich werde ihr ein Kompliment wegen ihres Halstuchs machen, das sie heute trägt und das, ehrlich gesagt, nicht ganz so hübsch ist wie das kyrillische. (Vielleicht hat sie, als sie sich heute Morgen anzog, dieses Strickkleid angezogen und sich dann daran erinnert, dass ich ihr Halstuch schön gefunden hatte, und vielleicht hat sie gedacht, dass es, wenn sie es heute wieder trüge, ein zu direktes Ja von ihr wäre; andererseits wiederum trug sie das Kleid vielleicht deswegen so bald wieder, weil ihr mein Kompliment bezüglich des Halstuchs gefallen hatte und sie nun indirekt auf dieses Kompliment anspielen wollte, indem sie dasselbe Kleid zusammen mit einem anderen Halstuch trug.) Dieses neue nun hat ein lilagrau-grünes Liberty-Muster; es ist in jedem Fall ein Lächeln und sogar eine ausgesprochene Würdigung wert. Aber ich will auch nicht in so ein schreckliches Ständig-Komplimente-machen-Schema verfallen, wo ich jedes Mal, wenn ich sehe, dass sie ein Halstuch trägt, auch eine Bemerkung dazu machen muss.
Ich sollte noch sagen, dass ich sonst an dieser Stelle wahrscheinlich ernsthaft daran denken würde, «ein Ei zu pochieren», aber weil ich das alles jetzt aufgeschrieben habe und weil das, glaube ich, der erste Anfang einer Art Autobiographie ist, kann ich es nicht. Aber welche Überraschung, dass diese Casio-Schreibmaschine neuerdings als Anstandsdame fungiert! (Vielleicht tue ich es aber auch einfach, ohne weiter darüber zu reden.)
Zwei
Ich bin mit einem Knoten in der Nabelschnur auf die Welt gekommen, einem simplen Brezelknoten. Ich bezweifle, dass dieser Umstand meiner Geburt etwas mit meinen späteren Chronanismen zu tun hat, aber ich halte das einfach mal hier fest, falls dem doch so ist. Ich bin stolz darauf, mich sogleich darangemacht zu haben, die funktionelle Ausstattung meines intrauterinen Dekanats zu jugendstilisieren. Irgendwie gelang es mir, eine Schlinge zu bilden und einfach hindurchzuschwimmen. Ich habe einen Knoten in mich selbst gemacht. Wie viele Wunderkinder bin ich jedoch bald verpufft. Die Fermate, die sich erstmals in der vierten Klasse für mich öffnete, hat mich zeitlebens abgelenkt. Ich wollte stets ihr Geheimnis bewahren, und infolgedessen hat sie große Teile meiner Persönlichkeit verschlungen. Aber ich hoffe, das ändert sich jetzt.
Einmal ist es mir nach einer langen Flaute gelungen, fünf- oder sechsmal wieder in die Furche zu kommen, nachdem ich in Philadelphia mit dem Kopf gegen eine Parkuhr geknallt war. Da war ich dreizehn oder vierzehn. Wir wohnten im Barclay Hotel; zur Feier des Tages durfte ich zum Mittagessen etwas verwässerten Wein trinken. Ich trank mehr, als die Erwachsenen mitbekamen, und lief dann bei unserem Nachmittagsspaziergang wie aufgezwirbelt herum. Ich rannte voraus und versteckte mich in der Absicht, hervorzuspringen und alle zu erschrecken, zwischen zwei Autos. Ich sprang los und schrie «Buh!». Doch dabei stieß ich mit dem Mund und der Seite meines Gesichts gegen eine Parkuhr, die ich völlig übersehen hatte. Der Aufprall erzeugte einen ungeheuer knochigen Ton in meinem Kopf. Auf der Uhr waren, wie ich taumelnd sah, nur noch ein paar Minuten, die rote Gedankenblase mit dem ABGELAUFEN darauf war kurz vor dem Aufgehen. Ich sah ein Muster ineinanderfließender Karos, das ein sehr hübsches Wiener-Werkstätten-Geschenkpapier abgegeben hätte. Zwanzig Minuten später im Hotelzimmer (wo man mich zur Genesung hingelegt hatte), das Bett fuhr in krummen Achten durchs Zimmer, kniff ich mich in meine geschwollene Lippe und merkte, dass jeglicher Verkehrslärm verstummte. Ich erkannte, dass ich in der Furche war. Ich ging hinunter in die reglose Hotelbar, dann nach hinten in die Küche und aß zwei riesige Shrimps, die ein regloser Koch oder Küchengehilfe zwecks Zubereitung eines Shrimp-Cocktails in der Hand hielt. Ich war verblüfft, wie gut die Cocktailsauce schmeckte. Ich saugte ein Stück Limone aus und warf es in einen Mülleimer hinter der Bar. Ich fühlte mich gestärkt. Ich ging in die Lobby, setzte mich neben eine Frau und sog tief den Geruch ihres Mantelkragens ein. Zunächst dachte ich, er rieche nach Pickles, aber dann wurde mir klar, dass er nach Zigarettenrauch roch, und ich war sehr überrascht, dass Pickles und Zigarettenrauch verwandte Gerüche waren. (Ist es das, was man unter einem «säuerlichen» Geruch versteht?) Dann ging ich wieder nach oben und kniff mich wie vorher in die Lippe, etwas rechts von der Mitte, bis es ziemlich weh tat, um das Barclay Hotel und den restlichen Planeten wieder anzustellen, worauf ich einschlief. Bis heute habe ich ein schlechtes Gewissen wegen des Diebstahls der Shrimps – nicht nur wegen des Diebstahls, sondern weil der Küchengehilfe womöglich bis zum heutigen Tag von dieser seltsamen Begebenheit vor all den Jahren, als er in jeder Hand einen hielt und sie plötzlich verschwunden waren, verstört ist.
Das also war ein typischer früher Sprung. Ich weiß, dass ich meine Gabe wahrscheinlich viel besser nutzen könnte, als ich es tue. Für mich ist sie lediglich ein sexuelles Hilfsmittel. Andere würden, aus Habsucht oder geistigem Antrieb, größeren Nutzen daraus ziehen. Regierungsgeheimnisse, Technologiespionage usw. Bestimmt haben durch die Jahrhunderte ein paar Menschen diese Fähigkeit entwickelt und sie benutzt, um ihre Macht zu festigen oder Feinde auszuschalten. J. S. Bach beispielsweise hätte ohne irgendwelche Zeittricks wohl kaum eine Kantate pro Woche rausleiern können; als er starb, wird er um die fünfundsiebzig und nicht fünfundsechzig gewesen sein; das letzte Jahrzehnt seines Lebens hat er sich geborgt und es vorher mit Sprüngen scheibchenweise verbraucht. Vor nicht allzu langer Zeit las ich Cardanos Autobiographie, um mal zu sehen, wie man seine Autobiographie schreibt (es ist schwieriger, als ich dachte!), und an einer Stelle hatte ich den Verdacht, dass er einen Weg in die Furche entdeckt hatte, ihn uns aber nicht verraten wollte. Er meinte, er ziehe die Einsamkeit vor, und da horchte ich auf. Er schrieb: «Ich bezweifle, dass irgendjemand das Recht hat, unsere Zeit zu verschwenden. Zeitverschwendung ist verabscheuenswert.» Manche würden an meiner Stelle die Zeit ausknipsen und bei ihrem Rigorosum schummeln oder einfach Geld aus offenen Ladenkassen nehmen. Mich aber reizt Schummeln und Stehlen nicht.
Vielleicht denke ich auch nur, dass Schummeln und Stehlen unrecht ist, und tue es deshalb nicht. Als ich vor ein paar Jahren mal ziemlich knapp bei Kasse war und einen Weg fand, in die Furche zu springen, indem ich eine bestimmte mathematische Formel auf ein Stück Papier schrieb, erwog ich ernsthaft, ob ich in der Stadt herumlaufen und aus jeder offenen Ladenkasse einen Dollar stehlen sollte. Ich hätte Monate gebraucht, um ein paar tausend Dollar zusammenzukriegen; in gewisser Hinsicht hätte ich also für meine Beute gearbeitet und aus jedem Geschäft nur einen geringfügigen Betrag gestohlen. Aber ich merkte, dass das Gefühl, einen Dollarschein, der nicht mir gehörte, unter der Federklemme, die ihn mit seinesgleichen niederhielt, hervorzuziehen, etwas Schreckliches hatte. Es war etwas Elendes daran, nichts Erregendes. Ich stand im Filene’s an der Handschuhkasse, um meinen allerersten Dollar zu stehlen, und brachte es nicht fertig. Stattdessen stellte ich mich hinter die reglose Handschuhverkäuferin, eine Frau um die zwanzig, ganz dicht hinter sie, und drückte sie so fest, dass ich glaubte, ich könnte die winzigen Zysten in ihren Brüsten und auch ihre Rippen unter der Hemdbluse spüren. (Eine Frau so zu umfassen, finde ich immer gut, denn wenn ich ihre Rippen spüre, weiß ich, dass sie ein Mensch ist. Rippen erwecken Anteilnahme, Zärtlichkeit und das Gefühl, dass wir alle im gleichen gespanteten Boot sitzen.) Sie war, glaube ich, italienischer Abstammung, und sie sah aus, als hätte sie ein paar Kosmetikkurse gemacht und sich dabei ihren natürlichen Sinn für Schönheit angeknackst. Sie trug einen großen Verlobungsring mit einem ovalen Diamanten. Sie war ein Mensch, der sich nie zu einem Menschen wie mir körperlich hingezogen fühlen würde, ebenso wie ich mich nie zu einem Menschen wie ihr körperlich hingezogen fühlen würde. Diese völlige Unvereinbarkeit versetzte mich in die Lage, eine kurz aufwallende Sympathie für sie zu empfinden, die fast leidenschaftliche Ausmaße annahm.
Ich schob den Diamanten auf ihrem Finger vor und zurück. (Ihre Nägel waren kurz geschnitten, aber poliert – kurz geschnitten vielleicht deshalb, weil sie gern die Handschuhe anprobierte, die sie verkaufte?) Dann zog ich ihr den Verlobungsring ab und blickte hindurch. Auf der Innenseite stand 14 K. Aus einer Laune heraus kniete ich nieder, nahm ihre Hand und steckte den Ring sanft wieder darauf. «Willst du?», sagte ich. Bis zu diesem Moment war mir die offene Erogenität von Ringen nicht bewusst gewesen: Jetzt plötzlich fiel mir auf, dass die Seiten eines Fingers oberschenkelgleich empfindlich sind und dass es eigentlich ganz verblüffend erotisch ist, dass jener vierte, verletzliche, schüchterne Finger, der Planet Neptun unter den Fingern, der im Leben sonst keine weiteren Aufmerksamkeiten erfährt und von allein sehr wenig tut, außer das C auf der High-School-Klarinette zu bedienen oder die Ziffer Zwei und den Buchstaben X zu tippen, dazu ausersehen wurde, von einem teuren Goldreif auf immer umfangen und sanft stimuliert zu werden. Der Widerstand des schmalen Fingergelenks dieser Filene-Frau, an dem sich die Haut vorübergehend zusammenschob, bevor sie nachgab und den Reif, den ich hielt, an seinen Bestimmungsort ließ, war gewissermaßen umgekehrt gleich jenem Augenblick des Widerstands oder trockenen Fummelns, bevor der ungeübte Richard des Bräutigams reibungslos hineinglitt. Sich zu verloben war mithin eine Obszönität. «Wenn du den Ring jetzt für mich fingerfickst, Schatz, dann schwöre ich, dass ich dich für den Rest deines Lebens ficke, wie es sich gehört.» Auf diese Abmachung läuft es doch hinaus. Warum dauert es so lange, bis ich so offensichtliche Sachen begreife, Sachen, die jeder andere wahrscheinlich sofort kapiert?
Eine andere, wichtigere Frage könnte sein: Wenn ich finde, dass es unrecht ist, einen Dollarschein aus einer offenen Kasse zu stehlen, und wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich in einem Hotelrestaurant zwei frische Shrimps stehle, warum bekomme ich dann keine Gewissensbisse, wenn ich eine anderweitig gebundene Handschuhverkäuferin im Filene’s umfasse? Sie kennt mich nicht; sie weiß nicht, dass ich sie umfasse und ihr zum Spaß einen Antrag mache. Glaube ich denn wirklich, dass ich das Recht habe, Joyce das Wollkleid über die Hüften zu schieben und einen Knoten hineinzumachen? Wie kann ich so sicher annehmen, sie würde wollen, dass ich ihr mit den Fingern an die Schamhaare gehe? Die Frage, ob ich da etwas Unrechtes tue, ist berechtigt, aber ich will sie vorerst zurückstellen und stattdessen noch ein paar meiner frühen Furchenerlebnisse skizzieren – nicht, weil sie etwas erklären würden, sondern weil ich, wenn ich versuche, meine Taten mit Worten zu verteidigen, merke, dass sie nicht zu verteidigen sind, und davon will ich nichts wissen. Ich finde ganz ehrlich nicht, dass ich etwas Unrechtes getan habe. Bewusst habe ich noch nie jemandem Leid zugefügt. Ja ich habe mit Hilfe der Furche sogar einige Frauen vor kleinen Peinlichkeiten bewahrt, etwa vor einem wichtigen Verkaufstermin ein schief sitzendes Hemdchen gerade gezogen oder einen verrutschten BH-Bügel zurechtgerückt, so in der Art. Ich meine es gut. Aber ich weiß, dass es gut zu meinen keineswegs eine befriedigende Rechtfertigung ist.
Das erste Mal hielt ich die Zeit an, weil ich meine Lehrerin in der vierten Klasse, Miss Dobzhansky, gern hatte und sie leichter bekleidet sehen wollte. Vielleicht fände ich sie heute gar nicht mehr so schön, aber damals fand ich sie sehr schön. Alle fanden das. Sie hatte kürzere Haare als 1967 bei Grundschullehrerinnen üblich, und sie trug leidenschaftlich gern stoppschildroten Lippenstift – bestimmt hatte sie alle vierzehn Tage einen Stift runter, so voll waren ihre Lippen. Auch hatte sie eine jener breiten, weichen Zungen, die sich gern wie selbstverständlich ein Stückchen vor der Schwelle des Mundes, vor den Zähnen ausruhen. (Nicht, dass sie herausgehangen hätte!) Und immer lächelte sie mit offenem Mund. Meist trug sie eine lange, weich fallende und aussehende marineblaue Strickjacke über einem ärmellosen Kleid. Ich hörte mit großer Aufmerksamkeit zu, wenn sie das Schleusensystem von Kanälen im neunzehnten Jahrhundert und die indianische Technik der Einbaumherstellung beschrieb. In scharfem Kontrast zu Mrs. Blakey, meiner talentierten und anspruchsvollen Lehrerin in der Dritten, deren schlaffes Armfleisch in chaotischen Rhythmen herumschlackerte, wenn sie etwas an die Tafel schrieb, erwies sich Miss Dobzhanskys Tafelarm, wenn sie nachmittags die Strickjacke auszog und über die Stuhllehne drapierte, als schön und fest und mit einem flammenförmigen Muskel grazil an der Schulter befestigt.
Eigentlich hatte ich keine Lust auf sie. Im Grunde ist das Wort Lust zu abstrakt und intransitiv und moralisierend, um meine Gefühle für Miss Dobzhansky oder irgendeine andere Frau beschreiben zu können. Ich habe nie «Lust auf» oder «an» eine(r) Frau. Ich will nur bestimmte Sachen: mit ihr essen gehen, sie zum Lächeln bringen, sie an den Hüften halten. Ich stellte mir anfangs nicht einmal vor, Miss Dobzhansky halbbekleidet zu sehen. Was mich ursprünglich dazu anregte, die Zeit anzuhalten, war, dass sie nach den Weihnachtsferien die ursprüngliche Sitzordnung der Klasse veränderte. Ich war ganz vorn gewesen und nun auf einmal ganz hinten. An meinem alten Pult saß jetzt ein Kind, das die Wörter rückwärts schrieb. Ich hatte Verständnis für ihre Beweggründe, war aber trotzdem ein wenig verletzt. Und dann stellte ich fest, dass ich die Tafel nicht mehr so gut sehen konnte wie vorher.
Das Problem war aber nicht, dass ich die Wörter nicht mehr lesen oder die Zahlen nicht mehr hätte entziffern können. Ich konnte nur nicht mehr, wie vorher von meinem alten Platz aus, mit einem Blick sehen, ob Miss Dobzhansky ein frisch abgebrochenes Stück Kreide mit einer scharfen Kante benutzte, die zuweilen kurz einen schwachen Parallelstrich hinterließ, oder ob sie ein eher abgerundetes Stück nahm, das sie schon benutzt hatte. Ich wollte genau wissen, was auf der Tafelfläche vor sich ging – mir war, als käme ich zwar nicht hinsichtlich der Bedeutung, aber hinsichtlich der physischen Wirklichkeit dessen, was sie schrieb, zu kurz. Als ich noch vorn gesessen hatte, konnte ich den Kreideschemen eines Wortes mitlesen, das sie mehrmals weggewischt hatte; nun war das praktisch unmöglich. Zwei andere Kinder hatten schon eine Brille bekommen, und ich wusste, dass es mit einer Brille ein bisschen besser würde, aber im Grunde wollte ich jedes Mal, wenn es mich an die Tafel drängte, um ihre Oberfläche von ganz nah zu betrachten, die ganze Klasse, die ganze Schule, den ganzen Schulbezirk für ein paar Minuten anhalten.
In jenem Jahr war mein großes Weihnachtsgeschenk eine Autorennbahn in Form einer Acht, mit einem blauen und einem braunen Rennwagen, die darauf herumfuhren und gelegentlich herunterfielen. Ein paar Wochen spielte ich damit. Das Problem damit war, dass es nicht genügend Bahnsegmente gab, um eine asymmetrische Rennbahn daraus zu machen, und bei Rennbahnen legte ich großen Wert auf Asymmetrie. Bald schon verstaubte die Bahn, und die Autos blieben plötzlich stehen, weil die Stromabnehmer keinen Kontakt mehr bekamen. Ich schob sie unter mein Bett und dachte stattdessen über Fleischthermometer und Kröten nach, die jahrelang im ausgetrockneten Wüstenschlamm überleben können.
Doch nachdem Miss Dobzhansky mich nach hinten gesetzt hatte, wachte ich einmal mitten in der Nacht auf und ließ den Arm zwischen Bett und Wand auf den Boden fallen. Ich machte das gewohnheitsmäßig und ziemlich häufig; ich tat es, um mir zu beweisen, wie lässig ich war, wie sicher ich mir war, dass unter dem Bett keine Krustentiere krabbelten. Diesmal jedoch strich meine Hand über etwas Warmes. Es war der Transformator der Rennbahn. Er war noch immer eingesteckt, noch immer eingeschaltet und am Transformieren. Ich stand auf und zog die Bahn hervor. Der Transformator hatte ein rotes facettiertes Licht, das schwach glomm. Auch hatte er einen verchromten Kippschalter. Ich machte Licht im Zimmer, damit ich besser sehen konnte, und nahm den Transformator in die Hand. Er war sehr schwer, hatte gerundete Ecken und eine Lackierung, die aussah, als sei sie entstanden, indem er in dicke schwarze Farbe getaucht worden und dann einem Heißluftgebläse ausgesetzt gewesen sei, sodass die Farbe eine winzige Runzelstruktur bekam. Auf der Unterseite war ein silbernes UL-Schildchen. «Underwriters Laboratories» – ein rassiger, entfernt unterwäschiger Name. Das Summen des Transformators war nahezu unhörbar. Ich fasste den Kippschalter an, legte ihn um und wusste plötzlich, dass das die Maschine war, die ich brauchte, und dass der Transformator, wenn ich ihn das nächste Mal anschaltete, alles anhalten würde.
Ich schmuggelte ihn samt einem Verlängerungskabel in meiner Lunchbox in die Klasse. Den ganzen Vormittag machte ich nichts damit. Als sich die anderen Schüler zum Lunch anstellten, Miss Dobzhansky stand ein Stück vor der Tür, steckte ich eilig die Verlängerungsschnur hinten an der Wand in die Dose unter dem langen Tisch, der nur etwa einen Meter von meinem Stuhl entfernt war, und versteckte den Transformator in meinem Pult. Den ganzen Lunch hindurch verriet ich nichts davon, obwohl ich ganz aufgeregt war. Beiläufig unterhielt ich mich mit meinem Freund Tim darüber, wie es wohl wäre, eine Rührkugel in einer Spraydose mit grüner Farbe zu sein, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Wir stimmten darin überein, dass es witzig wäre, sich in das Pigment am Boden der Spraydose zu bohren und dann durch den unter Druck stehenden Schaum hochzudüsen und herumzuklackern – vielleicht sogar besser, als in einem kugelrunden Raumfahrzeug in die chemischen Stürme des Saturns runterzugehen. Tim behauptete, manchmal seien in einer einzelnen Sprühdose zwei Rührkugeln, was ich bestritt, da es meiner Meinung nach nur so klang, als gäbe es zwei, wenn man sie schnell schüttelte.
Ich war nicht davon ausgegangen, dass jemand das Kabel, das in mein Pult führte, bemerken würde, da ich ja hinten in der Ecke saß, und tatsächlich bemerkte es auch keiner. Ich ließ eine halbe Stunde verstreichen und betrachtete Miss Dobzhansky, während sie über eine Sonnenbrille mit Schlitzen redete, die die Eskimos aus Knochen schnitzten, um nicht schneeblind zu werden. Sie fing an, «Eskimo» in der alten französischen Schreibweise, mit einem «q», mit weißer Kreide an die Tafel zu schreiben. Ich hatte die Hände tief in meinem Pult; meine Fingerspitzen berührten den schwarzen Runzellack und den glatten Kippschalter. Als sie, den Rücken der Klasse zugewandt, zu dem Buchstaben m ansetzte, legte ich den Schalter um. Sie beendete das m nicht. Sie und die Klasse verharrten geräusch- und bewegungslos.
Ich sagte: «He.» Ich sagte noch einmal «He». Niemand drehte sich nach mir um. Die Stille war weit davon entfernt, unheimlich oder verstörend zu sein, sondern, wie ich fand, ganz gemütlich. Diese akustische Behaglichkeit, eine beständige Eigenschaft der Furche, ist, glaube ich, auf die relative Trägheit der mich umgebenden Luftmoleküle zurückzuführen. Soweit ich das sehe, dringen Geräusche nur etwa einen Meter weit.
Einen Augenblick später («Augenblick» passt!) schnippte ich den Kippschalter wieder in die Aus-Stellung, wodurch ich das Gerät deaktivierte. Sogleich ging alles da weiter, wo es aufgehört hatte. Die Welt dehnte sich aus und klang wieder, als wäre sie in Stereo aufgenommen. Miss Dobzhansky schrieb «Esquimaux» zu Ende. Sie ließ durch nichts erkennen, dass ihr bewusst war, dass sich gerade etwas Ungewöhnliches ereignet hatte; und für sie hatte sich natürlich auch nichts ereignet. Sie drehte sich zu uns um und begann von einem schmalen Streifen Land zu erzählen, der, so behauptete sie, einmal Alaska und Asien verbunden habe und über den Stämme gezogen seien, aus denen nicht nur die Eskimos, sondern auch die Indianer der südlicher gelegenen Staaten hervorgegangen seien. Ich muss sie mit einem Ausdruck ungewöhnlicher Aufmerksamkeit oder gar Verzücktheit angeschaut haben, denn ihr Blick fiel auf mich, und sie lächelte. Ich wusste, dass wir einen besonderen Draht zueinander hatten. Ebenso wusste ich, dass sie vielleicht der schönste Mensch war, den ich je kennen würde. Ich wusste, dass sie wusste, dass ich manchmal nicht die Hand hob, um auf ihre Fragen zu antworten, selbst wenn ich die Antwort kannte, weil ich ihr die Möglichkeit lassen wollte, andere dranzunehmen und mich nur aufzurufen, wenn es sein musste, als Reserve sozusagen. Ihre Erklärung der Wellen von asiatischen Wanderbewegungen über die Beringstraße interessierte mich, also ließ ich sie ausreden, bevor ich das Universum ein zweites Mal anhielt. Sobald sie sich wieder der Tafel zuwandte, um Bering hinzuschreiben, legte ich den Schalter um und zog mich nackt aus.
Die Luft in der Furche ist ganz dicht und ein wenig gewöhnungsbedürftig, wenngleich praktisch kein Erstickungsrisiko besteht, wenn man immer mal wieder die Arme herumschleudert. Ich atmete sehr bewusst, als ich durch den Gang zwischen den Pulten und Stühlen nach vorn ging, nackt, und zu meiner hübschen Lehrerin trat. «Miss Dobzhansky?», sagte ich, als ich direkt hinter ihr stand, wenngleich ich wusste, dass sie mich nicht hören konnte. Mein Plan, wie ich ihn blitzartig gefasst hatte, als sie mich gerade eben angelächelt hatte, war, sie ganz auszuziehen, mich dann wieder an mein Pult zu setzen und die Zeit anzuklicken – das heißt, den Zeittransformator auszuschalten. Wenn sie dann die kühlere Luft an ihrer Haut spürte und merkte, dass sie ganz nackt war, würde sie sich uns zuwenden, verwirrt und verblüfft, aber eigentlich nicht richtig entgeistert – ihre Heiterkeit und Fähigkeit, sich auf jede Eventualität im Klassenzimmer einzustellen, hatten einen wesentlichen Anteil daran, dass sie für mich so liebenswert war –, und sie würde dieser Herausforderung mit ihrem üblichen Aplomb begegnen. Sie würde sich uns zuwenden, die Brüste mit den Händen schützend, und uns fragend in die Gesichter schauen, als wollte sie sagen: «Wie, Klasse, ist das passiert?» Ihre Augen würden die meinen suchen, weil sie wüsste, dass sie mir vertrauen und ich ihr über schwierige Augenblicke hinweghelfen könnte, und ich würde mit einem glühenden, liebevollen, ernsten Ausdruck zu ihr zurückblicken. Ich würde aufstehen und jeden, der es wagte, über Miss Dobzhanskys und meine vollkommene Nacktheit zu feixen, zum Schweigen bringen, und ich würde zu ihr hingehen und ihr zunicken, als wollte ich sagen: «Alles wird gut, Miss Dobzhansky», und ihr die Strickjacke und das Kleid holen, die ich säuberlich gefaltet über ihr Pult gelegt hätte. Mit einer Stimme, die vermittelte, wie dankbar sie dafür war, dass es mich gab und dass ich ihr über diesen Augenblick hinweghelfen konnte, würde sie «Danke, Arno» sagen.