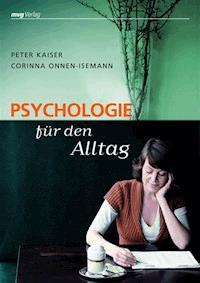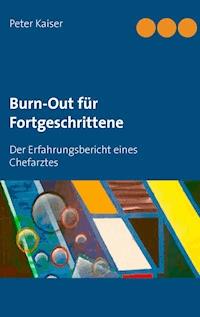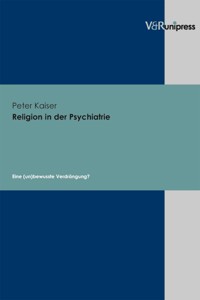39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Soviet and Post-Soviet Politics and Society
- Sprache: Deutsch
Am späten Abend des 22. Februar 1939 verkündeten drei Richter des Militärkollegiums des Obersten Gerichtes der UdSSR mit müden Stimmen und ausdruckslosen Gesichtern ihr Urteil: Todesstrafe mit sofortigem Vollzug. Der Mann, der vor ihnen stand, durch wochenlange Tortur gebrochen, mental ausgelaugt und physisch am Ende, wirkte wie gelähmt. Er fand kaum Worte, um zu protestieren, um gegen die Ungerechtigkeit aufzubegehren, die ihm hier und jetzt widerfuhr, als er von kräftigen Bewachern fortgeschleppt wurde. Wenige Stunden später, es war bereits der 23., wurde er in einem finsteren Loch ohne Fenster erschossen. So endete der Lebensweg von Aleksandr Kosarev, einem heute weitgehend vergessenen sowjetischen Politiker der Vorkriegszeit, einem Helden der damaligen Jugend, die ihn in ihren Liedern verehrte und seinem Beispiel nachzueifern trachtete. Beinahe zehn Jahre lang leitete er den kommunistischen Jugendverband (Komsomol), ein einzigartiger Mensch an der Spitze einer einzigartigen Organisation. Dieses Buch versucht nicht nur, seinem Lebensweg nachzuspüren und seine Persönlichkeit aus dem Dunkel der ehemals geheimen Archive ans Licht der Öffentlichkeit herauszuzerren. Es ist darüber hinaus eine Studie über Macht und Handlungsspielräume, über epochenspezifische Möglichkeitsbestimmungen, über perspektivische Variabilität und Kontingenz eines Politikerlebens, über die sozialen, kulturellen und politischen Kontexte, in die Aleksandr Kosarev verstrickt war. Lenin und Stalin, Trockij und Zinov’ev, Maksim Gor’kij und Samuil Maršak, Lazar‘ Kaganovič und Vjačeslav Molotov, Lavrentij Berija und Nikolaj Ežov – sie alle begleiteten Kosarev auf seinem Weg an die Spitze der Machtpyramide, und sie sind genauso handelnde Personen dieses Buches wie zahllose andere Akteure, deren Namen längst verblichen sind. Die verlockende Aussicht, von der Figur eines Bauern zu der des Königs aufzusteigen, ließ Kosarev mitunter die Tatsache vergessen, dass das Schachbrett der Macht ein gefährliches Minenfeld war, auf dem eine Karriere in Sekundenschnelle für immer in die Brüche gehen konnte. Sein politisches Leben wurde zu einem unablässigen Kampf um Einfluss und Autorität. Wer mehr darüber erfahren will, muss dieses Buch lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1995
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Danksagung
Einleitung
a) Gegenstand der Untersuchung
b) Theoretische Annäherung I: Die biographische Methode
c) Theoretische Annäherung II: Biographie in einer Diktatur
d) Theoretische Annäherung III: Die Macht und ihre Spielräume
e) Die Fragestellung
f) Forschungsstand
g) Quellen
h) Die Gliederung der Arbeit
KAPITEL 1 Die Formung eines Bolschewiken
a) Doppeladler und Roter Stern – Die ersten zwanzig Jahre
b) Von der Hauptstadt in die Provinz: Moskau-Penza (1924–1925)
c) Von Moskau nach Leningrad und zurück (1926-1928)
KAPITEL 2 „Bewaffnet euch mit dem Dynamit der klassenbedingten Unduldsamkeit“ – Kosarev und der „Große Durchbruch“
b) „Lasst uns die Reihen des Komsomol reinigen!“ – Der Komsomol und der „verschärfte Klassenkampf“
c) „An den vordersten Frontabschnitt des Feldzuges für das neue Dorf!“ – Kosarev und der Dorfkomsomol
d) „Unsere Träume sind groß und herrlich“ – Kosarev und die Industrialisierung
1) „Die Kader entscheiden alles!“ – Von Arbeiterfakultäten und FZU-Schulen
2) „Peitscht die Wut der Massen gegen die verdammten Bürokraten auf!“ – Die Kontrolle als Schlüssel zum Erfolg
2.1. Die „leichte Kavallerie“ sattelt auf
2.2. „Es ist schwer, gegen mächtige Menschen zu kämpfen“ – Die Kontrolle der Industrie
3) „Der ganze Verband ist eine einzige Stoßbrigade“ – Der Komsomol zwischen Enthusiasmus und Erschöpfung
KAPITEL 3 Aleksandr Kosarev – Der Mann und das Amt
a) „Doch Politik ist kein Kinderspiel“ – Der Komsomol als Organisation
1) „Das Plenum des ZK schlägt vor…“: Der Aufbau des Komsomol, seine Strukturen und Mitglieder
2) „Die Jugend muss uns, die Alten, ablösen“ – Der Komsomol, Kosarev und die Partei
b) „Er saß nicht in seinem Dienstzimmer…“ – Aleksandr Kosarev als Generalsekretär des Komsomol
1) „Es ist eine komplizierte Kunst, andere zu führen“ – Der Generalsekretär des Komsomol und die Taktik der Macht
2) Von Patronen und Klienten
3) Stalin und Kosarev – Der Meister und sein Schüler
4) „Der Talentierteste von allen“ – Der Kosarev-Kult
c) „Ein Führer Leninschen Stils“ – Kosarev als sowjetischer Funktionär
KAPITEL 4 Vom Kinderbuch und Tannenbaum – Kosarev und die „soft targets“ der sowjetischen Innenpolitik
a) Vom Kinderspielzeug und sowjetischem Weihnachtsbaum
b) „In den Kampf für das Kinderbuch!“ – Kosarev und die Entstehung der sowjetischen Kinderliteratur
KAPITEL 5 „Das feindliche Agentennetz im Komsomol soll endgültig ausgemerzt werden“ – Kosarev und der „Große Terror“
a) „Der Schlange soll ihr Kopf abgehackt werden!“ – Auf der Suche nach „Volksfeinden“
b) „Hinsichtlich der Aufdeckung feindlicher Aktivitäten überprüft das Zentralkomitee des Komsomol…“
c) „Diese Arbeit ist noch nicht beendet“ – Die neue Qualität des „Großen Terrors“
d) „Ich denke, dass Kosarev nicht länger ZK-Sekretär sein kann“ – Der letzte Kampf
Zusammenfassung
Anhang
Liste aller ersten Sekretäre bzw. Generalsekretäre des ZK des Komsomol (1918-1991)
Liste der Mitglieder des ZK des Komsomol, gewählt auf dem X. Komsomolkongress 1936
Liste der während des „Großen Terrors“ 1936-39 verhafteten Mitglieder und Kandidaten des ZK des Komsomol
Kosarevs Besuche in Stalins Dienstzimmer im Kreml
Abkürzungsverzeichnis
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Quellen
a) Archivalien
b) Publizierte Quellen
c) Zeitgenössische Darstellungen, Reden, Artikel
2. Literatur
SPPS Soviet and Post-Soviet Politics and Society
Impressum
Vorwort
Die Stalinismusforschung hat seit der Öffnung der russischen Archive nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine reiche Ernte gebracht. Trotz zahlreicher Arbeiten über die politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse wissen wir aber immer noch erstaunlich wenig über das Personal, mit dem Stalin seine Politik in die Tat umsetzte. Die vorliegende Arbeit von Peter Kaiser stößt in diese Lücke und untersucht mit Aleksandr Kosarev einen sowjetischen Funktionär der Stalin-Ära, der als Chef des Kommunistischen Jugendverbandes in den dreißiger Jahren eine wichtige Rolle spielte und weithin bekannt war.
Kaiser verortet seine Arbeit in einem modernen Ansatz von Biographieforschung, der sich nicht auf das Leben der Person an sich beschränkt, sondern sie in das Kräftefeld ihrer Zeit einordnet, als Mitglied einer gesellschaftlichen Gruppe auffasst und daher die Umgebung und die Strukturen in die Untersuchung mit einbezieht. Anhand der Biographie von Aleksandr Kosarev zeigt er, wie ein sowjetischer Funktionär in seiner Zeit agierte, was die Rahmenbedingungen seines Handelns waren und wie er diese Spielräume ausfüllte. Er begreift Kosarev als organization-man, der mit fortschreitender Machtentfaltung in der von ihm geleiteten Institution aufging, so dass eine Unterscheidung zwischen Dienst und Privatleben hinfällig wurde.
Ausgehend von der Person Kosarevs erzählt Kaiser die Geschichte des Komsomol und bettet sie zusammen mit den Handlungen seines Protagonisten in ein struktur- und kulturgeschichtliches Zeitbild der frühen Sowjetunion ein. Über die Aktivitäten Kosarevs und des Komsomol erschließt er die wichtigen Entwicklungen und Ereignisse in der Sowjetunion der 1920er und 1930er Jahre, von der Neuen Ökonomischen Politik über die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft bis zum Großen Terror. Kaiser verwebt den neuesten Forschungsstand mit eigenen spezialisierten Quellenstudien zu einer umfassenden Innensicht auf die Probleme. Dabei gelingt es ihm eindrucksvoll, die Atmosphäre der damaligen Zeit einzufangen und das Handeln im Kontext der Strukturen und Umstände verständlich zu machen.
Auf diese Weise entfaltet der Verfasser vor dem Leser ein faszinierendes Bild von den Zuständen in der Sowjetunion der 1920er und 1930er Jahre, dem Agieren und dem Habitus der Funktionäre auf der unteren und mittleren Ebene, der sukzessiven Durchsetzung von Stalins Herrschaft über seine Netzwerke von Vertrauensleuten. Man erfährt am Beispiel Kosarevs, wie der Aufstieg eines jungen, aus einfachsten Verhältnissen kommenden Funktionärs erfolgte: Aufgaben, Belohnungen, Loyalitätsbeweise, Zurücksetzungen und seitens des Funktionärs selbst raffinierte Taktiken und Strategien der Anverwandlung an das erwünschte Profil und der Aufbau einer eigenen Machtbasis werden überzeugend beschrieben.
Neben der Einbettung in die großen Zeitbilder gelingt es Kaiser immer wieder, seinen Protagonisten eindrücklich und plastisch greifbar zu positionieren: etwa wie er zu Beginn der 1920er Jahre mit Lederjacke und Schirmmütze, dem antibürgerlichen Kostüm der damaligen Jungkommunisten, ins Moskau der Neuen Ökonomischen Politik kam, oder wie er – um eine Episode gegen Ende seines kurzen Lebens herauszugreifen – 1938 in einer Plenarsitzung des Zentralkomitees des Komsomol, konfrontiert mit massiven Angriffen, verzweifelt versuchte, seine Haut zu retten und unter Stalins Regie rhetorisch in die Enge getrieben wurde.
Zu den Stärken der Arbeit gehört zweifellos die akribische und quellengesättigte Analyse von Interaktionen und Entscheidungsprozessen innerhalb des Komsomol und der Kommunistischen Partei im Sinne einer „dichten Beschreibung“. Auf derart aufschlussreiche und quellennahe Weise wurden diese Prozesse noch nie dargelegt. Es eröffnen sich Einblicke in das Funktionieren der frühen Sowjetunion und die Aktionshorizonte der damaligen Funktionäre sowie in den Wandel der kulturellen Leitbilder, die weit über das engere Thema hinaus wertvoll sind. An mehreren Beispielen zeigt Kaiser, wie die schrittweise Ausgrenzung von Personen funktionierte, an deren Loyalität Zweifel aufgekommen waren, wie Beschlüsse taktisch so formuliert wurden, damit sie die gewünschten Effekte erzielten, wie Versammlungen und Presseartikel gezielt manipuliert wurden, um Personen zu demontieren und ihre Klientel einzuschüchtern und auf diese Weise ihre Hausmacht zu zerstören und sie in Handlungszwänge zu bringen.
Beim Austausch der Führungsriege des Komsomol 1929, die im Kontext von Stalins „Revolution von oben“ für diesen untragbar geworden war, weil er an ihrer Loyalität zweifelte, konnte Kosarev diese Mechanismen für seinen Aufstieg nutzen, in weiterer Folge seine Macht aufbauen. In der Phase des Großen Terrors wurde er allerdings am Ende selbst zum Opfer. Kaiser zeigt, wie Kosarev systematisch daran arbeitete, seine Kompetenzen zu erweitern, aber dabei auch Rückschläge hinnehmen musste. Für den Aufstieg seiner Person und der von ihm geleiteten Institution erwies sich die Übernahme bzw. eigenmächtige Anmaßung von Kontrollaufgaben als besonders geeignet, weil es an Missständen nicht mangelte und der Kampf gegen sie gute Chancen bot, Hierarchien und reguläre Zuständigkeiten außer Kraft zu setzen und als Vollstrecker übergeordneter Direktiven aufzutreten, verbunden mit militaristisch-aktionistischem Habitus. Kaiser hat ein gutes Gespür für symbolische Handlungen und Rituale der Loyalität, der Unterwerfung, aber auch der Ermächtigung.
Hinter dieser „dichten Beschreibung“ und zugleich tiefschürfenden Analyse steht eine gigantische Quellenarbeit in russischen Archiven und Bibliotheken. Mit jahrelanger Ausdauer und Hartnäckigkeit hat Kaiser allen nur denkbaren Verästelungen nachgespürt und zu den untersuchten Ereignissen praktisch alle zugänglichen Quellen ausgewertet, um die Vorgänge aus möglichst vielen unterschiedlichen Positionen auszuleuchten. Er strebt grundsätzlich keine einfachen, polarisierenden Erklärungen an, sondern differenziert stets maximal und bemüht sich, der Komplexität des Beschriebenen gerecht zu werden. Vor den Augen des Leser breitet sich ein Panorama des Lebens und der Strukturen, der Verhaltensweisen, Wahrnehmungs- und Erfahrungshorizonte der Akteure, ihrer Kommunikationsformen und personalen Netzwerke in der frühen Sowjetunion aus, wie man es kaum in einer anderen Darstellung so gebündelt findet. Auf diese Weise erschließen sich, ausgehend vom biographischen Zugriff, in konzentrischen Kreisen Schlüsselaspekte der sowjetischen Geschichte.
Prof. Dr. Dietmar Neutatz
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Danksagung
Habent sua fata libelli wusste bereits der antike Grammatiker Terentianus Maurus zu vermerken, und auch das vorliegende Buch blickt auf ein abwechslungsreiches und nicht immer geradlinig verlaufendes Schicksal zurück.
Es sind beinahe neun Jahre seit dem Augenblick vergangen als ich, damals frisch nach dem Studium und voll naiven Enthusiasmus, mit klopfendem Herzen im Dienstzimmer meines künftigen Doktorvaters erschien, um ihn zu bitten, mein Dissertationsvorhaben zu betreuen. Mit einer gehörigen Portion gesunder Skepsis lauschte Prof. Dr. Dietmar Neutatz meinen schwärmerischen Ausführungen, bevor er mich mit seiner Aussage erdete, man dürfe sich als Doktorand beim Auswahl des Themas „nicht verheben“. Da ich jedoch von meinem Plan genauso überzeugt war wie ein ordentlicher Katholik von der Unfehlbarkeit des Papstes, bestand ich darauf, das Thema „Komsomol und Stalinismus“ sei das am besten geeignete, um von mir als Dissertation bearbeitet zu werden. Immer noch nicht ganz von meinen Beteuerungen überzeugt, sagte Herr Neutatz mir dennoch seine Unterstützung zu. Und so begann der Weg, der jetzt mit diesem Buch seinen Abschluss findet.
Wie Herr Neutatz es vorausgesagt hatte, war es kein einfacher Weg. Bereits nach meinem ersten Besuch Moskauer Archive stellte ich etwas entnervt fest, dass dort Berge an unerschlossenem Material liegen, dessen Heterogenität und Komplexität eine konsistente Auswertung im Rahmen einer einzigen Studie von vornherein ausschließen. Darüber hinaus machte ich Bekanntschaft mit der berühmt-berüchtigten Welt der russischen Archivbürokraten, die bereits meine Anwesenheit dort für ein furchtbares und verdammungswürdiges Sakrileg hielten und deswegen sich mit Vorliebe hinter Direktiven und Rundschreiben verbarrikadierten, mit denen sie mir zu beweisen suchten, die Archivalien, die ich auszuwerten trachtete, seien in „schlechtem Zustand“ und für die Forschung generell „uninteressant“.
Doch bekanntlich macht die Not erfinderisch. In dem Material, das ich monatelang gesammelt hatte, fand ich genügend Anhaltspunkte, um auf deren Grundlage die Biographie eines Mannes zu schreiben, der längst in Vergessenheit geraten war, zu seinen Lebzeiten jedoch wie kein anderer das Begriffspaar verkörperte, dem von Anfang an mein Interesse galt: „Komsomol und Stalinismus“. Und so wurde Aleksandr Kosarev zu meinem ständigen Begleiter für die nächsten sechs Jahre. Manchmal schien es mir, ich würde ihn besser kennen als er sich selbst je gekannt hatte; manchmal verzweifelte ich an den fehlenden Dokumenten, die es mir unmöglich machten, in die „Politküche“ der Sowjetunion der 1930er Jahre in gewünschter Tiefe einzudringen. Und sehr oft krächzte ich unter der Last der schier unübersehbaren Menge an Informationen, die mich zu erdrücken drohte, unfähig, alles in die entsprechenden Schubladen einzusortieren.
Dass ich dennoch mein Projekt zu einem sinnvollen Abschluss gebracht habe und nicht im „Tal der Doktorandentränen“ untergegangen bin, verdanke ich vielen Menschen, die mich nie im Stich gelassen und mich immer mit Rat und Tat unterstützt haben. Eigentlich mag ich keine Reihenfolgen, suggerieren diese doch eine strenge Totalordnung, die es meistens gar nicht gibt. Doch an dieser Stelle möchte ich eine Ausnahme machen und als ersten meinen Doktorvater Herrn Prof. Dr. Dietmar Neutatz nennen. Dies geschieht nicht nur aus pflichtschuldigem Respekt des Schülers gegenüber seinem Lehrer, sondern vor allem aus der tiefen Überzeugung heraus, dass es ohne Herrn Neutatz‘ unermüdlichem Einsatz, ohne seine fachmännischen Ratschläge und scharfsichtigen Warnungen vor Untiefen des Forscherlebens diese Arbeit gar nicht geben würde. Egal wann ich seine Hilfe gebraucht habe, wurde sie mir stets gewährt und seine freundliche und unaufgeregte Art, meiner Phantasie wissenschaftliche Fesseln anzulegen, hat mich vor manchem Irrweg bewahrt. In dieser Arbeit steckt viel mehr von ihm drin, als es ihm möglicherweise selbst bewusst ist. Die Fehler und Patzer, die der kritische Leser dennoch finden mag, gehen selbstverständlich einzig und allein auf mein Konto.
An zweiter Stelle ist Apl. Prof. Dr. Dr. h.c. Victor Dönninghaus zu nennen, der ungeachtet seiner vielen anderweitigen Verpflichtungen sich dankenswerterweise bereit erklärt hatte, mein Opus Magnum als Zweitgutachter zu lesen und der mir vor allem während meiner Moskauer Archivaufenthalte viele wertvolle Ratschläge gab, die mir das Leben ungemein erleichtert haben. Apropos Archive. Neben den bereits oben erwähnten Bürokraten traf ich dort viele hilfsbereite Menschen, die völlig uneigennützig die Rahmen des Machbaren ausreizten, um einem ihnen fremden Doktoranden aus dem märchenhaft fernem Deutschland zu helfen. Überall wo es nur möglich war, kamen sie meinen Wünschen entgegen und halfen mir, einen Pfad zu finden, der mich sicher durch den Dokumentendschungel hindurch zu meinem Ziel leitete. Zu nennen sind an dieser Stelle Galina Michajlovna Tokareva und Galina Vladimirovna Gorskaja vom Russländischen Staatsarchiv für sozial-politische Geschichte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatsarchivs der Russländischen Föderation und des Russländischen Staatsarchivs für Literatur und Kunst sowie die Bibliothekarinnen der Russländischen Staatsbibliothek (die noch immer unter ihrer früheren Abkürzung Leninka bekannt ist), der Historischen Bibliothek und der – leider zwischenzeitlich abgebrannten – Bibliothek des INION-Instituts.
Auch wenn Wissenschaftler nicht gerne übers Geld reden, ist es nur in seltensten Fällen möglich, ein großes Projekt ohne finanzielle Unterstützung von außerhalb zu stemmen. An dieser Stelle will ich zuallererst der Abteilung Promotionsförderung des Begabtenwerkes der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) und ihrer Leiterin Frau Dr. Daniela Tandecki ganz herzlich danken für die wunderbaren drei Jahre, während der ich die großzügige Förderung durch diese außergewöhnliche Institution genießen durfte. Darüber hinaus danke ich der Dorothee-Wilms-Stiftung und dem Deutschen Historischen Institut Moskau für die kurzfristigen Forschungsstipendien, die es mir ermöglicht haben, die bereits gewonnenen Erkenntnisse durch gezielte Archivstudien zu vervollständigen. Außerdem gilt mein ganz besonderer Dank dem ehemaligen ersten stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag Herrn Dr. Klaus Schüle für dessen Unterstützung, die vor allem am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere von enormer Bedeutung war.
Darüber hinaus danke ich: Meinen Kolleginnen und Kollegen vom Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Michel Abeßer, Kristina Offterdinger, Laura Ritter, Lena Radauer, Kathrin Philipps, Marc Lindner, Jan Hendrik Issinger, Susanne Clauss und Kai-Achim Klare für ihren moralischen Beistand und ihre erstaunliche Geduld, mit der sie mich und meine endlosen Monologe über Aleksandr Kosarev und den Komsomol über Jahre hinweg ertragen haben; den zahllosen Teilnehmern verschiedener Kolloquien für deren Kritik und hilfreiche Hinweise auf Schwachstellen; Herrn em. Prof. Dr. Gottfried Schramm, der mir während meines Studiums beigebracht hat, nicht alles zu glauben, was geschrieben steht; Herrn em. Prof. Dr. Dietrich Beyrau für seine Gastfreundschaft während meines Aufenthaltes in Tübingen; Frau Prof. Dr. Julia Obertreis, die Zeit fand, Teile des Manuskripts zu lesen und mich so vor manchem Fettnäpfchen bewahrte; Herrn Dr. Andreas Umland, der meine Arbeit für gut genug befunden hat, um sie in die renommierte „Soviet and Post-Soviet Politics and Society“-Bücherreihe aufzunehmen sowie allen Mitarbeitern des ibidem-Verlages für die hervorragende Betreuung meines Projektes; Claudius Maier, der sich mit erstaunlicher Beharrlichkeit durch die dicksten Kapitel hindurch gekämpft und meine sprachlichen Missgeschicke ausgebessert hat, sowie den Jungs und Mädels von der „Europa-Café-Gruppe“ (Tina, Clemens, Eveline, David, Marcus, Tilmann, Sarah und Hannah), die mir immer gezeigt haben, wie wichtig die Freundschaft ist.
Last but not least möchte ich meiner Familie meinen tief empfundenen und immerwährenden Dank für die Geduld und die Unterstützung aussprechen, die sie mir jederzeit gewährt haben, und hier vor allem meinen Eltern: Meinem Vater Herrn Dr.-Ing. Valerij Korobotschkin-Kaiser, der sich großzügig bereit erklärt hat, die Drucklegung meiner Dissertation zu finanzieren, und meiner Mutter, Frau Dr. med. Anna Kaiser, die mir zwar oft gesagt hat, der Beruf eines Historikers sei der direkte Weg in die Arbeitslosigkeit, die jedoch nichtsdestotrotz alles in ihrer Kraft stehende tat, um mir den Rücken freizuhalten, als ich das am meisten gebraucht habe.
Und zu guter Letzt will ich an dieser Stelle meine Großeltern nicht unerwähnt lassen. Viele von den blutigen und entsetzlichen Ereignissen, die in diesem Buch geschildert werden – Bürgerkrieg, Industrialisierung, Kollektivierung, Stalinscher Terror –, mussten sie am eigenen Leib erfahren. In einem unbarmherzigen System gelang es ihnen wie durch ein Wunder ihre Herzlichkeit und ihre Menschlichkeit zu bewahren. Und zu keinem Zeitpunkt ließen sie sich biegen, immer der Tatsache eingedenk, dass die Würde das Einzige ist, das der Henker nicht wegzunehmen vermag. Sie haben die Fertigstellung dieses Buches, das auch zum großen Teil ihr Buch ist, nicht mehr erleben können. Ihnen sei es in tiefster Dankbarkeit gewidmet.
Einleitung
a) Gegenstand der Untersuchung
Im zweiten Band ihrer Memoiren, der passenderweise „Das zweite Buch“ heißt, schrieb Nadežda Mandel’štam, bekannte Dissidentin und Witwe des im Gulag gestorbenen Dichters Osip Mandel’štam, auf ihr Leben unter Stalin zurückblickend: „Wer sind wir, um Verantwortung zu tragen? Wir sind bloß Holzsplitter, die vom stürmischen, beinahe schon wilden Fluss der Geschichte hinweg getragen werden… Unter den Holzsplittern gibt es welche, die mehr Glück haben als andere, die imstande sind, zu lavieren, einen Hafen zu finden, wenn man ihn braucht oder sich zum Hauptstrom durchzukämpfen, ohne in die Stromschnellen hineinzugeraten. Jeder so wie er Glück hat… Aber die Tatsache, dass der Hauptstrom uns wegträgt, der Teufel weiß wohin, daran sind wir nicht schuld: Sind wir etwa aus eigenem Antrieb hineingeraten?“1
Das Bild eines Holzsplitters, der, einmal in den mächtigen Strom der Geschichte geraten, von diesem ins Unbekannte, „der Teufel weiß wohin“, fortgerissen wird, schwach und schutzlos, ohne die Möglichkeit, sich der unbekannten und unergründlichen Kraft zu erwehren, ist eines, das auf den ersten Blick am geeignetsten erscheint, um das Leben in einer Diktatur zu beschreiben. Alle Menschen sind bloß Holzsplitter, außerstande, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, wehrloses Spielzeug in der Hand des Einen, des Mächtigen, der die Geschichte schlechthin verkörpert. Der Diktator ist der Lenker der Geschicke des Staates, er duldet keine Widerrede, er bestraft und begnadigt nach seinem eigenen Gusto, er hebt sich aus einer grauen, undefinierbaren Masse heraus, die ihn umgibt, er braucht auf nichts und niemanden Rücksicht zu nehmen. Die Quellen seiner Macht liegen in seinem Charisma oder seiner Verschlagenheit, seiner Brutalität oder seiner vorgeblichen Freigebigkeit und oft gehen diese und viele andere Faktoren eine den jeweiligen Gegebenheiten angepasste Symbiose ein, sie vermischen sich und werden zu einem einheitlich Ganzen, zum Fundament der Herrschaft. Der Tyrann, der, einem Gott gleich, auf dem politischen Olymp residiert und von dort auf seine Untertanen herunterblickt, die, wie Ameisen, zu seinen Füßen krabbeln –, auch so könnte man das gängige Bild einer Diktatur umschreiben.
An dem Gesagten ist vieles sicherlich wahr und dennoch spiegelt es nur einen Teil der Wahrheit wider. Eine Diktatur besteht nicht nur aus der Person des Diktators, wie mächtig er im Einzelfall auch sein mag. Er agiert nicht im luftleeren Raum und er findet keine tabula rasa vor, wo alles, was bisher war, restlos entfernt wurde. Er ist auf die Unterstützung bestimmter Bevölkerungsschichten angewiesen, aus denen er seine Anhänger rekrutieren kann; er braucht Gehilfen, die ihm ergeben und bereit sind, seinen Anweisungen Folge zu leisten, ohne sie unablässig in Frage zu stellen, Menschen, die auch imstande sein sollten, blutige Aufträge ihres Gebieters zu erfüllen und die zum Dank für ihre Treue einen Lohn verlangen dürfen, in welcher Form auch immer. Soll seine Herrschaft Bestand haben, muss der Herrscher ein Netz von Loyalitäten knüpfen, das stabil genug ist, um vielfältige Herausforderungen zu bewältigen und je größer und komplexer die Staatsstrukturen sind, desto komplexer und vielfältiger muss dementsprechend dieses Netz sein. Er muss bereit sein, Kompromisse einzugehen und Aufgaben zu delegieren, den Wünschen der Massen zu entsprechen und ihnen das Gefühl zu geben, seine Tyrannei sei etwas, was geschichtlich determiniert ist, ein notwendiges Mittel zum Erreichen des angestrebten Zwecks, von dem alle, die „wahrhaft glauben“, am Ende auch profitieren werden. Nur in seltensten Fällen vermag er sich dabei völlig von den Restriktionen zu lösen, die ihm von der Außenwelt auferlegt werden und die Momente, in denen seine Macht tatsächlich und nicht nur vorgeblich unumschränkt ist, sind meistens zeitlich klar begrenzt und überschaubar.
Bei der Betrachtung des Stalinismus, der neben dem Nationalsozialismus und dem Maoismus die wohl mit Abstand brutalste Diktatur in der Menschheitsgeschichte war, ist man geneigt, den Diktator in den Mittelpunkt der Darstellung zu rücken und sich auf diese Figur zu fokussieren. Eine solche Vorgehensweise hat sicherlich ihre Vorteile, denn die Person Stalins, die allein auf Grund ihrer geschichtlichen Bedeutung schon immer im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stand, bietet dem Forscher eine reichhaltige Quellenbasis und sie ist darüber hinaus auch legitim, denn schließlich war er derjenige, der den anderen politischen und gesellschaftlichen Akteuren seinen Willen aufzwang und folglich den zentralen Pol der Macht bildete. Sie soll allerdings nicht zu dem Ergebnis führen, dass man die staatlichen Strukturen künstlich vereinfacht, die vorhandenen gesellschaftlichen Konflikte für unbedeutend erklärt oder sie schlicht primitiviert und den Einzelmenschen zum bloßen Befehlsempfänger degradiert, zu einem blinden Werkzeug des allmächtigen Tyrannen, der keine Fragen stellt und nötigenfalls bereit ist, auch die eigene Mutter umzubringen, wenn es ihm befohlen wird. Keine einzige Diktatur vermochte es, solche menschlichen Roboter hervorzubringen, und auch der Stalinismus als System bestand nicht nur aus Stalin, selbst wenn dieser Eindruck immer wieder dem Betrachter durch manchmal übertriebene Darstellungsart suggeriert wird, bei der die übrigen gesellschafts-politischen Akteure ihrer Bedeutung beraubt und vorzugsweise mit Epitheta wie „Kreaturen“, „Satrapen“, „Henker“ und ähnliches belegt werden.2 Ohne zigtausende Mitläufer, ohne aktive und passive Helfer, ohne die von der Macht berauschten und von der Richtigkeit der verkündeten ideologischen Postulate überzeugten Menschen wären Stalin und das als „Stalinismus“ bekannt gewordene Herrschaftssystem gar nicht möglich gewesen. Auch Nadežda Mandel’štam sah das ein, die ihre Überlegungen über die Holzsplitter, die vom „wilden Fluss der Geschichte“ hinfort getragen werden, im weiteren Verlauf ihrer Darstellung entsprechend einschränkte. „Alles ist so und doch ist es nicht so“, schrieb sie. „Sogar der unbedeutendste menschliche Holzsplitter besitzt die geheimnisvolle Fähigkeit, den Strom zu lenken. Der Holzsplitter wollte ja selbst im Strom mit schwimmen, und er wurde nur dann sauer, wenn er in die Stromschnellen geriet. Jeder von uns hatte an dem, was geschah, seinen Anteil, und es ist vergebliche Liebesmüh, sich davon freimachen zu wollen“.3 Stalins Weg an die Spitze und noch mehr sein Verbleib auf dem Gipfel der Macht wären nicht möglich gewesen, wenn er nicht über eine loyale Gefolgschaft verfügt hätte, die bereit war, ihn bei seinen Vorhaben zu unterstützen. Diese „menschlichen Holzsplitter“ besaßen in der Tat die „geheimnisvolle Fähigkeit, den Strom zu lenken“; dass ihr Ende oft nicht so verlief, wie sie es sich vorgestellt haben, ändert an dieser Feststellung nichts. Es waren keine devoten Sklaven des Stalinschen Willens, sondern machtbewusste Politiker, die ihn aus bestimmten Überlegungen heraus zu ihrem „Boss“ machten, die ihm folgten, weil sie von ihm gewisse Vorteile für sich erhofften und weil sein Weg ihren ideologischen Überzeugungen und persönlichen Sympathien mehr entgegenkam als der Weg, den seine Rivalen parat hielten. Und einer von diesen Politikern, dessen Beitrag zur Errichtung und vor allem zur Stabilisierung des Stalinschen Systems nicht unterschätzt werden darf, soll im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen.
Aleksandr Vasil’evič Kosarev gehört nicht unbedingt zu den bekanntesten Akteuren der sowjetischen Geschichte. Von den Spezialisten für die Geschichte der Stalin-Zeit einmal abgesehen wird sich wohl kaum einer finden lassen, der mit seinem Namen eine bestimmte Vorstellung verbindet oder überhaupt je von ihm gehört hat. Und auch wenn sein Name in einer oder anderen Abhandlung über die sowjetische Frühgeschichte auftaucht, dann erfährt der Leser nur bedingt etwas über die Person und ihr Wirken. Dies ist kein Phänomen der jüngsten Zeit. Auch die breite sowjetische Öffentlichkeit der Nach-Stalinära wusste kaum etwas über Aleksandr Kosarev, der zu einer Fußnote der Geschichte herabgesunken war. Ein bezeichnendes Beispiel dafür bietet der Eintrag in der Sowjetischen Geschichtsenzyklopädie aus dem Jahr 1965:
„Aleksandr Vasil’evič Kosarev (14.XI. 1903- 23.II.1939) – ein Vertreter der kommunistischen Jugendbewegung. Mitglied des kommunistischen Jugendverbandes (RKSM) seit 1918, seit 1919 in der Kommunistischen Partei. Geboren in Moskau als Kind einer Arbeiterfamilie. Während des russischen Bürgerkrieges ging er mit fünfzehn Jahren freiwillig an die Front. Im Jahre 1919 nahm er an der Verteidigung Petrograds gegen die Armee General Judeničs teil. Nach dem Ende des Bürgerkrieges war er Komsomolsekretär des Baumanskij-Stadtteils von Moskau, des Moskovsko-Narvskij Stadtteils von Leningrad und des Gouvernementskomitees des Jugendverbandes in Pensa. 1926 wurde er zum Sekretär des Moskauer Komsomolkomitees gewählt, seit 1927 Sekretär des ZK des VLKSM. Von März 1929 bis 1939 war Kosarev Generalsekretär des Zentralkomitees des Komsomol; er war Führer der sowjetischen Jugend und genoss eine riesige [ogromnyj] Autorität. 1927 wurde er zum Mitglied der Kontrollkommission der Partei, auf dem XVI. Parteitag (1930) zum Kandidaten des ZK der Partei, auf dem XVII. Parteitag (1934) zum Mitglied des Zentralkomitees der VKP(b) gewählt. Kosarev war Mitglied des Organisationsbüros des ZK der VKP(b) und des Zentralen Exekutivkomitees der UdSSR. In der Atmosphäre des Personenkultes um Stalin wurde er verleumdet und rechtswidrig verurteilt. Er wurde posthum rehabilitiert.“4
Ungeachtet seiner relativen Faktendichte vermag dieser Artikel nicht mal annähernd die Rolle und die Bedeutung Kosarevs in der Politik der 1930er Jahre wiederzugeben, auch wenn Kosarev als „Führer“ der sowjetischen Jugend bezeichnet wird und man ihm zugesteht, eine „riesige Autorität“ genossen zu haben.
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung steht die Person Aleksandr Kosarevs stellvertretend für eine ganze Generation ehrgeiziger und fähiger Funktionäre der sowjetischen Frühgeschichte, so dass sein Leben und Wirken eine über seine individuelle Geschichte hinausreichende Bedeutung besitzt. Ungeachtet der Tatsache, dass er nur fünfunddreißig Jahre alt wurde, umfasst diese kurze Lebensspanne viele wichtige Momente der sowjetischen Vorkriegsgeschichte, an denen Kosarev in der einen oder anderen Art partizipierte: Die Neue Ökonomische Politik (NĖP), die Kulturrevolution, die forcierte Industrialisierung und Zwangskollektivierung, der „Große Terror“- diese und viele andere abrupte Kurswechsel der sowjetischen Innenpolitik vollzog er mit und manche davon antizipierte er sogar. Seine Machtbasis war der kommunistische Jugendverband (die russische Bezeichnung kommunističeskij sojuz molodёži bildete dann auch das geläufige Akronym Komsomol) und sein ganzes politisches Leben strebte er danach, den Einfluss dieser in gewissem Sinne einzigartigen Organisation zu festigen und zu mehren.
In den Wirren des Bürgerkrieges im Oktober 1918 ins Leben gerufen, ging der Komsomol im Chaos des letzten Jahres der Existenz des sowjetischen Imperiums beinahe genauso sang- und klanglos unter wie die anderen Institutionen des zerfallenden kommunistischen Staates. Von der Tatsache, dass am 27. und 28. September 1991 in Moskau der außerordentliche XXII. Kongress des Komsomol stattfand, dessen einziges erklärtes Ziel darin bestand, die endgültige Selbstauflösung zu verkünden, was mit dem Überflüssigwerden der „historischen Rolle“ des Jugendverbandes begründet wurde, nahm kaum jemand Notiz, denn bereits seit seinem XXI. Kongress im Jahr 1990 steckte der Jugendverband in der tiefsten Krise. Von dem Mythos, „Speerspitze“ der künftigen Erbauer des Kommunismus und Verkörperung des „fortschrittlichsten Teils der Menschheit“ zu sein, an dem so viele Generationen von Komsomolhistorikern eifrig herumgebastelt haben und an dem man bis zuletzt krampfhaft festhielt, blieb innerhalb weniger Monate nichts mehr übrig.
Dabei begann man erst 1988 damit, dem Komsomol seine Geschichte zurückzugeben. In diese Zeit fiel die endgültige Rehabilitierung der ersten großen Jugendführer der Vorkriegszeit und aus entsprechenden Berichten der reformfreudigen Medien erfuhren die meisten Leser zum ersten Mal überhaupt, dass diese Personen existiert hatten. Die Namen von Efim Cetlin, Oskar Ryvkin, Lazar‘ Šackin, Nikolaj Čaplin und Pjotr Smorodin bekamen endlich die Aufmerksamkeit, die sie aufgrund ihrer Rolle in der Zeit der Oktoberrevolution und des Bürgerkrieges längst verdient hatten. Aber ein Name überstrahlte alles und stellte all die rehabilitierten Komsomolzen eindeutig in den Schatten: der Name Aleksandr Kosarev. Die „Wiederentdeckung“ des bald als „Komsomolze Nummer 1“ verklärten Funktionärs führte mitunter zu seltsamen Auswüchsen: Man wollte in ihm plötzlich all das Gute sehen, was man am Jugendverband in der Zeit der Stalin-Herrschaft vermisst hatte, man wollte ihn als standhaften und ehrlichen Kommunisten darstellen, der den Mut besaß, dem „bösen Tyrannen“ Stalin die Stirn zu bieten, ein Verhalten, das er mit seinem Leben bezahen musste. Man sah in ihm gewissermaßen das Pendent zu einer anderen „wiederentdeckten“ Person aus den frühen Jahren der Geschichte der KPdSU, zu Nikolaj Bucharin. Genauso wie dieser zu einer Lichtgestalt am kommunistischen Firmament und zum mutigen Gegenspieler Stalins, zum geradezu geistigen Vater der Perestroika hochstilisiert wurde, mit dem Ziel, der Kommunistischen Partei den so dringend benötigten positiven Helden zu geben,5 wurde Kosarev im möglichst günstigen Licht dargestellt, um den Selbstzweifeln der Komsomolzen, die immer mehr von der unschönen Vergangenheit ihres Verbandes deprimiert und entmutigt wurden, zu begegnen und ihnen neuen Halt sowie „ihren“ eigenen Helden zu geben.
Diese Versuche dauerten jedoch nicht lange, denn mit der Öffnung der Archive drang auch die ungeschminkte Wahrheit über Kosarev immer öfter zutage. Bereits 1990 wurde die Tendenz deutlich, in ihm einen der treuesten Anhänger Stalins zu sehen; seinen Platz als „Strahlemann“ büßte er allmählich ein. In dieser Zeit verlor auch der Komsomol selbst immer mehr Interesse an der Aufarbeitung seiner Geschichte und rutschte zusehends in das Chaos der letzten Jahre der Gorbačov- Ära hinein.6 Als Vladimir Zjukin, der letzte erste Sekretär des ZK des VLKSM die Selbstauflösung des Jugendverbandes verkündete, verlor sich Kosarevs Name in den endlosen Listen von Parteifunktionären. Die vorliegende Arbeit versucht, diese Person wieder ins Licht des wissenschaftlichen Interesses zu rücken und den Fragen nach seiner Rolle im System, seinen Handlungsspielräumen und seiner Bedeutung für das Funktionieren des Regimes nachzuspüren.
Aleksandr Kosarev war keine außergewöhnliche Erscheinung. Ganz im Gegenteil: Man könnte sogar behaupten, dass er eine für die 1920-1930er Jahre geradezu typische Karriere durchlaufen hatte, die von viel Licht und noch mehr Schatten gekennzeichnet war. Seinen Aufstieg verdankte der Sohn einer einfachen Arbeiterfamilie aus Moskau allein der bolschewistischen Partei: Die Oktoberrevolution war gewissermaßen „seine“ Revolution, denn sie gab ihm die Möglichkeit, den vorgezeichneten Weg eines Fabrikarbeiters zu verlassen, der Welt der grauen Mietskasernen und der sozialen Ungerechtigkeiten des zarischen Systems zu entfliehen, sich gesellschaftlich-politisch zu engagieren. Dieses Engagement führte ihn vom Posten eines unbedeutenden Funktionärs des gerade gegründeten sowjetrussischen kommunistischen Jugendverbandes in die obersten Ränge der Staats- und Parteielite, um letztlich in seinem jähen Sturz und gewaltsamem Tod zu enden – alles Stationen, die die Lebensläufe hunderter sowjetischer Politiker in ähnlicher Weise geprägt haben. Allerdings bietet gerade die vordergründige Banalität seines Lebens, die sich auch aus dem oben zitierten Eintrag in der Sowjetischen Geschichtsenzyklopädie herauslesen lässt, eine gute Projektionsfläche, nicht nur um die typische Laufbahn eines sowjetischen Parteifunktionärs dieser Zeit nachvollziehbar zu skizzieren, der, durch den Sturz der zarischen Ordnung begünstigt, eine Karriere gemacht hatte, die ihm „zu alten Zeiten“ unter keinen Umständen gelungen wäre, sondern auch um die Entwicklungswege des sowjetischen Staates in der wohl dramatischsten Phase seiner frühen Geschichte nachzuzeichnen.
Wie bereits erwähnt, war Kosarev nicht nur Zeuge der Oktoberrevolution und des Bürgerkrieges, der Neuen Ökonomischen Politik, der darauf folgenden Kollektivierung und des „Großen Terrors“, sondern er nahm an vielen dieser Ereignisse selber aktiv teil und leistete einen bedeutenden Beitrag zu Stabilisierung und Verfestigung der Herrschaft von Iosif Stalin. Er unterstützte dessen utopische und grausame Politik, entlarvte angebliche Volksfeinde, sang Lobeshymnen auf den „Vater aller Völker“ und zählte zu denjenigen, denen der Ruf eines „Kettenhundes“ Stalins vorauseilte. Doch was seine Machtposition entscheidend stärkte und vielen seiner Genossen überlegen machte, war der offizielle Posten, den er seit 1929 innehatte: der Posten des Generalsekretärs des Komsomol. Insoweit ist die Geschichte des Aleksandr Kosarev auch die Geschichte des Kommunistischen Jugendverbandes, den er zehn Jahre lang geleitet und dem er seinen Aufstieg und seinen tragischen Fall zu verdanken hatte.
Kosarev gehörte zu keinem Zeitpunkt zu Stalins engstem Umfeld und dennoch war sein Name Mitte der 1930-er Jahre einer der bekanntesten in der ganzen Sowjetunion. Zu seinen Ehren wurden Kolchosen, Fabriken und Bergwerke benannt, ihm salutierten die sowjetischen Sportler, die fizkul’turniki, die in endlos scheinenden Reihen über die Plätze Moskau marschierten, ihm huldigten die führenden Intellektuellen des Landes und selbst Maksim Gor’kij, die Ikone des sozialistischen Realismus, sah es nicht für unter seiner Würde, mit Kosarev einen Briefwechsel zu führen. Er war Mitglied des Zentralkomitees der Partei, des Organisationsbüros (Orgbüro) des ZK der Partei und der Zentralen Kontrollkommission (ZKK), die die Funktionen des obersten Parteigerichts hatte. Unter seiner maßgeblichen Beteiligung und zum Teil auf seine Initiativen hin verabschiedete die Parteiführung wichtige Beschlüsse, die die Bereiche Freizeit, Sport und Schulwesen nachhaltig verändern und die These untermauern sollten, das Leben in dem Stalinschen Imperium sei „besser und lustiger“ geworden. Kosarev diente dem System, indem er Stalins Kult nach Kräften befeuerte und war gleichzeitig der eifrigste Architekt seines eigenen Kults, eine geschickte Vorgehensweise, die das Regime zu stabilisieren und seine persönliche Autorität zu festigen half. Je stabiler die bolschewistische Herrschaft, desto größer die Aussicht auf das eigene Fortkommen – diese Handlungsmaxime lag vielen seinen Aktionen zugrunde.
Allerdings war das Leben Kosarevs keine ununterbrochene Abfolge von Siegen, die sich, wie eine Girlande aneinandergereiht, zu einer Einheit kontinuierlich weiterführender Schritte auf der Karriereleiter in den ersehnten „Apparatschik-Himmel“ hinauf verschmolzen, sondern wies durchaus Brüche und Risse auf, die für die damalige Generation der Parteiführer geradezu typisch waren. Er wurde mehrfach von Stalin zurückgesetzt, musste die Arreste engster Mitarbeiter und Freunde schweigend hinnehmen und blieb dem „Führer des Sowjetvolkes“ trotzdem treu bis zu seiner eigenen Verhaftung und möglicherweise sogar darüber hinaus. Sein Leben war widersprüchlich, seine Ansichten änderten sich im Verlauf seiner „Dienstjahre“ und er konnte sowohl idealistischer Romantiker als auch skrupelloser Vollstrecker des Vernichtungswillens der obersten Parteiführung sein. Die Person Kosarevs darf nicht simplifiziert und eindimensional dargestellt werden: Er war weder ein blindes Werkzeug des Stalinschen Systems, das hirnlos alles in die Tat umsetzte, was ihm von oben befohlen wurde, noch war er ein Kämpfer gegen dieses System. Diese Arbeit wird versuchen, der Person Kosarevs in all ihren für uns greifbaren Facetten gerecht zu werden. Es soll gezeigt werden, wie er seine eigenen Netzwerke schuf und mit verschiedenen Institutionen interagierte, dabei nicht nur das Wohl des Komsomol, sondern auch seinen eigenen Aufstieg stets im Auge behaltend, wie er intrigierte und selbst Opfer von Intrigen wurde, wie er seine Gegner vernichtete und sich selbst zum treuen Schüler Stalins hochstilisierte, um so in den Besitz des teuersten Gutes in einer Diktatur zu gelangen, der Gunst des Diktators. Kurzum, es soll gezeigt werden, wie die bolschewistische Herrschaft der ersten zwanzig Jahre nach der Oktoberrevolution funktioniert hatte und welche Rolle einem Einzelakteur dabei zukam.
Die Grundpfeiler der Arbeit bilden mithin drei Erzählstränge, die miteinander korrelieren und erst in der Gesamtbetrachtung eine Einheit darstellen: die Lebensgeschichte einer Person, die Geschichte einer Institution und die Geschichte eines Regimes. Auf diese Weise soll die Lebensgeschichte Kosarevs mit der Geschichte des Komsomol kombiniert und mit der gleichzeitig stattfindenden Entwicklung des politischen Systems sowie mit zum Teil abrupten Veränderungen von Rahmenbedingungen, die die Anpassungsfähigkeit politischer Akteure jedes Mal aufs Neue herausgefordert haben, verknüpft werden. Dieses Vorgehen ist in seinem Kern weder revolutionär noch einmalig. Bereits Siegfried Kracauer postulierte in seiner Offenbach-Biographie, dass jeder, wer Jacques Offenbach nenne, in Wahrheit „das ganze Zweite Kaiserreich“ mit seinen Hauptakteuren, seinem Machtapparat, seinen Festen und seinem Zerfall heraufbeschwöre. „Offenbach in die Mitte dieses Buches zu rücken wäre schon deshalb gerechtfertigt, weil er die Mitte seiner Zeit einnimmt.“7 Das gleiche lässt sich auch über die Person Aleksandr Kosarevs behaupten: Ihn zu untersuchen, ohne dabei die sowjetische Geschichte der 1920-30er Jahre mit all ihren Peripetien, ihrer Tragik, ihrem Glanz und Elend zu beachten, wäre kein sinnvolles Unterfangen gewesen. Dass dabei gleichfalls der Komsomol als Institution im Mittelpunkt stehen wird, ist mehr als verständlich, denn hier stellte Kosarev den Gravitationspunkt dar, um den sich fast zehn Jahre lang alles drehte.
Ein für die richtige Einordnung der Arbeit unbedingt zu beachtender Hinweis sei an dieser Stelle noch einmal gestattet: Trotz der Tatsache, dass im Mittelpunkt dieser Arbeit eine Einzelperson steht, ist sie keine Biographie im klassischen Sinne, falls es diese „klassische“ Form überhaupt noch gibt (ob es sie jemals gab, ist eine anderer Frage). Auch wenn das biographische Moment nicht zu vernachlässigen ist und entsprechend große Aufmerksamkeit finden wird, ist die vorliegende Arbeit in erster Linie eine Studie über die Macht und deren Erscheinungsformen, über Handlungsspielräume und Betätigungsfelder, über Einflussmöglichkeiten, die ein gesellschaftlich-politischer Akteur in einer Diktatur innehat, ohne selbst Diktator zu sein.
Aus diesen Gründen ist es notwendig, eine theoretische Annäherung an das Thema in drei Schritten durchzuführen, wobei zuerst eine Auseinandersetzung mit Grundlagen der modernen Biographieforschung und (als zweiter Schritt) deren speziellen Spielart, der biographischen Erschließung von Diktaturen, als unumgänglich erscheint, bevor dann im dritten Schritt das Thema der Macht als Phänomen des sozialen Lebens des Menschen und die besonderen Formen, die sie in einer Diktatur annimmt, näher zu beleuchten sein werden.
b) Theoretische Annäherung I: Die biographische Methode
Am 31. Mai 1936 ließ Siegmund Freud den Schriftsteller Arnold Zweig wissen, er müsse ihm einen Brief schreiben, da er durch „die Drohung“ aufgeschreckt worden sei, „dass Sie mein Biograph werden wollen.“ Freud erachtete es für seine Pflicht, seinen Briefpartner vor den Tücken der Biographie als Genre und den Fallstricken, die auf denjenigen warten, der sich zur Betätigung auf diesem Feld entschließt, zu warnen: „Wer Biograph wird, verpflichtet sich zur Lüge, zur Verheimlichung, Heuchelei, Schönfärberei und selbst zur Verhehlung seines Unverständnisses, denn die biographische Wahrheit ist nicht zu haben, und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu brauchen.“8
Noch vor wenigen Jahren schien die Biographie als Thema für seriöse historische Forschung tot zu sein und die meisten Historiker stimmten der Freudschen Verachtung für dieses Genre uneingeschränkt zu. Die Generation der Forscher, die Anfang der 1970er Jahre nach neuen Wegen suchte, um die Methodik der Sozial- und Geisteswissenschaften zu reformieren, erklärte das Biographieschreiben kurzerhand für entbehrlich und sogar schädlich. Die Biographik sei zu einer „unschuldigen Gattung“ geworden, stellte einer von ihnen fest, man nehme sie nicht mehr ernst, lasse sie aber gewähren. Das Genre der Biographie sei nichts anderes als die „letzte Auffangstellung des deutschen Historismus“, deren Schicksal darin bestünde, von „programmatisch-pauschaler Kritik angegangen“ zu werden.9 Genauso wie der Historismus galt die Biographik als überholt, die Kritik an ihr beruhte auf der Ablehnung jeder Reduktion der Geschichte auf das Denken und Wirken von Individuen. Man warf der traditionellen Geschichtsschreibung vor, sich auf das Handeln großer Subjekte zu fokussieren, und betrachtete sie als ein Hindernis auf dem Wege der Etablierung einer theoriegeleiteten Historiographie. Die Untersuchung von Massenphänomenen, die sich dabei an den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu orientieren hatte, sollte das Studium einzelner Ereignisse und vereinzelter Individuen ersetzen.10
Die objektiven Handlungsspielräume des Individuums wurden als sehr gering eingeschätzt, während man den äußeren Einflüssen eine Wirkungskraft beimaß, die eine fast übermächtige Dimension erreichte und dadurch eine starke Relativierung des bewussten „Ich“ suggerierte. Unter diesen Voraussetzungen empfand man das Individuum bei der Untersuchung der allgewaltigen gesellschaftlichen Strukturen als störend und geradezu als Hindernis, das den Blick auf diese alleinigen Bewegungskräfte der Geschichte verstellte. Allerdings stellte man nach einer gewissen Zeit fest, dass die so verstandene Geschichtswissenschaft, die zu einer reinen Strukturgeschichte mutierte und die Biographie aus grundsätzlichen Überlegungen ablehnte, dazu neigte, „menschenleer“ zu sein. Die Folge davon war nicht nur ein von den Soziologen diagnostizierter „Verfall der Biographie als geschichtswissenschaftliches Genre“,11 sondern auch die Gefahr, Individuum und Gesellschaft als Dichotomie zu begreifen, eine Vorstellung, deren Folge darin bestehen könnte, Persönlichkeit und Strukturen als strikten Gegensatz und einander ausschließenden Alternativen wahrzunehmen. Diese Erkenntnis führte zum Erwachen eines neuen Interesses am historischen Subjekt, was im Verbund mit der stärkeren Einbeziehung des „wirklichen Menschen“ nicht zuletzt auf der Betonung der Handlungstheorie für das historische Verstehen beruhte.12
Wichtige Impulse zu dieser erneuten Wendung in der bundesdeutschen Historiographie gingen von denjenigen Wissenschaftlern aus, die sich der sogenannten „Alltagsgeschichte“ widmeten.13 Von den neu gewonnenen Erkenntnissen ausgehend und in Verbindung mit den Einflüssen, die vor allem aus Frankreich und dem angelsächsischen Raum kamen, entwickelte sich in der deutschen Geschichtswissenschaft die historische bzw. politische Biographik, die nicht mehr als „unbedeutend“ und „fern der theoretischen Grundlagen“ bezeichnet werden kann. Auch scheinen die Zeiten vorbei zu sein, in denen ein Hans-Ulrich Wehler postulieren konnte, dass bei der Biographie zwar das Individuum im Vordergrund stehe, doch dies unter Inkaufnahme der Verkürzung der allgemeinen historischen Antriebskräfte und Strukturen.14 Wenn man früher danach fragte, ob die Historie auch die Biographie erfordere,15 kann man heute davon sprechen, dass das Genre der Biographie eine Renaissance erlebt, die ihm in diesen Ausmaßen vor wenigen Jahren nur die größten Optimisten zugetraut hätten. Die Buchläden sind voll von Biographien, deren Mehrzahl mittlerweile den modernsten wissenschaftlichen Anforderungen genügt und nicht mehr ohne Weiteres in die „Schmuddel-Ecke“ des Historismus abgeschoben werden kann.16
Dieses wiedererwachte Interesse an der Biographie wird unter anderem dadurch bedingt, dass sie sich ihr Sujet aus allen Lebensbereichen nehmen und eine allgemeingeschichtliche Relevanz vermitteln kann, wobei der Anfang und das Ende durch die Lebensdaten der zu biographierenden Person klar gekennzeichnet sind. Während man früher besonders gern Männer, die „zur rechten Zeit“ auf der Bühne erschienen, um dort „Geschichte zu machen“,17 als bevorzugten Gegenstand einer biographischen Untersuchung wählte, und sie so zum Handlungsmaßstab für sich und die anderen verklärte, gibt es in der heutigen Gesellschaft viel mehr Distanz zu den als groß postulierten historischen Persönlichkeiten, ja „ihre ‚Größe‘ erscheint uns in vieler Hinsicht eher als unglaubwürdig“.18 Das bedeutet, dass ein Zurück zum Verständnis vom Menschen als „eine kleine Welt für sich, die letzten Endes ganz unabhängig von der großen Welt außerhalb seiner existiert“,19 die gerade dem Historismus zu eigen war, für die moderne biographische Darstellung ausgeschlossen ist, wenn sie als „wissenschaftlichen Ansprüchen genügend“ bezeichnet werden will. Und das führt zu der Feststellung, dass das historische Erzählen erst dann wissenschaftsspezifisch wird, „wenn es an methodische Regeln gebunden wird, die es darauf verpflichten, seine Geltungsansprüche systematisch überprüfbar zu machen“.20 Die moderne Biographie soll bestrebt sein, die Persönlichkeit aus isolierender, lediglich biographischer Betrachtung zu lösen und sie konsequent in das politische Kräftefeld ihrer Zeit einzuordnen, was dazu führt, dass man sich den Entwicklungen einer bestimmten Zeit widmen muss, um so die Voraussetzungen und Bedingungen des Wirkens der zu biographierenden Person verständlich zu machen. Durch das Studium von Biographien einzelner Personen bekommt man einen anderen Zugang zu Möglichkeiten der Analyse von Sozialstrukturen und kollektiven Verhaltensweisen, sie werden dadurch gewissermaßen komplementiert.
Dabei ist eine der wichtigsten Fragen die, ob das Kollektive nicht zum Individuellen führt. Wenn man diese Frage mit ‚Ja‘ beantwortet, dann schlussfolgert man daraus, dass ein Individuum für den Historiker das „unvermeidliche Mitglied der Gruppe“ ist, so dass dessen Studie unerlässlich ist, um die Analyse von Sozialstrukturen und kollektiven Verhaltensweisen zu vervollständigen.21 Auf die vorliegende Arbeit bezogen bedeutet diese Erkenntnis, dass die Persönlichkeit des Komsomolführers Kosarev nur dann – zumindest bis zu einem gewissen Grad -, nachvollziehbar dargestellt werden kann, wenn man ihn als Mitglied einer bestimmten Gruppe ansieht und somit auch diese Gruppe (im vorliegenden Fall sowohl die Komsomolfunktionäre als auch die Parteielite) zum Gegenstand der Betrachtung macht. Erst dadurch erreicht man das Ziel, dass sich jede wissenschaftlich seriöse Biographie setzen muss, und zwar die „Präsentation und Deutung eines individuellen Lebens innerhalb der Geschichte“.22
Zum Leben eines Individuums gehören aber neben den ihn umgebenden Personen auch die Gesellschaftsstrukturen, mit denen es ununterbrochen konfrontiert wird und die seine Handlungsweise in einer bestimmten Form erst überhaupt möglich machen. Nach Meinung von Christian Meier sind Strukturen „Verhältnisse gegenseitiger Bedingung zwischen verschiedenen Faktoren. Sie sind Zusammenhänge und können folglich nur zusammenhängend behandelt werden“.23 Daraus folgt, dass eine anspruchsvolle historische bzw. politische Biographie ihren „Helden“ sehr sorgfältig in Beziehung „zur Struktur seiner Gesellschaft und seiner Zeit“ setzen muss, da sie andernfalls seiner Besonderheit „nicht gerecht werden“ kann24. Das Erfordernis, die jeweiligen Strukturen zu erschließen, stellt für die vorliegende Arbeit eine Conditio sine qua non dar; ohne diesen Schritt wird die richtige Einordnung von Optionen, die Kosarev als Funktionär jeweils zur Verfügung standen (oder eben nicht), praktisch ausgeschlossen sein. Damit die Strukturen aber nicht als „nackte Wand ohne Putz“ stehen bleiben, müssen sie notwendigerweise um die kulturellen Bedingungen und Prägungen, die die Wahrnehmung des Individuums sowie der Gruppe, der es angehört, beeinflussten, ergänzt werden. Die um eine kulturelle Komponente angereicherte Strukturgeschichte liefert dem Biographen nicht nur den notwendigen historischen Hintergrund, sondern ermöglicht auch eine epochenspezifische „Möglichkeitsbestimmung“ des Protagonisten, die deswegen wichtig ist, da sie die Positionen aufzeigt, die von jeweiliger Strukturgeschichte „offen gelassen oder versperrt“ sind, die „einer einnehmen kann, um sich zu entfalten“.25 Zu fragen ist somit, ob Kosarev als Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit nicht nur Macht in den Verhältnissen hatte, sondern auch imstande war, Macht über die Verhältnisse zu gewinnen.26
Allerdings sind Biographien keine bloßen Ergänzungen sozialhistorischen Forschens. Es muss stets beachtet werden, dass eine Biographie der „historischen Totalität der historischen Strukturen“ eine „lebensgeschichtliche Totalität des historischen Ausschnitts“ gegenüberstellt. Sie betont die Bedeutung der Erkenntnis „kontingenten individuellen Handelns“, die hilft, eine Einsicht „in die Strukturen“ zu gewinnen und dadurch ihre unterstellte „Zwangsläufigkeit“ relativiert. Damit korrespondiert das Interesse des Biographen am Erkennen und Sichtbarmachen der Handlungsspielräume der untersuchten historischen Subjekte „und zwar sowohl der gegebenen wie der subjektiv erfahrenen, der genutzten wie der ausgeschlossenen, der Möglichkeitshorizonte, die sich ihr Handeln eröffnete und gleichzeitig verschloss”.27 Aus diesem Grund ist die vorliegende Arbeit keine reine Abhandlung über die Geschichte des Kommunistischen Jugendverbandes, auch wenn dessen Strukturen nicht unerwähnt bleiben und er als Ausgangsbasis für Kosarevs Handeln immer wieder in den Fokus der Darstellung gerät. Sie ist vor allem eine Untersuchung des individuellen Handelns von Aleksandr Kosarev, seiner Möglichkeitshorizonte, seiner genutzten und ungenutzten Chancen, die uns ermöglichen wird, bessere Einsicht in die innere Verfasstheit des sowjetischen Staates insgesamt zu bekommen. Durch den Einsatz der Methoden sowohl der „biographie modiale“ (G. Levi) als auch der „kontextuellen Biographie“28 sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht nur die typischen Verhaltensformen von Aleksandr Kosarev illustriert, sondern auch die Rahmenbedingungen untersucht werden, die die Möglichkeiten seines Handels definiert hatten. Diese „perspektivische Variabilität im Dienste einer empirischen Wirklichkeitserkenntnis“29 bedeutet gleichzeitig eine Zurückweisung des absoluten Wahrheitsanspruchs der historischen Rekonstruktion. Das Leben eines Menschen folgt keinem von vornherein festgelegten Plan; die Kontingenz biographischer Windungen hatte bereits Bourdieu zu der Feststellung bewogen, die kontinuierliche Entwicklung des Individuums sei eine Fiktion, die „wohl durch die Konstanz des Eigennamens in die Welt kam“.30
Doch die Kontingenz des Lebensverlaufs darf nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, das Individuum habe gar keinen Einfluss auf die Ausformung seiner Biographie. Ein Leben wird nicht einfach gelebt; es ist etwas Gestaltetes. Die Begriffe wie „unmittelbar“ und „authentisch“ müssen durch „konstruiert“ und „inszeniert“ ergänzt werden, „wobei kaum Kriterien zu finden sind, nach denen etwas als ‚noch authentisch‘ oder ‚schon inszeniert‘ zu gelten hat“. Jeder, der eine Biographie schreibt, „muss nicht nur einen Lebensweg nachzeichnen, sondern auch den dazugehörigen (bewussten wie unbewussten) Inszenierungs – und Konstruktionscharakter beschreiben“.31 Die von der Romantik im 19. Jahrhundert begründete Vorstellung des geschlossenen Selbst, eines homo clausus, ist zusammen mit dem Historismus obsolet geworden. Jeder Mensch zerfällt in viele soziale Rollen, in ihm kreuzen sich die Diskurse, die er fallbedingt aneignet und umwandelt, je nachdem, wie „der jeweilige Sprech- und Handlungskontext es eingibt“.32 Ein Biograph wird es kaum schaffen können, Kriterien für die Unterscheidung zwischen vermeintlich authentischem und inszeniertem Verhalten zu entwickeln, sondern „es kann allenfalls darum gehen, die Beweggründe für diese oder jene Handlung oder Entwicklung zu rekonstruieren, Parallelitäten herzustellen, Einflüsse aufzuzeigen, Traditionslinien nachzeichnen“.33 Diese Erkenntnis besitzt für die vorliegende Arbeit allein schon deswegen einen nicht zu unterschätzenden Wert, weil Kosarevs Machtausübung am deutlichsten in seinem Verhalten sichtbar wurde. Die Untersuchung von sozialen Rollen und Diskursen, die sich in seiner Person „kreuzten“, gehört mithin zum wichtigen Bestandteil der Analyse seiner Handlungsspielräume.
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass aus dem „Gesamtmosaik Leben“ oft nur wenige Steine überliefert sind, so dass man, um ein Bild vom Ganzen zu geben, zu erheblichen Ergänzungen gezwungen ist.34 Die unzugänglichen oder vernichteten Archivalien, die Tatsache, dass viele Entscheidungen überhaupt keine schriftliche Fixierung erfuhren, sondern unter vier Augen besprochen und auf inoffiziellem Wege erledigt wurden, bedingen zwangsläufig den Umstand, dass die Beweggründe für die eine oder andere Entscheidung nicht immer einleuchtend und lückenlos rekonstruiert werden können. Dieser Not kann dadurch abgeholfen werden, dass man den Kontext einer Biographie auch als Folie nutzt, um im Vergleich mit Zeitgenossen, deren Leben analog verlaufen ist, nicht nur individuelle Lebensläufe plausibel zu machen,35 sondern darüber hinaus die Frage nach Macht und Handlungsspielräumen zu beantworten. Vor allem dann, wenn es darum gehen wird, Kosarevs Handeln in einen größeren Zusammenhang einzuordnen, soll ein Vergleich mit anderen Vertretern der sowjetischen Partei- und Staatselite die Nachvollziehbarkei seiner Beweggründe erhöhen.
Im Verlauf der Arbeit wurde immer deutlicher, dass es unmöglich ist, Kosarevs Persönlichkeit in einen öffentlichen und einen privaten Teil aufzuspalten. Dieses Unterfangen, das allein aufgrund schwieriger Quellensituation kaum zu verwirklichen wäre (siehe dazu weiter unten), lässt sich auch deswegen nicht konsequent verfolgen, weil Kosarevs Lebens, wie das vieler Politiker auch, kaum über private Bereiche verfügt hat, die, von seiner politischen Tätigkeit gänzlich abgesondert, von ihm in die extra dafür kreierten „Enklaven der Privatheit“ ausgelagert werden konnten. Außerhalb seiner öffentlichen Ämter ist Aleksander Kosarev als Person kaum greifbar, er ist ein „Organization-Man“, der mit fortschreitender Machtentfaltung seine Privatheit weitgehend aufgab. Die in der sowjetischen Propaganda üblich gewordene Floskel von einem Bolschewiken, der sein ganzes Leben dem Dienst am Proletariat geopfert hat und seine Erfüllung in dem Bewusstsein fand, den Sozialismus aufzubauen, entsprach viel öfter der Realität, als man es gemeinhin annimmt, auch wenn der pathetisch-schwülstige Stil, der diesen Erklärungen innewohnt,36 durchaus fragwürdig bleibt. Kosarev als Privatperson gab es auch nach seinem Aufstieg in die oberste Führungsetage, doch sein Agieren als Politiker scheint seine private Seite endgültig in den Hintergrund abgedrängt zu haben. Dafür offenbaren seine politischen Aktionen umso deutlicher seinen Charakter: Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht deswegen vor allem darin, seine Verstricktheit in soziale, kulturelle und politische Kontexte hervorzuheben und ihn somit als Teil seiner Lebenswelt in all ihrer Komplexität, unter Einbeziehung von Handlungszusammenhängen, Handlungsspielräumen und Mentalitäten zu sehen. Die Ausübung der Macht lässt sich nicht ohne die Person und die Person ohne ihr Amt verständlich machen. An Kosarevs Beispiel wird der Nexus zwischen diesen Komponenten der Existenz politischer Akteure deutlich. Das Amt und die Person verschmolzen mit der Zeit zu einer Einheit; diese Erkenntnis wird im Rahmen dieser Arbeit noch etliche Male zur Sprache kommen. Seit dem Augenblick, in dem Kosarev seine Position auf dem Schachbrett der Macht einnahm, war sein ganzes Streben darauf ausgerichtet, das Spiel um die Macht zu gewinnen. Die verlockende Aussicht, von einer Bauer-Figur zum König aufzusteigen, ließ ihn mitunter die Tatsache vergessen, dass das Schachbrett der Macht ein gefährliches Minenfeld war, auf dem eine Karriere im Nu für immer scheitern konnte. Sein politisches Leben wurde mithin zu einem unablässigen Kampf um Einfluss und Autorität.
c) Theoretische Annäherung II:Biographie in einer Diktatur
Bis in die 1970er Jahre hinein befand sich die Sowjetunion-Forschung im „eisernen Griff“ der sogenannten Totalitarismustheorie. Dieses Konzept, entstanden aus dem Versuch, die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus zu erklären, bewirkte eine Auseinandersetzung mit dem vollkommen neuen Phänomen totalitärer Herrschaft, das in Europa nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war. Je mehr sich die Wissenschaftler bemüht hatten, die Natur der totalitären Diktatur Hitlers zu erklären, desto unausweichlicher erschien aus ihrer Sicht die Tatsache, dass auch eine andere Diktatur in diese Betrachtungen mit einbezogen sein müsse, die nach dem Zweiten Weltkrieg als großer Gegenspieler der westlichen Demokratien einen ständigen Anlass zur Sorge gab – der Stalinismus. Auf diesem Weg entstand ein Schema, das eine totalitäre Herrschaft auf der Grundlage bestimmter Merkmale zu definieren suchte. Dazu zählten das Vorhandensein einer Ideologie mit Ausschließlichkeitsanspruch, das Führerprinzip, der Alleinvertretungsanspruch einer Partei, die gewaltsame Durchdringung und Veränderung der Gesellschaft – Hannah Arendt sprach in diesem Kontext von der Atomisierung und Auslöschung des Individuums in der totalitären Diktatur, die in der Vernichtung aller horizontalen Beziehungen kulminierte – usw., die nach Meinung der Vertreter des Totalitarismuskonzeptes sowohl auf Hitlers Deutschland als auch auf Stalins Russland angewendet werden konnte.37
Die führenden Vertreter des Totalitarismuskonzepts konnten zwar vergleichende Beschreibungen der Funktion von Grundmechanismen der Herrschaft im Sowjetsystem und im Nationalsozialismus liefern und das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Merkmale „checken“, das Wesen des Stalinismus jedoch blieb ihnen ein Rätsel. In dieser Hinsicht stimmt die scharfsinnige Bemerkung von Manfred Hildermeier: „Hätte sich der Stalinismus als genau so kurzlebig erwiesen wie der Nationalsozialismus, wären totalitaristische Deutung und Erfahrungsbestand sicher eher zur Deckung gekommen. So aber blieben von Anfang an große Risse, die Fragen aufwarfen und Einwände nachgerade provozierten“.38 Das Totalitarismuskonzept vermochte keine überzeugende Abgrenzung gegenüber der vor- und nachstalinistischen Sowjetunion zu liefern, und eine seiner wichtigsten Prämissen, dass nämlich ein totalitärer Staat sich nur durch Ausübung hemmungsloser Gewalt und eine allumfassende Kontrolle gegenüber seiner Bevölkerung behaupten könne, schien auf die nachstalinistische Sowjetunion überhaupt nicht zu passen. Ungeachtet vieler guter Ansätze erstickte das Totalitarismuskonzept durch seine übermäßige Konzentration auf die Figur des Diktators eine differenziertere Sicht auf die Sowjetunion; da man davon ausging, dass ein totalitärer Staat alle Aspekte des menschlichen Lebens bis ins kleinste Detail unter seiner Kontrolle hat und von einer gesichtslosen Bürokratie gelenkt wird, die blind dem Willen des Führers folgt, sah man es als überflüssig an, sich mit den Vertretern dieser Bürokratie zu beschäftigen. Stalin und sein mächtiger Gegenspieler Trockij bildeten die einzigen biographisch-spezifischen Bezugspunkte der Sowjetunion-Forschung und aus der Sicht der Verfechter der Totalitarismustheorie war es nur logisch, diejenigen außer Acht zu lassen, die man sowieso nur für Marionetten des Parteichefs ohne eigenen Machtwillen und ohne nennenswerte Handlungsspielräume hielt.39
Das Umdenken setzte Ende der 1970er Jahre ein und gipfelte in der sogenannten „Revisionisten-Debatte“.40 Vereinfacht dargestellt, verfolgten die „Revisionisten“ das Ziel, ihre These des „Stalinismus von unten“ durch sozialgeschichtliche Forschungen zu beweisen. Der sozialgeschichtliche Ansatz bereicherte die Forschung um neue Einsichten, so dass man in der Sowjetunion der dreißiger Jahre plötzlich eine Anzahl an verschiedenen Gruppen „entdeckte“, auf die sich das Regime stützen konnte und auf deren Unterstützung es dringend angewiesen war. Auch bezüglich des „Großen Terrors“ der 1930er Jahre konnten die „Revisionisten“ zeigen, dass der Verlauf der Säuberungskampagnen der Führung beinahe entglitt und eine kaum mehr kontrollierbare Eigendynamik entwickelte, die durch Versuche bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, den Terror für ihre eigenen Zwecke zu vereinnahmen, noch begünstigt wurde.41 Und auch wenn es manch eine unfruchtbare Debatte gab, da einzelne Vertreter dieser Schule die These des „Stalinismus von unten“ durch die Behauptung überspitzten, die Politik des Regimes sei ihm von den Massen gewissermaßen aufgezwungen worden,42 bleibt die große Leistung der „Revisionisten“ unbestritten: Die Herausarbeitung des Befundes, dass das Stalinsche System eine breite Schicht von Unterstützern hatte, die bereit waren, aktiv an der Politik des Regimes zu partizipieren, war eine bahnbrechende Erkenntnis, die den Verlauf der Ereignisse plausibler machte. Die Mittäter waren keine „quantité negligeable“ mehr, sondern „nennenswerte und vor allem einflussreiche Gruppen“, und die intensive Beschäftigung mit ihnen diente der Überwindung der überkommenen Vorstellung vom Stalinismus als reiner Gewaltherrschaft einiger weniger über die übrige Bevölkerung. Die Gesellschaft wurde gegenüber dem Staat stärker ins Spiel gebracht, einschließlich einer Mitschuld an dessen Verbrechen.43
Den nächsten Schritt auf der Genesisleiter der westlichen Sowjetunion-Forschung stellte die Neue Kulturgeschichte dar, die unter dem Einfluss poststrukturalistischer, kulturanthropologischer und diskursanalytischer Fragestellungen bestrebt war, den Texten, Diskursen und symbolischen Handlungen eine bestimmte Bedeutung zu entnehmen, um sie anschließend zu entschlüsseln.44 Das Alltagsleben, subjektive Wahrnehmungen der Wirklichkeit und die Mentalitätsgeschichte, die Geschlechtergeschichte und die Kultur im weitesten Sinne- all diese multiplen Komponenten des Funktionierens einer Gesellschaft boten den Vertretern der Neuen Kulturgeschichte auch im Falle der Sowjetunion ein reichhaltiges Analysematerial, das in vielerlei Hinsicht wirkungsvollere Annäherung an die Stalinzeit zu gewährleisten imstande war als die bisher erprobten Wege. Die Einbeziehung von Ego-Dokumenten, die Interpretation ihres semantischen Inhalts, die verstärkte Beachtung diskursiver Praktiken und des Habitus als eines Mechanismus zur Vereinheitlichung des Diskurses sowie die „Wiederentdeckung“ der Emotionen als Instrumente zur Prägung des Individuums gaben der Erforschung des Stalinschen Systems neue und durchaus fruchtbare Impulse.45 Auch wenn die Rekonstruktion der historischen Wirklichkeiten aus der subjektiv erlebten Wahrnehmung und die Absolutheit, mit der sprachphilosophische und semiotische Kategorien (hier geht es vor allem um das Konzept des linguistic turn) gesetzt werden, bei ihrer Anwendung in Reinkultur unter Umständen zu Fehlurteilen und Überspitzungen führen können, ist die Neue Kulturgeschichte zweifelsohne ein unabdingbarer und unverzichtbarer Teil der modernen Sowjetunion-Forschung, deren Impulsen die vorliegende Arbeit viel zu verdanken hat.
Dem Autor erscheint der Streit darüber, welcher methodische Ansatz der Erforschung des Stalinismus denn nun am angemessensten sei, vor allem deswegen als verfehlt, weil jeder von ihnen einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis des komplexen Phänomens der sowjetischen Geschichte, das wir als „Stalinismus“ bezeichnen, zu leisten imstande ist und auch bereits geleistet hat und gleichzeitig jeder von ihnen seine Schwächen hat, die nicht zu übersehen sind, sobald man versucht, die jeweilige Theorie als ein apodiktisches Konstrukt zu betrachten, das keine „Verwässerung“ der „reinen Lehre“ duldet. Neuere Forschungen kennzeichnen sich gerade durch die Kombination intensiver Methodenreflexion, die Problematisierung von vermeintlichen Evidenzen und ein quellengesättigtes Vorgehen. „Dazu bedarf es des Methodenpluralismus und der Selbstreflexivität. Denn was in der Empiriebreite des Untersuchungsgegenstandes verloren geht, muss durch ein methodisch reflektiertes Vorgehen wettgemacht werden“.46
Die vorliegende Studie möchte einen Versuch machen, am Fallbeispiel der Frage nach den Macht- und Handlungsspielräumen eines Funktionärs in der Sowjetunion der 1920-1930er Jahre eine Synthese verschiedener Herangehens- und Betrachtungsweisen zu vollziehen. Die Stalinzeit soll nicht nur aus einem, sondern aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht werden: in politischer, sozial- und kulturgeschichtlicher Sicht, als soziale Praxis vor dem Hintergrund spezifischer Strukturmerkmale und Vorgaben des Systems.47
Die in etlichen Abhandlungen, auch in der jüngsten Zeit, zur Anwendung gekommene Methode, den russischen Kommunismus als ein sich ununterbrochen entwickelndes Ganzes zu präsentieren, dem eine einheitliche Linie zugrunde lag, die direkt von Lenin zu Stalin führte, stellt meines Erachtens einen bedenkenswerten Versuch dar, ein komplexes Geschehen unzulässig zu vereinfachen.48 Die Regierungszeit Lenins unterschied sich in mehrfacher Hinsicht von der Herrschaft Stalins genauso, wie der nordkoreanische Pseudokommunismus sich von dem Marxismus der Menschewiki unterscheidet, auch wenn es in vielen Bereichen Kontinuitäten gab, die nicht zu übersehen sind. Zu klären bleibt somit noch, was man in dieser Arbeit unter dem Begriff des Stalinismus zu verstehen hat.
Der Stalinismus hatte erstaunlich viele Gesichter. Einerseits war es ein Regierungssystem, das sich auf die Ausübung hemmungsloser Gewalt stützte, sie zu einer dominierenden Konstante und zum zentralen prägenden Moment seines Wirkens machte, „eine Form personalisierter, terroristischer Herrschaft totalitären Anspruchs“, die „unter den Bedingungen sozio-ökonomischen Wandels, ethnisch-kultureller Konflikte, institutioneller Unterentwicklung und gesellschaftlicher Mobilisierung entstand“.49 Damit untrennbar verbunden war ein „Komplex an Institutionen, Strukturen und Ritualen“, dessen Teil sowohl die Herrschaft der kommunistischen Partei als auch die marxistisch-leninistische Ideologie, die Suche nach „Klassenfeinden“, Terror, politische Überwachungsmaßnahmen, Kult aller möglichen „Führer“ etc. darstellen.50
Andererseits bestand der Stalinismus nicht nur aus Gewalt. Das System war auch imstande, mannigfaltige Partizipationsmöglichkeiten anzubieten, die breiten Massen zu begeistern, zu mobilisieren und sie – auch längerfristig -, für das Regime zu gewinnen, indem man ihnen das Gefühl gab, den „fortschrittlichsten Teil der Menschheit“ zu repräsentieren, etwas noch nie Dagewesenes zu erschaffen oder im glücklichsten Land der Welt zu leben, das, von Feinden umgeben, es dennoch schafft, von Sieg zu Sieg voranzuschreiten. Nicht umsonst erinnern sich viele Menschen, deren Kindheit in die Stalinzeit fiel, nicht nur an die Repressalien und Gewalterfahrungen, sondern auch an Sportlerparaden, an die Erfolge sowjetischer Polarforscher und an die patriotische Hochstimmung. Für viele war der Stalinismus eine Art „Selbstbedienungsladen“, wo man das nahm, was von einem gebraucht wurde. Es gab Lebensbereiche, die von Gewalt kaum berührt wurden, eine Erkenntnis, die sogar auf die Jahre der Kollektivierung und des „Großen Terrors“, als die Gewaltexzesse ihren jeweiligen Höhepunkt erreichten, anwendbar ist. Das Regime wurde zu einem eigenständigen „Lebenskosmos“ (M. Hildermeier), zu einem „cluster of powerful symbols and attitudes […] as an ongoing experience through which it was possible to imagine and strive to bring about a new civilization called socialism”.51 Die Aussicht auf Karriere und Wohlstand, die Aufstiegschancen, die das System denjenigen bot, die bereit waren, sich den herrschenden Dogmen zu unterwerfen, bildeten ein Fundament, das gewisse innergesellschaftliche Stabilität gewährleisten konnte.52 Die bolschewistischen Ideen hatten es geschafft, alle möglichen Bereiche des Lebens, von der Geburt über Schule und Studium bis zum Altwerden und Tod zu durchdringen und eine Symbiose mit überkommenen russischen Traditionen einzugehen, die durch eine solche Appropriation zum untrennbaren Bestandteil des Sowjetkommunismus wurden. Die von Stalin erschaffene Ideologie beinhaltete sowohl eine internationalistische als auch eine russozentristische Komponente, sie rehabilitierte diejenigen zarischen Generale, denen man unterstellte, „auf der Seite des einfachen Mannes“ gestanden und durch ihr pseudovolksnahes Verhalten den „Unterdrückern“ Paroli geboten zu haben (A.V. Suvorov, M.I. Kutuzov u.a.); sogar die Zaren wurden von ihr in „progressive“ und „rückständige“ geteilt, und sie verlieh der Sowjetunion ein imperiales Gepräge, das bis zum Zerfall des Landes bestehen bleiben sollte.53