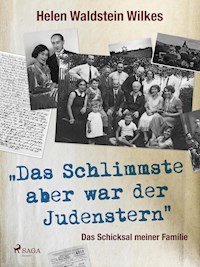
Das Schlimmste aber war der Judenstern - Das Schicksal meiner Familie E-Book
Helen Waldstein Wilkes
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Prag, 15. März 1939: Deutsche Truppen marschieren in die Tschechoslowakei ein, Hitler steht auf der Prager Burg. Am selben Tag, buchstäblich in letzter Sekunde, bekommen Helens Eltern Edmund und Gretl den entscheidenden Stempel in ihr Ausreisevisum gedrückt: `Genehmigt!´. Beginn einer Odyssee, die die junge jüdische Familie nach Kanada verschlägt. In Europa herrscht Krieg. In den Briefen aus der Heimat erfahren sie vom Schicksal ihrer Verwandten. Die Briefe werden weniger. Bald kommt keiner mehr. Helens Eltern beginnen zu schweigen. Jahre später entdeckt Helen Waldstein Wilkes die Briefe in einer zerschlissenen Pappschachtel. Verzweifelte Briefe. Sie liest, findet Fotos. Sie entdeckt eine verschwundene Welt. Und macht sich schließlich mit vielen Fragen und großer Hoffnung im Gepäck auf den Weg nach Europa.AUTORENPORTRÄTHelen Waldstein Wilkes, geboren in Strobnitz/Horni Stropnice. Im April 1939 ging die Familie von Prag über Antwerpen ins kanadische Exil. Sie hat in Romanistik promoviert und über 30 Jahre an Universitäten in Kanada und den USA gelehrt. Ihre Forschungsinteressen bezogen sich auf interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb und Fragen der Neurolinguistik. In ihrem Ruhestand, den sie in Vancouver verbringt, erforscht sie ihr eigenes kulturelles Erbe und dessen Bedeutung.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helen Waldstein Wilkes
»Das Schlimmste aber war der Judenstern«
Das Schicksal meiner Familie
Saga
Dank
Die Übersetzung ins Deutsche wurde ermöglicht durch:
Christina Goldt
Ingrid Hildebrand
Margarete Kollmar
Angelika Meirhofer
Ilse Windhoff
Stammbaum der Familie Waldstein
1. Kapitel
Eine Schachtel aus Pappe
Für mich existierte sie immer, diese Pappschachtel, die gerade so groß ist, dass ein paar Zeitschriften hineinpassen würden. An eine Zeit ohne die Schachtel kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, sie kam von Eaton’s, damals das größte Kaufhaus in Kanada.
Die Schachtel gehörte meinem Vater. Sie war rot und mit kitschigen Bildern beklebt: Ein Vater, der einen Schlitten zieht, bunt gekleidete Kinder, die fröhlich Schlittschuh laufen, dazwischen kleine Stechpalmenzweige mit roten Beeren. Eigentlich eine Schachtel für ein Weihnachtsgeschenk.
Warum hatte mein Vater gerade diese Schachtel zum Aufbewahren seiner Briefe ausgesucht? War es seine Sehnsucht nach einer fröhlichen kanadischen Familie? Verkörperten die Bilder den Traum eines neuen Lebens in Kanada? Oder erinnerten sie ihn an eine vergangene, eine frohere Zeit? An seine eigene Kindheit?
Ich war gerade 22 Jahre alt, als er starb. Ich hatte zum ersten Mal das Elternhaus verlassen und mein Studium an der Sorbonne begonnen, als mich das Telegramm erreichte: »Vater krank. Komm sofort zurück.« Am nächsten Tag saß ich im Flugzeug, aber da war es schon zu spät.
Obwohl ich noch unter dem Schock seines Todes stand, hatte ich nur diesen einen Gedanken, der mich nicht losließ: Ich musste unbedingt meine Mutter dazu bringen, die Schachtel für mich aufzubewahren. Ich weiß nicht, was meine Mutter mit den anderen Habseligkeiten meines Vaters getan hat. Vielleicht hat sie ihn in seinem einzigen guten Anzug beerdigt, seine übrige Kleidung mag sie an bedürftige Nachbarn verschenkt haben, und die wenigen deutschen Bücher hat sie womöglich weggeworfen, weil sie sich dachte, dass sowieso niemand sie jemals lesen würde. Doch die Schachtel mit den Briefen hat sie tatsächlich aufgehoben.
Das Album mit den Familienfotos hat sie auch behalten. Erinnerungen können mit der Zeit verblassen, aber Fotos bleiben ewig. Wenn ich heute diese Bilder betrachte, sehe ich Menschen in einer Welt, die schon lange nicht mehr existiert. Aber ich entsinne mich gut, wie es war, wenn meine Mutter das Album hervorholte. Zuallererst breitete sie ein weißes Tuch auf dem Tisch aus und danach legte sie das Album darauf. Und dann war sie oft lange schweigsam und tauchte mit ihren Gedanken wie in eine andere Welt ein. Und noch heute höre ich ihre Stimme in der mir so vertrauten Färbung. Ihre Finger tasteten über die Gesichter der Angehörigen und sie erzählte mir von ihnen:
»Hier ist dein Onkel Arnold, der Bruder deines Vaters mit seiner Frau Vera, an ihrem Hochzeitstag. Vera war hübsch und hochintelligent. Sie haben sich so gut ergänzt. Er war Ingenieur und sie war Ärztin. Damals als Frau Medizin zu studieren, das war ja doppelt schwer.
Hier ist deine Tante Martha, die jüngste Schwester deines Vaters. Schau dir diese lockigen schwarzen Haare an! Sie war noch so jung, als sie Emil Fränkel geheiratet hat. Und hier ist ein Bild von deiner Cousine Ilserl. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr, aber ihr zwei habt stundenlang miteinander gespielt. Von der kleinen Dorli haben wir keine Bilder. Sie kam auf die Welt, kurz bevor wir Europa verließen.
Das hier ist ein Bild von Else. Sie ist die ältere Schwester deines Vaters. Deine Cousine Ilserl wurde nach Else benannt, weil sich Else schon als Kind wie eine zweite Mutter um Martha gekümmert hat.
Hier ist Else an ihrem Hochzeitstag. Sie hat Emil Urbach geheiratet. Der war ein sehr berühmter Arzt. Die Patienten kamen aus ganz Europa zu ihm – bis die Nazis an die Macht kamen. Dann war alles aus. Und hier, das sind die Urbach-Kinder, Marianne und Otto. Sie waren etwas älter als du, aber sie haben so gerne mit dir gespielt!«
Als Einzelkind auf einer von der Welt abgeschnittenen Farm fühlte ich mich so einsam, dass ich diese Worte geradezu aufsaugte. Da wir so weit weg von Nachbarn wohnten, hatte ich keine Spielkameraden, und meine Eltern besaßen weder Auto noch Telefon, um die Einsamkeit zu lindern. Als ich fünf Jahre alt war, konnte ich endlich in die Schule gehen, um meine ersten Worte Englisch zu lernen. Bis dahin war das Fotoalbum das Einzige, was mich mit anderen Menschen verband.
Manchmal bin ich heute noch neidisch, wenn ich meine Freunde die Feiertage planen höre:
»Es ist wichtig, dass die ganze Familie zusammenkommt.«
»Letztes Jahr waren wir 24.«
»Mein Sohn bringt dieses Mal seine neue Freundin mit, dann sind wir 31 bei Tisch.«
»Wie hältst du es mit der Sitzordnung? Die Kinder an einem Tisch und die Erwachsenen separat oder alle zusammen?«
Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel, Vettern und Cousinen, Großeltern. Oft habe ich mich gefragt, wie es wohl sein würde, sie alle zu kennen. Für mich bestand die Familie nur aus drei Personen: Mutter, Vater und ich. Für kurze Zeit waren wir fünf. Das war, als die einzige Schwester meiner Mutter, Anny, und ihr Mann Ludwig mit uns auf der Farm lebten.
Anny und Ludwig hatten keine Kinder. Man erzählte sich, dass Anny keine Kinder bekommen konnte, weil sie in Europa als Röntgenassistentin gearbeitet hatte, zu einer Zeit, als die schädlichen Auswirkungen der Röntgenstrahlen noch nicht bekannt waren. Oft drängte ich meine Eltern, noch ein Kind zu bekommen. Ihre Antwort war immer dieselbe: »Am Anfang hatten wir Angst. Du warst noch ein Baby, als wir geflohen sind, und wir waren Fremde in einem fremden Land. Wir hatten kein Geld, wir sprachen kein Englisch und wir hatten keinen passenden Beruf. Wir hatten Angst – und jetzt ist es einfach zu spät.«
Warum waren wir nur so wenige? Wo waren all unsere Verwandten aus dem Fotoalbum?
Mein Vater hatte vier Geschwister, von denen drei verheiratet waren. Sie luden einander zu ihren Hochzeiten ein, freuten sich zusammen, wenn einer von ihnen einen herausragenden Erfolg zu feiern hatte, und halfen sich gegenseitig, wann immer es nötig war. Drei der fünf Geschwister – Else, Martha und mein Vater – hatten Kinder und wohnten in der Nähe der Großeltern. So konnten sich Oma Fanni und Opa Josef am Lachen der Enkel erfreuen.
Leider besitzen wir keine Porträts von den Eltern meines Vaters. Von meiner Großmutter Fanni habe ich nur einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss. Sie sitzt in einem Liegestuhl im Garten und sieht liebevoll auf ein Kind herab, das sich an sie schmiegt. Das Kind ist meine Cousine Ilserl. Auf dem besten Bild, das es von meinem Großvater Josef gibt, trägt er Uniform. Es ist ein Foto aus dem Ersten Weltkrieg und zeigt ihn mit seinen drei Söhnen, Arnold, Otto und Edmund, alle uniformiert. Edmund, mein Vater, war damals siebzehn Jahre alt.
Es wird oft gesagt, dass Großeltern einen starken Einfluss auf ihre Enkel haben. Ich weiß von einem Großvater, der seine Liebe zur Natur an seine Kindeskinder weitergegeben hat, oder von einem, der seinem Enkel gezeigt hat, wie man mit Werkzeug umgeht und wie stolz es einen macht, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Ich kenne eine Großmutter, deren unendliche Liebe sich untrennbar mit dem Duft ihres frisch gebackenen Kuchens verband.
Was heißt es, Großeltern zu haben? Ich weiß es nicht, da ich keine bewusste Erinnerung an sie habe. Großmutter und Großvater sind keine Realität für mich. Es sind nur Namen, die zu den Bildern im Fotoalbum gehören. Großvater Max, der Vater meiner Mutter, ist nicht mehr als das Bild eines Mannes im Anzug mit Weste, ein Mann mit buschigen Augenbrauen und einem Schnurrbart über einem ernsten Mund. Er steht hinter einer einfach gekleideten Frau, die ein herzförmiges Medaillon trägt. Das ist meine Großmutter Resl.
Ich sammelte damals Geschichten über meine Großeltern, so wie ich dünnes Silberpapier von Zigarettenschachteln sammelte. Das Silberpapier brachten die Kinder in die Schule, für die Kriegshilfe. Kein Lehrer hat mir jemals erklärt, wie diese Folie unseren Soldaten helfen könnte. Ich stellte mir Berge von Silberpapier vor und Fabriken, in denen man daraus Tragflächen für Flugzeuge schmiedete.
Vieles wurde nicht erklärt. Aber sogar als Kind wurde mir irgendwann klar, dass es zwischen den Bildern im Fotoalbum und den Briefen in der bunten Schachtel einen Zusammenhang gab. Die Briefe waren immer auf hellblauem Luftpostpapier geschrieben. Immer wenn ein Brief kam, legte ihn der Briefträger in den Metallbriefkasten, der an einem Pfosten oben an der Landstraße angebracht war. Jedes Mal schickten mich meine Eltern mit einem liebevollen Klaps in den Garten. »Geh spielen«, sagten sie.
Allein streifte ich durch unseren zugewachsenen Garten und versuchte mir auszudenken, was für Geheimnisse wohl hinter den verschlossenen Türen besprochen wurden. Wenn es vorher geregnet hatte, ließ ich in den Pfützen auf dem Fahrweg zu unserem Haus Holzstückchen schwimmen. Ich stieß sie übers Wasser und stellte mir vor, dass sie Schiffe auf dem Ozean wären. Einige Schiffe erreichten das sichere Ufer, andere nicht.
Obwohl der Krieg schon begonnen hatte, bekamen wir immer noch Briefe. Ich erfuhr später, dass eine Cousine meines Vaters in New York die Briefe an uns weitergeleitet hatte. Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor Anfang Dezember 1941 kamen keine Briefe mehr. Bei Kriegsende war ich fast neun, alt genug, um mich daran zu erinnern, mit welcher Ungeduld meine Eltern auf Nachricht warteten.
Als der letzte, lang ersehnte Brief endlich unser Haus erreichte, wurde ich für lange Zeit aus dem Haus verbannt. Habe ich es wirklich gehört oder mir nur vorgestellt, dieses schreckliche Jammern, das mich noch heute mit Entsetzen erfüllt?
Schließlich kamen meine Eltern aus dem Haus, um ihrer täglichen Arbeit nachzugehen. Die Kühe mussten gefüttert und gemolken werden, der Stall wurde ausgemistet und das zweimal am Tag, ganz egal, was passiert war. Ich kam mir vor, als ob ich meine Eltern wie Fische in einem Aquarium beobachtete. Sie waren kaum mehr wiederzuerkennen und von einer unheimlichen Ruhe umgeben, ganz für sich in einer Welt, in der ich sie nicht erreichen konnte.
Dieses beängstigende Schweigen blieb. Obwohl sich meine Eltern langsam wieder an den Alltag gewöhnten, war doch etwas völlig anders geworden. Ich konnte es nicht benennen, aber dieser letzte Brief markierte eine Wende. Ab jetzt konnte nicht mehr über alles gesprochen werden. Ich habe nie gefragt, was in dem Brief stand, und man hat es mir auch nie gesagt.
***
Ich weiß nicht, wann mir zum ersten Mal klar wurde, dass mein Vater die Briefe behalten und in der bunten Schachtel aufbewahrt hatte. Ich weiß nicht einmal, wann ich eine Verbindung zwischen den Briefen und seiner Familie herstellte. Wahrscheinlich war es im Frühjahr 1946, als ich in der sechsten Klasse war und wir in die Stadt umzogen.
Als der Krieg vorbei war, konnten meine Eltern endlich die Farm hinter sich lassen. Einerseits waren sie stolz, ihre Dankesschuld an Kanada abgeleistet zu haben, andererseits sehnten sie sich nach einem ihr Leben bereichernden Freundeskreis, wie sie ihn in Europa hatten. Der Umzug in die Stadt bedeutete für meine Eltern die Rückkehr in ein kultiviertes Leben. Die Farm hatten sie dem erstbesten Interessenten, der auftauchte, gern verkauft. Mit dem Erlös erwarben sie ein altes Haus in Hamilton. Wir wohnten im Arbeiterviertel dieser Industriestadt und teilten das Haus mit einer anderen Familie, um die Hypothek ablösen zu können. Aber alles erschien ihnen besser als Kühe melken, Hühner schlachten und das abgeschiedene Leben auf der Farm.
Mein Vater arbeitete sechs Tage in der Woche als Packer in einem Lagerhaus. Täglich kamen Lastwagen voller Kisten, die er abladen und ein paar Tage später auf andere Lastwagen wieder umladen musste. Meine Mutter fand eine Stelle als Akkordarbeiterin in einer Textilfabrik, und ich hatte den Eindruck, dass es nichts gab, was meinen Vater mehr quälte. In diesen Nachkriegsjahren beklagte er stets, dass seine Frau arbeiten gehen musste. Manchmal sprach er sehnsüchtig von dem Plan, einen kleinen Lebensmittelladen zu kaufen, um eine eigene wirtschaftliche Grundlage zu haben, aber es blieb nur ein Wunschtraum.
Hatten sie Angst, das Wenige, das sie besaßen, aufs Spiel zu setzen? Waren die paar Ersparnisse zu gering, sogar für einen heruntergekommenen Laden? Was auch immer der Grund dafür gewesen sein mag, meine Eltern haben sich jedenfalls niemals selbstständig gemacht. Bis zum Ende ihres Arbeitslebens blieben sie unter dem Joch der Abhängigkeit von Vorgesetzten, die genau wussten, dass diejenigen, die keine Qualifikationen vorzuweisen hatten und nur wenig Englisch konnten, geringen Einfluss auf Bezahlung oder Arbeitsbedingungen hatten.
Das Lagerhaus, in dem mein Vater Kisten hin und her schleppte, lag in der Stadtmitte. Meine Mutter hatte einen weiteren Weg zur Arbeit. Sie musste mit der Straßenbahn fahren. In der Frühe – an hellen Sommermorgen oder in der Dunkelheit des Winters – begleitete mein Vater sie zur Haltestelle und wartete ab, bis sie eingestiegen war. Dann erst kam er zurück, um seinen Kaffee fertig zu trinken, während ich meine Schulbücher zusammensuchte.
Es lag bloß eine Stunde Zeit zwischen meiner Rückkehr von der Schule und der Rückkehr meiner Mutter von der Arbeit, aber diese Stunde war für mich die längste des Tages. Sie schien kein Ende zu nehmen. Manchmal stöberte ich dann im Haus herum. Eines Tages öffnete ich die Nachttischschublade meines Vaters und fand Ratgeberbroschüren für das eheliche Sexualleben. Ich las diese Broschüren und versuchte, eine Verbindung herzustellen zwischen den abgebildeten Zeichnungen und den verwirrenden Bruchstücken, die ich aus dem einzigen (und peinlichen) Gespräch zu diesem Thema mit meinen Eltern behalten hatte. Sie hatten es »Aufklärung« genannt. Das war meine einzige sexuelle Erziehung gewesen.
Es war wahrscheinlich während so einer Stöberstunde nach der Schule, als ich im Nachttisch meines Vaters die bunte Schachtel zum ersten Mal sah. Ich erinnere mich daran, wie meine Hände zitterten, als ich das Band von der Schachtel streifte, und welche Angst ich hatte, meinen ungeschickten Finger könnte es nicht gelingen, die Schleife wieder zuzubinden.
Ich entsinne mich auch, dass ich die Briefe gesehen hatte. Dutzende von Briefen, und auch wenn ich in den Sexratgebern geschmökert hatte – im Wissen, dass ich es nicht tun sollte –, hatte ich die Briefe nicht gelesen. Irgendwie war mir bewusst, dass diese Briefe etwas Besonderes waren. Sehr sorgfältig band ich die Schleife wieder zu und legte die Schachtel genau an ihren Platz zurück.
Ich glaube, dass ich kaum noch an die Schachtel dachte, bis zu dem Zeitpunkt, als mein Vater starb. Damals bat ich meine Mutter, die Schachtel für mich aufzubewahren. Ich erinnere mich, dass sie sagte, sie habe sie in den Keller getan, zu den High-School-Zeugnissen, den Sportabzeichen und zu dem Akkordeon, auf dem ich nicht mehr spielte. 1967 heiratete ich und zog nach Vancouver. Auch hier gab es bewegte Jahre mit Umzügen von einer Wohnung in die nächste, bis ich schließlich ein bleibendes Zuhause erwarb. Als meine Mutter bei einem ihrer Besuche die Schachtel mitbrachte, schien sie mir dadurch zu bestätigen, dass ich jetzt erwachsen war und dass ihr Haus in Hamilton nicht mehr mein richtiges Zuhause war. Ich erinnere mich, meinen Dank gemurmelt und die Schachtel ins oberste Fach des Schlafzimmerschranks gestellt zu haben. Da blieb sie, Jahr für Jahr, unbeachtet und vergessen.
Erst 1996, im Jahr meines sechzigsten Geburtstags, hatte ich das Bedürfnis, die Schachtel zu öffnen. Dieser Geburtstag sagte mir, dass es Zeit wäre, ein neues Kapitel meines Lebens zu beginnen. Jahrelang hatte ich eine Tür geöffnet und eine andere geschlossen. Mein Leben kam mir vor wie in Abschnitte aufgeteilt: vor dem Studium und danach, vor der Heirat und danach, bevor die Kinder da waren und nachdem sie das häusliche Nest verlassen hatten. Ich hatte das Bedürfnis, alle Türen gleichzeitig zu öffnen und mich im Geiste frei in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu bewegen. In diesem Sommer ging ich ganz allein in meine Hütte in den Bergen und nahm die Schachtel mit. Es war das erste Mal, dass ich kein einziges Buch dabei hatte.
Lange saß ich vor der bunten Schachtel und starrte sie an. Unsicher betasteten meine Finger das alte Band. Selbst als die Schleife gelöst war, zögerte ich noch. Nur das Ticken der Uhr unterbrach die atemlose Stille. Die Sommersonne schien durchs Fenster, doch meine Hände waren eiskalt. Endlich nahm ich den Deckel ab.
Vor mir lagen sorgsam gefaltete Blätter aus dünnem Luftpostpapier. Einige Briefe steckten in Umschlägen mit rot-weiß-blauem Rand, andere waren vorgedruckte Luftpostbriefe zum Zusammenfalten mit einem Adressfeld auf der Rückseite. Das Papier war so dünn, dass die Schrift durchschimmerte. Einige Blätter waren beidseitig beschrieben; jeder Zentimeter war mit winzig geschriebenen deutschen Wörtern bedeckt.
Ich griff nach dem obersten Brief und betastete das dünne Papier. Zeit verging. Endlich entfaltete ich es und suchte nach der Unterschrift. Emil. Sofort wusste ich, dass es ein Brief von Emil Fränkel war. Emil war der Mann von Martha, der jüngsten Schwester meines Vaters, und zugleich auch der beste Freund meines Vaters. Ich saß lange da und erinnerte mich an die regelmäßigen Sonntagmorgenspaziergänge mit meinem Vater nach unserer Übersiedlung in die Stadt. Ich war einsam, aber ich glaube, mein Vater war noch einsamer. Zusammen spazierten wir durch unser Viertel, nur wir beide. Manchmal sagte mein Vater, wie sehr er Emil vermisse und welches Glück er gehabt habe, einen Schwager zu haben, der auch sein bester Freund geworden war. Manchmal starrte mein Vater vor sich hin, und dann sagte er leise: »Wenn nur der Emil nach Kanada hätte kommen können ...«
Emil hatte darauf bestanden, dass wir nach Kanada auswanderten. Meinen Eltern wäre es nie in den Sinn gekommen. Warum sollte auch jemand eine liebevolle Familie, Freunde und ein bescheidenes, aber sicheres Auskommen aufgeben, um über den Atlantik zu reisen? Und warum gerade nach Kanada? Meine Eltern haben oft gesagt, dass sie sich vorgestellt hatten, den ganzen Sommer über mit Bären kämpfen zu müssen und im Winter in einem Iglu zu hocken.
Meine Eltern waren einfache Menschen. Wie seine vier Geschwister wurde mein Vater daheim in seinem Elternhaus im Dorf Strobnitz geboren. 1900, im Jahr seiner Geburt, war Strobnitz ein entlegenes Nest in einem ebenso entlegenen Winkel der Österreichisch-ungarischen Monarchie. Da es in solch einem Dorf nur eine Volksschule gab, besuchte mein Vater die Handelsakademie im nahe gelegenen Gmünd, wo er Buchführung lernte, um später seinen Eltern in ihrem kleinen Kolonialwarenladen zu helfen, der ihnen den Lebensunterhalt sicherte. Auf einem Silvesterball verliebte er sich dann in das schlanke Mädchen im blauen Abendkleid.
Dieses Kleid hat meine Mutter nach Kanada mitgenommen. Ich besitze es heute noch. Beide, mein Vater wie meine Mutter, sagten immer, es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Im Juni darauf heirateten sie und ein Jahr später, im August 1936, kam ich zur Welt.
Hitler ergriff im Januar 1933 die Macht, nachdem Reichspräsident Hindenburg der Berufung Hitlers als Reichskanzler zugestimmt hatte. So wie viele andere Menschen, die außerhalb von Deutschland lebten, machten sich meine Eltern deshalb keine großen Gedanken. Um Politik sollten sich andere kümmern. Zudem war Strobnitz für sie ein sicherer Ort in einem demokratischen Land. Bereits unter der böhmischen Krone war die Familie meines Vaters dort ansässig gewesen. Um sicherzustellen, dass der Erste Weltkrieg »der Krieg war, der alle Kriege beendete«, hatten die Alliierten, England und Frankreich, 1918 die Grenzen neu gezogen und Böhmen und andere strategisch wichtige Gebiete von Deutschland und Österreich abgetrennt und zu dem neuen Staat Tschechoslowakei zusammengefügt. Weil es ein von den Alliierten geschaffenes demokratisches Land war und weil seine Unabhängigkeit als vertraglich abgesichert galt, gab es keinen Grund zur Sorge.
Wie mein Vater erzählte, war es Emil Fränkel, der im Frühjahr 1938 für eine ernste Unterredung allein nach Strobnitz angereist kam. Ich nehme an, dass ihr Gespräch etwa folgendermaßen verlaufen sein muss:
»Kanada! Emil, bist du verrückt?«
»Aber Edi, wir haben schon früher darüber gesprochen.«
»Und ich habe Nein gesagt.«
»Nein, lieber Edi. Du hast gesagt, du willst es dir überlegen.«
»Ja, richtig. Ich habe es mir auch überlegt und meine Antwort ist Nein. Ich bin doch nur ein einfacher Mensch. Ich fühle mich wohl hier, und ich will nicht in einem fremden Land allein sein.«
»Aber Edi, hör mir zu. Du musst es tun. Für uns alle musst du es tun.«
»Für uns alle weigere ich mich zu gehen.«
»Edi, du verstehst einfach nicht, wie wichtig es ist.«
»Wichtig ist, dass ich für meine Familie sorge. Für meine Frau und das Kind zuerst und dann für meine Eltern.«
»Für die Familie zu sorgen, ist nicht mehr möglich, wenn Hitler über die Grenze kommt.«
»Aber Emil, er hat doch erst letzte Woche gesagt, dass er sich weiter für kein anderes Land interessiert.«
»Und du glaubst ihm? Heute sagt er so und morgen so. Das Sudetenland ist reich, es ist deutschsprachig, und die Leute hier sind nicht anders als die Österreicher. Im vorigen Monat haben 99% der Bürger meines Landes für Hitler und für den Anschluss gestimmt. Und so wie meine lieben Landsleute werden auch die Sudetendeutschen entscheiden, sich Deutschland anzuschließen.«
»Emil, ich weiß, dass die Zeitungen einen verrückt machen können. Schlechte Nachrichten bringen gute Schlagzeilen. Aber das ist doch noch kein Grund, alles zu glauben, was sie schreiben.«
»Edi, ich bin nicht verrückt. Du musst es mir glauben: Hitler kommt ins Sudetenland. Du musst weggehen.«
»Aber selbst, wenn du recht hast, ich kann nicht weg. Wer wird das Geschäft führen? Der Papa wird nicht jünger. Und wovon sollen wir leben? Du bist ein Geschäftsmann und hast Erfolg. Du hast mit nichts angefangen.«
»Ja, ich hab es gut getroffen, aber jetzt kann es sein, dass ich alles verliere. Die Juden sind gewarnt worden, sie sollen Österreich verlassen. Aber ich weiß nicht, wohin. Kein Land will Juden aufnehmen. Ich habe keine Verwandten im Ausland, die mir helfen könnten. Außerdem erwarten wir ein Baby. Martha ist schwanger, und der Arzt meint, sie soll nicht reisen. Wir müssen jetzt in Linz bleiben, bis das Kind da ist.«
»Du könntest wenigstens zu meinem Bruder Arnold nach Prag gehen. Der würde dir bestimmt helfen, bis alles vorbei ist.«
»Bis das vorbei ist? Edi, Hitler hat erst angefangen. Und so gern ich deinen Bruder habe, ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass Prag so ein sicherer Ort ist.«
»Prag nicht sicher? Die Hauptstadt der Tschechoslowakei? Die Alliierten haben für die Unabhängigkeit ihre Garantie gegeben.«
»Ich befürchte, dass Hitler zuerst das Sudetenland nimmt und dann den Rest der Tschechoslowakei.«
»Aber was soll ich denn tun? Ich habe jeden Groschen in das Geschäft gesteckt. Sie können mir doch nicht einfach das Geschäft wegnehmen.«
»Sie können und sie werden es tun. Denk an die Eltern von Gretl. Nur mit ihrer Kleidung auf dem Leib sind sie von Deutschland gekommen. Glaubst du, dass Hitler ihnen für ihr Haus und für ihr Geschäft in Deutschland Geld geben wird?«
»Aber ich habe weiter nichts gespart. Wovon sollen wir denn leben?«
»Eben deswegen musst du weggehen. Lass hier alles liegen und stehen und geh nach Kanada.«
»Aber Gretl? Kannst du dir Gretl in Kanada vorstellen? Dort ist doch Wildnis. Und was ist mit der kleinen Helen? Sie ist noch so klein. Ich kann sie nicht verlassen.«
»Natürlich nicht. Ihr müsst alle drei zusammen weggehen. So schnell wie möglich.«
»Unmöglich! Gretl wird nie ihre Eltern im Stich lassen. Sie sind schon aufgeregt genug, weil ihre andere Tochter nach Kanada geht. Aber Anny war schon immer die Widerspenstige. Sie hatte immer ihren eigenen Kopf.«
»Gretl muss gehen. Ich gebe dir mein Wort, ich werde mich um ihre Eltern kümmern, damit sie mit dem nächsten verfügbaren Schiff nach Kanada nachkommen. Du musst Gretl davon überzeugen. Sie muss vernünftig sein.«
»Vernünftig sein? Ich weiß nicht, was hier vernünftig ist. Gerade weil ihre Schwester Anny so verrückt ist, auszuwandern …«
»Nicht verrückt. Gescheit! Anny und Ludwig sind beide gescheit genug, um wegzugehen.«
»Gescheit sein ist leichter, wenn man entsprechende Fähigkeiten hat. Die Kanadier lassen Ludwig herein, weil er vom Land kommt und etwas von der Landwirtschaft versteht. Kanada braucht Farmer.«
»Dann geh als Farmer nach Kanada. Du bist jung, und Ludwig wird dir schon zeigen, wie man alles macht.«
»Emil, warum gehst du nicht nach Kanada, wenn du glaubst, dass es so leicht ist?«
»Edi, du weißt, dass ich schon morgen gehen würde, wenn ich nur könnte. Du bist der Einzige in der ganzen Familie, der die Möglichkeit hat auszureisen. Weil Gretl Annys einzige Schwester ist, kann sie für euch drei bürgen. Ihr seid Verwandte ersten Grades. Es gibt keinen anderen Weg nach Kanada. Sie nehmen keine Juden. Wenn ihr dort seid, musst du einen Weg finden, für uns zu garantieren. Siehst du das nicht ein? Edi, du bist unsere einzige Hoffnung. Die Zukunft der ganzen Waldstein-Familie liegt auf deinen Schultern.«
2. Kapitel
Die Heimat verlassen
Wie schwer muss diese Verantwortung auf den Schultern meines Vaters gelastet haben! Ich musste so oft an ihn denken, als ich die Briefe weiter durchlas. Ich konnte immer nur kleine Abschnitte lesen. Manchmal brauchte es nur einen einzigen Satz und schon flossen meine Tränen. Manchmal konnte ich einen ganzen Absatz lesen, ohne den inneren Drang zu verspüren, im Zimmer auf und ab zu gehen. Meine Gedanken waren in Aufruhr, und so oft ich auch auf den schönen Waldwegen in der Nähe meiner Hütte Spaziergänge machte, ich kam nicht zur Ruhe.
Fragen über Fragen verfolgten mich. Erinnerungen aus meiner Kindheit kamen an die Oberfläche. Sie vermischten sich mit Geschichten, die ich fünfzig Jahre früher gehört hatte.
Warum hatten sich meine Großeltern nicht sofort eingeschifft, wie sie es meiner Mutter versprochen hatten? Warum sind sie uns nicht gleich nach Kanada gefolgt? Was ist mit Emil passiert und was mit all den anderen Geschwistern und deren Familien? Es klafften in meiner Familiengeschichte riesige Lücken, die ich nicht schließen konnte. Das Lesen der Briefe hatte mir meine Seelenruhe genommen, und ich fühlte mich in Teile zerlegt wie ein aufgelöstes Puzzle.
Abends spazierte ich oft die Landstraße entlang und suchte vergeblich nach innerer Ruhe, die ein paar Stunden Schlaf versprochen hätte. Sehnsüchtig starrte ich in den Himmel, an dem ich gerne mehr Sternbilder als nur den Großen Wagen gekannt hätte. Sterne haben mich immer fasziniert. Die Vorstellung eines Lichtjahres überfordert mich. Trotz seiner unbegreiflichen Geschwindigkeit hat das Licht unzählige Jahre gebraucht, bis es mein Auge erreicht. Es ist sogar möglich, dass jener Stern am Himmel selbst schon lange tot ist, und doch sehe ich ihn in der Finsternis leuchten.
So schien es mir mit denjenigen, die die Briefe geschrieben hatten. Ihre Worte waren für mich so lebendig wie das Licht vom fernsten Stern. Lebten diese Menschen noch? War noch ein Einziger am Leben? Wie war es möglich, dass ich früher nicht gesehen habe, was ich heute sah? Jeder einzelne Mensch existierte jetzt durch seine Briefe, existierte so gewiss wie die Sterne am nachtschwarzen Himmel.
Zahlen haben für mich keine Bedeutung. Das ist ein Grund, warum ich ein Astronomiestudium nie ernsthaft in Erwägung gezogen habe. Ich bin hoffnungslos humanistisch veranlagt, und der Daseinskampf eines einzelnen Menschen macht auf mich einen größeren Eindruck als die exaktesten statistischen Angaben. Die Seelenqual von Eltern, die ihr Kind verloren haben, trifft mich tief. Ich erstarre innerlich, wenn man Kinder und Eltern zu Tausenden, Zehntausenden oder Hunderttausenden zusammenzählt. Oder gar zu Millionen. Besonders schwierig war für mich die Zahl sechs Millionen. Das ist die Anzahl der Juden, die nach einem systematischen, staatlich sanktionierten Plan in Europa vernichtet wurden. Darunter sollten auch meine Familie und ich sein. Es gibt keinen Grund, warum ich nicht zu den Millionen Ermordeten gehöre. Dass ich heute noch am Leben bin, ist ein Zufall, genauso wie es ein Zufall ist, dass sechs Millionen andere Juden dem Tod nicht entronnen sind.
Als Kind habe ich gelernt, Fragen zu vermeiden, die meine Eltern womöglich beunruhigt hätten. Obgleich ich als Erwachsene viele soziale und politische Normen hinterfragt habe, habe ich keine Fragen über den Krieg gestellt. Erst als ich die Briefe gelesen hatte, wurde mir das Ausmaß meiner Unwissenheit bewusst.
Die ersten Zeilen von Martha, der jüngeren Schwester meines Vaters, rüttelten mich auf. Der Brief, in dem sie stehen, stammte vom 2. April 1939. Die Handschrift war gut zu lesen und die deutschen Worte waren leicht zu verstehen:
Heute Sonntag fällt es uns besonders schwer, Euch zu vermissen, wir sind immer und immer in Gedanken bei Euch. Als Ihr uns Samstag verlassen habt, war eine solche Traurigkeit in uns, dass wir uns ernstlich zusammennehmen mussten, um vor allem die l. [lieben] Eltern zu trösten.
Ich hatte nie über das genaue Datum unserer Abreise aus Europa nachgedacht. Meine Eltern haben nur mit Unbestimmtheit davon gesprochen. Ich erinnere mich lediglich, dass sie sagten: »Es war vor Hitler.« Marthas Zeilen gaben mir zum ersten Mal ein Datum. Schnell habe ich zurückgezählt, zuerst mit meinen Fingern und dann auf dem Papier. Wenn der März 31 Tage hat und der 2. April ein Sonntag war, so war der Samstag davor der 25. März. Das muss der Tag gewesen sein, an dem wir den Zug von Prag nach Antwerpen genommen haben.
Warum hat mir dieses Datum keine Ruhe gelassen? Etwas hatte mich beunruhigt, und ich brauchte Zeit, um diese neue Information zu verarbeiten. Ich eilte in die Bibliothek. In der historischen Abteilung gab es ein ganzes Regal mit Büchern über den Krieg. Ich suchte nach Daten. Am 15. März 1939 marschierten Hitler und seine Armee in Prag ein. Das waren ganze zehn Tage, bevor wir abreisten.
Aber warum waren meine Eltern überhaupt in Prag, in der Hauptstadt der Tschechoslowakei? Prag war viele Kilometer von unserem Zuhause in Strobnitz entfernt. Unser Heimatort lag fast an der österreichischen Grenze. Meine Mutter hatte oft bedauert, Prag nie gesehen zu haben. Immer wenn Freunde von Prag sprachen, seufzte sie: »Alle sagen, es sei eine wunderschöne Stadt. Schade, dass ich Prag nie gesehen habe.«
Mir schwirrte der Kopf. Ich hatte noch nie die einzelnen Bausteine zusammengefügt. Für mich hatte der Krieg immer im September 1939 begonnen. Ich hatte nie an Ereignisse vor dem September gedacht. Verschwommen erinnerte ich mich an den Namen Neville Chamberlain, Premierminister von England, der versucht hatte, »Frieden in unserer Zeit« auf Kosten der Tschechoslowakei zu erkaufen. Nun suchte ich nach genaueren Angaben.
Die Tschechoslowakei war nach dem Ersten Weltkrieg zusammengestückelt worden, indem man mit künstlichen Grenzen grundverschiedene ethnische Gruppen miteinander verband, zu denen Tschechen, Slowaken, Ruthenen, Polen, Ungarn und Deutsche gehörten. Die Deutschen lebten zumeist in der Nähe der Grenze zu Deutschland und Österreich, in einem Gebiet, das Sudetenland hieß. Sobald Hitler 1933 an die Macht kam, strebte er danach, das Sudetenland dem Deutschen Reich einzuverleiben.
Wie haben die Juden gewusst, was Hitler vorhatte und dass es Zeit war, das Sudetenland zu verlassen? Vor der Bibliothek, von einer öffentlichen Telefonzelle aus, rief ich Mimi, die Freundin meiner Mutter, an. 1938 war sie 26 Jahre alt gewesen. Sie erzählte mir von den Koffern, die fertig gepackt für die Abreise im Flur standen, während sie mit ihrer Familie am Radio saß. In den frühen Morgenstunden des 30. September teilten die europäischen Großmächte der Welt das Ergebnis ihrer Verhandlungen mit. Ohne die Tschechoslowakei an den Beratungen zu beteiligen, unterzeichneten England, Frankreich, Deutschland und Italien in München das Abkommen, das Deutschland erlaubte, das Sudetenland zu besetzen.
Kaum war Neville Chamberlain in London aus seinem Flugzeug gestiegen, stolz darauf, die Gefahr eines Krieges durch diplomatische Verhandlungen mit Herrn Hitler abgewendet zu haben, setzte sich die deutsche Wehrmacht in Bewegung. Chamberlains Name blieb für alle Zeiten mit dem Begriff Appeasement verbunden. Im Sudetenland wusste man, was in Deutschland mit den Juden geschehen war, dass man ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und sie öffentlich diffamiert hatte. So flohen bereits in den frühen Morgenstunden Juden aus dem Sudetenland mit dem Zug nach Prag. Am selben Nachmittag überschritt die deutsche Wehrmacht die Grenze.
Es muss an diesem Morgen, dem 1. Oktober 1938, gewesen sein, dass meine Eltern in Prag Zuflucht fanden. Sechs Monate später, am 15. März 1939, waren sie immer noch dort, als Hitler vom Balkon des Hradschin den Gruß »Sieg Heil« entgegennahm und der Welt verkündete, dass die Tschechoslowakei als souveräner Staat nicht mehr existierte.
Warum waren meine Eltern so lange in Prag geblieben? Hatten sie sich versteckt gehalten, weil ihnen der stark bewachte Bahnhof zu unsicher war? War es zu gefährlich, auf der Straße mit einem Koffer in der Hand gesehen zu werden? Sind sie geblieben, weil sie kein Ausreisevisum hatten und nicht wussten, wohin sie fliehen sollten? Bekam mein Vater tatsächlich erst am 15. März 1939 den Stempel für die Ausreise?
Diese Geschichte hat mir mein Vater nur ein einziges Mal erzählt, auf einem unserer Sonntagsspaziergänge, aber sie hinterließ einen tiefen Eindruck:
»Ich ging an diesem Tag sehr früh auf die Bank. Noch bevor sie öffneten. Eine innere Stimme drängte mich, als Allererster anzustehen. In dem Augenblick, als sie aufmachten, lief ich sofort zum nächsten Schalter und schob meine Papiere unter der Schalteröffnung durch. Der Kassierer seufzte, als er meine Papiere in seine linke Hand nahm. Mit der Rechten griff er nach dem Stempel. Als er den Stempel auf dem Farbkissen hin und her bewegte, sagte ein anderer Bankbeamter etwas zu ihm. Automatisch drückte der Kassierer den feuchten Stempel auf meine Papiere und drehte den Kopf zu dem Bankbeamten.
Kassierer: ›Was hast du gesagt?‹
Bankbeamter: ›Ich habe gesagt, keine Stempel mehr. Keine Ausreisestempel. Wir machen zu. Befehl von oben.‹
Schnell zog der Kassierer das Gitter herunter, aber noch schneller hielt ich meine Papiere in der Hand!«
Jetzt hatte ich verstanden, warum mich das Datum im Brief von Martha so aus der Fassung gebracht hatte. In weniger als einem Jahr sind meine Eltern mit mir nicht nur zweimal geflohen, sondern mein Vater hatte außerdem den allerletzten Vorkriegsausreisestempel erhalten.
Was empfand man in den Jahren 1938 und 1939, wenn man Jude war? Über diese Tage, Wochen und Monate sprachen meine Eltern nie. Heute glaube ich, dass meine Mutter diese Zeit völlig aus ihrem Gedächtnis gelöscht hatte.
Ich habe weitere Hinweise dafür gefunden, dass wir tatsächlich monatelang in Prag lebten. Der stärkste Anhaltspunkt war eine Postkarte, die an uns in Prag adressiert war. Der Inhalt bezieht sich darauf, dass wir im September 1938 aus dem Sudetenland geflüchtet sind. Wie der Poststempel zeigt, saßen wir sechs Monate später immer noch in Prag fest und warteten darauf, uns aus der Schlinge befreien zu können.
Als ich von meiner einsamen Hütte zurückgekehrt war, fragte ich meine Mutter nach Prag. Wieder stritt sie ab, jemals in Prag gewesen zu sein. Ich versuchte, weiter in sie zu dringen, aber sie konnte sich an nichts erinnern. Ihr einziges Zugeständnis war – und das schützte sie vor dem, was sie in diesen Monaten der Ungewissheit erlebt hatte: »Es ist möglich, dass wir in Prag waren, aber nur ein paar Stunden. Nur am Bahnhof, auf dem Weg nach Antwerpen.«
Wieder überprüfte ich die Daten. Wenn wir erst am 25. März 1939 Prag verließen, dann waren wir noch dort, als Hitler in die Stadt einmarschierte. Welche Erfahrungen bewogen meine Mutter dazu, den Vorhang über diesem Teil ihres Lebens zuzuziehen?
Ich kann mir ihre furchtbare Angst nicht vorstellen. Saß sie vor Angst zitternd zusammen mit meinem Vater am Radio und hörte Hitlers heiserer Stimme zu? Haben sie über jedes einzelne Wort, das er sagte, nachgedacht oder konnten sie vor Angst nicht mehr denken? Wer war dabei? Waren wir allein, meine Eltern und ich? War es zu gefährlich, sich auf die Straße zu wagen? War selbst die kurze Entfernung zwischen zwei Häusern zu weit? War der Jubel bei Hitlers Ankunft in Prag und die wild gewordene Masse eine Warnung, dass sie zu Hause hinter zugezogener Gardine bleiben sollten?
Sicherlich fühlte sich jeder Jude in Prag in die Enge getrieben. Die sogenannte Kristallnacht, die Nacht der zerbrochenen Fensterscheiben, hatte bereits als staatlich organisierter Angriff gegen Juden überall in Deutschland, Österreich und im Sudetenland stattgefunden: Am 9. und 10. November 1938 wurden Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte und Häuser geplündert und Juden auf der Straße geschlagen, während die Passanten Hurra riefen und vor ihnen ausspuckten.
Fehlten meinen Eltern noch die nötigen Papiere? War das der Grund, warum wir immer noch in Prag waren? Ohne Papiere mussten sie um ihr Leben fürchten.
Ängstliche Gedanken müssen meinen Vater aufgewühlt und ihm die Kraft genommen haben. Meine Mutter hat oft erzählt, dass er auf der Bahnfahrt nach Antwerpen an der Ruhr erkrankt war und oft länger auf der Toilette blieb. Wie viel davon war Krankheit und wie viel war pure Angst?
»Niemand ist zu dieser Zeit mit der Bahn gefahren«, versicherte mir Mimi, als ich sie zum zehnten Mal anrief. »Die Flugzeuge waren klapperig, aber die Leute sind trotzdem geflogen. Den Zug zu nehmen war zu gefährlich. Da hätte man durch ganz Nazi-Deutschland fahren müssen.«
Die Briefe bestätigen, was meine Mutter erzählt hat. Wir fuhren tatsächlich mit der Bahn von Prag nach Antwerpen. Der einzige Weg, den es gab, führte quer durch Nazi-Deutschland.
Ich versuche, mir meine Eltern im Zug vorzustellen: wie sie den Blick senkten, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Irgendwie war es ihnen gelungen, meine kindliche Neugierde zu dämpfen und mich zum Schweigen zu bringen. Obwohl ich keine konkreten Erinnerungen an die Bahnfahrt habe, lebt ein Gefühl der Angst noch heute in mir.
In dem Hollywood-Film Julia spielt Jane Fonda eine Amerikanerin, die kurz vor Kriegsbeginn mit dem Zug durch Deutschland fährt. Dieses Video habe ich sehr oft ausgeliehen. Immer wieder sehe ich mit Herzklopfen, wie die Nazis in den Zug steigen. Ich warte auf die Szene, in der der Kontrolleur nach ihrem Pass fragt und einen kurzen Moment zögert. Wie hypnotisiert sehe ich meinen Vater in der gleichen Situation vor mir, wie er den Atem anhält, während seine Papiere geprüft werden.
Zwischen den Briefen in der Schachtel liegt eine ganz schlichte Postkarte, die an uns in Antwerpen adressiert ist. Auf der Karte ist kein Bild. Adresse und Mitteilung sind mit der Schreibmaschine getippt. Das einzig Persönliche ist die Unterschrift: Emil. Bewog schon die Unterschrift seines Schwagers meinen Vater dazu, diese unauffällige Karte aufzubewahren und mit nach Kanada zu nehmen?
Die Adresse sieht ganz nach vorübergehender Zufluchtsstätte aus. Das Wort Monsieur ist falsch abgekürzt als Mons. Dann folgt der eindeutig deutsche Name meines Vaters: Edmund Waldstein. Die Adresse: Hotel Maison Max und die Straße Rue de la Station 40-42-44 weisen darauf hin, dass meine Eltern ein Hotel gewählt hatten, in dessen Nähe eine Bahntrasse verlief – die Lebensader aller Menschen auf der Flucht. Und dann fällt die französische Fassade ganz ab und die Angabe von Stadt und Land ist in deutscher Sprache: Antwerpen, Belgien.
Emil bestätigt auf der Postkarte den Empfang eines Telegramms und dreier Briefe, was darauf hinweist, dass wir längere Zeit in Antwerpen geblieben sind. Was hat meine Eltern davon abgehalten, das nächste Schiff nach Kanada zu nehmen?
Genauestens prüfe ich jedes Wort von Emil:
Ich war heute bei der Canadian Pacific Gesellschaft und Steiner sagte mir, dass man keinen Vorzeigebetrag brauche, aber die Schiffskarte von drüben und ich soll in einigen Tagen nachfragen kommen, was für Bestimmungen herauskommen. Heute sagte Steiner nichts von einem Permit und ich muss Euch alles selbst überlassen, sich in Canada sofort zu erkundigen, ob ich auf Grund der früheren Anforderung ohne Kapital einreisen kann oder Permit und Schiffskarte von drüben brauche.
Das muss wohl der Grund gewesen sein, warum wir so lange in Antwerpen geblieben sind. Wir warteten darauf, dass Anny und Ludwig uns nicht nur die Einreisebewilligung für Kanada, sondern auch die Schiffskarten schickten. Außerdem verlangte die kanadische Regierung, dass für jeden Immigranten 1000 kanadische Dollar als Sicherheit hinterlegt wurden. Mimi erzählte mir, dass man aus Europa kein Geld ausführen durfte, und dass wir in Kanada mit dem Gegenwert von einem Dollar in der Tasche ankamen.
3. Kapitel
Briefe nach Antwerpen
Der Anfang ist wohl bitter. Manches wird Euch schwer fallen und schmerzlich berühren, aber der gute Wille und das harte Muss wird alle Schwierigkeiten überbrücken.
Diese Worte von Arnold, dem älteren Bruder meines Vaters, blieben mir im Gedächtnis. Ihre Symbolik erstaunt mich – wie so vieles im ersten Brief vom 2. April 1939. Mein Vater hatte dafür einen Ausdruck: vernünftig.
Diese Wortwahl passte gut zu meiner Vorstellung von einem großen Bruder, wie ich ihn mir wünschte, einem Bruder, der mir den Weg ebnen würde, und ebenso passte sie zu meinem Bild von Menschen, die sich zum Ingenieurberuf hingezogen fühlen. Jetzt entdecke ich diesen Arnold, dessen unerschütterlicher Optimismus das Ergebnis einer tiefen Familienbindung ist, und nehme ihn aus der Nähe wahr.
Heute sind es 8 Tage seit wir uns von einander verabschiedeten und noch immer habe ich dieses schreckliche traurige Gefühl in mir, das mich diesmal zum ersten Male so tief ergriffen hat. Ihr könnt Euch denken, wie glücklich wir waren, als wir von Eurer guten Ankunft in Antwerpen erfuhren und wie uns allen viel leichter wurde. Wir begleiten Euch in all den Tagen mit unseren Gedanken auf Eurer großen Reise und sprechen stets von Euch. Und ich schreibe Euch auch gleich am ersten freien Tag, damit Ihr gleich nach der Ankunft meine Zeilen erhaltet und Euch ein Gruß von der Heimat etwas Trost bringen soll, in Eurer neuen und so ungewohnten Umgebung.
Hoffentlich gelingt es Euch bald, Euch einzuleben, dem neuen Milieu anzupassen und das neue Ungewohnte nicht zu sehr zu empfinden. Eure l. Angehörigen werden es gewiss an nichts fehlen lassen, um Euch den Übergang erträglich zu gestalten, die Gegensätze mildern, und Euch manche von den Unannehmlichkeiten ersparen, die sie selbst mitzumachen gezwungen waren.
Für uns ist es ein sehr beruhigendes Bewusstsein und unsere stärkste seelische Stütze, Euch und den l. Otto in gesicherter Existenz zu wissen, denn wir bauen ja auch unsere Zukunft auf Euch.
Ich bitte Dich in diesem Sinne sofort an die l. Bella zu schreiben und die Sache so weit es nur geht, zu beschleunigen. Es wäre mir doch eine gewisse Beruhigung, wenn ich und die l. Vera schon diese Aussicht oder Sicherheit hätten.
Gestern nachm. waren wir bei Elsa. Wir waren die einzigen Gäste und so war es recht ruhig im Gegensatz zu voriger Woche. Wir sprachen viel von Euch und Emil berichtete von Euren Briefen. Für Deine Bemühung mit der Tovona habe vielen Dank l. Edi. Leider kam schon inzwischen ablehnende Antwort, da die dortigen Vorschriften es nicht zulassen.
Eine andere Handschrift – die von Arnolds Frau Vera – folgt. Als Ärztin hat Vera einen fotografisch präzisen Blick und hält so den Moment unserer Abreise fest:
Ich sehe Euch noch so vor mir, wie Ihr aus dem Coupéfenster saht, vor Euch das blonde Lockenköpferl der kleinen Helli, die so lustig und herzig war und lachte, als ob es keinen Abschied auf der Welt gäbe. Hoffentlich hat das Kind mit seinem unbewussten Optimismus recht.
Dort, wo Arnold und Vera zu schreiben aufhören, füllt die geschliffene Sprache von Else, der Schwester meines Vaters, die Seiten.
Meine Lieben, nun sind es schon acht Tage seit wir Euch Lebewohl sagten und Ihr habt Euch inzwischen ein großes Stück von uns entfernt. Wir denken jede Stunde an Euch und verfolgen im Geiste jedes Stück Eurer Reise. Es ist gerade Sonntag nachmittag, der erste ohne Euch. Ich glaube jeden Moment, dass die Türe aufgeht und Ihr hereinkommt und höre Helli sagen, Tante Else, ich will ein Fettenbrot.
Aunty Elsa, Tante Else. Ich versuchte es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, ließ die Worte auf mich wirken, aber sie riefen keine bekannten Gefühle hervor. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass ich einmal regelmäßig durch die Tür gestürmt bin und den Namen meiner geliebten Tante gerufen habe.
Weniger erstaunt mich, dass mein unersättlicher Appetit noch weiter zurück in die Vergangenheit zu gehen scheint, als ich gedacht habe. Meine Mutter hat mir oft von unserer Überfahrt erzählt. Während sie und mein Vater unter Deck in den überfüllten Kabinen kaum Luft bekamen, lief ich auf dem Schiff herum und erzählte völlig fremden Leuten, dass ich hungrig sei. Noch heute bereitet es mir Schwierigkeiten, nicht gleich, wenn ich nach Hause komme, in die Küche zu marschieren. Auch wenn mein Appetit sich nicht verändert hat, sind die Lebensmittel wenigstens andere. Ausgelassenes Gänsefett gehört heute nicht mehr zu meinen Leibspeisen. In der Welt meiner Mutter waren die bevorzugten Leckerbissen Gänsefett, Entenfett und Hühnerfett – und zwar genau in dieser Reihenfolge. Meine Mutter liebte es, mit der Hand die dicke, cremige Schicht Fett unter der Geflügelhaut herauszuziehen. Dann ließ sie es langsam in der Bratpfanne aus und gab noch etwas Zwiebel dazu, um den Geschmack zu verfeinern. Erst wenn es ausgekühlt und wieder hart war, durfte ich es auf eine dicke Scheibe Roggenbrot streichen.
Es ist mir noch immer nicht ganz ins Bewusstsein gedrungen, dass Ihr schon wirklich fort seid, und doch müssen wir alle von Glück reden, dass es so rasch und günstig gegangen ist, denn jetzt würde es bestimmt viel schwieriger oder vielleicht sogar unmöglich sein, da keine Ausreisebewilligungen zu haben sind. Unsere Marianne hat jetzt auf einmal große Lust bekommen, nach England zu gehen. Doch wird es sehr schwer möglich sein, dass sie hinkommt, da der Andrang sehr groß ist. Der l. Emil hat sich diese Woche mit ihr einige Stunden lang anstellen müssen, dass sie nur eine Nummer bekommt und in zwei Wochen soll sie erst eine nähere Information bekommen. Ich kann mich mit dem Gedanken noch nicht vertraut machen, dass sie schon in die Fremde gehen soll, aber je früher es der Fall wäre, desto besser für sie. Es ist ja leider jetzt das Los so vieler Eltern. Ich hoffe halt immer, dass wir doch noch einige Jahre werden alle beisammen bleiben können. Das Schicksal scheint es anders zu bestimmen.
Auch wenn sie es verstecken wollte, die Aussicht, Marianne nach England schicken zu müssen, lastete schwer auf Else. Ich erinnere mich daran, wie es mit meinen eigenen Töchtern war, die mit etwa zehn Jahren zwar schon sehr selbstständig waren, aber dennoch vielerlei Unterstützung brauchten, um erwachsen zu werden. Wie sehr hätte es mir widerstrebt, sie in dieser entscheidenden Phase ihres Lebens jemand anderem anzuvertrauen.
Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich den Mut einer Löwin besäße, wenn ich meine Kinder verteidigen müsste. Zugleich habe ich mich gefragt, wie schlimm die Situation sein muss, damit ich meine Kinder ins Ausland schicke, um sie von Fremden aufziehen zu lassen. Ich war nicht imstande, mir das vorzustellen. Andere Schrecknisse kann ich mir leicht vorstellen, und die sind auch nicht weit weg von mir. Die Angst vor Verfolgung ist immer gegenwärtig.
Bei der Geburt jedes Kindes kaufte ich goldene Münzen in der Absicht, sie in den Saum ihrer Bekleidung einzunähen, sollten wir jemals fliehen müssen. Für den Fall, dass meine Kinder von mir getrennt werden, wollte ich, dass diejenigen, die sie finden würden, auf jeden Fall ausreichend Mittel hätten, um sie durchzubringen. Noch heute entzündet jede Weltkrise die Flammen meiner Paranoia. Alte Ängste mögen begraben sein, aber sie verschwinden nicht. Das Gold habe ich noch.
Als nächstes Familienmitglied trägt Dr. Emil Urbach, der Ehemann von Else, zum Brief vom 2. April bei. Er richtet seine Worte nur an meinen Vater, sie sind eine Mischung aus sinnvollen Empfehlungen und ungeschminkten Fakten:
Lieber Edi, ich habe mich sehr gefreut, dass es Euch unterwegs verhältnismäßig gut ergangen ist und hoffe, dass Ihr auch gutes Seewetter haben werdet. Es wäre notwendig, dass Du an Deinem jetzigen Wirkungsorte eine sehr ausgiebige Kost einnimmst, damit Du Kräfte für das Farmen sammelst.
Emil gibt keinen Hinweis, dass er nach Kanada kommen möchte, aber er trifft Vorsorge, seine Tochter nach England zu schicken, um sie dort in Sicherheit zu bringen.
Bei uns hat sich vorderhand nichts geändert. Wir beabsichtigen die l. Marianne nach England zu einer Familie zu schicken, haben sie jetzt deswegen registrieren lassen. Ob und unter welchen Bedingungen es geschehen solle, erfahren wir Freitag, den 14. d. M.
Es waren die Worte Emils, die mich an Kindertransport denken ließen, ein Wort, an das ich mich noch dunkel erinnern konnte. Jetzt begann ich mich eingehender mit dieser Rettungsaktion zu beschäftigen.





























