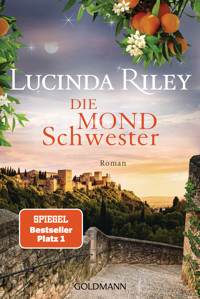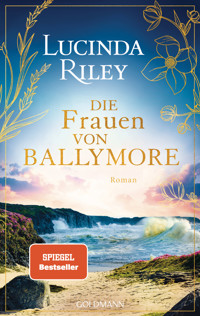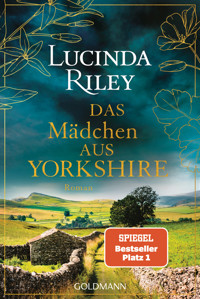11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Posy Montague steht kurz vor ihrem siebzigsten Geburtstag. Sie lebt alleine in ihrem geliebten »Admiral House«, einem herrschaftlichen Anwesen im ländlichen Suffolk. Eines Tages taucht völlig unerwartet ein Gesicht aus der Vergangenheit auf: ihre erste große Liebe Freddie, der sie fünfzig Jahre zuvor ohne ein Wort verlassen hatte. Nie konnte Posy den Verlust überwinden, aber darf sie nun das Wagnis eingehen, ihm noch einmal zu vertrauen? Freddie und das »Admiral House« bewahren indes ein lange gehütetes, düsteres Geheimnis – und Freddie weiß, er muss Posys Herz noch einmal brechen, wenn er es für immer gewinnen will …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Posy Montague steht kurz vor ihrem siebzigsten Geburtstag. Sie lebt alleine in ihrem geliebten »Admiral House«, einem herrschaftlichen Anwesen im ländlichen Suffolk. Eines Tages taucht völlig unerwartet ein Gesicht aus der Vergangenheit auf: ihre erste große Liebe Freddie, der sie fünfzig Jahre zuvor ohne ein Wort verlassen hatte. Nie konnte Posy den Verlust überwinden, aber darf sie nun das Wagnis eingehen, ihm noch einmal zu vertrauen? Freddie und das »Admiral House« bewahren indes ein lange gehütetes, düsteres Geheimnis – und Freddie weiß, er muss Posys Herz noch einmal brechen, wenn er es für immer gewinnen will …
Weitere Informationen zu Lucinda Riley sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buchs.
Lucinda Riley
Das Schmetterlingszimmer
Roman
Aus dem Englischenvon Ursula Wulfekamp
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Butterfly Room« bei Macmillan, London.
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Lucinda Riley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: andrew parker / Alamy Stock Photo
FinePic®, München
GettyImages / Barrett & MacKay
GettyImages / Martin Ruegner
GettyImages / Westend61
David Baker / Trevillion Images
Susan O’Connor / Trevillion Images
Redaktion: Claudia Alt
CN · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-20204-0V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Schwiegermutter Valerie, in Liebe
Posy
Admiral (Vanessa atalanta)
Admiral House, Southwold, Suffolk
Juni 1943
»Vergiss nicht, mein Schatz, du bist eine Fee, die mit zartesten Flügeln über das Gras schwebt, um deine Beute mit deinem seidenen Netz einzufangen. Schau!«, flüsterte er mir ins Ohr. »Da ist er, genau am Rand des Blatts. Jetzt flieg!«
Ein paar Sekunden schloss ich die Augen, wie er es mir beigebracht hatte, und stellte mir, auf Zehenspitzen stehend, vor, meine kleinen Füße würden vom Boden abheben. Dann versetzte Daddy mir mit der flachen Hand einen Schubs, ich öffnete die Augen, konzentrierte mich auf die beiden hyazinthblauen Flügel und flog die zwei kurzen Schritte nach vorne, um mein Netz über die zarte Rispe des Schmetterlingsflieders zu stülpen, auf der sich der Ameisenbläuling niedergelassen hatte.
Der Luftzug, den das Netz verursachte, schreckte den Bläuling auf, er öffnete die Flügel, um zu flüchten. Doch zu spät, denn ich, Posy, Prinzessin der Feen, hatte ihn gefangen. Natürlich würde ihm kein Leid geschehen, er würde von Lawrence, dem Feenkönig – der auch mein Vater war –, nur studiert werden, ehe er wieder in die Freiheit entlassen würde, und natürlich nicht, ohne zuvor ein Schälchen des besten Nektars vorgesetzt zu bekommen.
»Du bist wirklich ein kluges Mädchen, Posy!«, sagte mein Vater, als ich mich durch das Gestrüpp zurückzwängte und ihm stolz das Netz präsentierte. Er saß in der Hocke, sodass sich unsere Augen – die sich nach Aussage aller unglaublich ähnlich waren – in einem Blick geteilter Freude begegneten.
Er senkte den Kopf, um den Schmetterling zu untersuchen. Der Falter verharrte reglos, seine winzigen Beine umklammerten das weiße Netz seines Gefängnisses. Daddys Haar hatte die Farbe von Mahagoni, und durch das Öl, mit dem er es glättete, glänzte es wie der lange Esstisch, wenn Daisy ihn poliert hatte. Außerdem roch sein Haar wunderbar – nach ihm und nach Geborgenheit, weil er »Zuhause« bedeutete und ich ihn mehr liebte als alles andere in meinen Welten, ob der der Menschen oder der Feen. Natürlich liebte ich Maman auch, aber obwohl sie fast ständig zu Hause war, hatte ich das Gefühl, sie weniger zu kennen als Daddy. Sie verbrachte einen Großteil der Zeit mit etwas, das Migräne hieß, in ihrem Zimmer, und wenn sie nicht dort war, hatte sie zu viel zu tun, um etwas mit mir zu unternehmen.
»Er ist ein wahrer Prachtbursche, mein Liebling!«, sagte Daddy und sah zu mir. »Bei uns eine wahre Seltenheit und zweifellos adeliger Abstammung.«
»Könnte er ein Schmetterlingsprinz sein?«, fragte ich.
»Gut möglich«, antwortete Daddy. »Wir sollten ihn mit größtmöglichem Respekt behandeln, wie es seiner Herkunft gebührt.«
»Lawrence, Posy … Lunch!«, rief eine Stimme von jenseits der Pflanzen. Daddy richtete sich auf, sodass er größer wurde als der Schmetterlingsflieder und über den Rasen zur Terrasse von Admiral House winken konnte.
»Wir kommen, mein Schatz!«, rief er ziemlich laut, weil wir doch in ziemlicher Entfernung vom Haus waren. Beim Anblick seiner Frau, meiner Mutter und der Königin der Feen, bildeten sich Fältchen um seine Augen, er lächelte; dass sie diese Königin war, wusste sie allerdings nicht, das war ein Geheimnis zwischen Daddy und mir.
Hand in Hand gingen wir über den Rasen zum Haus zurück. Es duftete nach frisch gemähtem Gras, was ich mit glücklichen Tagen im Garten verband: Mamans und Daddys Freunde, die, ein Champagnerglas in der einen, den Krockethammer in der anderen Hand, einen Schlag ausführten, und dann sauste ein Ball über die Cricket-Pitch, die Daddy zu solchen Anlässen mähte …
Seit Kriegsanfang gab es diese glücklichen Tage seltener, wodurch die Erinnerungen, wenn es sie doch gab, umso kostbarer wurden. Der Krieg hatte Daddy auch ein Hinken beschert, sodass wir recht langsam gehen mussten. Das störte mich aber gar nicht, weil ich ihn dann länger für mich allein hatte. Mittlerweile ging es ihm sehr viel besser, denn als er aus dem Lazarett gekommen war, hatte er in einem Rollstuhl gesessen wie ein alter Mann, und seine Augen waren ganz grau gewesen. Aber Maman und Daisy hatten ihn gepflegt, und ich hatte mein Bestes getan, ihm Geschichten vorzulesen, und so war er bald wieder gesund geworden. Jetzt brauchte er nicht einmal mehr einen Gehstock, außer bei größeren Entfernungen.
»Jetzt lauf, Posy, und wasch dir Gesicht und Hände. Sag deiner Mutter, dass ich unserem neuen Gast helfe, sich einzuleben«, bat Daddy mich mit dem Netz in der Hand, als wir die Stufen zur Terrasse erreichten.
»Ja, Daddy«, sagte ich, als er über den Rasen davonging und durch einen Bogen in einer hohen Buchsbaumhecke verschwand. Er wollte zu seinem Turm, der mit seinen Zinnen aus gelbem Sandstein das perfekte Märchenschloss für das Feenvolk und seine Schmetterlingsfreunde darstellte. Dort verbrachte Daddy sehr viel Zeit, aber immer allein. Ich durfte nur dann in das kleine, runde Zimmer direkt hinter der Eingangstür spähen, wenn Maman mir auftrug, Daddy zum Lunch zu holen. Es war sehr dunkel dort und roch nach feuchten Socken.
Da bewahrte er seine »Außenausrüstung« auf, wie er sie nannte: Tennisschläger, Cricketstäbe, schlammverkrustete Gummistiefel. Nie forderte er mich auf, die Treppe hinaufzugehen, die immer weiter nach oben kreiselte, bis sie oben auf einem kleinen Absatz endete (das wusste ich nur, weil ich einmal heimlich hinaufgeschlichen war, als Daddy ins Haus ans Telefon gerufen wurde). Ich war sehr enttäuscht festzustellen, dass er die große Eichentür, die mich oben empfing, abgeschlossen hatte. Obwohl ich mit der ganzen Kraft meiner kleinen Hände am Knauf drehte, ließ sie sich nicht öffnen. Ich wusste, dass dieses Zimmer im Gegensatz zum unteren viele Fenster hatte, man konnte sie ja von außen sehen. Der Turm erinnerte mich ein bisschen an den Leuchtturm in Southwold, nur dass er auf seinem Kopf eine goldene Krone trug und kein strahlendes Licht.
Als ich die Terrassenstufen hinaufging und an den schönen, hell ziegelroten Mauern des Haupthauses hinaufschaute mit den Reihen hoher Schiebefenster umrahmt von lindgrünen Glyzinienranken, seufzte ich glücklich. Der alte gusseiserne Tisch, der jetzt eher grün als sein ursprüngliches Schwarz war, wurde gerade auf der Terrasse für den Lunch gedeckt, mit nur drei Platzdeckchen und Wassergläsern, was bedeutete, dass wir allein sein würden. Das war ungewöhnlich. Ich dachte mir, wie schön es sein würde, sowohl Maman als auch Daddy ganz für mich zu haben. Ich trat durch die breite Flügeltür in den Salon, umrundete die Seidendamastsofas vor dem riesigen, mit Marmor eingefassten Kamin – so groß war er, dass der Weihnachtsmann im Jahr zuvor ein glänzendes rotes Fahrrad hindurchgebracht hatte – und hüpfte das Gewirr der Korridore entlang, das zur unteren Toilette führte. Ich schloss die Tür hinter mir, drehte den schweren silbernen Hahn mit beiden Händen auf und wusch sie mir gründlich. Auf Zehenspitzen stehend, untersuchte ich dann mein Gesicht im Spiegel nach Dreckspuren. Maman war sehr genau, was das Äußere betraf – Daddy sagte, das sei ihr französisches Blut –, und wehe, einer von uns war nicht makellos sauber, wenn er sich an den Tisch setzte.
Doch selbst ihr gelang es nicht, die braunen Löckchen zu bändigen, die ständig meinen fest geflochtenen Zöpfen entwichen, sich im Nacken kringelten und den Klammern entkamen, die eigentlich das ganze Haar straff aus der Stirn zurückhalten sollten. Eines Abends, als Daddy zum Gute-Nacht-Sagen zu mir ans Bett kam, fragte ich ihn, ob ich vielleicht etwas von seinem Haaröl borgen könne, weil das womöglich helfen würde, aber er wand sich nur lachend ein Ringellöckchen um den Finger.
»Das wirst du schön bleiben lassen. Ich liebe deine Locken, mein Schatz, und wenn es nach mir ginge, würden sie dir den ganzen Tag um den Kopf fliegen.«
Auf dem Rückweg sehnte ich mich wieder einmal danach, Mamans glänzendes, glattes Haar zu haben. Es hatte die Farbe der weißen Pralinen, die sie nach dem Dinner zum Kaffee servierte. Meine Haare waren eher wie Café au lait, das behauptete zumindest Maman. Ich nannte sie mausbraun.
»Da bist du ja, Posy«, sagte Maman, als ich auf die Terrasse trat. »Wo ist dein Sonnenhut?«
»Ach, den muss ich im Garten liegen gelassen haben, als Daddy und ich Schmetterlinge fingen.«
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dir ohne Hut das Gesicht verbrennst, und dann verschrumpelst du wie eine alte Dörrpflaume«, tadelte sie mich, als ich mich setzte. »Du wirst mit vierzig aussehen, als wärst du sechzig.«
»Ja, Maman«, antwortete ich und dachte, dass man mit vierzig sowieso so alt war, dass es nichts mehr ausmachen würde.
»Und wie geht’s meinem anderen Lieblingsmädchen an diesem herrlichen Tag?«
Daddy erschien auf der Terrasse und schwang meine Mutter durch die Luft, sodass der Wasserkrug in ihrer Hand überschwappte und Tropfen auf den grauen Steinboden spritzten.
»Vorsicht, Lawrence!«, ermahnte sie ihn stirnrunzelnd, ehe sie sich aus seinen Armen befreite und den Krug absetzte.
»An einem so famosen Tag kann man sich doch nur des Lebens freuen.« Lächelnd nahm er mir gegenüber am Tisch Platz. »Und das Wetter hält offenbar fürs Wochenende und für unser Fest.«
»Gibt es bei uns ein Fest?«, fragte ich, als Maman sich neben ihn setzte.
»Ja, mein Schatz. Dein alter Herr wurde als so weit genesen erachtet, dass er in den Dienst zurückkehren kann, deswegen haben Maman und ich beschlossen, noch eine letzte Sause zu veranstalten.«
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Daisy, unser Hausmädchen für alles, seitdem die anderen Bediensteten uns verlassen hatten, um irgendetwas für den Krieg zu tun, servierte Frühstücksfleisch und Radieschen. Ich konnte Radieschen nicht leiden, aber etwas anderes gab es aus dem Küchengarten diese Woche nicht mehr, weil das meiste, das dort wuchs, ebenfalls für den Krieg gebraucht wurde.
»Wie lange wirst du fort sein, Daddy?«, fragte ich mit einer leisen, angestrengten Stimme. Ich hatte einen Kloß im Hals, als säße dort ein Radieschen fest, und das bedeutete, dass ich jederzeit in Tränen ausbrechen könnte.
»Ach, zu lange sollte es nicht mehr dauern. Jeder weiß doch, dass es für die Deutschen langsam eng wird, aber am Ende muss ich noch mal mit anpacken. Ich kann doch meine Kumpel nicht im Stich lassen, oder?«
»Nein«, stimmte ich mit zittriger Stimme zu. »Aber du lässt dich auch nicht wieder verletzen, Daddy, oder?«
»Aber nein, mon chérie. Dein Papa ist unverwüstlich, nicht wahr, Lawrence?«
Dabei warf meine Mutter ihm ein angestrengtes Lächeln zu, und ich dachte mir, dass sie sich wohl genauso viele Sorgen um ihn machte wie ich.
»Das stimmt, mein Herz«, antwortete er, legte seine Hand auf ihre und drückte sie fest. »Ich bin unverwüstlich.«
»Daddy?«, fragte ich am nächsten Morgen beim Frühstück, als ich Brotstreifen in mein weichgekochtes Ei tauchte. »Heute ist es so heiß, können wir an den Strand fahren? Wir sind schon so lange nicht mehr am Meer gewesen.«
Daddy warf einen Blick zu Maman, doch sie las gerade bei einer Tasse Café au lait ihre Briefe und bemerkte es gar nicht. Maman bekam ganz viele Briefe aus Frankreich, immer auf ganz dünnem Papier geschrieben, dünner noch als ein Schmetterlingsflügel, was gut zu Maman passte, weil alles an ihr so zart war.
»Daddy? Zum Strand?«, fragte ich noch einmal.
»Mein Schatz, ich fürchte, am Strand kann man zurzeit nicht richtig spielen. Er ist voll Stacheldraht und Minen. Weißt du noch, als ich dir erklärte, was letzten Monat in Southwold passiert ist?«
»Doch, Daddy.« Ich schaute auf mein Ei und schauderte bei der Erinnerung, wie Daisy mich in den Anderson-Luftschutzunterstand getragen hatte (ich hatte gedacht, der heiße so, weil das unser Nachname ist, und war völlig durcheinander, als Mabel mir erzählte, ihre Familie habe auch einen Anderson-Unterstand, dabei hieß sie doch Price). Es hatte geklungen, als tobe ein Gewitter mit Donner und Blitzen, aber, hatte Daddy gesagt, das schicke nicht der liebe Gott, sondern Hitler. Im Unterstand hatten wir uns alle aneinandergeschmiegt, und Daddy hatte gemeint, wir sollten uns vorstellen, wir wären eine Igelfamilie, und ich solle mich wie ein kleines Igeljunges zusammenrollen. Maman war richtig wütend geworden, weil er mich ein Igelchen nannte. Aber so hatte ich mich gefühlt, tief unter der Erde eingegraben, während über uns die Menschen kämpften.
Irgendwann hatte der schreckliche Lärm aufgehört, und Daddy hatte gesagt, wir könnten wieder ins Bett gehen, aber ich war ganz traurig, mich allein in mein Menschenbett legen zu müssen, anstatt mit allen anderen in unserem Bau zu bleiben.
Als ich am nächsten Morgen in die Küche gekommen war, hatte Daisy geweint, aber nicht sagen wollen, was passiert war. An dem Tag kam der Milchmann nicht, und Maman sagte, ich werde nicht zur Schule gehen, weil keine mehr da sei.
»Aber Maman, wie kann sie nicht mehr da sein?«
»Sie ist von einer Bombe getroffen worden, mon chérie«, hatte sie geantwortet und Zigarettenrauch ausgeatmet.
Mittlerweile rauchte Maman auch, und manchmal hatte ich Angst, sie würde ihre Briefe in Brand stecken, weil sie sie beim Lesen immer so dicht vor die Nase hielt.
»Aber was ist mit unserer Strandkabine?«, fragte ich Daddy. Ich liebte unsere kleine Hütte – sie war buttergelb gestrichen und stand als letzte in der Reihe. Wenn ich also in die eine Richtung schaute, konnte ich mir vorstellen, wir wären die Einzigen am Strand, aber wenn ich mich umdrehte, war es nicht weit zum netten Eismann am Pier. Daddy und ich bauten immer ganz prächtige Sandburgen mit Türmen und Wassergräben, groß genug, damit die kleinen Krebse dort einziehen konnten, wenn sie Lust dazu hatten. Maman wollte nie an den Strand mitfahren, sie sagte, es sei »zu sandig«. Ich fand, das war das Gleiche, als würde man sagen, das Meer sei zu nass.
Jedes Mal sahen wir dort einen alten Mann mit einem großen Hut, der langsam den Strand entlangging und im Sand mit einem langen Stock herumstocherte, aber einem anderen als den, auf den Daddy sich beim Gehen stützte. Der Mann hatte einen großen Sack dabei, und ab und zu blieb er stehen und begann zu graben.
»Was macht er denn da, Daddy?«, fragte ich einmal.
»Mein Schatz, er durchkämmt den Sand nach Strandgut. Das sind Gegenstände, die auf hoher See über Bord eines Schiffs gegangen sind oder von weit entfernten Ländern hier angespült werden.«
»Ach so«, hatte ich gesagt, obwohl der Mann gar keinen Kamm dabeihatte und schon gar keinen der Art, mit dem Daisy mich jeden Morgen quälte. »Meinst du, dass er nach einem verborgenen Schatz sucht?«
»Wenn er lange genug gräbt, wird er ganz bestimmt eines Tages etwas finden.«
Ich hatte mit wachsender Aufregung zugesehen, wie der alte Mann etwas aus dem Loch zog, das er gegraben hatte, und den Sand abwischte, nur um festzustellen, dass es eine alte Emailkanne war.
»Wie enttäuschend«, hatte ich geseufzt.
»Vergiss nicht, mein Schatz, der Müll des einen ist das Gold des anderen. Vielleicht durchkämmen wir auf die eine oder andere Art alle den Strand«, hatte Daddy gesagt und blinzelnd in die Sonne geblickt. »Wir suchen immer weiter, hoffen, den vergrabenen Schatz zu heben, der unser Leben bereichert, und wenn wir statt des funkelnden Edelsteins eine Teekanne ausgraben, müssen wir einfach weitersuchen.«
»Suchst du auch immer noch nach deinem Schatz, Daddy?«
»Nein, meine Feenprinzessin, den habe ich schon gefunden.« Er hatte zu mir hinabgelächelt und mir einen Kuss auf den Scheitel gegeben.
Nach langem Quengeln gab Daddy schließlich nach und fuhr mit mir zum Schwimmen an einen Fluss. Daisy half mir, meinen Badeanzug anzuziehen, setzte mir einen Hut auf die Locken, und ich stieg zu Daddy ins Auto. Maman hatte gesagt, sie habe zu viel mit den Vorbereitungen für das morgige Fest zu tun, aber das störte mich gar nicht, denn dann konnten der Feenkönig und ich alle Lebewesen des Flusses an unserem Hof empfangen.
»Gibt es da Otter?«, fragte ich, als wir vom Meer fort durch die sanften grünen Hügel fuhren.
»Um Otter zu sehen, muss man ganz leise sein«, antwortete er. »Meinst du, das schaffst du, Posy?«
»Natürlich!«
Wir fuhren eine ganze lange Weile, bis ich das blaue Band des Flusses sah, das sich jenseits der Binsen dahinschlängelte. Daddy parkte, dann gingen wir zusammen zum Flussufer, mein Vater beladen mit unserer ganzen wissenschaftlichen Ausrüstung: Kamera, Schmetterlingsnetz, Glasgefäße, Limonade und Corned-Beef-Sandwiches.
Libellen schwirrten über dem Wasser, verschwanden aber, sobald ich hineinstapfte. Es war wunderbar kühl, doch mein Kopf und das Gesicht waren ganz heiß unter dem Hut, also warf ich ihn ans Ufer, wo Daddy mittlerweile auch seine Badehose angezogen hatte.
»Bei dem Lärm haben alle Otter längst das Weite gesucht«, sagte er, als er in den Fluss watete. Er reichte ihm nur bis knapp unters Knie, so groß war er. »Jetzt schau dir mal den vielen Wasserschlauch an. Sollen wir welchen für unsere Sammlung mitnehmen?«
Gemeinsam griffen wir ins Wasser und zogen eine der Pflanzen mit den gelben Blüten heraus, die unten in knolligen Wurzeln endeten. Darin lebten viele winzige Insekten, also füllten wir ein Glas mit Wasser und steckten unser Exemplar hinein.
»Mein Schatz, erinnerst du dich noch an den lateinischen Namen?«
»U-tri-cu-la-ria!«, antwortete ich stolz, während ich mich am Ufer neben ihn aufs Gras fallen ließ.
»Kluges Mädchen. Kannst du mir versprechen, dass du unsere wachsende Sammlung immer weiter vergrößerst? Wenn du eine interessante Pflanze siehst, dann presse sie, wie ich es dir gezeigt habe. Während ich weg bin, brauche ich doch Hilfe mit meinem Buch, Posy.« Ich nahm das Sandwich, das er mir aus dem Picknickkorb reichte, und bemühte mich, ernsthaft und wissenschaftlich dreinzublicken. Daddy sollte wissen, dass er mir mit seiner Arbeit vertrauen konnte. Vor dem Krieg war er Botaniker gewesen, so nannte sich das, und fast mein ganzes Leben lang schrieb er schon an seinem Buch. Oft schloss er sich in seinem Turm ein, um »zu denken und zu schreiben«. Manchmal brachte er Seiten daraus ins Haus mit und zeigte mir seine Zeichnungen.
Und sie waren großartig. Er erklärte mir, dass es im Buch um unseren Lebensraum ging, und dazu hatte er wunderschöne Zeichnungen und Gemälde von Schmetterlingen und Insekten und Pflanzen gemacht. Einmal hatte er mir gesagt, dass sich nur eine Sache zu ändern brauche, damit alles aus dem Gleichgewicht geriete.
»Schau dir zum Beispiel diese Mücken an.« Daddy hatte an einem heißen Sommerabend auf eine Wolke dieser Plagegeister gezeigt. »Sie sind für das Ökosystem überlebenswichtig.«
»Aber sie stechen uns«, hatte ich eingewendet und eine vertrieben.
»Das liegt in ihrer Natur, ja.« Er hatte leise gelacht. »Aber ohne sie hätten viele Vögel keine unerschöpfliche Nahrungsquelle, ihre Zahl würde rapide sinken. Und wenn der Vogelbestand abnimmt, hat das gravierende Folgen für die ganze Nahrungskette. Ohne Vögel hätten Insekten wie Grashüpfer viel weniger Jäger, sie würden sich stark vermehren und alle Pflanzen auffressen. Und ohne Pflanzen …«
»… hätten die Pflanzenesser nichts zu essen.«
»Die Pflanzenfresser, genau. Du siehst also, dass alles auf einem fragilen Gleichgewicht beruht. Ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings kann große Folgen haben.«
Darüber dachte ich nach, während ich jetzt mein Sandwich kaute.
»Ich habe etwas für dich«, sagte Daddy und reichte mir eine glänzende Dose, die er aus seinem Rucksack holte.
Ich öffnete sie und sah Dutzende frisch gespitzter Buntstifte in allen Farben des Regenbogens.
»Zeichne immer weiter, und wenn ich zurückkomme, kannst du mir zeigen, wie viel besser du in der Zwischenzeit geworden bist.«
Ich nickte. Das Geschenk verschlug mir die Sprache.
»Als ich in Cambridge war, haben sie uns gelehrt, die Welt genau anzusehen«, fuhr er fort. »So viele Menschen gehen blind an all der Schönheit und dem Zauber um sie her vorbei. Aber du nicht, Posy. Du siehst alles jetzt schon viel besser als die meisten anderen. Wenn wir die Natur zeichnen, verstehen wir sie – dann erkennen wir die ganzen Einzelteile und wie sie zusammengesetzt sind. Indem du zeichnest, was du siehst, und es genau betrachtest, kannst du anderen Menschen helfen, das Wunder der Natur ebenfalls zu begreifen.«
Zu Hause schimpfte Daisy mich, weil mein Haar nass geworden war, und steckte mich in die Badewanne, was ich völlig unsinnig fand, weil es dann nur wieder ganz nass wurde. Nachdem sie mich ins Bett gebracht und die Tür hinter sich geschlossen hatte, stand ich noch mal auf und schaute mir meine neuen Buntstifte an. Ich fuhr mit den Fingern über die weichen und doch scharfen Spitzen und nahm mir vor, so fest zu üben, dass ich Daddy, wenn er vom Krieg heimkam, zeigen konnte, dass ich gut genug war für Cambridge – auch wenn ich ein Mädchen war.
Am nächsten Morgen verfolgte ich vom Fenster meines Zimmers aus, wie immer mehr Autos auf unserer Auffahrt erschienen. Jedes war gesteckt voll Menschen. Ich hatte Maman sagen hören, all ihre Freunde hätten für die Fahrt von London zu uns ihre Bezugsscheine für Benzin zusammengelegt. Eigentlich hatte sie sie émigrés genannt, aber da sie seit meiner Geburt französisch mit mir sprach, wusste ich, dass das so viel wie »Emigranten« bedeutete. Im Lexikon stand, das sei ein Mensch, der von seinem Heimatland in ein anderes zog. Maman sagte, es käme ihr vor, als sei ganz Paris nach England emigriert, um dem Krieg zu entkommen. Ich wusste natürlich, dass das nicht stimmte, aber zu den Festen kamen irgendwie immer mehr von ihren französischen als von Daddys englischen Freunden. Das störte mich nicht, weil sie so bunt aussahen, die Männer mit ihren leuchtenden Schals und den juwelenfarbenen Hausröcken, die Damen mit ihren Satinkleidern und den knallroten Lippen. Das Schönste war, dass sie mir alle etwas mitbrachten, also kam es mir vor wie Weihnachten.
Daddy nannte sie »Mamans Bohemiens«, womit laut Lexikon kreative Menschen wie Künstler, Musiker und Maler gemeint waren. Maman war früher Sängerin in einem berühmten Nachtclub in Paris gewesen, und ich hörte so gern ihre Stimme, die tief und seidenweich war wie geschmolzene Schokolade. Natürlich wusste sie nicht, dass ich ihr zuhörte, weil ich eigentlich schlafen sollte, aber bei einem Fest im Haus war das sowieso unmöglich, deswegen schlich ich immer die Treppe hinunter und lauschte der Musik und dem Geplauder. Es kam mir vor, als würde Maman an solchen Abenden zum Leben erweckt und wäre zwischen den Festen bloß eine unbelebte Puppe. Dabei hörte ich sie so gern lachen, was sie nur selten tat, wenn wir allein waren.
Daddys Flieger-Freunde waren auch nett, obwohl sie alle ziemlich gleich in Marineblau oder Braun gekleidet waren, sodass ich sie nicht richtig auseinanderhalten konnte. Mein Taufpate Ralph, Daddys bester Freund, war mir der liebste. Ich fand, dass er mit seinem dunklen Haar und den großen braunen Augen sehr gut aussah. In einem meiner Bücher war ein Bild von dem Prinzen, der Schneewittchen mit einem Kuss aufweckt, und genau so sah Ralph aus. Außerdem spielte er wunderschön Klavier – vor dem Krieg war er Konzertpianist gewesen (vor dem Krieg war irgendwie jeder Erwachsene, den ich kannte, etwas anderes gewesen, außer Daisy, unser Hausmädchen). Onkel Ralph hatte eine Krankheit, wegen der er nicht kämpfen oder Flugzeuge fliegen konnte, deswegen hatte er das, was die Erwachsenen eine »Schreibtischtätigkeit« nannten, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, was man mit Schreibtischen anfangen konnte, außer dahinter zu sitzen. Wahrscheinlich tat er das. Wenn Daddy weg war, um seine Spitfire zu fliegen, kam Onkel Ralph Maman und mich besuchen, was uns beiden gut gefiel. Er kam am Sonntag zum Lunch und spielte mir und Maman hinterher auf dem Klavier etwas vor. Vor Kurzem hatte ich mir überlegt, dass Daddy vier meiner sieben Jahre auf dieser Welt im Krieg gewesen war, was für Maman sehr dröge sein musste, mit niemandem außer mir und Daisy zur Gesellschaft.
Ich saß auf meiner Fensterbank und reckte den Hals, um zu sehen, wie Maman ihre Gäste auf der breiten Treppe begrüßte, die zur Haustür direkt unter mir führte. Meine Mutter sah so hübsch aus in ihrem nachtblauen Kleid, das zu ihren schönen Augen passte, und als Daddy sich zu ihr stellte und ihr einen Arm um die Taille legte, fühlte ich mich richtig glücklich. Daisy kam, um mich in das neue Kleid zu stecken, das sie mir aus zwei grünen Vorhängen genäht hatte. Während sie mir die Haare bürstete und nur ein bisschen davon mit einer grünen Schleife aus dem Gesicht band, nahm ich mir vor, nicht daran zu denken, dass Daddy morgen wieder wegfahren und sich dann eine Stille wie vor einem Gewitter über Admiral House und uns, die Bewohner, legen würde.
»Bist du so weit, nach unten zu gehen, Posy?«, fragte Daisy. Ihr Gesicht war ganz rot, sie schwitzte und sah müde aus, wahrscheinlich, weil es wirklich sehr heiß war und sie das Essen für diese vielen Leute herrichten musste, ohne dass ihr jemand half. Ich warf ihr mein schönstes Lächeln zu.
»Ja, Daisy. Gehen wir.«
Eigentlich hieß ich gar nicht Posy, sondern Adriana, nach meiner Mutter. Aber da es viel zu schwierig gewesen wäre, wenn wir beide auf den Namen gehört hätten, hatten meine Eltern beschlossen, meinen zweiten Namen zu verwenden, Rose, nach meiner englischen Großmutter. Daisy hatte mir erzählt, dass Daddy schon, als ich ein Baby war, angefangen hatte, mich »Rosy Posy« zu nennen, und irgendwann war einfach der zweite Teil hängen geblieben. Was mir nichts ausmachte, schließlich fand ich, dass es sehr viel besser zu mir passte als meine richtigen Namen.
Einige von Daddys älteren Verwandten nannten mich trotzdem »Rose«, und natürlich hörte ich darauf, denn man hatte mir beigebracht, immer höflich zu Erwachsenen zu sein, aber bei dem Fest kannten mich alle als Posy. Ich wurde umarmt und geküsst, und kleine, mit Schleifen verpackte Netze voll Süßigkeiten wurden mir in die Hand gedrückt. Von Mamans französischen Freunden bekam ich meist Zuckermandeln, die ich eigentlich nicht besonders mochte, aber ich wusste, dass Schokolade wegen des Kriegs schwer zu finden war.
Als ich an dem langen Tapeziertisch saß, der auf der Terrasse aufgebaut worden war, damit wir alle Platz fanden, die Sonne auf meinen Hut herabbrannte (sodass mir noch heißer wurde) und ich die Unterhaltungen um mich herum hörte, wünschte ich mir, dass jeder Tag in Admiral House so sein könnte. Maman und Daddy saßen nebeneinander in der Mitte, wie das Königspaar, das Hof hielt, sein Arm um ihre weißen Schultern gelegt. Sie sahen beide so unendlich glücklich aus, dass ich am liebsten geweint hätte.
»Posy, mein Schatz, ist alles in Ordnung?«, fragte Onkel Ralph, der neben mir saß. »Verdammt heiß hier draußen«, sagte er noch und tupfte sich die Stirn mit einem makellos weißen Taschentuch ab, das er aus seinem Jackett gezogen hatte.
»Doch, Onkel Ralph. Ich habe mir gerade gedacht, wie glücklich Maman und Daddy heute aussehen. Und wie traurig es ist, dass er wieder in den Krieg muss.«
»Das stimmt.«
Ralph betrachtete meine Eltern, und plötzlich wirkte auch er traurig.
»Na ja, mit etwas Glück ist es bald vorbei«, sagte er schließlich. »Dann können wir uns alle daranmachen, unser altes Leben wiederaufzunehmen.«
Nach dem Lunch durfte ich ein bisschen Krocket spielen, was ich erstaunlich gut konnte, wahrscheinlich, weil die meisten Erwachsenen ziemlich viel Wein getrunken hatten und den Ball recht wacklig über den Rasen schlugen. Vorher hatte ich Daddy sagen hören, er leere zu diesem Anlass die Reste seines Weinkellers, und mir kam es vor, als wäre ein Großteil davon schon in die Gäste geleert worden. Eigentlich konnte ich nicht verstehen, weshalb Erwachsene betrunken werden wollten; nach meiner Ansicht wurden sie dann nur lauter und dümmer, aber vielleicht würde ich es besser verstehen, wenn ich selbst erwachsen war. Als ich über den Rasen Richtung Tennisplatz ging, sah ich einen Mann mit zwei Frauen im Arm unter einem Baum liegen. Alle drei schliefen. Irgendjemand spielte allein auf der Terrasse Saxofon, und ich dachte mir, wie gut es war, dass wir keine direkten Nachbarn hatten.
Ich wusste, dass ich Glück hatte, in Admiral House zu leben. Als ich in die Schule gekommen war und Mabel, meine neue Freundin, mich zum Tee zu sich nach Hause eingeladen hatte, war ich völlig verblüfft gewesen zu sehen, dass man bei ihnen von der Haustür direkt ins Wohnzimmer kam. Hinten gab es eine winzige Küche, und die Toilette war draußen hinter dem Haus! Mabel hatte vier Geschwister, und alle schliefen zusammen in einem klitzekleinen Zimmer oben im ersten Stock. Da war mir zum ersten Mal klar geworden, dass ich aus einer reichen Familie stammte und nicht alle in einem großen Haus mit einem Park als Garten lebten. Das war ein ziemlicher Schock. Als Daisy mich abholte und wir nach Hause gingen, fragte ich sie, warum das so war.
»Das Leben ist ein Würfelspiel, Posy«, hatte Daisy erwidert. »Manche Menschen haben Glück und andere nicht.«
Daisy hatte eine Vorliebe für Redensarten, von denen ich die Hälfte nicht richtig verstand, aber ich war sehr froh, dass das Leben mich zu den Glückskindern gewürfelt hatte, und ich beschloss, mehr zu beten für alle, die nicht dazugehörten.
Meine Lehrerin, Miss Dansart, mochte mich, glaube ich, nicht besonders. Sie forderte uns zwar immer auf, uns zu melden, wenn wir die Antwort auf eine Frage wussten, aber irgendwie war ich jedes Mal die Erste, und dann verdrehte sie die Augen, und ihr Mund spitzte sich komisch zu, bevor sie sagte: »Ja, Posy.« Dabei klang ihre Stimme sehr matt. Auf dem Pausenhof hörte ich sie einmal mit einer anderen Lehrerin reden, als ich ganz in der Nähe das eine Ende eines langen Hüpfseils hielt.
»Einzelkind … wächst nur in der Gesellschaft Erwachsener auf … altklug …«
Zu Hause hatte ich das Wort »altklug« im Lexikon nachgeschlagen. Danach hatte ich aufgehört, mich zu melden, selbst wenn mir die Antwort im Hals kitzelte, weil ich sie mir verkniff.
Gegen sechs Uhr wachten alle auf und zogen sich zurück, um sich zum Dinner umzuziehen. Ich ging in die Küche, wo Daisy auf mein Abendessen deutete.
»Für dich, Fräulein, gibt’s heute Abend Brot und Marmelade. Ich habe zwei Lachse, die Mr. Ralph mitgebracht hat, und ich habe keine Ahnung, was ich mit ihnen anfangen soll.«
Sie lachte, und plötzlich tat sie mir leid, weil sie die ganze Zeit so schwer schuften musste.
»Brauchst du Hilfe?«
»Marjorys beiden Kleinen aus dem Dorf kommen, um den Tisch zu decken und beim Auftragen zu helfen, da schaffe ich das schon. Aber danke, dass du gefragt hast«, fügte sie hinzu und lächelte. »Du bist wirklich ein liebes Mädchen.«
Nachdem ich gegessen hatte, verschwand ich aus der Küche, bevor Daisy mir auftragen konnte, nach oben zu gehen und mich bettfertig zu machen. Der Abend war so wunderschön, ich wollte wieder nach draußen und ihn genießen. Als ich auf die Terrasse kam, schwebte die Sonne gerade oberhalb der Eichen und warf buttergoldene Strahlen auf den Rasen. Die Vögel sangen, als wäre es erst Mittagszeit, und es war noch so warm, dass ich keine Strickjacke brauchte. Ich setzte mich auf die Treppe, strich mir das Kleid über die Knie glatt und betrachtete einen Admiral, der sich in dem Beet, das zum Garten hin abfiel, auf einer Pflanze niedergelassen hatte. Ich hatte immer geglaubt, unser Haus wäre nach den Schmetterlingen benannt, die so hübsch zwischen den Büschen umherflatterten, und war sehr unglücklich gewesen, von Maman zu erfahren, dass es in Wirklichkeit nach meinem Ur-Ur-Ur- (ich glaube, es waren drei Urs, aber vielleicht auch vier) Großvater benannt war, der als Admiral in der Marine gedient hatte. Das fand ich nicht halb so romantisch.
Obwohl Daddy gesagt hatte, dass Admirale zu den Schmetterlingen gehörten, die in dieser Gegend gewöhnlich seien (wie Maman auch manche Kinder in meiner Schule nannte), waren sie mit den leuchtend rot-schwarzen Flügeln und den weißen Flecken an den Spitzen für mich die allerschönsten. Außerdem ließen sie mich an das Muster auf der Spitfire denken, die Daddy im Krieg flog. Aber der Gedanke stimmte mich traurig, weil er mich auch daran erinnerte, dass er am nächsten Tag wegfahren würde, um wieder eine zu fliegen.
»Guten Abend, mein Schatz. Was machst du denn ganz allein hier draußen?«
Bei seiner Stimme fuhr ich zusammen, weil ich gerade an ihn gedacht hatte. Ich schaute hoch, er kam über die Terrasse auf mich zu, eine Zigarette in der Hand. Die warf er zu Boden und trat sie aus. Er wusste, dass ich den Geruch nicht leiden konnte.
»Sag Daisy nicht, dass du mich hier gesehen hast, Daddy, ja? Sonst schickt sie mich sofort ins Bett«, sagte ich schnell, als er sich neben mich auf die Treppe setzte.
»Versprochen. Außerdem sollte an einem himmlischen Abend wie diesem niemand im Bett liegen. Für mich ist der Juni der schönste Monat, mit dem England aufwarten kann. Die ganze Natur hat sich von ihrem langen Winterschlaf erholt, hat sich gereckt und gestreckt und ihre Blätter und Blüten zur Freude von uns Menschen entfaltet. Im August ist ihre Energie in der Hitze verbrannt, und alles ist wieder bereit, sich schlafen zu legen.«
»So wie wir, Daddy. Im Winter freue ich mich immer aufs Bett.«
»Genau, mein Schatz. Vergiss nie, dass wir untrennbar mit der Natur verbunden sind.«
»In der Bibel heißt es, dass Gott alles auf Erden geschaffen hat«, sagte ich wichtigtuerisch. Das hatte ich im Religionsunterricht gelernt.
»Das stimmt, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass ihm das in ganzen sieben Tagen gelungen ist.« Er lachte.
»Es ist ein Wunder, Daddy, oder? Genauso, wie der Weihnachtsmann es schafft, allen Kindern auf der Welt in einer Nacht Geschenke zu bringen.«
»Da hast du recht, Posy, es ist ein Wunder. Die Welt steckt voll von ihnen, und wir müssen uns glücklich schätzen, hier leben zu dürfen. Vergiss das nie, ja?«
»Nein, Daddy. Daddy?«
»Ja, Posy?«
»Wann fährst du morgen?«
»Ich muss den Zug nach dem Lunch erreichen.«
Ich starrte auf meine schwarzen Lacklederschuhe. »Ich habe Angst, dass du wieder verletzt werden könntest.«
»Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, mein Schatz. Wie deine Maman sagt, ich bin unverwüstlich.«
»Wann kommst du wieder?«
»Sobald ich Heimaturlaub habe, was relativ bald sein sollte. Kümmre dich um deine Mutter, während ich weg bin, ja? Ich weiß, dass sie ganz unglücklich wird, wenn sie allein hier ist.«
»Das versuche ich auch immer, Daddy. Aber sie ist ja bloß traurig, weil du ihr fehlst und sie dich liebt, oder?«
»Ja, Posy, mein Schatz, und ich liebe sie auch. Der Gedanke an sie – und an dich – ist das Einzige, was mir beim Fliegen Mut gibt. Weißt du, als der dumme Krieg begann, waren wir noch gar nicht so lang verheiratet.«
»Nachdem du sie in dem Club in Paris singen gehört und dich auf der Stelle in sie verliebt hast und sie als deine Braut nach England entführt hast, bevor sie es sich anders überlegen konnte«, sagte ich verträumt. Die Liebesgeschichte meiner Eltern war viel schöner als alle Märchen in meinen Büchern.
»Ja, Posy, Zauber bekommt das Leben nur durch die Liebe. Selbst am grauesten Tag im tiefsten Winter kann Liebe die Welt zum Leuchten bringen, sodass sie so schön aussieht wie jetzt.«
Daddy seufzte tief und nahm meine Hand in seine große. »Versprich mir, Posy, wenn du die Liebe findest, dann halt sie fest und lass sie nie wieder los.«
»Das verspreche ich dir, Daddy«, sagte ich und sah ihn feierlich an.
»Braves Mädchen. So, und jetzt muss ich mich zum Dinner umziehen.«
Natürlich wusste ich es nicht, aber das war das letzte richtige Gespräch, das ich mit meinem Vater führen sollte.
Daddy fuhr am folgenden Nachmittag, ebenso wie die ganzen Gäste. An dem Abend war es sehr heiß, und die Luft kam einem beim Atmen dick und schwer vor, als wäre aller Sauerstoff aus ihr herausgesaugt. Im Haus war es ganz still – Daisy machte ihren wöchentlichen Ausflug zum Nachmittagstee mit ihrer Freundin Edith, also war nicht einmal sie zu hören, wie sie beim Abspülen brummelte oder sang (mir war das Brummeln lieber). Und zum Abspülen gab es wahre Berge, sie stapelten sich in der Spülküche auf den Tabletts. Ich hatte angeboten, mit den Gläsern zu helfen, aber Daisy hatte gemeint, das würde ihr nur noch mehr Arbeit bereiten, was ich ziemlich ungerecht fand.
Maman hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen, sobald der letzte Wagen jenseits der Kastanienbäume verschwunden war. Offenbar hatte sie wieder einmal ihre Migräne, was laut Daisy ein vornehmes Wort für Kater war, obwohl wir doch gar keinen hatten. Ich setzte mich mit untergeschlagenen Beinen auf meine Fensterbank direkt über dem Vorbau zum Eingang von Admiral House. Wenn Besuch erwartet wurde, sah ich ihn als Erstes. Daddy nannte mich seine kleine Ausguckerin, und seitdem Frederick, der Butler, weggegangen war, um im Krieg zu kämpfen, öffnete meistens ich die Tür.
Von dort oben hatte ich die Auffahrt im Blick, die von sehr alten Kastanien und Eichen gesäumt war. Daddy hatte mir erzählt, dass einige von ihnen vor fast dreihundert Jahren gepflanzt worden waren, als der erste Admiral sich dieses Haus gebaut hatte. (Eine faszinierende Vorstellung, denn das bedeutete, dass Bäume fast fünfmal länger lebten als Menschen, wenn die Encyclopaedia Britannica recht hatte und die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer einundsechzig und für Frauen siebenundsechzig Jahre betrug.) Mit zusammengekniffenen Augen konnte ich an klaren Tagen oberhalb der Bäume und unter dem Himmel eine dünne graublaue Linie ausmachen. Das war die Nordsee, keine acht Kilometer von Admiral House entfernt. Es machte mir richtig Angst, mir vorzustellen, dass Daddy ganz bald in seinem kleinen Flugzeug darüber hinwegfliegen würde.
»Komm heil und ganz wieder nach Hause, und komm bald«, flüsterte ich in die dunkelgrauen Wolken, die die Sonne beim Untergehen zusammenquetschten, als wollten sie sie wie eine saftige Orange auspressen (die hatte ich auch schon lange nicht mehr geschmeckt). Die Luft stand, keine Brise kam zu meinem geöffneten Fenster herein. In der Ferne grollte Donner, und ich hoffte nur, dass Daisy nicht recht hatte und Gott sich über uns ärgerte. Mir war nie klar, ob er nun Daisys zorniger Gott war oder der gütige Gott des Pfarrers. Vielleicht war er wie Eltern und konnte beides sein.
Als die ersten Regentropfen fielen, die bald zu Sturzbächen wurden, und Gottes Zorn über den Himmel zuckte, hoffte ich, dass Daddy mittlerweile sicher bei seinem Stützpunkt angekommen war, sonst würde er tropfnass werden, oder schlimmer noch, vom Blitz getroffen. Ich schloss das Fenster, weil das Sims nass wurde, und dann merkte ich, dass mein Magen fast genauso laut grummelte wie der Donner. Also machte ich mich auf den Weg nach unten zu dem Brot und der Marmelade, die Daisy mir zum Abendessen hingestellt hatte.
Während ich in der Dämmerung die breite Eichentreppe hinabging, fiel mir auf, wie leise es im Haus war im Vergleich zu gestern, als es schien, als wäre ein Schwarm summender redseliger Bienen eingeflogen, der genauso plötzlich wieder verschwunden war. Ein weiterer Donnerschlag über mir zerriss die Stille, und ich überlegte mir, wie gut es war, dass ich keine Angst vor der Dunkelheit und Gewittern und vorm Alleinsein hatte.
»Oh, Posy, bei dir zu Hause ist mir richtig unheimlich«, hatte Mabel gesagt, als ich sie zum Tee zu uns eingeladen hatte. »Schau dir doch bloß die ganzen Bilder von den toten Leuten in ihren altmodischen Kleidern an! Richtig Angst machen mir die«, hatte sie schaudernd gesagt und auf die Gemälde der Anderson-Vorfahren gedeutet, die zu beiden Seiten der Treppe hingen. »Aus Angst vor Gespenstern würde ich mich nachts gar nicht aufs Klo trauen.«
»Das sind meine Verwandten von vor langer Zeit, sie wären bestimmt richtig nett, wenn sie wirklich zurückkommen und mich begrüßen würden«, widersprach ich. Es kränkte mich, dass es ihr in Admiral House nicht so gut gefiel wie mir.
Als ich jetzt durch den Eingangsbereich und den widerhallenden Korridor entlang zur Küche ging, hatte ich überhaupt keine Angst, obwohl es mittlerweile ganz dunkel war und Maman, die oben in ihrem Zimmer vermutlich noch schlief, mich nie und nimmer hören würde, wenn ich schrie.
Ich wusste, dass ich hier sicher aufgehoben war, dass mir innerhalb der soliden Mauern des Hauses nichts passieren konnte.
Als ich die Küchenlampe einschalten wollte, wurde es nicht hell, also zündete ich stattdessen eine der Kerzen auf dem Regal an. Das konnte ich gut, weil der Strom in Admiral House nicht ganz zuverlässig war, zumal nicht seit dem Krieg. Mir gefiel der weiche, flackernde Schein, der nur den Bereich erleuchtete, in dem man war und bei dem selbst der Hässlichste schön aussah. Ich beschmierte die Brotscheiben, die Daisy mir vorgeschnitten hatte – ich durfte zwar Kerzen anzünden, aber keine scharfen Messer in die Hand nehmen –, dick mit Butter und Marmelade. Eine Scheibe steckte ich mir schon in den Mund und ging mit dem Teller, auf dem die anderen lagen, und der Kerze wieder in mein Zimmer hinauf, um dem Gewitter zuzusehen.
Dann saß ich auf meiner Fensterbank, aß meine Marmeladenbrote und dachte daran, dass Daisy sich immer Sorgen um mich machte, wenn sie ihren freien Abend hatte. Vor allem, wenn Daddy nicht da war.
»Es ist nicht richtig, dass ein kleines Mädchen ganz allein in einem so großen Haus ist«, brummte sie. Ich erklärte ihr dann immer, dass ich gar nicht allein war, weil Maman ja da war, und außerdem war ich mit meinen sieben Jahren nicht klein, sondern ziemlich groß.
»Hmp!«, machte sie dann immer nur, wenn sie ihre Schürze an den Haken hinten an der Küchentür hängte. »Egal, was sie sagt, weck sie auf, wenn du sie brauchst.«
»Das mache ich auch«, sagte ich immer, aber natürlich tat ich es nie, nicht einmal, als ich mich eines Abends auf dem Boden übergeben und richtig Bauchschmerzen gehabt hatte. Außerdem störte es mich gar nicht, allein zu sein; seit Daddy im Krieg war, hatte ich mich daran gewöhnt. Abgesehen davon hatte ich in der Bibliothek die ganze Encyclopaedia Britannica zu lesen. Die ersten beiden Bände hatte ich schon durch, aber noch zweiundzwanzig vor mir. Bis ich fertig war, würde ich wahrscheinlich erwachsen sein.
An diesem Abend, ohne Strom, war es zum Lesen zu dunkel, und von der Kerze war nur noch ein Stumpen übrig, also schaute ich stattdessen dem Himmel zu und versuchte, nicht daran zu denken, dass Daddy fort war, denn sonst würden die Tränen so schnell aus meinen Augen rinnen wie die Regentropfen, die gegen die Scheibe prasselten.
Und da bemerkte ich in der oberen Fensterecke plötzlich etwas Rotes.
»Ach! Ein Schmetterling! Ein Admiral!«
Ich stellte mich auf die Fensterbank und sah, dass der arme Schmetterling unter dem Fensterrahmen Zuflucht vor dem Gewitter suchte. Ich musste ihn retten. Ganz vorsichtig öffnete ich den Riegel vor der obersten Scheibe und streckte die Hand hinaus. Obwohl der Falter sich nicht bewegte, brauchte ich eine Weile, um ihn zwischen Zeigefinger und Daumen zu fassen zu bekommen, weil ich seine zarten Flügel nicht beschädigen wollte, die durchnässt und schmierig waren, aber fest geschlossen.
»Jetzt habe ich dich«, flüsterte ich, als ich meine patschnasse Hand zurückzog und das Fenster mit der trockenen wieder schloss.
»Mein Kleiner«, flüsterte ich, als ich ihn betrachtete, wie er da auf meinem Handteller saß. »Wie soll ich dir bloß die Flügel trocknen?«
Ich überlegte mir, wie sie in freier Natur trocken würden, denn sie müssten doch öfter nass werden.
»Ein warmer Wind«, sagte ich mir und hauchte vorsichtig darauf. Zuerst reagierte der Schmetterling nicht, aber gerade als ich dachte, ich würde vor lauter Pusten ohnmächtig werden, flatterte er mit den Flügeln, und schließlich öffnete er sie. Kein Schmetterling hatte je so still bei mir auf der Hand gesessen, also studierte ich die schöne Farbe und das kunstvolle Muster ganz genau.
»Du bist ein richtig Schöner«, sagte ich ihm. »Heute Abend kannst du nicht wieder hinaus, sonst ertrinkst du, also lasse ich dich hier auf dem Fenstersims, damit du deine Freunde draußen noch sehen kannst, und morgen früh entlasse ich dich wieder in die Freiheit, ja?«
Vorsichtig setzte ich ihn auf dem Fenstersims ab. Eine Weile beobachtete ich ihn und fragte mich, ob Schmetterlinge wohl mit geöffneten oder geschlossenen Flügeln schliefen. Aber mittlerweile fielen mir die Augen zu, also zog ich die Vorhänge zu, damit der kleine Admiral sich nicht verlockt fühlte, ins Zimmer zu fliegen und sich an die hohe Decke zu hängen, wo ich ihn nie erreichen würde. Dort könnte er vor Hunger oder Angst sterben.
Mit der Kerze in der Hand ging ich zu meinem Bett. Dort legte ich mich schlafen mit dem schönen Gefühl, ein Leben gerettet zu haben. Vielleicht war das ja ein gutes Omen, und Daddy würde dieses Mal nicht verletzt werden.
»Gute Nacht, Schmetterling. Schlaf gut bis morgen früh«, flüsterte ich, als ich die Kerze ausblies. Dann war ich auch schon eingeschlafen.
Als ich aufwachte, sah ich Lichtstrahlen an der Decke, die durch die Spalten in den Vorhängen fielen. Da sie golden waren, wusste ich, dass die Sonne schien. Da erinnerte ich mich an meinen Schmetterling, ich stand auf und zog die Vorhänge vorsichtig zurück.
»Ach!«
Mir stockte der Atem. Mein Schmetterling lag mit geschlossenen Flügeln auf einer Seite, die Beinchen in die Luft gereckt. Und weil die Unterseite der Flügel dunkelbraun war, sah er aus wie eine große und sehr tote Motte. Tränen traten mir in die Augen, ich stupste ihn an, nur um sicherzugehen, aber er rührte sich nicht, deswegen wusste ich, dass seine Seele schon im Himmel war. Vielleicht hatte ich ihn getötet, weil ich ihn am vergangenen Abend nicht hinausgelassen hatte. Daddy sagte immer, man müsse sie sehr rasch wieder freisetzen, und der Falter war zwar nicht in einem Schraubglas gewesen, aber doch in einem geschlossenen Innenraum. Vielleicht war er aber auch an Lungenentzündung oder Bronchitis gestorben, weil er so nass geworden war.
Ich stand da, starrte ihn an und wusste einfach, dass das ein ganz schlechtes Omen war.
Herbst 1944
Ich mochte die Zeit, wenn der Sommer allmählich in den langen, toten Winter überging. Der Nebel breitete sich wie gigantische Spinnweben über die Baumwipfel, und in der Luft lag ein Geruch nach Holz und Fermentation (den Ausdruck hatte ich erst vor Kurzem kennengelernt, als wir auf einem Schulausflug eine lokale Brauerei besucht und zugesehen hatten, wie Hopfen zu Bier gemacht wurde). Maman fand das englische Wetter bedrückend und wollte lieber irgendwo leben, wo es das ganze Jahr sonnig und warm war. Ich persönlich stellte mir das ziemlich langweilig vor. Dem Kreislauf der Natur zu folgen, die unsichtbaren Zauberhände zu beobachten, wie sie das leuchtend grüne Laub der Buchen zu glänzendem Messing färbten, war aufregend. Vielleicht war aber auch mein Leben nur recht eintönig.
In der Tat war es seit Daddys Abreise eintönig gewesen. Keine Feste mehr, keine Besucher außer Onkel Ralph, der ziemlich häufig kam und Blumen und französische Zigaretten für Maman und manchmal Schokolade für mich mitbrachte. Das Einerlei war zumindest im August durch den jährlichen Besuch bei Oma in Cornwall unterbrochen worden. Normalerweise begleitete mich Maman, und Daddy gesellte sich für ein paar Tage auch zu uns, wenn er Urlaub bekommen konnte, doch dieses Jahr, so erklärte Maman, sei ich alt genug, um allein zu fahren.
»Du bist diejenige, die sie sehen möchte, Posy, nicht mich. Sie hasst mich, das hat sie immer schon getan.«
Ich war überzeugt, dass das nicht stimmte, weil niemand Maman hassen konnte, sie war so schön und sang so zauberhaft, aber die Folge davon war, dass ich allein fuhr, auf der weiten Hin- und Rückreise begleitet von einer übellaunigen Daisy.
Oma lebte am Rand des kleinen Orts Blisland, östlich davon erstreckte sich das Bodmin Moor. Obwohl ihr Haus groß und prächtig war, kam es mir mit den grauen Wänden und den schweren, dunklen Möbeln nach den lichtdurchfluteten Räumen in Admiral House eher düster vor. Aber die Natur draußen zu erkunden machte mir Spaß. Wenn Daddy da war, wanderten wir ins Moor hinaus und pflückten Exemplare des Heidekrauts und der hübschen Blumen, die zwischen dem Ginster blühten.
Bei diesem Besuch kam Daddy leider nicht, und es regnete jeden Tag, was bedeutete, dass ich nicht nach draußen konnte. An den langen, nassen Nachmittagen brachte Oma mir das Patiencespielen bei, und wir aßen viel Kuchen, trotzdem war ich sehr froh, wieder nach Hause fahren zu dürfen. Als wir ankamen, stiegen Daisy und ich aus dem Einspänner, mit dem Benson, unser Teilzeitgärtner (der vermutlich hundert war), manchmal Gäste vom Bahnhof abholte. Ich überließ das Gepäck ihm und Daisy und lief ins Haus auf der Suche nach Maman. Aus dem Salon hörte ich »Blue Moon« auf dem Grammofon spielen, und dort tanzte Maman mit Onkel Ralph.
»Posy!«, rief sie, löste sich aus Onkel Ralphs Armen und zog mich an sich. »Wir haben dich gar nicht kommen hören.«
»Wahrscheinlich, weil die Musik so laut ist, Maman«, antwortete ich und dachte, wie hübsch und glücklich sie aussah mit den geröteten Wangen und dem wunderschönen langen Haar, das sich aus der Spange gelöst hatte und in einem hellgoldenen Sturzbach ihren Rücken hinabfiel.
»Wir haben gefeiert, Posy«, erklärte Onkel Ralph. »Es gibt noch mehr gute Nachrichten aus Frankreich. Es sieht aus, als würden die Deutschen bald kapitulieren, und dann ist der Krieg endlich vorbei.«
»Ach, schön«, antwortete ich. »Das heißt, dass Daddy bald nach Hause kommt.«
»Ja.«
Kurz herrschte Stille, dann sagte Maman, ich solle mich nach der langen Fahrt erst einmal ein bisschen frisch machen. Ich hoffte, dass Onkel Ralph wirklich recht hatte und Daddy bald nach Hause kommen würde. Seitdem das Radio uns in den Nachrichten vom großartigen Erfolg von D-Day berichtet hatte, hoffte ich jeden Tag, er werde kommen. Über drei Monate waren seitdem vergangen, und er war immer noch nicht wieder da, obwohl Maman ihn einmal besucht hatte, als er kurz Urlaub hatte, weil es einfacher gewesen sei. Auf meine Frage, warum er noch nicht zurückgekommen sei, obwohl wir den Krieg beinahe gewonnen hätten, zuckte sie mit den Schultern.
»Er hat sehr viel zu tun, Posy, und wenn er kommt, ist er da.«
»Aber woher weißt du, dass es ihm gut geht? Hat er dir geschrieben?«
»Oui, chérie. Hab Geduld. Es dauert sehr lange, bis ein Krieg zu Ende ist.«
Das Essen wurde immer knapper, und wir hatten nur noch zwei Hühner, denen der Hals nur deshalb noch nicht umgedreht worden war, weil sie am meisten Eier legten. Doch selbst sie wirkten niedergeschlagen, obwohl ich jeden Tag mit ihnen redete, weil Benson gesagt hatte, glückliche Hühner würden mehr Eier legen. Aber meine Unterhaltung nützte offenbar nichts, denn weder von Ethel noch von Ruby hatten wir in den vergangenen fünf Tagen auch nur ein Ei bekommen.
»Daddy, wo bist du?«, fragte ich den Himmel und stellte mir vor, wie wunderbar es wäre, wenn zwischen den Wolken plötzlich eine Spitfire erschien und Daddy herunterflog, um bei uns auf dem großen Rasen zu landen.
Es wurde November, und nach der Schule verbrachte ich die Nachmittage damit, im durchnässten, frostigen Gestrüpp nach Reisig für das Feuer zu suchen, das Maman und ich abends im Frühstückszimmer entzündeten. Der Raum war viel kleiner als der Salon und deswegen leichter zu heizen.
Eines Abends sagte Maman: »Posy, ich habe mir Gedanken über Weihnachten gemacht.«
»Vielleicht ist Daddy dann schon zu Hause, und wir können zusammen feiern.«
»Nein, er wird nicht kommen, und ich bin nach London eingeladen worden, um mit meinen Freunden zu feiern. Dir wäre es mit den ganzen Erwachsenen viel zu langweilig, und deswegen habe ich deiner Großmutter geschrieben, und sie ist bereit, dich über Weihnachten aufzunehmen.«
»Aber ich …«
»Posy, bitte sei vernünftig. Wir können nicht hierbleiben. Das Haus ist eisig, wir haben keine Kohle …«
»Aber wir haben Holz, und …«
»Wir haben nichts zu essen! Posy, deine Großmutter hat vor Kurzem ihr Dienstmädchen verloren und ist bereit, auch Daisy bei sich aufzunehmen, bis sie im Ort einen Ersatz gefunden hat.«
Ich biss mir auf die Lippen, ich war den Tränen nahe. »Aber was, wenn Daddy kommt und das Haus leer vorfindet?«
»Ich werde ihm schreiben.«
»Aber vielleicht bekommt er den Brief nicht, außerdem würde ich lieber hierbleiben und verhungern, als Weihnachten bei Oma zu verbringen! Ich liebe sie, aber sie ist alt, und ihr Haus ist nicht mein Zuhause, und …«
»Das genügt! Mein Entschluss steht fest. Vergiss nicht, Posy, wir müssen alle Opfer bringen, um die letzten Monate dieses grausamen Kriegs zu überleben. Zumindest wirst du es warm haben, du wirst in Sicherheit sein und genug zu essen bekommen. Das ist sehr viel mehr, als viele andere auf der Welt haben, die hungern oder gar vor Hunger sterben.«
Ich hatte Maman noch nie so wütend erlebt. Obwohl mir die Tränen in den Augen brannten, schluckte ich sie hinunter und nickte. »Ja, Maman.«
Danach wirkte zumindest Maman besserer Laune, auch wenn ich und Daisy wie Gespenster durchs Haus schlichen, die für den Rest ihres Daseins unter einem Fluch standen.
»Wenn ich eine andere Wahl hätte, würde ich nicht fahren«, brummte Daisy, als sie mir beim Kofferpacken half. »Aber Madam sagt, dass sie kein Geld hat, um mich zu bezahlen, was soll ich also tun? Von Knöpfen kann ich schließlich nicht leben.«
»Wenn der Krieg vorbei ist und Daddy wieder nach Hause kommt, wird alles besser«, sagte ich im Versuch, auch mich zu trösten.
»Schlechter kann es kaum werden. Hier ist es ganz schön weit gekommen, da beißt die Maus keinen Faden ab«, antwortete Daisy grimmig. »Fast glaube ich ja, dass sie uns beide aus dem Weg haben will, um …«
»Um was?«, fragte ich.
»Das geht dich nichts an, junge Dame. Aber je früher dein Dad nach Hause kommt, desto besser.«
Da das Haus für einen ganzen Monat geschlossen werden sollte, putzte Daisy jeden Quadratzentimeter.
»Aber warum putzt du es denn, wenn sowieso niemand hier ist?«, fragte ich.
»Das reicht mit deinen Fragen, Fräulein, hilf mir lieber«, sagte sie, nahm einen Stapel weißer Laken und schlug sie auf, sodass sie flatterten wie große Segel. Gemeinsam breiteten wir sie über die Betten und Möbel in den sechsundzwanzig Räumen des Hauses, bis es aussah, als hätte eine Gespenster-Großfamilie Einzug gehalten.
Als die Ferien begannen, machte ich mich mit meinen Buntstiften und einem Block weißem Papier auf, um alles zu zeichnen, was ich im Garten finden konnte. Das war nicht einfach, weil alles tot war. An einem frostigen Dezembertag ging ich mit meiner Lupe hinaus. Es hatte noch nicht geschneit, aber auf den Stechpalmen lag glänzender weißer Raureif, trotzdem zog ich meine Fäustlinge aus, damit ich die Lupe richtig halten konnte, um mir die Stiele genau anzusehen. Daddy hatte mir gezeigt, wo ich nach den Puppen des Faulbaum-Bläulings suchen musste.
Da sah ich, dass die Tür zum Turm aufging und Daisy herauskam, das Gesicht gerötet, die Arme voll Putzmittel.
»Posy, was machst du hier draußen ohne deine Fäustlinge?«, schimpfte sie. »Zieh sie sofort wieder an, sonst frierst du dir noch die Finger ab.« Damit marschierte sie zum Haus. Ich schaute zur Tür des Turms, die noch einen Spalt offen stand. Ehe ich michs versah, war ich hineingeschlüpft, und die Tür war knarzend hinter mir ins Schloss gefallen.
Es war sehr dunkel, aber meine Augen gewöhnten sich schnell daran, und ich konnte die Umrisse der Cricketstäbe und Krocketbügel erkennen, die Daddy hier aufbewahrte, ebenso wie den verschlossenen Waffenschrank, den zu öffnen er mir verboten hatte. Ich blickte zur Treppe, die zu Daddys Zimmer hinaufführte, und stand da, hin und her gerissen in meiner Unentschlossenheit. Wenn Daisy die Eingangstür nicht abgesperrt hatte, dann war die zu Daddys Geheimzimmer vielleicht auch offen. Ich wollte doch so gerne einmal einen Blick hineinwerfen …
Schließlich siegte meine Neugier. Bevor Daisy zurückkam, lief ich die Treppe hinauf, die sich immer weiter im Kreis nach oben drehte. Oben angelangt, legte ich die Hand auf den Knauf der schweren Eichentür und drehte daran. Daisy hatte sie eindeutig nicht verschlossen, denn sie ging auf, und nach einem Schritt stand ich in Daddys geheimem Arbeitszimmer.
Es roch nach Politur, und Licht fiel auf die runden Wände mit ihren Fenstern, die Daisy gerade geputzt hatte. An der Wand mir gegenüber hing eine ganze Großfamilie von Admiralen, in Viererreihen hinter Glas angeordnet und umschlossen von einem goldenen Rahmen.
Ich trat näher und fragte mich verwundert, wie die Schmetterlinge so still halten und was sie in ihrem Glasgefängnis zu fressen gefunden haben konnten.
Dann sah ich die Köpfe der Nadeln, mit denen sie auf die Rückwand gesteckt waren. Ich schaute zu den anderen Wänden und stellte fest, dass auch dort lauter Rahmen mit den Schmetterlingen hingen, die wir im Lauf der Jahre gefangen hatten.
Mit einem Schrei des Grauens stürzte ich die Treppe hinunter und in den Garten hinaus. Als ich Daisy vom Haus herüberkommen sah, machte ich kehrt und lief in den Wald jenseits des Turms. Erst in sicherer Entfernung ließ ich mich auf die Wurzeln einer großen Eiche fallen und holte keuchend Luft.
»Sie sind tot! Sie sind tot! Tot! Wie konnte er mich nur so anlügen?«, schrie ich zwischen Schluchzern.
Ich blieb sehr lange dort im Wald, bis ich Daisy nach mir rufen hörte. Ich wünschte nur, ich könnte Daddy fragen, weshalb er sie getötet hatte, wo sie doch so schön waren, und sie wie Trophäen an die Wand hängte, damit er ihr Totsein bestaunen konnte.
Aber ich konnte ihn nicht fragen, weil er nicht hier war, also musste ich ihm vertrauen und glauben, dass es einen sehr guten Grund für die Morde in unserem Schmetterlingsreich gab.
Doch auf meinem langsamen Rückweg zum Haus fiel mir kein einziger Grund ein. Ich wusste nur, dass ich nie wieder einen Fuß in den Turm setzen wollte.
Admiral House September 2006
Schmetterlingsflieder(Buddleja davidii)
Kapitel 1
Posy erntete im Küchengarten gerade Karotten, als in den Tiefen ihrer Barbourjacke ihr Handy klingelte. Sie fischte es heraus und nahm das Gespräch an.
»Guten Morgen, Mum. Ich habe dich doch nicht geweckt, oder?«
»Guter Gott, nein, und selbst wenn, ich freue mich doch, von dir zu hören. Wie geht es dir, Nick?«
»Alles bestens, Mum.«
»Und wie sieht’s in Perth aus?«, fragte sie, richtete sich auf und schlenderte durch den Garten zur Küche.
»Langsam wird es heiß, gerade wenn es bei euch wieder kühler wird. Wie sieht’s bei dir aus?«
»Mir geht’s gut. Wie du weißt, ändert sich hier herzlich wenig.«
»Ich rufe an, um dir zu sagen, dass ich gegen Ende des Monats nach England komme.«
»Ach, Nick! Wie schön. Nach all den Jahren.«
»Zehn, um genau zu sein«, bestätigte ihr Sohn. »Langsam ist es an der Zeit, dass ich nach Hause komme, findest du nicht?«
»Aber ja. Ich bin überglücklich, mein Schatz. Du weißt doch, wie sehr du mir fehlst.«
»Und du mir, Mum.«
»Wie lang wirst du bleiben? Vielleicht sogar lang genug, um beim Fest zu meinem siebzigsten Geburtstag kommenden Juni der Ehrengast zu sein?«, fragte Posy und lächelte.
»Sehen wir mal, wie alles läuft, aber selbst wenn ich beschließen sollte, wieder herzukommen, bin ich bei deinem Fest auf jeden Fall dabei.«
»Soll ich dich vom Flughafen abholen?«
»Nein, nicht nötig. Ich werde erst ein paar Tage in London bei meinen Freunden Paul und Jane bleiben. Es gibt einige Dinge, die ich erledigen muss. Ich rufe dich an, sobald ich weiß, wann ich nach Admiral House fahren und dich besuchen kann.«
»Ich kann es gar nicht erwarten, mein Schatz.«
»Ich auch nicht, Mum. Wir haben uns viel zu lang nicht gesehen. Jetzt sollte ich langsam Schluss machen, aber ich melde mich bald wieder.«