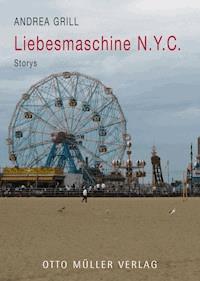Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Männer, viel Kaffee und eine Schleichkatze. Das Schöne und das Notwendige ist eine ökologische Parabel, ein witziger und herzklopfenerregender Roman, in seiner Wirkung dem Kaffee nicht unähnlich: Er weckt die Sinne. Zwei Freunde, die vor dem finanziellen Ruin stehen, fassen einen gewagten Plan: Sie wollen in den Kaffeehandel einsteigen und mit einem originellen Einfall die mitteleuropäische Kaffeekultur revolutionieren. Die geniale Idee hat nur einen Haken: Für ihre Umsetzung benötigen die beiden Männer eine asiatische Schleichkatze. Ein nachtaktiver, pelziger Bewohner der Baumkronen indischer Regenwälder. Denn auf dem Speiseplan dieser Katzen stehen unter anderem Kaffeebohnen ... Woher bekommt man aber ein solches Tier, und wie hält man es in einer Wohnung im fünften Stock? Andrea Grill erzählt mit großer Leichtigkeit, hintergründig und berührend. Ihr neuer Roman ist eine literarische Ernte der überraschenden und manchmal auch bitteren Früchte des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Grill
Das Schöne und das Notwendige
Andrea Grill
Das Schöne und
das Notwendige
ROMAN
O T T O M Ü L L E R V E R L A G
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1169-9eISBN 978-3-7013-6169-4
© 2010 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIEN Alle Rechte vorbehalten Satz: Media Design: Rizner.at, Salzburg Umschlaggestaltung: Ulrike Leikermoser Abbildung Umschlag: Andrea Grill Druck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
Für d’Usch
Inhalt
Das Schöne und das Notwendige
Anmerkungen
Ich hantiere herum, wärme die Kaffeekanne vor und stelle die beiden kleinen Schalen aus Augartenporzellan auf das Tablett, sie stehen so unübersehbar vor mir, wie es unübersehbar sein müsste, dass ich hier stehe und noch denke.
(I. Bachmann)
Die Kaffeepflanze gehört zur Familie der Rötegewächse, wie Kreuzlabkraut, Waldmeister, Ackerröte und die südamerikanische Psychotria, die – gemischt mit der Rinde einer im Amazonasgebiet wachsenden Liane – zu Halluzinationen und dem Erleben anderer Wirklichkeitsdimensionen führt.
Das Getränk Kaffee wird aus den Samen der zwei weltweit populärsten (weil am leichtesten in Plantagen zu haltenden) Kaffeebäume gekocht, Coffea arabica und Coffea canephora (robusta). Die restlichen mehr als hundert Arten sind wirtschaftlich von geringer Bedeutung, viele sind vom Aussterben bedroht.
1 Coffea arabica
Der erste kultivierte Kaffeebaum. Bekannt unter dem Namen „Arabica Kaffee“. Wird bis zu fünf Meter hoch, zur Erleichterung der Ernte meist aber auf zwei Meter gestutzt. Zwei bis vier Jahre nach der Pflanzung beginnen die Bäume weiß und stark duftend zu blühen. Ihr Duft ähnelt dem des Jasmins. Aus den Blüten entwickeln sich die Kaffeekirschen
Der April hat so vielversprechend begonnen, mit seinem elastischen Mund, voll Blühpflanzen und knospender Bäume. Jetzt ist August, ein Monat wie ein Sonntag, dem Sehnsüchtigen alles versprechend, um nichts zu halten außer einer erstickenden Temperatur. Von den Wäscheleinen, wo sie zwischen feuchten Socken und Unterwäsche eine letzte Zuflucht gesucht haben, hängen vertrocknete Regenwürmer. Die Erde bricht, ausgedörrt. Am ganzen Kontinent herrscht eine Trockenperiode. Auch das andere Land glüht, sein Adoptivland. Er ist nie dort gewesen, hat es nur vorhin in der Zeitung gelesen, die einer der Fabrikarbeiter, die in die Frühschicht gefahren sind, liegen gelassen hat. Von ihnen ist nichts zu erwarten. Deshalb beginnt er später. Es wird ein schlechter Tag für ihn werden. Die meisten morgendlichen Zugfahrer blättern in der Zeitung, sie würden es auch wissen: Rumänien vertrocknet, wie ganz Europa, in Rumänien brennt der Wald. Er steht auf, geht durch den Waggon, wankend, die Strecke ist kurvig, er stützt sich an jeder zweiten Sitzlehne ab.
Einmal greift er dabei in Haare, so lang, dass sie wie ein eigenes Wesen auf dem Stoff liegen. Der Kopf, zu dem sie gehören, lehnt einen Sitz weiter. Erst als ein böser Blick ihn trifft, bemerkt er ihn. Der Kopf schüttelt sich, Arme bündeln die Haare über eine Schulter.
Vom Fenster aus sieht er draußen wieder die Frau, die er jeden Tag sieht, ihr gelbes Kopftuch leuchtet zwischen den abgeernteten Stängeln, den Plastikkuppeln über den Salatbeeten. Er möchte sie fragen, was sie tut, wenn sie nicht am Feld arbeitet. Ob sie Zeit hat. Immer wenn der Zug durch die Peripherie der Stadt fährt, sieht er sie dort zwischen den Beeten stehen.
Er macht sich an die Arbeit, holt einen Stoß Zettel aus der Hosentasche, geht durch den Mittelgang, der Zug fährt langsamer und geradeaus. Auf den Zetteln steht, dass er aus Rumänien ist, drei Kinder hat und sein Haus bei einer Überschwemmungskatastrophe zerstört wurde. Mit dem Oberarm wischt er sich einige Schweißtropfen von der Stirn, der heutige Tag wird noch schlimmer werden als die anderen dieser Woche. In den Waggons dunsten Pendler und Reisende in der Hitze, lehnen apathisch in ihren Sitzen. Eigentlich könnte er gleich aufhören, gleich aussteigen, umsteigen und zurückfahren.
Den ersten Zettel legt er einer jungen Frau hin. Sorgfältig und bedächtig, aber ohne sie anzuschauen, platziert er das Stück Papier auf das schmale Tischchen vor ihr, unter dem sich der ausklappbare Mistkübel befindet. Sie tut, als sähe sie den Zettel nicht, als konzentriere sie sich ganz auf das in ihrem Schoß liegende Telefon, ununterbrochen drückt ihr Daumen eine Taste, als spiele sie ein Spiel. Er weiß, sie denkt nur an seinen Zettel. Eigenhändig, von ihm selber unterschrieben, mit einem rumänischen Vornamen. Radu steht da, in seiner Schrift. Im Zug nennt er sich so.
*
Ich heiße Ferdinand. Aber alle nennen mich Fiat, hat er im April zu Finzens gesagt, in ihrem ersten Gespräch. Vier Tage später ist er bei ihm eingezogen.
Fiat?Ja. Fiat.Wie das Auto?
Wie das Auto. Meine Eltern fanden, dass ich etwas mit dem Auto gemein habe, und Mercedes ist ja auch ein Name. Ich bin es gewöhnt.
Ich könnte dich Ferdinand nennen. Einfach, wie du heißt. Fiat wäre mir lieber.
Von den roten Bänken, auf denen sie sich niederließen, um Bekanntschaft zu machen, sah man eine Uhr, auf einem langen Stiel vom Gehsteig aufragend, als hätte jemand sie gepflanzt, wie die Linde daneben. Es war zwölf Uhr vierzig. Von der Linde fielen Zweiglein mit trockenen Fruchtkapseln vom Vorjahr aufs Tischtuch.
Zum ersten Mal begegnet sind sich die beiden Männer im sechseckigen Beinhaus direkt neben der Kathedrale der Stadt, wo Tausende Schädel aufeinandergestapelt sind. Finzens verbringt dort oft seine Mittagspause. Er ist in der Kathedrale angestellt. Fiat war an dem Tag als Tourist gekommen. Eine Frau, deren Charme er sich nicht entziehen konnte, hatte ihm empfohlen, sich das Beinhaus anzuschauen, und er wollte berichten können, dass er dort gewesen sei und dass es ihm gefallen habe. Als Finzens ihn ansprach, stand er gerade überrascht vor einem Schädel, auf dem er seinen eigenen Nachnamen entdeckt hatte.
Kennen Sie hier jemanden?, fragte Finzens, das Leuchten in Fiats Gesicht, der an diejenige dachte, die ihm den Besuch des Beinhauses nahegelegt hatte, fehldeutend. Unwillkürlich hatte Fiat genickt und auf den Schädel gezeigt, der vor ihm lag. Anna Neupert war in bunten Buchstaben auf die Stirn gemalt. Daneben lag Rosa Engl, kleine helle Blümchen über dem E.
Das ist meine Großmutter gewesen, sagte Finzens und deutete auf den Schädel von Rosa Engl. So kamen die zwei Männer ins Gespräch.
Das Bemalen der Totenschädel hat eine lange Tradition in der Stadt, erklärte Finzens, ohne dass ihn jemand darum gebeten hätte. Von eigens dafür ausgebildeten Künstlern werden Ranken und Weinblätter, bunte Zeichen angebracht. Vorher werden die Schädel gewaschen und in Chlorwasser gebleicht. Der Grund für diese ungewöhnliche Aufbewahrungsweise Verstorbener ist schlicht Platzmangel. Der Friedhof ist zu klein. Er befindet sich auf einer Hügelkuppe an der Peripherie der Stadt, direkt neben der Kathedrale, umgeben von Weinstöcken in vielen Reihen. Die Skelette der Begrabenen müssen nach ein paar Jahren wieder exhumiert werden, ihr Fleckchen Boden freigeben für neue Tote. Weltweit sei dies die beeindruckendste Sammlung, sagte Finzens bei ihrer ersten Begegnung.
Äußerlich (wie innerlich) könnten die Freunde kaum unterschiedlicher sein.
Finzens Engl kam in Bardarski Geran zur Welt, einem Dorf unweit der bulgarischen Hafenstadt Orjachov. In diesem Dorf lebte damals noch eine aus dem rumänischen Banat zugewanderte deutschsprachige Minderheit, der auch Finzens Familie angehört. Diese Leute sind inzwischen abgewandert oder ausgestorben oder haben sich angewöhnt, bulgarisch zu sprechen. Finzens spricht Deutsch, und niemand, der ihn reden hört, würde vermuten, dass es nicht seine Muttersprache ist. Mittlerweile kann er vier Sprachen: deutsch, bulgarisch, rumänisch, und englisch, und alle spricht er so deutlich, dass sogar Beistriche und Kommata hörbar sind, als würde ihn kontinuierlich jemand interviewen, ein unsichtbarer Gesprächspartner, dessen Intelligenz es mit jeder Silbe zu überflügeln gilt. Die Besessenheit, sich sorgfältig auszudrücken, hat er von seinem Großvater geerbt (das sagt Finzens selber).
Im Gegensatz zu Fiat hat Finzens einen Beruf, einen richtigen, wichtigen. Er ist Ruhestifter in der Kathedrale der Stadt. Stille! Stille! Ruhe! Bitte!, schreit er in Abständen von ungefähr fünf Minuten. Und zwischendurch: Keine Fotos! Keine Videos! Auf fünf Schreie um Stille kommt einer, der Fotos und Videoaufnahmen verbietet. Dann lässt er das Mikrophon sinken und schlendert bedächtig umher, kontrolliert, was er schreiend befohlen hat. Die Stille.Für Stille zu sorgen, sei eines der schwierigsten Unterfangen überhaupt, sagt Finzens, wenn Fiat meint, mit so einem Beruf sei das Geld leicht verdient.
Zum Beispiel gibt es da ein Kind, einmal wöchentlich bringen die Eltern es in die Kathedrale. Dieses Kind liegt immer auf dem Bauch. Sogar im Auto wird es bäuchlings transportiert, es liegt auf dem Rücksitz, die schuhlosen Füße schlagen gegen das Glas der Seitenfenster. Der Vater trägt es auf den Armen herein, vor dem Altar versuchen sie, es zum Stehen zu bringen, vergeblich. Sobald man es auf den Boden lässt, legt es sich auf den Bauch, den Kopf auf die Arme, da zappelt es dann mit den Füßen, dünn und in bunten Strumpfsocken. Aber es dreht sich nicht um. Würden die Eltern es drehen, würde es schreien wie am Spieß. Finzens beobachtet die Szene jedes Mal mit angehaltenem Atem. Für einen Ruhestifter ist ein brüllendes Kind eine Horrorvorstellung.
Täglich um acht Uhr früh betritt Finzens die Kathedrale. Sie liegt ein bisschen außerhalb der Stadt und er muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wenn er kommt, ist sie schon offen. Einer der Mönche des Klosters, zu dem sie gehört, sperrt das Tor um sieben für die Frühmesse auf. Von sieben bis acht erhält sich die Stille von selber, um diese Zeit gibt es kaum Besucher. Die Messe – das Zeigen und Hochheben der Monstranz und die Worte des Pfarrers – schafft sich ihre eigene Andacht. Sobald der Chor der Mönche den Abschlusschoral anstimmt, betritt Finzens den Schauplatz. Bald darauf läuten die Glocken, und von einer anderen Uhr in der Stadt schlägt es acht.
Finzens hat dichte lockige Haare, hellblond (fast weiß). Er trägt sie lang, ab und zu in zwei dicken, unten mit roten Wollfäden zusammengebundenen Zöpfen, im Dienst in der Kathedrale immer offen, in der Freizeit („was ist Freizeit, lieber Fiat, als könnte man uns von der Zeit befreien“) eher zusammengebunden. Seine Augen sind blau.
Als Ruhestifter schlüpft er allmorgendlich in eine spezielle Uniform. Er zieht sich in einem Container um, von dem aus tagsüber Kopfhörer und MP-3-Spieler vermietet werden, die den Besuchern der Kathedrale deren Geschichte erzählen. An zwei in die Wand geschlagenen Nägeln hängen seine Kleider: ein grauer Anzug, die Uniform des Wächters der Stille. Hose und Sakko. Der Anzug wird ihm zur Verfügung gestellt. Die Nägel hat er selber eingeschlagen, um seine Kleidung in seiner Abwesenheit sicher aufbewahrt zu wissen. Früher, als er sie einfach über einen Sessel warf, wenn er Feierabend machte, setzte sich oft jemand darauf.
In der Freizeit trägt er Schnürlsamthosen und Rollkragenpullover, auch im Sommer. Er ist 1,98 groß und hat Schuhgröße 43.
Ferdinand Neupert, alias Fiat, stammt aus einer Kleinstadt, die nur etwa achtzig Kilometer von der Stadt entfernt liegt, in der die beiden wohnen. Er spricht keine Fremdsprachen und ist zur Zeit arbeitslos. Pardon, er arbeitet als „fliegender Händler“ im Zug, der zum Flughafen fährt – so hätte er sich ausgedrückt. Fiat hat dunkelbraune, leicht schräg stehende Augen (das gibt ihm einen treuherzigen Anschein, eine seiner vier Tanten nannte es charmant).
Er trägt seine Haare halblang, zum Pagenkopf geschnitten, die obersten Zentimeter grau, darunter ein Streifen dunkles Kastanienbraun. Unter seinem Bett hat er achtzig Schachteln dieser Farbe stehen, sein eiserner Vorrat. Die Marke und Nuance des Färbemittels, des einzigen, das er jemals verwendet hat und verwenden wird, war eines Tages urplötzlich aus den Geschäften verschwunden. Den Vorrat unter seinem Bett verdankt er dem Lager eines Greißlers, der in Konkurs ging. Wenn der Vorrat aufgebraucht ist, wird er als graue Maus herumlaufen müssen (befürchtet er). Er ist 1,82 groß und hat Schuhgröße 46.
Wenige Tage nachdem er Finzens kennengelernt hatte, zog er – auf dessen Vorschlag – bei ihm ein. Länger hätte er den (von einer der vier Schwestern seiner Mutter anlässlich seines Geburtstags finanzierten) Status des „Touristen“, auch nicht aufrechterhalten können.
Wir sind wie Wechselbälge, sagt Finzens manchmal zu Fiat. Ich müsste du sein und du müsstest ich sein. Du spielst einen Rumänen, während ich einer bin. Kein Wunder, dass wir einander begegnet sind.
Die Stadt, in der sie leben, befindet sich dort, wo der westlichste Teil Mitteleuropas langsam verlischt, wie ein Nachtkerzchen, das nur benützt, wer noch an die romantische Liebe glaubt. Sie liegt auf einer Hochebene in ungefähr 1000 Metern Meereshöhe und wird von einem bescheidenen Fluss in zwei ähnlich große Teile geschnitten. In einiger Entfernung ragen höhere Berge in die Wolken. Auf den Gipfeln strahlt im Frühling der Schnee noch leuchtend weiß, wenn unten die Straßenränder schon wochenlang grün sind.
In unmittelbarer Nähe gibt es mindestens einen See, Felder, auf denen Getreide angebaut wird, Gemüse, Salat und rundum einen Gürtel von Plantagen. Die Bauern ziehen Obstbäume, vor allem Äpfel, in rauen Mengen. Die Einheimischen haben seit langem genug von Äpfeln.
Fünfundfünfzigtausend Menschen leben in dieser Stadt, das ist zu viel und zugleich zu wenig. Ich habe die Stadt zu schätzen gelernt, wie man alles schätzt, was man besser kennt. Sie hält sich für schön, entspricht aber wohl einfach dem Geschmack der Leute. Gesäumt von Akazienbäumen ist da ein weitläufiger offener Platz, wo man an lauen Sommerabenden einige Zigaretten rauchen kann. Insider nennen den Platz „Die Wiener Schule“. Woher der Name kommt und in welcher Beziehung er zum namensgebenden Wien steht, begreift nur, wer sich gerade dort befindet. In Wien scheint alles seinen Anfang zu nehmen, obwohl es nur einen Kopfbahnhof hat. Von dem aus könnte man aber mit der Eisenbahn nach Frankreich fahren und würde, wenn man einen kleinen Umweg macht, die Stadt durchqueren.
*
Im Zug hat Fiat heute, wie erwartet, keinen Erfolg. Nicht nur, dass ihm keiner Geld gibt, die meisten interpretieren sein Verteilsystem falsch und schmeißen die Zettel in einen der aufklappbaren Mistkübel unter den Tischchen, bevor er sie sich wieder holen kann. Die Frau mit dem Telefon hat es getan. Ein älterer Herr hat es getan. Vergeudete Zettel, die er mühsam nochmals kopieren muss. Vergeudete Arbeit. Er legt den Zettel auch einem Mann hin, der wie ein Herr aussieht, ein Sakko anhat, eine Krawatte trägt. Der Mann ist ein Herr und begreift sofort. Er gibt ihm den Zettel zurück, kaum dass er ihn hingelegt hat. Außer dem Zettel gibt er ihm nichts.
Fiat steigt aus. Am Bahnsteig, wie er dasteht und auf den Zug wartet, der in die Gegenrichtung fährt, könnte er für einen objektiven Betrachter alles sein, ein Büroarbeiter zum Beispiel oder ein Verkäufer in der Käseabteilung des Supermarktes, nein, kein Fabrikarbeiter, dazu ist sein Hemd zu glatt. Ein Rechtsanwalt könnte er sein, dem Äußeren nach. Vorhin, auf dem Zugklosett, hat er sich die Schuhe geputzt, das tut er immer, bevor er vor die Kunden tritt. Nicht einmal Rechtsanwälte tun das immer, er kennt einen, aus dem Zug, hat sich mit ihm angefreundet. Eine wortlose Freundschaft, denn im Zug spricht er kein Deutsch. Rumänisch natürlich auch nicht, also muss er still sein. Ausgerechnet der Rechtsanwalt ist heute nicht da gewesen, er hätte ihn aufgemuntert. Der durchschaut ihn, spielt aber mit. Überschwemmung, hätte der Anwalt gesagt, das ist ja furchtbar, das haben wir auch einmal erlebt, vor ein paar Jahren, da konnte man von der einen Seite der Stadt nicht mehr auf die andere, alle Brücken waren unter Wasser, meine Frau hat es in Gummistiefeln gerade noch nach Hause geschafft. Wie soll es weitergehen, wenn die Trockenheit in Rumänien anhält?, denkt Fiat. Wenn die Hitze anhält? Das Klima ruiniert ihm das Geschäft.
Er wird den Freund fragen, vielleicht hat der einen Einfall, Finzens hat ständig Einfälle. Unlängst verbrachte er einen ganzen Abend damit, zu erläutern, wie man im Golf von Venedig das Hologramm eines Orkans errichten könnte.
Warum Rumänien, hat er Fiat schon oft gefragt, warum drei Kinder? Wäre es nicht besser, bei der Wahrheit zu bleiben, ehrlich zu sein, wäre das nicht immer besser, vor allem: einfacher? Ob ihm daran liege, sich das Leben zu komplizieren? Du ergreifst zu selten die Initiative, hat Finzens gesagt, man muss pro-aktiv sein.
Fiat hat den Ausführungen des Freundes aufmerksam gelauscht und entschieden, dass pro-aktiv nichts für ihn ist. Die Antworten auf die übrigen Fragen blieb er Finzens schuldig.
Was wahr ist, wird sich nie herausstellen, war sein einziger Kommentar, nur, was unwahr ist.
Fiat mag Bequemlichkeit und er mag die Zeit. Weil sie allen Leuten in gleichem Maße zugeteilt ist und von niemandem verwaltet wird. Sie ist einfach da zur Selbstbedienung, eine Art Wunder, jedenfalls: ein Ideal. Ein sich täglich aus dem Nichts erneuerndes Kapital. Vierundzwanzig Stunden für jeden, zins- und steuerfrei. Die Zeit ist das demokratischste Prinzip überhaupt. Manchmal denkt Fiat, das habe er erfunden, und wenn er es endlich jemandem sagte, die Erkenntnis an der richtigen Stelle deponierte, würde ihm umgehend der Nobelpreis verliehen. Im Handumdrehen würde jeder wieder Zeit haben; die gestressten Alltagsforscher und Börsenhaie oder wie sie alle heißen, die vor seinen Zettelchen sitzen, mit ihren mobilen Telefonen an den Ohren. Als Nobelpreisträger würde er davon abraten. Die beiden Dialogierenden bewegen sich in unbekannte Richtungen voneinander weg oder aufeinander zu. Keiner weiß, wo sich den anderen vorstellen.
Fiat, du übertreibst maßlos, hat Finzens gesagt, du bist einfach nur faul.
Als ob das einfach wäre. Faulsein ist äußerst kompliziert!
Der Zug in die Gegenrichtung lässt auf sich warten. Der Perron füllt sich mit schwitzenden, ungehaltenen Leuten. Erhitzte, übellaunige Menschen kann Fiat heute noch weniger ertragen als sonst. Wenn man Menschen lieben will, muss man sie meiden, denkt er. Er geht nach vorne, fast bis ans Ende des Bahnsteigs, starrt auf die Gleise. Auf der Rückfahrt will er sich in den letzten Waggon setzen, er weiß, die Fahrt ist zu kurz, als dass der Schaffner sich bis zu ihm vorarbeiten könnte. Auf der Hinfahrt unterstreicht das Fahren ohne Karte seinen Status, ein Eklat mit dem Schaffner ist gut fürs Geschäft, irgendwie sind alle Passagiere immer gegen den Schaffner, selbst wenn sie 1. Klasse Fahrkarten haben. Auf der Rückfahrt will er unbehelligt bleiben. Ein paar Kilometer von hier arbeitet die Frau mit dem gelben Kopftuch in der hochsommerlichen Sonne. Auf die Augenblicke, während derer sie vom Zugfenster aus zu sehen ist, wartet er jeden Tag.
Du musst dich auf Rohstoffe verlegen. Handel mit einem essentiellen Rohstoff, hat Finzens zu ihm gesagt. Diese Bettlerei ist doch unter deiner Würde.
Rohstoff? Was meinst du damit? Soll ich nach Öl bohren? Nach Kohle graben? Gold waschen? Auf Diamantsuche gehen in den Bergen? Heutzutage gibt es doch gar keine Rohstoffe mehr. Keine echten. Alles ist verarbeitet und bearbeitet. Die Rohstoffe werden nicht mehr gefunden, sondern in Fabriken hergestellt. Abgesehen davon, bin ich irr, mir so was anzutun? Bin ich ein Präsident, der sagt, guten Tag, ich werde einen Krieg anfangen, weil man bös zu mir war. Ist mir viel zu anstrengend.
Ich rede von einem sanften Rohstoff, hat Finzens geantwortet. Etwas Menschliches. Etwas, das das Schöne mit dem Notwendigen verbindet.
Das Schöne mit dem Notwendigen verbinden … Utopist. Das Schöne ist eben schön, weil es nicht notwendig ist, gänzlich überflüssig.
Essen ist notwendig und schön. Trinken.Aber nicht schön, wie ich es meine.Deine Schönheit kenne ich dann nicht.
2 magnistipula
Ein erst vor wenigen Jahren entdeckter Kaffeebusch aus West Afrika. Der wissenschaftliche Name kommt von den Stipeln, den Nebenblättern, die diese Pflanze ausbildet und an denen sich Regenwasser und Detritus sammelt. Oberirdische Zusatzwurzeln, die erst nach der Keimung ausgebildet werden, nehmen aus dem dort gesammelten Wasser Nahrung auf
Die Vielfalt der Welt reckt sich ihm entgegen. Wie andere im Wald wandern, um zur Ruhe zu kommen, wandert er durch ein Gestrüpp von Kleiderständern. Schals schlingen sich weich und flauschig um seinen Hals, gesäumte Ärmel von Staubmänteln umarmen ihn, bevor er das Geschäft geschwind wieder verlässt. Kinder, die da unvermittelt vor seine Füße geraten, aus Ecken hervorschießen, als würden sie gejagt, gleichen in seiner Vorstellung wilden Füchsen, Wieseln oder Dachsen, von irgendeinem Rascheln aufgeschreckt. Es ist lange her, seit er zum letzten Mal etwas gekauft hat. Kaum war er bei Finzens eingezogen, hat er eine Investition getätigt, sich ein scharfes Messer zugelegt, für Gemüse.
Jetzt, im Trubel der Stadt, streunt er von Geschäft zu Geschäft. Zwischen den Türen der Kaufhäuser bläst ein straffer Wüstenwind. Er hält sich die Hände vors Gesicht, als müsse er sich wirklich durch einen Sturm kämpfen und die klimatisierten Verkaufsräume wären Oasen. Er trägt helle Sandalen, an den Zehen haben sie Ranken, wie Blättchen. Weil Finzens dieses Schuhwerk oft verspottet, überlegt er, ein neues Paar zu erstehen. Besser gar kein Geld als zu wenig. Jemand muss doch den Markt beleben. Die Verkäuferinnen sind siebzehneinhalb Jahre junge Kinder. Ein Mädchen mit dunklen Zöpfen hat ihm ihr Alter verraten, im Vertrauen, ein Kichern verschluckend.
Wenn Sie dieses Modell unbedingt wollen, strahlt sie ihn an, dann kann ich in der Filiale weiter unten anrufen, Sie kennen sie vielleicht, die gegenüber von Peek & Cloppenburg, nur fünf Minuten von hier. Er nickt, will unbedingt, dass sie anruft.
Leider, in ihrer Größe ist nichts mehr da.Schade.
Es tut mir so leid.Kann man nichts machen.
Vorsichtig mischt sich eine kleine Dosis Missmut in ihr Strahlen. Missmut dem Schuhfabrikanten gegenüber, weil er genau dieses Paar, das ihr Kunde wünscht, nicht anfertigen hat lassen. Sie wünscht Fiat einen blendenden Tag. Er wünscht ihr dasselbe. Er hat geahnt, dass es seine Größe nicht geben würde. Seine Größe gibt es fast nie, sie ist einfach zu groß. Das hat den Vorteil, dass er unbesorgt leidenschaftliches Interesse an diversen Schuhen zeigen kann, Verkäuferinnen für sich auf die Pirsch schicken, auf Jagd nach Stiefeln, Halbschuhen, Mokassins, Fußballschuhen, Segelschuhen, in der Gewissheit: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie finden, was er sucht, ist gering. So kann er guten Gewissens wieder gehen, auch wenn sich die Frau, das Fräulein, eine halbe Stunde lang für ihn geplagt hat. Und nie würde das strahlende Zopfmädchen erfahren, dass er absolut pleite ist.
Die regelmäßigen Besuche der Kaufhäuser sind seine Leidenschaft und sein „Roulette“. Das hat angefangen, als er einmal einen grauen Trenchcoat anprobierte und Geldscheine in der Manteltasche fand. Ein Mantel aus warmem samtigem Stoff, ganz glatt gefüttert. Ein Mantel wie ein Zuhause, hatte er gleich gedacht, als er hineinschlüpfte. Geschwind fühlen, wie es wäre, so einen Mantel zu haben, hatte er gedacht und im nächsten Moment beschlossen, ihn zu nehmen und so lange wie möglich nicht mehr auszuziehen. Als er die Hände in die Taschen steckte, abtastend, ob sich auch seinen Händen das Gefühl des Behagens mitteilen würde, spürte er zusammengefaltetes Papier, wusste, ohne es herauszunehmen, dass es Geld war. In den Mantel gehüllt, die Hände in den Taschen, spazierte er zur Kasse.Bitte, den möchte ich.
Würden Sie ihn kurz ablegen, damit ich abrechnen kann? Lieber nicht.
Die Kassiererin musste hinter der Kasse hervorkommen, sich auf die Zehenspitzen stellen und in den Mantelkragen greifen, wo sich der Preiszettel mit dem digitalen Strichcode befand, ihn herunterreißen und damit zu ihrer Kasse zurückgehen.
Ein Sackerl brauchen Sie dann wohl nicht.Ein Sackerl brauche ich wirklich nicht.
Sie händigte ihm die Rechnung aus und bedankte sich, als hätte er ihr einen großen Gefallen getan. Er bog um eine Häuserecke und nahm die Hände aus den Manteltaschen. In der Hand hielt er einen Hundert- und einen Fünfzig-Euro-Schein. Der wunderbare Mantel hatte weniger gekostet.
Seit damals probiert er bei jeder sich bietenden Gelegenheit Kleidung. Mäntel, Jacken, Sakkos, ab und zu Hosen und sogar Kleider (wenn er sich unbeobachtet wähnt). Nie wieder hat er Geld in den Taschen gefunden. Aber er gibt nicht auf. Er wartet auf dem Gehsteig vor dem Zebrastreifen, bis die Fußgängerampel grün wird. Neben ihm wartet ein Rabe. Ein Rabe mitten in der Stadt? Er hat Raben im Schnee gesehen. Im Gebirge schnappen sie den Wanderern oft das Essen aus der Hand. Sie trippeln näher, wenn jemand seine Jause isst, setzen unvermittelt zum Sturzflug an. Raben schlucken die Seelen unvorsichtiger Gaffer, mitfühlender Observierer des Leids anderer. Elegant und bescheiden zucken sie mit ihren schmalen Schultern. So zuckt die Welt mit den Schultern, geschmackvoll verstört.
Ich bin auf dem besten Weg, zynisch und verbittert zu werden, denkt er angesichts des Raben. Wie um sich zu entschuldigen, legt er dem Vogel eine Nuss hin. Seit einigen Monaten trägt er Walnüsse in den Hosensäcken, jemand hat ihm versichert, sie würden gegen Kreuzschmerzen helfen. Fiat hält sich zwar für zu jung für solche Gebrechen, die Walnüsse steckt er aber trotzdem ein. Wieder ein anderer hat ihm versichert, ab dreißig hätten das alle, nur niemand gebe es zu. Der Rabe steigt von einer Klaue auf die andere. So umkreist er die Nuss. Als die Ampel auf Grün schaltet und Fiat sich anschickt, die Straße zu überqueren, trippelt der Vogel an seiner Seite ein paar Rabenschritte. Dann dreht er sich zur Nuss um, die verwaist am Gehsteig zurückgeblieben ist. Mit einem Flattern holt er sie, hebt ab und setzt sich auf die Ampel. Von dort aus lässt er die Nuss auf den Zebrastreifen fallen und stürzt sich gleich hinterher, um das Resultat des Falls zu inspizieren. Fiat beobachtet das Geschehen von der anderen Seite der Straße aus. Der Rabe macht seinem Ruf alle Ehre. Die Nuss allerdings auch. Sie ist so einfach nicht zu knacken. Die Ampel wird rot. Der Rabe setzt sich ordentlich zurück auf den Gehsteig. Die Nuss legt er neben sich. Bei der nächsten Grünphase platziert er sie vorsichtig auf die Straße, hüpft zurück und wartet, bis ein Auto drüberfährt. Sogar aus der Entfernung hört Fiat das Knacken der Schale. Während der folgenden Grünphase der Ampel holt sich der Rabe die zerquetschte Nuss. Es scheint, als würde der Vogel kurz über Fiats Kopf innehalten, bevor er fortfliegt.
Fiat geht langsam weiter. Am Kai oberhalb der Stadtbahn steht ein Zelt mit einem Korbstuhl davor, als hätte sich hier jemand für längere Zeit eingerichtet. Auf einem Plakat an der Bahnhofswand wirft eine Katze den Schatten eines Löwen. Gleich daneben hängt ein roter Mond, gefärbt vom Schatten, den die Erde auf ihn wirft.
3 mogeneti
Großwüchsige Pflanze mit ebenfalls großen hellgrünen Blättern. Zum Verzehr angebauter Kaffee aus tropischen Klimaten. Sehr wetterempfindlich, braucht konstante Temperaturen und reichhaltigen Boden. Schlecht geeignet fürs Glashaus. Blüht weiß, ab und zu pink oder gelb. Milder Geschmack. Von Natur aus koffeinfrei
Sein Wort in Gottes Ohr. Gott ist das einzige Wesen, das nicht einmal zu existieren braucht, um alle Macht zu haben. Fiat wäre gern Gott gewesen und hätte nicht existiert. Hätte keine Schuld gehabt, aber alle Macht.
Im 19. Jahrhundert hat es als Schande gegolten, arbeiten zu müssen, erzählte Finzens vor kurzem, im 19. Jahrhundert sei Arbeit kein Verdienst gewesen, sondern eine Notsache. Arbeitslos zu sein sei keine Schande, es sei elegant, hat Finzens gesagt.
Für jede Galaxie ein Ohr Gottes, stellt Fiat sich vor. Ein Gott muss unendlich viele Ohren haben. Ohne Gott kommt niemand aus. Nicht einmal er. Auch ihm tropft das Wort immer wieder aus dem Mund. Um Gottes willen! Er hat oft nach etwas anderem gesucht, etwas anderes sagen wollen, aber nichts hat so gut funktioniert.
Wie Gottes Ohr wohl aussehen würde? Er stellt es sich vor wie zwei überdimensionale Lippen. Lippen, groß wie ein Hügel in der Landschaft. Pulsierende Lippen, die alle paar Millisekunden alles ansaugen, was sich in der Galaxie befindet. Ständig schmilzt Schnee auf diesen Lippen, der von oben her, vom Himmel natürlich, unentwegt nachgeliefert wird. Die Membran, mit der gelauscht wird, ist aus Goldgas. Ein unheimlich dichtes Gas, das noch aus der fernsten Ferne von Gehauchtem in Schwingung versetzt wird. Und drinnen geht es weiter, Biegung um Biegung rutscht das Gottgehörte immer tiefer und tiefer auf einer Rutschbahn, wie für Rodeln oder halbnackte Sommerhintern in Badekostümen. Von außen betrachtet schaut die Bahn unendlich lang aus, doch wenn man drauf sitzt, geht es mit einem Ruck. Unten landet das Gehörte in allerfeinstem Sand; versickert.
*
Der Exekutor kommt, als Fiat noch im Vorhaus steht, den Haustürschlüssel in der Hand, den Kopf voller Raben und ihrer neuartigen Methode, Autos als Nussknacker zu benützen. Den Kopf voller Ohren Gottes. Er habe den Auftrag, ein Pfändungsprotokoll zu erstellen, sagt der grau in grau gekleidete Mann und hält einen Ausweis in die Höhe. Mit einem solchen Auftrag könne er die Polizei rufen, damit sie die Tür aufbreche, fährt er fort, ist nicht unhöflich und fügt hinzu, dass es wenig Sinn habe, ihm den Zugang zu verweigern.
Dann liest er von einem mitgebrachten Dokument das Folgende vor:
Entsprechend dem Gesetzeswortlaut müssen dem Schuldner all die Gegenstände verbleiben, die für eine bescheidene Lebensführung unentbehrlich sind. Wie diese Maxime im Einzelfall auszulegen ist, ist Aufgabe des Gerichtsvollziehers. Allerdings bestehen bestimmte Grundregeln.
Unpfändbar sind:
* Unverzichtbare Gebrauchsgegenstände (Bett, Kasten, Tisch und Stühle, Kücheneinrichtung, Kühlschrank, Waschmaschine)
* Einfache Kleidung
* Für die Berufsausübung erforderliche Gegenstände
* Höchstpersönliche Gegenstände wie Ehering, Fotos
* Gegenstände mit geringem Versteigerungswert, die jedoch hohe Transportkosten verursachen würden
* Bücher, die der Ausbildung dienen
Außer dem Fernseher und einem DVD-Spieler besitzen die Freunde, dem Urteil des Exekutors zufolge, nur unverzichtbare Gebrauchsgegenstände. Der Laptop befindet sich glücklicherweise bei Finzens in der Kathedrale.
Diese zwei Geräte muss ich Ihnen also entführen, sagt der Gerichtsvollzieher und tätschelt Fiats Schulter. Berührungen von Fremden in heiklen Situationen rühren an eine äußerst empfindliche Saite von Fiats Wesen, die, einmal zum Schwingen gebracht, seine Fäuste in Bewegung setzt. Er weiß das und hält die Arme krampfhaft verschränkt.Die Geräte gehören mir nicht, versucht er einen Widerspruch.Er sei nicht verpflichtet und nicht befugt, die bestehenden Eigentumsverhältnisse vor Ort zu klären, fügt der Exekutor hinzu, während er Fernseher und DVD-Spieler auf einem grün lackierten Handwagen festzurrt. Alle pfändbaren Gegenstände, die sich im Verfügungsbereich des Schuldners befinden, könne er umgehend ins Pfändungsprotokoll aufnehmen, auch das Eigentum von Mitbewohnern, Freunden oder Verwandten, das dem Schuldner zur Verfügung gestellt worden ist. Gegebenenfalls müssten die jeweiligen Eigentümer ihre Gegenstände aus dem Pfändungsprotokoll streichen lassen. Fast atemlos bringt der Gerichtsvollzieher diese Informationen vor. Jetzt greift er wieder zu seinen Unterlagen und liest:
Der eigentliche Eigentümer muß über geeignete Beweismittel verfügen. Am geeignetsten sind Handelsrechnungen, auf denen der Name des Käufers bzw. Eigentümers aufscheint. Aufgrund der freien Beweiswürdigung des Gerichtes darüber, was als Beweis angesehen wird oder nicht, sollte alles, was einer Wahrheitsfindung dienlich sein kann, angeführt werden.
Habe die Ehre, Herr Neupert. Der Exekutor grüßt durchaus freundlich.
*
Nichts geschieht von selber, sagt Finzens, als er Fiat vollkommen aufgelöst antrifft. Fiat hat Schulden, die er dem Freund verheimlicht hat. Verheimlicht ist der falsche Ausdruck, er hat es ihm noch nicht erzählt.
Verstehst du jetzt, wieso ich aus Rumänien komme? Würde ich irgendwo arbeiten, Geld verdienen, ein Gehalt bekommen – ich hätte rein gar nichts davon. Das Gehalt würde sofort verpfändet. Der Großteil davon ginge ans Gericht, beziehungsweise nicht einmal ans Gericht, sondern an den Rechtsanwalt der Bank, bei der ich angeblich diese Schulden habe.
Angeblich? Hast du jetzt Schulden oder nicht? Offensichtlich schon, sonst hätte ich nämlich noch meinen Fernseher.
Man hat sie mir angehängt. Sie gehören einem anderen, aber ich muss dafür geradestehen …
Dann musst du denjenigen verklagen! Da gibt es doch Möglichkeiten …! Finzens ist laut geworden und nervös.Nein. Mehr wird Fiat dazu nicht sagen.
Aber wie viel Geld ist es denn?
Fiat zupft Fäden aus dem roten Küchenfauteuil, in dem er sitzt. Das ist kein Küchengespräch, sagt er, wechseln wir lieber das Thema, ich regle das schon. Hast du Eis mitgebracht?
Mitgebracht!, brüllt Finzens, jetzt nicht nur nervös, sondern herzlich wütend. Ich war in der Kathedrale, mein Lieber. Ich habe gearbeitet! GEARBEITET! Es gibt auch Leute, die arbeiten!
Fiat zupft weiter am Fauteuil.
Und lass meine Möbel in Ruhe! Finzens Stimme überschlägt sich.
So verärgert hat Fiat ihn noch nie erlebt, dabei hat er so oft gesagt, das Beste am Fernsehen sei die Fernsehzeitschrift.
Geldsorgen überschatten in den kommenden Tagen alle Gespräche der beiden Freunde, wie die Blätter der Platanen den heißen Asphalt. Alle Worte, die nicht Geld betreffen, das Kaufen oder Zahlen, versiegen ihnen im Mund, bevor sie ausgesprochen werden können.
Die Hitze hat die berühmten, schachbrettartig angelegten Straßen der Stadt leergefegt, oder die Passanten sind in den Asphalt hineingeschmolzen. Nur Fiat ist unterwegs. Eine Eiswürfelnatur hat Finzens ihn gestern genannt. Während es draußen heißer und heißer wird, erkaltet der Kern des Menschen, hat Finzens erläutert, der Konsument kühle innerlich aus, es liege an der Art, wie die Waren, das Essen, im Supermarkt ausgelegt werden – eine von seinen Theorien. Alles sei verpackt, wer eine nackte Tomate erblicke oder gar berühre, ohne den Schutz der allerorts dargebotenen dünnen Plastikhandschuhe in Anspruch zu nehmen, habe das Gefühl, Verbotenes zu tun. Die porösen Handschuhe atmen, sie sind es, die leben, der Konsument muss ihnen dienen und kühlt aus. Weil er sich an nichts mehr reiben kann, nicht einmal am Obst. Die Luft ist aufgeheizt, aber innerlich erfriert man, sagt Finzens.
Fiat fährt nicht mehr mit dem Zug. Zum Bahnhof geht er nur, weil dort die Zeitungen gratis herumliegen. Sein Stoffwechsel ist durcheinandergekommen. Ständig quält ihn ein unstillbarer Durst. Soviel er auch trinkt, kaum hat er ein paar Schritte getan, klebt ihm die Zunge schon wieder am Gaumen. Er bedient sich aus halbleeren Aluminiumdosen, die er auf der Straße findet, von Parkbänken sammelt, trinkt gierig das warme Cola, die Limonaden, schluckt die Spucke von Fremden mit.
Kaufhäuser sucht er keine mehr auf. Seit Tagen hat er kein einziges Kleidungsstück mehr anprobiert. Die Hoffnung, dass sich ein Geldschein, irgendwo ein Geldschein findet, den er sich nehmen kann, der ihm gehören würde, die Hoffnung, die ihm jahrelang ein liebgewordenes Steckenpferd war, das er hegte und pflegte, erscheint ihm nun absurd.
4 kapakata
Erstmals aus Angola beschrieben. Dieser Kaffeebaum wächst in feuchten immergrünen Wäldern West Afrikas
Es ist kein Diebstahl, er leiht es sich nur aus und wird es ihm hundertfach zurückerstatten. Finzens hat ihm zwar das Versprechen abgenommen, nicht mehr ins Casino zu gehen – aber er wird es ja gar nicht merken. Bis er aufwacht, ist Fiat längst wieder da. Mit der Geldbörse des Freundes in der Hand schleicht er im Dunkeln ins Stiegenhaus. Dort, im Licht, fischt er die Bankomatkarte aus einem der Fächer. Er muss nicht suchen, er weiß, in welches Fach Finzens die Karte steckt, hat ihn oft beobachtet. Den PIN-Code hat der Freund ihm einmal aus Jux verraten – ein Vertrauensbeweis. Jetzt sind wir mehr als Blutsbrüder, hat er gesagt und dabei laut gelacht, wir teilen sogar das Geld. Fiat schleicht zurück in die dunkle Wohnung, steckt die Börse wieder in Finzens Jacke und schlüpft in seinen eigenen Mantel. Den Mantel, in dem er einmal das Geld gefunden hat; sein Glücksmantel. Und weil er Glück bringen soll, zieht er ihn jetzt an, trotz der Hitze, die auch nachts nicht mehr nachlässt. Es ist lange her, dass er zuletzt im Casino war.
Der Taxifahrer ist nicht erfreut, als er das Fahrziel hört. Es würde extra Zuschlag kosten, wegen der späten Stunde, ob er das wisse, fragt er den Fahrgast, und es sei ziemlich weit. Klar, klar, kein Problem, antwortet Fiat selbstsicher und lässt sich auf der Rückbank nieder. Sich neben den Fahrer zu setzen, mag modern geworden sein, er findet es unangenehm. Im Taxi will er aller Verantwortung enthoben sein, auch der Verantwortung für ein Gespräch, und das gelingt nur, wenn er sich auf der Rückbank so tief wie möglich in die Polster sinken lässt.
Taghell erstrahlt das Gebäude des Casinos, ein urbaner Komet in der Vorgebirgslandschaft. Fiat zieht eine schmale Wollkrawatte aus der Manteltasche und bindet sie um. Mit einer leichten Verbeugung nimmt er Abschied von seinem Chauffeur, wie er ihn insgeheim nennt. Angesichts des Lichterspektakels werden ihm die Schultern leichter, er fühlt sich in seinem Element. Der Kopf sitzt locker. Alle Verspannungen lassen unversehens nach. Federnden Schrittes betritt er das Casino. Beim Portier ein kurzes Erschrecken, hat er sich nicht von hier verbannen lassen? Hat er nicht eigenhändig unterschrieben, nie mehr eine Spielhalle betreten zu wollen, ein lebenslängliches Verbot über sich selbst verhängt? Das war damals, in einem anderen Land, mit anderen Spielgesetzen. Der Schreckmoment ist vorbei. Beim Einlass wird ihm höflich zugenickt. Da sind sie alle. Die Üblichen. Die Traditionelle, eine verblichene Frau mit flattrigen Fingern, nur eine Sekunde ganz ruhig, wenn sie den grün bezogenen Tisch berühren. Der fettleibige Neureiche. Das Pärchen, das sich hier herein verirrt hat, leicht betrunken vor Verliebtheit und der Aufregung, zum ersten Mal im Casino zu sein; dem plötzlich flammenden Fieber, den finanziellen Grundstein ihrer jungen Ehe legen zu können. Ein Irrtum, ein großer Irrtum. Wer, wenn nicht er, muss das wissen.
Er begibt sich zur Kasse und wechselt seine Scheine in Jetons. Ja, in diese Räume begibt man sich. Das Gehen wird zum Schreiten. Da mache ihm noch jemand weis, Geld beflügele nicht. Geld sei reine Scharlatanerie! Wenn dem so ist, dann ist es eine, die ihm wohl tut. Seit langem spürt er endlich wieder etwas in sich brennen. Eine Hoffnung. Ein Vergnügen. Wer weiß … wer weiß, vielleicht bringt das Geld seines Freundes ihm Glück. Ein einziges Mal. Sein allerletztes Mal im Casino.
Er setzt sich an den Roulette-Tisch. Roulette ist das einzig wahre Spiel. Poker ist etwas für Liebhaber von Kindereien. Er ist ein ernsthafter Mann. Und ein Experte mit ausgeklügelter Strategie. Für jede Runde, die er verliert, setzt er den doppelten Einsatz. Gewinnt er, halbiert er den Einsatz. Er setzt Rot, immer Rot und Ungerade. Dazu eine Zahl.
Die Strategie funktioniert! Fünfunddreißig Minuten später ist das Sakko unter den Achseln zum Auswinden nass, und er hat seinen Einsatz verzehnfacht. Jetzt wäre der Moment aufzuhören. Er weiß es. Aber es ist nicht genug, noch lange nicht genug, den Betrag abzubezahlen, den die Bank verlangt. Einmal noch, ein einziges Mal, höchstens zwei Runden. Und alles wird vorbei sein. Ein freier Mann wird er sein. Einer, der jede Arbeit pfeifend annimmt, denn was er verdient, landet direkt in seiner höchstpersönlichen Rocktasche. Gelassen setzt er. Rot. Ungerade. 23. Er hat den Croupier angesehen, die Zahl an dessen gewölbter Brust abgelesen. Eindeutig. Das war sie.
Oder eben nicht. Er setzt und setzt. Hastet hinaus in die Vorhalle, fragt nach dem nächstgelegenen Geldautomaten. Er könne auch hier an der Kasse direkt mit der Karte zahlen, erfährt er. Das sei kein Problem. Wieder und wieder tippt er Finzens’ Code.
Um sieben Uhr früh gibt die Karte nichts mehr her. Er geht auf die Toilette des Casinos, trinkt vor den goldumrandeten Spiegeln Wasser, viel Wasser, gierig aus den hohlen Händen, das Wasser tropft ihm auf sein Hemd, macht nasse Flecken. Wie ein Hund, denkt er, wie ein Hund schlabbere ich hier. Am Parkplatz vor dem Casino, das jetzt, weil es hell ist, nicht mehr strahlt, wartet er auf eine Mitfahrgelegenheit zum nächstgelegenen Bahnhof und setzt sich mit einer fadenscheinigen Ausflucht zu einem ebenfalls finanziell ausgebluteten Casinokollegen ins Auto. Wie ein Köter, denkt er, muss ich mich auflesen lassen.
5 bonnieri
Wirtschaftlich genützte Kaffeeart aus Madagaskar mit großen dunklen Blättern. Sehr widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen. Wächst auch bei geringem Niederschlag. Den idealen Geschmack bekommen die Bohnen bei mindestens fünf Zentimetern Regen pro Monat. Wird wegen des leicht verbrannt schmeckenden Aromas vorzugsweise als Mischung mit anderen Bohnen, insbesondere liberica, verwendet