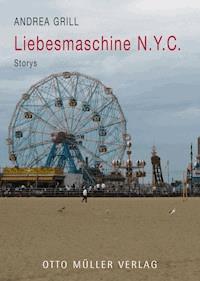Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jede Familie hat ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Zeit und besonderen Orte - das erfrischende Debüt von Andrea Grill erkundet den Familienmenschen. "Es wäre das beste, wenn Kinder auf Bäumen wüchsen." Sie würden im Herbst herabfallen wie reife Birnen und niemand müsste sich für sie verantwortlich fühlen, so wie sie selbst zu nichts verpflichtet wären. Da wir aber nicht wie Obst vom Baum fallen, sind wir ein Leben lang mit bestimmten Menschen verbunden; Verwandten, denen wir zu Weihnachten und zu Ostern, auf Beerdigungen und Hochzeiten begegnen, beim Sonntagskaffee oder im Urlaub, und deren Leben uns oft so gegenwärtig erscheint wie unser eigenes. Doch wer sind diese Menschen, die wir so gut zu kennen glauben? In ihrem Debüt versammelt Andrea Grill feinsinnige und humorvolle Porträts, die von den Mitgliedern einer Familie erzählen. Da ist der Onkel, der die Farbe "Beige" über alles liebt und ein Geheimnis bewahrt, das die Familie erst nach seinem Tod entdeckt. Tante Lulja aus Tirana, deren Lieblingsgetränk der Calvados ist, obwohl sie ihn noch nie im Leben getrunken hat, und die Großmutter, die als junge Frau aus einem brennenden Haus sprang, das "Teufelmühle" hieß, und sich dabei den Knöchel brach, genau wie die Enkelin viele Jahre später, allerdings weniger spektakulär, indem sie vom Fahrrad fiel. So leicht die Prosa von Andrea Grill ist, so wenig glättet sie Schrulligkeit und Eigensinn der von ihr Porträtierten, umspielt die aus der Familiengeschichte Emporgehobenen der warme Ton des Erzählens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Grill
Der gelbe Onkel
Andrea Grill
Der gelbe Onkel
Ein Familienalbum
OTTO MÜLLER VERLAG
www.omvs.at
ISBN 3-7013-1105-6eISBN 978-3-7013-6105-2
© 2005 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIEN Alle Rechte vorbehalten Satz: Media Design: Rizner.at, Salzburg Umschlaggestaltung: Ulli Leikermoser Druck und Bindung: Ueberreuter, Korneuburg
Inhalt
Großmutter, das Schalentier
Großvater, der Gärtner
Die Sonne ist ausgegangen, und du hast sie abgedreht
Der gelbe Onkel
Tante Annie
Onkel Mali
Tante Lulja in Europa
Der Bruder
Der Cousin
Der Enkel
Der Freund des Hauses
Der Nachbar
Der Friseur
Der Kollege
Die andere Großmutter
Für meine Großeltern, Eltern, ’s Schwesterl, Familja Mullaj & Sojli, de moeder van Léon, und Deine Oma.
Es wäre das Beste, wenn Kinder einfach auf Bäumen wüchsen. Das Beste für die Kinder und auch für die Eltern. Dann hätte niemand Mühe damit. Sobald sie erwachsen wären, fielen sie zu Boden wie reife Früchte, stünden auf und gingen ihres Weges. Sie wären niemandem verpflichtet und niemand wäre ihnen verpflichtet.
Eine Familie ist etwas, das wir alle haben und über das wir alle klagen. Sie ist es, die wir dafür verantwortlich machen, wenn uns Dinge misslingen oder wir faul sind. Eine Familie hat ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Zeit, ihre eigene Geographie. Egal welche Nationalität er haben mag, der Onkel ist immer der Onkel. Er gehört zu uns, und wir zu ihm, ob er nun in Griechenland wohnt oder in dem Nachbarort im Salzkammergut. Und gleichgültig, wie lange es her ist, seit wir ihn zum letzten Mal gesehen haben, wenn wir ihm wieder begegnen, wird es sein wie früher. Für den Onkel werden wir immer jung bleiben, so wie er für uns schon immer alt war.
Die Familie ist tot, höre ich mich sagen. Die Familie hat ihre Zeit gehabt. Sie ist aus der Mode gekommen, überflüssig geworden. Oh nein, höre ich mich sagen, die Familie lebt und hat sich verändert. Sie ist erwachsen geworden und hat den Nachbarn adoptiert, den Friseur, den Arbeitskollegen. All jene, die da sind, ohne dass wir sie darum gebeten haben, sie, die wir uns nicht ausgesucht haben, sie, die uns alles so schwer machen und doch den unentbehrlichen Rahmen bilden, ohne den unser Antlitz kein Profil ergäbe, nur einen Schatten.
P.S.: Es ist gut, jemanden zu haben, der an allem schuld ist. Es ist gut, jemanden zu haben, der einem immer bleibt, egal was man tut.
Großmutter, das Schalentier
Je älter meine Großmutter wurde, desto jünger dachte sie zu sein. Sie dachte, sie wäre dreiundzwanzig, und war fünfundachtzig. Sie trank Weißwein und um vier Uhr nachmittags eine Tasse Kaffee. Doch beide Getränke hatten keinerlei Einfluss auf sie. Wenn es finster wurde, sagte sie immer, dass sie fort müsse, den Bus nicht versäumen dürfe, sonst nicht mehr nach Hause käme. Sie saß mitten in ihrer eigenen Küche, wo sie schon seit zehn Jahren saß und sich nie mehr fortbewegte, und nichts auf der Welt konnte sie davon überzeugen, dass sie zu Hause war. Ihre Kinder, meine Mutter und meine Tante also, sagten immer, dass es fürchterlich mit ihr sei, man nicht mehr mit ihr sprechen könne. Man konnte jedoch recht gut mit ihr sprechen, wenn man nur akzeptierte, dass sie im Moment des Gesprächs dreiundzwanzig Jahre alt war. Ich führte wunderbare Gespräche mit ihr. Manchmal dachte sie, ich sei ihre Schwester, manchmal, dass ich Renate hieß, und manchmal, dass ich eine Kollegin von ihr war, die auch Schneiderin war, wie sie. Sie hatte vergessen, dass ich meine Nähkarriere bereits als Zehnjährige beendet hatte und dass diese Karriere nur fünf Minuten lang gedauert hatte, denn dann hatte ich in meine Finger genäht, und zwar gründlich, weil ich vergaß, den Fuß vom Pedal unter dem Tisch zu nehmen, was die unaufhörlich auf- und absausende Nadel stoppen hätte können. Danach brauchte ich für den Rest des Jahres in der Schule nicht mehr zu nähen. Die kommenden Jahre wusste ich das Nähen dahingehend einzurichten, dass ich mich während der Schulstunden vollkommen dem Skizzenzeichnen und Zuschneiden hingab. Meine Mutter oder Schwester machten dann in der Zeit bis zur nächsten Nähstunde zu Hause wieder einige Nähte fertig.
Mit siebenundzwanzig brach ich mir den rechten Knöchel, genau wie meine Großmutter sich mit siebenundzwanzig den Knöchel gebrochen hatte. Mit dem Unterschied, dass sie aus einem brennenden Haus gesprungen war, ich dagegen einfach vor dem Eingang der Universität von meinem Fahrrad fiel. Doch habe ich mich oft gefragt, bis zu welcher Höhe ich aus einem Fenster springen könnte, ohne mir den Knöchel zu brechen, und Feuer im Haus war lange Zeit eines der furchtbarsten Geschehnisse, die ich mir vorstellen konnte. „Teufelmühle“ hieß das Haus, aus dessen Fenster meine Großmutter sprang, weil die auf der Straße unten stehenden Nachbarn ihr zuriefen, sie müsse springen, wenn sie nicht verbrennen wolle. Einige Minuten später kam die Feuerwehr mit einem Sprungtuch. Da lag meine Großmutter allerdings schon im Gras, den Fuß mit dem gebrochenen Knöchel hochgelagert, wie sie ihn in den anschließenden Wochen immer halten würde, nachdem sie ihr im Krankenhaus Gewichte ans Bein hängten, um den Bruch einzurichten. Das Haus steht immer noch. Es liegt an einer Kreuzung, wo die Eisenbahnschienen die Straße queren, die den Fluss entlang geht.
Seit ich das Haus kenne, diese Mühle des Teufels, befindet sich eine Bäckerei im Erdgeschoß. Dort kaufte ich später oft rosa Zuckergebäck in der Form von zwergenhaften Salzstangerln, Kipferln oder Semmeln. Das Bein der Großmutter wuchs nicht ganz gerade zusammen, und ihr Leben lang hat sie Wetterumschwünge im Knöchel gefühlt. In meinem Knöchel spüre ich ebenfalls den Schnee kitzeln. Ein keineswegs unangenehmes Gefühl. Ich bekam einen gelben Gips, und niemand würde heute noch sehen, dass der Knöchel einmal gebrochen war.
Ich glaube, meine Großmutter hat sich niemals ganz vom Krieg erholt. Der Krieg, wie sie ihn nannte, als hätte es nur einen einzigen gegeben. So wie sich niemand jemals ganz vom Krieg erholt. Daher kam es wohl auch, dass sie sich, als sie alt war und den ganzen Tag wie ein sessiles Schalentier in ihrem Stuhl saß, immer so sehr fürchtete, wenn es Abend wurde. Wenn sie den Bus versäume, könne sie an diesem Abend nicht mehr nach Hause fahren, jammerte sie, schnell, wir müssen uns beeilen. Zuhause müsse sie für ihre Brüder kochen, drängte sie und versuchte fast aufzustehen in ihrem Stuhl, den sie doch seit Monaten bereits nicht mehr ohne Hilfe verlassen hatte. Für ihren Bruder, dachte ich mir, denn der zweite war früh verstorben. Renate, nannte sie mich und drückte flehentlich meine Hand. Ich wiederholte ihr meinen Namen und meine Funktion in ihrem Leben, und sie lächelte und sagte, dass mir die kürzeren Haare jetzt gut stünden. Tatsächlich hatte ich meine Haare erst kurz zuvor schneiden lassen. Doch war es mir ein Rätsel, wie sie das mit ihren Augen sehen konnte, graublaue Augen, die fast blind waren und ihr normalerweise kaum mehr als farblose Silhouetten zu erkennen gaben, sodass sie Menschen nur auf Grund ihrer Stimmen erkannte und die Gesichter schon lange vergessen zu haben schien.
Je älter und jünger sie wurde, desto kleiner wurde sie. Ihr Gesicht schrumpfte zusammen, ihr Körper, der einige Jahre zuvor noch ein maßloser Molluskenkörper gewesen war, der in seinem Sessel vor sich hin wuchs, obschon sie kaum aß, wurde kleiner, klein wie der eines Kindes, das man leicht von seinem Sitzplatz heben und ins Bett tragen konnte. Sie hatte keine Lust mehr, abends lange wach zu bleiben. Wenn sie schon nicht zum Bus gehen durfte, wollte sie ins Bett, wo sie dann mit offenen Augen lag und nichts sah.
Gegenüber dem Bett stand noch immer die alte Nähmaschine von früher, ein stromloser Nähtisch, dessen Motorik man mit einem Fußpedal antreiben konnte. An diesem Tisch hatte sie mir einmal gezeigt, wie man am Ende eines Fadens einen Knoten macht. Man wickelt sich den Faden mehrere Male um den Zeigefinger, rollt mit dem Daumen langsam und häufig über das Fadenbündel und zieht es sich mit einer raschen Bewegung vom Finger, die gleichzeitig bereits den Knoten herstellt. Es funktioniert immer noch, und jedes Mal, wenn ich mir einen Knopf annähe, mache ich, bevor ich die Nadel durch den Stoff ziehe, erst den Knoten meiner Großmutter am Ende des Fadens.
Mittlerweile erinnerte sich meine junge Großmutter an keine Knoten mehr. Sie war beim Massieren der Kurgäste im Kurmittelhaus angelangt. Sie war in den Keller ihres Hauses gezogen, damit sie die Zimmer im oberen Stock an Gäste vermieten konnte. Sommergäste, nannte sie diese Leute, Kurgäste. Das Massieren gefiel ihr sehr, und sie zeigte mir, wie sie den Leuten den Nacken massierte. Die Kanten der Hände mussten mit schnellen gezielten Bewegungen auf den Rücken des Patienten einschlagen. Oft hat sie mir das auf meinen Schultern vorgemacht, und ich habe es auf ihren Schultern nachgemacht.
Ich frage, ob ich ihr noch einen Schluck Wein nachschenken soll. Sie reagiert nicht, zeigt mit keiner Bewegung, dass sie meine Frage gehört hat. Ich frage sie nochmals, biete ihr dann eine geschälte Orange an, füttere ihr die einzelnen Spalten, und obwohl sie kein Ja sagt auf meine Erkundigung, ob sie mehr will, öffnet sie jedes Mal, wenn sich meine Hand ihrem Gesicht mit einer Fruchtspalte nähert, willig den Mund und schluckt wie ein braves Kind alles wortlos hinunter.
Die ersten zwei Jahre meines Lebens habe ich auf dem Tisch meiner Großmutter verbracht. Dort lag ich, wenn sie mich wickelte oder fütterte. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie immer besonders gern mochte, und oft, wenn ich mit meinen Eltern Streit hatte, schaute ich sie bitterböse an und sagte, ich gehe zur Oma, ich zieh zur Oma, Oma versteht mich. Bei ihr durfte ich den Finger in den Kuchenteig stecken, mit der ganzen Hand die Töpfe ausputzen, in denen sie den Eischnee geschlagen hatte, und mit der Zunge über meine Handfläche schlecken. Eischnee schmeckte herrlich nach nichts. Ich war verrückt nach Eischnee. Um zehn Uhr vormittags, denn damals standen wir früh auf und waren um zehn schon wieder hungrig, schnitt sie mir eine Semmel auf, in die sie eine Rippe Milchschokolade legte. Ich bin verrückt nach mit Schokoladerippen belegten Semmeln. Die Schokolade war so dick, dass man sich anstrengen musste, mit den Zähnen durchzukommen.
Freitags aßen wir niemals Fleisch bei meiner Großmutter, die mich zu Ostern immer in die Kirche mitnahm und am Karfreitag um drei Uhr nachmittags regelmäßig betroffen schaute, den Kreuzweg ging mit mir, wo sie diese spannend-schaurige Geschichte vom gekreuzigten Wundermann erzählte, Großmutter, die mir abends vor dem Einschlafen Gebete beibrachte, die ich später zu Handelsgeschäften umwandelte, in denen ich mit Gott mein Bravsein und das Nicht-streiten-mit-meiner-Schwester gegen interessantere Dinge wie einen Roller oder eine Sachertorte zum Geburtstag eintauschte. Ich mochte den Freitag besonders, denn dann aßen wir Mehlspeisen, die immer schon meine Lieblingsspeisen waren, Powidltadschgerl und Milchrahmstrudel, Mohnnudeln, von den Eispalatschinken ganz zu schweigen. Es war als Strafe gedacht, um die Sünden zu büßen, die man im Laufe der Woche begangen hatte, und um dem Wundermann zu danken, der sich für uns geopfert hatte, so verstand ich es damals, doch begriff ich nichts, denn für mich waren diese süßen Gerichte zu Mittag die größte Belohnung. Den Wundermann mochte ich gerne. Er sah hilflos und rührend aus auf dem Kreuz mit den über dem Kopf eingravierten Buchstaben I.N.R.I. Ich besaß eine Kinderbibel und las darin die aufregendsten Geschichten. Von Leuten, die über das Wasser laufen konnten. Zum Beispiel. Ein lang gehegter Traum, den in die Wirklichkeit umzusetzen mir bisher nur im Winter gelungen ist.
Deutlich höre ich die Stimme meiner Großmutter, wie sie mich aus dem Garten ins Haus rief, um vier Uhr nachmittags, wenn ihr Kaffee fertig war und mein Kakao, den sie nicht einfach aus Löspulver machte, sondern aus geschmolzener Schokolade. Ich höre, wie sie ein „erl“ an meinen Namen dranhängt, wie sie konsequent den falschen Artikel vor das Wort „Eiscreme“ setzt. Vergessene Wörter höre ich sie sagen, Wörter, die niemand mehr sagt, Kredenz, Psyche, Fauteuil, Paradeiser.
Während ich bei ihr auf dem Küchentisch lag, kochte sie auf einem holzbefeuerten Herd, den sie morgens anzündete und erst nachmittags verglühen ließ. Nicht nur das Mittagessen kochte sie auf diesem Herd, auch die Wäsche kochte sie dort, weiße Unterwäsche und Leintücher, die sie, wenn sie gar gekocht waren, auf einer zwischen Stachelbeer- und Ribiselsträuchern gespannten Wäscheleine trocknen ließ. Seit meine Großmutter keine Wäsche mehr zum Trocknen aufhängt, sind Stachelbeeren selten geworden.
Meine Großmutter stand im Garten und wies mit dem Zeigefinger auf den Schneefleck am Berg, den man im Norden hinter der Holzhütte aufragen sah. Siehst du die Krone, den Schleier, den sie trägt, das lange, reich verzierte Kleid, das ihre Schuhe verdeckt? Gleichzeitig mit den Schneeglöckchen und den Frühlings knotenblumen an den Wurzeln des Apfelbaums kam regelmäßig auch die Schneekönigin zum Vorschein. An warmen Märztagen schien sie gerne auf den oberen Hang der Zimnitz zu steigen und von dort aus ins Tal hinunterzuschauen. Auch von ihrem Mann, dem Schneekönig, der sich ebenfalls aus einer Form der schmelzenden Schneefelder ergeben sollte, sprach meine Großmutter. Doch den König sah ich nie.
Je älter ich werde, desto ähnlicher wird mein Spiegelgesicht dem Foto meiner jungen Großmutter, das in ihrem Schlafzimmer über der Psyche hing. Je älter sie wurde, desto öfter erinnerte sie sich an dunkle Nächte in dunklen Kellern. An die Tage, als ihr Mann verletzt von der Front zurückkam, von der sie sprach, als hätte es nur eine einzige gegeben. Er sei dann zu Fuß über den Traunsee gegangen – am Ufer des Traunsees entlang, meinte sie damit, denn er war kein Heiliger – und so nach Hause gekommen, wo er aber nicht blieb, sondern sich wiederum versteckte, in den Bergen oder auf dem Dachboden der Teufelmühle, weil er nicht zurückwollte an die Front, da er sie ohnehin verloren wusste. Je älter sie wurde, desto öfter wartete sie auf ihren Bruder, der seit mehr als sechzig Jahren tot war.
Sie war ein fröhlicher Mensch, doch gelingt es mir nicht, ihre Stimme zum Lachen zu bringen. Als meine Großmutter so alt war, dass sie nicht einmal mehr dreiundzwanzig sein konnte, viel jünger werden musste, so jung, dass sie tatsächlich kaum mehr sprechen konnte, sagte sie nur noch, sie habe genug vom Leben, faltete fortwährend ihre Hände, wie sie es mir damals beigebracht hatte, während unserer Ausflüge zum bunt geschmückten Kreuzweg, an dessen Ende die hübsche Puppe eines Jünglings unter einem Brautschleier schlief, der dann zusammen mit allen Glocken der Umgebung für einige Tage verschwin den sollte, fortfliegen, bis er zurückkam, an einem Sonn tag, an dem ich auf dem Tisch in der Küche der Großmutter so viele gefärbte Eier essen durfte, bis mir schlecht wurde und ich mich auf den Rücken ins Gras zwischen den Stachelbeersträuchern legte. Ihr Leben lang hatte meine Großmutter für mich ihre Hände gefaltet. Und wenn sie es tat, glaubte ich auch, dass es etwas half. Wenn ich es tue, ist es nur eine Geste, um mich selbst am Fuchteln zu hindern.
Wäre es nach mir gegangen, hätte ich meine Großmutter am liebsten so lange im Stuhl in ihrer Küche sitzen gesehen, bis ich selber so alt geworden wäre, dass ich schon wieder jünger wurde. Dann hätten wir nebeneinander gesessen, in ihrer Küche, zwei Muscheln, die sich nie mehr irgendwohin bewegten. Doch das wollte sie nicht.
Großvater, der Gärtner